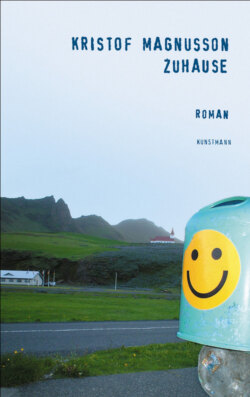Читать книгу Zuhause - Кристоф Магнуссон - Страница 10
MUSTERHAFTE HERZEN
ОглавлениеAls der Zapfkarton leer war, gingen wir aus. Wir ließen uns, den Nordwestorkan im Rücken, runter in die Stadt treiben und taten das, was alle taten: Wir gingen auf den Laugavegur, die oft verregnete, immer zu enge und irgendwie auch zu lange Hauptstraße Islands.
Es war kurz nach eins. Eine Autoschlange schob sich langsam stadteinwärts, in Richtung Nacht, in Richtung Leben. Wir gingen an einem von Techno-Bässen geschüttelten Geländewagen vorbei, in dem ein einzelner Mann saß. Er hatte das Fenster heruntergekurbelt und ließ eine Hand heraushängen, in der er eine Dose Cola hielt. Dahinter war ein glänzender Golf, dessen Heckklappe offen stand. Aus seinem Inneren drangen die Beats der Reykjavíker Hip-Hop-Helden XXX Rottweiler Hundar. Unbeeindruckt davon, dass die Heckklappe im Sturm zitterte, saßen zwei Jungs im Kofferraum und redeten gleichzeitig auf ein Mädchen ein, das zwischen ihnen saß. Sie tranken Bier aus Dosen, ihre Beine berührten fast die Straße. Das Mädchen sprang heraus, rannte auf ein anderes Mädchen zu, das gerade im 22 verschwinden wollte, und rief den Jungs zu: «Das ist meine Cousine. Meine Cousine Hulda.«
Weil viele Autofahrer Fußgänger trafen, die sie zumindest hupend begrüßen mussten, wenn sie nicht sogar anhielten, um sich grölend über das Ziel der bevorstehenden Nachtvergnügung zu verständigen, kam der Verkehr vollkommen zum Erliegen.
Auf den Parallelstraßen wäre man viel schneller vorangekommen, und doch fuhren alle den Laugavegur hinab. Alle halfen mit, wenigstens freitags und sonnabends einen Verkehrsstau zu erzeugen, wie er sich in Reykjavík sonst selbst im dichtesten Berufsverkehr nicht einstellen wollte. An den Wochenenden zwischen ein und sechs Uhr wirkte die Stadt so großstädtisch wie nie. Alle stürzten sich in das Nachtleben, diese kollektive Auflehnung gegen den Winter, die Dunkelheit, Langeweile, Pizzabringdienste, Chat-Rooms und Pay-TV.
Wir ließen eine Ginflasche kreisen, wobei – ein richtiger Kreis war es nicht. Eher eine Gerade, auf der die Flasche hin- und herpendelte, zwischen Matilda und mir. Dabei freute ich mich nicht nur auf die Nacht, sondern auch auf den nächsten Morgen. Es kam immer so, dass wir, wenn wir überall gewesen waren, bei Matilda weitertranken, bis der Erste von uns auf einer ihrer Fensterbänke einschlief, die leer waren und breit wie Betten. Nirgendwo schlief ich so gut wie dort, Reykjavík mit seinen erleuchteten Hügeln und der schwarzen Bucht unter mir. Und das Aufwachen in der übersäuerten Einsamkeit des nächsten Tages war niemals schrecklich, weil wir weder allein aufwachten noch in dem Bett eines unbekannten, im aufkommenden Tageslicht hässlicher werdenden Menschen.
Wir waren auf dem Weg ins kaffi gógó. Dort waren wir das erste Mal vor vierzehn Jahren gewesen, als wir gerade angefangen hatten, in uns mehr zu sehen als den Jungen und das Mädchen mit den Kleinbildkameras. Wir hatten unsere Freundschaft aus den Kinder- und Lebertranpillentagen herübergerettet in ein Erwachsenengefühl, das seit einiger Zeit wie ein dem Schlamm Nibelheims entstiegenes Monster in uns herumtorkelte. Wir hatten uns vorgenommen, zum ersten Mal in der Innenstadt betrunken zu werden. Wir wollten endlich Kontakt aufnehmen mit dem erwachsenen Leben, das aus Freundschaften zu Barkeepern, Türstehern und Tresenmädchen zu bestehen schien. Wir wollten dazugehören, zu den hart gesottenen Twens, geheimnisvollen Fischerburschen und trägerlosen Björk-Nachahmerinnen, die an der Bar im kaffi gógó ihre Nierenknuffe setzten und im Obergeschoss auf den Sofas knutschten. Matilda hatte ihre Mutter gebeten, zum Schwarzen Schwan am Busbahnhof Hlemmur zu gehen und französische Zigaretten in roten Schachteln zu kaufen. Zusätzlich hatte ich aus Hamburg zwei Zigarettenpackungen mitgebracht, von deren Steuermarken wir eine Eins und eine Zwei ausschnitten und über die Fünf der 1975 auf unseren Ausweisen klebten. So kamen wir an dem Türsteher vorbei. Drinnen verlangte ich mit einem Nuscheln, das zumindest damals für mich der kettenrauchenden Nonchalance eines Godard-Schauspielers ebenbürtig war, einen Aschenbecher und kaufte Bier. Der erwartete Kampf an der Bar blieb dabei aus, denn bis auf uns war noch keiner da. Wir setzten uns im Obergeschoss auf die Fensterbank unter dem Straßenschild aus Amsterdam und schauten lange in den regennassen Hinterhof mit den Lüftungsschächten. Als sich das gógó langsam füllte, entpuppte sich die Fensterbank als Logenplatz, um zuzusehen, wie um uns herum alles aus dem Ruder lief. Eine Frau in hohen Stiefeln schlug ihrem Freund weinend ins Gesicht. Ich unterhielt mich mit einer betrunkenen Krankenschwesterschülerin, die sich mühsam an der Handtasche unter ihrem Arm festhielt und mich zweimal grinsend fragte: »Deine Freundin ist nicht deine Freundin, oder?« Als die Krankenschwesterschülerin mich küssen wollte, ging Matilda aufs Klo, und als ich die Krankenschwesterschülerin nicht küssen wollte, sagte diese: »Denk dran, ich werde Krankenschwester. Irgendwann wird dein Leben einmal in meiner Hand sein.«
Am Anfang dieses ersten Abends im Reykjavíker Nachtleben war ich fest entschlossen, mich im kaffi gógó zu bewegen wie ein The Clash hörender Nordengländer mit einer Narbe in der Augenbraue und einer Rule Britania-Tätowierung auf dem mächtigen Bizeps. Als ich jedoch zum dritten Mal die Treppe hinabging, um für Matilda und mich ein viertes Bier zu holen, wurden meine Beine plötzlich leicht. Mir war Barbra Streisand eingefallen, und während ich langsam, Schritt für Schritt, die Treppe hinunterstieg, sang ich leise vor mich hin: There’s no business like show business.
Wie jeder Stammgast hatte ich eine Theorie, warum das kaffi gógó nie aus der Mode kam: Es war der einzige Club mit einer Dramaturgie. Im gógó musste man keine Fragen stellen und keine Entscheidungen treffen: Das gógó könnte mindestens bis sechs Uhr offen bleiben wie die meisten anderen Clubs, machte aber um vier Uhr fünfzehn dicht. Punkt vier Uhr fünfzehn. Weil das alle wussten, achteten sie darauf, um zwei in bester Stimmung zu sein und sich um halb vier vor der Bar in erbitterte Kämpfe um ein letztes Getränk zu verwickeln. Wenn dann genau um vier, mitten im Lied, die Musik abbrach und das Licht anging, konnte man sich noch eine Viertelstunde an die Reste der Nacht klammern. In den anderen Läden, die bis sechs offen hatten, zerfaserte die Nacht. Dort waren einige bereits um Mitternacht betrunken, während die anderen blöd guckten, und wenn die, die um Mitternacht noch blöd geguckt hatten, um drei betrunken waren, waren die anderen, bereits um Mitternacht Betrunkenen, schon gar nicht mehr wach.
Immer schneller ging ich mit Matilda den Laugavegur hinunter. Dies war die Zeit, zu der sich vor dem kaffi gógó oft eine Schlange bildete, und ich wollte auf keinen Fall warten. Matilda bemerkte den Rauch zuerst. Ich hatte ihn für eine verirrte Wolke gehalten, bis ich den beißenden Geruch wahrnahm und das Flackern des Blaulichts sah. Als wir an die Polizeiabsperrung herangingen, sahen wir, dass eines der alten Häuser auf dem Laugavegur in Flammen stand.
Matilda sagte:
»Da wohnt doch Dagur.«
»Wer?«
»Na, Daggi!«
Aus den Dachfenstern des mit Wellblech gedeckten Hauses, deren Scheiben schon gesprungen waren, quollen im Wechsel schwarze und graue Schwaden hervor. Durch die Stellen, an denen die Wellblechbahnen auf dem Dach zusammengenagelt waren, kroch ebenfalls Rauch, in ordentlichen Linien. Vor dem Haus war ein Gewirr aus gelbem Absperrband, Schläuchen und Drehleitern entstanden. Wie ein Vorhang aus Gaze legte sich feine Löschwassergischt um die Feuerwehrautos. Wir tauchten unter der Absperrung hindurch und gingen auf einen roten Bus zu, in dessen Fenster ein Schild hing, auf dem »Feuerwehr Reykjavík « stand und dass hier die geretteten Bewohner betreut würden. Der Bus war leer.
Ein Polizist in einem schwarzen Schneeanzug, der mit den Reflektorstreifen an Armen und Beinen aussah wie ein übergroßes Schulkind, scheuchte uns hinter die Absperrung zurück.
»Hat sich jemand verletzt?«, fragte Matilda den Polizisten. Er hielt eine Tasse in der Hand, aus der Dampf aufstieg.
»Wir wissen noch nichts Genaues.«
»Ein Freund von mir wohnt da drin. Sind denn alle raus?«
»Das können wir noch nicht sagen.«
Wir stellten uns auf den Parkplatz, der dem brennenden Haus direkt gegenüberlag. Ein gelber, fast quaderförmiger Wasserwerfer der Flughafenfeuerwehr rangierte sich in Position, um die Brandschutzwand zu dem Haus mit dem Schuhgeschäft zu bespritzen. Alle Feuerwehren aus Südwestisland schienen ausgerückt zu sein. Die ankommenden Feuerwehrmänner entluden hastig ihre silbern glänzenden Atemschutzgeräte. Sie trugen Gummistiefel, die aussahen wie Köpfe von riesigen Gelbwangenschildkröten. Es war kalt und merkwürdigerweise auch still. Nur das Rattern der Dieselmotoren war zu hören; gelegentlich heulte ein Elektromotor auf und eine Drehleiter schob sich in die Höhe. Da erschien der dichte schwarze Rauch, der auf der Rückseite des Hauses aufstieg, plötzlich in einem roten Feuerschein. Wenig später flackerte es in den Fenstern des obersten Stockwerks auf. Das Feuer schien an dem Wasser vorbei zu brennen, die Flammen standen unbeeindruckt wie Ausstellungsstücke in den Fenstern, auf die die Feuerwehrmänner auf den Leitern mit Hochdruck zielten. Auch als der ganze Dachstuhl innerhalb von Minuten in Flammen stand, blieb das Feuer absolut still.
Das inzwischen knöchelhoch auf dem Laugavegur stehende Löschwasser trug Hotdog-Tütchen, Colabecher und Zigarettenkippen davon. Eine Gruppe junger Männer in Jeans und beigebraunen Wolljacken stand neben uns auf dem Parkplatz herum, auch sie tranken Bier. Einer trat gegen einen der prallen Schläuche und sagte: »Wow.« Ich sah mich um. Hinter mir standen inzwischen mindestens hundert Schaulustige: hauptsächlich Ausgänger, aber auch einige der Pfandflaschen sammelnden Rentner und Asiaten, die sich sonst durch nichts von ihrer Mülleimerrunde abhalten ließen. Neben uns stand ein grauhaariger Mann in einem Fleecepullover, der starr in das Feuer blickte. Wenn ich ein Brandstifter wäre, dachte ich, hätte ich mich auch genau hierhin gestellt, denn aus dieser Perspektive sah man alles: die Flammen, die Feuerwehrmänner und die Polizisten, die von einem Leuchtstreifenbein auf das andere sprangen, um sich zu wärmen. Matilda sprach laut in ihr Telefon:
»Daggi, endlich! Dein Haus brennt, Mann. Ich weiß auch nicht. Okay, bye!«
»Was hat er gesagt?«, fragte ich.
»Was soll er schon gesagt haben«, sagte Matilda. »Scheiße, hat er gesagt. Zum Teufel. Und fokk.«
Dagur.
Ich erinnerte mich nur dunkel an Dagur. Wahrscheinlich hätte ich ihn wie die meisten meiner Grundschulkameraden vollkommen vergessen, wäre er nicht der Sohn von Kjartan Benediktsson, Kjartan dem Reichen, gewesen. Kjartans Familie gehörte die Mýrar hf, die das isländische Wirtschaftsleben dominierte und aufgrund ihres weit verzweigten Firmennetzwerks von vielen ›der Krake‹ genannt wurde. Die Mýrar hf war der größte Lebensmittelproduzent des Landes, der größte Importeur von Autos, Benzin und Elektrogeräten, ein bedeutender Exporteur von Fisch, besaß Baufirmen, Reisebüros, mehrere Verlage und einen Fernsehsender. Schon in der Grundschule wusste jeder von Dagurs besonderer Herkunft, und er litt sehr darunter: Im Unterschied zu seiner jüngeren Schwester, die den Ruhm ihrer Familie täglich mit Herrinnenschritt zur Schule trug, schlich sich Dagur, meist ein paar Minuten zu spät, mit hängendem Kopf ins Klassenzimmer. Er erweckte immerfort den Eindruck, dass er sich für die Stellung seiner Familie schämte, was dazu führte, dass die gesamte Schülerschaft auf ihm herumhackte, während niemand gegen seine Schwester auch nur ein Wort sagte.
Seit unserer Grundschulzeit hatte ich Dagur nicht mehr gesehen. Trotzdem erkannte ich ihn sofort, als ich ihn nun zu seinem brennenden Haus rennen sah. Dagur war nicht besonders groß geworden; seine langen Haare waren zu blonden Dreadlocks verfilzt, die wild auf- und absprangen. Er hielt mit beiden Händen seine weite Jeans fest und trug einen Pullover mit der Aufschrift Vöfluvagninn. Das erklärte, warum er so schnell hier war, denn der Waffelwagen, an dem tagsüber Kinder und nachts betrunkene Kinder Waffeln mit Eis kauften, stand keine zwei Minuten entfernt auf dem Lækjatorg. Matilda wollte ihm etwas zurufen, doch er würdigte uns keines Blickes, zerriss wie ein Langstreckenläufer beim Zieleinlauf das gelbe Absperrband, schubste einen Feuerwehrmann aus dem Weg und griff sich ein Atemschutzgerät. Ein Polizist kam angerannt, doch da war Dagur schon in dem Haus verschwunden.
Kurze Zeit später erschien er in einem Fenster im ersten Stock. Ein dicker Aktenordner flog heraus und verfehlte nur knapp den Kopf eines Feuerwehrmanns. Bald standen die Einsatzkräfte in einem Regen von Videokassetten und Kleidungsstücken. Sogar CDs warf Dagur aus dem Fenster, deren Hüllen beim Aufprall aufplatzten und ihren glänzenden Inhalt freigaben. Es war ein kurzer, heftiger Regen, dann war Dagur, ebenso plötzlich wie er in dem Fenster aufgetaucht war, wieder verschwunden. Unter den Schaulustigen um uns herum waren die Gespräche verstummt.
Dagur tauchte in demselben Fenster wieder auf. Er hatte eine Kiste auf das Fensterbrett gestellt, die nur wenig kleiner war als ein Mineralwasserkasten. Sie schwankte hin und her, Dagur sah unschlüssig herunter. Die Feuerwehrleute riefen etwas zu ihm hinauf, das ich nicht verstand. Da rannte ich an dem Polizisten vorbei, der einen Moment zu spät reagierte, um mich festhalten zu können, rannte bis unter das Fenster und streckte die Arme aus. Dagur ließ die Kiste los, die in der Luft eine halbe Drehung vollführte, bevor ich sie auffing. Ich knickte in den Knien ein und verlor fast das Gleichgewicht. Eine Sekunde lang dachte ich, ich hätte mir die Arme gebrochen, so stark war der Schmerz. Als ich wieder hinaufsah, war Dagur fort. Der Feuerwehrmann auf der Drehleiter über mir spritzte in ein Fenster, dann in ein anderes. Ein Polizist packte mich an einem der schmerzenden Arme. Ich sah ihn an, als er mich plötzlich losließ und herumfuhr. Die Menge der Schaulustigen klatschte, johlte, pfiff – Dagur stand vor dem Haus! Er schmiss die Atemschutzmontur von sich wie ein Rockstar seine Gitarre und begann, seine Sachen zusammenzusuchen. Die Menge jubelte weiter, der Polizist schrie etwas von Einsatzbehinderung und Nötigung, doch Dagur hörte nicht zu. Schon nicht mehr ganz so laut rief der Polizist, dass er ihn eigentlich verhaften müsse, doch da hatte Dagur seine CDs, Kleidungsstücke, Aktenordner und Videokassetten bereits aufgehoben und zog sich hinter die Absperrung zurück. Ich folgte ihm.
»Ja, ja«, sagte er.
»Wichtige Sachen, was?«, fragte ich. Dagur nickte und hustete. Ich stellte die Kiste vor ihm ab und wollte sie öffnen, da schob Dagur mich so unsanft zu Seite, dass ich ihn erstaunt ansah.
»Kennst du Lárus noch?«, fragte Matilda.
»Nein.«
»Er war mit uns in der Grundschule und ist dann nach Deutschland.«
»So was«, sagte er und sah mich an. »Lalli.« Er wischte seine rußverschmierten Hände an der Jeans ab.
»Lárus«, sagte ich.
»Lalli. Lalli skaggi!«
»Lárus!«, sagte ich erneut.
»Lalli skaggi«, wiederholte Dagur, und Matilda konnte das Grinsen, das ich ihr streng verboten hatte, nicht unterdrücken. Ich hatte gehofft, dass alle die ›Lalli skaggi‹-Episode meines Lebens vergessen hatten, ja, ich hatte sogar selber versucht, die ›Lalli skaggi‹-Episode meines Lebens zu vergessen. Fast hatte ich schon gedacht, es wäre mir gelungen, aber ich erinnerte mich natürlich ganz genau.
Es war so, dass ich, nachdem ich eingeschult wurde, vorgab, gehbehindert zu sein. Morgens hüpfte ich noch gleichmäßigen Schritts die Betontreppe am Eingang unseres Hauses herunter, doch sobald das Fenster zur Küche außer Sicht war, in der meine Mutter stundenlang Sachen hin- und herräumte und in der es trotzdem immer unordentlich war, fing ich an zu humpeln. Irgendwie schien das zur Schule zu passen. Mich verwirrten die vielen anderen Kinder. Einige ärgerten mich, riefen ›Lalli skaggi‹, ›Lalli, der Schiefe‹, was wiederum Jónína, die Lehrerin, ärgerte, die mich in Schutz nahm, was wiederum Valdimar ›Valli‹ Hermansson und Böddi Jónsson dazu verführte, mich nach der Schule noch mehr zu ärgern. Bald kloppte ich mich fast regelmäßig mit den beiden. Ich hatte nie eine Chance, konnte aber auch nicht weglaufen, weil ich ja humpelte. Ich kam nicht auf die Idee, von meiner vorgespielten Behinderung zu lassen, denn da ich die anderen Kinder nicht mochte, erschien es mir nur logisch, dass sie mich ärgerten und ich mich mit ihnen schlug. Einige andere bemitleideten mich – das war auch gut. Hauptsache, jeder wusste, wer ich war.
Natürlich konnte dieser emotionale Subventionsbetrug auf Dauer nicht gut gehen. Nach einem halben Jahr rannte der Dobermann einer Klassenkameradin quer über den Schulhof auf mich zu, bellte sein grabestiefes Bellen, und ich lief weg, so schnell ich konnte.
Die Schmach war groß.
Dass sich nun ausgerechnet Dagur daran erinnerte, der damals auch noch ein Kind gewesen war, erschreckte mich um so mehr. Was mussten dann erst die wissen, die damals schon erwachsen waren?
Dagur zog nachdenklich die Nase hoch und strich sich mit beiden Zeigefingern den Schweiß aus den blonden Augenbrauen. Dann sah er mich an. Seine Augen waren blau und seine Zähne sehr weiß in dem rußgeschwärzten Gesicht.
»Wer kauft mir was zu trinken? Ich bin total abgebrannt.«
Bevor wir ins kaffi gógó gingen, brachte Dagur seine Sachen zu seinem Auto. Irgendwoher hatte er zwei Plastiktüten genommen, in die er die Kleidungsstücke und CDs gestopft hatte, die er aus dem brennenden Haus auf die Straße geschmissen hatte. Obwohl er kaum alles tragen konnte, gab er nichts aus der Hand. Als wir sein Auto schon fast erreicht hatten, fiel aus einer der überfüllten Tüten ein Buch heraus. Dagur bemerkte es erst, als ich mich schon danach gebückt hatte. Es war eine zerlesene Ausgabe der Saga von Egill Skallagrímsson. Die Buchdeckel waren fast vollständig mit durchsichtigem Tesafilm beklebt, was das Buch vor dem vollkommenen Auseinanderfallen bewahrte. Unter dem Klebestreifen war eine Abbildung des Sagahelden zu erkennen, der einen schwarzen Helm mit großer Krempe und einen zerzausten Kinnbart trug. Die Stirn traurig gekräuselt, das Schwert erhoben stand er da, dämonisch und verletzlich zugleich; ein zaudernder Berserker, der sich nicht entscheiden konnte, ob er zuschlagen oder sich weinend unter ein Tierfell zurückziehen sollte.
»Gib das her«, sagte Dagur und hatte mir das Buch schon aus der Hand gerissen. Dafür hatte er eine der Tüten loslassen müssen und bückte sich, um seine im Schneematsch verstreute Habe wieder einzupacken. Einmal schnellten seine Augen hoch zu mir, doch als er merkte, dass auch ich ihn ansah, starrte er sofort wieder nach unten.
Dagur stellte die Reste seines Hausrats in den Kofferraum seines Land Rover Defender, der alt war und rot, mit weißem Dach und knopfäugigen Rücklichtern. Bevor er sorgfältig eine Wolldecke über alles breitete, nahm er ein T-Shirt aus einer der Tüten und zog es an: Es war ein enges schwarzes T-Shirt mit weißen Sternen auf der Vorderseite und der Aufschrift Betty Ford Clinic.
Nachdem Matilda im kaffi gógó erzählt hatte, auf welch spektakuläre Weise Dagur seine Sachen aus dem brennenden Haus gerettet hatte, bekamen wir umsonst ein Thule-Bier und einen nach Apfelkaugummi schmeckenden Schnaps. Es war ziemlich leer im kaffi gógó. Viele sahen sich das Feuer an, nur die Stammgäste, die praktisch zur Einrichtung gehörten, waren da: Hrafnhildur, die Bankkauffrau, sprang auf der Tanzfläche herum wie eh und je und strahlte so viel Hitze ab wie ein ganzer Aerobic-Kurs. In der dunkelsten Ecke, wo das Licht der Discokugel niemals hinschien, hing Gísli in den Seilen. Schon seit einigen Jahren war der Physiklehrer im grauen Anzug der älteste Gast und starrte durch eine Batterie von Gläsern in das schwarze Nirgendwo, das sich zwischen Bar und Notausgang auftat. Es war, als hätten sie alle im gógó ausgeharrt, damit ich nun, ein halbes Jahr nach meinem letzten Besuch, gerührt feststellen konnte, dass alles beim Alten geblieben war. Nur gelegentliche Lieder von den Bright Eyes oder Belle & Sebastian zeigten, dass sich die Diskokugeln dieser Welt weitergedreht hatten. Ansonsten liefen wie immer Pulp, Clash, Beck und Bowie, dazwischen die isländischen Rockklassiker Lúftgítar und Lóalóa. Auch der Hit der Riot Girl-Band Grílurnar, die von dem Mädchen Sísí sangen, das nähend in ihrem Suzuki ausflippt, fehlte nicht. Wie immer.
»Und, wie läuft deine Nacht?«, fragte Matilda.
»Super.«
»Du stehst seit einer Stunde hier herum«, sagte sie.
»Ich höre der Musik zu«, sagte ich.
Matilda verschwand wieder auf der Tanzfläche. Dagur stellte sich neben mich, legte seine Hand auf meine Schulter und sagte: »Gib dein Glas.« Er hatte eine Plastikflasche dabei, ähnlich denen, die Radrennfahrer benutzen. Er füllte mein Glas, aus dem der Geruch von starkem Gin aufstieg.
»Mein Cousin brennt den. In seiner Garage. Der beste Gin des Landes.«
Der beste Gin des Landes schmeckte holzig, die weißen Sterne über Dagurs Betty Ford Clinic glänzten im Schwarzlicht.
»Dann können wir uns ja mal unterhalten«, sagte ich.
Er zuckte mit den Achseln und sah an mir vorbei auf die Tanzfläche. Direkt traurig sah er nicht aus, eher gleichgültig und sehnsüchtig im selben Moment, wie ein Junge, der in der großen Pause unter dem Dach des Laubengangs steht und den anderen Kindern beim Spielen zusieht. Mir fiel ein, dass ich zwar schweigsame Menschen gut leiden konnte, mit schüchternen Menschen aber Probleme hatte.
»Wo kommst du her?«, fragte er, als ich die Hoffnung schon aufgegeben hatte.
»Aus Tornesch«, sagte ich.
»Soll ich das kennen?«
»Kopenhagen, Köln … Kennst du irgendwelche Städte in Europa?«
»Natürlich.«
»Dazwischen.«
Er schnippte mit dem Daumen gegen den Filter seiner Zigarette, doch es fiel keine Asche ab. Er versuchte es noch mal.
»Wann seid ihr da hin?«
»Als ich neun war.«
»Warum?«
»Nur so.«
»Niemand zieht nur so nach … wie hieß das noch mal?«
»Mein Vater hatte da Arbeit.«
»Und wie fandest du das?«
»Und du?«, fragte ich, »was machst du?«
»Ich bin Literaturwissenschaftler.«
»An der Uni?«
»Nein«, antwortete er und machte ein Gesicht, als hätte ich ihm ein angebissenes Hotdog vom Fußboden angeboten.
»Uni ist das reinste Endlager.«
»Aha.«
»Ich bin freiberuflich.«
»Freiberuflicher Literaturwissenschaftler.«
»Und du Tierfilmer.«
»Wer sagt das?«
»Matilda.«
»Ich bin kein Tierfilmer.«
»Filmst du keine Vögel?«
»Doch.«
»Sind Vögel keine Tiere?«
»Tierfilmer sind die, die sich einen Busch aufsetzen und …« Ich war es leid, das immer wieder zu erklären, und sagte einfach: »Meditativer Realismus. Dokumental-Film, wenn du so willst.«
Er sah mich an wie einen wildfremden Mensch, der ihn grundlos mit seiner Lebensgeschichte belästigte. Dieses Gespräch gefiel mir nicht. Es störte mich, wie Dagur behauptete, einen Beruf zu haben, den es nicht gab, und wie er dasselbe von mir dachte. Ich sagte: »Ab jetzt mache ich auch Fernsehen.« Er grinste, als hätte er erraten, warum ich das hinzufügte.
»Und dein Freund kommt übermorgen und arbeitet in der Psychiatrie.«
»In der Presseabteilung. Er ist kein Psychiater«, das war mir wichtig zu betonen. Ich dachte an Milan, der jetzt schlief und die gepackte Reisetasche vor seinem Bett stehen hatte. Milan packte immer am Tag vorher, während ich in letzter Minute viel zu wenig in einen großen Koffer schmiss. Milan, der vielleicht in diesem Moment gerade aufwachte, sich verwirrt aufrichtete und dann allein wieder unter die Decke kroch.
»Er kommt morgen, nicht übermorgen«, sagte ich.
Dagur schwieg.
Meine Arme taten immer noch weh. Er hätte sich ruhig dafür bedanken können, dass ich die Kiste aufgefangen hatte. Oder war es von so einem Menschen schon ein Dank, dass er sich überhaupt mit mir unterhielt? Immerhin war es einer meiner Neujahrsvorsätze für das inzwischen fast vergangene Jahr gewesen, das Wort ›Soziopath‹ nicht mehr so oft zu verwenden. Außerdem hatte Dagur mir schon in der Grundschule leid getan, und vorhin tat er mir auch leid, wie ihm seine letzte Habe auf den vom Löschwasser überschwemmten Laugavegur fiel und er sich nicht helfen lassen wollte. Sogar jetzt tat er mir leid, in seinem verräucherten T-Shirt, mit seinem nach Holz schmeckenden, selbst gebrannten Gin. Ich überlegte, ob ich eine Frage über den Berufsalltag freiberuflicher Literaturwissenschaftler stellen sollte. Nicht, dass ich die Hoffnung hatte, eine normale Antwort zu bekommen, aber die Sache interessierte mich irgendwie. Da sagte Dagur:
»Scheiße«, und sah mich plötzlich direkt an, »meine Schwester.«
Sie hatte ihn schon gesehen. Er ließ sich nur widerwillig auf ihre Umarmung ein und wich dabei mit dem Unterleib zurück, um die Berührungsfläche zu minimieren. Sie redete auf ihn ein, er antwortete mit einem Wort, woraufhin sie die Mundwinkel spöttisch verzog. Sie wollte ihm den Ruß aus dem Haaransatz wischen, doch er zog instinktiv seinen Kopf zurück, woraufhin sie ihn wegschubste. Dann sah sie mich an, so kurz, als sei ich eigentlich nie geboren worden. Sie fragte Dagur etwas, doch diesmal schüttelte er nur den Kopf. Kurz nachdem sie verschwunden war, erschien Matilda mit einem Typen im Schlepptau.
»Das ist Lárus. Das ist Simon.« Ich drückte eine Hand und sah in zwei nah beieinander stehende Augen, weit über mir. »Du glaubst es nicht«, sagte Matilda zu mir: »Er ist U-Bahnfahrer. Aus Manchester. Das ist so aufregend!«
Sie drückte Simon einen Kuss auf sein säuerliches Lächeln.
»Das glaubst du dem doch nicht!«
»Warum nicht?«
»Man trifft keine U-Bahnfahrer beim Tanzen.«
»Die fahren doch auch mal in Urlaub.«
»Der will doch nur Eindruck schinden, weil er weiß, dass es hier auf Island keine U-Bahn gibt.«
»Sieht er nicht gut aus?«
»Er sieht überhaupt nicht wie ein U-Bahnfahrer aus.«
»Wie sehen denn U-Bahnfahrer aus?«
»Der ist noch nicht mal blass«, sagte ich und wandte mich an Dagur. «Oder was meinst du?«
»Hör nicht auf ihn«, sagte Matilda zu Dagur. »Der ist eh tot.« Sie lachte.
»Was?«
»Lárus ist durch irgendeinen blöden Computerfehler im Einwohnerverzeichnis als tot eingetragen.«
Dagurs Miene verfinsterte sich.
»Aber … hast du …«
»Was?«
»Nichts.«
»Habe ich was?«
»Nichts!«, sagte Dagur.
»Jungs, bis später«, sagte Matilda und zog den angeblichen U-Bahn-Fahrer hinter sich her auf die Tanzfläche.
»Solche Computerfehler gibt es nicht«, sagte Dagur.
»Offensichtlich schon. Ich bin der Beweis. Der lebende Beweis.«
»Das hat jemand absichtlich gemacht.«
»Wer sollte das denn können?«
»Meine Familie zum Beispiel«, sagte Dagur, und ich war mir nicht sicher, ob das Hass war in seinem Blick, Angst oder nur ein Widerschein des Gins.
»Ich kenne deine Familie noch nicht mal.«
»Aber die kennen dich vielleicht.«
Ich hatte keine Lust mehr. Ich kannte solche Leute. Es bereitete ihnen Vergnügen, sich mit der dämonischen Aura eines Geheimnisträgers zu umgeben. Oft waren es die verschrobensten Leute, die so etwas taten, vielleicht in der Hoffnung, man würde dann ihre Kommunikationsunfähigkeit für tiefen Einblick halten, in Sphären, die normalen Menschen verborgen blieben. Ich dachte an seine schubsende Schwester, seinen reichen Vater und die Ausgabe der Saga von Egill Skallagrímsson im Schneematsch.
Weil mein Bierglas leer und es an der Bar inzwischen voll geworden war, nahm ich das halb volle Glas eines Jungen, der gerade seine Freundin küsste. Dann entdeckte ich Maggi Frímannsson. Maggi war einer der besten Kreisläufer Europas und spielte beim THW Kiel in der Handballbundesliga. Früher bin ich manchmal von Hamburg aus hingefahren und habe mir angesehen, wie er mit dem in seiner Wurfhand klein wirkenden Ball durch die Gegend flog. Danach haben wir uns oft zusammen ins Böll gesetzt. Wie üblich hatte Maggi Frímannsson eine neue Freundin. Maggi Frímannsson hatte immer eine neue Freundin. Diesmal war sie nicht viel größer als einssechzig, saß auf dem Schoß des fast zwei Meter großen Maggi und sah so unbeteiligt in die Gegend wie die Puppe eines Bauchredners. Dazu rauchte sie, während Maggi sie verliebt ansah. Ich wollte wegsehen, konnte es aber nicht. Maggi war wieder einmal dabei, es sehr ernst zu meinen. Dann würde es so laufen wie immer: In ein paar Wochen würde sie von Trennung sprechen, er würde versuchen, ihr alles recht zu machen und dabei nichts richtig machen. Er würde Mengenrabatt beim Blumenhändler bekommen und seine ganze Liebe ausschütten auf den Grabbeltisch der Gefühle, bis sie alles so billig bekam, dass sie es ohne schlechtes Gewissen wegwerfen konnte. Jedes Wochenende, an dem er nicht in Kiel oder sonstwo in Deutschland versuchte, die Verteidigungskette der gegnerischen Mannschaft zu durchbrechen, flog er nach Island, warf sich ins Reykjavíker Nachtleben und verliebte sich so sehr, dass er aufhörte zu schlafen, nachts mit 180 über die Landstraßen donnerte, morgens zwei Stunden joggte und Tabletten gegen die Muskelschmerzen nahm. Für eine Frau nach der anderen gab er alles und ging dabei regelmäßig zu Boden. Doch Maggi Frímannsson, Spitzensportler, der er war, stand wieder auf. Bei den meisten Frauen auf Island war sein Ruf ruiniert, und wenn man seinen Ruf hier einmal ruiniert hatte, war es eigentlich zu spät. Doch es gab auch viele, die Respekt vor Maggi hatten, weil er nicht zynisch wurde, viele, die sich fragten, wo er diese ganze Liebe überhaupt hernahm.
Maggi hatte mich entdeckt, und ich prostete ihm zu. Er hatte einmal gehofft, ich könnte ihn mit Matilda zusammenbringen, aber ich habe es gar nicht erst versucht. Weder er noch ich brachten mehr als ein halbes Lächeln zustande. Er wusste, was ich dachte, ich hatte es ihm oft genug gesagt, im Böll in Kiel. Maggi ließ sein kleinwüchsiges Stimmungstief allein und steuerte mit verzweifelter Entschlossenheit und gezücktem Portemonnaie in Richtung Bar. Er holte sich einen neuen Campari – nicht einmal sein Lieblingsgetränk passte zu ihm. Ich nahm ein weiteres verwaistes Bier von einem Tisch und ging hinüber zu seiner Freundin.
»Ich bin ein Freund von Maggi. Lárus«, sagte ich.
»Hallo«, sagte sie.
»Und du?«
»Birna«, sagte sie, nahm eine neue Zigarette und starrte so lange in den Deckel der Schachtel, als sei dort ein Schminkspiegel. Ich wollte sie bitten, ihm eine faire Chance zu geben, es nicht so zu machen wie alle. Maggi war zwar ein Frauenheld, aber ein Frauenheld wider Willen. Er wollte eigentlich nur eine, die bei ihm blieb. »Du wirst schon sehen, Birna, dass auch du nett sein kannst, Maggi kann es dir zeigen«, wollte ich sagen und dass es falsch sei, sich von jemandem zu trennen, nur weil er zu sehr liebte, man durfte das nicht tun, man musste auch chronisch hingebungsvollen Menschen eine Chance geben, gerade ihnen, denn sie hatten es schwer genug – aber sie sah mich nicht an.
Ich tanzte und bemerkte, dass mir schwindelig war. Den holzigen Geschmack des Gins hatte ich auch nach dem dritten Bier noch im Mund. Dann bemerkte ich, dass ein Mädchen in einem Kleid vor mir stand, ihre dünnen Arme auf und ab bewegte und offensichtlich schon seit einigen Sekunden mit mir redete.
»Was?« fragte ich.
»English«, sagte sie.
»Yes«, sagte ich.
»Do you have a secret for me?«
»What?«
»A secret!«
Sie machte mit der einen Hand eine Geste. In der anderen Hand hielt sie ihr Telefon. Ich stellte mir vor, dass sie Kunst studierte, durch das Nachtleben der westlichen Welt zog und Leute nach ihren Geheimnissen fragte, um sie dann in einer Installation zu verwenden. Ich überlegte, ob sie die Geheimnisse der Nachtlebenmenschen in ihrem Telefon speicherte oder gleich verschickte; vielleicht war die Installation auch schon installiert, dann würde man das, was ich ihr jetzt sagte, in einigen Minuten irgendwo in England lesen können. Ich hätte ihr von der ›Lalli skaggi‹-Episode erzählen können, doch das war kein Geheimnis, sondern nur etwas, das ich erlebt und vergessen hatte, ohne es vergessen zu können; ich glaube, man sagt dazu ›verdrängt‹.
Das Kleid der Künstlerin war schwarz und hochgeschlossen. Es hatte etwas von einer Beichtsituation, und doch wirkte sie irgendwie naiv. Plötzlich wollte ich nichts mehr als ihr die Wahrheit sagen. Die unausweichliche Wahrheit:
»Morgen fahre ich zum Flughafen und hole meinen Freund ab, der aus Hamburg kommt, um mit mir Weihnachten zu feiern«, sagte ich. »Dabei hat er mit mir Schluss gemacht. Er wird nicht kommen.«
Sie sah mich verwundert an und blickte dann auf ihr Telefon, das sie auf mich richtete, als sei es ein Trikorder aus Raumschiff Enterprise und ich eine merkwürdige, elektronisch abzutastende Lebensform. Dann sagte sie:
»Oh.«
»Wir haben einen Ausflug nach Bremerhaven gemacht. Da gibt es verlassene Hafenspeicher, in denen Falken wohnen. Gründerzeitspeicher mit so … aber was rede ich, du studierst ja Kunst. Ich habe ihm gesagt, dass ich den Ausflug sehr schön fand, da fing er an, dass er den Ausflug ganz fürchterlich fand. Ich fragte ihn warum, und er konnte gar nicht aufhören zu sagen, was er alles fürchterlich fand. Nicht an dem Ausflug. An mir. Wir hatten ausgemacht, hier zusammen Weihnachten zu feiern. Deswegen bin ich hier. Und allen meinen Freunden habe ich auch erzählt, dass ich nur vorgefahren bin und er nachkommt.«
Nicht nur allen meinen Freunden, auch mir selber hatte ich das erzählt. Eigentlich war ich niemand, der sich Dinge einbildete, und doch hatte ich es geschafft, mir nach der Trennung von Milan einzubilden, dass ich mir das alles nur eingebildet hatte. Die letzte Zeit in Hamburg verbrachte ich wie in Trance, und nachdem ich ins Flugzeug gestiegen war, dachte ich, alles wäre wieder gut. Milan war noch nie auf Island gewesen. Hier würde alles anders sein.
»Matilda will morgen früh mit mir zum Flughafen fahren, ihn abholen.«
Mir fiel ein, dass die Künstlerin vorhatte, mein Geheimnis im SMS-Format zu verarbeiten, und ich verzichtete auf weitere Ausführungen, zumal gerade sehr laut Me And The Major von Belle & Sebastian lief. I want to dance, I want a drink of whiskey, so I forget the major and go up the town, because the snow is falling … Außerdem musste sie ja auch noch von anderen Leuten secrets sammeln. Merkwürdigerweise schien sie sich gar nichts notiert zu haben. Schließlich sagte sie:
»So are you going to give me a cigarette then?«
Ich gab ihr eine Zigarette. Sie war wirklich Studentin, allerdings nicht Kunst. Während sie noch die Zigarette rauchte, bot ich ihr eine zweite an, die sie lächelnd ablehnte. Als sie sich schon umdrehen wollte, fragte ich:
»Gibt es in Manchester eine U-Bahn?«
»Keine Ahnung, ich komme aus der Schweiz.«
Ich traf Dagur auf der Tanzfläche; im Licht des Stroboskops schienen die Sterne auf seinem Betty-Ford-Clinic-T-Shirt immer heller zu leuchten. Er grinste mich an und sagte: »Ich habe gerade ein bisschen gekotzt.« Ich suchte Matilda. Noch hatte ich sie nicht belogen, zumindest nicht mehr, als ich mich selbst belogen hatte. Ich musste ihr sofort sagen, dass Milan mich verlassen hatte, doch sie war nirgendwo zu sehen. Ich verfluchte den nordenglischen U-Bahnfahrer.
Was war mit der Musik los? Es lief I Thought You Were My Boyfriend von den Magnetic Fields, wie ich es hier schon oft gehört hatte, doch in die vertraute elektronische Ordnung mischte sich ein merkwürdiges Klappern. Dem Klappern folgte ein dudelsackähnliches Pfeifen, das zu einem schrillen Klingeln anschwoll. Das hatte es an diesem Ort, an dem ich ganze Nächte verbringen konnte, ohne ein Lied nicht zu mögen, noch nie gegeben. Auf der Tanzfläche erstarb jegliche Bewegung. Alle sahen sich an und griffen verwirrt zu ihren Getränken, sofern diese ihnen nicht von anderen angetrunkenen Gästen geklaut worden waren. Sogar die Gäste an der Bar wagten kaum, sich zu bewegen. Ich sah zum DJ-Pult. Dort stand ein dünner Mann, dessen schmächtige Schultern sich in den Tiefen eines ausgebeulten Samtjackets verloren. Er sah aus wie ein schlecht gelaunter Soziologiestudent, der sich stundenlang vor dem Spiegel auf verwahrlost stylte. Auf der Tafel hinter der Bar las ich: Special Appearance 2 AM: dj différance (Paris). In diesem Moment bemerkte ich, dass die Tanzfläche doch nicht vollkommen leer war: Eine Person warf begeistert ihre Arme und Beine so weit von sich, dass sie allein den Raum füllte: Matilda.
Ich hatte sie noch nie so tanzen gesehen und erst recht nicht zu so einer Musik. Das war keine Musik, wie wir sie hörten. Nun begann dj différance auch noch, mit hoher Stimme französisch klingende Worte ins Mikrofon zu näseln – irgendetwas von amour. Dann schon lieber Simon, der U-Bahnfahrer! Natürlich müssen auch Clubs sich verändern. Ich war einmal auf einer Achtziger-Party in Berlin, wo nur Leute waren, die sich seit Ende der Achtziger nicht mehr für Popmusik interessierten und in den Neunzigern, als die Kinder aus dem Gröbsten raus waren, auf CD noch mal all das gekauft hatten, was sie ohnehin schon auf Platte besaßen. Sie trugen Doc Marten’s, schwarze Levi’s 501 und diese nach unten enger werdenden Lederjacken mit diagonal verlaufenden Reißverschlüssen, in der irrigen Annahme, das seien Klassiker und nicht einfach Klamotten, die zufällig in ihrer Jugend modern gewesen waren. Aber so ein Club war das gógó nicht. Das gógó ging mit der Zeit, ohne dazu eine Tanzbremse aus Paris zu brauchen. Warum trat er nicht in irgendeiner Einrichtung in Berlin oder Hamburg auf, an einem dieser Orte, wo kein Platz zum Tanzen war und die Musik trotzdem zu laut, um sich zu unterhalten? Warum stand nicht die ganze Besucherschaft auf, um ihn vom Pult zu vertreiben? Ich beschloss, mit Matilda den Anfang zu machen. Dazu musste sie aufhören zu tanzen. Ich hielt sie fest und brüllte ihr ins Ohr:
»Wo ist der U-Bahnfahrer?«
»Der wollte gar nicht knutschen und trinken, der wollte nur mit mir in sein Hotel. Da hab ich gesagt: ›Meet them in the club, leave them in the club.‹ Der versucht’s jetzt im NASA.«
Wieder einmal hatte Matilda einer Sache von vornherein keine Chance gegeben. Auf einmal tat er mir leid. Simon, aus Manchester, der sich als U-Bahnfahrer ausgegeben hatte, um Matilda zu gefallen – auf der Skala der sexuell motivierten Verzweiflungstaten stand das sicherlich ganz weit oben.
»Vielleicht wäre er ja doch ganz nett gewesen.«
»Spinnst du?«
»Wirklich.«
»Das sagst du jetzt nur, weil ich nichts mehr von ihm will.«
»Ich möchte mich mit dir über diese grauenhafte Musik beschweren«, sagte ich.
»Was?«
»Grauenhafte Musik. Beschweren«, sagte ich erneut, doch der Franzose drehte immer lauter auf, sodass das schmerzhaft schrille Klingeln in meinem Ohr einem dumpfen Pulsieren wich. Ich schleuderte eine Bierflasche in Richtung DJ-Pult; er duckte sich. Die Flasche traf den Plattenarm, es gab ein kurzes, quietschendes Geräusch, dann war es still. Einige klatschten.
»Wir sollten uns beschweren«, sagte ich.
»Magst du die Musik nicht?«
»Ich habe gerade eine Bierflasche auf den DJ geworfen.«
»Oh, habe ich gar nicht bemerkt«, sagte Matilda und fing sofort wieder an zu tanzen, als die Musik von neuem einsetzte. Ich schob mich Richtung Ausgang und sah Milan. Milan, wie er lachte. Milan, wie er sagte, ›ich mach jetzt Schluss‹, was er am Ende von jedem Telefongespräch gesagt hatte. Dann stand ich vor der Tür in frisch gefallenem Schnee.
Ich traf Matilda später vor der Die Besten der Stadt-Hotdog-Bude am Hafen wieder, wo sie Schnee von den Autos fegte, was sie gerne tat, wenn sie betrunken war. Sogar der Parkplatz hing voll von elektrischen Kerzen und rot erleuchteten Weihnachtssternen. Ich hatte mir fest vorgenommen, ihr auf dem Weg nach Hause von Milan zu erzählen. Immerhin wollten wir am nächsten Morgen zum Flughafen fahren, und es war eigentlich eine gute Nachricht, dass wir nun ausschlafen konnten – der perfekte Anlass für mein überfälliges Geständnis.