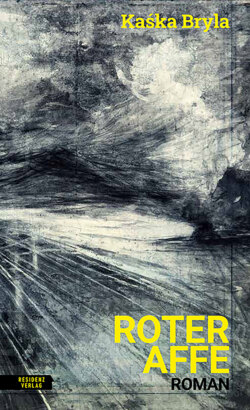Читать книгу Roter Affe - Káska Bryla - Страница 8
1.
ОглавлениеMania starrte auf den Bildschirm des Smartphones, ohne entscheiden zu können, was sie mit Tomeks Bericht anfangen sollte. Schließlich wischte sie ihn weg und steckte das Gerät zurück in den Rucksack. Dann zog sie die Akte von Roland K. aus dem Schrank.
Sie hatte ihren Überstundenausgleich kurzfristig eingereicht, also würde Sobowitz jeden Moment anrufen. Die Telefone in der Justizvollzugsanstalt Moabit hatten einen quengelig schrillen Ton, und auch nach drei Jahren fuhr Mania wie immer beim ersten Klirren zusammen.
»Was soll denn das?«, raunzte Sobowitz in die Leitung. Sie hörte im Hintergrund Geraschel, Piepen und Stimmen, die sich über Gartengeräte unterhielten.
Einige Sekunden überlegte sie, ob sie ihm die Situation erklären sollte: Dass sie, gerade als sie dabei gewesen war, die JVA zu verlassen, ihr Smartphone aus dem Kästchen geholt und eine Sprachnachricht von Zahit darauf vorgefunden hatte. Zahit rief nie an. Gab es etwas zu besprechen, meldete sich Tomek bei ihr. Noch ohne sich die Nachricht angehört zu haben, war sie verbotenerweise mit dem Smartphone in ihr Büro zurückgelaufen und hatte Zahit zurückgerufen.
»Es liegen ein paar Zettel auf dem Tisch. Keine Ahnung, was darauf steht! Keine Adresse! keine Nummer!«, brüllte Zahit. Gleich darauf versuchte er, vorzulesen, und scheiterte dabei an seinem Deutsch. »Es tut mir leid«, schluchzte er.
»Fotografier die Zettel und schick sie mir«, befahl Mania. »Ich nehme den nächsten Zug.«
»Zug? Wieso Zug?!«, hörte sie die Ausläufer seiner Stimme.
Sie stellte sich vor, dass Sobowitz im Baumarkt stand und wartete, das Smartphone ans Ohr gepresst, als wäre es ein Telefonhörer aus dem zwanzigsten Jahrhundert. Dann warf sie die Akte, die sie in der Hand hielt, in die Luft. Wenn das Deckblatt mit dem Foto von Roland K. beim Aufprall herausrutschte, würde sie ihm die Wahrheit sagen. So war Mania. Die Mappe knallte auf den Boden. »Was machen Sie denn da?«, fragte Sobowitz gereizt. »Es handelt sich um eine persönliche Angelegenheit«, antwortete Mania wahrheitsgemäß und ergänzte: »Mein Bruder wurde als vermisst gemeldet.« Die halbe Wahrheit für ein halbes Foto.
»Ach. Das tut mir leid«, stammelte Sobowitz. »Ich wusste nicht, dass Sie einen Bruder …«
»Genau. Ich hoffe, er taucht bald wieder auf.«
»Ja, natürlich. Das hoffe ich auch.« Sie schob die herausgerutschten Blätter in die Aktenmappe und betrachtete für einen Moment das Foto des Insassen Roland K., den sie drei Jahre lang therapeutisch begleitet hatte. Plötzlich begriff sie, dass sie nicht mehr zurückkommen würde.
»Wissen Sie. Eines der Gutachten eilt. Könnten Sie? Wie lange?«
»Weiß ich noch nicht«, ließ Mania Sobowitz zappeln und steckte die Akte ein. Der Senator, Sobowitz’ Vorgesetzter, wurde ungeduldig, sobald er unter Rechtfertigungsdruck vor der Presse geriet. »Stellen Sie sich vor, ich hätte Kinder und die wären jetzt krank.« Sobowitz schwieg. Er hatte selbst zwei Kinder, Junge und Mädchen, fein säuberlich ein Jahr voneinander getrennt. »Ich nehme die Akte mit und schicke Ihnen das Gutachten per Mail«, log sie.
»Danke«, sagte Sobowitz gedämpft und schien vergessen zu haben, dass es verboten war, Akten von Inhaftierten aus der JVA mitzunehmen. »Viel Glück«, presste er hinterher.
Als sie auflegte, das Büro ein letztes Mal begutachtete, erinnerte sie sich an eine der Gruppentherapiesitzungen zu Beginn ihrer Arbeitszeit.
Zehn Männer und sie waren um einen runden Tisch gesessen. Es war Sommer und schwül, die Fenster standen offen, sodass vom Innenhof die Stimmen aus den Zellen, deren Fenster ebenfalls geöffnet waren, in den Therapieraum drangen und die ohnehin unsichere Grundstimmung verstärkten. Zum ersten Mal war sie mit den Inhaftierten ganz alleine. Das hausinterne Walkie-Talkie – wie sie es nannte – lag auf dem Tisch, der rote Knopf, den sie in Notfällen drücken konnte, beobachtete sie. Weil sie neu war, war sie für gewöhnlich sehr wachsam.
Plötzlich erkannte sie in den Augen des ihr gegenübersitzenden Gerhard O., dass hinter ihr Gefahr drohen musste. Seinem Blick folgend, drehte sie sich um, legte den Kopf leicht in den Nacken und sah in das leere Gesicht von Roland K., der hinter ihr stand.
Vor ihr war der Tisch, hinter ihr und Roland K. die Fensterwand, rechts neben ihr saß Sebastian S.
Aus der Gruppe erwartete sie keine Hilfe. Bevor sie den Knopf drücken könnte, hätte Roland K. alle Zeit, die er brauchte, um ihren Kopf zu packen und gegen die Tischplatte zu donnern. Also machte sie sich innerlich leer, setzte seiner Leere die ihre entgegen. Einige Sekunden später kehrte Bewusstsein in seine Augen zurück.
»Seien Sie jetzt bitte so freundlich und setzen sich«, sagte sie ruhig. Keiner sah sie an und sie fuhr mit der Sitzung fort.
Auf dem Weg zum Bahnhof rief sie in jedem Krankenhaus in Wien und Umgebung an und versuchte dabei, nicht an Kaja zu denken. »Wir werden Tomek finden«, beruhigte sie Zahit, der sie alle zwei Minuten mit einem weiteren Detail anrief.
»Aber er hat Sue hiergelassen!«
»Alles wird gut«, antwortete sie halb abwesend, wischte ihn weg und buchte ihr Ticket.
Zufrieden stellte sie fest, dass vor dem Liegewagenabteil für Frauen nur ihr Reservierungskärtchen steckte. Von draußen drang rosiges Abendlicht hinein. Trotzdem zog sie die Vorhänge zu und las den Brief, die Geschichte, den Bericht, was auch immer Tomek da zurückgelassen und Zahit ihr geschickt hatte, noch einmal. Tomek hatte ihr nie von einer Marina erzählt.
Heute ist der 27. Juni 2016. Eben schlugen die Kirchenglocken vier Mal, es ist 16 Uhr. Ich werde alles so genau aufschreiben wie möglich, auch wenn ich glaube, dass dies nicht sehr wichtig ist.
Ich verfasse diese Niederschrift nicht auf eine Vollständigkeit hin, aber ich schreibe unter enormem Zeitdruck.
Vor genau einem Jahr habe ich etwas versprochen, weswegen es mir heute widerstrebt, zu gehen. Hinzu kommt, dass es draußen heftig stürmt und ich Angst vor Wind habe. Es ist banal, aber es ist so. Der Wind erschwert es mir zusätzlich, mich auf den Weg zu machen. Vor meinem Küchenfenster steht eine Birke. Wenn der Wind sie um 45 Grad nach unten drückt, sage ich alle Termine ab, gehe nicht zur Arbeit und warte. Solange ich drinnen bleibe, kann mich die Angst nicht packen, aber sobald ich die Wohnungstür aufschließe, werden meine Ohren taub. Im Hausflur zittern meine Knie, und bis zum Haustor schaffe ich es nur selten. Auch der Hund, der mit mir die Wohnung teilt, muss sich an diesen Tagen gedulden und seine Notdurft zurückhalten. Das macht er, ohne sich zu beklagen. Wir teilen ein Erlebnis, das uns beide gelehrt hat, den Wind zu fürchten. Bei diesem Erlebnis lernte ich Marina kennen, eine sehr dünne und sehr kleine Frau, die gerne Kaffee trinkt und die Großstadt schlecht verträgt. Mit Marina sollte eigentlich meine Niederschrift beginnen, denn wäre nicht ihre Traurigkeit und unsere gemeinsame Liebe zu Filmen und Büchern, säße ich jetzt nicht an meinem Schreibtisch. Wahrscheinlich wäre ich heute ein ganz anderer Mensch.
Den Sturm hatten sie damals im Radio angesagt, mit Böen bis zu 120 Stundenkilometer. Ich wusste nicht, wie ich mir 120 Stundenkilometer in Form von Wind vorzustellen hatte. Es war Sonntag, ich wollte Zeitungen holen, und der Hund bat mich mit der Leine im Maul um einen Spaziergang. Als ich sah, wie die Ampel an dem Drahtseil immer stärker schaukelte, es Dachplatten von einer Lagerhalle riss und diese zehn Meter weiter auf dem Boden zerschmetterten, bekam ich einen Eindruck von der Windstärke und meiner Ohnmacht. Ich wollte schnell zurück in meine Wohnung. Ich lief und hörte hinter mir einen Schrei. Ich bin mir sicher, dass ich zögerte, aber dann drehte ich mich doch um und sah, wie Marinas Beine für kurze Zeit über dem Boden schwebten. Sie wirkte darüber mehr verblüfft als panisch, aber Angst lag auch in ihrem Gesichtsausdruck. Das muss mich dazu bewogen haben, meine eigene Furcht hintanzustellen, Marina am Jackenkragen zu fassen und über die Straße in den nächstgelegenen Hauseingang zu zerren.
Wenn ich an den Tag zurückdenke, erinnere ich mich, wie meine Knie gezittert haben, an Marinas Tränen und daran, dass ich gegen den Impuls ankämpfen musste, nur mich und den Hund in Sicherheit zu bringen, und nicht einmal, was den Hund angeht, kann ich mit Gewissheit behaupten, dass ich nicht in einem Moment in Erwägung zog, die Leine loszulassen.
Später erzählte Marina wiederholt, ich hätte ihr an diesem Tag das Leben gerettet. Ich denke, das ist sehr übertrieben. Aber es schien ihr darum zu gehen, mich vor anderen als Helden aufzubauen, weil dankbar, das spürte ich, dankbar war sie mir nicht.
Den restlichen Tag des Sturmes verbrachten wir gemeinsam in meiner Wohnung, und danach verabredeten wir uns immer wieder. Als hätte der Wind ein Band zwischen uns geknüpft, fühlte ich mich für den weiteren Verlauf ihres Lebens auf seltsame Weise verantwortlich, und kann mir das nur erklären, indem ich es mit der Verbindung zwischen mir und meinem Hund vergleiche.
Als ich den Hund mit in meine Wohnung nahm, ihn fütterte, ihm einen Wassernapf hinstellte und eine Decke auf meinen Fußboden legte, gab ich dem Hund das Recht, zu bleiben, so lange er wollte. Ich durfte ihm sein Zuhause nicht wieder entziehen. Wo ich lebte, musste auch immer Platz für sein Leben sein. Ich weiß nicht, woher sie kamen, aber so waren die Regeln.
In dem Moment, in dem ich Marina dem Wind entzog und in meine Wohnung brachte, willigte ich ein, mein Leben nicht mehr unabhängig von ihrem zu führen. Es ist mir nicht möglich, die Zusammenhänge anders zu denken.
Marina und ich sprachen oft über Filme, die ich gesehen, und Bücher, die sie gelesen hatte. Ein Buch, das sie in Abständen immer wieder las, war »Die unendliche Geschichte«, während es zu meinen Ritualen gehörte, mir einmal im Jahr die alte »Star-Wars-Trilogie« anzusehen. Beides machten wir, seit wir einander kannten, gemeinsam. Wir nahmen den Hund auf lange Spaziergänge. Manchmal übernachtete Marina danach bei mir, so war es bequemer, und ich fand schnell heraus, dass sie alleine nur schlecht einschlafen konnte. Dass es ihr oft nächtelang überhaupt nicht gelang.
Müsste ich mich selbst beschreiben, würde ich von mir als einer positiven und verantwortungsbewussten Person sprechen. Ich gehe zwei Mal die Woche joggen, ich verbringe gerne Zeit mit anderen, ich verfolge meine Arbeit mit Ehrgeiz, um mir und dem Hund einen angemessenen Lebensstandard zu sichern, und ich lasse einmal im Jahr bei einer Gesundenuntersuchung meine Blut- und Urinwerte prüfen. Auch was den Hund betrifft, achte ich auf seine Ernährung, seine Impfungen und einen regelmäßigen, seiner Statur und seinem Alter angemessenen Auslauf.
Marina hingegen hatte zwar ihr Studium abgeschlossen, sogar den Grad eines Doktors erlangt, behielt aber trotzdem keine Anstellung länger als sechs Monate. Zu viele Menschen, Tiere, Angelegenheiten drängten sich zwischen sie und ihre Arbeit, und obwohl Marina häufig lachte, auch selber gerne scherzte, mit ihren Anekdoten ganze Abendrunden unterhielt, muss ich ihren mir vertrautesten Gemütszustand als trüb beschreiben.
Ich wurde sehr bald, nachdem wir einander begegnet waren, das Bild nicht mehr los, es läge ein Schatten auf ihr, der manchmal mehr, manchmal weniger von ihr verdeckte. Es beunruhigte mich, und ich erzählte ihr davon. Sie hörte mir zu, war erst sehr still und meinte dann, ich sei nicht der Erste, der ihr das sage, aber sie sehe keinen Weg, den Schatten loszuwerden. Er gehöre zu ihr so wie mein Hund zu mir. Kurze Zeit später zog sie in einen anderen Stadtteil.
Danach sahen wir einander seltener, aber sie übernachtete häufiger als früher bei mir. In der Nacht lag sie in meinem Arm, ihr Körper war anfangs immer sehr steif und ich hielt sie fest, bis sich ihre Muskeln entspannten und ihr Atem gleichmäßig und ruhig wurde. Selber wachte ich in diesen Nächten häufig von Albträumen geplagt auf. Meine Schreie weckten Marina. Was denn los sei, fragte sie schlaftrunken, aber ich sah davon ab, ihr von den Träumen zu erzählen, aus Angst, sie könnte sich schuldig fühlen.
In der Zeit, in der Marinas Traurigkeit tiefer war denn je, der Schatten groß und meine Albträume sehr düster, schrieb ich an einer wichtigen Reportage. Die frühen Morgenstunden zählten zu meinen produktivsten Arbeitsphasen, weshalb mein Vorankommen unter den Nächten litt, in denen Marina bei mir schlief. Also bat ich sie, bis zur Fertigstellung meiner Arbeit nicht mehr bei mir zu übernachten, zog diese Bitte aber wenige Stunden, nachdem ich sie geäußert hatte, telefonisch wieder zurück.
Es sind bereits zwei Stunden vergangen, seit ich an meinem Schreibtisch sitze und schreibe. Die Kirchenglocken schlugen eben 18 Uhr. Der Wind hat sich gelegt. Die dünne Birke steht gerade, einige Zweige hat sie verloren. Vor mehr als zwei Stunden erreichte mich Marinas SMS. Sie schrieb, ich solle jetzt kommen. Dass ich ihr vor einem Jahr etwas versprochen, ob ich das vergessen hätte. Mit dem Versprechen hat sie recht. Aber es ist mir schier unmöglich, mich von diesem Stuhl zu erheben. Im Kopf zähle ich die Meter, die es bis zu Marinas Wohnung zurückzulegen gilt, und rechne sie in Minuten um. Dreißig Minuten würde ich mit dem Fahrrad brauchen, sechzig, nähme ich Bus, Metro und Straßenbahn. Mit jedem Meter, den ich mich zu ihr hinbewege, verkürze ich ihre Lebenszeit. Wahrscheinlich werde ich zu Fuß gehen.
Vor einem Jahr und einem Monat war Marinas Schatten so groß, dass ich sie kaum noch erkannte. Eines Morgens, nachdem sie bei mir übernachtet hatte, schaffte sie es nicht mehr, das Bett zu verlassen. Sie lag da und weinte, und wenn ich sie fragte, warum sie denn weine, antwortete sie, sie wisse es nicht, aber sie könne nicht aufhören, und dass sie sterben wolle. Sie meinte auch, die Menschen nutzten sie nur aus. Die Tiere ebenso, aber denen könne sie es nicht übel nehmen. Und ich nutzte sie auch aus, und sie habe für all das keine Kraft mehr. Jetzt hallen ihre Sätze in mir nach.
Damals wollte ich all das nicht hören. Es sei eine Krankheit, erklärte ich mir, und brachte Eiscreme und Chips und Filme und Bücher nach Hause, ließ den Hund tagsüber zu ihr ins Bett, stellte sie alle zwei Tage unter die Dusche und zwang sie nach einer Woche dazu, wenigstens in der Wohnung mit mir auf und ab zu gehen. Erst dachte ich, dass es vorübergehen würde wie eine Grippe. Nach zwei Wochen lud ich eine befreundete Psychiaterin zum Abendessen ein. Sie verschrieb Marina Antidepressiva.
Nachdem die Ärztin gegangen war, saß Marina zurückgezogen in einer Ecke des Bettes und sah mich an, als wäre ich ihr schlimmster Feind. Ich holte »Die unendliche Geschichte« aus dem Regal und las ihr die Passage über die Sümpfe der Traurigkeit vor, beschwor sie, nicht aufzugeben, flehte sie an, es mit den Tabletten um meinetwillen zu versuchen. Wenn sie sprach, dann nur über den Tod.
Nach drei Wochen war sie dünn und sehr bleich. Essen, das ich ihr zubereitete, nahm sie nur spärlich zu sich, und ich hegte den Verdacht, dass sie es ohnehin nur mir zuliebe anrührte. Ich wusste, dass ich nicht die Kraft haben würde, ihr länger dabei zuzusehen. Zugleich fürchtete ich, dass der Schatten sich ausdehnen und auf mich überspringen könnte.
Heute denke ich, dass ich ihr und dem Schatten bereits am Tag unserer ersten Begegnung verfallen war. Dass sie mich damals schon überzeugt hatte. Ich erinnere mich an ihren Gesichtsausdruck, an diese verzerrte Mischung aus Todesangst und Gleichgültigkeit, und wie er sich als eine tiefe Wahrheit in mein Bewusstsein brannte: dass genau daraus das ganze Leben bestand. Aus dem Kampf, sich selbst überzeugend genug zu belügen, die Glückshormone an die Oberfläche zu kitzeln, wenn nötig, chemisch nachzuhelfen und jedem Jahr ein weiteres und noch eines folgen zu lassen. Der Unterschied zwischen Marina und mir bestand nur darin, dass sie die Wahrheit schon ihr ganzes Leben kannte. Die Wahrheit war der Schatten, und ich hatte ihn weit fortgesperrt.
Vor einem Jahr kaufte ich einen teuren Riesling, schälte Kartoffeln und Spargel, bereitete eine Sauce hollandaise zu, deckte den Küchentisch, stellte Kerzen auf, trug Marina unter die Dusche, wusch ihr Haar, föhnte und kämmte es, kleidete sie an und setzte sie auf einen gepolsterten Stuhl an den Küchentisch. Ich schenkte uns Wein ein und lud ihren Teller voll mit Essen. Sie machte keine Anstalten, etwas zu sich zu nehmen. Schließlich zündete ich mir eine Zigarette an und unterbreitete ihr meinen Vorschlag. Ich bat sie eindringlich, auf mich zu hören und mir zu vertrauen.
Die Tabletten?, fragte sie und die Verachtung in ihrer Stimme verletzte mich. Ich bat sie, es ein Jahr lang auf meine Weise zu versuchen. Dabei gehe es nicht nur um die Tabletten, es sei ein ganzheitlicher Ansatz mit Trainingsprogramm und Spaziergängen. Ich würde für sie kochen, sie würde bei mir wohnen, wir fänden gemeinsam eine Arbeit für sie, die ihr gefallen würde. Plötzlich lachte Marina auf, wurde gleich wieder ernst und fragte, was nach dem Jahr sei. Was dann sei, wenn sie all das befolgt habe, was ich vorschlug, und sich trotzdem nichts geändert hätte? Ich dachte lange darüber nach, aber mir fiel nichts ein. Ob sie dann endlich sterben dürfe und ob ich ihr dabei helfen würde, fügte sie hinzu, als von mir keine Antwort mehr zu erwarten war. Ich nickte schließlich und wir stießen darauf an.
Eigentlich lebte ich im letzten Jahr in der Überzeugung, Marinas Zustand verbessere sich stetig. Sie nahm die Tabletten, wir gingen gemeinsam joggen und sie aß beinahe gleich große Portionen wie ich. Sie sprach in dem Jahr nicht mehr über den Tod. Der Schatten verschwand nicht, aber sie schien glücklich. Es war eine gute Zeit. Wie lächerlich und verlogen sich diese Zeilen lesen. Vielleicht wollte ich es so sehen. Jetzt werde ich zu ihr fahren. Den Hund nehme ich nicht mit. Ich bin kein schlechter Mensch. Daran halte ich fest.
Es musste noch mehr davon geben. Seit Kajas Tod hatte Tomek alles aufgeschrieben. Ein Leben als Reportage. Das hatte einen erstklassigen Journalisten aus ihm gemacht. Er war so gut, dass man ihm schon nach kurzer Zeit eine fixe Stelle als Redakteur angeboten hatte.
Sie konnte sich nicht vorstellen, dass es diese Marina tatsächlich gab und Tomek nichts von ihr erzählt hatte. Dass er einen derart absurden Pakt mit ihr geschlossen haben sollte. Das konnte einfach nicht sein. Von der Windangst hörte sie auch zum ersten Mal. Einzig die Tatsache, dass er die Hündin zurückgelassen hatte, durchkreuzte ihre Analyse, denn das war für sie real und passte nicht zu Tomek.
Sie schlug die Augen auf, als der Zug in St. Pölten einfuhr. Widerwillig ließ sie sich vom Schaffner einen Kaffee bringen, obwohl ihr schon die Vorstellung den Appetit verdarb. Das Display ihres Smartphones quoll vor Nachrichten über, darunter auch einige von Sobowitz, der sich wohl an die Akte erinnert hatte und an den Ärger, der ihm bevorstand, wenn herauskam, dass sie fehlte. Mania löschte seine Nachrichten, ohne sie zu lesen.
Zehn Telegram-Nachrichten von Franziska und zwei verpasste Anrufe von ihrer Mutter, die wahrscheinlich zusammengehörten. Irgendwann musste Franziska Manias Mutter angerufen, sich nach Manias Verbleib erkundigt und über die ausstehende Beantwortung ihrer Nachrichten beschwert haben. Kurz ärgerte sie sich, dass sie Franziska in einem schwachen Moment die Nummer ihrer Mutter gegeben hatte. Sie löschte die Nachrichten und behielt einen verpassten Anruf ihrer Mutter als Erinnerung für später, wenn sie sich eine glaubhafte Ausrede zurechtgelegt hätte. Ihre Mutter tendierte dazu, Manias Lügen sehr schnell zu entlarven.
Zwanzig verpasste Anrufe von Zahit, aber keine Sprachnachricht. Tomek war nicht wieder aufgetaucht. Sie schickte Zahit eine SMS mit der Ankunftszeit des Zuges in Wien. Den letzten Schluck Kaffee nahm sie auf die Toilette mit und zündete sich eine Zigarette an.
Mania beugte sich zu Sue hinunter und umarmte die Hündin. Danach begrüßte sie Zahit, der aussah, als käme er vom Schlachtfeld in Rojava.
Zum letzten Mal hatte sie ihn vor einem Jahr gesehen. 2015. Damals hatte sie Zahit zu Tomek gebracht. Das schien ihr jetzt sehr fern.
Zahit übernahm kommentarlos ihren Rollkoffer, zog ihn hinter sich her, und sie folgte ihm, dabei die Gegend nach Veränderungen absuchend.
Als sie aus Wien wegzog, war der Hauptbahnhof noch eine Baustelle gewesen, und alle Anrainerinnen und Anrainer waren an den Sommerabenden mit ihren Kindern an den Rändern der großen Grube gestanden, die bei den Vätern und ihren Töchtern und Söhnen unweigerlich den Gedanken an Lego-Technik hervorrief – bei den Vätern, die ursprünglich Ingenieure gewesen waren und hier in Österreich als Putzkräfte arbeiteten, und den Töchtern und Söhnen, die es einmal besser haben sollten, um die Träume ihrer Väter zu verwirklichen. Den Vätern und Töchtern, denen vorerst nur Lego-Technik blieb, das sie auf Flohmärkten in den Außenbezirken ersteigerten, und die Baustelle des zukünftigen Hauptbahnhofs. Bei dem Gedanken lachte sie auf, worauf Sue interessiert zu ihr hochsah.
Der zehnte Wiener Gemeindebezirk war einer der Migrantenbezirke der Stadt. In Favoriten dampfte das Kopfsteinpflaster in der Fußgängerzone schon am Morgen die unerfüllten Träume und Sehnsüchte aus. Es stank nach Leben, Hundepisse und Bier. Mania verdrehte die Augen. Früher hatte sie den Geruch gemocht, aber heute versuchte sie nur noch, ihn mit Zigarettenrauch zu verscheuchen.
Durch die obere Fensterreihe des Schlaf- und Wohnzimmers drang ein breiter Balken grelles Licht. Der Rest des Fensters war mit auseinandergeschnittenem Karton abgedunkelt. Er musste zu dem Schrank in der Ecke gehört haben, den es vor einem Jahr noch nicht gegeben hatte.
Obwohl Tomek bereits seit drei Jahren hier wohnte, waren alle Kleidungsstücke lange Zeit in Umzugskisten verteilt gewesen. Mania schmunzelte. Sie sah Tomek vor sich, wie er umständlich den Karton mit der einen Hand gegen die Fensterscheibe presste und mit der anderen das Klebeband an Karton und Fensterrahmen befestigte. Es hatte sicher mehrerer Anläufe bedurft, bei denen Tomek geflucht und zwischenzeitlich aufgegeben hatte. Die Kartonoberfläche wies einige Schrammen auf.
Die oberste Fensterreihe, die er aus Ermangelung einer Leiter nicht hatte erreichen können, fand er im Nachhinein sicher sehr praktisch. Als hätte er es sich ausgedacht. Mania sah ins Sonnenlicht und blinzelte. Aber letztlich glaubte sie nicht, dass er die Fenster für sich selbst verdunkelt hatte.
»Was steht denn da?«, fragte Zahit ungeduldig, zeigte auf die Zettel, die er für sie abfotografiert hatte. »Kannst du es vorlesen?«
»Klar«, antwortete sie freundlich und langte nach den Blättern auf dem Schreibtisch. »Reicht es dir, wenn ich auf Deutsch lese, oder soll ich ins Englische übersetzen?«
»Deutsch ist okay. Nur lesen geht noch nicht«, dabei drehte er sich weg.
»Diese Marina?«, fragte Mania, als sie fertig war. »Existiert sie?« Zahit nickte verwundert. »Eine sehr schöne Frau«, fügte er hinzu. Mania zuckte, als hätte man sie nach etwas gefragt, worauf sie keine Antwort wusste. Sie ließ das letzte Blatt auf den Tisch gleiten. Er war aus Eichenholz, dunkel, mit Schnitzereien an den Seiten, eine Antiquität, die wie Nzinga von Matamba, eine afrikanische Königin, in einem weißen Slum wirkte. Es war Kajas Zeichentisch gewesen, das Einzige, was Tomek nach Kajas Verschwinden und auch später, nachdem man ihre Leiche gefunden hatte, behielt.
Wie klein sie beide damals gewesen waren. Zehn Jahre alt, als es Kaja von einem Tag auf den anderen nicht mehr in ihren Leben gab.
Sie kniete sich vor den Tisch und fuhr mit den Fingern über die Schnitzereien, Elefantenköpfe, die sich bis heute in Manias Träume drängten.
»G-E-S-T-O-RRR-B-E-N.« Sie rollte das R, wie es im Polnischen üblich war und im Deutschen ihre Herkunft verraten würde. »Gestorben.« Sie rollte das R so, wie Tomek es rollte.
Auch wenn sie beide bereits in Österreich geboren wurden, hatte Tomek das polnische R im Deutschen behalten – und Mania nicht. Das konnte sie sich bis heute nicht erklären.
»Einmal habe ich sie getroffen«, erzählte Zahit. »Gemeinsam mit Tomek. Wir sind Pizza essen gewesen.«
»Pizza?«, fragte Mania erstaunt. Tomek mochte keine Pizza.
»Ja. Tomek war sehr ruhig, sagte kaum etwas. Ließ Marina für ihn bestellen.« Sie registrierte die dezente Verachtung in Zahits Stimme.
»Glaubst du«, Mania tippte auf das Papier, »dass es stimmt?«
»Der geplante Suizid?«
»Hat er dir von dieser Vereinbarung erzählt?«
»Nein.«
»Tomek würde alles tun, um einen Suizid zu verhindern. Seine Mutter hat sich umgebracht«, ergänzte Mania.
Zahit sah zu Boden. »Wenn wir uns getroffen haben, dann meistens bei mir. Er hat oft dort gearbeitet, sagte, er könne sich bei mir besser konzentrieren.« Die Mimik war ungelenk. Er hatte seine Gesichtszüge nicht unter Kontrolle. Das fand sie interessant. Es war ihr vor einem Jahr nicht aufgefallen.
Einige ihrer Patienten hatten ähnliche Symptome. Ohnehin war wahrscheinlich, dass er an einer posttraumatischen Belastungsstörung litt.
»Das hilft uns nicht weiter«, stellte Mania fest.
»Nein«, stimmte er zu.
»Warum hast du ihn nicht als vermisst gemeldet?«
»Ich geh nicht zu den Bullen«, antwortete er und sah ihr dabei nicht in die Augen.
Draußen funkelten die grünen Birkenblätter. Der schlechte Kaffee und die Zigaretten quälten Manias Magen. Marina. Sie schrieb den Namen auf ein Blatt Papier. Ohne das R ergaben die Buchstaben Mania. Für einen Moment wurde ihr kalt, dann knüllte sie das Blatt zusammen.
Gemeinsam mit anderen hatte sie 2015 syrische Geflüchtete von Mazedonien nach Österreich und weiter nach Deutschland gefahren. So war sie Zahit begegnet und hatte ihn auf ihrer letzten Tour bei Tomek abgeladen.
»Er möchte in Wien bleiben. Kümmerst du dich?« Mitten in der Nacht hatte sie bei Tomek geklingelt, war todmüde mit Zahit in Tomeks Wohnung gestanden. Die Nächte davor war sie tausende Kilometer durchgefahren. Bilder von wartenden Frauen, hungrigen Kindern und starr immer weiter vor sich her laufenden Männern stauten sich in ihrem Kopf. »Morgen muss ich zurück nach Berlin. Kümmerst du dich?«
Tomek nickte, nahm sie in den Arm und hielt sie, bis sich Mania abrupt losriss, weil sie spürte, wie die Geborgenheit drohte, ihr die Stärke zu rauben, den Mut zu nehmen, morgen früh mit einem Auto voller Fremder über eine weitere Grenze zu fahren.
Zahit setzte sich. »Besser nicht zur Polizei«, stellte er nochmals klar und Mania nickte.
»Wir brauchen einen Plan«, sagte sie.
»Einen Plan?«
»Solange wir nicht wissen, dass er tot ist, gehen wir davon aus, dass er lebt. Wir gehen davon aus, dass beide noch leben.«
»Okay.«
»Wir müssen suchen. Wir überprüfen jede Erinnerung, jede Mail, jede SMS aus dem letzten Jahr. Wir durchsuchen die Wohnung.«
Zahit hörte nicht mehr auf zu nicken.
»Wir finden die beiden!«, überzeugte sich Mania selbst. Dann wurde sie schlagartig müde. Sie hörte noch, wie Zahit sagte, sie solle sich ins Bett legen, aber da hatte sie den Kopf wie in ihrer Kindheit bereits auf die Unterarme gebettet. »Nur 15 Minuten«, murmelte sie, verwundert darüber, dass diese alte und überwunden geglaubte Krankheit sie jetzt einholte.
Obwohl sie wusste, dass sie schlief, sah sie sich selbst in Tomeks Wohnung auf dem Stuhl sitzen, Hände und Kopf auf dem Tisch. Das Sonnenlicht war aus dem Raum verschwunden. Sonst war alles gleich. Zahit saß ihr gegenüber und schlief ebenfalls. Es war Nacht. Trotzdem breitete sich in dem dunklen Raum noch eine andere Dunkelheit aus. Von den Fenstern kroch sie langsam, aber beständig in ihre Richtung. Mania merkte, wie Furcht in ihr hochstieg. Sie wollte aufstehen und weglaufen, was nicht ging, weil sie schlief, und das wusste sie. Sie sah zu, wie die Dunkelheit immer näher kam, bis das Schwarz ihr Gesicht berührte. Sie schrak auf und glaubte, nun wach zu sein, aber es war immer noch Nacht.