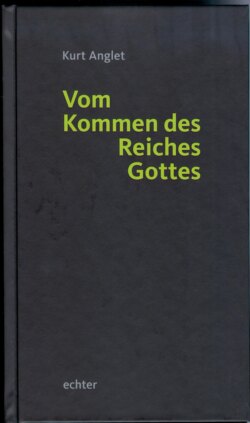Читать книгу Vom Kommen des Reiches Gottes - Kurt Anglet - Страница 6
Erkenntniskritische Vorrede: Theologie und Wirklichkeit
ОглавлениеIch habe mich durch Erfahrung von der Wahrheit des Spruches in der Bibel überzeugt und ihn zu meinem Leitstern gemacht: Trachtet am ersten nach Nahrung und Kleidung, so wird euch das Reich Gottes von selbst zufallen.
G. W. F. Hegel, Brief an Knebel (vom 30.8.1807)
Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist.
Mt 25,34
In seiner Heidelberger Antrittsvorlesung vom Herbst 1816 vermerkt Hegel: »Das zuerst verborgene und verschlossene Wesen des Universums hat keine Kraft, die dem Mute des Erkennens Widerstand leisten könnte; es muss sich vor ihm auftun und seinen Reichtum und seine Tiefen ihm vor Augen legen und zum Genusse geben.« – Szenenwechsel: Im Herbst 2011 ging der Nobelpreis für Physik an Saul Perlmutter, Adam Riess und Brian Schmidt, die herausfanden, dass sich das Universum mit wachsender Geschwindigkeit ausdehnt. Das Ergebnis sei eine bahnbrechende Überraschung gewesen, so das Nobelpreiskomitee in seiner Würdigung, insofern die Preisträger dazu beigetragen hätten, ein Universum zu enthüllen, dass in weiten Teilen der Wissenschaft völlig unbekannt gewesen war und bis heute rätselhaft bleibe.
Deutlicher lässt sich der Gegensatz zwischen dem Weltbild der heutigen Physik und einem Denken gar nicht zum Ausdruck bringen, das sich – nur weil es Einsicht in das Universum nimmt – aufspielt, als würde ihm das Weltall zu Füßen liegen; ja als wäre der Mensch aufgrund seiner »Erkenntnis« dessen Schöpfer. Unter dem Titel der »Wissenschaft« hat das Bewusstsein des Deutschen Idealismus bis in die jüngste Vergangenheit hinein den Zeitgeist bestimmt, der sich über die Schöpfung so erhaben wähnt wie über ihren Schöpfer, so dass sich heutzutage ein jeder, der auch nur an einen Schöpfer zu denken wagt, gar des Verdachts des »Gotteswahns« aussetzt. Folglich bleibt auch für die Rede vom Reiche Gottes, in dem sich dessen Kommen erfüllt und vollendet, nur ein Nicht-Ernstnehmen übrig. Die Ironie, mit der Hegel es angesichts einer am Horizont heraufziehenden Konsumgesellschaft bedenkt, gehört inzwischen zum guten Ton der Medien, sobald religiöse Themen zur Sprache kommen. Anders denn als eine überflüssige Zugabe zu einer Welt, die alle Bedürfnisse zu erfüllen vorgibt und darin ihre eigene Vollendung zelebriert, vermag man sich beim besten Willen nicht ein Reich vorzustellen, das über die Befriedigung unserer Wünsche und Bedürfnisse hinausreicht, zumal wir noch angesichts seines Einbruchs aufgerufen sind, diese hintanzustellen, ja unser Kreuz auf uns zu nehmen.
Ganz anders der Wissenschaftsbegriff der Physik unserer Tage, die um ihre Grenzen weiß; ja die sich selbst zurücknimmt, gerade weil ihre Erkenntnisse die Grenzen unserer Vorstellungskraft sprengen: angefangen bei der Entstehung des Weltalls aus einem winzigen Punkt, weit kleiner als ein Atomkern, bis hin zu seiner rasanten Ausdehnung, obgleich ihr Zeitbegriff dem der christlichen Apokalyptik nähersteht (vgl. 2 Petr 3,8–13) als Hegels Zeitauffassung, die über rein historische Zeiträume nicht hinausreicht und auch in kosmologischer Hinsicht ganz dem Weltbild der mechanistischen Physik ihrer Zeit befangen bleibt. Kaum zufällig hat Hegel in seiner Religionsphilosophie die Eschatologie eliminiert und die messianische Dimension des christlichen Glaubens ausgehöhlt; diesen auf eine säkularisierte Allerweltsreligion reduziert, die weder Erlösung noch Vollendung kennt, sondern über die Selbstzerrissenheit des Menschen und über die Vergangenheit nicht hinausführt. Kaum zufällig auch daher sein Scheitern der Begründung der Religion durch den Systembegriff, weil kein System Schöpfung, Erlösung und Vollendung zu begründen vermag, die in der Offenbarung Gottes ihr einziges Fundament besitzen. Die Vermessenheit, sich über sie zu erheben, sei es im Sinne einer rein naturalistischen, sei es einer rein historischen Auffassung des Menschen, kennzeichnet die Fortschrittsgläubigkeit unserer Epoche, bis hinein in die Theologie, soweit sich deren Vertreter ihrem Geist andienten, um mit unserer Zeit Schritt zu halten.
Doch wie das beschleunigende Tempo eines unablässigen Weltalls dem Gedanken, der damit Schritt zu halten trachtet, den Atem nimmt, so auch der Lauf der Zeit dem menschlichen Geist, der sich anmaßt, in unserer Weltzeit, gar in unserer Gesellschaft so etwas wie einen Zustand der Vollendung erkennen zu wollen. Nicht allzu lange ist es her, dass der amerikanische Zeitdiagnostiker Francis Fukuyama – unter dem Eindruck des Zusammenbruchs des kommunistischen Ostblocks – seinen Bestseller Das Ende der Geschichte. Wo stehen wir? [München 1992] schrieb. Heute könnte er jenes »Ende« um ein mögliches Ende der eigenen westlichen Kultur ergänzen. So hat jüngst Niall Ferguson in Civilization. The West and the Rest [London 2011; deutsch: Der Westen und der Rest der Welt. Die Geschichte vom Wettstreit der Kulturen, Berlin 2011] – für einen Kulturhistoriker recht ungewöhnlich, da sich diese in der Regel mit einer rein immanenten Betrachtung der Geschichte begnügen – seiner Schlussbetrachtung einen kleinen Abschnitt mit einem apokalyptischen Ausblick vorangestellt: »Naht das Ende aller Tage?«
Bemerkenswert daran ist zunächst die Schilderung von Verfall und Untergang des Römischen Reiches – so der Titel des monumentalen Werkes von Edward Gibbon, der für seinen Untergang einen historischen Zeitraum von 1400 Jahren, von 180 bis 1590 ansetzt; also eine »Geschichte der langen Dauer« [andere haben gar sein Ende mit dem förmlichen Erlöschen des Römischen Reiches Deutscher Nation unter Napoleon im Jahre 1807 in Zusammenhang gebracht]. Doch Ferguson nimmt den entscheidenden Zeitraum im Zuge der Invasion der Germanenstämme im 5. Jahrhundert in den Blick und vermerkt in Anlehnung an Ward-Perkins: »Am erstaunlichsten an dieser modernen Lesart der Geschichte ist die Geschwindigkeit, mit der das Römische Reich zusammenbrach. In nur fünf Jahrzehnten ging die Einwohnerzahl der Stadt Rom um drei Viertel zurück. Archäologische Zeugnisse aus dem späten 5. Jahrhundert – ärmlichere Wohnungen, primitivere Töpferwaren, weniger Münzen, kleinere Hausrinder – zeigen, dass der zivilisatorische Einfluss Roms im übrigen Westeuropa schnell verschwand. Was ein Historiker das ›Ende der Zivilisation‹ nannte, trat tatsächlich innerhalb einer einzigen Generation ein.« (430) Und genau jene Geschwindigkeit ist es, die dem Lauf der Geschichte eigen ist – ganz im Gegensatz zum historistischen Zeitbewusstsein des 19. Jahrhunderts, über das sich Nietzsche in seinem Aphorismus Die Tyrannen des Geistes (= Menschliches, Allzumenschliches I, § 261) mokiert: »Das ist das Stürmische und Unheimliche an der griechischen Geschichte. Jetzt zwar bewundert man das Evangelium der Schildkröte. Geschichtlich denken heisst jetzt fast so viel, als ob zu allen Zeiten nach dem Satz Geschichte gemacht worden wäre: ›möglichst wenig in möglichst langer Zeit!‹ Ach, die griechische Geschichte läuft so rasch! Es ist nie wieder so verschwenderisch, so maasslos gelebt worden. Ich kann mich nicht überzeugen, dass die Geschichte der Griechen jenen natürlichen Verlauf genommen habe, der an ihr gerühmt wird.« (KGW IV.2, 220) Und hätte Nietzsche, alles andere als ein Apokalyptiker, erst die Geschichte des 20. Jahrhunderts vor Augen gehabt, in dem Reiche, die den Anspruch erhoben, ihr Zeitalter zu überdauern, ja 1000 Jahre zu währen, ganze 12 bzw. 72 Jahre beschieden waren – geradezu biblische Zahlenmaße! Nichts scheint daher naheliegender als eine eschatologische Geschichtsdeutung, weshalb Ferguson in seinen Ausführungen auch auf die sog. Offenbarung des Johannes verweist, doch dabei lediglich auf die Endzeitvorstellungen evangelikaler Christen sowie (pseudo-)christlicher Sekten zu sprechen kommt.
Dass die zeitgenössische christliche Theologie außen vor bleibt, erscheint nicht weniger bemerkenswert, vermag freilich aus dem einfachen Grunde nicht zu überraschen, weil es über vereinzelte Bestandsaufnahmen hinaus eine theologische Deutung der Gegenwart nicht gibt, ja seit Generationen nicht einmal sonderlich erstrebenswert erscheint. »Nichts war ihr ferner als Erwartung einer Endzeit, ja auch nur eines Zeitenumschwungs« (GS I.1, 259), vermerkt Benjamin in seinem Trauerspielbuch zur Gegenreformation, während »der Moralismus des Luthertums« immer bestrebt gewesen sei, »die Transzendenz des Glaubenslebens an die Immanenz des täglichen zu binden« (ebd. 263). Erst unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs hat der Erlanger evangelische Theologe Walter Künneth ein beachtliches Werk vorgelegt: Der große Abfall. Eine geschichtstheologische Untersuchung der Begegnung zwischen Nationalsozialismus und Christentum [Hamburg 1947]. Allein der Untertitel grenzt ihren Gegenstand auf deren »Begegnung« ein, während in Anbetracht von Künneths Bestimmung des Nationalsozialismus als eines religiösen Phänomens ebenso das außerkirchliche Geschehen – zumal der Holocaust – auch in theologischer Hinsicht von Interesse gewesen wäre, wo doch im alttestamentlichen Buch Daniel dem Propheten bedeutet wird: »Und jetzt bin ich gekommen, um dich verstehen zu lassen, was deinem Volk in den letzten Tagen zustoßen wird. Denn auch diese Vision bezieht sich auf jene fernen Tage.« (Dan 10,14) Es sei jedoch angemerkt, dass sich in einer kleinen Schrift des großen jüdischen Gelehrten Leo Baeck aus dem gleichen Zeitraum mit dem Titel Der Sinn der Geschichte [Berlin 1946] ebenfalls kein Hinweis auf den Holocaust findet, obwohl sie von der Auffassung der Geschichte als »rückwärtsgewandte Prophetie« ausgeht.
Bereits in der Vorkriegszeit hat der katholische Theologe Georg Feuerer (1900–1940) ein schon dem Titel nach ekklesiologisch akzentuiertes Werk vorgelegt: Unsere Kirche im Kommen. Begegnung von Jetztzeit und Endzeit [Freiburg 1937], das immerhin 1941 posthum eine zweite Auflage erreichte. Obwohl die Arbeit des an multipler Sklerose erkrankten und früh verstorbenen Verfassers über weite Strecken eher den Charakter einer persönlichen religiösen Selbstvergewisserung besitzt denn einer wissenschaftlichen theologischen Abhandlung [er selbst spricht eingangs davon, dass er 1930 einen Grundriss schrieb, »um alles wieder zu verwerfen und Neues zu suchen«], gewährt sie tiefgründige und zuweilen höchst aktuelle Einblicke, etwa in »Das Geheimnis der Kirche«, im Abschnitt 18 des so überschriebenen Kapitels: »Die Kirche und das Böse«; und in dem Schlussabschnitt »Das endzeitliche Geheimnis der Kirche« findet sich folgende Feststellung: »Sie ist ständig umzittert von dem Kommen Gottes, und die Unruhe, die von der Kirche aus durch die Welt geht, ist nur ein letztes Zeichen des Kommens Christi, der Gewalt der Entscheidung für oder gegen ihn, die ständig in der Zeit gefordert wird. Alles ist eingetaucht in den Tod Christi, muß klein werden, muß untergehen vor dem Gericht, vor dem Kommen des herrlichen Christus in der Kirche. Alle Gnadenvermittlungen, alle Feste und Feiern der Kirche möchten ein stummes Zeichen sein für dieses Kommen. Auch die Apostel der Kirche sind nicht bloß Ausgesandte zur Missionierung der Welt, sie sind in erster Linie Vorboten seines Kommens.« (221) Gerät aber sein Kommen aus dem Blick, dann bleibt nicht nur der Missionsauftrag auf der Strecke und das Christentum erschöpft sich in einem allgemeinen »Christsein«. Vielmehr wird verkannt, was Feuerer unter dem Passus »Christus und die Vollendungsordnung« vermerkt: »Die Vollendungsordnung steht nicht neben der Schöpfungs- und Erlösungsordnung, sondern, tiefer gesehen, ist sie nur die tiefste werdende Schicht all dieser bestehenden Ordnungen. In Christus ist ein werdender Prozeß der Vollendung entgegen.« (41) Von daher wird verständlich, wenn etwa der Apostel Paulus in 1 Kor 10,4 den »lebensspendenden Felsen« der Wüstenwanderung der Israeliten auf Christus hin deutet: »uns zur Warnung wurde es aufgeschrieben, die das Ende der Zeiten erreicht hat.« (1 Kor 10,11) Denn wie es keinen Sinn ergibt, unter Abstraktion von der Schöpfungsordnung von Erlösung zu reden, so könnte von Erlösung ohne unsere Vollendung gar nicht die Rede sein. Wäre Christus nicht nach 1 Kor 15,20 »von den Toten auferweckt worden als der Erste der Entschlafenen«, also seine Auferstehung der Anfang unserer Vollendung, wie Paulus im Anschluss näher ausführt (vgl. 1 Kor 15,21–28), dann wäre die Zeit der Kirche eine leere Übergangszeit; von einem Kommen Christi, wie es in der Erwartung seiner Wiederkunft bzw. seines Reiches nahezu alle neutestamentlichen Schriften bezeugen, könnte man gar nicht sprechen.
Noch präziser als Feuerer hat der Theologe Erik Peterson (1890–1960) in seiner Römerbriefauslegung unterschieden, um die Zeit der Kirche als die Zeit der Vollendung hervorzuheben: »Die Hoffnung auf das Wiederkommen Christi ist etwas anderes als die Hoffnung auf das Kommen Christi. Die Hoffnung der Propheten eine andere als die Hoffnung der Kirche. Die Hoffnung der Propheten wartet auf die Erfüllung, die Hoffnung der Kirche auf die Vollendung.« (156) Im strengen Sinne gilt Petersons Unterscheidung freilich nur für die Erwartung eines Johannes des Täufers oder prophetischer Gestalten wie Simeon und Hanna, da die meisten prophetischen Schriften über die messianische Erwartung hinaus zugleich auf die Vollendung der Zeit verweisen [und daher auch in den apokalyptischen Texten des Neuen Testaments zitiert werden], wie auch das Neue Testament bisweilen im Hinblick auf die Wiederkunft Christi von einem Kommen spricht [vgl. 1 Thess 5,23; Offb 22,7;12]. Gleichwohl gilt Jesu Wort: »Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um, und glaubt an das Evangelium.« (Mk 1,15)
Denn mit der Erfüllung der Zeit setzt der Prozess der Vollendung ein, und zwar unabhängig vom Wann, also vom Zeitpunkt der Wiederkunft Christi, der ohnehin außerhalb unseres Ermessens liegt. Zwar ist schon durch seine erste Ankunft das Reich Gottes »nahe«, ja in seinem messianischen Wirken »ist das Reich Gottes zu euch gekommen« (vgl. Mt 12,28); aber seine Nähe, seine Gegenwart ist Mysterium, unterliegt dem Geheimnis des Kreuzes, weshalb Christus den Jüngern nach dem Messiasbekenntnis des Petrus verbietet, »mit jemand über ihn zu sprechen« (vgl. Mk 8,30). Bezeichnenderweise folgt nach seinem Verbot die erste Ankündigung von Leiden und Auferstehung, anschließend der Aufruf zur Nachfolge und Selbstverleugnung.
Nur ein einziges Mal wird das Geheimnis gewissermaßen »gelüftet«, wird einigen Jüngern gleichsam wie durch ein Schlüsselloch Ausblick auf den Zustand der Vollendung gewährt: »Amen, ich sage euch: Von denen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht erleiden, bis sie gesehen haben, dass das Reich Gottes in Macht gekommen ist.« (Mk 9,1) Oder wie es in der Parallelstelle Mt 16,28 heißt: »… bis sie den Menschensohn in seiner königlichen Macht kommen sehen.« Gemeint ist die Verklärung Jesu »sechs Tage danach« (Mt 17,1; Mk 9,2), als Jesus Petrus, Johannes und Jakobus beiseitenahm und auf einen hohen Berg, auf den Tabor, führte. Denn nicht nur folgt die Verklärungsszene auf jenes Wort Jesu, auch die Kirchenväter haben es darauf bezogen. Vermutet man dagegen hinter jener Aussage eine »Naherwartung« Jesu, so ergäbe es schon deshalb keinen Sinn, weil Jakobus und Petrus, die Zeugen seiner Auferstehung, das Martyrium erlitten haben. Daher sein Gebot nach dem Abstieg von dem Berg, niemandem etwas »zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Dieses Wort beschäftigte sie, und sie fragten einander, was das sei: von den Toten auferstehen.« (Mk 8,9–10)
Denn erst im Lichte der Auferstehung des Menschensohns kann es eine Hoffnung auf Vollendung geben, die sich den Jüngern entzog, solange noch Jesus unter ihnen weilte; nach dem Lukasevangelium gar entbrannte unter ihnen noch im Abendmahlssaal ein Streit, wer unter ihnen der Größte sei (vgl. Lk 22,24–27). Die Teilhabe an der messianischen Herrschaft auf Erden, nicht aber das Kreuz Christi markierte für sie das Ende seines Weges, während das Wort von der Auferstehung ihnen so rätselhaft bleiben musste wie die Endzeitreden Jesu, die seiner Passion vorausgehen. Schon allein daraus wird ersichtlich: Wenn schon den Jüngern Jesu, denen es immerhin gegeben ist, »die Geheimnisse des Reiches Gottes« (vgl. Lk 8,10) bzw. »des Himmelreichs zu erkennen« (vgl. Mt 13,11), ja in Mk 4,11 heißt es gar: »Euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes anvertraut« – wenn schon sie vor seiner Auferstehung nicht zu erfassen vermögen, was es mit dieser und mit seinem Kommen in Herrlichkeit auf sich hat, dann kann es keinerlei historische Bestimmung des Messianischen vorbei an dessen göttlicher Bekundung geben: »Das ist mein geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören.« (Mk 9,7; vgl. Mt 17,5; Lk 9,35)
Denn es gehört zu den Verirrungen und Verwirrungen einer historistischen Bibelexegese seit dem 19. Jahrhundert, vom Historischen aus zu einer Bestimmung des Messianischen, d. h. des Wesens und Wirkens des Messias und des Kommen seines Reiches, zu gelangen. Dass es sich hierbei ausschließlich um eine Prärogative des Menschensohns, des Messias handelt, hat nicht etwa ein christlicher Theologe, sondern – gewissermaßen vor jedem christologischen Dogma – ein säkularisierter jüdischer Denker zum Ausdruck gebracht. Und zwar leitet Walter Benjamin (1892–1940) sein Theologisch-politisches Fragment aus dem Zeitraum 1920/21, also aus dem Erscheinungsjahr von Franz Rosenzweigs Stern der Erlösung, mit den Worten ein: »Erst der Messias selbst vollendet alles historische Geschehen, und zwar in dem Sinne, daß er dessen Beziehung auf das Messianische selbst erst erlöst, vollendet, schafft.« (GS II.1, 203) D. h., er vollendet nicht nur »alles historische Geschehen« durch seine Wiederkunft, sondern Er ist es, der »dessen Beziehung auf das Messianische selbst erst erlöst, vollendet, schafft«. Christlich gesprochen, durch sein Kreuz und sein Gnadenwirken ebenso wie durch seine eschatologische Herrschaft über die Mächte der Endzeit. D. h., wir können nicht aus einem historischen Blickwinkel das Wesen des Messianischen bestimmen, weil alles Historische das Messianische – christlich betrachtet: die Erfüllung der Zeit – voraussetzt. Andernfalls unterschiede sich der Messias in keiner Weise von einer beliebigen historischen Gestalt. »Darum kann nichts Historisches von sich aus sich auf Messianisches beziehen wollen. Darum ist das Reich Gottes nicht das Telos der historischen Dynamis; es kann nicht zum Ziel gesetzt werden. Historisch gesehen ist es nicht Ziel, sondern Ende.« (Ebd.) Ende aber ist es aus christlicher Sicht im Spannungsbogen zwischen Erfüllung und Vollendung der Zeit; zwischen erster und zweiter Ankunft des Menschensohns, in der das Reich Gottes »mit Macht« hereinbricht, wie es im Vaterunser tagtäglich erbeten wird: »Dein Reich komme.«
Genau hier aber liegt ein, wenn nicht der Grund für die derzeitige Krise des Christentums in der westlichen Welt. Dürfte doch selbst unter gläubigen Christen, sooft sie das Vaterunser beten, dessen – immerhin zweite [!] – Bitte kaum wirklich erhofft, erbeten sein. Gewiss, welcher ernsthafte Beter möchte schon nicht angesichts des Todes in das Himmelreich kommen. Aber die Bitte: »Dein Reich komme!«, die ja nicht weniger als die Vollendung der Zeit einschließt, möchte man doch lieber nicht gar so wörtlich nehmen, weil sie unserer »Weltverpflichtung« zu widersprechen scheint, obwohl nirgendwo im Neuen Testament wie auch in der kirchlichen Überlieferung die Welt den theologischen terminus ad quem abgibt, sondern – das Reich Gottes bzw. das Evangelium vom Reiche Gottes, dessen Erbe Christus denen verheißen hat, die Ihm in den »Geringsten« Ehre erwiesen haben. »Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen: Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist.« (Mt 25,34) Seit der Erschaffung der Welt – spätestens hier, in Jesu großartigem Gleichnis vom Weltgericht, zeichnet sich ab, wie Schöpfung, Erlösung und Vollendung zusammengehören, wie ja schon die Erlösung eine Neuschöpfung bedeutet, die wie die Schöpfung selbst – »denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt« (Röm 8,22) – am Jüngsten Tag zur Vollendung gelangt.
Dass es sich hierbei keineswegs um eine rein interne Glaubensfrage handelt, die dem profanen Zeitgenossen nichts anginge, mag aus den hier wie in den Eingangskapiteln angeführten theologischen Überlegungen des Philosophen Walter Benjamin hervorgehen, dem wir entscheidende theologische Einsichten in die Moderne verdanken, zumal in den Zeitraum zwischen 1910 und 1940, eine außerordentlich fruchtbare wie äußerst furchtbare Zeit, die im Geschehen der kommenden Kriegsjahre ihre volle Bestätigung finden sollte, obwohl wir in Messianität und Geschichte (Akademie Verlag, Berlin 1995) die Aporien seines Geschichtsbegriffs aufgewiesen haben. War doch Benjamin bis in das Projekt über die Pariser Passagen, seine »Urgeschichte der Moderne«, geradezu süchtig der urbanen Welt des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, zumal dem Paris eines Baudelaire und Proust, verhaftet. Erst der heraufziehende Krieg hat ihn auf seine frühere »theologische Gedankenmasse« zurückkommen lassen; so in den als sein Vermächtnis bezeichneten Thesen Zum Begriff der Geschichte – in »Gedanken«, wie er in einem Brief an Gretel Adorno vom April 1940 vermerkt, »von denen ich sagen kann, daß ich sie an die zwanzig Jahre bei mir verwahrt, ja, verwahrt vor mir selber gehalten habe« (vgl. GS I.3, 1226). Da heißt es zunächst abschließend zu These VI, in jeder Epoche müsse »versucht werden, die Überlieferung von neuem dem Konformismus abzugewinnen, der im Begriff steht, sie zu überwältigen«. Der Konformismus aber ist nichts anderes als der jeweils herrschende Zeitgeist, der sie zu adaptieren, ganz in seinem Sinne zu glätten sucht. Doch nicht allein um eine intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Zeitgeist handelt es sich, der seine Gestalt von Epoche zu Epoche wechseln mag – es geht buchstäblich um Leben und Tod. Und zwar nicht um ein Überleben der Überlieferung, ja nicht einmal der Menschen im Sinne ihrer Selbstbehauptung, sondern selbst um die Toten – um »die Hoffnung gegen alle Hoffnung« (vgl. Röm 4,18). Benjamin verlangt sie nun nicht dem Glaubenszeugen, dem Märtyrer, ab, ja nicht einmal dem Theologen, sondern dem Geschichtsschreiber: »Der Messias kommt ja nicht nur als der Erlöser; er kommt als der Überwinder des Antichrist. Nur dem Geschichtsschreiber wohnt die Gabe bei, im Vergangenen den Funken der Hoffnung anzufachen, der davon durchdrungen ist: auch die Toten werden vor dem Feind, wenn er siegt, nicht sicher sein. Und dieser Feind hat zu siegen nicht aufgehört.« (GS I.2, 695)
Wenn man bedenkt, dass diese Zeilen erst zu Beginn des Krieges geschrieben wurden, also vor Auschwitz, dann muss dem Letzten, der sich noch ein wenig theologisches Gespür bewahrt hat, dämmern, was es bedeutet: »Der Messias kommt ja nicht nur als der Erlöser; er kommt als der Überwinder des Antichrist.« Eine christliche Theologie, die das verkennt oder verleugnet, verleugnet nicht nur ihre eigene Überlieferung; sie begibt sich vielmehr jeder theologischen Deutung der Wirklichkeit, und zwar nicht allein des Zeitgeschehens, sondern buchstäblich des »Seinsgeschehens«. Denn darum dreht sich das in jenen Jahren entstandene sog. zweite Hauptwerk Heideggers, seine sog. »Kehre«: Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), das erst posthum 1989, anlässlich seines 100. Geburtstags, erschienen ist. Nicht zuletzt Heidegger gegenüber haben wir uns folgende »Methodenanweisung« aus Benjamins Passagen-Werk zu eigen gemacht: »Sich immer wieder klarmachen, wie der Kommentar zu einer Wirklichkeit (…) eine ganz andere Methode verlangt als der zu einem Text. In einem Fall ist Theologie, im andern Philologie die Grundwissenschaft.« (GS V.1, 574) Damit ist weit mehr als nur eine Methode angesprochen. Was der Wirklichkeitsbezug der Theologie bedeutet, mag das dritte Kapitel dieser Abhandlung zeigen, wo es um Heideggers Deutung des Seinsgeschehens geht, in dem er gegenüber der metaphysischen Geistestradition das Sein als Möglichkeit fasst. Und zwar nicht als eine, sondern als die Möglichkeit nicht etwa menschlicher Selbstverabsolutierung, sondern Selbstübersteigerung, die in der Verherrlichung des Todes kulminiert: »Der Tod das höchste und äußerste Zeugnis des Seyns«. Nie hat in der Philosophie – über alle weltanschaulichen oder ideologischen Verengungen hinaus – die Macht des Todes eine derartige Affirmation erfahren; ist dem Reich des Antichristen mit dem »Reich des Fragwürdigsten« ein beredteres Denkmal gesetzt worden. Gewiss, jene »Möglichkeit« hat es seit dem Sündenfall gegeben. Aber dass sich einer, der einmal mit einer Arbeit über Die Kategorien- und Bedeutungslehre des Duns Scotus (1916) habilitiert worden ist [da dessen Sprachlehre in der betreffenden Arbeit unbearbeitet geblieben sei, trug sich Benjamin damals pikanterweise mit dem Gedanken, sich darüber zu habilitieren …], nicht allein über die Lehre des Doctor subtilis der scholastischen Philosophie hinwegsetzt, sondern gleich seinen eigenen »letzten Gott« erfindet, bezeugt den Abfall vom Gott der Offenbarung – einen Abfall, der über Heidegger hinaus nicht allein das Denken, sondern buchstäblich das »Seinsgeschehen« des 20. Jahrhunderts weithin bestimmen sollte.
Wenn wir entgegen unserer ursprünglichen Absicht hier noch einmal auf Heidegger rekurrieren, so nicht nur deshalb, weil sich in seinem »Reich des Fragwürdigsten« gewissermaßen das Gegenreich zum Reich Gottes auftut. Ebenso im Hinblick auf Edith Stein, deren Kreuzesliebe. Einige Gedanken zum Fest des hl. Vaters Johannes vom Kreuz vom 24. November 1933 [nach der Liturgiereform ist das betreffende Fest auf den 14. Dezember verlegt] eine programmatische Bedeutung für ihr Glaubenszeugnis gewinnen sollte. Die folgende Konstellation erscheint nicht allein in geistesgeschichtlicher Hinsicht bemerkenswert: Martin Heidegger, ehedem Assistent Edmund Husserls, aus einer gut-katholischen Familie stammend, bricht mit dem überlieferten Glauben, um einer Philosophie des Todes und des Untergangs das Wort zu reden. Darin ist er für ganze Generationen von Intellektuellen bestimmend geworden, mochten sie auch sein nationalsozialistisches Engagement missbilligen. Noch kürzlich hat ihm der Komparatist Georges Steiner in seinem Buch Gedanken dichten [Berlin 2011] als den modernen Denker geehrt, der Denken und Dichten zusammengebracht habe. – Edith Stein, auch sie vormals Assistentin Husserls, aus einer jüdischen Familie stammend, findet vom Atheismus zum katholischen Glauben. Außergewöhnlich, wie sich bei ihr der Gedanke des Kreuzesmysteriums und das Leben aus dem Kreuzesmysterium bis hin zum Martyrium in Auschwitz deckt; außergewöhnlich auch die Entsprechung der christologischen und der eschatologischen Dimension des christlichen Glaubens in ihrem Leben und Denken. Selbst wenn hier nur einige geistliche Texte zur Sprache kommen, zeichnet sich in ihnen eine Deutung nicht zuletzt der jüngsten Geschichte im Licht der messianischen Offenbarung ab, während Heidegger dem »Spiel des Abgründigen« huldigt, dem sich seine Philosophie verschrieben hat. Man mag in jenem Wort eine poetische Metapher erblicken, obschon es Die Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) enthalten [wo es an entscheidender Stelle steht, wie noch zu zeigen sein wird]. Man kann jedoch auch im Versuch einer Literarisierung alles Sinnes, wie er sich in der westlichen Kultur im Zuge der Verbreitung von Hermeneutik und Kontextualismus seit dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts durchgesetzt hat, in Abwandlung eines Celan-Wortes ein »Metapherngestöber« sehen, das die Einsicht in die Wirklichkeit, in die Wahrheit wie in das Unwesen des Geschehenen, verdunkelt: »Orkane. / Orkane, von je, / Partikelgestöber, das andre, / du / weißts ja, wir / lasens im Buche, war / Meinung.« (Die Gedichte, 115) So lautet eine Strophe in Engführung, dem wohl bedeutendsten Gedicht zur Shoah. Was sich aber hinter dem Allerweltswort »Meinung« verbirgt, hat bereits im Jahrhundert zuvor Kierkegaard in seiner Rede An einem Grab zum Ausdruck gebracht: »Man kann eine Meinung haben über ferne Begebenheiten, über einen Naturgegenstand, über die Natur, über gelehrte Schriften, über einen anderen Menschen, und so über vieles andere, und wenn man diese Meinung äußert, kann der Weise entscheiden, ob sie richtig ist oder unrichtig. Dagegen bemüht keiner den Meinenden damit, die andere Seite der Wahrheit zu betrachten, ob man nun wirklich die Meinung hat, ob sie nicht etwas ist, das man bloß hersagt. Und doch ist diese andere Seite ebenso wichtig, denn nicht allein der ist ja geisteskrank, der das Sinnlose sagt, sondern ebensosehr der, welcher eine richtige Meinung sagt, wenn diese doch ganz und gar keine Bedeutung für ihn hat.« (Religiöse Reden, 170) Ohne es zu wissen, hat Kierkegaard die Pathologie dessen beim Namen genannt, was wir heute Relativismus nennen: ein Sichverstecken hinter Meinungen und Metaphern, um nicht für das einmal Gesagte zur Rechenschaft gezogen werden zu können. Denken und Dichten, Dichten und Denken – alles gerät zur poetischen Verflüchtigung der Wahrheit, in der Verleugnung des Logos, wie übrigens Heidegger vor der betreffenden Stelle dem Logos entsagt und »das Sagen in die Zweideutigkeit der Aussage hineingerissen« werde [wir kommen darauf unten zurück]. Und so kann einer, nachdem er mit einer kaum zu überbietenden Kälte Tod und Untergang beschwor, nach dem geschehenen Untergang zurückrudern, ganz so sei es nun auch wieder nicht gemeint gewesen, und einen Humanismusbrief schreiben, um sich in der ehrenwerten Gesellschaft der großen Denker und Dichter wiederzufinden; selbst der zeitlebens gebrochene Celan wird, um dem Jahrhundertphilosophen seine Reverenz zu erweisen, zum Todtnauberg pilgern. Darin liegt die Zweideutigkeit einer Moderne beschlossen, die in Wahrheit keine Wahrheit kennt.
Es sei mit Nachdruck betont, dass hier von einer und nicht etwa verallgemeinernd von der Moderne die Rede ist. Das Problem hat bereits vor einem halben Jahrhundert Alois Grillmeier in seinem Münchener Vortrag Die Herrlichkeit Gottes auf dem Antlitz Jesu Christi. Zur Bild-Theologie der Väterzeit (1963) umrissen, der in erweiterter Fassung sein Buch Mit ihm und in ihm. Christologische Forschungen und Perspektiven (Freiburg i. Br. 1975) eröffnet, und zwar mit folgender Feststellung: »Ein Gespräch zwischen Künstlern und Theologen kann – über alle persönlichen Kontakte hinaus – in dem Maße zu gegenseitiger Anregung führen, als sich eine feste Brücke zwischen christlicher Kunst und Theologie schlagen läßt. Beiden kommt wohl die Notwendigkeit eines solchen Brückenschlages heute in gesteigerter Dringlichkeit zum Bewußtsein. Der gläubige Künstler fühlt mehr und mehr die Spannung zwischen den modernen Kunstrichtungen und dem religiösen Bildgehalt, den er darstellen soll. Er kann auch mit der ausschließlich zur Herrschaft gekommenen formalästhetischen Betrachtung des Bildes oder Bildwerkes nicht mehr zufrieden sein und muß eine philosophisch und theologisch unterbaute Bildtheorie fordern. Der Theologe aber – um vom Philosophen zu schweigen – muß verlegen gestehen, daß eine moderne Theologie des Bildes noch nicht erarbeitet ist.« Diesem Manko haben wir abgeholfen in Kreuz und Kairos. Eine eucharistische Grundlegung des Christusdogmas (Würzburg 2005), zunächst in Anlehnung an Grillmeiers Abhandlung Der Logos am Kreuz. Zur christologischen Symbolik der älteren Kreuzigungsdarstellung (München 1956), von der er später einige Kapitel in Die Herrlichkeit Gottes auf dem Antlitz Jesu Christi eingebaut hat. Doch sind wir nicht wie Grillmeier von Spätantike und Frühmittelalter ausgegangen, sondern von der Moderne – so im abschließenden Teil »III. Kreuz und Kairos: Drei Annäherungen: 1. Barnett Newman: Fourteen Stations of the Cross. Lema Sabachthani – eine Deklaration; 2. Miloslav Čelakovský: Kreuzesdarstellung (ohne Titel) – Versiegelung Christi; 3. Paul Klee: Das Lamm – die Entsiegelung Christi«. Kein Zufall, dass Newman, ein säkularisierter New Yorker Jude, der nach einer schweren Schaffens- und Gesundheitskrise seinen Kreuzweg malte, den antinominalistischen Charakter seiner Kunst betont. Denn dass die moderne Kunst subjektivistisch sei, wie Karl Barth empfand [wir kommen gleich darauf zurück], ist ein Vorurteil. Vielmehr ist die subjektive Reduktion, die reductio ad hominem, ein Wesenszug der neuzeitlichen Kunst und Philosophie; man könnte in der ästhetischen Moderne, von eher zweitrangigen Kunstwerken einmal abgesehen, wie auch in der modernen Philosophie – man denke an Wittgenstein – eher eine Umkehrung jener Reduktion im Zuge der sog. anthropologischen Wende der Neuzeit sehen. In diesem Sinne werden wir im Schlusskapitel dieses Buches, ausgehend von einschlägigen Überlegungen Edith Steins zum Begriff des Gehorsams sowie eigenen zur »Herrlichkeit Gottes auf dem Antlitz Jesu Christi« nach 2 Kor 3,4–4,6, zu einer theologischen Bestimmung des Begriffes Reich Gottes zu kommen suchen. Den Schlüssel zu einer theologischen Bildtheorie der Moderne lieferte freilich weniger die Christologie als vielmehr die Eschatologie, die Konstellation von Moderne und Apokalypse, wie sie Benjamin etwa in seinen Aufzeichnungen zum Passagen-Werk verzeichnet. Weit mehr als in der Bilderwelt des 19. Jahrhunderts, dem Benjamins Interesse in erster Linie gilt, hat jene Konstellation zwischen beiden Kriegen ihre Bestätigung erfahren und ihren Niederschlag vor allem in den Werken der »drei großen K« – Kraus, Kafka und Klee – gefunden, denen wir einen kleinen Exkurs widmen, und zwar nicht, weil ihre Namen in eine Hagiographie gehörten; viel zu widersprüchlich bzw. zu einseitig ihrer Kunst verpflichtet erscheint ihr Leben, als dass von ihm ein besonderes Licht ausginge. Vielmehr fällt das Licht der Offenbarung auf ihr Werk, in dem jedes auf seine Weise die finstersten Abgründe unserer Zeit erhellt; insofern buchstäblich ein Stück Apokalypsis (= Enthüllung, Offenbarung) verkörpert. Man könnte jene Namen durchaus um weitere ergänzen. So hat der frühe Chagall in La caduta dell’angelo (Der Sturz/Fall des Engels) [Öl auf Leinwand, 1923–1933–1947] mit den entsprechenden Variationen aus den Jahren 1933/34 ein Epochenbild geschaffen. Dann wäre Olivier Messiaen (1908–1992) zu nennen, dessen Quartett auf das Ende der Zeit mit dem wunderbaren Schlusssatz 1940 in deutscher Kriegsgefangenschaft entstand; auch spätere Kompositionen wie für Holz- und Blechbläser mit Schlagzeug Et exspecto resurrectionem mortuorum (1964). Auch eine zeitgenössische Komponistin wie Sofia Gubaidulina, auf deren Johannes-Passion wir kurz eingehen. Und nicht zuletzt Galina Ustwolskaja (1919–2006), über Messiaen hinaus die einzige Komponistin, der die Vertonung der Apokalypse gelungen ist, so in der Komposition Nr. 1 »Dona nobis pacem« (1972), in der Komposition Nr. 2 »Dies irae« (1972/73), Komposition Nr. 3 »Benedictus, qui venit« (1974/75), Sinfonie Nr. 2 » wahre, ewige Seligkeit!« (1979), Sinfonie Nr. 3 »Jesus Messias, errette uns!« (1983), einer Anrufung, die in Sinfonie Nr. 4 (1985/87) wie zuvor mit knappen Worten von Hermann dem Lahmen (Hermannus contractus, 1013–1054) untermauert wird. Schließlich in Sinfonie Nr. 5 »Amen« die Vertonung des Vaterunsers.
Verständlich, dass sich einer hedonistisch gestimmten (Post-)Moderne der theologische Gehalt einer Musik nicht erschließt, deren unaufhörliches procedendo den Eindruck vermittelt, als ob ein Engelsheer ganze Panzerarmeen niederwalzte. So vermerkt jüngst die Musikwissenschaftlerin Anja Städtler in ihrem Essay Kunst und Ethik. Spiritualität als Grundlage des Schaffens bei Komponistinnen und Komponisten aus dem Osten Europas (Sonderbeilage der NZZ zum Lucerne Festival Sommer 2012 unter dem Thema »Glaube« [9. August 2012], 3) anlässlich der Aussage der Komponistin »Meine Musik ist geistig, aber nicht religiös«, damit bringe sie »zum Ausdruck, dass sie ihre Kunst als individuelle Angelegenheit und individuellen Schöpfungsakt verstanden wissen will, der einen spirituellen Hintergrund hat, aber nicht mit traditionellen, kirchlichen Formen und Ritualen gleichgesetzt werden soll«. Zunächst ist dazu anzumerken, dass jegliche große Musik, auch tiefreligiöse, auf einem »individuellen Schöpfungsakt« beruht, und zwar aus dem rein theologischen Grund, weil jedwedes Charisma einem Einzelnen, also einem Individuum zugeteilt wird, auch wenn das daraus resultierende Wirken der Allgemeinheit dient. [Ein Pianist etwa, der zeitlebens nur für sich spielte, wäre eine ähnlich absurde Figur wie ein Beter, der lediglich für sich betete.] Außerdem lautet das Zitat genau: »Meine Werke sind zwar nicht religiös im liturgischen Sinne, aber vom religiösen Geist erfüllt, und – wie ich es empfinde – sie würden am besten in einem Kirchenraum erklingen, ohne wissenschaftliche Einführungen und Analysen. Im Konzertsaal, also in ›weltlicher‹ Umgebung klingen sie anders …« (Galina Ustwolskaja, Musikverlag Hans Sikorski, Hamburg 2006, 7). Allein ein Blick auf die oben genannten Titel zeugt von dem religiösen, ja hochtheologischen Charakter ihrer Musik. Dass sich bei deren Aufführung Galina Ustwolskaja »wissenschaftliche Einführungen und Analysen« verbeten hat, liegt auf der Hand in Anbetracht der massiven Unkenntnis des Liturgischen unter einigen Musikwissenschaftlern: Nicht nur würde ihr Benedictus aufgrund seiner Überlänge in keinem Sanctus aufgehen; vielmehr verweist Viktor Suslin in seinem Vorwort auf den Komponisten Boris Tischtschenko, auf dessen Vergleich der »›Dichte‹ ihres Stils mit dem gebündelten Licht des Laserstrahls, der in der Lage ist, Metall zu durchdringen« (vgl. ebd. 6). M. a. W., die Gemeinde wäre bei dem anschließenden eucharistischen Hochgebet, dem Höhepunkt der gesamten Liturgie, so verstört, dass so etwas wie eine innere Sammlung gar nicht zu denken wäre; ganz abgesehen davon, dass nach dem neueren Liturgieverständnis der katholischen Kirche die Gemeinde zu einer participatio actuosa, also zu einer aktiven Mitfeier der Liturgie, gehalten ist. Was schließlich die orthodoxe Liturgie betrifft, so beruht deren Gestaltung auf dem Chorgesang, den Ustwolskajas Musik so wenig kennt wie jene die Instrumentalmusik.
Allerdings hat auch die neuere Theologie kaum ein Verhältnis zur Moderne noch zur ureigenen neutestamentlichen Eschatologie gefunden. Bezeichnenderweise blieb in Karl Barths Dogmatik die Eschatologie ungeschrieben. »Sicher sei nur, dass er sie unter den Titel der ›Apokalypsis‹ stellen würde.« Und es klingt wie ein Treppenwitz der Geschichte, wenn Barth anschließend gegenüber seinem letzten Assistenten Eberhard Busch, der nach ihr fragte, bekennt: »Wenn der Hitler nicht dazwischen getreten wäre und ihn so lange in Atem gehalten hätte, dann wäre er vielleicht noch mit der Dogmatik fertig geworden.« (Busch, Meine Zeit mit Karl Barth, 444) Dabei hätte jene Zeit nicht nur reichlich Anschauungsunterricht für seine »Apokalypsis« geboten. Vielmehr entsprach sie der Apokalypsis, wie sie in Klees Bilderwelt und in Kafkas Schriften zum Ausdruck gelangt. Nicht nur dass Barth vor Kafkas Schloss-Fragment kapituliert (vgl. ebd. 512). »Er verstehe diese moderne Kunst einfach nicht« (ebd. 402). Denn »die modernen Gedichte, die er durchweg nicht mag, die modernen Bilder und Musikstücke, das alles sei anscheinend zu verstehen als ein endloses Sichausbreiten und Sichernstnehmen einer individualistischen Subjektivität.« Wäre dem so, so könnte bereits von ihr im Hinblick auf die Genieästhetik der Vormoderne die Rede sein. Doch um bei der modernen Prosa zu verbleiben – allein hier wird die individuelle Erfahrungswelt auf das Kommende hin überschritten. Kaum zufällig setzt Adalbert Stifters letzte Erzählung Aus dem bairischen Walde nach einem langgezogenen Spätsommer (»Der October war so sonnig und warm, wie ich selten einen erlebt hatte«) mit einem fulminanten Wintereinbruch ein, so dass »achtzigjährige Männer sagten, daß sie das nie erlebt hätten«. Und der Erzähler scheint über die Jahrhundertschwelle hinwegzuschauen, wenn er konstatiert: »Man konnte nur das Toben anschauen und hatte keine Ahnung, wohin das führen werde.« (Vgl. Sämtliche Erzählungen Bd. II, 1526 ff.) Wo Stifter endet, da beginnt Kafkas Schloss-Fragment mit den Worten: »Es war spät abends, als K. ankam. Das Dorf lag in tiefem Schnee. Vom Schloßberg war nichts zu sehen, Nebel und Finsternis umgaben ihn, auch nicht der schwächste Lichtschein deutete das große Schloß an.« Nicht etwa Europas Landkarte sollte Kafkas Landvermesser neu vermessen; das war kurz zuvor in Versailles und Trianon geschehen. Sondern »das Reich des Fragwürdigsten«, das Reich des Todes, von dem Heideggers Philosophie Zeugnis ablegt: »die verborgene Geschichte der großen Stille«, die sich bald über Europa herabsenken wird. Von ihr zeugt nicht allein die große Literatur der Moderne, mehr noch die Musik in der »Detonation des Schweigens«, wie es im musikalischen Schaffen Galina Ustwolskajas zum Ausdruck gelangt, und zwar durch einen doppelten Bruch und die daraus resultierende persönliche Isolation bestimmt: einmal durch den Bruch mit ihrem Lehrer Schostakowitsch, dessen Heiratsantrag sie empört zurückwies; dann durch ein mehrjähriges Schweigen infolge des mysteriösen Todes eines befreundeten Komponisten Anfang der sechziger Jahre. Dass sie danach nicht einfach ihre frühere, durchaus eigenständige Kompositionsweise fortsetzte oder gar aus einer inneren Trauer heraus der schwermütigen Musik des von ihr verehrten Schubert nacheiferte, liegt auf der Hand: Nach der Niederschlagung des Prager Frühlings im Jahre 1968 schien die Sowjetherrschaft nach innen wie außen auf unabsehbare Zeit so gefestigt und die politische Eiszeit im sog. Kalten Krieg auf ihren Höhepunkt gelangt, dass es letzthin nur die Wahl gab zwischen einer resignierenden Unterwerfung bzw. einem melancholischen Rückzug ins eigene Innere oder aber einem Voran, ebenjenem Ton eines unablässigen procedendo, den ihre Kompositionen im Geiste der christlichen Apokalyptik in den folgenden Jahren anschlagen werden, um den zerstörerischen Mächten ihrer Zeit den Untergang, den Dies Irae, zu verkünden. Dass es sich hierbei nicht um Kirchenmusik im herkömmlichen Sinne handelt, liegt auf der Hand: Keine Glocken können so laut läuten, kein Chor so laut singen und keine Orgelregister gezogen werden, wie jene Cluster auf dem Klavier ertönen, wie jene Pauken- und Posaunenklänge oder Sirenenklänge der Streicher, die das Nahen des Gerichts bzw. das Benedictus dessen, der da kommt, ankündigen. Denn anders als ein fader christlicher Humanismus, der seinen Frieden mit der Welt geschlossen hat, in unseren Tagen glaubt, hat die Apokalypse nur zu fürchten, wer das Gericht zu fürchten hat; nicht umsonst heißt es schon bei dem Propheten Jesaja: »Denn dein Gericht ist ein Licht für die Welt, / die Bewohner der Erde lernen deine Gerechtigkeit kennen.« (Jes 26,9b) Und wie eine Antwort auf die Komposition Nr. 1 »Dona nobis pacem« kurz darauf: »Herr, du wirst uns Frieden schenken; denn alles, was wir bisher erreichten, hast du für uns getan.« (Jes 26,12) Daher kennt Ustwolskajas Musik Phasen der Stille wie kaum eine andere; ja alle Kompositionen enden nicht in einem Klangchaos oder münden einer klassischen Sinfonie gleich in ein dramatisches Finale, sondern in ein Schweigen, das der Erwartung des Kommenden Raum gibt; der Erwartung Dessen, der das Werk der Erlösung vollendet.
Deshalb begrüßt auch der heilige Johannes in seiner brieflichen Einleitung zur Apokalypse die sieben Gemeinden in der Provinz Asien: »Gnade sei mit euch und Friede von Ihm, der ist und der war und der kommt« (Offb 1,4), weil es für Christen keinen anderen Frieden geben kann als von dem kommenden Gott her, mögen sie noch so sehr dazu neigen, mit ihrer Welt, mit ihrer Zeit Frieden zu schließen und das Kommen ihres Gottes in dieser Zeit zu übersehen. Denn mochte es für eine Galina Ustwolskaja noch so aussichtslos erscheinen, in jenen Jahren an der Arbeit an ihren apokalyptisch akzentuierten Kompositionen auf einen politischen oder gesellschaftlichen Wandel zu hoffen; ja trennte einen Karl Kraus, als er 1908 Apokalypse (Offener Brief an das Publikum) schrieb, nur wenige Jahre von dem Ersten Weltkrieg – eines sollte sich nicht allein der Christ vor Augen führen, wenn er auf die letzten hundert Jahre zurückblickt, in denen mehr Leid angehäuft worden ist als je zuvor in der Geschichte: Nahezu alle Weltmächte sind seitdem verschwunden oder gewissermaßen auf ihr Normalmaß zurückgestutzt worden: zunächst Preußen und Österreich-Ungarn, später das Britische Empire und die Kolonialmächte, das Italien Mussolinis und das Tausendjährige Reich Hitlers, zuletzt die Sowjetunion; und die noch vor 20 Jahren als »unilaterale« Weltmacht dastehenden Vereinigten Staaten von Amerika versinken im Schuldensumpf, aus dem auch das neue Europa kaum hinausfindet; schließlich dürfte kaum jemand auf die aufstrebende Wirtschaftsmacht China Wetten abschließen, die einmal dort stehen könnte, wo sich das in den achtziger Jahren aufstrebende Japan heute befindet. – Wie sich aber nach dem alttestamentlichen Buch Daniel in des Propheten Auslegung von Nebukadnezzars Traum von den Weltreichen ein kleiner Stein von einem Abhang löst und das große, im Traum geschaute Standbild, den Inbegriff aller Weltreiche, vernichtet, so entfaltet das Reich Gottes, so unscheinbar es wirken mag, seine Kraft durch die Geschichte: »Zur Zeit jener Könige wird aber der Gott des Himmels ein Reich errichten, das in Ewigkeit nicht untergeht; dieses Reich wird er keinem anderen Volk überlassen. Es wird all jene Reiche zermalmen und endgültig vernichten; es selbst aber wird in alle Ewigkeit bestehen. Du hast ja gesehen, dass ohne Zutun von Menschenhand ein Stein vom Berg losbrach und Eisen, Bronze und Ton, Silber und Gold zermalmte. Der große Gott hat den König einst wissen lassen, was dereinst geschehen wird. Der Traum ist sicher und die Deutung ist zuverlässig.« (Dan 2,44 f.) Bis in unsere Zeit hat sie ihre Bestätigung erfahren, mögen sich jene Reiche auch heutzutage mit Stahl vergleichen oder ihr Gewicht mit Dollarnoten oder Derivaten aufzuwiegen suchen, die am Ende nicht einmal das Papier wert sind.
In der Verkennung des Kommens Gottes bzw. des Reiches Gottes liegt die eigentliche Schwäche einer Christenheit, die sich, um zu überdauern, in der Vergangenheit der Protektion historischer Mächte unterstellte, in neuerer Zeit gar Ideologien und Philosophien andiente, selbst wenn deren Repräsentanten – wie etwa Hegel – die Rede vom Reich Gottes lediglich mit Spott bedachten, oder – wie Heidegger – seinen Platz »das Reich des Fragwürdigsten« einnehmen ließen. Es ehrt die Christen der ersten Jahrhunderte, dem widerstanden zu haben. So vermerkt Laktanz, ein christlicher Autor des 4. Jahrhunderts, den noch als Heiden Kaiser Diokletian, der letzte große Christenverfolger, als Lehrer der lateinischen Beredsamkeit in seine neue Hauptstadt Nikomedien berief, in seinem Abriss der göttlichen Unterweisungen, die Christen sollten sich mit aller Kraft und Geduld bemühen, Gott die Treue zu halten. »Der Tod darf uns nicht schrecken noch der Schmerz uns beugen; wir müssen die Kraft des Geistes und die Standhaftigkeit unerschütterlich bewahren.« Dieser Widerstand ist es, der nicht aus eigener Kraft erfolgt als vielmehr aus der »Kraft des Geistes«, der dessen Wirken in der Geschichte Rechnung trägt, mögen auch die Zeiten dagegensprechen, die Mächte des Untergangs anscheinend triumphieren. Resistenza (Résistance, Widerstand) lautet bezeichnenderweise der Titel gleichsam eines Epochengemäldes Chagalls aus den Jahren 1937–1948 (Öl auf Leinwand, Nizza, Musée national), das eine Welt in Auflösung zeigt – doch mittendrin der gekreuzigte Christus als einzigen Fixpunkt. Keine andere Ordnung ist einer Zeit mehr gegeben, die ihre raison d’être in der Auflösung aller Ordnung erblickt, in Erhebung und Fall – und nicht in Widerstand und Ergebung, wie das theologische Vermächtnis Dietrich Bonhoeffers überschrieben ist. Ganz in diesem Geiste der Widerstand einer Ustwolskaja, der sich nicht auf sich selbst beruft, sondern in Sinfonie Nr. 3 im Ausruf: »Jesus Messias, errette uns!« gründet.
Der Verkennung des göttlichen bzw. des messianischen Wirkens in der Gegenwart im Zuge einer historistischen Geschichtsauffassung korrespondiert die Verkennung des Diabolischen in der Geschichte im Geiste der Aufklärung, durch deren Reduktion der Religion auf Moral alles, was mit Teufel oder Hölle zusammenhängt, ins Reich der Phantasie verwiesen wird. Schon Hegel befand mit Blick auf eine nominalistische Theologie, selbst die Lehre von der ewigen Seligkeit und der ewigen Verdammnis seien lediglich »Worte, die in sogenannter guter Gesellschaft nicht gebraucht werden dürfen; solche Ausdrücke gelten für – ἄρρτα. Wenn man sie auch nicht leugnet, so wäre man doch geniert, sich darüber zu erklären.« (Vorlesungen über die Philosophie der Religion, Bd. 3, 68)
Mehr als phantasielos, geradezu grotesk mutet es daher an, wenn in einem Zeitalter, in dem mehr Menschenleben vernichtet wurden als je zuvor, Theologen »Abschied vom Teufel« (Herbert Haag) nehmen wollen oder über die Existenz der Hölle streiten. Wie real diese ist, mag ein Blick in das von dem britischen Historiker Antony Beevor edierte Kriegstagebuch des großen Romanciers Wassili Grossman belegen, dessen Stalingradroman Leben und Schicksal vom sowjetischen Geheimdienst konfisziert wurde. Grossman selbst blieb nur deshalb verschont, weil er als Kriegsberichterstatter der Armeezeitschrift Roter Stern äußerst populär war. Obschon weder Parteimitglied noch von soldatischer Statur, hat er an vorderster Front erst den Rückzug, dann den Vormarsch der Roten Armee begleitet, erlebte auf einem nur drei Kilometer breiten Landstreifen an der Wolga die Schlacht um Stalingrad mit, hatte also zahlreiche Menschen leiden und sterben gesehen und zudem die Ermordung seiner Mutter bei dem Massaker von Babi Jar zu verkraften. Was jedoch Grossman nach, wohlgemerkt nach der Befreiung des KZ Treblinka zu sehen bekam, ließ ihn nach seinem Bericht für Monate verstummen. »Und mir scheint«, heißt es am Ende, »das Herz müsste mir stehen bleiben, zusammengepresst von solcher Trauer und solchem Leid, die kein Mensch ertragen kann.« (Beevor, Ein Schriftsteller im Krieg, 377) Wie Beevor abschließend anmerkt, sei es »nicht verwunderlich, dass Grossman dieser Tortur nicht gewachsen war. Als er im August [1944] nach Moskau zurückkehrte, befiel ihn eine schwere Nervenkrise.« Denn was er zu Augen bekam – das ist die Hölle, gemäß dem Diktum Kafkas, es gebe nichts Teuflischeres als das, was ist.
Allein deshalb hat die Theologie in ihrer Methodik der Wirklichkeit Rechnung zu tragen, statt sich in Interpretationen, in die Philologie irgendwelcher Lesarten zu flüchten, die oft genug nicht einmal den überlieferten Texten gerecht werden, geschweige denn der Offenbarung, die in der Wirklichkeit statthat und so real ist, wie nur das Kreuz Christi real ist. Allein von hier aus hat eine Deutung der Geschichte zu erfolgen, nicht nach unseren Vorgaben und Maßgaben; allein von hier aus hat nicht allein der Geschichtsschreiber zu gewärtigen: »Der Messias kommt ja nicht nur als der Erlöser; er kommt als der Überwinder des Antichrist.«
Dass sich zu dieser Einsicht Benjamins – von wenigen Ausnahmen einmal abgesehen – die zeitgenössische Theologie kaum durchrang, ist eine Sache; eine andere die, dass schon nach Benjamins Tod der heute herrschende Zeitgeist den Ton angab. Sollte doch in den folgenden Jahrzehnten vollauf seine Bestätigung finden, was Brecht in seinem Arbeitsjournal vom August 1941 vermerkt, nachdem er »die letzte arbeit« Benjamins, von dessen Tod er gerade erfahren hat, in den Händen hält: »günther stern [Günther Anders] gibt sie mir mit der bemerkung, sie sei dunkel und verworren, ich glaube, das Wort ›schon‹ kam darin vor.« Und nach ihrer Lektüre das Resümee: »– kurz, die kleine Arbeit ist klar und entwirrend (trotz aller metaphorik und judaismen), und man denkt mit schrecken daran, wie klein die anzahl derer ist, die bereit sind, so was wenigstens mißzuverstehen.« (B. Brecht, Arbeitsjournal. Erster Band 1938 bis 1942, hrsg, von W. Hecht, Frankfurt am Main 1973, 294) Dabei ist es bis heute geblieben, mag die Benjamin-Literatur auch ins Unabsehbare angewachsen sein. Mehr denn je findet Benjamins Feststellung am Ende der ersten These Über den Begriff der Geschichte ihre volle Bestätigung von der Theologie, »die heute bekanntlich klein und häßlich ist und sich ohnehin nicht darf blicken lassen«. (GS I.2, 693) Dem kommt die Theologie insofern entgegen, als sie es aufgegeben hat, die Zeichen der Zeit zu deuten – im Licht der Offenbarung des kommenden Gottes. Eher zieht es einen in die Vergangenheit zurück.
So hat jüngst Rémi Brague, der Inhaber des Münchener Guardini-Lehrstuhls, im Fazit seines Aufsatzes über Das Scheitern des Atheismus die Forderung erhoben: »Wir brauchen ein neues Mittelalter. Oder: Wir müssen dem neuzeitlichen Versuch, sich vom Mittelalter loszusagen, den Garaus machen. Wir brauchen ein echtes Mittelalter, auf keinen Fall dagegen das Zerrbild, das die Neuzeit daraus gemacht hat, um sich zu rechtfertigen. Ja, wir brauchen ein Mittelalter, das den Errungenschaften der Neuzeit positiv nachkommt und sie in eine neue Synthese integriert.« (Internationale Katholische Zeitschrift Communio 41 [2012], 279–288, hier 287) Gegen jenes Zerrbild ist bereits vor einem Menschenalter der Scheler-Schüler Paul Ludwig Landsberg angegangen in seiner Schrift Die Welt des Mittelalters und wir. Ein geschichtsphilosophischer Versuch über den Sinn eines Zeitalters (Verlag von Friedrich Cohen, Bonn 1922); auch täte zumal unserer Zeit eine Rückbesinnung auf den mittelalterlichen Ordo-Begriff durchaus gut.
Nun hat Romano Guardini, ausgehend vom »Daseinsgefühl und Weltbild des Mittelalters« wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg ein kleines Buch verfasst unter dem Titel Das Ende der Neuzeit. Ein Versuch zur Orientierung (Basel 1950; hier zit. nach der Werkbund-Ausgabe, Würzburg o. J. [1950]). Bemerkenswerterweise dachte Guardini zunächst an eine Studie zu Pascal, der anders als sein Zeitgenosse und Gegner Descartes nicht in seiner Zeit aufging, doch ist daraus ein Epochenbild geworden, das Bild einer im Untergang begriffenen Epoche. Entscheidend ist die Lossage des neuzeitlichen Menschen von der Offenbarung, um sein Dasein auf sich selbst zu begründen, ohne aber solche Werte wie die Freiheit und Einzigartigkeit der menschlichen Person, die sich ihr verdanken, zu verneinen. Auch wenn, ja weil es nach Guardini keine Rückwendung zum Mittelalter im Sinne der Romantik geben kann, müsse der Nicht-Glaubende »aus dem Nebel der Säkularisation heraus«, wie schon Nietzsche den Nicht-Christen gewarnt habe, dieser »habe noch gar nicht erkannt, was es in Wahrheit bedeute, ein solcher zu sein.« (110) Guardini geht dabei weder der Zweideutigkeit des modernen Menschenwesens nach noch der »Dialektik der Aufklärung«; ja nicht einmal – wie zehn Jahre zuvor Benjamin in seinen Aufzeichnungen Über den Begriff der Geschichte – von den zurückliegenden Katastrophen. Ausgehend von der Offenbarung, könnte man von einem Offenbarwerden des Menschen sprechen. »Wenn wir die eschatologischen Texte der Heiligen Schrift richtig verstehen«, heißt es abschließend, »werden Vertrauen und Tapferkeit überhaupt den Charakter der Endzeit bilden. Was umgebende christliche Kultur und bestätigende Tradition heißt, wird an Kraft verlieren. Das wird zu jener Gefahr des Ärgernisses gehören, von welcher gesagt ist, daß ihr, ›wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten erliegen würden‹ (Mt 24,24).« Obgleich die Endzeit, neutestamentlich gesehen, die gesamte Christuszeit umfasst, erkennt Guardini mit dem Ende der Neuzeit eine dramatische Zuspitzung: »Die Einsamkeit im Glauben wird furchtbar sein. Die Liebe wird aus der allgemeinen Welthaltung verschwinden (Mt 24,12). Sie wird nicht mehr verstanden noch gekonnt sein. Um so kostbarer wird sie werden, wenn sie vom Einsamen zum Einsamen geht; Tapferkeit des Herzens aus der Unmittelbarkeit zur Liebe Gottes, wie sie in Christus kund geworden ist. Vielleicht wird man diese Liebe ganz neu erfahren: die Souveränität ihrer Ursprünglichkeit, ihre Unabhängigkeit von der Welt, das Geheimnis ihres letzten Warum. Vielleicht wird die Liebe eine Innigkeit des Einvernehmens gewinnen, die noch nicht war. Etwas von dem, was in den Schlüsselworten für das Verständnis der Vorsehungsbotschaft Jesu liegt: daß um den Menschen, der Gottes Willen über Sein Reich zu seiner ersten Sorge macht, die Dinge sich wandeln (Mt 6,33).« Dabei konnte Guardini schwerlich Edith Steins Kreuzesliebe kennen, die damit ernst machte. Denn was Guardini im letzten Abschnitt mit Blick auf die Zukunft zu erkennen glaubt, das ist in Edith Steins Leben sowie im Leben und Sterben vieler anderer Christen in den Jahren zuvor bereits Wirklichkeit geworden. »Dieser eschatologische Charakter wird sich, scheint mir, in der kommenden religiösen Haltung anzeigen. Damit soll keine wohlfeile Apokalyptik verkündet werden. Niemand hat das Recht zu sagen, das Ende komme, wenn Christus selbst erklärt hat, die Dinge des Endes wisse der Vater allein (Mt 24,36). Wird also hier von einer Nähe des Endes gesprochen, so ist das nicht zeithaft, sondern wesensmäßig gemeint: daß unsere Existenz in die Nähe der absoluten Entscheidung und ihrer Konsequenzen gelangt; der höchsten Möglichkeiten wie der äußersten Gefahren.« Das freilich gilt für eine christliche Existenz von Anbeginn, nicht zuletzt aber für die zurückliegenden Jahre, die »das Ende der Neuzeit« markieren. Und wenngleich niemand das Recht habe, zu sagen, das Ende komme, so besitzt seine Erwartung durchaus eine »zeithafte«, also temporäre Bedeutung, insofern im kommenden Gott die ontologische Ordnung durchbrochen wird, wie auch mit Blick auf die »Offenbarung [apokalypsis] Jesu Christi« (Offb 1,1), also auf den Anfang der Apokalypse, Erik Peterson in seiner Auslegung der Offenbarung des Johannes (vgl. 14) auf den »eigenartigen Doppelsinn« hingewiesen hat; es heiße »eben nicht einfach Enthüllung Jesu Christi in seiner Zukunft, in seiner Parusie, sondern das heißt zugleich auch Offenbarung, die er seinen Knechten und im besonderen seinem Knecht Johannes schon jetzt hat zuteil werden lassen«. Über seine Zeit hinaus gilt die Aktualität des ihm Offenbarten, wie Johannes selbst bezeugt: »Dieser hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt: alles, was er geschaut hat. Selig, wer diese prophetischen Worte vorliest und wer sie hört und wer sich an das hält, was geschrieben ist; denn die Zeit ist nahe.« (Offb 1,2 f.) Dass die Zeit nahe ist, folgt also nicht etwa aus menschlicher Spekulation, sondern aus prophetischer Einsicht in die Aktualität des Messianischen. Ist doch die messianische Welt »die Welt allseitiger und integraler Aktualität« (vgl. GS I.3, 1235), wie Benjamin in Neue Thesen K, im Rahmen seiner Aufzeichnungen Über den Begriff der Geschichte notiert. Die Aktualität der messianischen Botschaft vom Kommen des Reiches Gottes bewusstzumachen, wie sie nahezu alle neutestamentlichen Texte bekunden, bildet das zentrale Anliegen der vorliegenden Abhandlung, ganz entgegen den bis in die zeitgenössische Theologie hinein vorherrschenden Zeitauffassungen zumal Hegels und Heideggers, die dem christlichen Begriff der messianischen bzw. eschatologischen Zeit völlig inkompatibel, ja konträr sind, wie nicht zuletzt aus den Lebenszeugnissen und dem Martyrium Edith Steins ersichtlich wird. Ganz im Gegensatz zum Geist ihrer Zeit wie dem Geist unserer Zeit, der zwischen Selbstübersteigerung und Nietzsches »Lust am Selbstuntergang« taumelt, konstatiert sie, dass die Kreuzesnachfolge Christi »eine starke und reine Freudigkeit« gebe, und die es dürften und könnten, »die Bauleute an Gottes Reich«, seien »die echtesten Gotteskinder« (vgl. GT II, 113).
Berlin, den 9. August 2012, dem 70. Todestag Edith Steins.