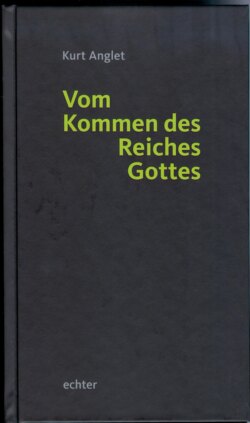Читать книгу Vom Kommen des Reiches Gottes - Kurt Anglet - Страница 7
I. Der Kreuzestod Christi – der Anfang der Vollendung
ОглавлениеDass es seit längerem keine geschichtstheologische Deutung des Zeitgeschehens gibt, wie sie ein Salvian von Marseille im 5. Jahrhundert in De gubernatione Dei vorlegte, ist verständlich, da mit der Christianisierung der Völker Europas seit dem frühen Mittelalter die Geschichte der Kirche – trotz aller Spannungen und Konflikte – mit ihrer (profanen) Geschichte eng verknüpft war. Waren doch etliche Herrscher, wie das Königspaar Heinrich und Kunigunde, wie die Königin Mathilde, wie Stephan I. von Ungarn oder Ludwig IX. von Frankreich Heilige; einige wie Václav von Böhmen oder die skandinavischen Könige Erik und Knut sogar Märtyrer. Noch enger scheint das Band von profaner Herrschaft und Kirche seit dem Zeitalter der Reformation geknüpft, als Fürsten oder Könige zugleich als geistliches Oberhaupt ihrer Landeskirche figurierten. Entsprechend eng auch die Bindung im katholischen Raum, zu denken ist etwa an Reinhold Schneiders literarisches Porträt Philipp der Zweite. Oder Religion und Macht [Leipzig 1931]. Erst von der Französischen Revolution an zeichnet sich ein Bruch ab, wenngleich der Prozess der Säkularisierung bis ins 20. Jahrhundert hinein in erster Linie die geistigen und politischen Eliten erfasste, während die Volkskirchen, obschon eher in der Defensive, zumindest im ländlichen Raum weitgehend intakt blieben, ja in einigen Ländern, wie etwa Mexiko, den überlieferten Glauben erfolgreich gegen antichristliche Machthaber verteidigten.
Erst mit dem Ersten Weltkrieg, dem amerikanischen Historiker und Diplomaten George F. Kennan, der 2005 im Alter von 101 Jahren starb, zufolge »die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts«, wird mit der Selbstzerfleischung der christlichen Völker den apokalyptischen Mächten der Moderne Tür und Tor geöffnet. Doch selbst hier noch keine Scheidung, kein radikaler Bruch angesichts der Volksverbundenheit der Kirchen; bezeichnenderweise ist in der eingangs erwähnten geschichtstheologischen Untersuchung Walter Künneths Der große Abfall im Untertitel von »der Begegnung [!] zwischen Nationalsozialismus und Christentum« die Rede, obschon es sich in Wahrheit um eine handfeste Konfrontation handelte, die etlichen christlichen Glaubenszeugen, wie einem Dietrich Bonhoeffer noch in den letzten Kriegstagen, das Leben kostete. Und auch das eingangs zitierte Werk des katholischen Theologen Georg Feuerer Unsere Kirche im Kommen spricht im Untertitel von einer »Begegnung von Jetztzeit und Endzeit«, während doch aus christlicher Sicht Jetztzeit und Endzeit seit Christus sich nicht bloß »begegnen«, sondern einander entsprechen.
Denn keineswegs erst im allgemeinen Zeitgeschehen, im Verlauf der Geschichte, sondern im Christusgeschehen selbst zeichnet sich die Konstellation von messianischer Jetztzeit und eschatologischer Endzeit ab. So nach dem Matthäusevangelium beim Verhör Jesu vor dem Hohen Rat, wo es zunächst angesichts der verschiedenen Anschuldigungen heißt: »Jesus aber schwieg. Darauf sagte der Hohepriester zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, sag uns: Bist du der Messias, der Sohn Gottes? Jesus antwortete: Du hast es gesagt. Doch ich erkläre euch: Von jetzt an werdet ihr den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen.« (Mt 26,63 f. – Es überrascht, dass die Parallelstelle Mk 14,62 von den Herausgebern der Einheitsübersetzung nicht angegeben ist; vice versa nicht dort auf Mt 26,64 verwiesen ist, sondern jeweils auf Mk 13,26.) In Anlehnung an zwei Schriftworte aus Dan 7,13 und Ps 110,1 bekennt der seinem Todesurteil und seiner Kreuzerhöhung entgegensehende Christus nicht nur seine Messianität, sondern in einem Atemzug seine eschatologische Herrschaft, die mit seinem Todesurteil öffentlich gemacht wird. War sie bislang über seinen Jüngerkreis hinaus weitgehend verschwiegen, lediglich ausnahmsweise im persönlichen Gespräch – ob mit der Samariterin oder mit Martha und Maria, den Schwestern des Lazarus – bekannt, so ist mit dem Eingeständnis seiner Messianität nicht allein sein Todesurteil wegen Gotteslästerung gesprochen: »Da zerriss der Hohepriester sein Gewand und rief: Er hat Gott gelästert! Wozu brauchen wir noch Zeugen? Jetzt habt ihr die Gotteslästerung selbst gehört. Was ist eure Meinung? Sie antworteten: Er ist schuldig.« (Mt 26,65 f.) Was in diesem Zusammenhang leicht übersehen wird, ist der theologisch höchst bedeutsame Sachverhalt, dass hier, also »von jetzt an«, d. h. im Augenblick seiner äußersten Erniedrigung und Demütigung, seine endzeitliche Herrschaft ihren Anfang nimmt. Heißt es doch nach dem allgemeinen Schuldspruch: »Dann spuckten sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn. Andere ohrfeigten ihn und riefen: Messias, du bist doch ein Prophet! Sag uns, wer hat dich geschlagen?« Doch nicht genug, denn anschließend folgt die tiefste aller Demütigungen: die Verleugnung durch Petrus (Mt 26,69–75), des Ersten seiner Jünger, der ihn vordem als Messias bekannt hat (vgl. Mt 16,13–20).
Nirgendwo wird der Zusammenhang von Jesu Messianität und seiner Hoheit als Menschensohn, zwischen seinem Kreuzestod und seiner eschatologischen Herrschaft so manifest wie hier, nach Mt 26,64 bzw. Mk 14,62. Es wird offenkundig, dass diese nicht etwa irgendwann am Ende aller Zeiten einsetzt als vielmehr mit dem Werk unserer Erlösung ihren Anfang nimmt. Theologisch gesprochen: Erlösung und Vollendung, Christologie/Soteriologie und Eschatologie gehören aufs engste zusammen: Das Kommen des Menschensohns, das Kommen des Reiches Gottes vollzieht sich nicht irgendwann nach seiner ersten Ankunft, sondern ist mit seiner ersten Ankunft gegeben. Mit ihrer Vollendung im Kreuzestod nimmt die Vollendung der Zeit ihren Anfang – nicht erst mit der Wiederkunft Christi.
Daher ist auch im Grunde genommen nicht ganz zutreffend die Rede von einer »eigentümlichen Dialektik der christlichen Eschatologie, wonach das messianische Reich zwar schon gekommen ist, aber doch erst in der zweiten Ankunft Christi seine Vollendung erfahren wird« – so Erik Peterson, dem wir die Wiederentdeckung der christlichen Eschatologie verdanken, in seinem Spätwerk Frühkirche, Judentum, Gnosis [Darmstadt 1982, 59; Erstausg.: Freiburg i. Br. 1959]. Gewiss wird das messianische Reich, das mit Christus schon gekommen ist, bei seiner zweiten Ankunft seine Vollendung erfahren. Nur setzt der Prozess der Vollendung nicht erst bei seinem zweiten Kommen ein, sondern nimmt seinen Anfang im Prozess gegen Jesus Christus, der vor dem Hohen Rat eingeleitet wird und – nach der Episode seiner Verspottung und der Verleugnung durch Petrus – mit der Auslieferung an Pilatus und dessen richterlichen Schuldspruch endet (vgl. Mt 27,26). Es folgen die Verspottung durch die (heidnischen) Soldaten sowie die Kreuzigung und der Tod Jesu – gleichsam das Ende der ersten Ankunft Jesu und der Anfang seiner eschatologischen Herrschaft, die vom Kreuz ihren Ausgang nimmt. Denn nicht erst am Ende der Zeiten, sondern vom Kreuz Christi aus erscheinen die Mächte dieser Weltzeit als Gerichtete – vorab der Hohe Rat und das Imperium Romanum, bis heute der Inbegriff aller Weltmacht. Deshalb kann mit Feuerer nur insofern davon die Rede sein, dass Unsere Kirche im Kommen ist, weil in Christus bereits das Reich Gottes gekommen und die Jetztzeit zur Endzeit geworden ist. Und deshalb vollzieht sich das »Kommen der Kirche« als Vorausbotin des mit Macht kommenden Gottesreiches unter dem Zeichen des Kreuzes [was übrigens der frühe Peterson in seiner Auslegung des ersten Korintherbriefes zutreffend beschrieben hat, insofern er die Parusie Christi als Apokalypsis, als Enthüllung, im Gegensatz zu seiner ersten Ankunft fasst, die im Mysterium vor sich ging; vgl. ebd. 397] bzw. des »geschlachteten Lammes«, das im Blutzeugnis der christlichen Märtyrer seine Entsprechung findet (vgl. Offb 12,11: »Denn sie haben ihn [den »Ankläger unserer Brüder« = Satan] besiegt durch das Blut des Lammes / und durch ihr Wort und Zeugnis; / sie hielten ihr Leben nicht fest, / bis hinein in den Tod«). Christi zweite Ankunft bildet gewissermaßen den Schlusspunkt jenes Prozesses, der von seiner Verurteilung ausgeht – nun aber um am Jüngsten Tag seinerseits den Mächten dieses Äons, dieser Weltzeit, das Urteil zu sprechen. Alle Geschichte nach Christus gleicht daher einem Prozess, dessen Urteil bis zum Jüngsten Tag aussteht.
Darum ist es kein Zufall, wenn Petrus im Haus des römischen Hauptmanns Kornelius, gleichsam dem Ursprungsort der Heidenmission, seine Rede, in der er Christus als den Gekreuzigten und Auferstandenen bekennt, mit den Worten beschließt: »Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkündigen und zu bezeugen: Das ist der von Gott eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten. Von ihm bezeugen alle Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen die Vergebung der Sünden empfängt.« (Apg 10,42 f.) Es ist bezeichnend, dass hier, also im Hause des römischen Hauptmanns, Christus als »der von Gott eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten« proklamiert wird. Denn zuvor – in seinen Reden auf dem Tempelplatz wie vor dem Hohen Rat – hat Petrus Jesus lediglich als Messias bekannt, durch dessen Name Heilungen geschehen und Israel die Sünden vergeben würden. Doch bereits hier, in seiner Rechenschaft vor dem Hohen Rat wegen der Heilung eines Gelähmten, verweist Petrus auf die universale Bedeutung des messianischen Namens Jesu: »Wenn wir heute wegen einer guten Tat an einem kranken Menschen darüber vernommen werden, durch wen er geheilt worden ist, so sollt ihr alle und das ganze Volk Israel wissen: im Namen Jesu Christi, des Nazoräers, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht dieser Mann gesund vor euch. Er [Jesus] ist der Stein, der von euch Bauleuten verworfen wurde, der aber zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil zu finden. Denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen.« (Apg 4,10–12)
Hier, vor dem Hohen Rat, weist Petrus im Geist der Umkehr auf den messianischen Erlöser, der Heilung und Rettung bringt, hin – nicht auf den Richter und Rächer des Bösen. Deshalb erklärt er zuvor, in seiner Rede auf dem Tempelvorplatz: »Nun, Brüder, ich weiß, ihr habt aus Unwissenheit gehandelt, ebenso wie eure Führer [!]. Gott aber hat auf diese Weise erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten im Voraus verkündigt hat: dass sein Messias leiden werde. Also kehrt um, und tut Buße, damit eure Sünden getilgt werden und der Herr Zeiten des Aufatmens kommen lässt und Jesus sendet als den für euch bestimmten Messias. Ihn muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung von allem, die Gott von jeher durch den Mund seiner heiligen Propheten verkündet hat.« (Apg 3,17–21) Unter »den Zeiten der Wiederherstellung«, der Apokatastasis, ist allerdings keineswegs, wie ein Origenes († 253/254) vermeinte, eine Preisgabe des Gerichtsgedankens zu verstehen; schon im Fortgang seiner Rede verweist Petrus unter Zuspitzung zweier Zitate aus Lev 23,29 sowie Dtn 18,19 auf die Ausmerzung desjenigen aus dem Volke, der nicht auf den messianischen Propheten hört. Mehr noch deutet das Gebet der christlichen Urgemeinde um Furchtlosigkeit nach der Freilassung des Petrus und Johannes durch den Hohen Rat (vgl. Apg. 4,23–31) auf den universalen Zusammenhang von messianischer Erlösung und dem Gericht über Völker und Herrscher, insofern Gott zunächst als Schöpfer des Kosmos gepriesen wird, um dann den Beginn von Ps 2 zu zitieren: »Warum toben die Völker, / warum machen die Nationen vergebliche Pläne? Die Könige der Erde stehen auf, / und die Herrscher haben sich verbündet / gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Wahrhaftig, verbündet haben sich in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und Stämmen Israels, um alles auszuführen, was deine Hand und dein Wille im Voraus bestimmt haben.« M. a. W., es geht hier nicht um irgendeine abstrakte Gerichtsidee oder um einen entsprechenden Gerechtigkeitsgedanken. Vielmehr wird hier – im Bündnis eines Herodes und Pontius Pilatus – genau der geschichtliche Schnittpunkt benannt, in dem Profan- und Heilsgeschichte, die Gewalten des alten und des neuen Äons, aufeinandertreffen, und zwar nicht aufgrund irgendeiner historischen Kontingenz, sondern »um alles auszuführen, was deine Hand und dein Wille im Voraus bestimmt haben«.
Das bedeutet nicht weniger, als dass sowohl die konkrete Machtausübung eines Herodes und eines Pontius Pilatus wie ihr endgültiges Scheitern ganz in der Hand Gottes liegen. Auch wird immer wieder gern auf die Gütergemeinschaft der Urgemeinde als Modell eines authentischen Christentums hingewiesen, von der im darauffolgenden Abschnitt die Rede ist (vgl. Apg 4,32–37). Doch ebenso wichtig, ja vielleicht noch wichtiger ist der Abschluss des vorausgehenden Gebets der Urgemeinde, die fortfährt: »Doch jetzt, Herr, sieh auf ihre Drohungen und gib deinen Knechten die Kraft, mit allem Freimut dein Wort zu verkünden. Streck deine Hand aus, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Als sie gebetet hatten, bebte der Ort, an dem sie versammelt waren, und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, und sie verkündeten freimütig das Wort Gottes.«
Denn hier ereignet sich gewissermaßen das »zweite Pfingsten« (vgl. Apg 2,1–13), die Geburtsstunde der Parrhesia, der »freimütigen Rede«, wie sie bereits die Apostel zuvor auf dem Tempelplatz und vor dem Hohen Rat bewiesen haben. Kündigte sich dort die Macht des Heiligen Geistes in einem Sturm an, unter der Ausbreitung von Feuerzungen, der Gabe, in fremden Sprachen zu reden, so jetzt in einem Beben, das der kleinen Schar der Urgemeinde die Kraft schenkt, den Drohungen der Mächtigen standzuhalten und »mit Freimut« [μετà παρρησίας = metà parrhesías] das Wort Gottes zu verkünden.
Mehr als in irgendeinem Manifest politischer Natur oder in einer gutmeinenden ethischen Absichtserklärung liegt in diesem Gebet der Urgemeinde gewissermaßen die pneumatische Sprengkraft des christlichen Glaubens. Und zwar nicht allein in einem historischen Sinne, im Hinblick auf »die Stämme Israels« wie die Völker des Römischen Imperiums. Es ist der gewaltige eschatologische Impetus jenes Geistes, der in der Kraft jenes Bebens ganze Reiche zum Einsturz bringt – eines nach dem anderen. Allein aus diesem Grunde ist eine geschichtstheologische Betrachtung einer jeden Epoche nicht allein von kultur- oder kirchengeschichtlicher Bedeutung. Vielmehr trägt sie dem im Kommen begriffenen Christus Rechnung, wie es auch im Epheser-Hymnus (Eph 1,10) heißt: »Er [Gott] hat beschlossen, die Fülle der Zeiten heraufzuführen [wörtlich: im Blick auf den Heilsplan für die Erfüllung der Zeiten], / in Christus alles zu vereinen, alles, was im Himmel und auf Erden ist.«
Und zwar gilt jener »Heilsplan [griech.: oikonomia] für die Erfüllung der Zeiten« bereits für die Zeiten vor Christus wie für Gegenwart und Zukunft. Mit Blick auf das Heilsgeschehen vor Christus hat Irenäus von Lyon in seinem Buch gegen die Irrlehren (Adversos haeresos, Lib. 4, Cap. 2,14) Gottes Wirken umschrieben: »Von Anfang an hat Gott den Menschen gebildet im Hinblick auf die Gaben, die er ihm schenken wollte. [ – ] Die Patriarchen erwählte er um ihres Heiles willen. Im Voraus formte er das ungelehrte Volk, um die Ungelehrigen zu lehren, Gott zu folgen. Im Voraus unterrichtete er die Propheten, um die Menschen daran zu gewöhnen, den Geist Gottes zu tragen und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Der selbst niemanden braucht, gewährte denen, die ihn brauchen, seine Gemeinschaft. Denen, die sein Wohlgefallen besaßen, entwarf er wie ein Baumeister den Plan für den Aufbau des Heils.« Erst recht aber gilt dies im Hinblick »auf den Heilsplan für die Erfüllung der Zeiten«: »in Christus alles zu vereinen, alles, was im Himmel und auf Erden ist«. Entscheidend ist also die theozentrische bzw. christozentrische Fundierung christlicher Geschichtsdeutung. M. a. W., es kann keinerlei christliche Geschichtsdeutung auf dem Fundament des Deutschen Idealismus, des Marxismus, der Lebensphilosophie, Nietzsches, Heideggers oder irgendwelcher postmoderner Geschichtskonzeptionen geben, weil alle diese säkularen Geschichtsauffassungen Gott nicht als Lenker der menschlichen Geschichte kennen, geschweige denn in Christus die anakephaleiosis, d. h. die »Zusammenfassung« alles Geschehens in Christus als Haupt erkennen. Es kennzeichnet all jene Geschichtsauffassungen, dass der Mensch – als Gestalter, ja als Schöpfer seiner Geschichte und seines Geschicks – den Platz Gottes einnimmt, und sei es auch um – wie etwa Cioran – einer ausweglosen Skepsis, der Melancholie einer unauslotbaren Trostlosigkeit zu huldigen.
Gern wird in diesem Zusammenhang auf die Errungenschaften der europäischen Freiheitsgeschichte verwiesen. Diese mögen unbestritten sein in Anbetracht von Unmündigkeit und Unterdrückung im Zeitalter des Absolutismus. Nur ist der Traum der Vernunft, nach ihren eigenen Gesetzen die Welt zu regieren, auf den Kriegsschauplätzen und in den Todeslagern des 20. Jahrhunderts zum Albtraum geworden. Goyas Capriccio »Der Traum der Vernunft gebiert Ungeheuer« (1797) greift mehr als ein Jahrhundert voraus: Angesprochen, was für ihn das erste Dokument des modernen Antisemitismus sei, antwortete Raul Hilberg, der Nestor der Holocaust-Forschung, es sei ein Brief Hitlers aus dem Jahre 1919, in dem dieser von einem »Antisemitismus der Vernunft« gegenüber dem gefühlsbetonten Antisemitismus der Vergangenheit spricht [vgl. Geschichte reicht in die Gegenwart. Ein Gespräch mit Raul Hilberg, in: NZZ Nr. 287 (10.12.2002), 34]. Denn das Monströse, buchstäblich »Ungeheuerliche« der menschlichen Vernunft tritt da zutage, wo der Mensch sich nicht mehr als der Vernehmende, also gegenüber Gott als der Gehör und Gehorsam Schenkende, begreift, sondern sich anmaßt, selbst den Platz Gottes in der Geschichte im Geiste seiner Selbstverabsolutierung, ja seiner Selbstübersteigerung einzunehmen. Nichts anderes aber ist seit Goyas Zeiten, seit der Ära Napoleons in der europäischen Geschichte etliche Male geschehen: Allein deshalb kann es keinerlei Substitution des christlichen Gottesbegriffs durch eine säkulare Geschichtskonzeption geben, selbst wo diese sich – wie noch die Kriegsmächte des Ersten Weltkriegs – auf Gott beruft. Das in aller Unmissverständlichkeit zum Ausdruck gebracht zu haben, ist nicht zuletzt das Verdienst von Erik Petersons Abhandlung Der Monotheismus als politisches Problem aus dem Jahre 1935, wo – über ihren historischen Gegenstand, die römische Kaiserzeit, hinaus mit einem Seitenhieb gegen Carl Schmitts »politische Theologie« – es abschließend heißt: »Die Lehre von der göttlichen Monarchie mußte am trinitarischen Dogma und die Interpretation der Pax Augusta an der christlichen Eschatologie scheitern. Damit ist nicht nur theologisch der Monotheismus als politisches Problem erledigt und der christliche Glaube aus der Verkettung mit dem Imperium Romanum befreit worden, sondern auch grundsätzlich der Bruch mit jeder ›politischen Theologie‹ vollzogen, die die christliche Verkündigung zur Rechtfertigung einer politischen Situation missbraucht. Nur auf dem Boden des Judentums oder Heidentums kann es so etwas wie eine ›politische Theologie‹ geben. Doch die christliche Verkündigung von dem dreieinigen Gott steht jenseits von Judentum und Heidentum, gibt es doch das Geheimnis der Dreieinigkeit nur in der Gottheit selber, aber nicht in der Kreatur. Wie denn auch der Friede, den der Christ sucht, von keinem Kaiser gewährt wird, sondern allein ein Geschenk dessen ist, der ›höher ist als alle Vernunft‹.« [Hervorh. K. A.]
Wenn aber Gott allein der Schenkende, der Mensch jedoch der Empfangende ist, wie auch aus den oben zitierten Ausführungen des Irenäus von Lyon ersichtlich wird, dann kann es ebenso wenig eine politische Fundierung des Gottesreiches auf dem Boden des Profanen in einer Art Synthese von christlicher Reich-Gottes-Erwartung und politischer Weltverantwortung geben. Es entbehrt nicht der Ironie, dass nicht etwa ein christlicher Traditionalist oder ein politisch Konservativer das in aller Unmissverständlichkeit zum Ausdruck gebracht hat, sondern der später dem Marxismus zugewandte Philosoph Walter Benjamin, und zwar im Anschluss an die eingangs zitierten Aussagen des Theologisch-politischen Fragments: »Darum kann die Ordnung des Profanen nicht am Gedanken des Gottesreiches aufgebaut werden, darum hat die Theokratie keinen politischen sondern allein einen religiösen Sinn. Die politische Bedeutung der Theokratie mit aller Intensität geleugnet zu haben ist das größte Verdienst von Blochs ›Geist der Utopie‹.« (GS II.1, 203) Denn nicht nur hat der Versuch ihrer politischen Fundierung eine Verwirrung der Begriffe zur Folge. Vielmehr nehmen unsere »Optionen«, unsere Ideen und Wunschvorstellungen den Platz ein, der ausschließlich Gott bzw. seinem Gesalbten gebührt. Und wie kein »Gesalbter« im Sinne eines profanen Herrschers dessen Platz behaupten kann, so obliegt das Kommen des Gottesreiches allein Gott und seinem Gesalbten, dem Messias und Menschensohn, durch die Geschichte hindurch – nicht zuletzt durch unsere Zeit hindurch, soweit sie dem dreieinigen Gott den Rücken gekehrt hat, um sich selbst zu inthronisieren. Nicht etwa auf dessen erklärte Feinde bezieht sich das Wort Jesu, sondern auf diejenigen, die unter Berufung auf Gott eine politische Theokratie zu errichten trachten: »Seit den Tagen Johannes’ des Täufers bis heute wird dem Himmelreich Gewalt angetan; die Gewalttätigen reißen es an sich.« (Mt 11,12) – Bis heute, d. h. bis auf den heutigen Tag wird dem Himmelreich und denen, die daran bauen, Gewalt angetan.