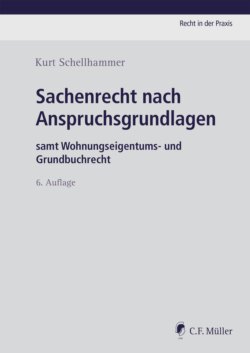Оглавление
Kurt Schellhammer. Sachenrecht nach Anspruchsgrundlagen
Sachenrecht
Autor
Impressum
Vorwort
Vorwort zur 1. Auflage
Inhaltsübersicht
Inhaltsverzeichnis
Verzeichnis der Abbildungen
Abkürzungsverzeichnis
1. Das Zivilrecht
Abbildung 1: Zivilrecht
2.1 Der Kodex und seine Nebengesetze
2.2 Das bürgerliche Vertrags- und Vermögensrecht
3.1 Die Themen der ersten drei Bücher des BGB
Abbildung 2: Das System des BGB
3.2 Schuld- und Sachenrecht
Abbildung 3: Schuld- und Sachenrecht
3.3 Sachenrecht und BGB Allgemeiner Teil
1. Die Rechtsgrundlagen
2.1 Die Gliederung des BGB
2.2 Besitz und Eigentum
2.3 Grundstücksrecht und Recht der beweglichen Sachen
3.1 Die rechtliche Zuordnung der Sachgüter
3.2 Das unnachgiebige Sachenrecht
1.1 Die unmittelbare rechtliche Herrschaft über eine Sache
1.2 Die Schranken des dinglichen Rechts
2. Das absolute Recht
3.1 Das Eigentum und seine Spaltprodukte
Abbildung 4: Beschränkte dingliche Rechte
3.2 Das Erbbaurecht
3.3 Die Dienstbarkeiten
3.4 Das dingliche Vorkaufsrecht
3.5 Die Reallast
3.6 Die Grundpfandrechte
3.7 Nießbrauch und Pfandrecht an beweglichen Sachen
3.8 Beschränkte dingliche Rechte an eigener Sache
1. Besitz und Eigentum
2. Die Funktion des Besitzes im System des BGB
3. Der Gang der Darstellung
1. Gesetzlicher Normalfall und Sonderfälle
Abbildung 5: Besitzarten
2. Unmittelbarer und mittelbarer Besitz
3. Voll- und Teilbesitz
4. Allein- und Mitbesitz
5. Eigen- und Fremdbesitz
6. Berechtigter und unberechtigter Besitz
7. Fehlerfreier und fehlerhafter Besitz
1. Die gesetzliche Definition
2. Die Funktion des unmittelbaren Besitzes im System des BGB
3.1 Zwei Möglichkeiten
3.2 Die tatsächliche Gewalt über eine Sache
Abbildung 6: Unmittelbarer Besitz
3.3 Der Erwerb der tatsächlichen Sachherrschaft
3.4 Die Einigung über den Besitzerwerb statt einer Übergabe
3.5 Besitzübertragung und Besitzerwerb durch Hilfspersonen
4. Der Verlust des unmittelbaren Besitzes
4.1 Die Besitzaufgabe
4.2 Der unfreiwillige Besitzverlust
4.3 Die vorübergehende Verhinderung
5.1 Eine gelungene Hilfskonstruktion
5.2 Die Rechtsfolge der Besitzdienerschaft
5.3 Der Besitzerwerb durch Besitzdiener
5.4 Der Besitzverlust durch Besitzdiener
6. Der ererbte unmittelbare Besitz
1.1 Der dingliche Besitzschutz vor verbotener Eigenmacht
Abbildung 7: Besitzschutz gegen verbotene Eigenmacht
1.2 Besitzschutz und Eigentumsschutz
1.3 Der schuldrechtliche Besitzschutz
2.1 Die unerlaubte Entziehung oder Störung des unmittelbaren Besitzes
2.2 Die Beweislast
2.3 Die Besitzentziehung
2.4 Die Besitzstörung
2.5 Die gesetzliche Gestattung der Besitzstörung
3.1 Das gesetzliche System
3.2 Die Besitzwehr gegen eine Besitzstörung
3.3 Die Besitzkehr gegen eine Besitzentziehung
4.1 Die Anspruchsgrundlage
4.2 Die Rechtsfolge
4.3 Die Anspruchsvoraussetzungen
5.1 Die Anspruchsgrundlagen
5.2 Der Anspruch auf Beseitigung der Störung
5.3 Der Anspruch auf Unterlassung einer Störung
Abbildung 8: Beweislast für und gegen die Besitzschutzansprüche
6.1 Überblick und Beweislast
6.2 Die Ausschlussfrist
6.3 Keine Einwendungen aus einem Recht zum Besitz
7.1 Die rechtliche Konstruktion
7.2 Der Anspruch auf Gestattung
7.3 Gegenrechte des Grundstücksbesitzers
1.1 Der Besitz ohne tatsächliche Sachherrschaft
1.2 Sinn und Zweck des mittelbaren Besitzes
2.1 Die Gleichstellung mit dem unmittelbaren Besitz
2.2 Der Schutz des mittelbaren Besitzes
2.3 Kein Besitzschutz gegen den unmittelbaren Besitzer
2.4 Weitere Rechtsfolgen
3.1 Das Besitzmittlungsverhältnis
3.2 Vertragliches oder gesetzliches Besitzmittlungsverhältnis
3.3 Der Erwerb des mittelbaren Besitzes
3.4 Der Verlust des mittelbaren Besitzes
3.5 Kein Nebenbesitz mehrerer mittelbarer Besitzer
4. Die Übertragung des mittelbaren Besitzes
5. Der mehrfach gestufte mittelbare Besitz
6. Kapitel Der Teilbesitz
1. Der Besitz mehrerer Personen auf gleicher Stufe
2. Die Rechtsfolge des Mitbesitzes
3. Die Voraussetzungen des Mitbesitzes
1. Eigenbesitz und Fremdbesitz
2. Die Rechtsfolgen des Eigenbesitzes
1. Das gesetzliche System
2. Die Rechtsfolge
3. Die Anspruchsvoraussetzungen
4. Die Einwendungen
1. Individualrecht und Rechtsinstitut
2. Jedes vermögenswerte Recht
3. Inhaltsbestimmung und Sozialbindung des Eigentums
4.1 Enteignung durch Gesetz oder Verwaltungsakt
4.2 Materielle Voraussetzung der Enteignung
4.3 Formelle Voraussetzung der Enteignung
4.4 Enteignungsgleicher Eingriff
4.5 Enteignender Eingriff
1. Das gesetzliche System
2. Das absolute und umfassende Herrschaftsrecht an einer Sache
3. Die zivilrechtlichen Schranken des Eigentums
4.1 Das gesetzliche System
Abbildung 9: Miteigentum
4.2 Das Bruchteilseigentum
4.3 Das Wohnungs- und Teileigentum
4.4 Das Gesamthandseigentum
5.1 Dicht vor dem Ziel
5.2 Das Anwartschaftsrecht des Auflassungsempfängers
5.3 Das Anwartschaftsrecht des Vorbehaltskäufers
Abbildung 10: Anwartschaftsrecht auf Eigentum
5.4 Der gemeinsame Nenner
6. Das Treuhandeigentum
1.1 Die Selbsthilfe als ultima ratio
1.2 Die Beweislast für und gegen den Herausgabeanspruch
2. Die Konkurrenz mit anderen Herausgabeansprüchen
3. Berechtigter und unberechtigter Besitzer
1. Die Herausgabe durch den unmittelbaren Besitzer
2. Die Herausgabe durch den mittelbaren Besitzer
3. Der Erfüllungsort für die Herausgabe
4. Die Abtretung des Herausgabeanspruchs und die Einziehungsermächtigung
5. Der Herausgabeanspruch und das allgemeine Schuldrecht
1. Die Beweislast für und gegen den Herausgabeanspruch
Abbildung 11: Die Beweislast für und gegen den Herausgabeanspruch aus § 985
2.1 Gegenüber dem Fremdbesitzer einer beweglichen Sache
2.2 Gegenüber dem Eigenbesitzer einer beweglichen Sache
2.3 Gegenüber dem Grundstücksbesitzer
3. Der Besitz des Anspruchsgegners
4. Der Verlust des Eigentums nach Klageerhebung
1. Eine anspruchshindernde Einwendung
2. Die Beweislast des Anspruchsgegners für sein Besitzrecht
3. Das Recht zum Besitz gegenüber dem Eigentümer
4. Beispiele für die Vielfalt der Besitzrechte
5.1 Die Einwendung aus dem Besitzmittlungsverhältnis
5.2 Der Besitzverlust des Anspruchsgegners
5.3 Die Verjährung des Herausgabeanspruchs
5.4 Die Verwirkung des Herausgabeanspruchs
1. Eigentum contra unrechtmäßigen Besitz
2. Die gesetzliche Regel und ihre Ausnahmen
3. Die Methode der Rechtsfindung
4. Die entsprechende Anwendung der §§ 987 ff
1. Die Rechtsfolgen des Eigentümer-Besitzer-Verhältnisses
Abbildung 12: Eigentümer-Besitzer-Verhältnis
2. Das Privileg des unverklagten gutgläubigen Besitzers
3. Eine erschöpfende Sonderregelung für Nutzungs-, Schadens- und Verwendungsersatz
4.1 Juristische Winkelzüge
4.2 Der besondere Regelungsbedarf für den berechtigten Besitzer
4.3 Verwendungen des unberechtigten Besitzers während der Zeit seines Besitzrechts
4.4 Die Eingriffskondiktion
4.5 Der Fremdbesitzerexzess
1. Die Anspruchsgrundlagen
2. Die Rechtsfolge
3. Der auf Herausgabe der Sache verklagte Besitzer
4. Der bösgläubige Besitzer
5.1 Die Haftungsverschärfung
5.2 Der unentgeltliche und der rechtsgrundlose Besitzerwerb
6. Der unverklagte gutgläubige Besitzer
1. Die Anspruchsgrundlagen
2. Die Rechtsfolge
3. Der auf Herausgabe verklagte Besitzer
4.1 Zwei Alternativen
4.2 Der Besitzerwerb durch Besitzdiener
4.3 Die Anmaßung von Eigenbesitz durch den Fremdbesitzer
5. Die Verletzung der Herausgabepflicht
6. Der Besitzerwerb durch verbotene Eigenmacht oder strafbare Handlung
7. Der unverklagte gutgläubige Besitzer
8. Der Exzess des Fremdbesitzers
1.1 Eine abschließende Regelung
1.2 Das gesetzliche System
1.3 Der unberechtigte Fremdbesitzer
1.4 Die Reparaturfälle
2.1 Der Verwendungsersatz
2.2 Das Zurückbehaltungsrecht des Besitzers
2.3 Die Klage des Besitzers auf Verwendungsersatz
2.4 Das Verwertungsrecht des Besitzers
2.5 Entweder – Oder
3.1 Das gesetzliche System und die Beweislast
3.2 Notwendige Verwendungen
3.3 Werterhöhende Verwendungen
3.4 Verwendungen während der Besitzrechtszeit
3.5 Der Wechsel des Eigentümers oder des Besitzers
4. Der verklagte und der bösgläubige Besitzer
5. Die Einwendungen des Eigentümers gegen den Anspruch auf Verwendungsersatz
6.1 Wegnahme oder Verwendungsersatz
6.2 Das Aneignungsrecht des Besitzers
6.3 Der Duldungsanspruch des Besitzers
6.4 Der Ausschluss der Wegnahme
7. Der Verwendungsersatz in der Praxis
1. Der umfassende dingliche Schutz des Eigentums
Abbildung 13: Abwehransprüche des Eigentümers
2. Zivilrechtliche und öffentlichrechtliche Störungsabwehr
3. Die Konkurrenz der Ansprüche
4.1 Die Anspruchskonkurrenz
4.2 Die Geldentschädigung statt Abwehr
5. Dingliche Ansprüche und Schuldrecht
6. Der gesetzliche Schutz anderer Rechte
7. Die entsprechende Anwendung des § 1004
1. Die Anspruchsgrundlage
2. Die Rechtsfolge
3.1 Die Beweislast
3.2 Das Eigentum des Anspruchstellers
3.3 Die Beeinträchtigung des Eigentums
3.4 Wer ist Störer?
Abbildung 14: Eigentumsstörer
3.5 Der Handlungsstörer
3.6 Der Zustandsstörer
3.7 Störende Naturgewalten
3.8 Mehrere Störer
4.1 Die Beweislast
4.2 Rechtsgrundlagen der Duldungspflicht des Eigentümers
Abbildung 15: Duldungspflicht des Eigentümers
4.3 Das Erlöschen der Duldungspflicht
5. Die Duldungspflicht des Eigentümers kraft seiner Einwilligung
6.1 Die Güterabwägung
6.2 Der Verteidigungsnotstand
6.3 Der Angriffsnotstand
6.4 Notstandsexzess und Putativnotstand
7. Die Duldungspflicht des Grundeigentümers kraft Nachbarrechts
8. Die öffentlichrechtliche Duldungspflicht des Eigentümers
8.1 Die Baulast
8.2 Baugenehmigung und Konzession
8.3 Gemeingebrauch und Sondernutzungsrecht
8.4 Lebenswichtige öffentliche Interessen
8.5 Der Naturschutz
9.1 Die Erfüllung der Beseitigungspflicht
9.2 Die Unmöglichkeit der Beseitigung
9.3 Die Mitverursachung der Störung durch den gestörten Eigentümer
9.4 Verjährung und Verwirkung des Beseitigungsanspruchs
1. Die Anspruchsgrundlage
2. Die Rechtsfolge
3.1 Die Beweislast
3.2 Die Wiederholungsgefahr
3.3 Die Gefahr einer ersten Störung
4. Der Einwand der Duldungspflicht des Eigentümers
5. Sonstige Einwendungen und Einreden gegen den Unterlassungsanspruch
1. Die Rechtsgrundlage
2. Die Rechtsfolge
3.1 Die dingliche Einigung über den Eigentumswechsel
3.2 Die Form der Auflassung
3.3 Der Nachweis der Auflassung im Grundbuchverfahren
3.4 Die fiktive Abgabe der Auflassungserklärung
3.5 Die bedingungsfeindliche Auflassung
3.6 Die Vorlage des Verpflichtungsvertrags
3.7 Allgemeine Regeln für die Auflassung
4.1 Besondere Verfahrensregeln
4.2 Die Übereinstimmung von Auflassung und Eintragung
4.3 Die Eintragung nach einer Verurteilung zur Auflassung
4.4 Die Eintragung nach Auflassung eines Teilgrundstücks
4.5 Die materiellrechtliche Prüfung des Grundbuchamts
5.1 Die Rechtsfolge
5.2 Die Genehmigung des Familien- oder Betreuungsgerichts
5.3 Die Genehmigung der Landwirtschaftsbehörde
5.4 Die Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts
1. Der öffentliche Glaube des Grundbuchs
2. Die Beweislast für und gegen den Grunderwerb vom Nichtberechtigten
3. Die Rechtsfolge des Grunderwerbs vom Nichtberechtigten
4. Die Voraussetzungen des Grunderwerbs vom Nichtberechtigten
5. Die Zerstörung des öffentlichen Glaubens
1. Die rechtliche Konstruktion
2. Der Erwerb des Anwartschaftsrechts
3. Die Übertragung des Anwartschaftsrechts
4. Die Pfändung des Anwartschaftsrechts
5. Der Schutz des Anwartschaftsrechts
6. Die Kettenauflassung
1. Die Buchersitzung
2. Der Verzicht auf das Grundeigentum
1. Die gesetzliche Beschränkung des Grundeigentums
Abbildung 16: Beschränkung des Grundeigentums durch das Nachbarrecht
2.1 Das gesetzliche System und die Beweislast
2.2 Die unwesentliche Störung des Grundeigentums
2.3 Die wesentliche Störung des Grundeigentums
2.4 Die Immissionen
3. Gefährliche Anlagen
4. Der drohende Gebäudeeinsturz
5.1 Das gesetzliche System und die Beweislast
5.2 Die Vertiefung des Grundstücks
5.3 Der Verlust der erforderlichen Stütze
5.4 Die genügende andere Befestigung
6.1 Das gesetzliche System und die Beweislast
6.2 Der rechtmäßige Grenzüberbau
6.3 Der rechtswidrige und der zu duldende Grenzüberbau
6.4 Die Duldungspflicht des Nachbarn
6.5 Der rechtzeitige Widerspruch des Nachbarn
6.6 Überbaurente und Grundabnahme
6.7 Der Ersatz des durch den Überbau verursachten Schadens
6.8 Das Eigentum am Grenzüberbau
6.9 Die entsprechende Anwendung der Überbauregeln
7.1 Das gesetzliche System und die Beweislast
7.2 Die Duldungspflicht der Nachbarn
7.3 Die Voraussetzungen der Duldungspflicht des Nachbarn
7.4 Die Ausnahmen von der Duldungspflicht des Nachbarn
7.5 Die Notwegrente
8.1 Worüber Nachbarn streiten
8.2 Die fehlende Grenzabmarkung
8.3 Die Grenzverwirrung
8.4 Gemeinsame Grenzanlagen
9. Das Landesnachbarrecht
1.1 Der Vorrang der Störungsabwehr
1.2 Die Opfergrenze
1.3 Die zivilrechtliche Entschädigung
1.4 Die Enteignungsentschädigung
Abbildung 17: Entschädigung statt Abwehr
1.5 Entschädigung und Schadensersatz
1.6 Anspruchsteller und Anspruchsgegner
2.1 Der Ausgleich für einen Substanzverlust des Eigentums
2.2 Der erforderliche Schallschutz
2.3 Der Nutzungsverlust
2.4 Die Grenze der Entschädigung
3. Der nachbarrechtliche Ausgleichsanspruch nach § 906 II 2
4. Der nachbarrechtliche Ausgleichsanspruch analog § 906 II 2
5.1 Die Enteignung
5.2 Enteignender und enteignungsgleicher Eingriff
5.3 Der Rechtsgedanke der Aufopferung
5.4 Das Sonderopfer durch einen unmittelbaren hoheitlichen Eingriff
5.5 Beispiele für enteignende und/oder enteignungsgleiche Eingriffe, die zu entschädigen sind
5.6 Beispiele gegen eine Entschädigung
6.1 Die Mitverursachung
6.2 Der Vorteilsausgleich
6.3 Verjährung und Ausschlussfrist
1. Kapitel Die gesetzliche Grundlage des Wohnungseigentums
1. Das dreifache rechtsgeschäftliche Fundament
Abbildung 18: Rechtsgrundlagen des Wohnungseigentums
2. Die sachenrechtliche Begründung des Wohnungseigentums
3. Konstruktionsfehler bei der Begründung des Wohnungseigentums
4. Die Vereinbarung der Wohnungseigentümer
5. Der Mehrheitsbeschluss der Wohnungseigentümer
1. Das Wohneigentum als Verbindung zwischen Miteigentum und Sondereigentum
2. Das Miteigentum
3. Das Sondereigentum an der Wohnung oder an anderen Räumen
4. Das Wohnungs- oder Teileigentum
5. Das Teileigentum
6. Die Übertragung und Belastung des Wohnungseigentums
7. Die Veräußerungsbeschränkung
8. Die Änderung des Wohnungseigentums
9. Die Aufhebung des Wohnungseigentums
10. Die Entziehung des Wohnungseigentums
4. Kapitel Die besonderen Rechte und Pflichten des Wohnungseigentümers
1. Die Haftung des Wohnungseigentümers
2. Der Anspruch auf Vereinbarung
3. Die Nutzung des Sondereigentums
4. Pflichten des Wohnungseigentümers
5. Die Nutzung des gemeinschaftlichen Eigentums
6. Die Kosten des gemeinschaftlichen Eigentums
Abbildung 19: Anspruch der Gemeinschaft auf Wohngeld
7. Der Anspruch auf eine ordnungsgemäße Verwaltung
8. Die bauliche Veränderung
9. Das Stimmrecht
1. Die Bruchteilsgemeinschaft
2. Die rechtsfähige Gemeinschaft
3. Das Vermögen der Gemeinschaft
4. Anfang und Ende der rechtsfähigen Gemeinschaft
1. Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer als Verwalterin
2. Die Aufgabe der Verwaltung
3. Die Ausübung von Rechten der Wohnungseigentümer
1. Die Versammlung der Wohnungseigentümer
2. Die Einberufung der Versammlung, der Vorsitz, die Niederschrift und die Beschlusssammlung
3. Die Beschlussfassung
4. Die Beschlusskompetenz der Wohnungseigentümer
5. Der Mehrheitsbeschluss als Rechtsgeschäft
6. Der nichtige Mehrheitsbeschluss
1. Der zertifizierte Verwalter
2. Die Bestellung des Verwalters
3. Der Verwaltervertrag
4. Die Rechte und Pflichten des Verwalters
5. Der Verwalter als Kassenwart
6. Die Haftung des Verwalters
7. Die Abberufung des Verwalters
8. Die Entlastung des Verwalters
9. Der Verwaltungsbeirat
1. Auf dem Weg zum Normalprozess
2. Die Zuständigkeit für Wohnungseigentumsstreitigkeiten
3. Die Beschlussklagen
10. Kapitel Das Wohnungserbbaurecht
1. Beschränkte dingliche Nutzungsrechte
2. Veräußerung und Vererbung
3. Der Heimfallanspruch
4. Die Konkurrenz
1. Erbbaurechtsgesetz und BGB
2. Ein beschränktes dingliches Grundstücksrecht und eine Grundstücksbelastung
3. Ein grundstücksgleiches Recht
1. Das dingliche grundstücksgleiche Recht, auf fremdem Grund ein Bauwerk zu haben
2. Das Eigentum am Bauwerk
3.1 Die Vereinbarung eines Erbbauzinses
3.2 Die Erbbauzinsreallast
3.3 Die Abänderung des Erbbauzinses
3.4 Die Anpassungsvereinbarung
3.5 Die unbillige Erhöhung des Wohn- Erbbauzinses
3.6 Die Anpassung des Erbbauzinses nach Treu und Glauben
3.7 Die Verjährung
1. Die dingliche Einigung über das Erbbaurecht
2. Die Eintragung des Erbbaurechts
3.1 Der sachenrechtliche Typenzwang
3.2 Der Heimfallanspruch des Grundeigentümers
3.3 Die Zustimmung des Grundeigentümers
3.4 Die Erwerbspflicht des Erbbauberechtigten
4.1 Das Gesamterbbaurecht
4.2 Das Eigentümererbbaurecht
4.3 Das Untererbbaurecht
4.4 Das Wohnungserbbaurecht
5. Der Rechtsgrund des Erbbaurechts
1. Die Übertragung des Erbbaurechts
2. Die Belastung des Erbbaurechts
1. Das Erlöschen durch Zeitablauf und die Entschädigung
2. Die Aufhebung des Erbbaurechts
3. Keine Erlöschensgründe
1. Kapitel Gemeinsames und Trennendes
Abbildung 20: Dienstbarkeiten
1. Das umfassende dingliche Nutzungsrecht
2.1 Ein dingliches Recht auf Sachnutzung
2.2 Das Recht des Nießbrauchers zum Besitz
2.3 Der dingliche Rechtsschutz des Nießbrauchs
2.4 Das gesetzliche Schuldverhältnis des Nießbrauchs
3.1 Die Bestellung des Nießbrauchs
3.2 Die Überlassung der Ausübung des Nießbrauchs
3.3 Die Pfändung des Nießbrauchs
3.4 Das Erlöschen des Nießbrauchs
1. Ein beschränktes subjektiv-dingliches Nutzungsrecht an einem Grundstück
2.1 Grunddienstbarkeit und beschränkte persönliche Dienstbarkeit
2.2 Grunddienstbarkeit und Nießbrauch
2.3 Grunddienstbarkeit und Baulast
3.1 Inhalt und Umfang der Grunddienstbarkeit
Abbildung 21: Die Grunddienstbarkeit
3.2 Das Recht, die Grunddienstbarkeit auszuüben
3.3 Der dingliche Rechtsschutz der Grunddienstbarkeit
3.4 Das gesetzliche Schuldverhältnis der Grunddienstbarkeit
3.5 Die Änderung der tatsächlichen Verhältnisse
4.1 Die Bestellung der Grunddienstbarkeit
4.2 Der Vorteil der Grunddienstbarkeit für das herrschende Grundstück
4.3 Der Rechtsgrund der Grunddienstbarkeit
4.4 Das Erlöschen der Grunddienstbarkeit
1. Ein beschränktes dingliches Nutzungsrecht an einem Grundstück
2. Die Rechtsfolgen der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit
3. Die Erscheinungsformen der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit
4. Bestellung und Erlöschen der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit
5. Die Überlassung der Ausübung
6. Das dingliche Wohnungsrecht
1. Ein beschränktes dingliches Recht auf den Erwerb eines Grundstücks
2.1 Der dingliche Rang
2.2 Die Ausübung im Vorkaufsfall
2.3 Der Vorkaufsfall
2.4 Die dingliche Sicherung des Vorkaufsrechts
Abbildung 22: Dingliches Vorkaufsrecht
3.1 Die Bestellung des dinglichen Vorkaufsrechts
3.2 Der Rechtsgrund des dinglichen Vorkaufsrechts
3.3 Die Übertragung des dinglichen Vorkaufsrechts
3.4 Das Erlöschen des dinglichen Vorkaufsrechts
1. Ein beschränktes dingliches Recht auf wiederkehrende Leistungen aus dem belasteten Grundstück
2. Die Erscheinungsformen der Reallast
3.1 Die dingliche Haftung des Grundstücks
3.2 Die persönliche Haftung des Eigentümers
3.3 Die vertragliche Haftung aus dem Verpflichtungsgeschäft
3.4 Die Gesamtschuld nach einem Eigentumswechsel
4.1 Die Bestellung der Reallast
4.2 Der Rechtsgrund der Reallast
4.3 Die Übertragung der Reallast
4.4 Das Erlöschen der Reallast
1. Das beschränkte dingliche Verwertungsrecht an einem Grundstück
2. Die dingliche Sicherheit
Abbildung 23: Dingliche Sicherheiten
3. Das Grundpfandrecht und andere Sicherheiten
4. Grundpfandgläubiger und Kreditgeber
5. Der Wert des Grundpfandrechts
1.1 Beschränkte dingliche Verwertungsrechte
1.2 Die Spezialität
1.3 Die Publizität
1.4 Die Priorität
1.5 Dingliche und schuldrechtliche Haftung
2. Der unterschiedliche rechtliche Zusammenhang des Grundpfandrechts mit der zu sichernden Forderung
3. Das Grundpfandrecht und sein Rechtsgrund
1. Hypothek und Grundschuld mit ihren Ablegern
2. Gesetzliche Kriterien der Artenvielfalt
3.1 Die gesetzliche Regelung
Abbildung 24: Grundpfandrechte nach dem Grad der Akzessorietät
3.2 Die Sicherungshypothek
3.3 Die Verkehrshypothek
3.4 Die Grundschuld
4.1 Die Verkehrsfähigkeit
4.2 Das Buchpfandrecht
4.3 Das Briefpfandrecht
4.4 Inhaberbriefgrundschuld und Papierhypothek
5.1 Fremd- und Eigentümergrundpfandrechte
Abbildung 25: Grundpfandrechte nach der Person des Gläubigers
5.2 Die gesetzliche Eigentümerhypothek
5.3 Die gesetzliche Eigentümergrundschuld
5.4 Die offene und die verdeckte Eigentümergrundschuld
5.5 Die vorläufige und die endgültige Eigentümergrundschuld
6. Die Zahl der haftenden Grundstücke
1. Die Hypothek vor der Grundschuld
2. Anspruchsgrundlagen und Gegennormen
3.1 Das Sachenrecht
3.2 Der allgemeine Teil des BGB
3.3 Das Schuldrecht
1. Ein beschränktes dingliches Verwertungsrecht an einem Grundstück
2. Grundschuldrecht und Hypothekenrecht
3. Die Bestellung der Grundschuld
4. Die Übertragung der Grundschuld
5. Der Haftungsumfang der Grundschuld
6. Der Schutz der Grundschuld bis zur Pfandreife
7. Die Verwertung der Grundschuld nach der Pfandreife
8. Grundschuld und Forderung
9.1 Der Rechtsgrund der Grundschuld
9.2 Der Gegenstand der Sicherungsvereinbarung
9.3 Die Partner der Sicherungsvereinbarung
9.4 Der schuldrechtliche Umfang der Sicherung
9.5 Die Sicherungsvereinbarung als Treuhandgeschäft
9.6 Das Fehlen und der Wegfall des Rechtsgrundes der Grundschuld
9.7 Die Sicherungsgrundschuld
1. Die vorzeitige Pfandreife der gefährdeten Grundschuld
2. Der vorbeugende Rechtsschutz durch einen Unterlassungsanspruch
3. Der Anspruch auf Schadensersatz wegen Verletzung der Grundschuld
1. Zwangsvollstreckung statt privater Verwertung
2.1 Schuld- und Sachenrecht
2.2 Die Darlehensklage
2.3 Die Grundschuldklage
3.1 Die Anspruchsgrundlage
3.2 Die Rechtsfolge
3.3 Der dingliche Gerichtsstand
3.4 Die Anspruchsvoraussetzungen und die Beweislast
Abbildung 26: Anspruchsvoraussetzungen und Beweislast für Darlehen und Grundschuld
4.1 Der richtige Anspruchsteller
4.2 Die Berechtigung des Anspruchstellers kraft Eintragung im Grundbuch
4.3 Die Berechtigung des Anspruchstellers kraft Briefbesitzes und öffentlich beglaubigter Abtretungserklärungen
4.4 Der Erwerb der Grundschuld vom Berechtigten und vom Nichtberechtigten
4.5 Der richtige Anspruchsgegner
5. Die Fälligkeit der Grundschuld
6. Die Höhe der dinglichen Haftung
7.1 Die beurkundete Unterwerfung unter die sofortige Zwangsvollstreckung
7.2 Das selbstständige Schuldversprechen neben Darlehen und Grundschuld
7.3 Die Inhaltskontrolle der vorformulierten vollstreckbaren Urkunde
7.4 Die Verteidigung des Eigentümers gegen die vollstreckbare Urkunde
7.5 Der Streit über Inhalt oder Umfang der vollstreckbaren Urkunde
7.6 Die Titelübertragung auf den Zessionar der Grundschuld
8.1 Zwangsversteigerung und/oder Zwangsverwaltung
8.2 Das Erlöschen der Grundschuld durch Befriedigung des Gläubigers
8.3 Die Grundschuld im geringsten Gebot
8.4 Der Ausfall der nachrangigen Grundschuld
9. Die Grundschuld im Insolvenzverfahren
1.1 Die Behauptungs- und Beweislast des Eigentümers
1.2 Dingliche und schuldrechtliche Einwendungen
1.3 Einwendungen gegen den ursprünglichen Grundschuldgläubiger und gegen dessen Rechtsnachfolger
Abbildung 27: Einwendungen des Eigentümers gegen den Zessionar der Grundschuld
2. Der dingliche Einwand eines unwirksamen Erwerbs der Grundschuld
3. Der dingliche Einwand des Erlöschens der Grundschuld
4. Der dingliche Einwand des Verzichts auf die Grundschuld
5.1 Das Ablösungsrecht und die Rechtsfolge der Ablösung
5.2 Ablösung der Grundschuld oder Tilgung des Darlehens?
5.3 Tilgungsvereinbarung und Tilgungsbestimmung
5.4 Die Zahlung des Eigentümers an einen Scheingläubiger
5.5 Das Zurückbehaltungsrecht des Eigentümers
5.6 Der Ausschluss der Grundschuldablösung
6. Das Recht des Eigentümers, der Grundschuld zu widersprechen
7. Die schuldrechtliche Bereicherungseinrede
8. Der schuldrechtliche Einwand fehlender Valutierung
9. Sonstige schuldrechtliche Einreden
10.1 Dingliche Einwendungen und Einreden
10.2 Einwendungen und Einreden aus einem Schuldverhältnis mit dem Zessionar
10.3 Schuldrechtliche Einwendungen und Einreden gegen die gesicherte Forderung
10.4 Schuldrechtliche Einreden aus der Sicherungsvereinbarung
10.5 Andere schuldrechtliche Einreden
1. Zwei Anspruchsgrundlagen
Abbildung 28: Anspruch auf Rückgewähr der Grundschuld
2. Der vertragliche Anspruch aus der Sicherungsvereinbarung
3.1 Das Wahlrecht des Sicherungsgebers
3.2 Die Teilrückgabe der Grundschuld
3.3 Das Leistungsverweigerungsrecht des Sicherungsgebers
3.4 Die Verletzung des Rückgewähranspruchs
4. Die Voraussetzungen des Rückgewähranspruchs
5. Der Sicherungsvertrag
6.1 Die Partner des Sicherungsvertrags
6.2 Die Rechtsnachfolge in den Rückgewähranspruch und in die Rückgewährpflicht
7.1 Grundschuld und Forderung
7.2 Der Umfang der Sicherung
7.3 Die nachträgliche Übersicherung
8.1 Die Auslegung der Zweckerklärung
8.2 Überraschende Klauseln der vorformulierten Zweckerklärung
8.3 Die Inhaltskontrolle der vorformulierten Zweckerklärung
9. Einwendungen und Einreden des Sicherungsnehmers gegen den Rückgewähranspruch
10. Die Abtretung des Rückgewähranspruchs
11. Die Pfändung des Rückgewähranspruchs
12. Die Konkurrenz zwischen mehreren Abtretungen und/oder Pfändungen des Rückgewähranspruchs
13. Der Rückgewähranspruch in der Zwangsversteigerung
14. Der Rückgewähranspruch als Leistungsverweigerungsrecht
15. Der Rückgewähranspruch als Widerspruchsrecht in der Zwangsvollstreckung
1. Die wirtschaftliche Einheit
2.1 Die latente Haftung bis zur Beschlagnahme
2.2 Die akute Haftung durch Beschlagnahme
3. Der rechtliche Zusammenhang zwischen Sachenrecht und Vollstreckungsrecht
4.1 Die Bestandteile des Grundstücks
4.2 Die Verfügungsmacht des Eigentümers
4.3 Abschreibung, Vereinigung und Zuschreibung
5.1 Die latente Haftung bis zur Beschlagnahme
5.2 Die Enthaftung vor der Beschlagnahme
5.3 Die akute Haftung durch Beschlagnahme
5.4 Die Enthaftung trotz Beschlagnahme
6.1 Die latente Haftung bis zur Beschlagnahme
6.2 Die Enthaftung des Zubehörs vor der Beschlagnahme
6.3 Die akute Haftung des Zubehörs durch die Beschlagnahme
6.4 Die Enthaftung des Zubehörs trotz Beschlagnahme
7.1 Die latente Haftung bis zur Beschlagnahme
7.2 Die Enthaftung von Rückständen
7.3 Die Enthaftung durch Vorausverfügung
7.4 Die akute Haftung der Miet- oder Pachtzinsforderung durch die Beschlagnahme
8.1 Die Schadensversicherung
8.2 Die Haftung bis zur Beschlagnahme
8.3 Die Haftung nach der Beschlagnahme
8.4 Die Konkurrenz zwischen Grundschuld und Auflassungsvormerkung
1.1 Eine dingliche Grundstücksbelastung
1.2 Fremd- und Eigentümergrundschuld
1.3 Nur Verkehrsgrundschuld
1.4 Brief- und Buchgrundschuld
1.5 Einzel- und Gesamtgrundschuld
1.6 Die Umwandlung der Grundschuld
1.7 Grundschuld und Forderung
2. Der Gegenstand der Belastung mit einer Grundschuld
3.1 Der gesetzliche Normalfall
Abbildung 29: Bestellung der Briefgrundschuld
3.2 Erster Akt: Die dingliche Einigung
3.3 Zweiter Akt: Die Eintragung im Grundbuch
3.4 Dritter Akt: Die Übergabe des Grundschuldbriefs
4. Die Bestellung der Buchgrundschuld
5. Der Widerspruch zwischen Einigung und Eintragung
6. Der Erwerb der Grundschuld vom Nichtberechtigten
7. Die Sicherung eines Zwischenkredits durch die Grundschuld
1. Sachenrecht pur mit schuldrechtlichen Schwächen
2.1 Die Abtretung außerhalb des Grundbuchs
Abbildung 30: Übertragung der Briefgrundschuld
2.2 Die Form der Abtretung
2.3 Die Übergabe des Grundschuldbriefs
3.1 Die Grundlage des Rechtsscheins
3.2 Der Ausschluss des Erwerbs vom Nichtberechtigten
3.3 Der Widerspruch zwischen Grundbuch und Grundschuldbrief
4. Die Abtretung der Buchgrundschuld
5.1 Die Abtretung künftiger Zinsen
5.2 Die Abtretung rückständiger Zinsen
6.1 Sachenrecht und Schuldrecht
6.2 Die einheitliche Abtretung von Grundschuld und Forderung
6.3 Die Abtretung der Grundschuld ohne die Forderung
6.4 Die Abtretung der Forderung ohne die Grundschuld
1. Verpfändung und Sicherungsabtretung der Grundschuld
2. Die Pfändung der Grundschuld
1. Eine Grundschuld auf mehreren Grundstücken
2. Die Rechtsgrundlage der Gesamtgrundschuld
3. Die Vor- und Nachteile der Gesamtgrundschuld
4. Die Rechtsfolgen der Gesamtgrundschuld
5.1 Die rechtsgeschäftliche Bestellung
5.2 Die Entstehung durch Gesetz
6.1 Die Tilgung der Darlehensschuld
6.2 Die Befriedigung des Gläubigers aus der Gesamtgrundschuld
6.3 Die Ablösung der Gesamtgrundschuld
7. Der Verzicht des Gläubigers auf die Gesamtgrundschuld
8. Die Vereinbarung des Gläubigers mit einem Eigentümer
1. Eine ganz besondere Spezies
Abbildung 31: Eigentümergrundschuld
2.1 Keine Verwertung durch Zwangsvollstreckung des Eigentümers
2.2 Die Rangbesetzung
3. Die rechtsgeschäftliche Bestellung der Eigentümergrundschuld
4.1 Entstehungsgründe
4.2 Die „Hypothek“ ohne Forderung
4.3 Die „Hypothek“ ohne Briefübergabe
4.4 Die Ablösung der Grundschuld oder Hypothek
4.5 Der Verzicht auf Grundschuld oder Hypothek
4.6 Die Vereinigung von Eigentum und Grundpfandrecht in einer Hand
5.1 Die Rechtsfolge der Abtretung
5.2 Die vom Eigentümer bestellte Eigentümergrundschuld
5.3 Die endgültige gesetzliche Eigentümergrundschuld
5.4 Die vorläufige gesetzliche Eigentümergrundschuld
5.5 Die künftige gesetzliche Eigentümergrundschuld
6. Die Pfändung der Eigentümergrundschuld
7. Die Eigentümergrundschuld in der Zwangsversteigerung
1. Das gesetzliche System
2. Der Löschungsanspruch als Inhalt des Grundpfandrechts
3. Die Rechtsfolge des gesetzlichen Löschungsanspruchs
4. Die Voraussetzung des gesetzlichen Löschungsanspruchs
5. Gläubiger und Schuldner des gesetzlichen Löschungsanspruchs
6. Der Ausschluss des gesetzlichen Löschungsanspruchs
7. Der gesetzliche Löschungsanspruch in der Zwangsversteigerung
8. Der gesetzliche Löschungsanspruch und der schuldrechtliche Rückgewähranspruch
9. Die Löschungsvormerkung
1. Ein beschränktes dingliches Verwertungsrecht an einem Grundstück
Abbildung 32: Hypothek
2. Eine akzessorische dingliche Sicherheit für eine Geldforderung
3. Die Verwertung der Hypothek durch Zwangsvollstreckung
4. Der Erwerb der Hypothek
5. Der Schutz der Hypothek bis zur Pfandreife
1. Keine private Verwertung
2.1 Schuld- und Sachenrecht
2.2 Die Darlehensklage
2.3 Die Hypothekenklage
3.1 Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge
3.2 Die Anspruchsvoraussetzungen und die Beweislast
4.1 Die Anspruchsberechtigung
4.2 Die Anspruchsberechtigung kraft Eintrags im Grundbuch
4.3 Die Anspruchsberechtigung kraft Briefbesitzes und öffentlich beglaubigter Abtretungserklärungen
4.4 Der Erwerb der Hypothek vom Berechtigten und vom Nichtberechtigten
4.5 Der richtige Anspruchsgegner
5. Die Fälligkeit der Hypothek
6. Der Umfang der dinglichen Hypothekenhaftung
1.1 Dingliche und schuldrechtliche Einwendungen und Einreden
1.2 Einwendungen gegen den ursprünglichen Gläubiger und gegen dessen Rechtsnachfolger
2.1 Die unwirksame Bestellung der Hypothek
2.2 Der Verlust der Hypothek
2.3 Der Anspruch des Eigentümers auf Löschungsbewilligung
3. Einwendungen des Eigentümers gegen die gesicherte Forderung
4. Einreden des Eigentümers gegen die gesicherte Forderung
5. Einreden des Eigentümers gegen die Hypothek
6.1 Dingliche Einwendungen des Eigentümers gegen den Erwerb der Hypothek
6.2 Einwendungen des Eigentümers gegen die gesicherte Forderung
6.3 Einreden des Eigentümers gegen die gesicherte Forderung
6.4 Einreden des Eigentümers gegen die Hypothek
1.1 Eine akzessorische dingliche Grundstücksbelastung
1.2 Verkehrs- und Sicherungshypothek
1.3 Brief- und Buchhypothek
1.4 Die Umwandlung der Hypothek
1.5 Hypothek und Forderung
1.6 Der Gegenstand der Belastung
2. Die mehraktige dingliche Bestellung
3.1 Gläubiger und Schuldner
3.2 Die bestimmte Geldforderung
3.3 Die künftige und die bedingte Geldforderung
3.4 Für eine Forderung nur eine Hypothek
3.5 Keine Hypothek ohne Forderung
1.1 Die Hypothek als unselbstständiges Sicherungsrecht
1.2 Die Abtretung der gesicherten Forderung nach Sachenrecht
1.3 Die Beweislast des Abtretungsempfängers
1.4 Der öffentliche Glaube des Grundbuchs
2. Die Abtretung der Briefhypothek außerhalb des Grundbuchs
3.1 Die Rechtsgrundlagen
3.2 Der Erwerb der Briefhypothek nach § 892 I 1
3.3 Der Erwerb der Briefhypothek nach § 1155
3.4 Der Erwerb der Briefhypothek nach § 1138
4. Die Abtretung der Buchhypothek
5.1 Die Abtretung künftiger Zinsen
5.2 Die Abtretung rückständiger Zinsen
1. Die Verpfändung der Hypothek
2. Die Pfändung der Hypothek
1. Eine Hypothek auf mehreren Grundstücken
2.1 Das gesetzliche System
2.2 Der Eigentümer aller belasteten Grundstücke ist auch der Schuldner
2.3 Die Eigentümer der belasteten Grundstücke sind auch die Schuldner
2.4 Die Eigentümer der belasteten Grundstücke sind nicht auch die Schuldner
3. Hypothek und Bürgschaft
1. Die total forderungsabhängige Hypothek
2.1 Die totale Abhängigkeit von der Forderung
2.2 Die Beweislast
2.3 Die Bestellung der Sicherungshypothek
2.4 Die Abtretung der Sicherungshypothek
2.5 Die fehlende Valutierung der Sicherungshypothek
3. Die Bauhandwerkersicherungshypothek
4. Die Höchstbetragshypothek
5. Die Wertpapierhypothek
6. Die Zwangshypothek
7. Die Arresthypothek
8. Die Sicherungshypothek kraft Gesetzes
1. Die rechtsgeschäftlichen Gestaltungsmöglichkeiten
2.1 Die gesetzliche Regel
2.2 Dingliche Rechtsänderungen außerhalb des Grundbuchs
3.1 Die Gesellschaft
3.2 Die Erbengemeinschaft
3.3 Die Gütergemeinschaft
1.1 Ein dinglicher Vertrag
1.2 Die Bindung an die Einigung und ihr Widerruf
2.1 Der Mindestinhalt der Eintragung und ihre Bezugnahme auf die Eintragungsbewilligung
2.2 Die Auslegung des Grundbuchs
3. Der Widerspruch zwischen Einigung und Eintragung
3. Kapitel Die Änderung des Inhalts eines Grundstücksrechts
1. Die Aufhebungserklärung und die Löschung im Grundbuch
2. Die erforderliche Zustimmung des Eigentümers oder eines Dritten
1. Das Problem des mehraktigen dinglichen Rechtsgeschäfts
2. Der Verlust der Geschäftsfähigkeit und der Tod eines Beteiligten
3. Der Verlust der Rechtszuständigkeit des Verfügenden
4. Die Beschränkung der Verfügungsmacht des Verfügenden
1. Die Konkurrenz der Grundstücksrechte
2. Das gesetzliche System
3. Der vereinbarte Rang eines Grundstücksrechts
4.1 Eine dingliche Verfügung
4.2 Die Zustimmung Dritter
5. Der Rangvorbehalt
6.1 Die Priorität
6.2 Die bewegliche Rangordnung
6.3 Die Reihenfolge der Eintragungen im Grundbuch
7. Kapitel Die Verjährung dinglicher Ansprüche aus Grundstücksrechten
1. Der Versuch einer Definition
2. Das besondere Sicherungsbedürfnis
3. Vormerkung und Widerspruch
1. Eine starke dingliche Sicherung
Abbildung 33: Auflassungsvormerkung
2.1 Eine komplexe rechtliche Konstruktion
2.2 Die objektiv beschränkte Unwirksamkeit
2.3 Die subjektiv beschränkte Unwirksamkeit
2.4 Die vormerkungswidrige Verfügung oder Zwangsvollstreckung
3.1 Zwei Anspruchsgegner des Vormerkungsberechtigten
3.2 Der Anspruch des Vormerkungsberechtigten gegen den Vormerkungsschuldner
3.3 Der Anspruch des Vormerkungsberechtigten gegen den Zwischenerwerber
3.4 Die Erfüllung des vorgemerkten Anspruchs
3.5 Beispiele zur Vormerkung
4. Die Rangsicherung durch die Vormerkung
5. Die Vormerkung in der Zwangsversteigerung
6. Die Vormerkung in der Insolvenz des Schuldners
7.1 Der Anspruch auf Schadensersatz aus unerlaubter Handlung
7.2 Die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung
1. Das gesetzliche System und die Beweislast
2.1 Die Vormerkung für einen unbedingten Anspruch
2.2 Die Vormerkung für einen bedingten Anspruch
2.3 Die Vormerkung für einen künftigen Anspruch
2.4 Die rechtliche Abhängigkeit der Vormerkung vom gesicherten Anspruch
2.5 Die vertragliche Änderung des vorgemerkten Anspruchs
3.1 Materielle und formelle Bewilligung
3.2 Die Bewilligung der Vormerkung durch den Nichtberechtigten
4. Die einstweilige Verfügung auf Eintragung einer Vormerkung
5. Die Eintragung der Vormerkung
6. Die Verfügungsbeschränkung zwischen Bewilligung und Eintragung
1. Die Verteidigung des Vormerkungsgegners
2. Einwendungen und Einreden gegen den vorgemerkten Anspruch
3. Einwendungen gegen die Bewilligung oder die einstweilige Verfügung
4. Die Verteidigung des Zwischenerwerbers
1. Der Erwerb vom Berechtigten
2. Der Erwerb vom Nichtberechtigten
3. Das unrichtige Grundbuch
6. Kapitel Das relative Veräußerungsverbot
1. Das gesetzliche System
2.1 Die Umkehr der Behauptungs- und Beweislast
2.2 Die Vermutung für den Bestand des eingetragenen Rechts
2.3 Die Vermutung für das Nichtbestehen des gelöschten Rechts
2.4 Die Vermutung für den früheren Bestand des gelöschten Rechts
3. Der Vermutungstatbestand
4. Die Widerlegung der gesetzlichen Vermutung
5. Die gesetzliche Vermutung für eingetragene Gesellschafter
1. Die Funktion des Grundbuchs und der Rechtsschein
2. Das gesetzliche System
1.1 Ein dinglicher Rechtserwerb
1.2 Ein Erwerb mit Rechtsgrund
2.1 Zwei Voraussetzungen
2.2 Das unrichtige Grundbuch
2.3 Ein rechtsgeschäftlicher dinglicher Erwerb
2.4 Ein Verkehrsgeschäft
2.5 Kein Erwerb vom Nichtberechtigten kraft Gesetzes oder durch Zwangsvollstreckung
3.1 Die Beweislast
3.2 Der Widerspruch gegen den unrichtigen Grundbucheintrag
3.3 Die Kenntnis des Erwerbers
4. Kapitel Der rechtsgeschäftliche Erwerb trotz Verfügungsbeschränkung
5. Kapitel Andere Verfügungen des eingetragenen Nichtberechtigten
1. Das unrichtige Grundbuch
2. Die dinglichen Rechtsänderungen außerhalb des Grundbuchs
3. Die Mängel des dinglichen Rechtsgeschäfts
4. Der Widerspruch zwischen dinglicher Einigung und Eintragung
5. Die Fehler des Grundbuchamts
6. Die Risiken des unrichtigen Grundbuchs
7. Die Schutzmaßnahmen gegen ein unrichtiges Grundbuch
1. Ein dingliches Sicherungsmittel
2. Die Rechtsfolge des Widerspruchs
3. Die Voraussetzungen des Widerspruchs
4. Der Widerspruch gegen eine Vormerkung
1.1 Der dingliche Anspruch auf Grundbuchberichtigung
1.2 Der schuldrechtliche Anspruch auf Grundbuchberichtigung
2.1 Die Bewilligung der Grundbuchberichtigung
2.2 Klage auf und Verurteilung zur Berichtigungsbewilligung
2.3 Die eintragbare Grundbuchberichtigung
2.4 Weder Abtretung noch Pfändung des Grundbuchberichtigungsanspruchs
2.5 Folgeansprüche aus der Unrichtigkeit des Grundbuchs
2.6 Der Nachweis der Unrichtigkeit des Grundbuchs
3.1 Die Beweislast
3.2 Das unrichtige Grundbuch
3.3 Anspruchsteller und Anspruchsgegner des Grundbuchberichtigungsanspruchs
4.1 Die Verteidigung des Anspruchsgegners
4.2 Der Anspruch des Anspruchsgegners auf das eingetragene Recht
4.3 Das Zurückbehaltungsrecht des Anspruchgegners wegen eines fälligen Gegenanspruchs
4.4 Das Zurückbehaltungsrecht des Anspruchsgegners wegen seiner Verwendungen
1. Ein öffentliches Register
2. Die Rechtsgrundlagen des Grundbuchs
3. Die Publizität des Grundbuchs
4. Das Grundbuchamt
5.1 Eine rechtliche Größe
5.2 Zusammenschreiben, Vereinigen und Zuschreiben von Grundstücken
5.3 Erbbaurecht und Erbbaugrundbuch
5.4 Wohnungseigentum und Wohnungsgrundbuch
5.5 Buchungsfreie Grundstücke
6.1 Was muss und was kann eingetragen werden?
6.2 Der öffentliche Glaube als Maßstab
6.3 Die inhaltlich unzulässige Eintragung
7.1 Sein Inhalt
7.2 Der Eigentümer des Grundstücks
7.3 Real- und Personalfolium
7.4 Das maschinell geführte (elektronische) Grundbuch
7.5 Die Bestandteile des Grundbuchblatts
8. Das Recht auf Einsicht in das Grundbuch
1. Die Voraussetzungen der Eintragung
2. Sachenrecht und Grundbuchverfahrensrecht
3. Das materielle Liegenschaftsrecht
4. Das formelle Liegenschaftsrecht
5. Das Beispiel einer Briefgrundschuld
Abbildung 34: Bestellung einer Briefgrundschuld nach materiellem Recht und nach Verfahrensrecht
1. Eine Verfahrenshandlung
2. Das Antragsrecht
3. Die Wirkung des Eintragungsantrags
4. Das amtliche Ersuchen um Eintragung
5. Die Eintragung von Amts wegen
1. Eine Verfahrenshandlung
2. Die Bewilligung des Betroffenen
3. Die Eintragungsbewilligung und die dingliche Willenserklärung
4. Die Eintragungsbewilligung als Bestandteil des Grundbucheintrags
5. Der Nachweis der Auflassung
6. Der Nachweis der Unrichtigkeit des Grundbuchs
1. Die gesetzliche Regel
2. Die gesetzlichen Ausnahmen
6. Kapitel Die Formstrenge des Grundbuchverfahrensrechts
7. Kapitel Was prüft das Grundbuchamt?
1. Die Eintragung im Grundbuch
2. Der Amtswiderspruch
3. Die Amtslöschung
4. Die Ablehnung des Eintragungsantrags
5. Die Zwischenverfügung
6.1 Die Beschwerde gegen die Eintragung
6.2 Die Beschwerde gegen die Ablehnung der Eintragung
1. Der Inhalt des Eigentums
2. Die Schranken des Eigentums
3. Die Erwerbsarten
4. Das Eigentum an beweglichen Sachen als Sicherheit
1. Die Übereignung als abstrakte dingliche Verfügung
2. Der Doppeltatbestand der Übereignung
3. Die Übereignung als Rechtsgeschäft
4.1 Vier Varianten der Übergabe und des Übergabeersatzes
4.2 Der gemeinsame Nenner
Abbildung 35: Die Rolle des Besitzes bei der Übereignung
4.3 Der Erwerb des Eigentums kraft Gesetzes und durch Hoheitsakt
1. Der gesetzliche Normalfall und die Beweislast
2.1 Ein dinglicher Vertrag
2.2 Ein formfreier Vertrag
2.3 Die zu übereignende bewegliche Sache
2.4 Vertragsbindung und Widerruf
3. Die Übergabe
Abbildung 36: Übergabe
4. Die Übergabe mittels Besitzdieners oder Besitzmittlers
5. Die Übergabe durch oder an einen Dritten auf Geheiß des Veräußerers oder des Erwerbers
6. Die Übereignung mittels eines Traditionspapiers
7. Die Übereignung eines nicht eingetragenen Seeschiffs
2. Kapitel Die Übereignung kurzer Hand
1. Das Besitzmittlungsverhältnis als Übergabeersatz
2. Das rechtsgeschäftliche Besitzmittlungsverhältnis
3. Ein Doppeltatbestand
4. Das gesetzliche Besitzmittlungsverhältnis
1. Zwei Fallgruppen
2. Der Veräußerer als mittelbarer Besitzer
3. Der besitzlose Veräußerer
1. Besitz und Eigentum
2. Die Beweislast für und gegen einen Eigentumserwerb vom Nichtberechtigten
Abbildung 37: Der Erwerb des Eigentums an beweglichen Sachen vom Nichtberechtigten
1. Der Eigentumserwerb
2. Der rechtmäßige Eigentumserwerb
3. Der Eigentumserwerb mit Rechtsgrund
4. Die Haftung des Veräußerers und des Erwerbers
1. Die Übereignung durch Einigung und Übergabe
2. Die Übereignung kurzer Hand
3. Die Übereignung durch Einigung und Vereinbarung eines Besitzmittlungsverhältnisses
4. Die Übereignung durch Einigung und Abtretung des Herausgabeanspruchs
1.1 Ein Ausnahmetatbestand
1.2 Der für den bösen Glauben maßgebliche Zeitpunkt
1.3 Kenntnis und grobfahrlässige Unkenntnis des Erwerbers
2.1 Ein Ausnahmetatbestand
2.2 Das Abhandenkommen der beweglichen Sache
2.3 Der rechtserhaltende Gegeneinwand
1. Die Rechtsfolge
2. Die Voraussetzung des lastenfreien Erwerbs
3. Die Einwendungen gegen einen lastenfreien Erwerb
1. Nach dem BGB
2. Nach dem HGB
1. Die allgemeine Beweislastregel für subjektive Rechte
2. Die Umkehr der Beweislast durch die gesetzliche Vermutung
3. Die Widerlegung der gesetzlichen Vermutung
1. Drei gesetzliche Eigentumsvermutungen
2.1 Der unmittelbare Eigenbesitz als Normalfall
2.2 Der vermutete Eigentumserwerb durch Erwerb des unmittelbaren Besitzes
3. Der rechtliche Zusammenhang der drei Eigentumsvermutungen
4. Die Reichweite der Eigentumsvermutungen
1.1 Der Eigentumserwerb durch Besitzerwerb
1.2 Die Vermutung für Eigenbesitzerwerb
1.3 Die Vermutung für unbedingten Eigentumserwerb
1.4 Die Vermutung für Erwerb von Miteigentum
1.5 Keine Vermutung für gegenwärtiges Eigentum
2. Der Tatbestand der Eigentumsvermutung
3. Die Widerlegung der Eigentumsvermutung
4. Der Einwand des Abhandenkommens
5. Der Einwand des Eigentumsverlusts
4. Kapitel Die Eigentumsvermutung für den früheren unmittelbaren Besitzer
5. Kapitel Die Eigentumsvermutung für den mittelbaren Besitzer
1. Geliehen oder geschenkt? (nach BGH WM 70, 1272)
2. Die Lieferung unter Eigentumsvorbehalt oder unbedingt? (nach BGH NJW 75, 1269)
3. Der Streit über die Verfügungsmacht des Veräußerers (nach BGH NJW 61, 779)
4. Der Eigentumserwerb vor dem Besitzerwerb (nach BGH NJW 84, 1456)
5. Der Veräußerungserlös für angeblich gestohlene Ware (nach BGH NJW 95, 1293)
6. Keine Vermutung für den Fremdbesitzer (nach BGH WM 68, 406)
7. Die Auflösung eines fremden Wertpapierdepots (nach BGH WM 74, 591)
8. Eigentumsvorbehalt oder Sicherungseigentum? (nach BGH MDR 69, 750)
9. Wertpapierdepot als Oderkonto: Übereignung oder nur Verfügungsermächtigung? (nach BGH NJW 97, 1434)
10. Die Veräußerung eines Kraftfahrzeugs ohne Brief (nach BGH NJW 2006, 3488)
1. Die wirtschaftliche Seite des Eigentumsvorbehalts
2. Die schuldrechtliche Seite des Eigentumsvorbehalts
3.1 Die aufschiebend bedingte Übereignung
3.2 Das Anwartschaftsrecht des Käufers
3.3 Der verlängerte Eigentumsvorbehalt
1. Ein Bestandteil des Kaufvertrags
2. Der vorformulierte Eigentumsvorbehalt
3. Die Abwehrklausel des Käufers
4. Die Spielarten des Eigentumsvorbehalts
5.1 Der Konzernvorbehalt
5.2 Die Übersicherung
6. Die Erfüllung des Vorbehaltskaufs
7. Der Herausgabeanspruch des Vorbehaltsverkäufers
8. Der Verbraucherschutz
1.1 Der vereinbarte Eigentumsvorbehalt
1.2 Der einseitige Eigentumsvorbehalt
1.3 Der Erwerb unter Eigentumsvorbehalt vom Nichtberechtigten
1.4 Der nachträgliche Eigentumsvorbehalt
2.1 Der mittelbare Eigenbesitz des Vorbehaltsverkäufers
2.2 Das auflösend bedingte Eigentum des Vorbehaltsverkäufers
2.3 Die Zwangsvollstreckung gegen den Vorbehaltskäufer in die Vorbehaltsware
2.4 Die Insolvenz des Vorbehaltskäufers
3.1 Das Recht des Vorbehaltskäufers zum Besitz
3.2 Das aufschiebend bedingte Eigentum des Vorbehaltskäufers
3.3 Die Zwangsvollstreckung gegen den Vorbehaltsverkäufer in die Vorbehaltsware
3.4 Die Insolvenz des Vorbehaltsverkäufers
1. Die rechtliche Konstruktion
2.1 Die aufschiebend bedingte Übereignung
2.2 Die Kaufpreiszahlung als Bedingung
3.1 Nach den Regeln der Übereignung
3.2 Das Anwartschaftsrecht als Sicherheit
3.3 Die Verfügung des Anwartschaftsberechtigten über sein eigenes Recht
3.4 Der Erwerb des Eigentums unmittelbar vom Verkäufer
3.5 Die spätere Änderung des Eigentumsvorbehalts oder des Kaufvertrags
3.6 Der Erwerb des Anwartschaftsrechts vom Nichtberechtigten
4. Die Verpfändung des Anwartschaftsrechts
5. Die Pfändung des Anwartschaftsrechts
6. Das Besitzrecht des Erwerbers eines Anwartschaftsrechts
7. Das Anwartschaftsrecht als „sonstiges“ Recht
8.1 Ohne Kaufvertrag kein Anwartschaftsrecht
8.2 Das Ende des Anwartschaftsrechts auch in der Hand des Rechtsnachfolgers
8.3 Die Aufhebung des hypothekarisch belasteten Anwartschaftsrechts
1. Die rechtliche Konstruktion
Abbildung 38: Verlängerter Eigentumsvorbehalt
2. Der Eigentumsvorbehalt als Bestandteil des verlängerten Eigentumsvorbehalts
3.1 Die Beschränkung auf normale Veräußerungen
3.2 Der Widerruf der Verfügungsermächtigung
4.1 Die Vorausabtretung
4.2 Die ausreichende Bestimmung der künftigen Forderung
4.3 Die Sicherungsabtretung
4.4 Die Einziehungsermächtigung
5. Die Verarbeitungsabrede als Bestandteil des verlängerten Eigentumsvorbehalts
6. Die Konkurrenz des verlängerten Eigentumsvorbehalts mit der Sicherungsglobalzession
6. Kapitel Der erweiterte Eigentumsvorbehalt
1. Eine selbstständige dingliche Sicherheit
2. Eine verborgene dingliche Sicherheit
3. Ein schuldrechtlich beschränktes Eigentum
4. Das Problem des Sicherungseigentums
1. Ein schuldrechtlicher Verpflichtungsvertrag
2. Der Rechtsgrund der Sicherungsübereignung
3.1 Mehr rechtliches Können als rechtliches Dürfen
3.2 Die Rückgabe des Sicherungsguts nach Zweckerfüllung oder Zweckverfehlung
4.1 Die Anspruchsgrundlage
4.2 Die Anspruchsvoraussetzung: Eine dauerhafte Übersicherung
4.3 Die Deckungsgrenze
5.1 Die Rechtsfolge
5.2 Die Beweislast
5.3 Der maßgebliche Zeitpunkt
5.4 Der Nichtigkeitsgrund
1.1 Der Eigentumserwerb
1.2 Der Erwerb mittelbaren Eigenbesitzes
1.3 Der Vollstreckungszugriff auf das Sicherungseigentum
1.4 Die Insolvenz des Sicherungsgebers
2.1 Dingliche Einigung und Vereinbarung eines Besitzmittlungsverhältnisses
2.2 Der Gegenstand der Sicherungsübereignung
3. Die unwirksame Sicherungsübereignung
1. Das gesetzliche System
2.1 Der Verlust der Sonderrechtsfähigkeit
2.2 Die Verbindung einer beweglichen Sache mit einem Grundstück
2.3 Die Verbindung beweglicher Sachen
3. Die Vermischung beweglicher Sachen
4.1 Der Interessenkonflikt zwischen Lieferant und Verarbeiter
4.2 Die Rechtsfolgen der Verarbeitung
4.3 Die Verarbeitung eines Stoffes
4.4 Der Hersteller der neuen Sache
4.5 Der geringere Wert der Verarbeitung
5.1 Die Anspruchsgrundlage
5.2 Die Rechtsfolge des Bereicherungsausgleichs
5.3 Die Anspruchsvoraussetzungen
5.4 Die Einwendungen gegen den Bereicherungsanspruch
5.5 Das Wegnahmerecht
2. Kapitel Das Eigentum an Schuldurkunden, Rektapapieren und Kraftfahrzeugbriefen
1.1 Vom Grundtatbestand zu den Sondertatbeständen
1.2 Die Beweislast
1.3 Die Trennung der Erzeugnisse und sonstigen Bestandteile
1.4 Der Rechtsgrund des Eigentumserwerbs
2. Der Eigentumserwerb des Sacheigentümers
3. Der Eigentumserwerb des dinglich Nutzungsberechtigten
4.1 Die Erwerbsvoraussetzungen
4.2 Die Einwendung des bösen Glaubens
5.1 Die Erwerbsvoraussetzungen
5.2 Die Gestattung der Aneignung
6. Der Eigentumserwerb vom Nichtberechtigten
4. Kapitel Die Aneignung herrenloser beweglicher Sachen
1. Das gesetzliche System
2. Der Erwerb des Eigentums an gefundenen Sachen
3. Das gesetzliche Schuldverhältnis des Fundes
4. Der Fund in einer Behörde oder einem Verkehrsunternehmen
5. Der Schatzfund
6. Kapitel Die Ersitzung
1. Kapitel Das gesetzliche System
2. Kapitel Der Nießbrauch an beweglichen Sachen
1. Die Pfandrechtsarten
2. Die Akzessorietät des Pfandrechts
3. Die Spezialität des Pfandrechts
4. Die Publizität des Pfandrechts
5. Die Erscheinungsformen des Vertragspfandrechts
1. Ein dingliches Verwertungsrecht
2.1 Ohne Forderung kein Pfandrecht
2.2 Das Ablösungsrecht
2.3 Das Vorzugs- und Absonderungsrecht
3. Der Rang des Pfandrechts
4. Die Konkurrenz des Pfandrechts mit der Bürgschaft
5. Der absolute Rechtsschutz des Pfandrechts
6. Das gesetzliche Schuldverhältnis zwischen Verpfänder und Gläubiger
7. Der Sicherungsvertrag als Rechtsgrund
1. Der Gegenstand des Vertragspfandrechts
2. Die Sicherung einer Forderung
3.1 Ein Doppeltatbestand
3.2 Die Einigung
3.3 Die Übergabe und deren Ersatz
3.4 Die Verschaffung eines rechtlich gebundenen Mitbesitzes
4. Der Erwerb des Pfandrechts vom Nichtberechtigten
5. Pfandrechtsähnliche Sicherheiten
6. Kapitel Die Übertragung des Vertragspfandrechts
1. Das Erlöschen der gesicherten Forderung
2. Die Rückgabe des Pfandes
3. Die Aufhebung des Pfandrechts
4. Die Konfusion und Konsolidation
1. Das gesetzliche System
2.1 Die Rechtsgrundlage
2.2 Der Kaufvertrag über die versteigerte Pfandsache
2.3 Die Übereignung der versteigerten Pfandsache
2.4 Die Tilgung der gesicherten Forderung
2.5 Der Versteigerungserlös als Surrogat der Pfandsache
2.6 Der rechtmäßige Pfandverkauf
3.1 Die Zwangsvollstreckung in die Pfandsache
3.2 Die vereinbarte Verwertung der Pfandsache
3.3 Die Verwertung nach Billigkeit und gerichtlicher Anordnung
1. Die Entstehung des gesetzlichen Pfandrechts
2. Der Erwerb vom Nichtberechtigten
3. Das gesetzliche Pfandrecht nach seiner Entstehung
1. Die Entstehung des Pfändungspfandrechts
2. Das Verwertungsrecht des Pfändungsgläubigers
3. Die Verwertung der gepfändeten beweglichen Sache
1. Das gesetzliche System
2. Die rechtliche Qualität des beschränkten Rechts an einem Recht
3. Die belastbaren Rechte
1. Der Nießbrauch an einzelnen Rechten und am Vermögen
2.1 Das Nutzungsrecht
2.2 Das Forderungseinziehungsrecht des Nießbrauchers
2.3 Das Besitz- und Einziehungsrecht des Nießbrauchers an einem Wertpapier
3. Die Bestellung des Nießbrauchs an einem Recht
1. Das gesetzliche System und die praktische Bedeutung
2. Eine akzessorische Sicherheit
3.1 Bis zur Pfandreife
3.2 Nach der Pfandreife
3.3 Die Bestellung des Pfandrechts
4. Das Vertragspfandrecht an Wertpapieren
5. Das Vertragspfandrecht an anderen Rechten
6.1 Das gesetzliche System
6.2 Die Pfändung einer Geldforderung oder Hypothek
6.3 Das Pfändungspfandrecht an einer Geldforderung
6.4 Die Überweisung der gepfändeten Geldforderung
6.5 Unpfändbare Geldforderungen
6.6 Die Pfändung eines Herausgabeanspruchs
6.7 Die Pfändung anderer Rechte
1. Das gesetzliche System
2. Die Sachen als körperliche Gegenstände
3. Andere Gegenstände
4. Der Mensch
5. Das Tier
1. Eine bunte Vielfalt
2. Bewegliche und unbewegliche Sachen
3. Vertretbare und unvertretbare Sachen
4. Verbrauchbare und unverbrauchbare Sachen
5. Einzelsachen und Sachinbegriff
6. Öffentliche Sachen
1. Das gesetzliche System
2. Unwesentliche Bestandteile einer Sache
3.1 Die Rechtsfolge
3.2 Die gesetzliche Definition
4. Wesentliche Bestandteile eines Grundstücks
5. Wesentliche Bestandteile eines Gebäudes
6.1 Die Rechtsfolge
6.2 Die Beweislast
6.3 Die Verbindung oder Einfügung zu einem vorübergehenden Zweck
6.4 Die Verbindung in Ausübung eines Grundstücksrechts
7. Rechte als Bestandteile eines Grundstücks
1. Das gesetzliche System
2. Die Beweislast
3. Die gesetzliche Definition des Zubehörs
4. Die Ausnahmen von der gesetzlichen Regel
1. Das gesetzliche System
2. Die gesetzlichen Definitionen
3. Die Verteilung der Früchte
4. Die Gewinnungskosten
5. Die Lasten einer Sache oder eines Rechts
1. Kapitel Was das Sachenrecht vom Schuldrecht unterscheidet
1. Die dingliche Verfügung
2. Die schuldrechtliche Verfügung
3. Der Verpflichtungsvertrag
3. Kapitel Der numerus clausus und der Typenzwang im Sachenrecht
1. Die Funktion von Besitz und Grundbuch
2. Die Übertragung des dinglichen Rechts
3. Der Erwerb des dinglichen Rechts vom Nichtberechtigten
4. Die gesetzliche Vermutung für das dingliche Recht
1. Das Eigentum
2. Das beschränkte dingliche Recht
3. Das Forderungsrecht
6. Kapitel Die Übertragbarkeit des dinglichen Rechts
1. Die Erscheinungsformen des Rechtsgeschäfts
2. Dingliche und andere Verfügungen
3. Die Bestandteile der dinglichen Verfügung
2. Kapitel Der schuldrechtliche Verpflichtungsvertrag und die dingliche Verfügung
1. Die rechtsgeschäftliche Zuwendung und ihr Rechtsgrund
2. Kausale und abstrakte Rechtsgeschäfte
3.1 Die Trennung zwischen kausalem Verpflichtungsgeschäft und abstrakter dinglicher Verfügung
3.2 Die Rechtsfolgen der Trennung
3.3 Die Durchbrechung der Trennung
1. Die dingliche Verfügung als Rechtsgeschäft
2. Die rechtliche Bindung an die dingliche Einigung und ihr Widerruf
3. Die Stellvertretung bei der dinglichen Verfügung
4. Die Zurechnung fremden Verhaltens oder Wissens im Sachenrecht
5. Kapitel Die dingliche Verfügung und das Schuldrecht
Sachregister