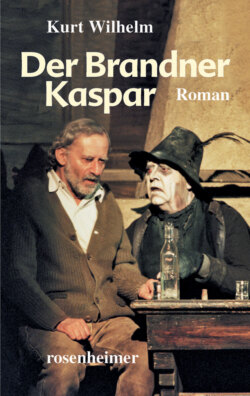Читать книгу Der Brandner Kaspar - Kurt Wilhelm - Страница 5
Die Jagd
ОглавлениеDer Tag, an dem der Brandner Kaspar hat sterben sollen, war einer von jenen, an denen die Natur behaglich zu schmunzeln scheint, wo poetische Seelen davon schwärmen, wie schneeweiß die Wolken sind, wie angenehm frisch das Elf-Uhr-Lüftl von den Bergen herab weht, wie die Mittagssonne nicht gar so heiß sticht, wie die Wälder widerhallen vom bunten, emsigen Lärmen der Vögel, wie es zirpt und summt in Wiesen und Gründen, und Schmetterlinge zuhauf über die Blüten hin schaukeln.
Am Mittag noch war der Kaspar gänzlich gesund und springlustig und hat so viel Lazzi und G’spaß gemacht, dass ihn der Flori gefragt hat:
»Was ist denn, du bist ja heut gar so fidel? Gibt’s einen Anlass?«
»Grad den«, war die Antwort, »dass mich’s Leben unbändig g’freut. Des g’langt doch!«
Die kleine weite Welt um den See ist von stiller Beständigkeit. Das Altbewährte wird sorgsam bewahrt, das Neumodische argwöhnisch beäugt, ob man es überhaupt braucht und für was es gut sein soll. Ein jeglicher hat seinen Platz, ein jegliches Tun und jegliches Ding seinen einfachen Sinn.
Ein Durcheinander und elendes Lärmen gibt es in dieser Zeit der neuen Maschinen und Eisenbahnen nur in den Städten. Ja, vier Stunden entfernt, in München drin, da rasseln die Fuhrwerke, eines am anderen, und fahren einander in die Quere, da schreien und fluchen die Kutscher wie die Kutscher, plärren Hausierer, streiten Bettelweiber, gießt man Unrat aus den Häusern in die Rinnsteine, hämmern und wuchten Handwerker an ihrem Zeug den lieben langen Tag und die halberte Nacht, und unaufhörlich tappen Leute scheinbar ziellos hierhin und dorthin, mit schallenden Sohlen über die buckligen Kopfsteinpflaster. Uhren und Glocken schlagen von den Türmen eine jegliche Viertelstunde, das Militär marschiert mit klingendem Spiel, es ist ein ständiges Schwätzen und Hasten, und immer gibt es etwas zum Schauen, zum Hören, nie ist Ruh, und man muss sich seine Behaglichkeit suchen.
Am Tegernsee rasselt halt ein-, zweimal am Tag ein Stellwagen oder ein Landauer von Gmund aus mit trabenden Rössern die Uferstraße entlang und bringt ein paar Sommergäste nach Bad Kreuth hinter zur Molkenkur. Es ist rundum so still, dass man am Ufer die Stimmen der Fahrgäste draußen über das Wasser vernehmen kann, wenn das kleine Dampfboot auf dem See herum schinakelt.
Freilich krähen die Hähne sich von aller Herrgottsfrüh an heiser, brüllt vor dem Füttern und Melken das Vieh, hört man den Hufschlag der einzelnen Reiter oder gar einer Kavalkade weithin. Fuhrwerke knirschen auf sandigen Wegen, beim Marmorbruch am Lohbach, hinten am Ringberg, kracht dann und wann eine Sprengung, deren Echo lange durchs Tal rollt, und auf dem Sixtnhof bei Finsterwald drüben quietscht gottserbärmlich die alte Wasserpumpe, wenn man die Tröge füllt für die Fackein, das Vieh und die großen Gemüsebeete. Aber sonst, und abgesehen davon, herrscht eine weite Stille. Die Einheimischen sind sie gewohnt, und den Stadtfräcken ist sie ein Labsal. Dann und wann freilich wird’s lauter, so wie heute, wo eine Hofjagd die Idylle verscheucht. Da sind alle versammelt, die es angeht, die teilnehmen und helfen, und sie wuseln voll Eifer durcheinander.
Das zweite Treiben ist am Spätnachmittag. Die Hunde haben das Wild bestätigt, verbellen und kreisen es ein, Jagdhörner tönen rundum, die es zum See lenken müssen, und der Kaspar spürt und weiß es, diesmal kommt der Hirsch nicht mehr aus, wie heut in der Früh, wo ein paar Deppen nicht Obacht gegeben haben, und er ist ihnen hinaus durch die Kette und hinauf in das Dickicht, versteckt und verloren für den Moment.
Das war eine böse Blamage, wo er doch dem alten, schon etwas wackligen König angesagt und versprochen war. Der Prinz Carl hat recht unglücklich dreingeschaut, und der Herr Königliche Advokat Dr. Senger hat den Brandner beiseite genommen:
»Was meinen S’, derwisch ma den noch?«
»Man müsst suchen«, hat der Kaspar erwidert. »Ich kunnt mir eppa scho denken, wo dass er naus is.«
»Tun Sie uns den Gefallen? Wenn einer ihn findet, dann Sie mit Ihrem tüchtigen Söllmann.«
Da ist der Kaspar in der Mittagszeit, während die Herrschaften zum Picknick gelagert waren, mit seinem Leithund, dem Söllmann, über die Holzeralm den Kogel hinauf. Er hat fleißig geschaut, wo Zweigerln von dem fliehenden Hirschen geknickt worden waren, der Söllmann hat bald die Witterung gehabt und die Fährte lautlos verfolgt, bis er mit einem kurzen Bellen angesprochen hat. Der Brandner hat sich niedergebeugt und das frische Fädlein betrachtet, den dünnen Erdstreifen, der zwischen den Schalen des Hirsches emporgedrückt wird. Kein Zweifel, der Tritt war noch jung, der Hirsch ist ausgemacht, er muss in der Nähe sein. Der Brandner war nicht grad begeistert, dass der fremde König den Napoleon bekommen sollte, aber um der Herrschaft die Freud nicht zu verderben, hat er es unten gemeldet und angezeigt, wo man die Treiberkette erneuern und frisch aufstellen kann.
Gegen Abend zu ist dann der Hirsch aus dem Dickicht gescheucht. Er stürmt talzu, verfolgt vom Bellen der Meute und den Rufen ›Tajo!‹ und ›Harro!‹ der Treiber, die sein Kommen ankünden. Jeden Augenblick muss er im Blickfeld des Brandner auftauchen, an ihm vorbei hinunter zur Fürlege hetzen, wo die Jagdgesellschaft schussbereit harrt. Der ist so gut wie Halali.
Weiter oben brechen zwei Schüsse. Kann es da einer nicht derwarten, wo der Schuss doch dem König der Belgier gebührt, keinem sonst? Der Brandner tritt ärgerlich aus dem Gebüsch auf die Lichtung, will nach dem Rechten sehen, läuft ein paar Schritte –
Da geschieht es. Das soll der Moment seines Todes sein. Er hört den Schuss schallen, ganz nah, eh er ihn wie ein Peitschenschlag am Kopf trifft und ihn umwirft. Im Fallen vermeint er, es dauere eine Ewigkeit, bis er den Boden erreicht, und während des schnellen, langsamen Sturzes jagen allerhand Bilder aus seinem Leben vorbei. Dann wird es ihm gänzlich schwarz vor dem Blick. Er liegt auf seinem Gesicht, seine Augen sind zu, und doch erkennt er ganz deutlich, wie und wo er da liegt, so, als stünde er aufrecht daneben und blicke von oben auf sich hinab. Zwischen ihm und der Welt sind auf einmal dicke gläserne Wände errichtet, die alles verzerren, verziehen, und durch die kein Laut dringt. Mit dem Peitschenschlag ist es um ihn stumm und still, starr und betäubt, und vor seinem unwahren Blick regt sich kein Ast und kein Blattl.
Doch – etwas bewegt sich! Eine schwarze Gestalt erhebt sich in der Entfernung aus dem Dicket und schreitet langsam herzu. Ein Jäger in dunkler Livree will sich forschend über ihn beugen, über ihn, der vermeint, sich selber da liegen zu sehen.
Der Kaspar möchte ihn anschreien: »Schaug net so loami, tu was und hilf«, da schwindet ihm diese unwirkliche Sicht von oben auf sich herab, wird blass und vergeht. Er kann seine wahren Augen wiederum öffnen, und sie sehen ganz nah vor sich die Steine, Gräser und das Moos des Waldbodens, auf den er gestürzt ist.
Er ist wieder bei Sinnen, er versucht aufzustehen, dreht den Kopf und erkennt über sich, schattenhaft gegen den weiß-blauen Himmel, wie ein Etwas einen schwarzen Mantel aufhebt, um ein Gesicht zu verbergen, und gleich sich auflöst und fort ist, als sei da niemand gewesen, sondern nur ein Schatten, ein Schemen, sonst nichts.
»Was is mir denn g’schehn? Warum hat’s mi hing’haut?«, will der Kaspar in seiner Wirrnis fragen und rufen: »Heda, ich bräuchert an Beistand!« Doch aus der Kehle kommt nur Gurgeln und Pfeifen, und gleich darauf fällt wieder Dunkel um ihn, seine Glieder strecken sich leer und schlaff, und der Söllmann, der ihn ängstlich umkreist hat, stupst den Leblosen mit der Schnauze und winselt.
An diesem Morgen hatte man sich früher versammelt als sonst bei Hofjagden mit erlauchten Gästen, denn die meisten der Teilnehmer waren nicht Sonntagsjäger, die den Schießprügel nur gelegentlich auf gut Glück handhaben, sondern des edlen Waidwerks Kundige. Jagdherr und Gastgeber war der Feldmarschall und Generalinspektor der Armee, Prinz Carl, der Halbbruder des gewesenen Königs, ein Reiter vor dem Herrn, der es an Jagderfahrung mit einem jeden aufnehmen kann. Mit von der Partie waren Mannsbilder, die gleich ihm das Leben in freier Natur der Stadtluft allezeit vorziehen:
Graf Arco-Zinneberg mit seinem Freund Franz von Kobell, Professor für Mineralogie. Der Advokat Dr. Senger, der sich oberhalb der ehemals gefürsteten Benediktinerabtei Tegernsee ein protziges Lustschlössl erbaut hat. Die Herren von Krempelhuber, von Stegmaier und Reichenbach aus dem Münchener Kaufherrenstande, Herr von Wydenbruckh und der Lord Ponsby, kurz alle jene, die in den letzten Jahrzehnten am Tegernsee, nahe der Gnadensonne des lange betrauerten ersten Königs von Bayern, Max des Ersten Joseph, und seiner sanften Gemahlin Caroline von Baden ein Sommer- und Jagddomizil sich errichtet hatten.
Die Jagd war zu Ehren Leopolds I., des bald sechzigjährigen Königs der Belgier. Der hohe Besuch, ein Spross des befreundeten Hauses Sachsen-Coburg-Gotha, war ein viel bewunderter, gerechtsamer Herr, ein wichtiger Mann unter den Herrschern Europas. Von großem Einfluss auf seine Nichte Victoria, die englische Königin, dem Hause Frankreich verwandt und den Bayern gewogen. Der Witwer war mit seiner siebzehnjährigen Tochter auf der Reise nach Wien, wo sie dem österreichischen Erzherzog Maximilian verlobt werden sollte. Der alte Herr war, bei allem Wohlwollen, nicht grad als ein exzellenter Schütze zu preisen. Man bot ihm daher nicht eine Pirsch wie einem echten Jäger, sondern eine jener althergebrachten Treibjagden, bei denen man sich nicht echauffieren muss, weil einem gewiss etwas vor die Flinte gebracht wird.
»Es wird eh a Trauerspiel«, hatte Graf Arco schon in aller Herrgottsfrüh beim hastig getrunkenen Kaffee zu Kobelln gesagt.
»Na, was denn. Ma kann ihm bloß brav zutreiben. Kommt daher, was mag, wir selber dürfen nix treffen, aus Höflichkeit.«
»Jedenfalls nicht, bis er einigermaßen a Strecke beinand hat, der Belgierpoldl.«
Kobell machte schmale Augen unter seinen großen, buschigen Brauen: »Das Beste wird sein, ich halt mich in seiner Näh, und wenn er abdruckt, schieß ich im selben Moment mit, damit wenigstens hie und da irgendwas umfallt. Er wird gewiss nit lang fragen, ob’s meine Kugel war oder die seine.«
»Hauptsach, er bringt überhaupts eine Strecke z’amm, na is er schon glücklich.«
»Stehen tät gnua im Revier. Ich hab gestern den alten Brandner gebeten, dass er vorsucht. Könnt sein, am End kommt sogar der Napoleon daher.«
Graf Arco musste lächeln. ›Napoleon‹ hatte der Brandner einen alten, rauflustigen Zwölfender getauft, der so unberechenbar war wie einst der Franzosenkaiser.
»Is der vom Fockenstoa abi zum Kogel g’wechselt?«
»Ja, die vorige Woch’.«
Bei der gestrigen Behangzeit am Abend hatte der Brandner mit seinem Söllmann die Abtritte des Napoleon ausgemacht und für die Treiber mit Verbruch aus Zweigen bezeichnet. Der gerissene alte Hirsch war nicht von jener edlen Rasse, die Graf Arco vor einiger Zeit angesiedelt hatte. Er hatte als Spießer und Gabler frühzeitig gelernt, die Jäger nicht zu fürchten. Sie taten ihm nichts, weil er damals nicht jagdbar war, und so fühlte er sich allezeit sicher. Wurde er gestellt, hoffte er stolz eine Weile nach allen Seiten, wendete sich in kräftigem Bogen, keineswegs übereilt ins Unterholz, vollführte dort ein paar Wiedergänge und streckte sich endlich ins Dickicht, bis sich die Jagd und die Hörner entfernten. Er spielte sich auf als Platzhirsch, bewachte sein Wildbret gegen jüngere und stärkere Achter, indem er sie zornig ansprach, drohend gegen sie schritt und sie endlich in Sprüngen in die Flucht trieb. Dabei verblieben nicht selten einige Schmaltiere aus dem Harem des Jüngeren achtungsvoll beim Napoleon.
Derzeit stand er oberhalb von der Holzeralm. Dem lautlos witternden Söllmann nachhängend, hatte der Brandner sein Bett in einer Feuchte gefunden und ihn am Schlosstritt erkannt, mit dem Hirsche beim Erheben mitten in ihrer Lagerstatt den Abdruck der Schalen hinterlassen. In der Nähe wuchs eine Leibspeise des Rotwilds, ein wilder Jasmin. Der allein gehende Napoleon hatte den Platz schon nahezu abgeäst, doch gab es unterhalb noch mehr davon, und so würde er gewiss heute wechseln. Dort war das Unterholz spärlich und licht, von dort aus konnte man ihn leicht vor die Büchsen der Hofjäger treiben als ein Prunkstück für den belgischen Gast.
Obwohl er drüben daheim war, am anderen Ufer des Sees, am Albach, oberhalb von Kloster und Ort Tegernsee, zwischen Wester- und Pfliegelhof, noch ein Stück höher droben, kannte der Brandner sich auch auf dieser Seite recht gut aus. Auch wenn er selten in dieses Revier kam, sein sechster Sinn für jegliches Wild machte seine Wahrnehmungen verlässig. Dafür hatte ihn noch ein jeder Jagdherr belobigt. Instinkt, Erfahrung und seine lebenslange Leidenschaft für die Jägerei ließen ihn den Jungen in allen Stücken über sein.
Der Haller Simon, Hofjäger in Diensten des Prinzen Carl, zog ungern auf eine große Jagd, wenn der Brandner nicht mit von der Partie war. Manchmal zahlte er ihm sogar aus der eigenen Tasche einen Sold als Jagdhelfer, weil er wusste, dass er in heiklen Situationen ohne den Alten aufgeschmissen war.
Der Kaspar war weithin beliebt und geachtet. Wenn er so daherkam, spottlustig, mager, zäh und ein bissei krummhaxert, mit der verschmitzten Freundlichkeit auf dem in tausend Falten gegerbten Gesicht, verströmte er eine Sicherheit, die Vertrauen einflößen musste.
In der Frühe hatte sich die Gesellschaft nahe dem prächtigen Königsgut Kaltenbrunn versammelt. Die Gäste genossen gebührend den weiten Blick über den See auf die Blauberge, hinter denen der Unnütz im Tiroler Achental hervorragte. Zum Betrachten reichte man ihnen die neueste Attraktion der Naturschwärmer, farbige Gläser, durch die das Panorama überraschende Varianten gewann.
Dann waren die Herren zu Pferde, der Belgier und die Damen in Wagen, am Finnerhof vorbei zum Rohnbognerhof hinaufgezogen, neben dem das Gebäude der Ölkapelle steht. Während die Treiber von den Hofjägern auf ihre Plätze gewiesen wurden, zeigte man den Belgiern die Erdölquelle, die der heilige Quirinus aus der Erde hat sprudeln lassen, wie die Legende behauptete.
Majestät Leopold erfuhren, und waren höflich beeindruckt darob, dass schon im 15. Jahrhundert ein dunkelgrünes, dickliches Bergnaphtha dem Boden entquoll, das auf Wasser schwamm, leicht entzündbar war und dem Heilkräfte nachgesagt wurden. Prinzessin Maria Charlotte kräuselte während der Erläuterung durch einen Ingenieur des Hofes die Nase ob des penetranten Geruches und begehrte ins Freie.
Dort harrte der Rohnbogner im Kreise seiner zahlreichen, sauber gewaschenen, gekämmten, geschnäuzten Familie, um mit tiefer Verneigung, halsig um ein verständliches Schriftdeutsch bemüht, den hohen Gästen ein Fläschchen voll Öl als Souvenir zu verehren.
»Glauben S’ as, Majestät, bal S’ an Wehdam ham, ich mein, eine Schmerzlichkeit, a Halsweh oder a Reißerts, schmieren S’ es unverzagt drauf. I sag ’s Ihna, des hilft auf der Stell, besser wie a jegliche Kräuterhex. Nix tut so guat, wie meine Familie beweist, wenn Sie ’s o’schaun mögen, ich meine geruherten, da, wie ’s dastehngan, allesamt g’sund zum Verrecka.«
Unter der Holzeralm war dieses Tages Fürlege. Dort fassten die Jäger in weitem Halbkreis Posto und erwarteten den Zutrieb. Die Strecke des Vormittags war erfreulich. Dass der versprochene Napoleon entwischte, ließ die Gastgeber sich vielmals entschuldigen, beratschlagen und den Eifer verdoppeln. Die Hofjäger, unter ihnen der Haller Simmerl, wurden instruiert, beim Treiben am Nachmittag sich so zu postieren, dass sie durch absichtsvoll daneben gezielte Schüsse den Napoleon, wenn man seiner habhaft werden und ihn herleiten könne, vor die Flinte des Königs jagten.
Durch besonderen Eifer im Bedienen der Herrschaft tat sich wieder einmal der Kaufmann Senftl buckelnd hervor. Seines Amtes als Stellvertreter des Bürgermeisters war es, den Verlauf von Festlichkeiten sorgfältig zu arrangieren.
»Schau nur, der G’schaftlhuber, wie er wieder rumfuhrwerkt«, flüsterten Treiber, und manch einer stellte sich bei seinen Befehlen grad extra recht dumm an, damit der Gockel vor Ärger rot anlief.
Der Senftl Alois war weiß Gott nicht beliebt, doch kam keiner ohne ihn aus. Sein Kaufhaus, in dem es alles gab, was man brauchte, Werkzeug, Stoffe, Geräte, Gewürze, Spezereien, Petroleum, Waffen, Pulver, Wagenschmier und Heiligenbilder, beherrschte den Markt. Sein Eheweib regierte den großen Hof nahe der Tuftn, während er nebsbei Geschäfte machte mit Holz, mit Vieh und Getreide, Rüben, Kartoffeln und Saatgut, Gründe vermittelte und Häuser und Höfe, Boote und Wagen verlieh an reisende Gäste, kurz, in allem und jedem seine gierigen Finger drin hatte.
Seine Tüchtigkeit war ebenso respektabel wie unangenehm. Nach der Napoleonzeit ein armer Schlucker, der vazierend mit Graffel und Glump von Hof zu Hof zog, hatte er es verstanden, sich beim gutmütigen König Max in derart schmieriger Weise einzuschmeicheln, dass er zum Gespött wurde, und wehe, es wagte heute noch jemand, ihn daran zu erinnern. Dank der königlichen Förderung und seiner Gerissenheit brachte er es zu Vermögen und Einfluss. Weil er auch Geld auf Zinsen verlieh, war die Zahl seiner Schuldner erheblich. Kleine und größere Bauern, Fischer, Fuhrleut und Handwerker waren abhängig von seiner Gnade und durften nichts gegen ihn sagen oder gar unternehmen. Hohen Herrschaften gegenüber war er stets hilfreich, süß und devot, aber auch sie trauten ihm nicht über den Weg.
Er war es, der an diesem Mittag in triefendem Eifer dem Brandner befahl:
»Es geht um die Wurscht, wir müssen a Ehr einlegen, hoppauf, geh zu mit dei’m Söllmann und find ihn uns schleunigst, den Malefizhirschn, den gottsverreckten.« »Warum akkrat mir diese Ehr?«, tat der Kaspar gleichmütig und verriet nicht, dass er nach der Bitte des Dr. Senger ohnehin auf dem Wege war, den Napoleon zu suchen. »San net Jager g’nua da, vom Hof und die Forstämter, was sollt da a armes Mannderl wie ich ausrichten, noch dazu ganz allein?«
Der Senftl war zu humorarm, um den Hohn zu erkennen. »Du kennst dich am bessern aus, alter Wilderer, g’stell di net so! Des weißt du genau, dass ich verantwortlich bin für den heutigen Erfolg, und drum tust du des auf der Stell, und zwar für mich, sonst – mehra brauch i ja wohl nimmer sagen, oder?«
»Naa, drohen brauchst wahrlich net, damit i der Herrschaft einen Gefallen erweis«, hatte der Brandner erwidert. Als der Senftl mit seinen glühenden Augen über der Vogelnase in dem hageren Gesicht noch weiter scharf und unangenehm keifte, ihn ja nicht zu hintergehen und womöglich nicht fleißig zu suchen, und ihm dabei immer wieder mit dem Zeigefinger auf die Brust stach, hatte er ihm einfach den Rücken gekehrt und war, den Hund an der Leine, pfeifend davongeschlendert.
»Dich muss ma ermahnen, weil du bist und bleibst a Hallodri, dir kann ma net trauen«, hatte der Senftl ihm nachgerufen, so laut, dass es andere hören mussten.
Da hatte der Brandner sich umgedreht und ebenso laut zurückgerufen:
»Aber gell, dir traut blindlings a jeder, du glücklicher Mensch, du gute, kreuzbrave Seel’«, und im Fortgehen einige genüsslich kichern gehört. Nein, mit dem Senftl war kein Auskommen, und die Schulden, die er bei ihm hatte, bedrückten den Brandner mitunter recht sehr.
Gegen den Abend zu nahm die Jagd auf den Napoleon einen Verlauf, den niemand erwartet hatte.
Als der Brandner nach dem Schuss leblos lag, brach der flüchtige Hirsch an ihm vorbei. Der königliche Gast wartete schon in einiger Spannung, das Gewehr schussbereit an die Wange gelehnt, denn er wollte sich vor den erfahrenen Jägern keine Blöße gestatten. Kobell, halb hinter ihm stehend, legte, für alle Fälle, bedächtig zum Parallelschuss an.
Das Kläffen der Hunde, das Lärmen der Treiber, die Gasse der Hörner und lenkenden Schüsse der Hofjäger hetzten das Tier der Fürlege zu. Es tauchte auf, der Belgier zog durch, der Schuss brach, der Napoleon stürzte im vollen Lauf, rutschte ein Stück ins Gebüsch und blieb liegen.
Triumph!
Die Gesellschaft applaudierte dieser Krönung der Jagd und schenkte dem übrigen Getier, das im Gefolge des Lärms noch vorbeikam, keine Beachtung mehr. Prinz Carl gab dem Hornisten das Zeichen, und es erscholl das stolze ›Hirsch tot‹. Der König bekam einen Kuss seiner Tochter und nahm die Glückwünsche der Gastgeber huldvoll lächelnd entgegen.
Dann begab man sich zu der gefällten Beute. Der Napoleon lag reglos mit offenen Lichtern, der Lecker hing ihm aus dem Maul. Man reichte dem König den Gnicker, das Jagdmesser, bog die hindernden Buschen beiseite, in die der mächtige Körper gestürzt war, Majestät beugten sich nieder –
– da, kaum hatte der Herrscher der Belgier die Luser gepackt, um waidgerecht zu genicken, fuhr Lebendigkeit in die Kreatur, sie rangelte und riss sich empor auf die Läufe und fegte so kraftvoll, als sei sie niemals getroffen, bergauf und davon. Majestät machten einen erschrockenen Satz rückwärts und bargen sich bei der Prinzessin, und noch ehe einer der verblüfften Umstehenden für einen Nachschuss die Waffe ergreifen konnte, war der Napoleon schon im Unterholz verschwunden.
»Was is des für e Gwerch …?«, stöhnte der König, ins Fränkisch der Jugendtage verfallend.
»Qu’est-ce que c’est?«, rief die Prinzessin, »Ca c’est tellement incroyable. C’etait mort, bien sûr mort!«
»A Prellschuss, Kreuzdividomine, gibt’s denn des aa!«, rief Graf Arco.
»Alle heilige Zeiten kommt sowas vor«, sagte Prinz Carl entschuldigend, »ich hab ’s selber noch niemals erlebt bis auf heut.«
»Prellschuss?«, begehrte der König zu wissen, und Kobell wusste ihm Antwort: »Es ist immer bedenklich, wenn der Schuss einen Hirschen so niederwirft auf dem Fleck. Oft ist da nur das Kreuz geprellt oder unter dem Rückgrat, wie man sagt, ›hohl‹ durchgeschossen.«
»Aber er ist doch verletzt und muss eingehen. Er bleibt irgendwo liegen, man kann ihn doch finden«, rief der geprellte Jäger, voll Empörung, dass die Jagdtrophäe, die sein Brüsseler Schloss zieren zu helfen bestimmt war, so eigenwillig am Leben geblieben sein sollte.
»Net amal das ist gewiss, Majestät, mit Verlaub. Meistens erholt so einer sich bald, weil die Wunde nur klein und glatt durchgängig ist. Ich befürchte, den ham ma verloren, zumindest für heut …«
»Die Hund’ hinterher, trotzdem. Man soll die Suche aufnehmen«, befahl Prinz Carl seinen Jägern. »Wer kennt sich aus? Wo ist der Brandner mit seinem Söllmann …?«
Der liegt noch wie tot auf dem Bauch, als ihn einer der Treiber, der junge Florian Högg, im Vorüberlaufen entdeckt, weil der Söllmann neben ihm tänzelt und Laut gibt. Der Flori erschrickt, ruft ein hilfloses, halblautes »Heda – da liegt einer« ins Leere, läuft herzu, kniet nieder und wendet den Alten um. Der ist gar nicht tot, seine Augenlider flattern. Der Flori richtet ihn auf und bringt ihn zu sich.
»Brandnervater, geh zua, mach keine G’schichten, wach doch auf! Was is dir denn g’schehn?«
Der wälzt und ringt sich aus der Betäubung, und als er endlich die Augen aufgebracht hat, stöhnt er:
»Herrschaftszeiten … der Flori! Bist du der sell Schwarze?«
»Was für a Schwarzer? Bist net am Zeug? A Schuss hat dich g’striffen, da am Schädel, am Ohr. Es bliat no …« Die Kugel ist sichtbar am Filz des alten verbeulten Hutes abgeglitten, hat ihn aufgerissen und den oberen Rand vom Ohrwaschel erwischt. Da läuft helles Blut aus der Wunde. Der Flori tastet vorsichtig.
»Ouh, du, des war haarscharf! Da kannst fei a Kerzen stiften zum Dank. Oa Alzerl daneben, und du wärst nimmermehr da.«
Der Alte ist noch ganz dasig.
»Einen Schuss in der Näh hab ich grad noch vernommen, aber was danach g’wesen is, Flori … des war mehra wie g’spaßig«, murmelt er und rappelt sich mühsam empor auf die Füß. Er beutelt den Schädel, tappt sich ans Ohr und schaut kopfschüttelnd auf das Blut an den Fingern.
»G’spürst was? Is dir net extra? Draht sa si vor deine Augen oder so eppas?«, fragt der Flori besorgt.
»Naa naa, nixi. I bin aufm Posten, es tut net amal weh. Grad so a g’spaßiges Singen und Zirpen hab i im Schädel«, erwidert der Brandner wie in Gedanken, fingert sein Sacktuch heraus und presst es aufs Ohr.
»Wer schießt da auf mich und verschwindt … und warum? I kann mir des all’s net so recht z’ammadipfin …«
»Hast den Schützen denn g’sehen?«
»Ja. Nein. Glaub scho. I bin mir net g’wiß.«
»Hast ’n net ’kennt?«
»I moan, net. A ganz a schwarz ang’legter Kerle könnt’s g’wen sein.«
»A Jager, a fremder, von die Belgischen einer?«
»Wär gut möglich.«
»Solchene Lalli g’hörert a Lehre verpasst für den Leichtsinn! Schießen, wenn Leut davor san!«
Von unten tönt soeben das Hornsignal ›Hirsch tot‹ und danach das wilde Geschrei und Getön. Ein Vieh bricht in der Nähe durchs Holz, läuft bergan, Schüsse fallen, und gleich darauf schreit wer:
»Hö, wer strawanzt da umanander im Schussfeld!«
Der Brandner horcht auf:
»Des is doch der Simmerl –«
»Der sell Jager vom Prinzen? No, von dem is’ bekannt, dass er schießt wie a Wildsau, wenn sich wo was rührt. Ob ’s am End der war, der dich derwischt hat?«
Ein Fehlschuss des eifrigen Haller Simon? Gewiss, der schwarzschädlerte Bursch war ständig bemüht, durch besondere Tüchtigkeit sich beliebter zu machen, als dies seinem verschlossenen, etwas groben Wesen beschieden war. So brav er auch war und obwohl er sich nie einen Tadel verdiente, er hatte es immer schwer gehabt, Freunde zu finden und fröhlich zu sein. Er musste sich eine jegliche Anerkenntnis sauer erringen. Gut möglich, dass er im Eifer und um sich hervorzutun blindlings dem flüchtigen Hirschen nachgeschossen und dabei den aufrecht stehenden Brandner übersehen hatte.
»Der Simmerl?«
Ein winziges Lächeln zieht um den Mund des Alten. Er schaut listig zum Florian hin:
»Du meinst, dem sollt ma auf alle Fälle die Lehre erteilen?«
»Dem ganz g’wiß. Wurscht, ob er ’s war oder net. Eh ’s ’n zerreißt, vor lauter Bedeutung, die er sich einbild’t.«
Der Brandner, das Schlitzohr, von dem allbekannt ist, dass er keine Gelegenheit vorbeigehen lässt, jemandem einen Streich zu spielen, feixt:
»Guat, tratz ma ’n a bissei. Pass gut auf und spiel mit. Des gibt a Gaudi!«
Er reckt das Ohr hin und fragt: »Bliat ’s noch?« Und als der Flori nachschaut und nickt, zwinkert er zufrieden, legt sich gestreckterlängs auf den Boden und beginnt recht zu jammern: »Ah ah – au au«, und, als sei er eingeweiht und spiele mit, hebt der Söllmann wiederum herzzerreißend zu winseln an und tänzelt mit krummem Rücken um ihn.
Der Simmerl taucht am Rande der Lichtung auf, schreit herüber: »Seids ihr denn narrisch, dass ihr im Schussfeld …«, erblickt die Gestalt auf dem Boden und rennt erschrocken herzu:
»Brandner, was is denn?«
Der Flori zieht die Augenbrauen recht weit hinauf: »Taat er noch fragen. Statt dass er a Brillen aufsetzert, ehvor dass er ’s Gewehr in die Hand nimmt.«
»I hab bloß dem Hirschen hinterhergschossen«, stammelt der Simmerl.
»– und an alten Dackel getroffen, au au.«
Der Simmerl kniet und betrachtet die Wunde: »Da ham ma, scheint’s, grad noch a Massl g’habt. Schlimm schaut’s net her.«
»Aber schwindlig is mir, so vui schwindlig«, wimmert der Alte und rollt in gespieltem Schmerz den Kopf hin und her.
Der Simmerl ist einen Atemzug lang ratlos. Dann wirft er den Rucksack von seiner Schulter: »Wart, ich verbind dich«, zieht ihn auf, kramt herum und bringt Leinzeug und Charpie heraus.
»Gell«, feixt der Flori gelinde, »so a ganz a sicherer Schütz hat allerweil a Verbandszeug im Sack, is ’s net so?«
»Du musst mi ausspotten, du Ratschenbertl, du windiger Treiber«, knurrt der Simmerl, hebt eine helle, eckige Glasflasche aus dem Sack, korkt sie auf, schüttet ein wenig über das Linnen und tupft damit auf der Wunde herum. Ein zarter Duft breitet sich aus.
»Ui, is des wahrhaftig a Kerschgeist?«, fragt der Brandner und windet sich nicht mehr und ächzt auch nicht weiter.
»Freili. Des Beste, dass die Wunde sich schließt.«
»Geh, aber äußerlich is es doch ewig schad um a selchterne Kostbarkeit. Gebertst mir besser a Schlückerl für einwendig, zu meiner Stärkung, gegen mein’ Schwindel, verstehst.«
»Von mir aus.«
Der Kaspar schnuppert, ehe er trinkt, und bezeigt Überraschung: »Uh, der is aber was ganz was Rar’s, kimmt mir für. An sowas kommt unsereins sonst net so leicht. Wo hast denn den her?«
»A Wurzer-Burgl’scher is’, a G’schenk vom Prinz Carl.«
»An dich?«
»Ja, an mich.«
»Da schau her. Für Verdienste am End?«
Der Simmerl bemerkt nicht den Spott, sondern ist stolz: »Ja, für die heutige Jagdausrichtung.«
»Na mach i mei’ Gratulation und dank dir, dass du die Kostbarkeit teilen willst mit mir. Vergelt’s Gott, Simmerl.«
»G’segen’s Gott.«
Er verbindet mit Sorgfalt den Schädel und merkt in der Pflicht nicht, wie viel auf einen einzigen Zug, grinsend, genüsslich, der Alte aus seiner Flasche heraustrinkt. Im Eifer entgeht ihm auch noch, dass hinter seinem Rücken der Flori einen gewaltigen Zug tut, eh er dem Kaspar die Flasche zurückreicht. Der setzt abermals an, um sich noch mehr zu vergönnen, da schreit schon der Simmerl: »Hö – net a so viel! Der ist kostbar! Und b’suffa bal dich die Herrschaften finden –«
Der Flori macht recht kummervolle Augen her und derbleckt den Jäger im Jammerton: »Simmerl, bedenk doch, wie groß dass der Schwindel vom Kaspar is, vermutlich durch deine eigene Schuld –«
Das ist zu viel. Da fährt er auf und rückt ihm nah auf den Leib: »Du, sei net so frech, du Lauser, und schmatz da net so a Zeugs umanander. Lauf lieber ’nunter zur Gesellschaft und vermeld, dass ich aufg’halten bin, für den Moment!«
Der Flori nickt und heuchelt Gehorsam:
»Weil du wen ang’schossen hast, sag ich.«
Da packt ihn der Simmerl hart am Schlafittl und zieht ihn sich nah vors Gesicht:
»Untersteh dich und sag des! Es is net erwiesen, dass des mei Schuss war! Wehe, du probierst es, dass d’ mich blamierst vor die Herrschaften, Bürschei!«
»Guat«, grinst der Flori und schaut ihn treuherzig an. »Na lüg i was z’amm, und du tust es beichten, hernach.«
Jetzt merkt es sogar der Simmerl, dass man ihn ausspottet, und löst den harten Griff an Floris Gewand, während er drohend erwidert:
»Schau du nur drauf, dass du dei’ eigene Hoffart derbeichtst, und bekümmmer dich net um mein Seelenheil. Schieb ab!«
Wenn zwei so junge Burschen einander nicht grün sind, ist meistens ein Weiberts dran schuld. Der Brandner weiß nur zu gut, wer es ist, sein eigenes Enkelkind nämlich, die Marei, die zusammen mit ihm das klein gewordene Anwesen bewirtschaftet.
Sie kennt den Haller Simon schon, seit sie ein halbertes Kind war, weil der Simmerl sich immer beim Kaspar Rat geholt hat. Erst hat er sie wenig beachtet, aber dann, nachdem er sie auf Ostern beim Kirchgang im von der Mutter ererbten Sonntagsstaat sah, muss es ihn jählings erwischt haben. Von da an ist er weit öfter auf dem Brandnerschen Anwesen erschienen, als es nötig gewesen wäre.
Im folgenden Herbst, zum Kirchtag, hat der Alte sie nach dem Amt zum ersten Mal mitgehen lassen ins Gasthaus zur Post, zum Feiern und Tanzen. Sie ist brav abseits auf der Bank an der Wand gesessen, wo die unverheirateten Töchter abwarten, bis einer sie holt, während die Eltern, die Erwachsenen, die Reichen und Ärmeren, mit ihren Frauen an der langen Festestafel im Saal hocken. Wer nur ein Dienstbot ist, hat überhaupt draußen zu bleiben. Die Ehhalten versammeln sich in der Schwemm oder lungern auf der Stiege herum, hoffend, dass sie jemand für wert hält, mit ihnen zu tanzen.
Es hat damals kein Geriss gegeben ums Marei, überhaupt keines. Die Danzl Maria – so hieß sie nach ihren Eltern, der Kaspar ist der Vater von ihrer verstorbenen Mutter – war noch ein junges, mageres Ding. Eines zwar mit einem bildhübschen, frischen Gesicht, aber doch ›no net bacha‹, nicht fertig gebacken, sodass die Burschen sich lieber um die ausgewachsene Ware gekümmert haben.
Da hat sie der Simmerl vom Hoffen und Warten erlöst. Er hat nur mit ihr getanzt und sie sogar an den Tisch zu den Erwachsenen und den Verheirateten gebracht. Das wurde allseits bemerkt, und fortan galten im Ort er und das Marei als ein sicheres Paar, mit dem man einverstanden sein konnte.
Das Jahr darauf haben die Burschen das inzwischen nicht mehr magere, blühende Marei gar nicht erst aufgefordert, weil sie ihrer unbändigen Tanzlust ohnehin nur mit dem Haller oblag. Die Ratschweiber warteten schon, dass der Simmerl mit ihr zum Stuhlfest beim Pfarrer erscheint, zum Aufgebot. Hoffentlich, denn auf den Brandnerhof gehört eine Jugend. Der Kaspar ist viel zu alt. Er hätte schon längst übergeben an seinen Schwiegersohn und die Tochter. Da waren aber beide gestorben, und das Marei, ihr einziges Kind, wuchs bei dem Großvater auf.
Seit zwei Jahrzehnten werkeln die beiden nun schon recht und schlecht. Einen Knecht oder eine Stalldirn konnten sie sich nicht leisten. Der Kaspar hat das Regieren nie richtig erlernt, weil ja sein ältester Bruder der Hoferbe gewesen wäre, und man hat ihn, den Jüngsten von dreien, das Schlosserhandwerk erlernen lassen, auf dass er später ein Auskommen habe. Er hat es gern ausgeübt und sich als Büchsenmacher schon in jungen Jahren bewährt.
Da waren aber seine beiden Brüder im Tiroler Krieg gefallen, und er blieb allein übrig. Sein Vater hatte einen schweren Stand in den notigen Jahren nach den Napoleonkriegen, die Europa um und um gerührt und gänzlich verarmt hatten. Das Brandnersche Sach ging zurück, der Vater schon musste ein Trumm Land nach dem ändern veräußern, und der Kaspar war dann noch tiefer in die Schulden geraten.
Nur ein geldiger Bauernsohn als Hochzeiter fürs Marei hätte die Rettung sein können, einer, der tüchtig zu arbeiten versteht. Der Simmerl aber, ein vierter Sohn aus der Gegend von Tölz, erbte nichts. Auch seine Leut krebsten nur so schlecht und recht, wie die meisten in diesen Jahren. Er verstand was von Jägerei und von Forstarbeit, aber wenig vom Bauernberuf. Darum tat er beim Kaspar den Mund wegen einer Heirat gar nicht erst auf. So auskömmlich sein Sold beim Prinzen für ihn allein war, zur Rettung des Brandnerschen Erbes langte es auf keine Weiten.
Er kam auf Besuch, saß in der Stube herum, half da und dort bei der Arbeit und gewöhnte sich dem Marei gegenüber eine besitzergreifende Art an, die den Kaspar mehr und mehr ärgerte. Er tat, als sei sie sein Eigentum, bewachte sie und ließ keinen anderen Burschen in ihre Nähe. Weil er sie niemals hitzig bedrängte und das Marei ihn so hinnahm, wie er war, mischte der Kaspar sich weiter nicht ein. Es war recht, wenn er da war, aber wenn er nicht kam, war es auch gut.
Dann aber, und das lag erst ein paar Wochen zurück, lief dem Marei der Florian Högg über den Weg, und alles war anders als vordem.
Der Simmerl schaut dem lachend zu Tal laufenden Flori hinterher: »Frecher Kerle. Den nimm i nimmer zu die Treiber, wenn er so frech ist.«
»Er is a braver Bua, tu ihm net unrecht«, hält der Brandner dawider und spielt weiter den schwindligen Kranken. Der Simmerl hilft ihm vorsichtig auf, hebt ihn, setzt ihn sacht auf einen Baumstumpf, rückt und drückt ihm seinen alten Hut so über den verbundenen Kopf, dass nur noch ein schmaler Streifen weißen Leinens am Ohr hervorschaut.
»So siecht ma nix mehr – und dei’m Enkelkind sagst einfach, du hast dich g’rissen an am Ast im Unterholz, verstanden?«
Der Kaspar schaut forschend, denn da ist wieder der Ton von Anspruch und Anordnung:
»Is dir des gar a so wichtig, was ’s Marei von dir denkt?«
»Frag net so dalkert!«
Der Simmerl geniert sich, seine Empfindung verraten zu haben. Er ist froh, dass sich darüber kein Disputieren ergeben kann, weil von unten das Hornsignal ›Sammeln für Jäger und Treiben‹ ertönt. Er packt seinen Rucksack und das Gewehr:
»Komm, steh jetzt auf, wir müssen ’nunter zur G’sellschaft.«
»Wir zwei? Mitanand? Dass ma fragt, was du g’macht hast mit mir?«
»Was hab i denn g’macht, nix hab i g’macht, Herrschaftszeitn! G’funden hab i di, verbunden hab i di – komm, steh jetzt auf!«
Er schreit, weil sein Gewissen ihn zwickt ob seines Schießens. Sein grobes Betragen spornt den Kaspar erst recht an, ihn zur Strafe weiter zu tratzen. Er wackelt den Kopf, klappert recht hilflos die Augendeckel und haucht:
»I kann leider net aufstehen. Der Schwindel, verstehst. Du müssertst mich tragen.«
»Tragen??!«
»Am Buckel, freundlicherweise, bis abi –«
»Tragen? Mich blamieren vor alle die Leut, wenn ich daherkomm, mit dir huckepack? … Mann Gottes, mach mi net narrisch!«
»Wennst mich so anschreist, krieg ich völlig ’as Zittern«, klagt der Kaspar und sinkt tragisch in sich zusammen. Das wirft den Jäger nun vollends aus dem Gleis.
»Du, i lass dich da liegen«, droht er.
»Des machert beim Marei fei einen mäßigen Eindruck. Solltest dich schon derbarmen –«
Weil der alte Hallodri gar so jammervoll dreinschaut und Miene macht, demütig bittend die alten Hände zu heben, kann der Simmerl nicht anders:
»Alsdann, von mir aus – hopp!«
Das Manöver des Aufsteigens erweist sich als schwierig. Der Kaspar kriecht schlenkernd und wackelnd auf den dargebotenen gekrümmten Buckel hinauf und schlingt die Arme derart fest um den Hals des Helfers, auf dass er nicht hinunterrutsche, dass er dem Simmerl den Adamsapfel zusammenquetscht und der nur röcheln kann:
»Derwürgen brauchst mi fei net!«
Der Söllmann, verwirrt von dem ungewöhnlichen Vorgang, beginnt warnend zu bellen. Der Simmerl hat nun den Alten im Genick. Der macht sich schwer und lässt seine Beine von rückwärts her gegen die Haxen des Lastträgers schlagen. Der Simmerl muss sich noch einmal bücken, um sein Gewehr und den Rucksack aufzuheben. Das ist mühsam genug. Als er sie endlich geangelt hat, wobei der Kaspar ihm mehrmals seitlich hinabgleitet, was besorgte Angriffe des wild kläffenden Söllmann zur Folge hat, kann er sich seine Ausrüstung nicht, wie gewohnt, über die Schultern hängen, weil ja der Kaspar da hinten wie ein Sack auf ihm lastet. Er muss sich Gewehr- und Rucksackriemen, albern genug, von vorn her über den Kopf auf den Nacken ziehen, sodass sie ihm störend und ungewohnt vor der Brust pendeln.
»Glump, varreckt’s«, knirscht er, und der Alte mahnt ihn mit schwacher Stimme zu alledem noch:
»Wackel net so umanand wie der Schwoaf von der Kuh, sonst kann i mich mit mei’m Schwindel net halten und fall abi, sei so freundlich.«
Der wütend-verzweifelte Simmerl packt mit den Pratzen den Kaspar so fest in den Kniekehlen, dass die Rutscherei auf dem Rücken ein End haben muss, der Alte ruft fröhlich: »So passt’s, auf geht’s – hüah, alter Schimmel« – und der Herr Hofjäger in seiner Jagdlivree tappt brav und ergeben mit seiner ächzenden Last bergab, wobei ihm bei jedem Schritt Gewehr und Rucksack auf die Brust schlagen und der unzufriedene Söllmann ihn, unaufhörlich bellend, kämpferisch immer wieder von allen Seiten her anspringt.
»So is es brav«, lobt der Brandner.
»Halt du bloß dei Mäu, ehvor dass i grantig werd«, keucht es zurück.
Der Simmerl hofft inständig, dass ihnen niemand begegnet und dass er den Alten nahe dem Sammelplatz irgendwie ungesehen loswerden kann. Das aber ist ihm nicht beschieden. Keine zweihundert Schritte vor dem Ziel kommt ihm, ausgerechnet, der emsige Senftl entgegen, reißt seine glühenden Augen weit auf und plärrt:
»Ja, gibt’s denn des aa! – I glaub, i träum! – Darf ich mir die ergebenste Frage erlauben, ob Hofjäger neuerdings ’as Hutschpferd machen für alte Krattler?«
»Plärr net a so«, fleht der Simmerl, weil er zwischen den Stämmen erkennt, wie in einiger Entfernung etliche Jäger, Treiber und Gäste aufmerksam werden, herschauen und Miene machen, herüberzuschlendern.
»Er kann net gehn. Er hat an Streifschuss derwischt.«
»So? Wo?«
»Am Ohr.«
»Aha! Und seit wann geht der auf die Ohren«, höhnt der Senftl und sieht missbilligend zu, wie der Simmerl versucht, den Alten vom Rücken zu schütteln. Der aber hält sich dort eisern fest.
»Schwindlig is ihm«, erklärt er verlegen, was den Senftl zu einem spöttischen Lachen veranlasst:
»So? Dem? Dem seine Schwindel kennt a jeds in der Gegend. Dem machst doch du grad den Kasperl. Schau nur, wie der fürizahnt, der Spitzbua, der o’drahte!«
Der Simmerl schielt zur Seite und sieht dicht neben sich das grinsende Antlitz des Brandner über seiner Schulter. Es schwant ihm, dass er wirklich den Kasperl abgibt, und als der Brandner lächelt und säuselt: »So viel schwindlig«, da schmeißt er ihn vom Rücken herunter, um die Blamage los zu sein. Der Söllmann springt daraufhin gleich mit allen vieren in die Höhe, wähnt sich von Feinden umgeben, hat noch jemanden, den er nicht mag, zum Anbellen gefunden, und geht waffend los auf den Senftl.
»Pfeif gefälligst dei’ Raubersviech da z’ruck«, schreit der Spötter geängstigt und flieht ein paar Schritte zur Seite. Da sieht er, wie der Brandner gemächlich die Kirschgeistflasche des Simmerl aus seiner eigenen Rocktasche hebt und sich erneut eine Stärkung genehmigt:
»Ah, brav – und dein’ Schnaps hat er aa scho, der alte Dadädl!«
Der hilflose Simmerl raunt, um zu begütigen und sich zu entschuldigen:
»Wenn’s mein Schuss g’wesen wär, der ihn g’streift hat, muss ich doch …«, doch dieses Bekenntnis bringt ihm nur weiteren Hohn ein:
»Dein Schuss, ja da schau her, aha, soso. Und du ›muaßt‹! Ja, freilich. Du ›muaßt‹ ja auch dem Hirschn hinterherschießen, der dem König gehört, und ihn net amal treffen – net amal des! Der Prinz Carl hat a Wut auf dich, verlangt dringlich nach dir, und wer is net da? Du! Du musst ja zahnluckerte Spitaler spazieren tragen am helllichten Tag!«
»Was sollt i denn machen?«, plärrt der hilflose Jäger zurück.
»Ja, nix mehr«, giftet der Senftl ihn an. »Hast ja scho alles g’macht, was ma verkehrt machen kann, du Prachtexemplar! – Weißt wenigstens, wo der Hirsch ’naus is? Des könnt deine Rettung sein, wennst du des wissertst! –«
Der Simmerl hat keine Idee. Er schlenkert den Arm und deutet vage zur Holzeralm: »No, wo wird er sein. Da nauf is er – vermutlich.«
Darauf antwortet der Senftl ihm gar nicht erst, sondern tritt funkelnden Auges dicht vor ihn hin, sticht ihm, wie es so seine Art ist, den Zeigefinger hart in die Brust und höhnt in übel wollender Sanftheit:
»Freilich, jaja, da ’nauf is er, so wird’s sein. Des meldst jetzt den hohen Herrschaften. Wörtlich und genau in dem Ton. Dann sagst es noch auf Französisch, damit der König von Belgien und sei Töchterl auch eine Freud ham – und dann suchst dir a andere Arbeit – im Fall, dass d’ noch eine findst, im rechtsrheinischen Bayern, du Preisschütz.«
Auf den Kaspar scheinen die beiden vergessen zu haben. Der hat sich inzwischen auf einen Holzstoß gesetzt und genießt schmunzelnd den Zank. Der Söllmann ist still zu seinen Füßen gelagert und horcht erst wieder auf, als von unten das Halali der Hörner das Ende des Jagdtages kündet.
»Malefiz«, sagt der Senftl. »Die Herrschaften dürfen den Ang’schossenen da nicht zu Gesicht kriegen. Das fehlert grad noch, das verdürb ihnen vollends den Tag, und ich wär am End wieder schuld!«
»Ich bring ihn heim«, sagt der Simmerl.
»Naa, du net. Du g’wiss net«, kommt es verächtlich zurück. »Du wärst es bei deiner Geschicklichkeit imstand und kutschierertst ihn pfeilgrad in’ See eini, dass er dersauft. Naa naa, und sowas is a Verwandter zu mir – a Sohn von am meinigen Basl!«
So ist es. Die Mutter vom Simmerl ist der Senftlsippe verwandt. Darum kann er ihn abkanzeln wie einen Abc-Schützen, ohne dass der es wagen darf, sich wirksam zu wehren. Dieserhalb wäre es auch dem Senftl zupass gewesen, wenn eine Hochzeit mit dem Marei hätte stattfinden können, weil so der Brandnerbesitz an die Senftlfamilie gelangt wäre. Wer weiß, am End war die solenne Feindschaft gegen den Kaspar nur die Folge davon, dass daraus nichts werden konnte, weil der Simmerl zu dieser Hochzeit nicht taugte. Zudem hatte der Senftl, der seine Nase in alles steckte, längst erfahren, dass sich zwischen dem Mädchen und dem Futterknecht in seinen Diensten, dem Florian Högg, etwas anspinnt. Auch das ist ihm nicht recht, aber was ist dem Senftl schon recht, was andere tun. –
Er entscheidet: »Den Brandner bringt irgendwer heim, unauffällig und hint ’rum«, und ruft einen Treiber an, der ahnungslos durch den Wald kommt:
»Heda, du – Bursch! – Ja, dich mein ich, hörst du net? – Geh amal zuawi, gefälligst.«
Der Angerufene ist von zarter Gestalt und trägt ein zu großes, schlotterndes Gewand, grobe Stiefel und einen Tegernseer Stopselhut, der ihm fast über die Ohren rutscht. Er zögert und kommt nicht ›gefälligst zuawi‹. Er scheint den Brüller zu fürchten.
Der Kaspar schaut um, erkennt, wer es ist, und widerspricht augenblicklich: »Lass den Burschen in Ruh. Ich brauch neamds, i find scho alloa heim.«
»Nix da! Wenn ich a Anordnung treff, wird die befolgt! – Was is, kommst du jetz her, oder sollt ma dir a schriftliche Einladung schicken? Horch zu, du schaffst mir den Brandner da weg, der is ang’schossen.«
Das trifft die kleine Gestalt wie ein Blitz: »Ang’schossen? Wo is er?«, ruft das Krischperl mit hoher, kindlicher Stimme und läuft eilends herzu.
»No, da flackt er. Und außerdem – hast eppa du den Malefizhirschen gesichtet? Du, oder einer von die anderen Treiber? Was is, krieg i koa Antwort? Kannst du net reden?«
Die kleine Gestalt hört nicht hin. Sie hockt sich neben den Kaspar, sie redet leise und voller Besorgnis mit ihm, und der Söllmann schnüffelt vertraulich an ihr herum. Der Simmerl erkennt es als Erster, wer das Krischperl in Wahrheit ist, und gleich darauf erkennt es der Senftl. Er staunt nur so:
»I glaub, i träum! – ’s Marei! In am Mannderg’wand. Brav, so is’ recht. Als Treiber gehn is verboten für Weiberleut, und sie kostümiert sich als Bua! – Freili, bei uns geht ja alles! In meiner G’moa tut a jeder grad, was er mag. Unsere Erlässe san euch ja Wurscht, euch Bagasch!«
Das Marei richtet sich verlegen auf, stolpert dabei ein wenig in den Stiefeln des Großvaters, das lange, dunkle Haar rutscht ihr unter dem Hut hervor, sie sucht es zurückzustecken, schaut dem Senftl fest ins Gesicht und erwidert bescheiden:
»Wir sind koa Bagasch, Senftl, des wissen Sie genau, und wir befolgen ansonsten auch alle Ihre Erläss’. Bloß grad heut …«
Weil sie, während sie redet, den Simmerl mit einem ganz kurzen Blick streift, argwöhnt der Senftl sofort:
»Ah so, des is a Komplott! Ah so? Hast du mir des eing’rührt, Herr Hofjäger?«
»Der Simmerl kann nix dafür«, wiegelt das Marei tapfer ab. »Des is mir ganz von allein eing’fallen. Weil doch der Gendarm, der Loichinger, der wo die Treiber aufnimmt und einweist, a so schuiklert und kurzsichtig is, hab i mir denkt, probierst es amal, verdienst dir die fuchz’g Kreuzer, den Tag.«
»Du Anten, du freche!«, schreit der Senftl sie an, und er hätte seiner Empörung noch weiterhin Luft gemacht, wäre nicht just in dem Augenblick der Flori gelaufen gekommen, um, ein wenig atemlos, zu vermelden:
»Senftl, an schön’ Gruß vom Prinz Carl, und Sie solltertn glei umi zur G’sellschaft, samt dem Herrn Hofjäger Simmerl! Und nach ’m Brandner hat er auch g’fragt! – Hö, was is denn da g’schehn? – des is ja ’s Marei …«
»Ja, das Marei!«, funkelt der Senftl, »dei Herzi, unbotmäßig, keck und ohne Respekt für die Obrigkeit. Aber des sag i dir, Madl, koan Kreuzer kriegst du für den heutigen Tag, für des sorg i. Und i überleg mir überhaupts noch, ob i net Anzeige mach gegen dich, wegen Verbotesmissachtung, und …«
»Und – was? Gar nix macha Sie!«
Der Flori schiebt sich, fest und bestimmt, mit breiten Schultern zwischen den Schimpfenden und das geängstigte Mädchen. »Aber scho gar nix! Des braucht’s net, dass Sie des Mädel so anplärrn, ham S’ mi verstanden?«
Der Senftl schluckt und bringt gegen diesen Beschützer der Unschuld nur ein mattes: »Ja, wie traust di denn du mit mir reden?«, heraus.
»Nix für ungut«, beschließt der Flori die Zurechtweisung, »aber a so a Schreierei z’wegs einer solchen Lappalie, des is koa G’hörtsi.«
Die Augen des Senftl glühen gefährlich auf, während er Luft holt:
»So, des waar koa G’hörtsi, aha? – Brav, a so mag i ’s! A meiniger Fuaderknecht möcht mir Manieren befehlen, taat mi abkanzeln vor alle Leut – hätt den Fiduz, dass er si auflehnert gegen sein’ eigenen Brotherrn! Was buidst dir denn du ein, Bürschei? Aber pass auf, i sag dir was Schön’s: Du bist ausg’stellt, und zwar auf der Stell!«
Das schlägt ein. Die Kündigung als Quittung für ein mutiges Wort? Das Marei ruft ganz verzweifelt:
»Vom Dienst jagen, mitten unter’m Jahr? Des is net Ihr Ernst, Senftl! Sowas tut ma doch net!«
»I wer’ mi geniern! Ich jag an jeden davon, wenn’s mir so passt! Und weil mir der Kerl, der freche, scho lang nimmer passt – basta und aussi, fort ohne Schaden! Er braucht gar nimmer kemma auf mein Hof! Sein’ restlichen Lohn b’halt i ein, weil er Schulden g’nua hat bei mir. Dir werd i ’s lerna, wiest du reden muaßt mit Respektspersonen!«
Er ist keinem Einwand zugänglich. Auch nicht, als der Simmerl und das Marei gemeinsam ihn bitten, sich noch einmal zu bedenken, es sei nicht böse gemeint gewesen. »Nix, nix, nix«, schreit er und säbelt mit den Händen durch die Luft. »Er ist und bleibt ausg’stellt! Basta damit!«
Da ertönt ein Lachen. Der Kaspar hockt noch auf dem Holzstoß, hat seine Pfeife angezündet, dem Streit zugeschaut, schüttelt tadelnd den Kopf und amüsiert sich. Der Senftl kann nichts anderes glauben, als dass der Schuss den Alten um den Verstand gebracht hat.
»Spinnst jetzt du vollends? Du bist schwer verwundet, rauchst wie a Schlot, beutelst dein’ Belli – und was gaab’s da zum Lachen?«
»Entschuldige schon, Senftl, aber es is gar zu g’spaßig, wie er dir wegen am jeden Schmarren gar a so schön stinkt! Spannst denn du nie, wenn was a Gaudi is und sonst nix? Verstehst net: Das Marei hat sich an G’spaß g’macht! – net mit dir! Mit dem schelchaugerten Loichinger und mit’m Simmerl dazua – und du rumpelst drauf rein, wo’s dich doch gar net betrifft. Da brauchst di net wundern, wenn ma di diam derbleckt.«
»Ja, derblecken, des is alles, auf was sich die Brandnerische Sippe versteht!« Der Senftl mag nicht von seinem hohen Ross herunter und käme sich windig vor, wenn er mitlachen würde. »Derblecken, so wie du damals mein’ Vater!«
»Geh, die uralte G’schicht’!« winkt der Brandner ab. »Des is über fuchz’g Jahr her, dass ich mir mit dem den sellen G’spaß erlaubt hab.«
»Aber vergessen is’ net, deine Untat! Die Leut reden heut noch davon, und des verzeih ich dir nie! Freilich, für dich waar ’s ganze Leben a G’spaß, des is allbekannt«, geht der Senftl ihn immer härter an, sodass der Söllmann sich aufsetzt und zu knurren beginnt. Der Wütende achtet nicht darauf.
»Aber dir wird noch das Lachen vergehn, wenn i Ernst mach und klag alles ein, was du mir schuldest. Dann is’ aus! Dann heißt’s ’naus aus deim Hof, dann stehst auf der Straß, mitsamt dei’m gaudigen Enkelkind da! Dann könnts alle zwoa ’as ganze Jahr Maschkra laufen, als Bettelleut nämlich von einer Ortschaft zur ändern, und schau’n, wo’s ihr bleibts! – Ich bin ganz g’wiss die Langmut und Nachsicht in Person, aber was z’viel is, is z’viel – und wehe, mir reißt die Geduld! Wehe!«
Die Geduld reißt dem Söllmann. Er meint seinen Herrn verteidigen zu müssen, er greift an, packt sich den Senftl, springt an ihm hoch, erwischt sein Gewand, zerrt einen Fetzen heraus vom Gilet und ist vom Brandner kaum mehr zu halten.
Der Gebissene schreit, schlägt um sich, läuft, was die Beine hergeben, bleibt in der Entfernung noch einmal stehen und brüllt, krebsrot im Gesicht, seine Kriegserklärung herüber:
»Des werd’s ihr mir büßen, ihr Krattlergesindel! Simmerl, geh her da! Dass i dich nie mehr derwisch mit dene Leut! Ihr sollt’s alle noch denken an mich!« – und rennt fort.
Dem Simmerl ist dieser Auftritt am ärgsten. Er muss dem Oheim folgen und mag ihm nicht folgen.
Er muss das Marei hier lassen und mag es nicht lassen. Schon gar nicht beim Flori, der sich so ritterlich aufgeführt hat, wo er, der Simmerl, nur schweigend daneben stand. Er möchte sich um den Kaspar kümmern und muss gehorsam zum Prinzen eilen, wenn der nach ihm schickt.
Ihm ist elend zumut. Nach ein paar Schritten schaut er hilflos zurück:
»Sollt i dich nochmals tragen, Kaspar, bis abi?«
»Naa naa, Simmerl, dankschön, i geh gut auf meine eigenen Füß. Ich hab vorhin a bissei Komödi g’spielt und mir a wengerl an G’spaß g’macht mit dir – derfst mir net gram sein.«
»Woher denn. Ich versteh ja an G’spaß«, antwortet der Simmerl traurig. »Was is, geh ma mit’nander, oder kommt’s ihr mir nach?«
»Geh nur voraus, wir säumen net lang.«
Die drei schauen ihm nicht hinterher, wie er trotzig davongeht, ohne sich umzusehen. Sie sitzen versonnen, und jeder überlegt vor sich hin. Der Kaspar setzt die Pfeife umständlich in Brand, ohne wahrzunehmen, was er tut. Nicht die Senftlische Drohung bedrückt ihn, nein, da ist ein dumpfer Schmerz über den Augen, und fließende Farben wechseln vor seinem Blick. Das macht ihn unsicher, das beobachtet er wie ein ungewohntes Naturschauspiel.
Der Flori fragt in das lange Schweigen hinein:
»Kann denn der Senftl euch wirklich ’nausteufeln, so, wie er sagt?«
»Rundum gehört eh schon bald alles sein«, erwidert das Marei bedrückt, »bis ’nauf zur Neureuth, zum Dr. Senger, zum Westerhof, und abi bis in die Grund vom Pfliegelhof. Viel is nimmermehr übrig für uns, im Albachtal.«
Der Kaspar kneift die Augen zusammen, weil das Sirren und Klingen im Schädel, auf das er eine Weile vergessen hatte, wieder lästig anzuschwellen beginnt.
Das Marei meint weiter: »Unser Herr Pfarrer hat neulich amal g’sagt: ›Euer Gütl is bald wie eine Insel im Senftlschen Meer!‹ Und jetzo g’lust’ ihn die Insel halt auch noch. Es is wie verhext, wir werkeln und macha und toa und kommen doch net vom Fleck.«
Der Flori nickt: »Des geht viele Leut so, heutzutag. A jeder is froh, der sei’ Auskommen hat«, und das Marei fragt ihn: »Was hast jetzt du im Sinn, nach dem Nausschmiss?«
»Weiß net. Ich find schon an Platz. Ich könnt wieder im Holz droben arbeiten, da war i schon vor meiner Militärzeit.«
»Die Holzarbeit is net gar leicht«, meint der Kaspar bedächtig. »Die braucht’s G’wöhnen, wennst länger pausiert hast. D’ Holzknecht san hagelbucherne Lackeln, allesamt. Des is aa net jedermanns Sach.«
Der Flori zuckt die Achseln: »Ich werd mir’s net aussuchen können.«
»Ob ’s net in der Schussermühle eppa wen brauchen?«, fällt dem Marei ein. Nahe Kreuth wird Marmor vom Ringberg auf durch Wasserkraft getriebenen neumodischen Säge-, Dreh- und Poliermaschinen verarbeitet: zu Bodenplatten für die Oper und die Glyptothek in München, zu griechischen Säulen, Tischplatten, Vasen, Schmuck und so Glump. Die Werkstätte gehört doch, ja – dem Herrn von Reichenbach, »den kennst du doch. Großvater! Is der net überhaupt heut bei der Jagdgesellschaft dabei? Ob du den amal fragst?«
»Ma kannt ’s ja versuchen.«
Der Brandner erhebt sich und klopft seine Pfeife aus: »Es is ohnehin Zeit. Wir müssen nunter, zum Sammeln ham’s scho geblasen.«
Auf dem Streckplatz sind bald alle beinander. Die Strecke wird auf Tannenzweigen säuberlich ausgelegt, die Hornisten stehen bereit, sie zu verblasen. Man verabreicht allseits den Jagdtrunk. Für die Feinen sind ein Champagner und edle Weine vorhanden, der Prinz, die Zünftigen und die Kenner bevorzugen den Kirschgeist und halten sich an die Spezialitäten, die ein grobes, älteres Frauenzimmer, die Wurzer-Burgl, rundum ausschenkt.
Die ist weithin bekannt und berühmt. Vor Jahrzehnten war sie mit ihrem Geliebten aus dem Zillertal zugewandert. Die beiden hatten sich eine Hütte erbaut, er ging in die Holzarbeit, sie strich mit Hacke und Korb durch die Gegend und sammelte Wurzeln und Kräuter.
Man hielt sie für spinnert, bis Holzknechte die ›geistigen Wässer‹, die sie aus Kräutern, aus Kalmuswurz, Brunnkress und Enzian höllisch scharf zu brennen verstand, zu kosten bekamen und ganz narrisch waren darauf.
Da musste ihr Jörgl bald feste Bänke und Tische vor die Hütte ins Gärtchen zimmern. Sie schenkte aus, Gäste kamen von weither, Hoch und Niedrig saßen selig-gierig beisammen und ließen sich von der Burgl allerlei Wahrheiten sagen, denn dies gewitzte, tüchtige Leut scheute keinen Erlauchten, und neben der Wirkung der Wässer erfuhren jene gleich auch noch, was das Volk denkt.
Bis hinunter nach Preußisch-Berlin drang dann ihr Renommee, als sie dem armen, matten, dürstenden Kronprinzen der Pruzzen im Gärtlein einen reschen Enzian einflößte, gegen das Zetern seiner mitwandernden Höflinge, die Vergiftung und Aussterben des Hohenzollernstammes befürchten zu müssen sich veranlasst sahen.
Zum heutigen Jagdtrunk ist sie samt ihrem Fässchen geladen und trägt zur Erbauung verbal und kulinarisch Erhebliches bei.
Die meisten der Damen sowie jene, denen von Arzt oder Gattin Mäßigung befohlen ist, laben sich, wie die meisten Einheimischen, die Diener, Kutscher und Treiber, am dunklen Bier aus dem Bräuhaus von Tegernsee, das den Wittelsbachern gehört, seit 1817 König Max der Erste – ob der grünen Filzkappe, die er so gern trug, ›Moosmaxl‹ geheißen – das den Benediktinern böse gewaltsam enteignete Kloster samt Brauerei insgeheim aufgekauft und vor dem Verrotten gerettet hatte. Insgeheim hatte er auch verjagte benediktinische Bräumeister heimgeholt, und das Ergebnis, die jährlichen tausend Hektoliter, befriedigte die Erwartungen aller.
Heut ist das Bier so, wie es sein soll, weil es aus den kühlen Kellern von Kaltenbrunn kommt. Oft ist es lack und lau, wenn kein Eis da ist, und oft ist es rar. Man kann davon nicht genügend aufbewahren, wenn der Sommer heiß ist, Durst macht und viele Fremde am Ort sind. Dann geht es aus, und man muss anderes von weit herschaffen, etwa aus Tölz.
»No, Brandner, war die Jagd net ganz nach Ihrem Geschmack, oder was? Sie schauen a bissei dernepft drein«, fragt der Herr Dr. Senger, als er ihn ganz draußen am Rande des Platzes bei den Treibern entdeckt, dort, wo auch Bettelleut lungern und gierig nach Almosen spähen.
»Treibjagden san net mein Fall, Herr Doktor. Was is des gegen a g’scheite Pirsch, wo man ansitzt und lurt und warten muss, bis was daherkommt, und es bleibt fraglich, ob ma zum Schuss kommen kann.«
»Sie ham a Berechtigung? Sie dürfen schießen?«
»Ich hab’s amal g’habt, aber dann is was fürkemma …«
»Was?«
»Ah, nix weiter. A dumme G’schicht. Da hätt einer g’moant, i hätt was erlegt, was eigentlich ihm g’hört hätt – und der hat prozessiert.« »Lassn S’ mich raten, wer’s war – der Senftl?«
»Der sell kunnt’s g’wesen sein, ja. Aber es macht nix.«
»Da kann man doch was unternehmen, damit Sie die Erlaubnis wieder erlangen. Ich bin gern bereit, als Jurist …«
»Dankschön, Herr Dokter, aber ’as Mitgehen am Pirschgang is genau a so scho schön, gar, wenn ma älter wird und bläder dazua.«
»Na, Sie doch net. Sie san doch das leibhaftige Leben, mit Ihre – wie alt san S’?«
»Zwoarasiebaz’ge bin g’wesen, vor etliche Wochen.«
»Na, also – mit zweiundsiebzig so vif beianand, des is doch a Gnade vom Herrgott.«
»Kann ma in Dankbarkeit sagen, ja.«
»Was ham S’ denn für an Verband um den Kopf? Is Ihnen was g’schehn?«
Es ist dem Kaspar nicht recht, dass man von seiner Verwundung erfährt. Und dem Senftl ist es schon gleich gar nicht genehm. Er hat zu langsam geschaut, als die Brandnerleut auf dem Platz erschienen sind. Als er sie verjagen hat wollen, hat der Hofadvokat schon mit dem Alten geredet, und er hat es sich nicht mehr getraut.
Nun muss er mit ansehen, wie der Senger den Alten zu den Großkopferten führt und berichtet, dass es unbemerkt zu einem gefährlichen Vorfall gekommen ist. Voll Ärger sieht er den Kobell, Graf Arco und den Reichenbach um den Brandner herumstehen und sich den Hergang erzählen lassen. Dann holt man gar noch den Prinzen dazu, den Gastgeber und Herrn der Jagd.
»Sie ham wirklich nicht g’sehn, wer’s gewesen sein könnt?«
»Tut mir Leid, Königliche Hoheit, nix.«
»Wer hat Sie denn in der Ohnmacht gefunden?«
»Der Florian Högg.«
»Geh, seids so gut, bittet’s mir den amal her. Vielleicht hat der wen erkannt. Wer war überhaupt droben platziert? Ist da nicht mein Jäger g’standen, der Haller? – Simmerl, kommen S’ doch amal her, bittschön!«
Sakradi, denkt der Senftl, jetzt kommt’s auf. Der Hundling, der Högg, wird’s verklagen, der Simmerl in seiner Blödheit bringt’s Herauslügen nicht z’amm, der Makel bleibt meiner Familie und mir. So ein Hundskopf, der Brandner! Nicht genug, dass er mir ein Wild weggeschossen hat, seinerzeit, jetzt macht er auf dem Wege des Mitleids sich gar noch Liebkind. Wer weiß, ob er denen nicht auch von dem Streit was erzählt, den wir gehabt ham –?
Prinz Carl besteht darauf, dass ein Medicus sich die Wunde besieht. Des Belgierkönigs Vertrauter, der sächsische Baron Christian von Stockmar, der Arzt war, ehe er sich der Geheimdiplomatie verschrieb, wickelt persönlich den Verband ab. Das Ohr blutet kaum mehr. Immerhin, kein Zweifel, das ging haarscharf am Tode vorbei. Sowas darf bei einer sauberen jagdlichen Ordnung nicht vorkommen. Der Florian Högg wird herbeigeführt und berichtet, dass der Brandner beim Erwachen etwas von einem schwarzen Kerl gefaselt hat.
Der Kobell flüstert ironisch zum Arco hinüber: »A ganz a Schwarzer? Uiui! War a Pfarrer dabei?«
»Wer sonst wär zuständig für die Schwelle zum Jenseits?«, grinst der leise zurück.
Der Medicus hält die Gestalt für ein Traumbild, das der Patient ins Erwachen geschleppt hat. Als aber der Prinz sich beim Simmerl erkundigt, ob jemand bei der Gesellschaft schwarze Kleidung trägt, da schluckt der verlegen, kriegt einen ganz roten Schädel und würgt schließlich heraus:
»Des net, Hoheit, aber – ich muss es vermelden, dass ich ganz in der Näh war und dass ich g’schossen hab.«
»Gib a Ruh«, fährt ihm der Kaspar ins Wort. »Dein Schuss war zu späterer Zeit, da bin ich schon wieder erwacht. Des hat nix zu tun mit dem!«
»Ich hab aber zweimal g’schossen, mit Verlaub, Königliche Hoheit. Einmal den Lenkschuss, wie der Hirsch abi zur Fürlege g’saust is, absichtlich nahe vorbei an ihm, in den Boden, und ’as zweite Mal, wie er wieder auf und davon g’roast is, ganz überraschend, als an versuchten Fangschuss.«
»Beide Schüss’ hab ich vernommen, und keiner von denen is’ g’wesen«, beharrt der Kaspar.
Prinz Carl legt seinem Jäger die Hand auf den Arm: »Es ehrt Sie, lieber Haller, dass Sie an diese Möglichkeit denken, aber san S’ friedlich: Sie waren’s net, wir müssen uns anderweitig erkundigen. Ich bring es zur Sprach bei der Jagdtafel, später, im Schloss drüben. Jetzt holen S’ an Wagen, dann fahren wir ihn heim, den Herrn Brandner.«
»Des braucht’s aber wirklich net, Hoheit, ich bin gut auf die Füß und hab auch zwei Leut zur Begleitung.« Der Kaspar beharrt aus Bescheidenheit und wehrt sich auch, als der Prinz ihn dem König von Belgien vorstellen will: »Hoheit, des braucht’s doch net, und i kann ja aa net Französisch.«
»Lieber Freund, einmal hat der Coburger auf sein Deutsch net vergessen, zum ändern waren Sie es, der den Hirschen für ihn aufg’funden hat. Also kommen S’ getrost, der Leopold freut sich, ich versprech’s Ihnen.« Des aa no, denkt der Senftl voll Ingrimm, wie der Prinz höchstselbst den Brandner vor den König hinführt. Ihn schmerzt diese Huld. Er ist neidig, dass dem Hofmeister gewinkt wird, der ein Geschenk zureicht und der Brandner einen goldenen Taler bekommt, als Dank, zum Trost und als Angedenken, und dass die Herrschaften um den Alten scharwenzeln, als sei er der Mittelpunkt. »Vielen Dank, zu viel Ehr, unverdient«, murmelt der Kaspar verlegen ein über das andre Mal, und weil er sich der Franzosenzeit seiner Jugend erinnert, sagt er noch mutig zum Belgier: »Merci beaucoup, Majestät«, eh er sich unter Verneigungen zurückzieht.
Eine leise schnarrende Stimme fragt den lurenden Senftl: »Pardong, Sie wissen, wer dieser Mann ist, um den man sich derart auffällig bemüht?«
»A windiger Jagdhelfer, der sich an Schuss eing’fangen hat, a Irgendwer, weiter net wichtig.«
Der Fragende ist ein eleganter junger Herr mit Schmissen im glatten Gesicht, gekleidet in eine nagelneue Jagduniform. Er blickt leicht blasiert, raucht eine Zigarette und sieht so wichtig und einflussreich aus, dass der Senftl sich allsogleich anbiedert:
»Gestatten, dass ich mich vorstell, Alois Senftl mein Name, eigentlicher Bürgermeister von Tegernsee, gewissermaßen. Und mit wem hab ich die Ehre?«
»Leutnant von Zieten, Adjutant des königlich preuß’schen Gesandten am bayerischen Hofe. Finde alles hier kolossal. Bin erst seit drei Tagen im Lande, muss sagen, äußerst disturbierend, verstehe kein Wort von dem, was die Leute so reden, aber insgesamt kolossal urig.«
»Gell, ja. Den meisten nördlichen Herrschaften gefallt’s bei uns gut. Wenn Sie mir die Ehre erweiserten, dass ich Ihnen beim Eingewöhnen behilflich sein dürft …«
»Wird dankbarst angenommen, Herr Bürgermeister.«
Das tut gut. Der Senftl belässt es bei der Titulatur. Er hört sie gar zu gern, und der Fremde braucht ja nicht wissen, dass er nur der Stellvertreter ist. Er wird es schon noch erreichen, dass ihn die zähen Leute zum Alleinherrscher des Ortes erwählen, na was denn …
Der Brandner kommt am Senftl vorbei, beider Blicke streifen sich, und wie der Senftl sieht, ist der Kaspar totenblass. Da kann er nicht anders, er grinst ihn mit seinen glühenden Augen so freundlich an, als sei nie etwas zwischen ihnen gewesen, der falsche Hund. Der Kaspar schüttelt nur seinen Kopf und geht weiter, zum Marei, das mit dem Flori bescheiden abseits steht.
Da geschieht ihm abermals etwas Unerwartetes. Sein Schritt wird unsicher, er stolpert, schwankt, taumelt und wäre gestürzt, hätte der Flori ihn nicht rasch noch gestützt.
Wieder muss der Senftl erleben, dass es ein Hallo gibt um den Alten, dass man sich erneut um ihn schart, dass der Freiherr von Stockmar noch einmal beigezogen wird, einen Schwächeanfall nach der übergroßen Aufregung feststellt, Ruhe verordnet und der Prinz apodiktisch befiehlt, der Brandner sei in einer Kutsche nach Hause zu fahren.
Der Simmerl bittet dringlich, ihn kutschieren zu dürfen, aber die Dienstpflicht verbietet es, er ist im Moment unentbehrlich. Während die Gesellschaft zur Jagdtafel hinüber ins Schloss Tegernsee zieht, ist er es, der beaufsichtigen muss, dass die Strecke und alle Jagdgerätschaften pünktlich dorthin verbracht werden.
Im Hin und Her stellt Dr. Senger seinen Jagdwagen zur Disposition. Der Flori soll ihn kutschieren, den Alten abliefern und das Gefährt dann zum Schloss Tegernsee bringen.
»So a G’schiss um den alten Deppen«, knirscht der Senftl in sich hinein, während er huldvoll lächelnd behilflich ist, den Wagen herbeizuführen. Er tut öffentlich dar, wie gewogen er der Brandnerfamilie ist, denn er kennt das Leben. Er weiß, der Kaspar ist von nun an nicht mehr nur ein geduldeter Kleinhäusler, der keinen Rückhalt hat. Wer von den hohen Herrschaften bemerkt und gefördert wird, darf ein besseres Leben und Beachtung erhoffen.
Das weiß er genau, weil sein eigener Aufstieg begann, als er sich beim König anwanzte, durch jene G’schicht, an die er nimmer erinnert sein mag.
Damals, als Jungem, war es ihm notig gegangen, und er hat Straßenarbeiten gemacht. Er war nicht grad fleißig dabei, das kann niemand behaupten. Oft ist er auf seinem Schubkarren gesessen und hat Brotzeit gemacht. Wie er einmal so dahockt, kommt die Kalesche des Königs Max I. Joseph vorbei, und der Monarch ruft herüber, leutselig oder ironisch, das hat er nicht ausmachen können:
»Recht guten Appetit, lieber Freund!«
Er ist hochgerumpelt, hat sich verneigt, hat im Verwirrnis sein Brot hingestreckt und gerufen:
»Dank, gnädiger König! Wir waar’s – mitgehalten?«
Da sind Majestät tatsächlich ausgestiegen und haben in das dargebotene Brot gebissen. Das war der entscheidende Augenblick.
Der Senftl hat gleich recht gezahnt und gejammert, wie schlecht es ihm geht, hat sich hingekniet und sein Lamento beschlossen:
»Sonst kann i nix tun für Enk, aber ich will fleißig beten für die gnädige Majestät.«
Das hat dem gutmütigen König gefallen. Er hat geschmunzelt: »Bet du für mich. Ich kann für dich auch was anderes tun«, hat sich den Namen sagen lassen, und schon am Abend hat der Senftl einen Beutel Dukaten bekommen und den Bescheid, dass er für den Hof arbeiten darf.
Von da an ist er überall besser behandelt worden, weil Protektion halt Reputation mit sich bringt, so sind die Leut, kannst nix machen. Damals begann sein Aufstieg, und wie man ihm draufgekommen ist, auf welch anlassige Weise er ihn erreicht hat, wurde er zum Gespött. Aber nicht lang. Er hat es den Klatschmäulern, den grinsenden, bald gezeigt, dass mit ihm von nun an zu rechnen ist.
Und jetzt, verflucht, denkt er, kann es sein, dass der Kaspar genauso in die Gnade kommt! Das hat noch gefehlt!
Eifrig besorgt hilft er beim Einsteigen und kommt dabei mit dem Marei in nahe Berührung, was ihm angenehm ist. So alt ist er nicht, trotz erwachsener ehelicher Kinder sowie derer, für die er insgeheim zahlen muss, dass ihm bei einem so frischen Geschöpf nicht einfiele, wie man herumtaubern muss, um sich zu nähern. Könnte er sich das Marei geneigt machen, würde der Kaspar zerspringen vor Wut, und er selber hätte zudem noch sein Vergnügen. Als er das denkt, lächelt er sie so liebreich und so verheißungsvoll an, dass die sich nur wundert, wie ein Mensch sich so zu verstellen imstand ist. Aber sie sagt es nicht.
Sie geniert sich ohnehin in ihrem Bubengewand und möchte rasch fort, ohne aufzufallen. Sie wagt es auch nicht, den Herrn Reichenbach wegen einer Arbeit für den Flori anzureden. Sie lächelt verlegen, als die Gesellschaft ihnen bei der Abfahrt zuwinkt und gute Wünsche nachruft.
Sie kutschieren im leichten Trab an Kaltenbrunn und dann an Gmunds dreißig Häusern vorbei, der Flori auf dem Bock, der Brandner und das Marei im Fond wie ein hochherrschaftliches Nobelpaar, zu ihren Füßen der Söllmann. Sie staunen, wie schnell es vorangeht, vorbei am Bauern am See, den Sandweg am Ufer entlang, schauen, genießen, kommen sich stolz vor, und der Kaspar denkt, dass es so eine Ehr in seiner Jugend gewiss nicht gegeben hätte, weil man damals noch nicht demokratisch war.
Sie begegnen Abendspaziergängern, Sommerfrischlern aus der Stadt. Man trifft sie seit einiger Zeit immer häufiger. Früher war ein fremdes Gesicht was Besonderes – wer kam schon hierher außer Weinreisenden, Schmusern, Händlern mit Holz oder Vieh und gelegentlich ein paar spinnerten Engländern. Seit aber König Max I. Joseph Schloss Tegernsee zur Sommerresidenz erkor, ist es, als sei dieses Tal entdeckt worden wie weiland Amerika und seine Indianer.
Die Sonne geht hinter dem Hirschberg hinab, der See erglänzt blau und golden, in den Rainen und Wiesen ratschen die Grillen, es wird kühler und stiller. In Quirin, beim Kircherl am See, hält der Viehtrieb vom Angermanngütl sie auf. Ihr elegantes Gefährt steckt in der muhenden, trottenden Herde. Die Kühe, die heim in den Stall geführt werden, sind aufgeregt, weil ein Pferd in der Nähe ist. Die Magd vom Gütl, die Genovefa, die mit dem Marei in die vom König eingerichtete Näh- und Strickschule geht, staunt nicht schlecht, als sie die Fahrgäste erkennt.
»Habt’s ihr in der Lotterie g’wunna?« ruft sie. Der Brandner antwortet ihr würdig: »Glei zwoamal, Vevi. Ich die Kutsch und sie des Ross, und jetzt samma so fürnehm, dass du künftig fei Sie sagen musst zu mir, und zu ihra gnädiges Fräulein!«, und dann feixen sie alle.
Sie überlegen den Weg, denn das einzelne Pferd kann den steilen Anstieg zum Hof gewiss nicht bewältigen. Das letzte Stück wird der Kaspar zu Fuß gehen oder auf dem ausgespannten Ross reiten müssen.
»Ich hatsch auffi, macht’s keine Krampf, ich bin doch scho wieder wie neu«, sagte er. »Kutschier du beim Westerhof auffi, so weit als es geht, dann kehrts ihr um und bringts den Wagen gleich z’ruck. Ich mag des Entgegenkommen net gar a so ausnutzen.«
Hinter ›Maria Schnee‹, der kleinen Kapelle, wo der Albach in den See sich ergießt, schlägt das Pferd selber den Weg hinauf ein. Es kennt ihn, er führt ja zum Lustschloss seines Herrn, Dr. Senger, und es zieht kraftvoll empor.
Die Sonne ist hinunter, die Silhouetten der Berge stehen scharf und blauschwarz vor dem in vielen Farben leuchtenden Himmel, und der Kaspar kann auf den schimmernden See hinabsehen. Er hat nicht die Wahrheit gesprochen, als er sagte, er sei schon wieder wie neu. Sirrend und klingend bedrängt seinen Schädel der unausweichliche Schmerz, und durch seine Glieder rieselt Kälte in Schüben und Wellen.
Ihm ist elend und fremd, und plötzlich fasst ihn der Gedanke, dass er das alles irgendwann ein letztes Mal sieht, dass das Sterben zu jeder Minute dicht beim Lebendigsein steht und dass er heut nicht einmal mehr Abschied hätte nehmen können von seiner Welt.
Ja, hätte er den Schädel um eines Fingers Breite zur Seite geneigt, er läge seit einer Stunde tot auf der Erde. Hätte er zur Mittagsstunde gedacht, dass ihn zu Abend eines Fingers Breite vom Tode trennt, von einem plötzlichen Sterben, das er nicht einmal wahrnehmen könnte? Dass er mitten aus seinem selbstverständlichen Leben ohne Abschied dahin gemusst hätte?
Wohin?
Erzählt der Herr Pfarrer jemals, wie das Sterben geschieht? Der sagt nur, dass vielleicht in einem lichten Himmel voll Engel und Heiliger das Paradies und die ewige Seligkeit warten, dass Sünder hinab ins Fegfeuer müssen. Was mir geschehen wäre, nachdem mich der Schuss aus dem Leben riss, davon schnauft er nichts.
Wär ich gestürzt ins Bewusstlose, Schwarze? In ein dunkles Reich, von dem alte Bücher und Weissagungen künden? Ich kann’s mir nicht ausmalen. Ist dieses Reich, unsichtbar, stets so dicht neben uns, dass in jeglicher Stunde eines Fingers Breite genügt, uns in seine ewige Finsternis zu stürzen? In jeder Minute unwahrnehmbar nah, ohne dass wir es merken? Wie geschieht die Verwandlung? Wie kann ein Geschöpf, Mensch oder Tier, grad noch voll Leben sein und gleich darauf unwiderruflich erloschen und tot? Wo ist das hin, das es lebendig hat sein lassen?
Herrschaft, was denk ich heut für a Zeug z’amm, schimpft er mit sich. Ich bin oft genug am Tode vorbeig’rutscht, und nie haben mich solche Gedanken bedrängt. Damals, wie auf der Pirsch am Setzberg der Steinschlag herunter ist mit Rumpeln und Poltern, wie links und rechts die Brocken eingehaut haben, da hätt mich, um des Fingers Breite, ein Trumm derschlagen können. Oder wie der Blitz neben mir in die Eiche gefahren ist, unter der ich den Augenblick vorher noch Schutz gesucht hab vor dem Gewitter. Wie oft werd ich, ohne es zu spüren, so nah am Tode gewesen sein?
Wenn ich’s nie gespannt hab, dass die nächste Minute die letzte sein könnt, warum hämmert’s mir heut so im Hirn? Ich bin wiederum unbeschadet davongekommen, mir droht keine Gefahr. Werd ich dappig und feig? Ich muss mich zusammenreißen.
»Dir is doch net gut, Großvater«, sagt das Marei besorgt, »du schaust drein, als wär dir net extra. Sollt ma anhalten, und du rastest dich aus?«
»Nix. Es ist alles, wie es sich g’hört. Wir sind ja gleich droben. Des Ross zieht ja wie der Deifi den Berg ’nauf, Sapristi!«
Ein paar hundert Schritte vom Haus wird der Weg zu steil und zu lehmig, da geht es nicht weiter, der Wagen bleibt stecken. Der Flori wirft die Zügel über den Weidezaun und schirrt so weit ab, dass das dampfende Tier sich beugen und grasen kann. Dann gehen sie das letzte Stück hinauf. Der Söllmann läuft vor ihnen her und kriecht gleich in seine Hütte beim Stall.
Dem Brandner sein Anwesen war früher einmal eine Hube. Heut ist es kein Lehen und nicht einmal mehr ein Halblehen, sondern nur noch eine Sölde, ein Sechzehntel von einem richtigen Hof.
Ihm gehört noch das niedrige Haus mit dem geneigten Schindeldach, der Altane aus Holz im ersten Stockwerk, den kleinen Fenstern, um die herum eine Lüftlmalerei verblasst. Die vielen Geranienkästen, die das Marei liebevoll pflegt, lassen es freundlich genug herschauen. Im Stall stehen drei Schafe, zwei Küh und zwei Ochsen, einer für die Arbeit und einer zur Mast, zum Erwerb. Früher waren da zwei Dutzend Milchvieh und die vier Rösser vom Fuhrgeschäft seines Vaters eingestellt, nun ja. Eine Loas mit vier Fackein liegt drinnen im Koben. Im Verschlag nebenan sind nur mehr zwei Enten und sieben, acht Hühner. Gäns gar keine mehr.
Der Wald hinterm Haus gehört schon lang nicht mehr ihm. Nur noch das Dicket aus Fichten und Buchen den Hang zum Albach hinunter. Der verläuft seit über vier Jahren außerhalb seiner Grenze, seit er, um dem Senftl Schulden zu zahlen, das Land mit dem Bach schweren Herzens dem Pfliegel verkauft hat, dessen stattlicher Hof im Dämmer in der Entfernung zu sehen ist.
Ans Haus grenzten einstmals sechzig Tagwerk bucklige Gründ. Zwölfe davon sind ihm verblieben. Das meiste ist Grasland, ein Acker Kartoffeln und ein Eckerl, wo der Roggen gedeiht, auf dass er sein eigenes Brot hat, das dankbar und fromm mit dem IHS des Brotstempels geweiht wird, und vor dem Anschneiden mit dem Messer bekreuzigt.
Im Stadel, an den das Brennholz sauber geschlichtet ist, stehen der große und der kleinere Wagen und der zum Odeln. Dort sind die alten Gerätschaften aufbewahrt: Strohschneider, Gsootbank, Schäffel, Dengelstock, Sattlerbank und die Hoanzlbank fürs Bearbeiten kleinerer Hölzer. Und natürlich das Heu für das Vieh. Voll wird er nimmer. Im Winter hacheln und kämmen er und das Marei dort das bissei Flachs, das oberhalb wächst, das sie zuvor geriffelt und am heißen Ofen gebrechelt haben, und das Marei ist tüchtig im Spinnen und Weben.
Am Stadel das Backhaus, daneben seine finstere Schlosserwerkstatt mit dem alten – zu alten – Werkzeug. Alles sauber geordnet und ein bissei heruntergekommen, weil es so lang schon am Nötigen fehlt.
Sie gehen durchs Sommergatterl in den Vorgarten mit den Blumen, dem Gmüs und den Krautern. Sie öffnen die Haustür, auf deren Stock das segnende 18 C + M + B 56 mit Kreide geschrieben steht. Hinter der Tür nimmt der Kaspar den Weichbrunn – heut ist ihm danach – und schlägt das Kreuz, dankbar für seine Heimkehr.
»Bring ma dich gleich ’nauf ins Bett?«, fragt das Marei, aber er mag noch nicht liegen, er will in die Stube, zum Lehnstuhl. Es ist bereits dunkel. Das Marei zündet die Petroleumlampe an, hockt sich nieder, zieht ihm die Stiefel aus und bringt die Hauspantoffeln mit den hölzernen Sohlen. Er lässt sich heut die Bedienung gefallen, weil er sich doch recht hart schnauft und keine Kraft in sich spürt.
»Ich mach dir was z’ essen.« Das Marei will in die Kuchl, doch er hält sie zurück:
»Dankschön, i mag nix. Ich brachtert nix nunter. Ich brauch bloß a Zeitl mei Ruh zum staad Sitzen und Ausschnaufen.«
Der Flori steht herum wie ein fremder Besuch und schaut ein bissei besorgt drein: »’s Beste is g’wiss, i druck mi und bring den Wagen zurück.«
»Das Marei soll mitfahren!«
»Geh, Großvater, ich lass dich doch jetzt net allein.«
»Und dein Treiberlohn? Wir ham’s net grad zum Verschenken, Madl. Du fahrst mit zur Jagdtafel und holst ihn dir ab. Da kann der Senftl nix machen dagegen. Nimm die Kraxen mit, dass d’ was heimschleppen kannst, im Fall was von der Strecke an die Treiber verteilt wird.«
Das Marei möchte schon gern zum Gelage, aber sie zögert: »Des wär doch net zum Verantworten, bei dei’m Zustand …«
Der Alte muss sie hinausstampern zum Umziehen, weil sie im Treibergewand, als Bub, dort nicht gut auftauchen kann. »Schleun di«, sagt er, »net dass die besseren Trümmer alle vergeben san.«
Das Marei lacht und gehorcht nur zu gern.
Während sie in ihrer Kammer sich putzt, mag der Flori in seiner jugendlichen Neugierde noch einmal über die Vorfälle reden:
»Du hast den Schwarzen doch ’kennt und magst es net sagen, aus Schonung für ihn. War’s dem Simmerl sein Schuss?«
»Is doch Wurscht. Es ist gut ausganga und damit vergessen. Ich hab niemand kennt und bin mir auch nimmer sicher, ob da wirklich wer war. Der Doktor wird schon Recht haben, es war a Traum, mehra net.«
»I glaub aber schon, dass es der Simmerl gewesen sein könnt.«
»Und wenn – ich wär ihm net gram, es wär net mit Absicht geschehn.«
Der Flori geniert sich ein wenig, ehe er allzu neugierig wissen mag:
»Is ’as Marei immer noch Freund mit dem?«
Der Kaspar schmunzelt, weil sich der junge Dutterer gar so plump über den Rivalen erkundigt:
»Des fragst sie selber. I schaug net dahinter – des is ihra Sach’.«
»Und die Drohung vom Senftl? Die war ja beinah wie a biblischer Fluch. Ich mein’, so ein Garneamd, wie ich, der richtet nix aus gegen ihn. Aber traut der sich wirklich an euch?«
»Bei dem weiß ma nie. Er is a tüchtiger Mann, er hat seine Verdienste, auch um die Gemeinde, aber halt a Ruach, a Geizkragen, a Zornniggel und a Gifthaferl dazu.«
»Des kannst aber laut sagen. Seine Knecht sind der Ansicht, sie derleben es noch, dass den der Schlag trifft, vor Giez und vor Geiz. Der werd amal blau im G’sicht und fallt um – auf des warten s’.«
»Man soll neamd nix Böses net wünschen, aber eine Vermahnung kunnt dem g’wisslich net schaden. Es war oft g’nua nah dran, dass s’ ihn ins Haberfeld treiben, so harb sein manche auf ihn. Was meinst, hat er’s dir gegenüber ernst g’meint?«
»Glaub schon. Ich geh nachert z’ruck auf sein Hof, in mei’ Kammer, und wart ab, was er morgen daherred’t. Kunnt aa sein, i triff ihn jetzt noch, drunten im Schloss, dass er da scho was sagt …«
»Geh ihm heut aus ’m Weg. Heut is er noch z’ gifti.«
»Vorhin, wie sich die Herrschaften um dich bekümmert ham, da war er ganz zahm und hat sogar aufs Marei a ganz a süße Fotzn hing’macht. Ihren Treiberlohn werd er na doch net verhindern, oder was meinst?«
Sie hätten noch mehr hin und her überlegt, wäre nicht das Marei hereingekommen, unternehmungslustig und voll Vorfreude. Im Feiertagsgewand mit dem Schalk sieht sie so zum Abbusseln aus, dass der Brandner ganz stolz auf sein ansehnliches Enkelkind wird.
»I waar ’s, Flori! Großvater, im Herd is noch Feuer, kanntst dir die g’schmalzene Brotsuppen aufwärmen, wenn dir danach is. Dann gehst aber ins Bett, des musst mir versprechen. Du schaugst zwar schon wieder ganz frisch her, aber besser is besser. Gib gut auf dich Obacht und mach keine G’schichten. Wenn’s dir schlechter gehn sollt, läutest die Glocken oben am Haus. Die hör ich bis drunten und bin glei bei dir.«
»Wenn ’s mir letz wurert, hätt i den allerbesten Nothelfer gleich bei der Hand«, sagt der Alte, holt den Kerschgeist des Simmerl aus seiner Tasche und lacht: »Jetzt druckt’s euch, ihr zwoa, vor i euch ’nausschmeiß! Hat ma denn niemals a Ruh vor euch Junge?«
Er ist so guter Dinge, wie er da sitzt in dem Lehnstuhl, dass sie fröhlich und sorglos davoneilen können. Er sieht durch das Fenster sie ins letzte Dämmerlicht laufen, hört ihre Stimmen, das Anschirren drunten, das Wenden des Wagens, das Schnauben des Sengerschen Pferdes. Sie rasseln davon, es wird still.
Da ist er allein und allem ausgeliefert, was kommt.