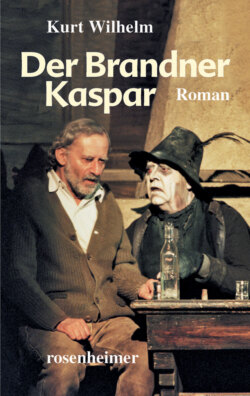Читать книгу Der Brandner Kaspar - Kurt Wilhelm - Страница 6
Der Tod
ОглавлениеDer Schmerz im Schädel wird ihm wieder bewusst. Er verharrt unbeweglich, er kann sich nicht entschließen, in die Schlafkammer zu gehen, er wartet und weiß nicht, worauf. Er wickelt die Binde ab, die der Medicus um seinen Kopf geschlungen hat, tastet, schaut auf die Finger, ob noch ein Blut zum Sehen ist, aber da ist nichts mehr. Missmutig tatscht er an dem wehen Ohr herum.
Das elende Sirren und Klingen in seinen Ohren will nicht verstummen. Und seine Augen? Wohin er auch schaut, es ist ihm, als blicke er wieder durch Wände aus dickem Glas, die alles verzerren und krumm machen. Deifi noch amal, denkt er, ich hab doch schon ganz andere Sachen derlebt, und mir war net a so. Jeder Wehdam wird mit der Zeit g’ringer, und so damisch kann einem doch net sein von so a bissei am Streifschuss. Sollt ich aufstehn und mir a Essen bereiten? Ich hab seit in der Früh fast nix im Magen. Am End liegt’s an dem, dass ich so roglert beinand bin.
Er will sich erheben, aber es geht nicht. Die Mattigkeit presst ihn in den Lehnstuhl zurück. Er ächzt leise und wiegt den Kopf schmerzhaft hin und her, wie er es öfter hat tun müssen seit dem Peitschenschlag des Schusses im Wald.
Es ist still. Er hört nur die alte Uhr an der Wand unermüdlich die Minuten in Stücke hacken. Lauter als sonst, kommt ihm vor. Dass von draußen so gar nichts zu vernehmen ist? Kein Laut von den Viechern im Stall, kein Uhuschrei durch die Nacht?
»Ah was«, sagt er rau, reißt sich empor aus dem Sessel, stellt sich, so fest es gehen will, auf seine Füß und schlurft in die Kuchl hinüber zum Herd. Er vernimmt dabei nicht die eigenen Schritte, über das Sirren und Klingen im Schädel dringt nur das schmerzende Hacken der Uhr, sonst ist alles wie tot und verstorben, als lebe die Welt nicht mehr, als sei er allein geblieben in ihr.
»Und ’s Feuer is auch aus? Kein Fünkerl Glut mehr, nur Asche? Wo ’s Marei doch g’sagt hat, es brennt noch, und wo ’s doch ansonsten immer noch glimmt, auch wenn wir den ganzen Tag fort waren. Was g’schiecht denn bloß heut? Spinn ich? Is alles derquer?«
Eine Wut packt ihn. Er haut mit der Faust auf die laue eiserne Herdplatte. Für die Brotsuppen müsst ich den Herd erst wieder zünden. Ah was, a Stückl a Brot oder a Nudel wird’s auch tun, und zur Feier meiner Errettung vergönn ich mir a Trumm vom G’selchten und einen Schluck von dem Kerschgeist dazu. Wo hab ich die Flaschn denn hingetan?
Als er sie sucht und in die Stube zurückkommt, gleitet sein Blick über den Herrgott im Winkel über der Ofenbank. Ein Schein Mondlicht fällt just auf ihn. Still hängt er da, aber es ist ihm, als schaue er her, mit einem wahrhaftigen Blick aus wirklichen Augen, wo die doch nur aufgemalt sind.
»Weh tut’s«, sagt er leise zum schmerzhaften Herrgott hinüber, »und mir is so loami wie niemals zuvor, und schieach zum Verzagen. Ich war noch nie krank, bis zum heutigen Tag. Was hätt mich auf oamal ’packt, und ich kann mich nicht wehren?«
Blicken die gemalten Augen aus dem gesenkten Haupt wahrhaftig forschend herüber, oder macht nur das seltsame Mondlicht, dass es so scheint? Mondlicht? Ist denn nicht Neumond?
Dem Kaspar rieselt es über den Buckel. Des muss wahrhaftig a Krankheit sein, die mich am Schlafittl ’packt hat, und desterhalb fang ich ’as Spinnen an, von einer Stund auf die ander’. Er reißt die Tür auf ins Freie und schaut zum Himmel hinauf. Da ist kein Mond. Es ist rundum stockfinster.
Just in dem Augenblick kommt ein Wind auf. Von fern über die Blauberge rauscht er daher, wie oft, wenn ein Südwetter einfällt und erst einen Sturm vor sich her jagt. Mit jeder Minute kann er das Heulen und Sausen deutlicher hören, aber, g’spassig, kein Blattl regt sich dabei, kein Bröserl Staub wirbelt auf, nur einen eiskalten Hauch verspürt er auf seinem Gesicht.
Ein Sturm nach so einem sonnigen Tag, einem geruhsamen, leuchtenden Abend? Ein Wettersturz, der einen Schub Kälte vorausschickt, zu dieser Jahreszeit? Ist der heilige Petrus närrisch worden? Oder der heilige Michael, von dem man die guten Wetter erflehen muss? Kann der es heulen und sausen lassen, ohne dass die Busch, die Äst und die Bäume sich biegen?
Warum steht alles starr da und still? Die Kerze in seiner Hand flackert nicht einen Deut, als er ums Haus eilt, um zu sehen, was er nicht glauben mag. Aber es ist so, wahrhaftig: Der Söllmann liegt ruhig in der Hütte, den Kopf auf den Pfoten, und im Stall drinnen rührt es sich nicht, wo die Viecher doch sonst beim Sturm an den Ketten zerren, brüllen, scharren und an die Bretterwand dreschen vor Angst. Sie liegen friedlich und still, und nur etliche heben ein wenig die Köpf, als der Kaspar die Tür auftut und im Kerzenschein nach ihnen schaut.
Eisige Furcht kriecht in sein Ingreisch, und er flüchtet förmlich zurück in die Stube. Der Schnaufer geht schwer, er greift sich ans Herz, auf dem ein Gewicht lastet, und er murmelt: »Des kommt alles vom Magen. Was essen, na bin i glei wieder beinand.«
Sein Blick streift abermals den Herrgott im Winkel. Das seltsame Licht ist erloschen, die Augen schauen nicht mehr. Na alsdann, es werd ja schon wieder, denkt er. Da mischt sich in das nahende Brausen des Sturms der ferne Klang einer Glocke.
»Läuten die drunten im Schloss bei der Festlichkeit? Aber nein, das ist die Totenglocken, drunten, vom See, von Quirin! – Wer is denn da g’storben? Und seit wann läutet man die bei der Nacht?«
Er schlägt das Kreuz, er hockt sich zum Tisch in den Herrgottswinkel, er horcht auf das Wachsen des Sturms und das scheppernde Glöckchen und vermag sich nimmer zu rühren. Etwas zwingt ihn zum Stillsein und Warten, bis geschieht, was nunmehr geschehen muss. Nach einer Weile wird’s still. Nur die alte Uhr hackt die unendliche Zeit in die Stube.
Dann klopft es hart an die Tür, drei Mal. Der Brandner hebt seinen Blick und ruft laut:
»Nur eini!«
Die Türe fliegt auf, und draußen vor dem Dunkel der Nacht steht wer, dessen Umriss zu ahnen und dessen Gesicht nicht zu sehen ist. Er tut keinen Schritt und sagt keinen Mucks, bis es dem Brandner zu dumm wird und er ihn anredet, obwohl es ihm widerstrebt:
»Hab mir’s glei denkt, dass des a Fremder is. ’s Anklopfen is bei mir net der Brauch. Meine Tür is für a jeds offen«, sagt er.
Die Gestalt regt sich nicht. Sie scheint nur feindlich und bös aus dem Dunkel auf ihn zu starren. Der Kaspar spürt einen Ärger und merkt nicht, dass der Schmerz, dass das Klingen und Sirren im Kopf ausgelöscht sind, dass ihm der alte Mut und die gesunde Courage zurückkehren, als er den Fremdling in Ungeduld angeht:
»Alsdann, was geit’s? Red halt, was d’ willst?«
Keine Antwort.
Der Kaspar rückt ein wenig herzu auf der Bank, um die Gestalt besser erkennen zu können, und spricht dringlicher auf sie ein:
»Grad war i draußd vor der Tür. Da war weit und breit keine Seel net zum Sehen. Bist du eppa herg’flogen?«
Auf einmal krächzt es aus der Gestalt, sanft und seltsam:
»Kunnt scho sein.«
Was ist das für eine Stimm? Sie klingt wie von fern her, rissig und dünn, und ist doch ausfüllend nah in den Ohren, so als raune sie von keinem Ort, als spräche sie in ihm selber. Der Brandner kann sich nur wundern:
»Du bist mir einer«, und winkt: »Geh halt zuawi, steh net draußen vorm Haus und trag mir die Ruh aussi.«
Langsam, und scheinbar ohne die Füße zu regen, gleitet der Fremde herein in die Stube. Hinter ihm fällt die Türe ins Schloss, ohne dass er sie angerührt hätte, ganz von selber. Nun steht er am Tisch, neben dem Ofen, schwarz und still. Der Schein der Petroleumlampe streift ihn, und der Kaspar kann sich gar nicht genug wundern:
»Du bist mir einer. Zaundürr und klappert, bleich und hohlaugert, zum Derbarmen.«
Die Gestalt scheint zu lächeln.
»Kennst mich net?«, fragt sie so sanft, dass es dem Kaspar ganz anders wird und seine Angst ihn immer mehr ausfüllt. Er schüttelt den Kopf. Freilich, insgeheim kennt er ihn, freilich. Woher nur?
»Derratst mich denn net?«, fragt es lauernd.
Der Kaspar schüttelt erneut seinen Kopf, während es ihm kalt und kälter durchs Hirn und den Leib rieselt, weil er es weiß und es dennoch nicht wissen und wahrhaben mag. Er duckt sich zusammen, er wendet den Blick ab und raunzt feindselig zurück:
»Mir is’, als möcht ich dich net derraten.«
»Wir san uns doch heut scho begegnet, auf an winzigen Augenblick – du erinnerst dich doch ganz genau, Kaspar, geh zua!«
Er hebt seinen schwarzen Umhang vors Gesicht, akkrat so, wie der Kerl heut im Wald, als den Brandner der Schuss riss und er wie tot auf dem Boden gelegen ist. Freilich! Das ist er! Aber nein, der hat doch ganz anders ausg’schaut, und den hab ich mir lediglich ein’bildt, hat der Doktor gesagt. Nun steht er da in der Stube und redet mit einer unbegreiflichen Stimme, wie niemand auf Erden sonst redet.
Der Tod ist es, und er erscheint in jener Gestalt, wie sie in der Kirchen aufgemalt ist, an der Decke. Es ist wahr. Ich hab’s nicht gewusst und hab’s nicht geahnt. Die Stunde des Scheidens, die Stunde des Sterbens ist da, vor mir steht der Tod!
Der antwortet, ohne dass es gesagt oder gefragt worden wäre:
»Net gar so dramatisch, Kaspar. Sag ›Boanlkramer‹ zu mir, wie alle Leut, wenn s’ meinen Namen nicht aussprechen mögen aus begreiflicher Furcht. Schau, ich komm, weil ich dich fragen hab wollen, ob’st net eppa mit mir gehst.«
Mitgehen? Ergeben und ohne Widerred sterben? Der Brandner springt auf und versucht mit ein paar Schritten die Tür zu erreichen.
»Naa!« ruft er dabei. »Und i mag amal net!«
Da zwingt ihn die Stimme zum Stehen.
»Es muss dengerscht sein«, sagt sie ungerührt, unverändert und sanft: »Schau, Kaspar, der Büchsenschuss sollt dich vermahnen ans End von aller Zeitlichkeit.«
Der beginnt zu begreifen: »Ah, so geht des zu?! Du bist es g’wesen, der den Schuss auf mich g’lenkt hat.« Und als die Gestalt zu nicken scheint, setzt er höhnisch hinzu: »Und hast mich net amal ’troffen? Net amal des? An Prellschuss hast z’ammbracht, wie der belgische König, du sauberer Schütz.«
Dem Schwarzen scheint dieser Vorwurf unangenehm, sein Raunen klingt um einen Deut strenger:
»Nach dem Schuss sollten die Leut sagen: Er hat dieses Schrecknis nicht überstanden, weil es zu viel war fürs alte Herz. Es hat’s nimmer derpackt und ist stille gestanden in Frieden, in der nämlichen Nacht. Verstehst?«
Freilich versteht das der Kaspar. Ganz gut versteht er’s, aber er will’s nicht verstehen. Er will leben und nicht ergeben sich fügen, und so vergisst er, welch ein Bote da vor ihm erschienen ist, und raunzt ihn an, als sei es der Loichinger, der schelchaugerte, dumme Gendarm:
»Nix da, nix. Des san Sprüch und san Krampf. Der Schuss, der war net für mich.«
Mit einem Ruck schnellt der Schwarze augenblicks dicht vor ihn hin, als wollt er ihn zwingen:
»Der Tag is für dich! So is es dir aufgesetzet. Es geht aufs End!«
Er hebt den Zeigefinger wie ein strafender Schullehrer. Als der Brandner bemerkt, wie knochig und dürr dieser Finger ist, wird ihm wieder bewusst, mit wem er da redet, und er denkt im nämlichen Augenblick nur noch das eine: dass er sich nun aufs Aushandeln verlegen muss, denn ein Mitgehen, Ergeben, so einfach mitten heraus aus dem Leben …
»Geh, Boanlkramer, sei net a so! Ich bin doch so g’sund wie der Fisch drin im Wasser. Sag selber, schau’n so die grablaufenden Leut aus, die du holst ansonsten?«
Grinst der Schwarze? Der Brandner kann es nicht recht erkennen, denn dieses Gesicht ist wie hinter einem schwarzen Schleier verborgen. Nur dann und wann brennt ein stechender Blick heraus, oder ein amüsierter, wie jetzt grad, als der Besucher kichert: »Naa naa, da hast Recht, die mehrern san siech und lägrig.«
»Und zaundürr und klappert, dass ma d’ Verwandtschaft zu dir gleich erkennt«, versucht der Brandner zu scherzen.
Der Bote schüttelt bedeutsam den Kopf: »Manch andere aber, schau, die sind wie du noch voll Leben, und dennoch ist es ihnen unwidersprüchlich ehern aufgesetzet.«
Ich darf ihm nicht zeigen, wie es mir graust, denkt der Brandner. Er mag es, scheint’s, wenn man sich nicht vor ihm fürchtet und lustig redet mit ihm, auf dass er noch einen G’spaß draufsetzen kann, und so ruft er und versucht ein Lachen dabei:
»Ja, wenn ’s rauschig san und heimzu wackeln, bei der finsteren Nacht!« Und wirklich kräht der Schwarze vergnügt: »Akkrat a so ist es! Wenn s’ da singen und hupfen, dann tun sie blindlings den falschen Schritt! Und ich – ich muss ihrer warten!«
Und schon ist sein Lachen wieder aus und vorbei. Todernst starrt er zum Brandner herüber. Der denkt sich, wenn ich ihn anbrüll, ist es vielleicht besser, und fetzt hinterher:
»No, und ich? Hab ich an Rausch? He? Da schau her – die ganze Flaschn Kerschgeist saufert ich aus und stehert danach noch allerweil kerzengrad aufrecht, als wie a alter Baum steht!«
Zum Beweis reißt er den Korken heraus und tut einen tiefen Zug. Der Boanlkramer schaut zu, lächelt milde, und raunt feierlich, seltsam und still:
»Nur zu! – ’leicht ist es dir aufgesetzet, dass da draus a Schlagerl wurert – und dass sie dir stehen bleibert, die Uhr.«
Die Uhr?
Der Brandner setzt in Verwirrnis die Flasche zurück auf den Tisch und weiß nicht, was tun. War das eine Drohung? Gäb es das wirklich, die Lebensuhr anhalten, wie es heißt in der Redensart? Was hat er vor, der ungebetene Gast?
Der weist mit dem Finger bedeutsam hinüber zur Wanduhr, deren unbeirrbares Hacken nicht mehr alles durchdringt, sondern die unbekümmert wie sonst ihren Gang geht. Will er am End mit dem knochigen Finger den Perpendikel berühren, auf dass sie ihm still steht? Sie, deren Ticken und Schlagen den Kaspar von Kindstagen an durchs Leben geleitet, war sie nicht wie ein Herzschlag der Zeit, wie der Puls des Verrinnens? War sie jemals stehen geblieben? Nein. Nicht in der Todesstunde des Vaters und nicht, als die Mutter verschied. Der Schwarze wendet sich um und scheint hinüber zur Uhr gleiten zu wollen, in seiner seltsam schwebenden Art. Was mach ich? Gegen den hilft mir keine Gewalt, ich kann doch nicht raufen mit ihm, denkt der Kaspar, und schon schreit er, ohne sich lange besonnen zu haben:
»Geh, lass doch den Schmarrn! Überhaupts, g’scheiter als die ganze Rederei da waar’s, wenn du mittrinkertst!« – und streckt ihm die Flasche entgegen.
Das reißt den Boanlkramer herum. Es schaut aus, als würde er auf den Schlag ein Stück kleiner. Er rutscht an den Tisch, starrt die Flasche an und sagt, gar nicht mehr feierlich jenseitig, sondern ganz nah und wahr und skurril:
»I? – An Schnaps?«
Oha, schießt es dem Brandner ein, des verfängt! Er hält ihm die Flasche grinsend unter die Nase:
»Elendig und sper, wiest du bist, taat dir a Glasl gwiss gut.«
Der Seltsame scheint sich kaum fassen zu können vor Staunen und Unglauben und gackst nur heraus:
»Du meinst … dass i sollt … dass i derfert?«
»I trink net gern allein. Pass auf, mir mach ma ’s uns kommod, wie es sich g’hört für so an besonderen Gast!«
Mit einem Griff holt er aus dem Wandkastl hinter sich zwei Glasln heraus und schenkt sie eilends so voll, dass sie überlaufen: »Alleinig trinken nur solche, die’s Leben vergessen möchten – und des könnt keiner mir nachsagen. Da! – Wohl bekomm’s!«
Der Boanlkramer glotzt in Sprachlosigkeit auf das Glasl. Dann räuspert er sich und murmelt: »Des hat mir keiner noch ’boten, und viel is mir schon g’schehn«, beugt sich hinab und schnuppert in Vorsicht:
»Des is gwiss ganz a milder, gell?«
»A guater is es, a starker. Probier nur!«
Der Kaspar hebt sein Stamperl und wartet gespannt. Wie sehr sein Gast aus der Fassung ist, kann er gut sehen, denn der rutscht hin und rutscht her, schnauft, hebt und senkt seinen Schädel und schmatzt lüstern. Dann aber, auf einmal, wendet er sich brüsk ab und knautscht, als habe man ihn beleidigt:
»Naa naa, nix, und des geht amal net.«
»Warum net? Traust du di eppa net?«
»Geh – trau’n! Es is net ums Trau’n. Warum sollt ich mich net trau’n?« Er schnauft, und er wackelt erneut. Er schaut, er schnuppert und hüstelt: »Es is bloß an dem: Ich weiß grad net so genau, ob des gern g’sehn wurert«, und schickt einen raschen Blick auf gen Himmel.
Nun ist es am Brandner, sanft und verführend zu säuseln:
»Schau, du musst doch kennen lernen, von was für Seligkeiten du die Leut wegholst. Trau di nur, glaub mir, du wirst ’s nicht bereuen!«
Das verfängt nicht. Der Boanlkramer raunzt lediglich barsch zurück: »Geh – ›Seligkeiten‹, du waarst guat. Irdische Freuden san des, allenfalls, vergängliche! Seligkeiten, mein Lieber, Seligkeiten san was ganz was anderes, aber scho ganz. Des san …«
Er unterbricht seine Predigt. Während er sie erteilte, war er mit dem dürren Finger dem Glasl zu nahe gekommen und hatte in die Lackn aus übergeronnenem Schnaps hineingetappt. Er erstarrt und verstummt, führt den Finger zum Mund, leckt zaghaft daran und meint sogleich ehrfurchtsvoll:
»Schmecka taat er, scheint mir, guat!«
Der Brandner grinst: »No, auf was wartest denn dann noch?!«, und macht Miene, mit ihm anzustoßen. Das bricht das lange Sich-Widersetzen, und mit einem scheinheiligen: »No, wennst mich zwingst, und wenn ich dir damit einen Gefallen erweis – «, nimmt er endlich das Glasl zwischen seine dürren Finger und trinkt einen winzigen Schluck.
Im nächsten Augenblick reißt ihn ein Husterer halb von der Bank. Er hat sich verkutzt, schluckt, schnauft, pfaunzt und pfutschert und schielt dabei ängstlich gen Himmel, als erwarte er von dort einen Blitzstrahl und ein schreckliches Donnerwetter.
Der Brandner ruft: »Bravo«, und schenkt augenblicks nach: »Nur zua! Des macht unsern Diskursi glei leichter, wirst es sehn!«
Das tröstet den Boanlkramer offenbar, denn er greift beherzt nach dem wieder gefüllten Stamperl und salbadert dazu: »Dann ist es gut, denn alles, was dir’s Ja-Sagen leichter macht, soll gerne geschehn. Weil Ja-Sagen muaßt, es is dir so aufgesetzet – verstehst mich?«, und schüttet den zweiten Kerschgeist in einem Schwapp hinunter.
›Aufgesetzet.‹
Da ist es erneut, das feierliche Wort, das der Herr Pfarrer nicht öfter als zweimal im Jahr ausspricht. Waren dem Menschen sein Schicksal und sein schließliches Ende denn wahrhaftig lediglich aufgesetzet? Konnte er sein Leben nicht selber schmieden, durch die Vernunft und die Mäßigkeit und den Glauben?
Der will mich einschüchtern und durchanand bringen, denkt der Kaspar, ist auf der Hut und trinkt nicht vom Kerschgeist, sondern tut nur, als trinke er mit.
Er schenkt allsogleich nach und überlegt fiebernd, wie er den ungebetensten aller Gäste hinausexpedieren kann. Er muss auf eine Gelegenheit passen, denn für einen solchen Hinausschmiss gibt’s kein Rezept und kein Vorbild. Einstweilen hockt er ja friedfertig da und säuft wie ein Loch. Der Kerschgeist verschafft ihm sichtbar ein ruhiges Behagen. Er trinkt aus, und gleich darauf noch einmal. Dann macht es aus ihm:
»Hick!«
Und gleich noch einmal: »Hick«. Er glotzt ganz verwundert. »Was is des?«
»Des is stets a so, auf ’n Kerschgeist«, grinst der Brandner und schenkt wiederum nach.
»Bei dir macht’s aber net so.«
»Weil ich ’n g’wohnt bin. Trink nur getrost, nach’m nächsten vergeht’s, wirst es sehn.«
Der Schwarze greift gierig zu: »Des waar mir fei lieb, weil, des stößt a so schierli her, dass ei’m glei die Boaner klappern.«
Er schlürft, und er schmatzt, setzt das Glas ab und erwartet den nächsten Stesser. Als er ausbleibt, lächelt er glücklich: »Ja, tatsächlich. Weg is ’s.«
Doch da reißt es ihn wieder, und zwar gleich so, dass es ihn halb von der Bank haut:
»Hick.«
Er sinkt mutlos zusammen. Der Brandner betrachtet ihn lauernd und ein wenig mitleidig und gießt noch einmal nach:
»Bist halt nix Gutes net g’wohnt, des is zum Merken.«
Nichts Gutes gewohnt – der Boanlkramer fängt zart zu greinen an. Sein Knochengesicht wird trübe im Kummer. Der Brandner kann es gut sehen, denn mit jedem Glas Kerschgeist sind die unheimlichen Züge deutlicher sichtbar, scheint der schwarze Schleier vor ihnen lichter zu werden.
Grad schön ist er ja nicht anzuschauen, mit seinen hohlen Wangen, dem luckerten Gebiss und der kleinen Nasen mit den großen Nasenlöchern. Von seinen dunklen, brennenden Augen aber geht eine Gewalt aus. Jetzt grad sind sie halb verschlossen von schweren, wimpernlosen Lidern, als er, angetrunken, voll Selbstmitleid anhebt:
»Naa, i bin wirkli nix Gutes net gewohnt. Weißt, diese Menschen! – Da jammern s’ und greinen s’, das Leben is gar so schwer und die Welt nix als wie ein Jammertal!«
»Geh!«
»Doch! Des sagen s’ im Ernst! Aber komm ich dann, sie zu erlösen, dann geht des G’schrei erst recht los! Da wollen s’ ums Verrecken weiterleben, und auf einmal wär alles so schön hier auf Erden, und grad Angst hams’.«
Er leert zur Bekräftigung sein Glas in einem Zuge.
»Musst es verstehn«, begütigt der Brandner und schenkt ihm das siebente Stamperl ein. Der unheimliche Besucher schüttet es gierig in sich. Man sieht ihm die Wirkung dieser ungewohnten Sauferei bereits an. Er lallt, als er heftig zu widersprechen beginnt:
»Naa, muaß i net. Und ich versteh’s auch net! Tu ich sie doch geleiten in zarter Gnade und die Luft erfüllen mit sanfter Musik auf ihrem Wege, auf dass sie sollen getröstet sein.« Er grinst. »Magst es hören? Pass auf – horch!«
Er tut eine große Handbewegung, und augenblicklich erschallt von fern ein Klingen von Harfen und Geigen und einer leisen Orgel dazu. Es dringt von oben herein und erfüllt allen Raum, es zieht den Brandner magisch empor in die Höh, auf die Füß, und er richtet den Blick nach oben. Er geht in der Stube herum und streckt sich, weil er es immer näher zu hören verlangt, und wäre gern aufgeschwebt, diesen Klängen nachfolgend.
Der Boanlkramer hockt auf der Bank, trinkt, und der Rausch macht ihn müde. Die Augendeckel sinken herab. Erst als der Brandner beim Umhergehen an den Tisch stößt, schreckt er auf, entsinnt sich der Pflicht und will sogleich wissen:
»No? Was is? Magst net doch mitgehn? Hm?«
Der Kaspar schüttelt den Kopf und versucht einen Ton der Vernunft:
»Es geht net, schau, siehg ’s halt ein, endlich. Ich bin noch vonnöten dahier. ’s Enkelkind und auch der Flori, denen muss ich das Gütl erhalten, auf irgend a Weis.«
Er schaut noch immer nach oben, als könne er die Musikanten der Himmelsweisen doch noch erspähen, und merkt kaum, wie der Boanlkramer hinter ihn tritt und ihm leise gebieterisch zuredet:
»Kaspar! Dein Leben währet nun schon zweiundsiebzig Jahre …«
Da fährt er herum:
»Ja, woaßt denn du, wie z’ kurz dass des is? Des lauft doch dahin, wie der Bach abi vom Berg, und stürzt mit jedem Jahr schneller talab, wie der Wasserfall! Vierzig Jahr waren ’s auf Lichtmess, dass mir mei Traudl g’storben is, und einundzwanzig, dass mir die Tochter wegg’holt worden is aus’m Kindbett. Von dir! Und mir is’ noch immer, als wär’s grad erst gewesen, grad gestern!«
Er redet sich in einen solchen Zorn hinein, dass der Boanlkramer vor dieser Anklage zurückwankt und kaum weiß, was erwidern, so hart geht der Alte ihn an: »Und jetzo, wo ich mich dreinfind’, wo grad alles wieder a bissei ins Lot kommt, da kamertst du mir daher, mitten im Sommer, zur Jagdzeit, wo d’ Rehbirsch beginnt, und taatst penzen und mich drangsalieren, dass i mitgeh – freiwillig! I bin doch net narret! Und außerdem is’ jetzt aa z’ hoaß!«
»So, zu heiß?« Der Boanlkramer zeigt sich beeindruckt und nickt ehrerbietig, als er auf die Ofenbank zurücksinkt und erneut nach dem Schnaps greift. Er wird wieder elegisch und beginnt leise zu jammern:
»Weißt, mir is es niemals z’ hoaß. Bloß jetzt grad is’ angenehm, bei dir da herin.« Er trinkt, setzt ab und lächelt recht freundlich: »Kaspar, des hast du schön vorgetragen, wirkli. Da will i aa net a so sein. Net, dass es heißert, an seinem Schnapse erlabet er sich, aber derkennt is nix. I sag dir was Schöns: I hol di im Hirgscht. Is des was? No, wie bin i zu dir? Sag selber!«
Der Kaspar gießt ihm abermals nach. Den Kerl würde er doch unter den Tisch saufen können, das wär doch gelacht! Er verzieht das Gesicht:
»Im Hirgscht? Was fallert denn dir ein? Sollt i die Hirschbrunft hint’ lassen? Und die Klopfeter?«
»Was is des?«
»’s Treibjagen! Ja, woaßt denn du gar nix?«
»Verzeih …«
»Und ’s Oktoberschießen? Und die großen Hofjagden?«
Abermals zeigt sich der Boanlkramer beeindruckt und voll Respekt: »Des is alles im Hirgscht?«
»No freili!«
»Die großen Hofjagden, soso? Net solche wie heut? G’scheide? Mit dem Eurigen Kini? Majestät persönlich?«
»Mit eahm selm. Und grad der möcht mi allweil dabei haben.«
Der Boanlkramer kratzt sich am Kopf und meint kleinlaut:
»Das freilich hab ich nicht bedenket.«
»Also. Was redst dann daher?«
Der Schwarze wackelt, seufzt tief, denkt angestrengt nach und kratzt sich dabei abermals ausgiebig am Kopf und den Schultern, ehe er würdig verkündet:
»Also, von mir aus, guat. Na mach ma ’s a so: I hol di im Winter. Punktum!«
Der Kaspar trumpft noch einmal auf:
»Punktum? Ja freili, so redt ma daher, wenn ma von nix was versteht. Und was is mit ’m Fuchspassen und ’m Marderausjagen? Außerdem is’ im Winter aa z’ kalt. Punktum!«
Ist dem Boanlkramer in seinem Surri das Heulen schon nahe? Er greint jedenfalls: »Ja, z’ kalt! Mir is’ immer z’ kalt! Verstehst, was des heißt, Kaspar? Zu kalt in Ewigkeit«, und legt die Knochenhänd auf den Kachelofen.
»Der Ofen is aa kalt. Da, trink, des wärmt. Was Bessers gibt’s net für di.«
Er schenkt abermals ein, er weiß nun schon selber nicht mehr, wie viele Kerschgeist er seinem Bedränger schon eingeflößt hat. Der bringt währenddessen einen letzten Vorschlag daher:
»Guat, Kaspar, wenn’s alles so schwierig sein soll, na kimm i im Fruahjahr! Aus Äpfi Amen! Aber des is mei allerletztes Wort!«
Der Kaspar verdreht nur die Augen:
»Im Fruajahr! Woaßt denn du net, dass da d’ Hahnfalz is und der Schnepfenstrich und die kloan Vögel am schönsten singen im Wald! Des kannst du im Ernst doch net moana, geh zua!«
Der Boanlkramer weiß keine Antwort mehr. Er klappt den Mund auf und zu, und der Kaspar nutzt das, um endlich zur Handelschaft mit dem Berauschten zu kommen, aber so, wie er sie sich vorstellt:
»Schau, bei mir bist eh an der falschen Adress’. Ich g’hör noch net ’nüber. Des muss ohnedem a Irrtum sein.«
Das hätt er nicht sagen sollen. Der Boanlkramer lässt das Glasl stehen, hebt sich würdig zu drohender Größe und donnert den Erdensohn an, so gut es ihm im Gewackel gelingen will:
»Irrtum?! Mir san die oberste aller Instanzen, du Mensch!«
Was soll der Kaspar da anderes tun, als behutsam einlenken:
»Is ja gut, hock di nur grad wieder hin. I moan bloß, ’leicht gibt’s noch an anderen Brandner Kaspar, könnt doch sein. Im Werdenfelser Land eppa …«
Die oberste aller Instanzen aber erweist sich als äußerst gekränkt und donnert unbeirrt weiter:
»Erdenwurm du! Ich komme aus der Allweisheit daher! Ich bin ausgesandt, dich zu geleiten in den ewigen Glanz – öha!«
Da dreht ihn der Kerschgeist, die Knie knicken ein, er plumpst zurück auf die Bank und vermag nur noch nachzumaulen: »Und du Bursch, du kecker, du werfertst mir eine Amtsverwechslung vor – i muss schon sagen –, naa!«
»Is ja guat, es war net a so g’meint.«
»Also! Was redst na! – Weißt was, jetzt trink ma aus, und dann gehn wir zwei miteinand auf die Reise, als guate Freund!«
Auf die Reise – die letzte, die endgültige? Nichts hatte der Kerschgeist genützt, nichts die schönen Worte und guten Wahrheiten allesamt. Der Unheimliche bleibt unerbittlich. Den Brandner packt eine Wut. Die Furcht vor dem Schwarzen hat er verloren, seit er ihn so lallend vor sich sieht, und darum traut er sich blaffen:
»Guate Freund, soso! Des wär mir a saubere Freundschaft, mit dem Kommando: ›Mir gehn mitnand auf die Roas!‹ Des is koa G’hörtsi unter g’standene Leut – und braucht auch nix weiter zum Trinken – Punktum!«
Mit einem ganz raschen Griff nimmt er dem Gast die Flasche gach aus der Hand und stellt sie weit weg, unter sich, unter die Bank auf den Boden. Punktum!
Dem Boanlkramer reißt es die rauschigen Augen weit auf:
»Kasper, ich hab dir a ganzes Jahr ’boten, als Zuwag, aber du, du hast ja für alles a Ausred. Willst denn du noch zehn Jahr leben?«
Er kann einem schier Leid tun, so kläglich schaut er jetzt drein. Der Brandner aber schüttelt nur seinen Kopf:
»Mein Vatern selig hast du schon vor der Zeit g’holt …«
»Geh, vor der Zeit, woher möchtst du des wissen?«
»Weil mei Großvater und fast alle meine Ahndln Neunz’ge worden san! Jaja, des is so bei uns! Und so alt werd i aa! Nachert kannst kommen, von mir aus, ehnder net.«
Das ist zu viel. Da schnappt der Boanlkramer nach Antwort und bringt keine heraus. Er wiegt sich und stöhnt, wie man es bei einer Handelschaft tut, und zieht seine Finger herauf, zählt an ihnen herum und murmelt dazu:
»Neunz’ge – achtz’ge – siebz’ge – äh – wie viel gaab denn des nachert, so alles mitnander?«
»Akkrat achtzehn Jahr«, sagt der Brandner leise und fest, holt tief Luft, greift zum ersten Male von sich aus nach seinem Stamperl und trinkt es leer auf einen einzigen Zug. Der Boanlkramer achtet nicht darauf. Er spitzt das faltige Maul, siffelt leise, pfeift vor sich hin und denkt nur und denkt. Dann sagt er entschieden:
»Naa – geht net!«
Ehe der Brandner etwas erwidern kann, hört er von draußen, ganz nah vor der Tür, ein Wiehern und Schnauben. Ein Ross? – Wo käm denn da mitternächtlich eines daher, denkt er erschrocken, und fragt:
»Was war des?«
»No, mein Karrenross, was denn sonst.«
Der Schwarze wundert sich nicht, dass der Brandner sich wundert. Er tut auf zwei Fingern einen gellenden Pfiff, und aus ist’s und gar mit dem Wiehern und Schnauben.
Dem Brandner ist es wieder eisig ins Herz gefahren, weil er sich vorstellt, wie da draußen die Fuhr auf ihn wartet, nur auf ihn, für die letzte Reise, deren Ziel niemand kennt. Wie oft hat er beim Rosenkranzbeten gedankenlos leiernd den Satz wiederholt: ›– jetzt und in der Stunde unseres Todes – Amen‹, und nun soll sie wirklich gekommen sein, die grausame Stunde der Überfuhr zu dem Ort, den keines Lebenden Aug je gesehen, für den er mit allen anderen um Gnade und Fürbitt gebetet, sein Leben lang. Dort draußen im Dunkel soll es beginnen –
»– auf am Karren?«
»Sowieso. Ich kann meine Passagier ja net gut auf’m Buckel spedieren oder auf meine Arm tragen«, grinst der Fuhrmann grob und ungerührt zu ihm her. Dann gedenkt er und lispelt mitleidig vor sich hin: »Höchstens die klein’ blassen Kinder, wenn s’ im Eis ein’brochen san – die sind eine leichte Last.« Und, als gereue es ihn, sich dem Lebendigen verraten zu haben, faucht er noch hinterher: »Aber so a Prügel Mannsbild wie du!« Da kann der Brandner auftrumpfen: »Prügel Mannsbild, soso? No also, jetz b’stehst es ja selber zu, dass i noch lebendig gnua wär für den Neunz’ger. Horch amal zu und pass auf …«
Er kommt nicht dazu, erneut über den Handel zu disputieren. Von draußen ist abermals, näher als vordem, das durchdringende Wiehern zu hören. Es gellt dem Brandner schmerzhaft im Ohr.
»Malefizkrampen! Is jetzt a Ruah!«, schreit der Boanlkramer, pfeift abermals auf den Fingern, fährt hoch, die Türe ins Freie schwingt dienstbar auf vor ihm, ohne dass er sie berührt hätte, er wankt hinaus und schimpft ins Dunkel. Er kommt zurück und lallt die Entschuldigung: »Der wird mir ungeduldig. So lang hat er noch nie warten müssen.«
»Z’wegs meiner braucht er net warten«, faucht der Brandner und ballt seine Fäuste. Er würde nicht mitgehen, ums Verrecken nicht, das steht für ihn fest.
Nun, da er grad wieder auf Füßen steht, wenn auch recht schwankend, scheinen Pflicht und Auftrag in den jenseitigen Boten zurückzukehren. Der frühere Glanz leuchtet wieder aus seinen seltsamen Augen, als er verheißt:
»Kaspar, sei halt vernünftig. Schau, die Welt dreht sich behaglich ohne dich weiter.«
Der aber blickt fest und finster, schaut nicht auf, und hört nicht auf den Ton der Verlockung:
»Nix! Neunz’ge sag i, und dabei bleibt’s!«
»Bedenk, für dich fängt’s dann doch erst an …«
»Was nacher?«
»Das wahrhaftige Leben«, haucht es ihm zu.
»Jaja, ich weiß schon. Des sagt der Herr Pfarrer aa. G’sehn hat er’s net.«
»Aber ich – ich hab’s g’sehn, Kaspar! Du, es is so unendlich wahr und gut dorten. Ich derf ja net ’nein. Im Paradies, da brauchen s’ koan Boanlkramer, so schön is’ es da, glaub mir’s, so schön – ach, bal du wissertst …«
Er seufzt verzückt und verdreht vor Wonne seine Augen gen Himmel. Da der Kaspar sich nicht regt und nicht rührt, nicht antworten will, sondern sich mit den Händen am Tisch einkrallt, greift der Bote listig lockend zum Glas, hebt es und zwinkert versöhnlich:
»Wie waar ’s, mir trink ma a letztes Glasl mitnand – als ein Siegel auf unser Verständnis. Gönnst mir net eines zum Abschied? Sei net a so, kumm –«
Der Kaspar brummt und wiegt sich in Missmut, ehe er grimmig die Flasche unter der Bank herausholt, eingießt und dabei fordernd und grob, dem Gast fest in die Augen schauend, sagt:
»Aber – neunz’ge, gell! Dass i mich vor die Ahndln net genieren müsst!«
»Wuh«, macht der Schwarze verzweifelt und versucht es erneut mit der gütigen Überredung: »Kaspar, hab doch a Einsehen. Schau, die Uhr da …« Er wendet sich hin und macht Miene, hinüberzuwanken.
Da ist aber der Kaspar schon aufgefahren, ihm voraus auf den Platz vor der Uhr in zwei Sätzen und stellt sich schützend davor. Der Boanlkramer gerät aus dem Lot, verhält, schaut auf seine dürren Haxen hinunter, reibt sich die Augen, und deutet erschrocken vor sich:
»Hui, da wackelt fei was. Der Boden hebt sich – da ’nüber! Was is des?«
»In einer Stund is er wieder eben, koa Sorg!«
Sich schüttelnd und vorsichtig tastend, stakt der Unheimliche weiter zur Uhr hin. Der Brandner breitet schützend die Arme und fleht:
»G’lang s’ mir net an! Die hat so redlich d’ Stunden zeigt, die voller Freud und die voll Kümmernis …«
»Alt is s’«, kommt es in lauernder Güte zurück, und ein förmliches Streicheln schwingt mit in der Stimme: »Schau, am Zifferblatt kannst kaum die Rosen mehr sehen, die aufg’malt g’wesen sind, da im Eck. Und d’ Zeiger wackeln, d’ G’wichtschnur rutscht …«
»Und dennoch arbeit s’ fleißig fort und macht so g’schäftig dipp und dapp.«
»Sie irrt sich freili g’nua dabei –«
»Aber lasst net aus! Ob s’ z’ fruah geht oder z’ spät, Herrschaftszeiten!«
Er schützt die Uhr, er steht und weicht nicht zurück vor dem drängenden Feind, der sie ihm würde anhalten wollen, und alles müsste stille stehen im nämlichen Augenblick und für immer. Das große Fürchten kriecht wieder in ihn.
Der Andere kichert: »Du g’freust dich halt, dass s’ überhaupts noch geht, gell. Und siehst ihr all ihre Fehler nach und hoffst dabei, dass dir die kommenden Jahr akkrat so alles nachg’sehen werdert, wenn bei dir die Zeiger wackeln und d’ G’wichtschnur rutscht«, und biegt sich vor Lachen über den eigenen Scherz.
»Lass nur mir getrost alle Sorg, wie ’s weitergehen soll«, fleht der Alte und streckt ihm mutig die Hand hin:
»Gilt’s? Schlag ein!«
Nickend und ob seines Scherzes noch kichernd, will der Rauschige brav gedankenlos in die Hand schlagen, doch im letzten Moment packt es ihn, was er da tut, es reißt ihn und er torkelt zurück:
»Naa naa, nix gilt! Sei doch g’scheit. Schau, ich könnt sie ja anhalten, einfach so, auf Ja und auf Nein!«
Und er hebt seine Hand und streckt sie gegen das hackende Pendel. Ums Haar hätte der Brandner ihm den Arm heruntergeschlagen, wäre sein Entsetzen nicht gar so groß gewesen. So schreit er nur aus seiner höchsten Not:
»Boanlkramer! Weißt du, was du da tust –?!«
»Und du? – Weißt denn du, wohin dass du derfst?«, ist die milde Antwort, sonst nichts. Feierlich hebt er beschwörend die Hand hoch empor, und augenblicklich erklingt wieder die ferne, verlockende Himmelsmusik und erfüllt die Stube. Sie dringt förmlich ein in den Kaspar, tief in sein Herz, kein Widerspruch ist ihm mehr möglich und kein Streit, er kann nur noch flehen:
»Boanlkramer, ich bin zufrieden allhier! Weißt du net, was des heißt: Zufrieden sein? Mit dem, was is, und dem, was man hat! Kennst net das Lied vom Zufriedensein?«
Weil keine Antwort erfolgt, beginnt er mit seiner kratzigen, alten Stimme über das himmlische Klingen hinweg aus der tiefen Verzweiflung heraus dem schwarzen Bedränger sein liebstes Gstanzl vorzusingen, wie eine Beschwörung:
»Nix han i und doch leb i halt
mit Gottes Gnad.
Und ’s Leben oft ein’ net besser g’fallt,
der ebbes hat –«
Den scheint der Gesang nicht zu bewegen, er macht ihn nur schläfrig. Er plumpst in den Lehnstuhl und murmelt, indem seine Lider klappern:
»Kaspar, du derbarmst mich. Mach mir’s doch net gar a so schwer.«
Ich hab ihn beinah so weit, denkt der Brandner. Wie nütz ich den Rausch aus, wie bring ich ihn fort, eh er mir einschläft und beim Erwachen sich als unerbittlich erweist? Ob er mir geht, wenn ich weitersing? Ob ich ihn förmlich hinaussing? Laut und inbrünstig flehend stimmt er die zweite Strophe des Leibliedes an:
»Und dengerscht hat mir Gott ja ’geb’n
a fröhlich’s Bluat.
Und fragst, wie steht’s mit Leib und Leb’n
Sag allzeit: Guat!«
Schau, er ist eingerusselt, der schreckliche Kerl. Ob ich ihn weck? Der Brandner verhält ratlos den Schnaufer. Da aber schreckt der Rauschige schon wieder hoch, gestört von der lauernden Stille, reißt die Augen weit auf, erhebt sich, gibt sich würdig und kalt, und gebietet:
»Schön hast du g’sungen, aber jetzt g’langt’s. Jetzt is es zu End mit dem Widerstreben. Komm, Brandner Kaspar, folge mir nach!«
Er reckt die Hand gegen ihn und schreitet voran, und dem Kaspar ist es, als zöge er ihn an einem unsichtbaren Strick hinter sich her, wie der Metzger das Kalb zur Schlachtbank, unentrinnbar und ganz ohne Gnade. Die Türe fliegt fremdwillig auf, Brandners eigene Tür, die sich zehntausend Mal willig von ihm hat öffnen und schließen lassen. Der unerbittliche Tod überschreitet die Schwelle so aufrecht und gerade es ihm eben noch möglich ist, und der Alte kann nichts dagegen, die Gewalt ist unendlich, er muss folgen, so schwer er im äußersten Widerstreben seine Schritte auch setzt, so inbrünstig jede Faser in ihm sich wehrt gegen den Gang, den letzten auf Erden.
Er steht an der Schwelle. Er weiß, wenn er sie überschreitet, ist sein Ende besiegelt. Da fallt es ihm ein, und er schreit es heraus:
»Halt aus! Wart! I sag dir was Schöns: Wir machen a G’spielei darum!«
Der erhabene Rauschige stockt, dreht sich um und fragt recht entgeistert:
»Was mach ma? Was sagst? Was geit’s da scho wieder?«
Der Kälberstrick ist erschlafft, der Alte kann sich wieder nach eigenem Willen bewegen. Er spürt zwar noch immer die große Gewalt, sie ist da, aber sie ruht, und so entwischt er geschwind in zwei Sätzen zum Kommodkastl hinüber, reißt die oberste Lade heraus, hebt das Packl hoch und hält es dem Peiniger, der draußen im Dunkel verhält, triumphierend entgegen:
»Da – des da mach ma! Wir schau’n, wer gewinnt, du oder ich, ’s Leb’n oder ’s Sterb’n! Komm nur grad her, geh zua, rühr di – und schaug net a so trapft!«
Dem Gewaltigen klappt der Kiefer herunter:
»Spielkarten?! Ja, siech i denn recht, du Hallodri! Karten möcht er – ums ewige Leben?!«
»Grad um achtzehn Jahr« – und sitzt schon am Tisch, fächert auf, winkt, lockt freundlich den Peiniger her.
Der wankt heran. Er stiert und glotzt den Talon an, die Knie knicken abermals weg, es haut ihn nieder im Stieren, er sitzt auf der Bank und stammelt recht ratlos:
»I kann gar net kartln.«
»Da brauchst net viel können. Da, misch!«
»Kann i aa net.«
Er zeigt es ihm, und mit spillrigen Fingern, steif und tapsig, wirft der finstere Gast die Karten herum, kreuz und quer über den Tisch und darüber hinaus, ein paar auf den Boden.
»Hui, etza san ma oa obag’fallen«, lallt er verwirrt.
»Dann heb’s auf, weil ma sie alle benötigen.«
Kichernd beugt sich der Rauschige über die Kante des Tisches, taucht hinab und fischt sich vom Boden auf, was er da findet.
Just das ist der Moment, der große Moment, da ein Irdischer sein Schicksal bewegt …
Es ist nur ein Griff, während der Boanlkramer unterm Tisch auf dem Boden herumkriecht und nicht hersehen kann. Obenauf liegt er, der Grasober, und verschwindet blitzschnell im Ärmel der alten Jacke des Brandner.
Da taucht der ungeschickte Gesandte schon wieder auf, schiebt alle Karten auf einen Haufen zusammen und kichert albern:
»Naa, sowas hab i noch net derlebt! – Und was jetzt?«
»Jetzt hebst auf.«
»Hab i doch grad. Oder was? I versteh net.«
»A Häuferl sollst aufheben, von dene am Tisch. Des ist dann des deine.«
»Und?«
»Wennst da drin den Grasober findest …«
»Wen?«
»Den Grasober!«
»Wie schaugt’n der aus?«
»Den kennst glei an der Farb und am Bildl, und sagen tu i dir’s aa.«
»Wenn der in mei’m Häuferl is, was is na?«
»Na geh i mit dir.«
»Ohne Widerred’?«
»Ja.«
»Versprochen?«
»Es gilt!«
Der Brandner schlägt mit dem Knöchel auf die Tischplatte, wie es Handelsleut tun, wenn der Vertrag unverbrüchlich ist. Ja, es gilt!
Der Boanlkramer glotzt noch, es geht ihm nicht ein. Freiwillig mit? Dieser Karten wegen? Welche Bewandtnis sollte es haben mit dem Häuferl? Wie groß war es? Was war mit dem Rest? Kenn einer sich aus mit dem Karten, der nie Karten gespielt hat. Und war er nicht unter den seinen, dieser Grasober, was dann? Gehörte das andere Häuferl auch ihm? Gehört es dem Brandner? Was sollte geschehen, wenn er in dem anderen war? Darum fragt er verlegen:
»Und wenn er in dei’m Häuferl befindlich is – na gehst aa mit. Oder?«
»Naa«, lacht der Brandner ihn aus, »dann darfst mir nimmer daherkommen, bis ich Neunz’ge bin!«
»Ui weh.«
Das also war der Sinn dieses G’spieleis. Da war der Haken.
»No? Gilt’s?«, drängt ihn der Brandner.
»Wart!«
Da heißt es erst denken, erwägen, sinnieren. Zwei Häuferl mit Karten. So weit ist es verstehbar. In einem musste er sein, der Grasober, oder wie das Blattl sich nennt. Gleich große Häuferl? Davon war nicht die Rede. Hui – wenn schon ein Schicksal in ein Spiel gesetzt wird, warum nicht die Chance verbessern!
Und schon schreit er und schlägt mit dem Knöchel hart auf den Tisch, wie es der Brandner soeben getan hat:
»Gilt – und versprocha!« Dem würde er’s zeigen!
»Gut – na hebst auf.«
Der Boanlkramer kichert sardonisch: »Du bist mir a ganz a dummer Teufel, Kaspar, aber scho a ganz a saudummer, weil, ich nimm mir so viele Karten in mein Häuferl hinein, dass der Grasober dabei sein muaß!«
Warum zuckt der Brandner da nicht zusammen und macht eine Lätschen angesichts solch geistiger Überlegenheit und mit allen Wassern gewaschener List? Warum grinst er dazu auch noch, senkt seinen Blick und sagt nur:
»Des is dei Sach. Es is a ehrliches G’spielei, und a jeder macht’s, wie er’s kann.«
Dass die Lüge den Brandner hart ankommt, weil Lügen nun einmal nicht seine Gewohnheit ist, bemerkt der Kichernde nicht. Er hebt ab, lässt mit spitzigen Fingern dem anderen noch vier, fünf Karten zurück, tut großmütig noch eine sechste dazu, packt sein Häuferl, lacht und kudert und strahlt, während er die Karten, eine nach der anderen, umdreht, beglotzt und dann auf die Tischplatte drischt.
Da hält er schon inne und schreit: »Ham ma ’n scho! Hurraxdax!«
»Naa, is er net. Des ist der Schellenober«, belehrt der Brandner ihn sanft. Und während der Boanlkramer nach kurzem enttäuschten Verhalten weiter umdreht und drischt, erklärt er ihm halblaut die Werte: »Herzzehner – Eichelsau – des da is der Grasneuner, auf die Farb musst schauen.«
»Schau scho, schau scho«, quietscht der Blätternde und werkelt mit jedem Schlag schneller und hitziger. Dann hat er ihn da, jault auf und strahlt vor Glück und Triumph:
»Daa!«
Der Kaspar schüttelt den Kopf: »Wieder net. Des is der Grasunter.«
Das Strahlen verschwindet: »Ja, gibt’s denn den aa?« mault er empört vor sich hin, blättert fort wie ein Wilder, drischt die Nieten, dass der Tisch dröhnt, und fällt in eine immer tiefere Verwirrtheit. Als die letzte Karte gefallen und sein Häuferl am Ende ist, greint er hilflos:
»Ja, wo is er denn bloß, dieser Krüppel? Der muaß doch dabei sein. Is er mir eppa abig’fallen, vorhin?«
Er fährt mit dem Kopf unter den Tisch und sucht auf dem Boden.
Dem Brandner schlägt das Herz wie ein Hammer, als er seinen Betrug vollendet, den Grasober aus dem Ärmel hervorzieht und ihn unter die sechs Karten seines eigenen Häuferls schiebt, als die siebente.
Falsch spielen, das ist eine Niedertracht, und er hat es seit seiner Lausbubenzeit nicht mehr getan. Hier aber geht es nicht anders, ihm bleibt keine Wahl. Er holt Luft, ehe er, so ruhig und gemächlich es ihm eben gelingen will, zu dem Suchenden sagt:
»Schau halt amal nach – in mei’m Häuferl.«
Der fährt auf, dass sein Kopf von unten her gegen die Tischplatte kracht, bekümmert sich nicht, sondern stürzt sich begierig auf die sieben restlichen Karten und schreit voll Begeisterung, weil er noch nicht begreift, dass er verloren hat:
»Ja! Da muss er drin sein!«
Erst als er ihn in den Fingern hält, geht ihm, langsam genug, ein Licht auf, und er stöhnt:
»Verdammti G’schicht! Wo es dir doch aufgesetzet war für den heutigen Tag.« Er wirft ihn weg, den vermaledeiten Grasober, und wischt ratlos mit den Händen herum auf dem Tisch.
Darf er lachen und brüllen vor Glück, der Kaspar? Nein, er hält sich im Zaum und schreit seinen Jubel nicht laut heraus. Seinen Augen indes kann er das Leuchten nicht nehmen und dem Mund nicht den Schatten des Schmunzelns, als er die Flasche aufhebt, beide Gläser auffüllt und schließlich das seinige ruhig und feierlich nimmt und dabei spricht:
»So! – Jetz trink ma zum Abschied no’mal mitanand. Auf den Neunziger!«
»Naa!« kreischt der Andere. »Naa, und i mag’n gar nimmer, den Kerschgeist, den hinterkünftigen. I glaub, da damit hast du mich dran’kriegt!«
Damit nicht, will der Brandner grad sagen, da hat der Ausgeschmierte seinen Schnaps schon wütend in einem Zuge hinuntergegossen und schaut so kummervoll her, als ginge es ihm an den Kragen.
Er erhebt sich mühsam, schlotternd und schwach, dreht sich torkelnd zur Tür hin und versucht noch ein Letztes:
»Aber eppa reut dich dei Glück amal, Kasper, könnt doch sein …«
»Kannt mir’s net denken!«
»Doch doch, ganz gewiss! Des weiß ich besser wie du. Der Gewinnst, der bringt dir koan’ Nutzen, da hast nix davo’. Der Ewigkeit kimmst du net aus!«
»Is scho recht, tua di net oba, i glaub dir’s a so.«
»Kaspar, im bitteren Ernst, wirst es sehn, dei’ gewonnene Zeit lauft dir übel dahin und kommt zu einem ganz bösen End’! Wenn’s dir vordem schon g’langt, na brauchst mi bloß rufen, gleich bin i da.«
»Hat guate Weg.«
»Naa, ruf mi, und hab koane Schiss. Ich weiß es, du werst di bald nach meiner Wiederkunft sehnen! Ruf! – Ich komm auf der Stell und führ dich ganz sanft und in Gnade, ganz sanft – i versprich’s. Versprich du mir’s auch, du Hallodri, o je …«
Alle Kraft ist aus ihm, es schmeißt ihn auf dem Weg hinaus noch an den Ofen und hinüber zum Stuhl. Ums Haar wäre er mit knickenden Knien an die Tür hingerannt, die sich auftut vor ihm.
»Jetzt schau, dass d’ endlich ’nausfindst beim Tempel«, lacht der Alte ihn aus, als er ihn da so ganz klein und ganz krumm am Türpfosten herumscheuern sieht.
»Und gib mir fei Obacht, dass es dich net auf d’ Nasen hinhaut, da draußen. Pfüa Gott, bis in achtzehn Jahr, Bruder, und Glück auf ’n Weg.«
»Ruf mi vordem! I bitt dich gar schön! Versprich’s halt! Wenn’s amal nimmermehr gilt, dei G’sangl!« Und er beginnt schauerlich falsch und daneben zu krähen: »Nix hast du, und lebst aa!«, und weiß nicht weiter.
Da singt’s ihm der Brandner noch einmal vor, laut und stark, und seine alte Stimme klingt jung, übermütig, und dankbar dazu:
»Nix han i, und do leb’ i halt,
mit Gottes Gnad.
Und ’s Leben oft ein’ net besser g’fallt,
der ebbes hat.«
»Ja, der ebbes hat, und du hast’s und kannst es gar net ermessen, was du hast – du –, du Mensch du!«, jault der Betrogene und fallt aus der Tür, ohne zu Boden zu stürzen. Ein Etwas fängt ihn da auf und hebt ihn hinweg, er gleitet hinaus in die Nacht, sein Klagen verklingt.
Der Brandner geht ihm nach bis zur Tür und will zuschaun, wie er verschwindet. Doch da ist nur die Finsternis und kein Schein und kein Schatten. Vom Waldrand klingt nun das Wiehern herüber, dann erhebt sich wieder der Sturm, der keinen Busch, keinen Ast und kein Blattl bewegt, tost davon, das Scheppern der Totenglocke mischt sich darein und verklingt mit dem Sausen.
Es wird still und – fort ist er.
Der Kaspar steht noch lange unter der Tür, späht und lauscht und fühlt, wie sein Herzschlag ruhig und gemächlich wird. Im Stall hört er die Viecher sich regen, aus dem Wald dringt der Schrei eines Uhus herüber, der Söllmann kommt her, reibt sich an den Füßen des Alten und gähnt weit dazu.
Hinter dem Wallberg steigt das erste Glimmen des Sommermorgens herauf. Die Vögel beginnen, eins nach dem anderen, in die Stille zu singen, die Luft ist kühl und ganz frisch, und dem Kaspar wird es so feierlich, als sähe er den ersten Tag der Schöpfung, als seien die Welt und alles Leben in ihr neu geboren, in dieser einen einzigen Nacht.
Er geht bedächtig in seine Stube zurück, schließt fest seine Türe hinter sich zu, seine Tür – und kniet vor dem Herrgottsbild nieder. Er will beten und danken mit Worten – und bringt doch nur ein um das andere Mal das eine hervor:
»Neunz’ge! Neunz’ge!«
Dann lässt er sich in den Lehnsessel fallen, todmüd und hellwach zugleich, und lässt es jagen in seinem Hirn.
Geträumt, denkt er.
Wahr, sagt es.
Wär ja nix g’wesen, so einfach fort auf ’n Schlag. Was hätt denn das für ein Sterben sein sollen, ohne die Letzte Ölung, ohne ’s Versehen durch den Herrn Pfarrer. Wer weiß, wie das ihm geschadet hätte, drüben, im Jenseits, dem er so nah war.
Er denkt, wie seine Eltern gestorben sind. Die Mutter im Haus hier, elend und schwer nach dem Kranksein. Stündlich ersehnt hatte sie ihre Erlösung. Da war er eingetreten, der Boanlkramer, sichtbar allein nur für sie, hatte sanft und ein bisserl verlogen in Güte gesprochen zu ihr, und dann hatte es sich aus ihrem Leib gehoben und war mitgegangen, hinaus vor das Haus, auf den Karren, und fort, davon mit dem wiehernden Gaul.
Sterben?
Was hätten die Leut wohl gesagt, wenn er heut Nacht hätte gehen müssen? »Z’ früh«, oder »So lebendig, voll Kraft, wie er noch war«, oder »Es trifft allaweil die Verkehrten?« Wer hätte um ihn getrauert? Das Marei gewiss, die hätte ihn arg vermisst. Die mehreren hätten gewiss bloß leichtfertig gesagt: »Jessas, jetz is der aa g’storben.« Ein jeder denkt ja doch bloß an sich und allenfalls noch an die Nächsten, ans Erben, wie es weitergehen soll und wie es wohl weitergehen wird.
Wie aber, und wohin, wird die Seele entrückt in die Erlösung? Wer denkt es und sucht’s zu erspüren? Doch keiner so recht, weil keiner es weiß und antworten könnt. Ich aber, ich hab einen Deut davon g’spürt, wie es ist und wie es geschieht. Ich weiß jetzt um was, von dem die ändern nix wissen. Und nie, niemals soll jemand ein Wörtl hören von mir über das!
Achtzehn Jahr noch zu leben in einer Gewissheit! Was wird das bedeuten? Was wird sich erfüllen in dieser Zeit? Werd ich krank sein auf den Tod und nicht absterben können? Nein, ich brauch ja bloß rufen. Dreimal hat er mir das gesagt und förmlich gefleht, dass ich’s tu! Mir kann nix geschehn! Ich hab ein Versprechen, grad so, als hätt ich das ewige Leben!
Und ich versprech mir selber in dieser Stund, dass ich es nutzen werd, für jene, die mir anvertraut sind hier auf Erden.
»O mei – Marei!«, lacht er noch vor sich hin. Dann schläft er im Lehnstuhl behaglich ein.