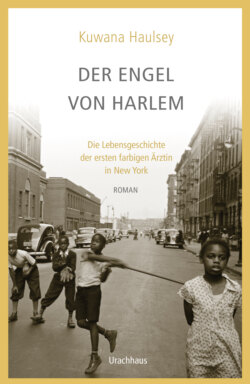Читать книгу Der Engel von Harlem - Kuwana Haulsey - Страница 10
Kapitel 2
ОглавлениеEmmaline Miller war sechzehn und über und über mit verkrustetem Schweiß bedeckt. Sie hievte ihren Körper aus dem Bett und rieb ihren Rücken an dem Schreibpult in der Ecke wie eine Katze. Als das nichts half, heulte das Mädchen voller Verzweiflung auf und versuchte, ihr Rückgrat gegen die Kante des Pults zu rammen. Ich sprang hin und konnte gerade rechtzeitig noch meine Hand dazwischenstecken. Mein Handrücken wurde an die spitze Kante des Holzes gedrückt, direkt auf den Knochen, und ich spürte einen stechenden Schmerz.
»Ich kann das nich machen«, jammerte sie.
»Doch, du kannst, Emmy. Du machst es bereits.«
Ich flüsterte ihr zu, leise und unnachgiebig, während meine Hände ihren Kopf hielten, sodass sie nicht anders konnte, als mir in die Augen zu sehen. Ihre Schulmädchenzöpfe gingen auf und umspielten meine Finger, zusammengeklebt von ihrem Schweiß. Sie hatte Blut in den Haaren, in die Kopfhaut einmassiert wie ölige Flecken. Es war das helle und strähnige Rouge, das sich von ihren Wangen abgelöst hatte.
Emmy schrie erneut, lang und laut. Sie schrie, bis sich die Tür öffnete und ein braunes, besorgtes Gesicht im Türspalt erschien. Ich hob eine Hand, die verletzte, und die Tür schloss sich schnell mit einem leisen Klicken.
»Sch, sch, sch, meine Kleine. Bald ist es vorbei, versprochen.«
Vornüber gebeugt kuschelte sich ihr massiver Körper in den meinen, sie schniefte und gluckste. Ich sang für sie, erfand Lieder ohne Worte, ohne störende, einengende Worte, und wischte den Speichel ab, der von ihren Lippen tropfte wie bei einem Baby. Ich hielt sie so, wie mein Vater mich gehalten hatte, als ich ein kleines Mädchen war, in Sicherheit und geschützt vor all dem Wissen.
»Versprochen?«, fragte sie.
»Ja.«
Emmy nahm meine beiden Hände in die ihren und legte sie auf die Unterseite ihres Bauches.
»Hol es jetz raus«, flüsterte sie.
»Noch nicht«, erklärte ich ihr. »Aber bald.«
Wir gingen rüber zu dem kleinen Bett in der Mitte des Raumes und ich drückte sie hinunter auf die durchnässte, plattgewalzte Matratze. Sie leistete keinen Widerstand, hatte gar keine Energie dazu, aber die Tränen schossen ihr in die Augen, als ihr Körper die grobe Decke berührte, die über das Bett geworfen war. Es war grobe Wolle, kratzig und rau, und sie tat weh. Alles tat ihr weh in dem Moment.
»Wenn du Angst hast«, sagte ich, »tut es noch mehr weh. Hab keine Angst. Es gibt nichts, wovor du Angst haben musst. Das gehört dazu: Du streckst dich nach dir selber aus. Erinnerst du dich? Atme, Baby. Fühlst du es? So leistest du deinen Beitrag zu Gottes Werk.«
Erstaunlich, wie sehr ich wie meine eigene Mutter klang. Ich verstand nicht einmal alles, aber was machte das schon? Es funktionierte. Die Augen meiner jungen Tochter wurden weich und ruhig. Sie nahm meine Hand und presste sie an ihr Herz.
Emmalines Baumwollkleidchen war einmal blau wie ein kleines Vogelei gewesen. Sie hatte es vollkommen verdreckt, den Stoff im Blut ertränkt. Es war wertlos. Ich zog es ihr über den Kopf, ließ es zu Boden fallen und wickelte eine saubere Decke um ihre Schultern. Die Decke hatte ich von zu Hause mitgebracht, extra für sie, sie war weich und roch frisch. Sofort nahm sie einen Zipfel zwischen ihre geschwollenen, ovalen Lippen und begann zu kauen. Ich weiß nicht warum, aber ich musste lachen. Sie versuchte auch zu lächeln, doch eine erneute Wehe setzte ein, und das Lächeln verwandelte sich in ein Wimmern, dann in einen Schrei.
So zerbrechlich, dieses Kind. So zart. Emmaline gehörte nicht hierher, in diesen Raum, in all diesen Schmerz. Sie gehörte in die Sonne, am besten daheim in Kingston, wo sie zur Welt gekommen war, irgendwo unten am Meer.
Ich massierte ihren Bauch mit Mandelöl, das mit Salbei versetzt war. Am oberen Rand, dort, wo die Rippenbögen sich teilen und wie Flügel öffnen, genau in der Mitte zwischen ihren Brüsten, konnte ich ein anderes kleines Köpfchen spüren.
Während ich ihren Bauch mit großen Kreisbewegungen einrieb, fiel mir ein Traum ein, den ich in der Nacht zuvor gehabt hatte. Am frühen Abend, kurz bevor ich aufwachte, hatte ich von Emmaline geträumt, wie sie vor mir stand, nackt und aufgebläht und braun, wie gebrannter Ton. Sie lächelte und sagte ohne die Spur eines Akzents: »Du bist der Dunst über dem Ozean, der Rauch, der vom Meer aufsteigt. Danke.« Dann verschwand sie.
Es war ein harmloser Traum, der unter anderen Umständen ohne Bedeutung gewesen wäre. Wahrscheinlich hätte ich mich nicht einmal an ihn erinnert. Doch ich wachte auf und wusste, dass sie mich gerufen hatte, auch wenn es fünf Wochen zu früh war, und ich wusste überdies, dass ich, egal, was passieren mochte, weder sie noch ihr Kind sterben lassen würde. Ich wusste nicht genau, was ich dafür zu tun hätte, aber das war auch nicht wichtig. Alles würde schon zu mir kommen.
Ich rieb über Emmys Haut, bis sie warm war und glänzte. Dann legte ich eine heiße Kompresse auf ihren Magen und griff hinunter, um ihre Beine zu spreizen. Ich tauchte meine Finger in Öl, ließ zwei von ihnen in sie hineingleiten und drückte gegen ihren Muttermund. Auch diesen Körperteil massierte und streichelte ich, drückte ich auseinander, machte ich weiter, geschmeidiger, dehnbarer. Sie öffnete sich wie eine Blume in meiner Hand und alles war plötzlich voll Flüssigkeit, mehr und immer mehr, strömend und unnachgiebig.
»Es ist soweit, meine Kleine. Ich möchte, dass du dich auf den Boden legst.«
Von mir gestützt setzte Emmaline sich auf und glitt aus dem Bett. Ihre Mutter hatte ihr eine Geburtsmatte gewoben, mit einem Muster aus Wurzeln und zerfließenden, korallenen Blüten eines Flammenbaums. Den Stamm herab kletterte eine dickbusige schwarze Frau mit Ästen aus abstehenden Haaren, ausgebreiteten Armen und weit geöffnetem Mund, ihr Gesang in die Fäden eingearbeitet. Auf allen vieren, unten auf dieser grob gewirkten Matte, die ihre Mutter geflochten hatte, begann Emmaline zu pressen.
Als das Knie zum Vorschein kam, stieß Emmy einen durchdringenden Schrei aus und versuchte wegzukriechen. Doch der Schmerz verfolgte sie, hielt sie auf und ließ sie zitternd am Bettrand verharren, weinend und den Kopf gegen das kühle Metall des Rahmens gepresst.
Als sie aufschrie, fingen die vier Frauen draußen vor der Tür ein Wehklagen an, zuerst leise, mit Stimmen, die rissig wurden und aufbrachen, genauso wie der Körper, der aufbrach, dann lauter, ganz so, wie der Körper sich immer mehr dehnte und aufs Loslassen vorbereitete. Tiefe und hohe Klänge ohne Worte verschmolzen zu Grund und Gischt eines Flusses und boten so dem Kind sicheres Geleit bei seinem Eintritt in die Welt.
»Hör mir zu, Emmy. Hörst du mich? Nicht weiterpressen. Erst, wenn ich’s dir sage. Was immer auch ist. Noch nicht pressen. Hast du verstanden?«
Mir schien, sie sagte ja, aber ganz sicher war ich mir nicht. Mit einer Hand unter ihrem Bauch wiegte ich sie hin und her, mit der anderen Hand schob ich das Knie des Babys wieder hinein. Emmy bäumte sich auf und schrie, als ich den Fuß des Babys ertastete und ihn herauszog. Dann griff ich nochmals in sie hinein, streckte das andere Bein des Babys und zog auch diesen Fuß heraus.
»Okay, pressen, Emmy! Pressen!«
Den Rücken gekrümmt und den Kopf am Rand des Bettes vergraben, gab Emmaline Beine und Becken ihres Kindes frei. Die Stimmen auf dem Gang wurden lauter.
»Braves Mädchen! Ein kleiner Junge ist unterwegs. Wie stolz ich auf dich bin!«
Das Baby begann herauszugleiten und ich ließ den Jungen zwischen ihren Beinen baumeln, sodass sein eigenes Gewicht ihn weiter nach unten zog. Dann hielt er inne, gehalten von seinen eigenen Armen.
»Ich press jetz. Es kommt.«
»Warte! Noch nicht.«
Vorsichtig nahm ich den kleinen Körper an der Hüfte und drehte ihn hin und her.
»Okay. Jetzt!«
Emmaline presste, während ich ihn drehte und dabei erst den einen, dann den anderen Arm befreite.
Grunzend presste sie nochmals und die Schultern des Babys glitten heraus. Dann schloss sich die Öffnung um seinen Hals und ließ den Kopf drinnen stecken. Ich ließ ihn wieder baumeln und griff mit der linken Hand nochmals hinein, um sein Kinn zu finden. Es gelang mir nicht.
Mittlerweile hatte die Nabelschnur aufgehört zu pulsieren, was bedeutete, dass sie keinen Sauerstoff mehr in sein Gehirn pumpte. Binnen einer Minute würde das Kind in seinem eigenen Geburtskanal ersticken.
Ich schob meine Hand in Emmy hinein und drückte von oben auf den Kopf des Babys. Sein Kinn streifte meine Fingerspitzen und ich griff zu.
»Emmy, press!«
»Kann nich.«
»Und ob, Baby. Du musst jetzt pressen. Jetzt!«
Aber sie war kurz vor der Ohnmacht. Ich wusste nicht, ob sie mich überhaupt hören konnte.
»Emmaline!«
»Dr. May, ich kann’s nich.«
»Du musst aber. Bitte, einmal noch. Fertig?«
Sie war heiser. Sie konnte nicht mehr schreien, deshalb keuchte sie, keuchte und knurrte und presste. Als sie presste, zog ich. Der Gesang der Frauen erreichte seinen Höhepunkt und löste sich in Schweigen auf, just als der kleine Junge in Unmengen von Blut und Flüssigkeit herausgeschwemmt wurde.
Er war zierlich und grau, bedeckt mit Geburtsüberbleibseln, zäh wie Schleim. Mein Gott, wie wunderbar!, dachte ich. Wie wunderbar lebendig und gesund.
Erst als ich ihn umdrehte, um Nase und Mund zu säubern, entdeckte ich das Glückshäubchen. Ein dünnes Gewebe, wie durchsichtige Haut, überzog sein Gesicht. Ich hatte davon gehört, wusste, was es bedeutete, aber ich hatte nie zuvor gesehen, wie ein Kind damit zur Welt kam. Der Junge war also nicht nur wunderbar schön und kräftig, sondern war auch in der Lage, mit geschlossenem Auge zu sehen. Vorsichtig entfernte ich das Glückshäubchen und legte es beiseite, verknotete dann die Nabelschnur und durchtrennte sie.
Er schnappte dreimal nach Luft und öffnete seine Augen.
»Du hast es geschafft, Emmy«, flüsterte ich.
»Ich will’s sehn.« Sie drehte den Kopf dorthin, woher das Wimmern des Babys kam, und ich hielt es ihr näher hin, damit sie sich nicht so sehr krümmen musste. Emmy musterte ihr neugeborenes Kind sorgfältig, machte jedoch keine Anstalten, es in die Arme zu nehmen. Sie starrte es nur an und versuchte, so schien es, Teile davon wiederzuerkennen oder sich zu erinnern, woher sie es kannte.
Ich hatte eine Schüssel mit warmem Wasser auf einem Hocker bei der Tür vorbereitet. Wir gingen rüber zu dem Wasser, um zu baden, dieses Kind und ich. Als der Junge sauber war, wickelte ich ihn in eine Decke und legte ihn in ein Körbchen am Boden. Ich holte weiteres Wasser für Emmy, half ihr auf die Beine und reinigte sie, wusch sie zärtlich ab, mehr wie das Kind, das sie gewesen, als wie die Mutter, die sie geworden war. Dann streifte ich ihr ein frisches Baumwollnachthemd über den Kopf und drehte die Matratze um, mit der trockenen Seite nach oben, damit sie und ihr Sohn ausruhen konnten. Das Mädchen kletterte in das Bett und streckte jetzt, das erste Mal, die Hände nach dem Baby aus.
»Wie heißt er denn?«, fragte ich, als ich ihn in ihre Armbeuge bettete.
»Was würden Sie sagen?«
»Nun«, antwortete ich langsam, »für mich sieht er aus wie ein David. Oder vielleicht ein Michael.«
»Michael. Das is, was meine Mamsie auch gesagt hat. Wenn’s ein Junge wird, dann Michael. Und Michael Anthony? Wie finden Sie das?«
Sie sprach den Namen aus wie Ant’ny, sodass es einen Moment dauerte, bis ich verstand, was sie meinte. Als ich dann kapierte, sagte ich: »Ja, das ist ein schöner Name. Der Name eines wirklich starken Mannes.«
Emmys Gesicht strahlte, als ich das sagte, und ich wusste, dass ich das Richtige gesagt hatte.
Der Junge suchte bereits nach ihrer Brust. Als er sie durch das Nachthemd hindurch nicht finden konnte, fing er das erste Mal an zu weinen.
»Was’n los, Junge? So’n kleines Ding und so’n großes Geschrei?«
Sie nahm Baby Michael in den Arm und ergab sich und ihren ausgelaugten Kinderkörper seinem suchenden Drängen. So einfach fanden sie zusammen. Diese beiden, Mutter und Sohn, wurden auf so natürliche Weise in einer Liebe verknüpft, so natürlich und instinktiv, wie er seinen ersten Atemzug getan hatte.
Meine Kehle schnürte sich zusammen, als ich die beiden so sah, und mein Mund füllte sich mit einem sauren Geschmack, von dem ich wusste, dass es Sehnsucht war. Sehnsucht nach der Vergangenheit. Sehnsucht danach, die Fülle, Schwere und Reichhaltigkeit meiner eigenen Fährte zu spüren, wie Wurzeln und Spuren, die eingebettet sind ins Erdreich. Das war, was ich dringend brauchte, aber nie besitzen würde.
Ein Teil von mir wollte nicht glauben, dass das immer noch so weh tat, nach so vielen Jahren. Diesen uralten, unauslöschlichen Kummer sollte es immer noch geben? Das konnte nicht sein. Ich musste doch die Kraft aufbringen können, einen Schmerz abzuwehren und zu vergessen, der so alt war, dass er schon bröckelte. Bloß wie? Besonders, wenn er sich teilen, weggleiten und abtropfen konnte, wie Wasser aus einer geöffneten Hand. Das Beste, was ich machen konnte, war, mich zu entfernen und die Traurigkeit jemand anderem zu überlassen. Ich gab sie an ein anderes Mädchen weiter, an eine, die viel jünger war als ich und dumm genug, nichts zu bemerken.
Ich ging zu dem kleinen Fenster und sah hinaus, runter auf die Straße hinter dem Gebäude. Im Zickzack hingen Wäscheleinen voller Westen und Röcke und Leintücher zwischen den hölzernen Fensterbrettern. Wäschestücke flatterten im Dunkeln, vom Wind umhergewirbelt, als ob sich bereits Leute darin befänden. Im Morgengrauen würde man die Kleider dann hereinholen, flachpressen und zusammenlegen; dann würden die Frauen zur Arbeit gehen.
Ich gab mir Mühe, Emmys Augen nicht zu begegnen, als ich meine Aufmerksamkeit wieder auf den Raum richtete und mich an meine Arbeit machte. Auch wenn ich nicht saubermachen musste, wollte ich es doch tun. Es schien mir meine Aufgabe zu sein, dieses Kind mit dem zweiten Gesicht in angemessener Weise zu präsentieren. Gleichzeitig wollte ich mich selbst ablenken von dem Gefühl der Enge, das in meinen Brustkasten gekrochen war und sich dort festgesetzt hatte.
Ich drückte das Gefühl der Einsamkeit, des Abgetrenntseins, weit hinunter in meine Hände und spülte es aus, indem ich den Boden schrubbte. Auch die Eifersucht wurde abgerieben, als ich saubermachte, mit dem Blut und der Nachgeburt auch die Traurigkeit wegwischte und bei all dem darauf achtete, dass ich auch unter das Bett und in jede Ecke kam. Ich steckte die Geburtsmatte und Emmys altes Kleid in einen Sack zum Verbrennen. Das Glückshäubchen bewahrte ich für den Tee gegen böse Geister und zur weiteren Untersuchung auf.
Emmy hatte Probleme mit Michael. Als sie anfing, ihn zu stillen, bekam sie Schmerzen. Es war an der Zeit, die anderen Frauen hereinzurufen; ich hätte gern hinübergegriffen und ihr geholfen, doch das war die Aufgabe ihrer Mutter. Ich machte die Tür auf und sagte: »Kommen Sie rein. Er ist da.«
Ruth Miller und ihre drei Schwestern stürmten ins Zimmer und stürzten sich auf das Kind, bevor ich noch die Tür richtig aufgemacht hatte.
»Schaut da«, sagte die älteste Schwester, Rose. »Schaut euch den großen Kerl da an.«
Sie waren verliebt. Michael Anthony, der einzige Mann im Haus.
»Der kann sich schon sehen lassen, oder nicht?«, fragte Miss Ruth.
»Dies Baby hier sieht genauso aus wie mein Henry, kurz bevor er starb, der Arme«, sagte Tante Lucy.
Annie, die jüngste und kräftigste der Schwestern, beugte sich vor und rümpfte die Nase.
»Was hast du denn jetzt schon wieder, Annie?«, fragte Rose streng. »Was machst du wieder für Grimassen?«
»Mit dem Baby stimmt was nich«, sagte Annie.
Die anderen Frauen begannen sofort, sie im Patois-Dialekt auszuschimpfen – das meiste davon verstand ich nicht. Aber Annie ließ sich nicht einschüchtern.
»Nee«, wiederholte sie, »der Junge riecht schlecht. Schlecht, sag ich. Kann nur nich sagen, was für’n Geruch das is.«
»Annie –«, fuhr Miss Ruth sie an.
»Ich sag’s euch im Ernst, der riecht.« Jetzt leuchtete Annies Gesicht auf. »Ich hab’s! Ich weiß, nach was er riecht.«
»Nach was?«, fragte Tante Lucy.
»Der riecht nach Muschi!«
Die Frauen kreischten allesamt vor Lachen, ließen sich prustend gegen die Wand fallen, aufs Bett, gegen das Schreibpult, tanzten lachend ein paar Cakewalk-Schritte und drehten sich gackernd umeinander. Dieses Baby war ein Fest. Es verdrehte den Frauen völlig den Kopf.
Ich hingegen war völlig schockiert, dass anständige Frauen solche Worte benutzten. Mein Vater hatte mir nicht einmal erlaubt, v-e-r-d-a-m-m-t zu sagen. Wenn ich je wütend genug war, um zu fluchen, legte ich eine Hand aufs Herz und sagte: »Du liebe Zeit!«
Je mehr ich errötete, desto lauter lachten sie natürlich.
»Hört auf!«, kreischte Lucy. »Schaut, was ihr gemacht habt. Ihr habt unsere Ärztin erschreckt.«
»Ach was! Frau Doktor hat auch eine, genau wie –«
»Bitte nicht!«, riefen die anderen Frauen, denen die Tränen übers Gesicht liefen.
Dann kam mir Tante Rose zu Hilfe. Wenn man so will.
»Gute Ärztinnen sagen solche Sachen nicht«, klärte sie ihre Schwestern auf. »Ist es nicht so, Dr. May? Und außerdem hat Miss Landry vom Frisiersalon unten an der Lenox neulich gesagt, Dr. May hat noch nie einen Mann gehabt. Deshalb ist sie besonders empfindlich bei solchen Sachen.«
Die Frauen rangen nach Luft und warfen die Hände in die Höhe. Dann fingen sie an, durcheinander zu reden, so schnell, dass ich fast nicht mitkam.
»Kein Mann! Wie lebst du denn ohne Mann, Kind?« (Tante Lucy)
»Is nich wahr.« (Tante Annie)
»Ist das die Möglichkeit?« (Miss Ruth)
»In deinem Alter, Liebes.« (Tante Rose)
»Sie sieht so jung aus.« (Miss Ruth)
»Wie ein Baby«. (Tante Lucy)
»So jung is sie gar nich.« (Tratschtante Annie)
Dann sagte Tante Lucy: »Raus mit der Sprache, Mädchen. Was für einen Mann hast du?«, und im Raum kehrte Ruhe ein.
Nach einem Moment Pause schnalzte Annie mit der Zunge. »Sie weiß nicht, was sie sagen soll.«
»Das denkt sie nur!«, sagte Tante Lucy.
Unter diesen Umständen blieb mir nichts anderes übrig – ich wich wie ein Feigling aus und hielt das Glückshäubchen hoch.
Die Frauen schlugen sich vor Schreck mit der Hand auf den Mund (endlich doch still) und traten den Rückzug an bis hinten an die Wand.
»Das wollen Sie sicher behalten«, sagte ich ihnen. »So kam er raus, mit dem hier auf dem Gesicht.«
»Ja, Dr. May«, sagte Miss Ruth leise. Sie streckte die Hand aus, um es mir abzunehmen, hielt dann jedoch inne und zog die Hand wieder zurück. Sie schien vor dem Ding Angst zu haben.
Ich kam mir vor wie ein Schuft. Ich hatte die ganze Fröhlichkeit aus dem Raum gesogen, von einer Sekunde auf die andere. Geburten sind doch eigentlich erfreuliche Anlässe. Aber auf einmal sahen diese Frauen ernst und eingeschüchtert aus. Miss Ruth stand da und starrte auf das Glückshäubchen, die Hände vor sich verschränkt, als ob sie es nicht anfassen wollte. Ich ging rüber zum Schreibpult und wickelte es in ein Stück weichen Stoff, der neben meiner Arzttasche lag.
»Mamsie, sein Name is Michael Anthony.«
So sanft wie deutlich brachte uns die Hoffnung in Emmys Stimme alle wieder zur Besinnung. Miss Ruth wandte ihre Aufmerksamkeit jetzt ihrer Tochter und ihrem Enkel zu. Die Frauen schienen ihn noch einmal ganz neu anzusehen, mit neuen Augen. Das Baby gähnte und dehnte sich und beendete mit seiner bloßen Vollkommenheit die Spannung.
»Schaut euch dieses faule Bürschchen an«, gurrte Tante Rose.
»Ja, Ma’am. Ich hab ihm noch nich mal Arbeit gegeben, und trotzdem tut er schon so, als ob er schläft«, sagte Miss Ruth.
Und mir nichts, dir nichts war der Raum wieder von Lachen erfüllt.
Es war weit nach vier in der Früh, als ich wieder die Lenox Avenue entlang Richtung Krankenhaus ging. Ich hatte keine Uhr, doch ich wusste einfach, wie die Zeit verstrich. Ich war so an die Nacht gewöhnt, dass ich die Stille, die um 2 Uhr 45 herrschte, von der um 3 Uhr 30 unterschieden konnte. Es gibt einen speziellen Geruch, einen anderen Geschmack in der Luft, wenn die Sterne wandern und untergehen. Man kann es kaum erklären, aber je später es wird, desto freier wird die Nacht. Und wenn dann die Dämmerung kommt, gibt es fast nichts mehr, was sie einengt.
Gegenüber dem Krankenhaus kam ich an Rudy’s Recovery Room Bar & Grill vorbei und überlegte kurz, ob ich nicht reinschauen sollte. Der Laden sollte eigentlich seit Stunden geschlossen sein, aber ziemlich oft saßen der alte Rudy und seine Kumpane, zu denen hie und da auch Papa gehörte, noch da und krakeelten herum, bis die Sonne aufging.
Was würden all die Taugenichtse und Säufer denken, wenn sie mich sehen würden, wie ich reinkomme, um noch einen zu nehmen? Skandal! Noch vor dem Mittagessen wüsste jeder hier in Harlem Bescheid. Die normalen Leute würden frömmelnd und peinlich berührt davon erzählen und die Säufer würden nur den Kopf schütteln können, hm-hm-hm.
»Dr. May? Lil’ Bit May von hier um die Ecke? Bei Rudy’s? Nee, Alter. Du lügst doch.«
»Kannste ruhig glauben, Mann. Hab’s selbst gesehn. Sie kommt rein, in aller Herrgottsfrühe, frech wie Oskar. Und ich sag’ dir: Die hatte schon’n bisschen was getankt.«
Bei dem Gedanken musste ich lachen, ein kurzes, teuflisches, niederträchtiges Lachen. Als ich so lachte, konnte ich atmen. Ich stand am Bordstein, wippte mit den Zehen und ließ ein Maultiergespann vorüberziehen, und das eigentlich nur aus Höflichkeit, denn außer diesem Ding bewegte sich rein gar nichts auf der Straße.
Der Haupteingang des Krankenhauses lag direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite. Im dritten Stock, im Nordwestflügel, lag mein Vater und erholte sich. Er hatte die Operation überlebt, und auch wenn niemand das sicher sagen konnte, hofften alle, er würde die Nacht überstehen.
Ich wollte schon loslaufen und reingehen, da hielt ich inne. Mir wurde klar, dass ich dort gar nicht hinwollte. Vielleicht starb mein Vater ja, und ich musste zusehen. Das konnte ich nicht. Wenn er schon sterben musste, dann musste er das ohne mich tun, ohne dass ich mich über ihn beugte und Gelassenheit vortäuschte. Es gab zu viele unerledigte Dinge zwischen uns. Ich konnte mir einfach diese Lüge nicht für den Rest meines Lebens auf meine Schultern laden.
Ich spürte Wind aufkommen und mir ins Gesicht blasen – einen wohlriechenden Wind, süß und köstlich. Dankbar für die Ablenkung folgte ich ihm weg vom Krankenhaus, um die Ecke und wieder die 137ste Straße entlang Richtung Eighth Avenue.
Manchmal machte Harlem einfach solche Dinge, wisst ihr? Es öffnete und offenbarte sich mit kräftigen Gerüchen, vielfältig und durchdringend, übergoss und umhüllte einen mit Klängen und ließ sie üppig herumwirbeln wie Herbstfarben. Schon wenig später wusste man nicht mehr, was was war oder wo die Wahrnehmung herkam.
Die meisten Menschen wissen es nicht, aber genau in diesem nebligen Nebeneinander von Wahrnehmungen entstehen Songs, hier werden sie erstmals entworfen, als Geschichten im Zweivierteltakt. Schließlich werden die Geschichten zu Wahrheiten, werden in komplexere Strukturen eingestreut, in den Rhythmus eingelagert, denn der geht nicht verloren. Er ist unzerstörbar und gehört uns, unverschämt unsterblich und frei.
Achtelnoten kamen vom Hang des Sugar Hill, und weil sie mich riefen und dabei lächelten, dachte ich nicht mehr an das Krankenhaus, sondern ging ihnen nach. Etwas anderes konnte ich nicht tun – nur ihnen antworten und folgen.
Ich musste mich einfach von dem Gefühl befreien, in meinem Körper gefangen zu sein, das Objekt der Erwartungen so vieler Menschen zu sein. Ich musste nachdenken, und im Krankenhaus konnte ich das nicht. Mittlerweile wussten sicherlich alle, dass Dr. Crump angeboten hatte, für Papas Operation und Krankenhausbett aufzukommen. Die anderen würden erzürnt und feindselig sein, würden wissen wollen, warum. Was machte William Chinn zum Vorzugspatienten in einem Krankenhaus, das für 200 000 Menschen nur 273 Betten hatte? Es würde lautes Murren und böses Gerede über »Sonderbehandlungen« geben. Vergeltungsmaßnahmen.
Es gab schon zu viele Menschen, die mich beobachteten, obwohl sie vorgaben, das nicht zu tun. Nein, noch schlimmer: Sie erwarteten allen Ernstes, dass ich vortäuschte, mir sei nicht bewusst, dass sie es waren, die etwas vortäuschten. Dieses Theater war schnell mühsam und lästig geworden. Es war der wahre Grund dafür, dass ich meinen Tutor gebeten hatte, mich dem Sanitätsdienst draußen zuzuteilen.
In den vergangenen Jahren hatten nur eine Handvoll Frauen (von der ersten bis zur letzten weiß) ein Internship, die praktische Ausbildung, absolviert. Keine hatte Sanitätsdienst machen dürfen. Die Männer wurden regelmäßig eingeteilt, aber um die Sicherheit einer Frau aufs Spiel zu setzen, war Harlem viel zu gefährlich, zu widerspenstig und unvorhersehbar. Die anderen Ärzte hatten keine Ahnung, warum ich darauf bestand und nicht locker ließ. Aber sie mussten ja auch nicht die Augen ertragen. Ihnen war ja auch nicht auferlegt, nicht zu wissen, was sie wussten, und sich bei all dem an alles zu erinnern, was man sie aufgefordert hatte zu lernen – nur um diese Augen zufriedenzustellen.
Die meisten von ihnen wollten mich loswerden, sowohl Ärzte als auch Interns, Assistenzärzte, aber wo sollte ich denn sonst hin? Wo sonst wurde ich gebraucht, wenn nicht hier, bei meinen Patienten? Sie waren meine Anker, strategisch angeordnet, um mich zu halten, Zahnräder, die mich mit meinem Leben verbanden. Ohne sie konnte ich jederzeit wegtreiben, ein neues und womöglich nicht wiederzuerkennendes Ding werden. Und was sollte ich dann machen?
Ich bog um die Ecke und überquerte die Straße an der Stelle, wo der Gehsteig nach Pfefferöl und Schweinebraten roch, und das, obwohl Pig Foot Mary erst wieder gegen zehn am Vormittag dastehen und Klatsch, gebutterte Süßkartoffeln und Innereien in ihrem Handkarren anbieten würde. Dann wieder stadtauswärts, nein, doch weiter Richtung Downtown, vorbei an den Sandsteinhäusern mit ihren bröckelnden Ziegelfassaden, vorbei an den rötlich-beigen Mietshäusern, die im Sommer brodelten und stanken, egal, wie sehr die Frauen auch putzen mochten. Vorbei an den ungestrichenen Bruchbuden, die im Winter schwer atmeten, sich dehnten und ihre Knochen und Fenster knacken ließen, sodass die Wärme nicht drinbleiben konnte und die Kälte einfach nicht draußenbleiben wollte.
Hier wohnte ich, hier fühlte es sich an, als ob ich schon immer hier gewohnt hätte.
Ich fragte mich, ob der kleine Michael schon eingeschlafen war und ob Emmy daran gedacht hatte, eine warme Kompresse auf ihren Busen zu legen, so wie ich es ihr gesagt hatte. Ich musste wieder einen Besuch machen und nach ihr sehen, vielleicht gleich morgen, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung war. Ich würde hingehen, bevor ich abends die Spätschicht antrat. Die anderen Frauen waren sicher noch munter und stießen auf das neue Leben an. Mama war noch nicht wach, würde aber bald aufstehen, in ein paar Minuten. Dann wären wir beide auf und könnten aneinander denken; damit fühlte ich mich gleich viel besser.
Beim Gedanken an Mama fiel mir ein, dass ich mich für die Nacht abmelden musste. Es gab noch etwas zu besprechen.
Ein Teil von mir sträubte sich gegen den Gedanken an ein Gespräch, gegen diesen plötzlichen Drang, der in mir entstand. Es konnte doch nicht richtig sein, dass ich auf die Meinung anderer Leute angewiesen war, um mich wohl in meiner Haut zu fühlen. Andererseits war ich es leid, allein zu sein; es kam mir vor, als hätte ich so viele Dinge, so viele Menschen in meinem Herzen aufgenommen, als Teil von mir, auch wenn sie sich offenbar nicht genötigt fühlten, den Gefallen zu erwidern.
Und was ist, wenn er wirklich stirbt?
Der Gedanke kam von ganz allein und flüsterte in mein rechtes Ohr, dasjenige, das mehr dem Straßenpflaster zugewandt war. Was, wenn er stirbt und nichts zwischen uns beiden geklärt ist? Um wie viel schlimmer wäre dann alles?
Ich drehte mich um Richtung Harlem. Beinahe so wütend darüber, dass ich plötzlich losrennen wollte. Nein, ich rannte nicht. Aber ziemlich schnell ging ich die leere, ruhige Straße hinunter.
Ich konnte es noch schaffen.
Ich öffnete die Tür, als Mama sich gerade im Wohnzimmer an den Küchentisch setzte. Sie pustete Wellen in ihren Kaffee und ließ den Dampf aufsteigen bis an ihr Haar, wo er einen Moment lang hängenblieb, wie ein schickes Hütchen, und sich dann auflöste. Ihr gegenüber stand eine zweite Tasse Kaffee und wartete.
Ich huschte leise hinein, vergaß jedoch, die Tür zu schließen – wieder einmal. Mit gesenkten Augen erinnerte mich Mama daran. Sie hatte natürlich recht. Schon zweimal war mir jemand nach Hause gefolgt, um mich auszurauben, mir das Kodeinpulver und die Morphiumpillen aus der Tasche zu nehmen; einmal mit vorgehaltener Waffe. Aber irgendwie schien ich das nicht wahrhaben zu wollen. Als ich die Tür geschlossen hatte, ging ich zum Tisch und rückte meinen Stuhl so nah wie möglich an ihren.
»Morgen, mein Liebling.« Sie lächelte, als ob sie mich gar nicht erwartet hätte. »Du bist früh dran.«
»Morgen.«
»Wie geht’s deinem Vater?«
»Unverändert. Sein Zustand ist der gleiche wie am Abend.«
»Wie war’s bei der Arbeit?«
»Gut«, sagte ich. »Das Miller-Baby kam zu früh.«
»Aber das wusstest du doch. Geht’s ihm gut?«
»Ja, Ma’am. Er und die Mutter sind wohlauf.« Ich pustete auf das Zimtpulver auf meinem Kaffee und nahm einen Schluck.
»Gott sei Dank.«
»Er hatte sogar ein Glückshäubchen über dem Gesicht.«
»Was du nicht sagst.« Mama seufzte und schloss die Augen. Ganz leicht, wie abwesend, mit geschlossenen Augen, strich sie mit ihren Fingerspitzen über meine Wange. »Möchtest du wirklich wissen, wer Fanny ist?«
»Ja, Ma’am.«
»Warum? Warum willst du das wissen?«
Ich zuckte mit den Achseln, obwohl sie mich gar nicht ansah. »Ich kann es nicht wirklich erklären. Aber ich spüre, dass es wichtig ist.«
Das war nur zur Hälfte wahr, aber jetzt war nicht der Zeitpunkt, um das auszudiskutieren. Ich legte meine Finger um die schwere, metallene Kaffeetasse, damit sie nicht sehen konnte, wie sehr meine Hände zitterten.
»Also gut«, sagte sie.
Es dauerte eine ganze Weile, bis meine Mutter weitersprechen konnte. Als sie dann schließlich ihre schwarzen Augen öffnete und zu erzählen begann, war sie schon längst ganz woanders.