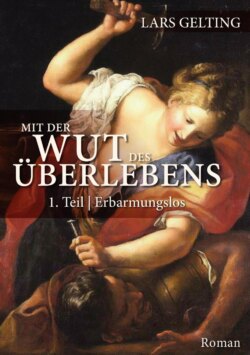Читать книгу Mit der Wut des Überlebens - Lars Gelting - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Teil Wie alles begann
ОглавлениеAls sie zum Haus und der kleinen Lichtung zurückkehrten, wurden diese bereits nicht mehr von den Strahlen der Sonne erreicht, lagen sie im Schatten der hohen Bäume. Die große Wiese jedoch, vom Hause aus teilweise zu überblicken, wellte sich im Wind und im warmen Licht der Abendsonne. Therese lehnte an der Hauswand, genoss die Wärme in ihrem Rücken, die immer noch den dicken Balken entströmte, hörte hinter sich Franz im Haus herumlaufen und rumoren. Als dieser wieder aus dem Hause kam, lehnte sie sinnend, den Kopf weit zurückgelegt und die Augen geschlossen an der Wand.
„Warum wohnst du hier draußen so einsam und allein?“ Sie fragte das, ohne ihre Haltung zu verändern.
„Weil ich seit zehn Jahren hier wohne!“ Er legte flaches Brot und ein Stück Rauchfleisch auf den Tisch und setzte sich dann schräg neben sie auf die Bank. „Das ist und das war in all den Jahren mein Zuhause! Wo sollte ich sonst hin?“
„Dein Zuhause war und ist der Köblerhof!“ sagte sie ruhig, aber sehr bestimmt.
„Ach komm!“ Er betrachtete sie, wie sie so dasaß, entspannt und genießend, „Ich wollt auch, es wäre noch so, aber es ist vieles geschehen in all den Jahren.“ Sie änderte ihre Haltung kaum, drehte jedoch ihren Kopf so, dass sie ihn ansehen konnte. „Hätten mich vor zehn Jahren nicht die Eltern vom Pater hier aufgenommen und mir ein neues Zuhause gegeben, ich wäre heute vielleicht Söldner, oder so was Ähnliches. Ich bin froh, dass ich hier wohnen und arbeiten kann und mein Auskommen habe.“
„Was machst du?“
„Ich bin Schreinermeister! Und nicht der schlechteste!“
„Und Stefan?“ Sie schob ihr Kinn vor, schaute interessiert zu dem Jungen, der immer noch auf den Knien lag und in der sich entwickelnden Glut herumstocherte.
„Stefan? Der ist genau solch ein armer Kerl, wie ich es damals war. Und deshalb bekommt er jetzt bei mir eine Ausbildung. Er ist ein fixer Junge. Der Pater hat ihn mitgebracht – wie mich vor zehn Jahren.“ Sie legte den Kopf leicht schräg, sah ihn sinnend an. Ihr Gesicht sagte, mit leicht heruntergezogenen Mundwinkeln: Alle Achtung!
„Übrigens,“ er legte seine große, sonnengebräunte Hand auf ihre Schulter, „sei nicht traurig! In unserem Haus, im Köblerhof, da kann niemand mehr wohnen. Zuerst hat´s der Wallert verhunzt! Das war der Büttel mit der eingedrückten Gesichtshälfte, du hast ihn ja sicher kennen gelernt. Dann hat der Schwede den Wallert beim großen Brand an unserem Heubalken aufgezogen und den roten Hahn aufs Dach gesetzt. Das Haus ist vollkommen verbrannt.“
Sie nickte ein wenig nachdenklich vor sich hin. Ruhig dann, „Was ist mit dem Zagelhof?“
„Der ist einigermaßen davongekommen. Der Bauer soll von den Schweden übel zugerichtet worden sein, lebt aber jetzt wieder auf dem Hof. Aber,“ er suchte ihren Blick, schaute sie bedeutungsvoll an, „der Hof gehört ihm seit damals, als alle diese Schweinereien passierten, auch nicht mehr. Der Josef muss heute auf seinem eigenen Hof fronen.“ Hörbar, mit einer Mischung aus Bedauern und etwas Spott, stieß er die Luft aus.
Therese lehnte ihren Kopf wieder an die Wand, wandte ihr Gesicht aber sinnend dem knisternden Feuer zu, während Stefan ihr genau gegenüber einen dicken Holzklotz an den Tisch heran rollte.
Sie sah die Zagelbäuerin, die alte Lisbeth, genau vor sich. Diese riesigen Augen, in denen sich Verzweiflung, Entsetzen, vielleicht auch Irrsinn ausdrückten.
„Du träumst!“ Franz stieß sie leicht mit dem Ellenbogen an, „Du solltest zugreifen, bevor Stefan loslegt.“ Was dieser mit großäugigem Grinsen und einigen schnellen Kopfnickern bestätigte.
„Ja.“ sie drehte sich zum Tisch herum, griff nach dem Brot und brach ein Stück ab. „Ich habe gerade an die alte Lisbeth gedacht. Mit der Armen hat alles angefangen.“
„Wie hat eigentlich alles angefangen?“ Pater Gregor beugte sich vor, um sie, an Franz vorbei, ansehen zu können. „Ich habe Lisbeths Verhörprotokoll lesen können, nur wirres Zeug. – Übrigens habe ich auch das von Lina gelesen, das war eine starke Frau!“
Therese ließ die Hand mit dem Stück Rauchfleisch auf den Tisch sinken, „Die Lina war auch im Turm und ist verhört worden?“ Fassungslos blickte sie Franz an, der jedoch geradeaus sah und mit zusammen gepressten Lippen nickte. „Mein Gott, die Ärmste. – Warum denn sie? Die Lina hat doch wirklich niemandem etwas getan!“ Sie musste sich etwas vorbeugen, um den Pater ansehen zu können, der sich gerade ein Stück Brot in den Mund schob und dessen Gesicht im zuckenden Widerschein des Feuers leuchtete.
„Das hatten die wenigsten, die diesen Kerlen in die Hände gefallen sind.“ Er kaute ruhig auf seinem Stück Brot herum, „Sie ist von einer anderen bei der Tortur benannt worden, ebenso wie ihr damals. Das reichte aus. Aber sie hat die Lisbeth mitgenommen, wenn das euren Kummer lindert.“
„Ach Unsinn!“ Therese lehnte sich an die Wand zurück, schaute über Stefan hinweg hinaus auf die Wiese, „Die Lisbeth wusste gar nicht, was sie da angerichtet hat. Die hat einfach durchgedreht, als ihr in der Nacht die Sache entglitt! Die hat den Verstand verloren! Die Lisbeth trifft die geringste Schuld.“
„Laut Anklageschrift hat sie immerhin ausgesagt, du sollst die Jungbäuerin, die Christine, und ihr ungeborenes Kind durch grausamen Hexenzauber ermordet haben.“ Franz sah sie bedeutungsvoll an, hob warnend den Zeigefinger, „Das ist ja schon was! Und das gilt auch heute noch!“
Therese legte den Kopf etwas schräg und in ihrem Blick lag etwas ungläubig Wartendes, „Und du glaubst das, was da in der Anklageschrift steht?“
Er ließ die Hand mit dem Stück Brot, das er schon zum Mund erhoben hatte, wieder sinken, blickte sie bestürzt an, „Wie kannst du mich so etwas fragen? Dieser ganze Hexenkram war und ist ein Wahnsinn, da gibt es für mich gar keinen Zweifel! Nein! Das Problem ist, dass niemand weiß, was wirklich damals auf dem Zagelhof passiert ist. Lisbeths Aussagen sind wirr und der Bauer sagt nichts. Ich habe schon mehrfach versucht, mit ihm darüber zu reden. Er muss es doch wissen, aber er sagt nichts. Und so kann sich bis heute niemand einen Reim machen. – Bis auf den Pocher natürlich!“
„Für das, was wirklich geschehen ist, hat sich damals niemand interessiert, Franz. Ich habe die Vorgänge jener Nacht genau geschildert, sie müssen im Protokoll stehen. Aber das war nicht die Wahrheit, für die sich das Gericht schon im Vorhinein entschieden hatte. Dabei war alles so einfach.“ Sie blickte hinaus auf die Wiese, die sie aber in der zunehmenden Dämmerung kaum noch erkennen konnte. „Ich hatte meinen Bruder in Buchenhüll besucht und bin auf dem Rückweg über den Zagelhof nach Hause gegangen. Als ich über den Hof gehe, kommt die Christine mit zwei schweren Milcheimern aus dem Stall, obwohl schon im neunten Monat. Natürlich habe ich ihr die Eimer abgenommen und hab noch mit ihr geschimpft, dass so etwas schlimme Folgen haben kann. In der Nacht dann hat der Josef bei uns an die Tür gehauen und mich geholt.“
Sie sah ihn noch, wie er im schwachen Licht der Öllaterne vor der Tür stand. Das runde Gesicht vor Angst verzerrt, schweißnass, die stoßweise hervor gepressten Worte: „Schnell, Therese! – Bitte! – Das Kind kommt nicht! – Bitte!“ Die kleinen, braunen Mausaugen, die sie sonst nur fröhlich lachend kannte, flehten hinter einem dicken Tränenvorhang.
Ich habe gar nicht weiter nachgedacht, es war alles ganz selbstverständlich: Hemd überwerfen, mein Bündel nehmen, und dann bin ich hinter ihm her, den Berg hoch. Oben auf dem Hof ist er dann stehen geblieben, hat mir zitternd die Laterne in die Hand gedrückt – ohne ein Wort, dann war er weg und ich stand da.“
„Was heißt weg?“ Pater Gregor runzelte die Stirn, schaute mit raschem Seitenblick Franz, dann wieder sie an.
„Weg heißt: Der hat sich einfach verdrückt und mich auf dem dunklen Hof stehen lassen – einfach so!“ Sie zuckte die Schultern.
„Das verstehe ich nicht!“ Der Pater blickte ratlos auf den Tisch, dann wieder zu ihr, „Aber ihr seid doch dann ins Haus gegangen, oder?“
„Natürlich bin ich ins Haus gegangen, musste ich doch! Was sollte ich sonst machen. Ich habe mich an die Eimer erinnert, die Milcheimer, und mir schwante schon nichts Gutes. Also musste ich auch ins Haus. Jedenfalls begann damit das ganze Elend! ...
Im Haus war es dunkel und sie weiß noch genau, dass sie die Treppe hinauf gelaufen und dort über irgendetwas – vermutlich ein Kleidungsstück – gestolpert ist. Oben auf dem Flur ein Lichtstreif. Die Tür zum Schlafzimmer stand etwas auf, es war gespenstisch still. Wenn sie sonst zu solchen Anlässen gerufen wurde, waren vor der Tür immer die gleichen und bekannten Geräusche zu hören: das Stöhnen, manchmal auch Jammern der Gebärenden, beruhigende Stimmen der Mütter. Hier jedenfalls war Totenstille. Besorgt ist sie ins Zimmer geeilt, in der einen Hand die Laterne, in der anderen ihr Bündel, und ist erschrocken wie angewurzelt stehen geblieben: Christine lag fast quer im Bett, der aufgewölbte Unterleib entblößt, die Beine gespreizt. Das Geschlecht war geschwollen, Blut sickerte heraus und hatte das Leinen in einem großen Flecken getränkt. Hinter dem Bett, dort, wo Christines Kopf matt und blass zur Seite gerollt war, stand mit angstvoll verzerrtem Gesicht, klein und hager, die alte Lisbeth und versuchte mit einem feuchten Tuch zu kühlen. Am ganzen Leibe zitternd brachte sie kein Wort heraus.
Therese sah das Blut und wusste gleich, dass es hier nichts mehr zu helfen gab. Dennoch ging sie zunächst vor, wie gewohnt: Temperatur – eher zu kalt. Das Tuch weg! Der Bauch war weich, zu weich! Sorgfältig fettete sie sich die rechte Hand ein und glitt dann behutsam in den Leib. – Das Kind konnte nicht kommen! Es würde nie mehr kommen! Therese schaute auf, blickte in die angstvoll geweiteten Augen der Alten, die an ihrem Gesicht klebten. Sie schüttelte den Kopf: >>Das Kind kann so nicht kommen!“
Und sie wusste auch: Christine war schon zu geschwächt, sie konnte das ebenfalls nicht überstehen. Vorsichtig zog sie ihre Hand zurück, wischte sich rasch das Blut ab. Lisbeth sah es, und in diesem Augenblick – Therese erinnert sich mit Grauen – bekam ihr Gesicht den irren Ausdruck: Die Augen schienen sich in die Höhlen zurückzuziehen, um von dort dunkel hervorzustechen. Der magere Unterkiefer verzog sich wie im Krampf etwas seitwärts, ließ eine hässliche, zahnlose Mundöffnung entstehen, aus der, so schien es, unaufhörlich ein stummer Schrei herausgepresst wurde.
Therese richtete sich auf, resigniert: Da war nichts mehr! Sie musste um das Bett herum, musste an das Kopfende, schob Lisbeth, die sie unverändert nur noch anstarrte, nicht mehr anwesend schien, vorsichtig zur Seite.
Christine reagiert längst nicht mehr auf das, was um sie herum und in ihr vorging. Der Kopf war kühl, die Augen halb geschlossen, ein Teil der Pupille zu sehen. Der Pulsschlag am Hals! Therese fühlte, tastete, suchte fast schon verzweifelt – nichts mehr! Tränen stiegen ihr in die Augen, sie schaute auf: Lisbeth hatte sich ganz an die Wand gedrückt, stand stocksteif zwischen Schrank und Fenster. Das blutbeschmierte Tuch, mit dem sie eben noch kühlen wollte, hatte sie etwa in Brusthöhe auseinandergezogen, spannte es in irrer Verzweiflung mit bebenden Armen und Händen, als wolle sie es unter Aufbietung aller Kräfte zerreißen.
Schlagartig erkannte Therese, während ihr Tränen über das Gesicht liefen, in welcher Gefahr sie sich befand. Sie wischte sich die Tränen ab, ließ Lisbeth nicht aus den Augen, während sie langsam um das Bett herumging und ihr Bündel zusammenrollte – so wie es war, ohne es zu reinigen. Lisbeth stand unverändert an der Wand, nur in ihren Augen schien es plötzlich zu brennen. Therese griff nach der Lampe – Lisbeth unentwegt im Blick – öffnete langsam, ganz langsam die Tür. Und genau in dem Moment, als sie durch den schmalen Spalt hinaus auf den dunklen Flur schlüpfte, kreischte Lisbeth mit sich überschlagender Stimme los: „Josef, Josef! Sie hat Christine umgebracht! Josef pass auf! – Josef sie kommt runter! Sie ist eine Hex, eine Hex! Josef pass auf, sie hat Christine und das Kind umgebracht! Josef!“
Sie stolperte vom Gekreische getrieben die Treppe hinunter, rutschte auf dem herumliegenden Kleidungsstück aus, fiel auf ihr Hinterteil, hielt krampfhaft die Lampe hoch. Weiter! Hinaus auf den Hof. Josef war nicht zu sehen. Sie rief nach ihm, zaghaft! – Oben kreischte Lisbeth! – Rief ihn laut, angstvoll, – nichts! Lisbeths Kreischen ging in ein hohes Klagen über, hing wie der Schrei eines verletzten Tieres in der Dunkelheit. Sie ließ die Laterne einfach stehen, kannte den Weg auch so und rannte los. Nahm die Abkürzung über die Wiese und den Abhang hinunter, an dem sonst die Kinder spielten. Sie keuchte, Zweige schlugen ihr ins Gesicht und hinter ihr überschlug sich in grausigen Tonhöhen immer noch Lisbeths Stimme.
Im Hause stand Lina auf der Diele.
Groß, hager, im langen weißen Nachthemd, die dunklen Haare wie immer zu einem dicken Zopf geflochten, stand sie mit der alten Öllampe mitten im fast dunklen Raum und wartete auf sie. Forschend, jede Kleinigkeit wahrnehmend, musterte sie Therese, während diese schweratmend mit dem Rücken an der geschlossenen Dielentüre lehnte; in ihren Augen spiegelte sich die Angst.
Lina erfasste die Situation, verstand ohne Worte, legt ihr beruhigend den sehnigen, von der täglichen Arbeit kräftigen Arm um die Schulter und führte sie von der Tür weg in den Raum – wortlos. Wie ein kleines Kind setzte sie die Weinende auf den Melkhocker, der zusammen mit den Milcheimern schon für den morgendlichen Einsatz an der Wand bereitstand. Sie holte Wasser vom Brunnen, half ihr beim Reinigen, redete ruhig und tröstend auf sie ein. Lina!
Seitdem ihr Sohn im Krieg war, führte Lina, gemeinsam mit Therese, sicher und unbeirrbar den Köblerhof. Sie verstanden und ergänzten sich gut. Die Alte mit ihrer Selbstsicherheit, Erfahrung und Abgeklärtheit, und die Junge mit ihrer Kraft und Lebensfreude. Dennoch: In Momenten wie diesem fehlte ihnen ihr Sohn Johannes. Er war kurz entschlossen, hatte ein zupackendes Naturell, hätte hier sicher eine typisch männliche Lösung gesucht. Lina kannte das Leben, spürte deutlich die Bedrohung, in der Therese schwebte und wusste, dass sie ihr hier nicht helfen konnte. Aber sie wusste auch, dass etwas geschehen musste.
Behutsam, ohne die Angst noch zu schüren, redete sie auf Therese ein, versuchte im Wechsel sie zu beruhigen, dann aber zur baldigen Flucht zu überreden. Zuerst nach Buchenhüll zum Bruder, mit seiner Hilfe dann weiter. Unmöglich! Die Kinder! Therese dachte an ihre Kinder: Flucht! Wie sollte das gehen, mit zwei kleinen Kindern? Und Wohin? – Sie wehrte ab, sah keinen Ausweg.
Zunächst noch grau und unauffällig drängte sich irgendwann der neue Tag durch die Fenster in die Stube. Die Gewissheit, dass mit dem neu beginnenden Tag die nächtliche Katastrophe zwangsläufig einer amtlichen Klärung zutreiben müsse, ließ Therese schließlich einlenken. Sie entschloss sich, Linas Rat zu folgen und zunächst – vorsorglich – für eine Woche nach Buchenhüll zum Bruder zu gehen. Die Kinder sollten solange bei Lina auf dem Hof bleiben, auch um den Eindruck einer Flucht zu vermeiden. Sollte sich dann in den nächsten Tagen eine Gefahr abzeichnen, wollte Lina mit den Kindern nach Buchenhüll folgen. Dort könne man dann sehen, wie es weitergehen sollte.