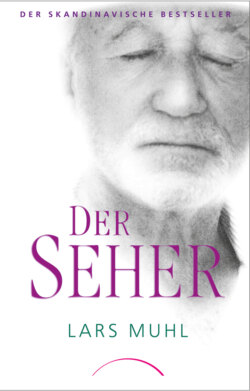Читать книгу Der Seher - Lars Muhl - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеIm Laufe eines halben Jahres zerfielen auch die letzten Reste meines Lebens. Der klaustrophobische Zustand, der ein fester Bestandteil der alten Welt gewesen war, wurde nun von der offenen und erhebenden Leichtigkeit abgelöst, die einen ergreift, wenn man am Rande eines Abgrundes steht und ins Universum schaut – man weiß genau, dass man im nächsten Augenblick einen Schritt vorwärts gehen und im Blau verschwinden wird. Dieses halbe Jahr fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Nie war ich so arm gewesen und hatte mich gleichzeitig so reich gefühlt. Ab und zu wurde ich von der Vergangenheit eingeholt und musste doch noch eine Runde auf der großen Achterbahn fahren. Ein Vertrag über ein Musical, das ich schreiben sollte, wurde ohne Vorwarnung gekündigt, und es schien mehr als nur ein Zufall zu sein, dass so die scheinbar letzte Tür, die mich mit der Welt der Musik verband, mit einem lauten Knall vor meiner Nase zuschlug. Zur gleichen Zeit erhielt ich einen Brief von der Zeitung, für die ich ab und zu Bücher besprach. Sie schrieben, dass es ihnen sehr leid tue, aber dass sie die Zusammenarbeit mit mir beenden müssten. Ich fühlte mich in jeder Hinsicht als Persona non grata. Während dieser Phasen war es immer noch schwer, einzusehen und zu akzeptieren, dass ich nicht länger Sänger war und es auch nie wieder sein würde, war doch meine Tätigkeit in der Musikbranche immer eine Illusion gewesen. Jetzt galt es zudem zu begreifen, dass ich mich nicht verleiten lassen durfte zu denken, ich sei Schriftsteller, nur weil ein paar meiner Manuskripte veröffentlicht worden waren. Und das war es, was immer noch so schrecklich schmerzhaft sein konnte: einzusehen, dass ich nichts war, und, noch schlimmer, zu akzeptieren, dass ich auch niemals etwas sein würde – sondern dass ich einfach nur sein würde.
Es wurde jedoch schnell klar, dass zu sein nichts war, was ich ohne Weiteres praktizieren konnte. Es war vielmehr etwas, das ich erst lernen musste. In meine neurotische Angst vor dem Abgrund mischte sich Faszination. Vorsichtig näherte ich mich seinem Rand. Langsam fing ich an zu begreifen. Alles, was ich vorher als eine Verschwörung gegen mich angesehen hatte, konnte ich jetzt als Fata Morgana meiner eigenen Projektionen erkennen. Weil ich sie ungehemmt hatte wachsen lassen, hatte ich ein ganzes Universum in Stücke geschlagen. Ich hatte alle meine Fehler auf andere übertragen und mich selbstgerecht geweigert, sie an mir selbst zu sehen. Jetzt musste ich lernen, in der dadurch entstandenen Leere zu existieren. Und in diesem Prozess erkannte ich, dass wir trotz all unserer Regeln und Systeme, trotz unserer Absichten von Frieden und Eintracht meistens nur in der Lage sind, Chaos, Lärm und Verschmutzung zu produzieren. Schreiend werden wir geboren, lärmend gehen wir durch die Welt, bloß um ein unüberschaubares Durcheinander zu hinterlassen, wenn wir wieder gehen.
Es war eine Kunst, loszulassen. Jeder Tag forderte neue, schwierige Entsagungen. Ein Schleier nach dem anderen wurde gelüftet, gleichzeitig lösten sich meine zähesten Vorurteile auf. Nach und nach ließ ich die Irrtümer hinter mir, die mich den größten Teil meines Lebens fest im Griff gehabt hatten. Selbst Wehmut und Scham musste ich loslassen. Als endlich der lang erwartete Tag anbrach – der Tag der verabredeten Konsultation beim Seher —, war nicht mehr viel übrig von dem, was ich einmal gewesen war.
Es nieselte, als ich die Store Kongensgade entlangging. Ich war wie betäubt. Trotzdem erinnere ich mich an alles: ein Pärchen mit den gleichen Segeltuchschuhen, das seine Fahrräder neben sich her schob. Eine Mutter mit einem roten Kinderwagen; ihre pergamentartige Durchsichtigkeit und das herzzerreißende Weinen des Kindes. Zwei Verkehrspolizisten, die die Fahrbahn überquerten; der eine sah aus, als ob er gerade geweint hätte. Ein alter Mann, der in einen Bus einsteigt, seine gekrümmte Hand voller Weisheit und Tod. Ein Mädchen auf einem grünen Fahrrad, das in die entgegengesetzte Richtung fährt, feurige schwarze Augen und ein hübsches Hinterteil in Jeans auf dem Sattel. Ein Fahrradbote. Ein Taxi, das hinten auf einen PKW aufgefahren ist, die Glasscherben eines zerbrochenen Schlusslichtes, zornige Stimmen und viel zu lange unterdrückte Hysterie. Das rätselhafte Lächeln und der lässige Gang einer Frau, vielleicht hatte sie gerade das Bett ihres Liebhabers verlassen. Die grüngestrichene Tür im Gebäude der Polizei gegenüber. Die Trockenheit in meinem Mund.
Ich öffnete die Tür und trat in ein Treppenhaus, das immer noch nach einer Vergangenheit als herrschaftlicher Wohnsitz einer reichen Familie duftete. Hoch über mir hörte ich schleppende Schritte, die sich langsam nach oben bewegten. Ich ging hinterher. Eine Tür wurde geöffnet und geschlossen und einen kurzen Augenblick lang hörte man Stimmen, die eine fremde Sprache sprachen. Meine eigenen Schritte hallten im Treppenhaus wider. Auf einem Treppenabsatz stand ein trotziger Kaktus in einem Topf mit vertrockneter Erde. Eine Etage höher schellte ich und schaute durch das dunkle Viereck in der Tür, auf dem früher ein Namensschild angebracht gewesen war. Ich hörte, wie irgendwo im Gebäude eine Toilette gespült wurde, undeutliche Stimmen verschwanden in einem Labyrinth gedämpfter Töne, die sich unten auf der Straße mit dem Lärm der Autos mischten. Ich drückte wieder auf die Klingel. Eine Glocke läutete in einem Zimmer irgendwo in der Wohnung. Keine Reaktion. Ich schaute noch einmal auf den Zettel: „2. Stock links“ stand da. Ich guckte auf meine Uhr. Zwei Minuten vor drei. Ich wartete etwas. Dann versuchte ich es noch einmal. Nichts. Fünf Minuten nach drei. Ein paar Etagen tiefer schlug die Haustür zu. Ich hörte leichte Schritte auf dem Weg nach oben. Sie kamen immer näher. Ich drehte mich um und sah direkt in ein Paar schwarzer Augen. Sie hielt mir einen Umschlag entgegen. Ich nahm ihn und wollte gerade etwas sagen, als ihre Schuhe bereits in Höchstgeschwindigkeit die Treppe hinunter Flamenco tanzten. Ich stand da und starrte auf den Umschlag. Mein Name stand drauf. Dann folgte ich der Flamencotänzerin. Draußen auf der Straße sah ich gerade noch, wie das Hinterteil in Jeans sich auf einen grünen Sattel schwang und im Verkehr verschwand. Hinter mir fiel die Haustür klickend ins Schloss. Ein kühler Wind fuhr um die Ecke und schob den schweren Geruch von Diesel vor sich her. Ich öffnete den Briefumschlag und zog ein Stück Papier hervor. „Buchhandlung ,Le Galois‘, Montségur-Village Nr. 19, 30. September, 7 Uhr“ stand da lakonisch. Darunter die Unterschrift: „Crede et Vicisti! – C de M.“
Es hatte aufgehört zu regnen. Über den Dächern der Stadt verschwand die Sonne hinter einer schwarzen Wolke. Ein bekannter Kritiker, mit dunklen Rändern unter den Augen, stand vor einer Bäckerei und aß ein Plunderstück. Auf der anderen Straßenseite schimpfte eine Mutter ihr Kind aus, das sorglos in einer Pfütze herumhüpfte. Vielleicht saß ein Dichter hinter den Fenstern einer der umliegenden Wohnungen und schrieb ein Gedicht über all das. Crede et vicisti! Glaube und siege! Ich ging in Richtung Kongens Nytorv.
Der Zug war voller Geschäftsleute in Hugo-Boss-Anzügen, die alle Laptops auf dem Schoß hatten und in ihre Handys sprachen. Sie ähnelten einem Bild von Magritte. Ich hatte einen Fensterplatz bekommen und sah auf eine trostlose Landschaft mit ebenso trostlosen Kleinstädten hinaus. Eine Reihe farbloser, unechter Perlen, die an einem Netz von Hochspannungsleitungen hingen, verbunden durch einen Wald von Elektrizitätsmasten, der immer chaotischer und undurchdringlicher wurde, je mehr wir uns Brüssel näherten. Mir drängte sich der Gedanke auf, dass alle diese Kabel auf irgendeine Weise die finanziellen und politischen Energien symbolisierten, die hier zusammenliefen und zu einem Fluss gescheiterter Erwartungen wurden, der in übertriebener Administration und Bürokratie versandete; genauso wie Brüssel selbst der Vorstadt einer Metropole glich, die gar nicht existierte. Ein Luftschloss? Ein Traum? Ein Alptraum?
Im Waggon herrschte eine nervöse, hektische Energie, in der die Handys in endloser Monotonie die gleichen digitalen Walzer und Märsche produzierten. Ein Teil der Magritte-Männer war ausgetauscht und durch andere Magritte-Männer ersetzt worden, die sich anstrengten, genauso bedeutungsvoll auszusehen wie ihre Vorgänger. In dieser Wirklichkeit war jedes Wanken, jedes Taumeln unerwünscht. So wie das europäische Gewissen voll von glitzernder Unterdrückung sein musste, schien auch der Hauptbahnhof von Brüssel gepflegt und von asozialem Gesindel gesäubert zu sein. Als der Zug durch den Wald von Elektrizitätsmasten in Richtung Paris rumpelte, war es wie eine Mahnung, dass die Vision ökonomischen Wachstums, mit der wir unablässig bombardiert werden, in Wirklichkeit eine Lüge ist, die nur Verlierer und kranke Menschen hervorbringt.
Als ich auf dem Kongens Nytorv stand und den Zettel des Sehers in der Hand hielt, entschloss ich mich, den endgültigen Schritt zum Abgrund zu wagen. Ja, ich bildete mir sogar ein, dass ich seine Stimme hören konnte, wie sie mich zum Rand hin rief. Und frei nach der Devise, dass derjenige, der nichts hat, auch nichts zu verlieren hat, verbrachte ich die folgenden Monate damit, mich auf meine Reise vorzubereiten.
Ich wusste bereits ein bisschen über Montségur. Ich wusste zum Beispiel, dass es sich um einen kleinen Ort und einen Berg mit einer Festung im französischen Teil der Pyrenäen handelte. Ich kannte die Geschichte von den südfranzösischen Ketzern, den Katharern, den bons hommes, und ihrem unglückseligen Ende auf dem Scheiterhaufen der Inquisition am Fuße des Montségur, dem Höhepunkt des Kreuzzuges gegen die Albigenser im Jahr 1244.
Die Katharer betrachteten sich selbst als die wahren Christen. Ein Teil ihrer Lehre basierte auf urchristlichen, gnostischen, jüdischen und islamischen Ideen, die sich in allen entscheidenden Punkten von der Römischen Kirche unterschieden. Das tägliche Brot war für die Katharer das geistige Brot, und in ihren Gemeinden konnten sowohl Männer als auch Frauen Priester werden, die sogenannten Perfecti. Die Bewegung der Katharer genoss große Unterstützung bei der Bevölkerung im Languedoc, und als es so aussah, als ob diese Unterstützung sich ins übrige Frankreich ausbreiten würde, schickte Papst Innocens III Bernhard von Clairvaux, einen berühmten Mönch, um gegen die Ketzer zu predigen. Der stellte jedoch fest, dass ihr Gottesdienst und ihre Moral viel christlicher waren als die seiner eigenen korrupten Kirche und gab zu, dass er an den Parfaits der Katharer keinen Fehler finden konnte. Sie praktizierten nur das, was sie selbst predigten. Das passte dem Papst nicht, woraufhin er den Albigenserkreuzzug ins Werk setzte, der im Massaker am Montségur endete.
Die Legende berichtet, dass der heilige Gral im Besitz der Katharer gewesen und dass es ihnen möglicherweise gelungen sein soll, ihn in Sicherheit zu bringen, ehe sie sich in die Hände der Henker der Inquisition begaben. Aber die Legende sagt nichts darüber, was der Gral eigentlich ist. Der herrschenden Auffassung nach ist der Gral der Becher, den Yeshua während des letzten Abendmahls benutzt hatte und in dem Josef von Arimathäa später angeblich Yeshuas Blut auffing, als dieser am Kreuz hing. Die Legende berichtet weiter, dass der Gral sich zu einer bestimmten Zeit in Spanien befand, wo ein Maure und Sufimeister, Kyot von Toledo, über ihn geschrieben hat. Die erste eigentliche Gralsgeschichte wurde von Chrétien de Troyes im 12. Jahrhundert verfasst, doch die bekannteste schrieb Wolfram von Eschenbach im Epos Parzival, in dem auch die Legende von König Artus und den Rittern der Tafelrunde erwähnt wird.
Eine volkstümliche Legende, die über Generationen unter den Nachfolgern der Katharer überliefert wurde, wurde zuletzt 1929 von einem Schafshirten aus Montségur erzählt: „Damals, als Montségurs Mauern noch intakt waren, bewachten die Katharer, die Reinen, dort den heiligen Gral. Montségur war in Gefahr. Die Heerscharen Luzifers lagen in einem Ring rund um die Mauern. Sie wollten sich den Gral holen, damit sie ihn wieder in das Diadem ihres Fürsten einsetzen konnten, aus dem er heraus und zur Erde gefallen war, damals, als die Engel aus dem Himmel vertrieben wurden. Als die Not am größten war, kam eine weiße Taube vom Himmel und spaltete den Berg mit ihrem Schnabel in zwei Teile. Esclarmonde, die Wächterin des Grals, warf das kostbare Kleinod in den Berg. Daraufhin verschloss er sich wieder. So wurde der Gral gerettet. Als die Teufel in die Burg eindrangen, kamen sie zu spät. Voller Wut verbrannten sie alle Reinen auf dem Scheiterhaufen am Fuße des Berges unterhalb der Burg, auf dem „camp des crémats.“
205 Katharer, Männer, Frauen und Kinder, gingen freiwillig ins Feuer. Einer mündlichen Tradition zufolge hatten sie gelobt, nach 700 Jahren wiederzukehren.
Früh morgens, am 29. September, nahm ich in Århus den Zug nach Südfrankreich. Am nächsten Morgen um halb fünf stieg ich auf dem kleinen Bahnhof von Foix aus. In demselben Augenblick, als ich aus dem Zug ausstieg und in den dichten Nebel hineintrat, wusste ich, dass meine Wirklichkeit sich für immer verändern würde. Ich blieb stehen, um mich in der Stille zu orientieren. Ich glaubte, eine Gestalt zu sehen, die sich am Rande des kalten, unwirklichen Lichts einer einsamen Lampe bewegte und dann im Schatten am Ende des Bahnsteigs verschwand. Aber ich war nicht sicher. Im Grunde genommen war für mich nichts mehr sicher. Der Wartesaal war leer und nirgendwo war ein Mensch zu sehen, als ich in die schlafende Stadt hinaustrat. Das weiße Gespenst des Nebels schien das einzig Lebendige zu sein. In einem Loch darin konnte ich so etwas wie eine Brücke erkennen. Ich ging in diese Richtung, denn ich dachte, dass sie vielleicht zum Zentrum führe. Das Geräusch brausenden Wassers überzeugte mich davon, dass ich auf dem richtigen Weg war. Aber ich war noch nicht weit gekommen, als mich ein weißes Licht blendete, das irgendwo vor mir angeschaltet wurde. Dann hörte ich, wie sich eine Autotür öffnete. Ich trat aus dem Lichtkegel hinaus und erkannte den Umriss einer Gestalt hinter dem Steuer. Sie gab mir ein Zeichen, dass ich nähertreten solle.
„Soll ich Sie mitnehmen?“, fragte eine Stimme in wunderschönem Englisch aus dem Inneren des Wagens. Es war eine Frau. Ich beugte mich vor und stotterte ein „Ja, danke.“
„Um diese Zeit geht kein Bus“, sagte sie. Zögernd stieg ich ein, nahm meinen Koffer auf den Schoß und machte die Tür zu. Im schwachen Licht des Armaturenbretts bemerkte ich so etwas wie ein Lächeln. Dann legte sie einen Gang ein und fuhr in die Dunkelheit hinein. Das Licht der Scheinwerfer tanzte im Nebel, es war, als seien wir in einem Raumschiff auf dem Weg in ein unbekanntes Universum. Mehr redeten wir nicht miteinander, und ich konnte spüren, dass es auch keinen Grund gab zu reden. Es wurde nicht erwartet. Und zum ersten Mal seit langer Zeit fühlte ich mich völlig entspannt und sonderbar frei. Ich weiß nicht, wie lange wir fuhren. Ich hätte ewig so weiterfahren können. Es war, als ob die Zeit verschwand und sich im Nebel auflöste. Ich merkte jedoch, dass der Weg anstieg und wir durch eine Serpentine nach der anderen fuhren. Als ob das Auto von selbst den Weg fand. Und plötzlich wurde der Schleier gelüftet. Es war ein überwältigender Anblick, als wir aus dem Nebel herauskamen. Jetzt konnte ich im Licht des Vollmondes sehen, wie hoch oben wir waren. Unter uns ragten die Berggipfel aus den Wolken hervor und vor uns erhob sich der Schatten eines imponierenden Berges wie ein riesiger Runenstein.
„Montségur!“, sagte sie.
Ich konnte den Stolz in ihrer Stimme hören.
„Hier müssen Sie aussteigen.“
Sie deutete auf eine Seitenstraße, die sich durch den Felsen schlängelte.
„Folgen Sie einfach dem Weg!“
Ich war etwas benommen und schaffte es gerade noch, „Danke“ und „Auf Wiedersehen“ zu sagen, ehe das Auto losfuhr. Erst als ich in der geisterhaften Mondlandschaft stand und den Wagen weiter vorne um eine Ecke verschwinden sah, wurde mir klar, dass sie überhaupt nicht gefragt hatte, wohin ich wollte. Woher wusste sie, dass es Montségur war?
Und was machte ich eigentlich hier? Wo ich genauso gut zu Hause auf meiner Insel in einem warmen Bett liegen konnte? Würde nicht jeder normale Mensch mein Vorhaben als verrückt ansehen?
Die Luft war genauso kalt und klar wie das Licht des Mondes. Ich schauderte etwas und ging los. Normal oder verrückt – was machte das für einen Unterschied? Der Weg schlängelte sich durch Felsvorsprünge hindurch. Immer weiter hoch. Ein paar Mal ging ich buchstäblich am Rande des Abgrundes entlang. Tief unten lag ein milchweißer Teppich über dem Tal. Vor mir lag Montségur. Ab und zu tauchte die Burg oben auf dem Gipfel des Berges im Mondlicht auf. Es sah aus, als ob der Weg auf einem Bergkamm lag und um den Berg herumführte. Es raschelte im Gebüsch. Das Geräusch von Tieren, die sich von meinen Schritten gestört fühlten, die durch die eisige Luft hallten. Ich musste mindestens eine Stunde gegangen sein, als der Weg sich nach einer Biegung gerade ausrichtete und von den Felsen am Fuße des Berges wegführte. Unter mir lag der Ort Montségur, eingetaucht in ein surrealistisches Licht, wie die Kulisse eines Abenteuerfilms. Von hier aus sah es aus, als ob es nur diesen einen Weg gab, der in das Dorf hinein- und auch wieder hinausführte. Es war offensichtlich kein Ort, durch den man hindurchreiste. Entweder hatte man dort etwas zu tun oder man machte sich gar nicht erst auf den Weg um den ganzen Berg herum. Ich begann den Abstieg. Der Weg führte in dichten Serpentinen abwärts. Nach einer dreiviertel Stunde lag der Berg schließlich hinter mir und ich konnte das letzte Stück auf ebener Strecke geradeaus gehen.
Das Haus lag an einer Ecke am Ortseingang und fiel wegen des Schildes sofort auf: „Librairie Le Gaulois“ stand dort. Von der Straße her schien es nur ein Stockwerk zu haben. Es wirkte völlig verschlossen. Weiter abwärts führte ein Weg aus dem Dorf hinaus, am Berg und an einer Reihe von Häusern entlang, die sich dicht aneinander schmiegten. Ein anderer Weg führte einen anderen Berg hinunter mit genauso dicht aneinander gebauten Häusern, die auf abfallenden Plateaus lagen. Ich ging um die Ecke und sah, dass das Haus zweieinhalb Stockwerke hatte. Einige Schritte weiter unten stand eine Pforte halb offen. Eine schiefe Eins, gefolgt von einer Neun in rissiger Emaille waren an der Mauer unter einer Lampe ohne Licht befestigt. Die Pforte führte in den Garten hinter dem Haus. Ich folgte den Stufen. Von hinten sah das Haus einladender aus. Ich blickte auf ein Fenster, dessen Läden offen standen, und eine doppelte, verglaste Verandatür. Sie war jedoch verschlossen. Dann entdeckte ich noch eine Tür, rechts von der Verandatür. Ich klopfte an und ergriff die Klinke.
Die Tür gab mit einem anhaltenden Knirschen nach. Drinnen blieb ich stehen, um meine Augen ans Dunkel zu gewöhnen. Es duftete schwach nach Eukalyptus und Rosen. An einem Garderobenhaken hing Regenkleidung. In einer Ecke standen ein Stock und Wanderstiefel. Am Ende des Flurs führte eine Treppe nach oben. Über ihr hing eine Uhr; ich konnte sehen, dass es kurz nach sieben war. Ich räusperte mich. Dann versuchte ich es mit einem etwas lauteren „Hallo“, blieb im Dunkeln stehen und wartete. Durch eine geöffnete Tür konnte ich sehen, wie ein Mondstrahl durch das Fenster im Zimmer nebenan fiel. Der einzige Laut war das elektrische Summen eines Kühlschranks. Am Türrahmen fand ich einen Schalter. Es war eine echt französische Landküche mit einem großen Tisch in der Mitte des Raumes. Neben der Spüle standen ein Teller, ein Glas und Besteck in einem Abtropfgestell. Ansonsten gab es kein Zeichen von Leben. Ich ging in den Flur zurück und fand noch eine Tür. Sie führte zu einem Raum, der einem kleinen Rittersaal ähnelte. Durch die Scheiben der Doppeltür fiel Licht von draußen herein. Ein riesiger Kamin bildete das natürliche Zentrum. Zwei Schwerter hingen über Kreuz an der Wand. Mitten im Raum stand ein Langtisch mit einer Bank an beiden Seiten. Über der Tür hing ein Katharerkreuz mit einer weißen Taube. Ich ging in den Flur zurück und langsam die Treppe hinauf. Oben auf dem Treppenabsatz konnte ich sehen, dass Licht unter einer von vier Türen, je zwei auf den beiden Seiten eines langen Ganges, hervorschien. Ich klopfte an. Wartete. Keine Reaktion. Ich öffnete die Tür. Das Fenster stand einen Spalt breit offen und auch hier war es der Mond, der seine bleichen Arme hereinstreckte und das Zimmer erleuchtete. Abgesehen von einer Matratze auf dem Boden war es völlig leer. Auf dem Deckbett lag ein Zettel: „Prat dels crémats, 12 Uhr mittags“. Ich war so müde, dass ich mich in ein Dornengebüsch hätte legen können, und meine Überlegungen, ob ich mich ausziehen solle oder nicht, bevor ich ins Bett ging, hatten sich schnell erledigt. Das Letzte, woran ich mich erinnere, war, dass ich vornüber auf die Matratze fiel. Dann wurde alles schwarz.
Es war eine große Erleichterung, als der Zug im Gare du Nord einfuhr. Ich hatte genug von Magritte-Männern und Telefonwalzern. Mir blieben fast acht Stunden, um den Gare du Austerlitz zu finden, von wo aus ich mit dem Nachtzug nach Madrid weiterfahren sollte. Obwohl die Luft kühl war, konnte man den ersten Hauch des Pariser Frühlings spüren. Draußen vor dem Gare du Nord hing die Sonne bleich und tief über dem Boulevard de Denain, wo ich für gewöhnlich die Brasserie „La Consigne“ besuchte. Wenn man nur wenige Stunden in Paris verbringen kann, ist „La Consigne“ genau der richtige Ort dafür. Es ist, als würden sich hier alle Arten von Parisern treffen, vom pensionierten Zuhälter mit Boxernase und der gebleichten Blondine an einem Tisch ganz hinten im Lokal, über zwei große Pernods gebeugt und ins Gespräch vertieft, bis zu den jungen Mädchen mit zu viel Lidschatten, Pferdeschwanz, nacktem Bauch, Kaffee, Zigaretten, Schmollmund und vielsagenden Blicken in der Glasveranda zum Boulevard hin. Und mitten im Lokal findet der Mittagsbetrieb statt, mit Büroangestellten, Händlern und einem vereinzelten Touristen, die hastig zu Mittag essen, Muscheln oder Fischsuppe, Schokoladenkuchen oder hausgemachte Crème de fromage, ehe die nächste Gruppe ankommt.
Ich fand einen kleinen Tisch mitten im Treiben und bestellte Sardinen mit Ingwer und einen Pastis. Im Hintergrund sang Jacques Brel: „Je ne sais pas pourquoi la pluie, quitte là-haut ses oripeaux …“ – „Ich weiß nicht, warum der Regen seine lumpigen Kleider verlässt, die schweren, grauen Wolken dort oben am Himmel, um in unseren Weinbergen zur Ruhe zu gehen. Ich weiß nicht, warum der Wind säuselt, um das Lachen der Kinder zu zerstreuen – des Winters zartes Glockenspiel – im klaren Morgen. Ich weiß nichts von alledem, doch ich weiß, dass ich dich immer noch liebe …“
Und meine Gedanken tanzten zwischen Brels Zeilen hin und her. Wie eine uralte Erinnerung, die erst jetzt befreit werden konnte. Denn ich kannte den Regen mit seinen lumpigen Kleidern und die schweren Wolken am Himmel, weil es diesen Himmel auch in mir gab. „Je ne sais pas pourquoi la route, qui me pousse vers la cité …“ – „Ich weiß nicht, warum dieser Weg, der mich zur Stadt drängt, von der einen Pappel zur nächsten, den ekligen Geruch der Verwahrlosten hat oder warum die eiskalten Nebelschleier, die mir folgen, mich an die Kathedralen denken lassen, in denen man für tote Lieben betet. Ich weiß nichts von alledem, doch ich weiß, dass ich dich immer noch liebe…“ Weil ich wusste, dass ich schon so oft in der Brasserie gesessen und diese Gesichter betrachtet hatte. Wenn nicht gerade dort, dann an einem ähnlichen Ort. Ich wusste, dass ich da gesessen und so oft gehört hatte, wie sie von Niederlage und Lügen, schnellen Nummern, Untreue und Eifersucht erzählten, dass mein eigenes Herz vielleicht abweisend und hart geworden war. Und ich hatte gedacht, dass ich all das hinter mir gelassen hatte. Vielleicht stand ich endlich einer anderen Zukunft gegenüber, einer, die neu und unbenutzt war. Und dann geschah es. „Je ne sais pas pourquoi la ville …“ – „Ich weiß nicht, warum die Stadt ihre Vorstadtwälle öffnet, um mich ganz still inmitten ihrer Liebenden in den Regen gleiten zu lassen – in all meiner Zerbrechlichkeit. Ich weiß nicht, warum alle diese Menschen ihre Nasen an die Scheibe drücken, um meine Niederlage besser feiern – um meinem Leichenzug besser folgen zu können. Ich weiß nichts von alledem, doch ich weiß, dass ich dich immer noch liebe …“
Vielleicht verstand ich jetzt, dass all diese Schicksale nicht nur Geschichten waren, die sich außerhalb von mir in einer fiktiven Welt abspielten. Sie waren ich. Die Masken und Personen. Die Straßen und Städte. Die Bettler und Bahnhöfe. Die Lieder und der Wind. Die Sehnsucht. „Je ne sais pas pourquoi ces rues …“ – „Ich weiß nicht, warum diese Straßen sich mir öffnen, eine nach der anderen, jungfräulich und kalt, kalt und nackt. Da sind nur meine Schritte und kein Mond. Ich weiß nicht, warum die Nacht auf mir spielte wie auf einer Guitarre und mich hierherbrachte, vor diesen Bahnhof, um hier zu weinen. Ich weiß nichts von alledem, doch ich weiß, dass ich dich immer noch liebe …“
Dies war all das, was ich glaubte, vergessen zu haben – die Erinnerung an die Sehnsucht —, die mich nun doch eingeholt hatte. Und draußen, am Ende von Jacques Brels rauher und harter Stimme, ganz draußen am Rande des Jahrmarkts dieser Welt, an der Endstation aller Dinge, ließ ich all den künstlichen Glanz fahren, weil ich nur auf der Durchreise war und mich vielleicht auch an nichts mehr zu erinnern brauchte. „Je ne sais rien de tout cela, mais je sais, que je t’aime encore.“ – „Ich weiß nichts von alledem, doch ich weiß, dass ich dich immer noch liebe.“
Das Haus