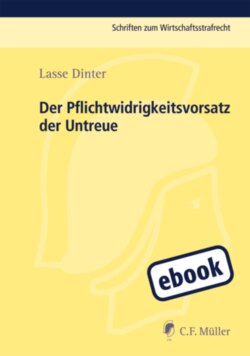Читать книгу Der Pflichtwidrigkeitsvorsatz der Untreue - Lasse Dinter - Страница 18
Anmerkungen
ОглавлениеBinding GS 81 (1913), 19, 21.
Maurach/Zipf AT I, § 37 Rn. 48 („derzeit am wenigsten gelösten Problem der gesamten Irrtumslehre“); Jakobs AT 8. Absch. Rn. 52 („Konfuse Lage“); Schünemann in: LK-StGB, § 292 Rn. 65 („dogmatisches Labyrinth“); Kindhäuser GA 1990, 406, 420 („dogmatische Konfusion“).
Vgl. die Besprechung der Literatur bei Tiedemann ZStW 107 (1995), 639 ff.
Schünemann in: LK-StGB, § 266 Rn. 153.
Schünemann in: LK-StGB, § 266 Rn. 153.
BGHSt 50, 331 ff.
LG Düsseldorf NJW 2004, 3275 ff.
LG Düsseldorf NJW 2004, 3275, 3285.
BGHSt 50, 331 ff.
BGH 3 StR 470/04, Rn. 83 (insoweit nicht in BGHSt 51, 331 ff. abgedruckt); zustimmend Vogel in: LK-StGB, § 16 Rn. 32.
EuGH NJW 2003, 3331 ff.
EuGH NJW 1999, 2027 ff.
EuGH NJW 2002, 3614 ff.
Dazu etwa Rönnau ZGR 2005, 832 ff.; Schlösser wistra 2006, 81 ff.; BGH 5 StR 428/09 Rn. 21 f.
Exemplarisch ist die Kommentierung Fischers § 266 Rn. 8, die erst seit der 55. Auflage Ausführungen zur Rechtsnatur des § 266 enthält.
Arzt/Weber § 22 Rn. 69; Baumann in: FS Welzel, S. 533, 542; Tiedemann Wirtschaftsstrafrecht AT, Rn. 227; Jakobs NStZ 2005, 276, 277; ders. in: FS Dahs, 49, 62; Kubiciel NStZ 2005, 353, 357; Dittrich S. 239; Schmitz Europäisierung des Strafrechts, 199, 208: „[Ein] normatives Tatbestandsmerkmal, das freilich in die Nähe eines Blanketts rückt, da die Pflichtwidrigkeit gerade auch im Zusammenhang mit den gesellschaftsrechtlichen Normen interpretiert wird“; Gross/Schork NZI 2006, 10, 15; Vogel/Hocke JZ 2006, 568, 571; Lüderssen in: FS Schroeder, S. 569, 571; ders. in: FS Richter II, S. 373, 377; Werle/Jeßberger in: LK-StGB, Vor § 3 Rn. 335; Hellmann ZIS 2007, 433, 443; Hellmann/Beckemper S. 128; Beckemper ZJS 2010, 554, 557; Ransiek/Hüls ZGR 2009, 157, 177; Schreiber/Beulke JuS 1977, 656, 660; Laskos S. 135; Burger S. 258; Dannecker in: LK-StGB, § 1 Rn. 258; nunmehr auch Rönnau ZStW 119 (2007), 887, 905.
Fischer § 266 Rn. 5; Sax JZ 1977, 663, 664; Deiters ZIS 2006, 152, 159; Dierlamm in: MK-StGB, § 266 Rn. 229; ders. StraFo 2005, 397, 401 („blankettartig“); Mosiek StV 2008, 94, 95; Nelles S. 505 („blankettartig“); Worm S. 112; Hantschel S. 86; Seier Symposion Geilen, S. 145, 150, der die Blanketteigenschaft auf die Treubruchvariante beschränkt. Unklar Schlösser wistra 2006, 81, 86, der § 266 StGB als eine „Sanktionshülle“ versteht, dessen Inhalt durch (mitgliedstaatliches) Gesellschaftsrecht auszufüllen sei. Früher Rönnau/Hohn NStZ 2004, 113 („Blankett“); Rönnau ZGR 2005, 832, 854 („blankettartig“).
Schünemann in: LK-StGB, § 266 Rn. 153; Puppe GA 1990, 145, 170 f.
Offen gelassen Radtke GmbHR 2008, 729, 735; Walter Der Kern des Strafrechts, S. 261; Mankowski/Bock ZStW 120 (2008), 704, 705, 756 f.
OLG Stuttgart wistra 2010, 34 ff.
BGH 5 StR 428/09 Rn. 21 f.
BVerfG 2 BvR 2559/08, Rn. 97; zustimmend BGH 1 StR 220/09 (BGH NJW 2011, 88, 91).
Weitere Sachfragen im Zusammenhang mit der Rechtsnatur eines Tatbestandsmerkmals als normatives Tatbestandsmerkmal bzw. Blankettmerkmal (dazu etwa Walter in: FS Tiedemann, S. 969 ff.) bleiben im Folgenden ausgeblendet.
Roxin Strafrecht AT, Bd. I, § 10 Rn. 3; Tiedemann Tatbestandsfunktionen, S. 3 u. 282; ders. ZStW 107 (1995), 643; zu den weiteren Funktionen des Tatbestands siehe nur Roxin Strafrecht AT, Bd. I, § 10 Rn. 3 ff.
Roxin Strafrecht AT, Bd. I, § 12 Rn. 100; Frister AT, 11. Kapitel Rn. 33; Wessels/Beulke § 7 Rn. 243.
Grundlegend Welzel MDR 1952, 584, 586; Warda Abgrenzung, S. 36.
Frister 11. Kapitel Rn. 42. Beachte aber Lüderssen in: FS Richter II, S. 373, 377: Er verlangt für den Vorsatz bzgl. (gesamt-)tatbewertender Merkmale Rechtskenntnis; vgl. auch Kunert S. 102; Schroth S. 24.
Z. B. BGHSt 34, 379, 390; BGH wistra 1986, 25; BGH StV 2000, 490; BGH wistra 2003, 464; BGH NJW 1991, 990, 991.
Z. B. LG Düsseldorf NJW 2004, 3275, 3285.
BGH 3 StR 470/04, Rn. 81.
BGH 3 StR 470/04, Rn. 81.
BGH 3 StR 470/04, Rn. 83.
Ransiek NJW 2006, 814, 816; Lackner/Kühl § 266 Rn. 19.
BGH 3 StR 470/04, Rn. 83.
Hohn wistra 2006, 161, 164.
Die Feststellung des Sachverhalts wäre dem neuen Tatrichter vorbehalten gewesen, die aufgrund der vorläufigen Verfahrenseinstellung gem. § 153a Abs. 2 StPO vom 29. November 2006 unterblieb, vgl. http://www.lg-duesseldorf.nrw.de/presse/pressearchiv/06-09.pdf.
BGH 3 StR 470/04, Rn. 83.
BGH 3 StR 470/04, Rn. 85.
Näher dazu siehe Rn. 23.
BGH StV 2007, 468.
BGHSt 9, 358, 360; BGH wistra 1989, 263, 264; zu dieser Widersprüchlichkeit siehe Walter in: FS Tiedemann, S. 969, 972, 977; Weidemann wistra 2006, 132 f.
Siehe nur Roxin Strafrecht AT, Bd. I, § 10 Rn. 2; ausführlich dazu Rn. 59 ff.
Dannecker in: LK-StGB, § 1 Rn. 149.
Dannecker in: LK-StGB, § 1 Rn. 149.
Dannecker in: LK-StGB, § 1 Rn. 151.
Dannecker in: LK-StGB, § 1 Rn. 206; vgl. auch BGHSt 4, 24, 32: „Als Verstoß gegen die guten Sitten kann deshalb in diesem strafrechtlichen Sinne nur angesehen werden, was nach dem Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden zweifelslos kriminell strafwürdiges Unrecht ist“.
So aber noch Bockelmann BT/1, S. 141.; wohl auch Schröder in: Schönke/Schröder, StGB-Kommentar, 18. Auflage, § 266 Rn. 4a. Nach Heimann-Trosien JZ 1976, 549, 550, sei es sogar „ganz unwahrscheinlich“, dass sich die Wendung „dem, dessen Vermögen er zu betreuen hat“ gem. § 266 Abs. 1 nach dem Wortsinn auf die Missbrauchsvariante beziehe. Dem dritten Satzteil komme nur die formale Bedeutung zu, auch für den Missbrauchstatbestand einen (Vermögens-) Nachteil vorzuschreiben. Kritisch siehe nur Kargl ZStW 113 (2001), 565, 569 (die grammatikalische Auslegung stehe „auf schwachen Füßen“).
Nach 1933 wurde der § 266 nur geringfügig geändert (z. B. Streichung die Regelbeispiele in Abs 2. S. 2). Näheres zur Gesetzgebungsgeschichte siehe Nelles S. 627 ff.; Dierlamm in: MK-StGB, § 266 Rn. 7 ff.; Schünemann in: LK-StGB, § 266 am Anfang.
Maurach/Schroeder/Maiwald § 45 II Rn. 8.
Binding Normen I, S. 20 ff.
RGSt 1, 172, 174; 3, 283, 285; 14, 184, 186; 20, 262, 264; 41, 265, 266; 45, 434, 435; 61, 228, 230 f.; 62, 15, 20; 68, 70, 74. Im Überblick Hübner in: LK-StGB, 10. Auflage, § 266 Rn. 2.
RGBl. I 295.
Schünemann in: LK-StGB, § 266 Rn. 7; Labsch Jura 1987, 343, 344.
Bezeichnung von Schünemann in: LK-StGB, § 266 Rn. 7.
BGHSt 24, 386; siehe auch BGHSt 33, 244 (Kreditkartenentscheidung).
Hübner in: LK-StGB, 10. Auflage, § 266 Rn. 5.
Anstatt vieler Dierlamm in: MK-StGB, § 266 Rn. 13 ff.; Wittig in: Beck’scher Online-Kommentar zum StGB, § 266 Rn. 12.
Labsch NJW 1986, 104, 106; ders. Jura 1987, 344, 345; Otto JZ 1985, 29, 30; ders. Grundkurs BT, § 54/8 ff.; Ranft JuS 1988, 673.
Schlüchter JuS 1984, 675, 676; Steinhilper Jura 1983, 401, 408; Wegenast S. 137; Perron in: Schönke/Schröder, StGB-Kommentar, § 266 Rn. 2; ähnlich Bringewat JA 1984, 347, 353.
Schünemann in: LK-StGB, § 266 Rn. 17 ff.; Puppe Kleine Schule, S. 38 f.
Schünemann in: LK-StGB, § 266 Rn. 20.
Schünemann in: LK-StGB, § 266 Rn. 20.
Schünemann in: LK-StGB, § 266 Rn. 25.
Ausführlich dazu Rn. 96 ff.
Siehe umfassend dazu anstatt vieler Wegenast S. 9 ff.
Kritisch Martin S. 153 f.; siehe auch Hantschel S. 74 f.
Es ist freilich umstritten, ob sich in der Missbrauchsvariante die Pflicht des der Befugnis zugrunde liegenden Grundverhältnisses, die die Vertreter der dualistischen Theorien mit der Vermögensbetreuungspflicht gleichsetzen, aus einem Treueverhältnis ergeben kann; vgl. dazu Nelles S. 516 ff.; Samson/Günther in: SK-StGB, § 266 Rn. 19. Unterschiede bestehen aber allenfalls in dem Umfang der Verweisungsobjekte, nicht aber wie § 266 auf die Verweisungsobjekte dogmatisch Zugriff nimmt.
Zur Geschichte der Irrtumsdogmatik siehe etwa Schroth S. 15 ff.
Der Begriff des „deskriptiven“ Tatbestandsmerkmals ist ungenau, da es rein beschreibende Begriffe ohne normativen Einschlag nicht geben kann, vgl. anstatt vieler Hassemer/Kargl in: NK-StGB, § 1 Rn. 33.
BGH 3 StR 470/04, Rn. 81 („stark normativ geprägte objektive Tatbestandsmerkmal“).
Binding Normen I, S. 162.
RGSt 7, 206; 46, 393, 395; 76, 37, 41.
BGHSt 6, 30, 41.
Neumann S. 13; andere Bezeichnungen wie „absolut unvollständiges Gesetz“ (Neumann, S. 6), „Rahmenstrafgesetz“ (BayObLGSt 4/191), „blinde Strafgesetze“ (RGSt 7, 206) haben sich nicht durchsetzen können. Nachweis über die verschiedenen Bezeichnungen bei Neumann S. 11 f. und Lohberger S. 12.
BGHSt 6, 30, 40, „echtes Blankettgesetz“. Synonyme: „Blankett im eigentlichen bzw. weiteren Sinne“ (z. B. Tiedemann Wirtschaftsstrafrecht AT, S. 62) und „Außen- bzw. Binnenverweisung“ (z. B. Dannecker in: LK-StGB, § 1 Rn. 148; Vogel in: LK-StGB, § 16 Rn. 36; BVerfGE 14, 245, 252; BVerfG NStZ-RR 2004, 275, 278); Otto Jura 2005, 538 f.
Baumann/Weber/Mitsch § 8 Rn. 102; Gribbohm in: LK-StGB, § 1 Rn. 34; Tiedemann Wirtschaftsstrafrecht AT, S. 62.
Mayer, S. 184 f.
Zur Entwicklungsgeschichte des Begriffs, siehe Schlüchter Irrtum über normative Tatbestandsmerkmale, S. 7 ff.; Engisch in: FS Mezger, S. 147 ff.
Jescheck/Weigend S. 270; Otto Grundkurs AT, § 7 Rn. 12; Kühl § 5 Rn. 92; Fischer § 16 Rn. 4; Frister 11. Kapitel Rn. 33 ff.; Jakobs AT, 8. Abschn. Rn. 48.
Engisch in: FS Metzger, S. 147; siehe ferner Roxin Strafrecht AT, Bd. I, § 12 Rn. 100; Rudolphi in: SK-StGB § 16 Rn. 21.
Schlüchter Irrtum über normative Tatbestandsmerkmale, S. 23.
Puppe GA 1990, 145, 171; Frister 11. Kapitel, Rn. 40.
Herdegen in: FS BGH 25 Jahre, S. 195, 201; kritisch Roxin Strafrecht AT, Bd. I, § 10 Rn. 51; Walter in: LK-StGB, Vor § 13 Rn. 56.
Roxin Strafrecht AT, Bd. I, § 10 Rn. 45; ders. Offene Tatbestände, S. 135 ff.
Vgl. Roxin Strafrecht AT, Bd. I, § 10 Rn. 45.
Walter in: LK-StGB, Vor § 13 Rn. 55; Sternberg-Lieben in: Schönke/Schröder, StGB-Kommentar, § 15 Rn. 22.
Puppe GA 1990, 145, 178; Walter in: LK-StGB, Vor § 13 Rn. 56; ders. Kern des Strafrechts, S. 106.
Kritisch daher Walter in: LK-StGB, Vor § 13 Rn. 57; ders. Kern des Strafrechts, S. 107, der die Begriffskategorie der gesamttatbewertenden Merkmale insgesamt für überflüssig erachtet.
Vgl. Frister 11. Kapitel Rn. 41.
Frister 11. Kapitel Rn. 40.
Vgl. Frister 11. Kapitel Rn. 40; Puppe in: NK-StGB, § 16 Rn. 52.