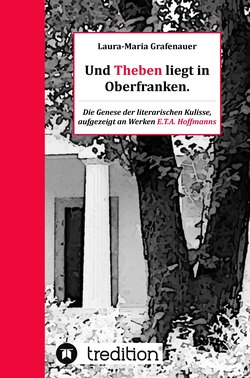Читать книгу Und Theben liegt in Oberfranken. - Laura-Maria Grafenauer - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1. Lebendigkeit und Frische: Ein Plädoyer für reale Schauplätze
1.1. E.T.A. Hoffmanns (auto-) biographische Orte
Berlin, im November des Jahres 1818: Der vierzehnte des Monats mag, wie um diese Jahreszeit nicht anders zu erwarten, ein nebelverhangener Tag gewesen sein, an dem man nicht einmal das Gemüt eines Poeten braucht, um zwischen Himmelgrau und wiederkehrenden Regenschauern melancholisch zu werden. Der Kammergerichtsrat Hoffmann ist ein solch poetischer Charakter durch und durch, doch anstatt die Witterung der Seele den Wetterkapriolen anzupassen, lädt er an diesem Abend einige enge Freunde und Bekannte zum gemütlichen Beisammensein in seine Dachwohnung mit Blick auf den Gendarmenmarkt. Angesichts eines großzügigen Vorschusses, den er ein paar Tage zuvor von seinem Verleger Georg Reimer erhalten hat, dürfte die kleine Feier nicht eben spartanisch ausgefallen sein, zumal da es einen außerordentlichen, alle Kosten rechtfertigenden Anlass für die Soirée gibt: Sie stellt das Willkommen für den Naturforscher Adelbert von Chamisso dar, der soeben von einer über dreijährigen Weltumseglung zurückgekehrt ist und damit die Erneuerung eines während und aufgrund seiner Abwesenheit unterbrochenen literarischen Zirkels ermöglicht. An wechselnden Orten und in wechselnder Besetzung trafen gleichgesinnte Herren zusammen, die zufälligerweise gemein hatten, dass ein jeder von ihnen Passables zu Papier zu bringen imstande war, und so trug man sich gegenseitig die neuesten poetischen Errungenschaften vor, um sie in geselliger Runde zu erörtern, zu diskutieren, zu kritisieren. Das Herzstück des wechselnd besetzten Klubs bildeten neben Kammergerichtsrat und Weltumsegler ihre Schriftsteller-Kollegen Julius Eduard Hitzig und Karl Wilhelm Salice-Contessa. Vielleicht war es einer dieser Herren, der an jenem herbstlichen Wiedersehens-Abend eine unterhaltsame Anekdote erzählte, deren Schauplatz sich dank der eindeutigen Bezeichnung von gewissen Straßenzügen mit einiger Wahrscheinlichkeit in B**lin vermuten ließ, und als er unter allgemeinem Beifall geendet hatte, wandte sich ein Zunftbruder mit den folgenden oder halbwegs ähnlichen Worten an ihn:
Du hattest, sprach Theodor, bestimmten Anlaß die Szene des Stücks nach Berlin zu verlegen und Straßen und Plätze zu nennen. Im Allgemeinen ist es aber auch meines Bedünkens gar nicht übel den Schauplatz genau zu bezeichnen. Außerdem daß das Ganze dadurch einen Schein von historischer Wahrheit erhält der einer trägen Fantasie aufhilft, so gewinnt es auch, zumal für den, der mit dem als Schauplatz genannten Orte bekannt ist, ungemein an Lebendigkeit und Frische.1
An dieser Stelle überlassen wir die Herren ihrem Punsch und halten uns an die Fakten: Jene Worte spricht im ersten Band der Serapions-Brüder Theodor zu Ottmar, der soeben die als Fragment aus dem Leben dreier Freunde bekannte Erzählung zum Besten gegeben hat, und das Zitat ist freilich das einzig Handfeste an der von mir erdichteten Szene.2 Das zwischen Verbürgtem und Erdichtetem oszillierende Phantasiestück besitzt aber insofern eine (literatur-) wissenschaftliche Berechtigung, als es die Verbindung nachzuzeichnen sucht, die zwischen der Rahmenhandlung der Serapions-Brüder und dem realen Vorbild des Seraphinenordens3 ebenso besteht wie zwischen Theodors Aussage und den historischen Ereignissen des Novembers 1818. Der Anteil von Realität in der Fiktion – inwieweit und wie hoch man ihn einordnen darf, stellt nicht nur in der Hoffmann-Forschung einen Gegenstand lebhafter Diskussion dar;4 auch im speziellen Fall der Serapions-Brüder führte er zu einem kontroversen Verhältnis hinsichtlich der wechselseitigen Anteile von Biographie und Erfindung im serapionischen Rahmen.5 Ursprünglich streute Hitzig, der es als Mitglied des historischen Zirkels am besten wissen müsste, das später vom Literaturwissenschaftler Hans von Müller aufgegriffene Gerücht einer Übereinstimmung zwischen den Figuren der Rahmenhandlung und den realen Mitgliedern des Seraphinenordens: Hitzig selbst stelle dabei den Ottmar dar, Salice-Contessa den Sylvester und Koreff den Vinzenz, während hinter den drei Figuren Theodor, Lothar und Cyprian verschiedene Egos von Hoffmann steckten.6 Als Gegner dieser biographistischen Zuschreibungen hat man wenig Mühe, sie mit einer denkbar prosaischen, aber deswegen nicht weniger zweckmäßigen Methode auszuhebeln: Wenn man alle Personenkonstellationen der Rahmenhandlung nach dem Schema ›eins zu eins‹ auf mögliche wirklich erfolgte Zusammenkünfte zu übertragen sucht, stellt man unweigerlich fest, dass die obige Aufteilung u.a. schon aufgrund von Hoffmanns Ubiquität in sich nicht kompatibel sein kann.7 Gleichzeitig ist Hitzigs Behauptung jedoch ebenso wenig von der Hand zu weisen wie die tatsächlichen Versammlungen der Seraphinenbrüder. Um beiden Seiten gerecht zu werden, gelangt man schließlich zu einem ›zwar nicht, aber trotzdem‹-Kompromiss: Es sind die literarischen Figuren zwar nicht die Abziehbilder der historischen Persönlichkeiten, aber trotzdem besteht zwischen beiden Ebenen eine kaum bestreitbare Verbindung.8 Natürlich ist die Figur Sylvester nicht in jeder einzelnen Situation auf Salice-Contessa, Vinzenz nicht auf Koreff, Ottmar nicht auf Hitzig zu beziehen, und ebenso wenig kann sich Hoffmann dreiteilen; wie sehr sich genau diese Identifikationsmodelle aber trotz aller Neutralitätsbemühungen in den Köpfen der Rezipienten festgesetzt haben, beweist Wulf Segebrecht selbst, wenn er im Kommentar zum Märchen Die Königsbraut Koreff als eine mögliche Bezugsperson für Hoffmanns Wissen bezeichnet: »Aus diesen Bemerkungen einer fiktiven Figur kann man nur spekulativ auf eine mündlich überlieferte ›Quelle‹ schließen, die der Berliner Arzt David Ferdinand Koreff (= Vinzenz) Hoffmann zugänglich gemacht haben könnte« (SB 1641). Man kommt nicht umhin, die dramatis persona Vinzenz mit der historischen Person Koreff in Verbindung zu bringen, ja in diesem Fall sogar gleichzusetzen, wenigstens ihr inspiratorisches Substrat betreffend.
Konkrete Entsprechungen (und bestünden sie auch nur in Einzelfällen) zwischen den Abendgesellschaften um Hoffmanns Schriftstellerkollegen und den in den Serapions-Brüdern verewigten Szenen lassen sich im Nachhinein weder eindeutig belegen noch widerlegen. Wenn wir jedoch den Disput bis auf weiteres unentschieden belassen und wenigstens annehmen dürfen, dass die zitierte Aussage der dramatis persona Theodor der Meinung des historischen (Ernst) Theodor entspricht, so darf das Zitat aus dem Fragment mit einiger Berechtigung als programmatischer Leitsatz über dieser Arbeit stehen. Im Fokus: Schauplätze von fiktionalen Werken, die auch in der real erfahrbaren, authentischen Wirklichkeit existieren. Was den Umgang mit ihnen betrifft, so plädiert die dramatis persona Theodor offenbar in Einklang mit der Vorgehensweise der dramatis persona Ottmar dafür, die Überschneidungen von fiktionalem Schauplatz und real existierender Umgebung in der Erzählung nicht zu verschleiern, sondern durchaus kenntlich zu machen, nicht nur, um ihr für die mit dem realen Ort vertrauten Leser eine gewisse ›Lebendigkeit und Frische‹ zu verleihen, sondern auch dank der Nennung von allgemein bekannten und erkennbaren Landmarken einen ›Schein von historischer Wahrheit‹ zu erwecken. Mit anderen Worten: Indem die Schauplätze der Fiktion mit den real existierenden Orten in Verbindung gebracht werden, aus deren Inspiration sie auch entspringen, und die Dichtung somit in die Realität zurückgespiegelt wird, gewinnt das schriftstellerische Produkt sowohl an Dynamik als auch an Glaubwürdigkeit.9 Die Vorgehensweise orientiert sich an der Regel des serapionischen Clubs, wo es zunächst allgemein heißt:
Jeder prüfe wohl, ob er auch wirklich das geschaut, was er zu verkünden unternommen, ehe er es wagt laut damit zu werden. Wenigstens strebe jeder recht ernstlich darnach, das Bild, das ihm im Innern aufgegangen recht zu erfassen mit allen seinen Gestalten, Farben, Lichtern und Schatten, und dann, wenn er sich recht entzündet davon fühlt, die Darstellung ins äußere Leben tragen. (SB 69)
An dieser Stelle geht es noch ausschließlich um das Nach-außen-Befördern des ›im Innern aufgegangenen Bildes‹; dass dieses innere Bild aber von einem äußeren beeinflusst werden darf, ja sogar soll, wird später im Dialog von Der Dichter und der Komponist verdeutlicht:
[…] und die Kunst des Dichters müßte darin bestehen, die Personen nicht allein vollkommen geründet, poetisch wahr, sondern recht aus dem gewöhnlichen Leben gegriffen, so individuell auftreten zu lassen, daß man sich augenblicklich selbst sagt: Sieh da! das ist der Nachbar, mit dem ich alle T age gesprochen! Das ist der Student, der alle Morgen in’s Kollegium geht, und vor den Fenstern der Kusine erschrecklich seufzt u. s. w. (SB 112)
Eindeutig sind die Parallelen zu Theodors ursprünglicher Aussage: Personen und Orte der Realität sollen in der Fiktion anschaulich bezeichnet werden, damit der Leser sie identifizieren und als Folge dieser Identifizierung dem Werk Authentizität und Glaubwürdigkeit einräumen kann. Die dramatis persona der Fiktion und das Individuum der Realität, der Schauplatz der Fiktion und der Ort der Realität schließen sich für Hoffmann nicht gegenseitig aus, sondern bereichern sich und befinden sich gleichsam auf einer Ebene – so wie er die Figuren der Fiktion und der Realität im Kunzischen Riss auf dem papierenen Plan eines realen Orts graphisch nebeneinanderstellt.10 Die besprochenen Zitate aus den Serapions-Brüdern exemplifizieren zunächst die von Hoffmanns Protagonisten in diesem Werk vertretenen Ansichten zur schriftstellerischen Produktion und sollen als Grundlage für mein Forschungsinteresse dienen. Worin dieses Forschungsinteresse genau besteht, wollen wir im Folgenden klären.
1.2. Literaturtourismus und seine Ergänzung im ›Serapionischen Prinzip‹
Das Spannungsfeld zwischen real existierendem Ort und fiktionalem Schauplatz mitsamt den daraus resultierenden Konsequenzen, zunächst für das jeweilige Werk, später für die Herausbildung der literarischen Kulisse im Allgemeinen, stellt den Gegenstand dieser Arbeit dar. Dafür gilt es erst einmal, den Begriff der ›Kulisse‹ zu definieren. Das Fremdwörterbuch des Dudenverlags führt als mögliche Bedeutungen für das Wort ›Kulisse‹ zunächst die »bewegliche Dekorationswand auf einer Theaterbühne; Bühnendekoration«11 an. Der Begriff ›Bühnendekoration‹ lässt sich vom Theater nahtlos auf die Literatur übertragen: Die Schauplätze der im Folgenden behandelten Werke sind die Bühnenbilder ihrer jeweiligen Szenen und Handlungsabläufe. Diese Schauplätze der Literatur in der Realität zu erforschen und Parameter eines historischen Schriftsteller-Blicks in die greifbare Wirklichkeit zu übersetzen ist eine Aufgabe, die sich der Literaturtourismus angeeignet und für seine Zwecke monopolisiert hat; seine Entwicklung zeichnet Barbara Schaff mit Prägnanz nach.12 Für die Literaturwissenschaft besitzen die Ziele des Literaturtourismus jedoch nur bedingten Wert, denn zu oft liegt sein Hauptaugenmerk nicht auf der Vermittlung der Literatur, sondern auf der breitenwirksamen Attraktivität des Genres: Für die »tourist industry«13 geht es bei der Erkundung von literarischen Schauplätzen nicht in erster Linie darum, neue Schlaglichter auf den Originaltext zu werfen, sondern der Originaltext selbst wird als ein dem Tourismus unterstehendes Medium genutzt.14 Für die literaturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex sollten daher zwei entscheidende Vorbedingungen konstatiert werden: Zum einen muss die Unterscheidung zwischen einem fiktionalen Ort und seiner in der Realität existierenden Referenz klar sein, wie Barbara Schaff sie definiert: »Narrative places, as mediated through literary texts, do not of course constitute reality, […] these textual locales cannot be objectified, but are to be regarded as symbolic instruments for making a text meaningful«15. Zum anderen ist eine conditio sine qua non zu beachten, die das Erfahrbarmachen von literarischen Kulissen erst ermöglicht. Um den per se fiktiven Schauplatz eines fiktionalen Werks mit einem in der Realität wirklich existierenden Ort vergleichen zu können, muss davon ausgegangen werden, dass die textinternen Referenzen realitätsrelevant sind, oder anders gesagt: dass der im Text beschriebene Ort seitens des Autors bewusst und absichtlich auf die räumlichen Gegebenheiten verweist, die außerhalb des Texts vorgefunden werden konnten oder noch können. Rolf Selbmann hält dazu fest: »Literarische Aussagen über die Wirklichkeit sind zwar an dieser Wirklichkeit nachprüfbar. Doch die Frage, ob sie wahr oder falsch sind, hat für die literarische Fiktion keine Bedeutung«16. Auf die Orte der Literatur übertragen bedeutet das: Ein literarischer Schauplatz kann zwar mit einem in der Realität existierenden Ort verglichen werden; ob er diesem Ort aber bewusst (= wahrhaftig) nachempfunden ist, spielt für den fiktionalen Ort keine Rolle. Trägt der fiktionale Ort jedoch ausgerechnet den Namen des Orts der Realität, so kann immerhin von einer bewussten Absicht des Autors ausgegangen werden, diese Referenz herzustellen. Schildert er einen Prachtboulevard, der in seinen Eigenheiten an die Berliner Allee Unter den Linden erinnert, so ist seine Absicht erst dann als erwiesen anzusehen, wenn er konkrete Namen nennt, die mit der im Berlin der Realität befindlichen Allee oder den sie umgebenden Straßen, Plätzen, etc. übereinstimmen. Unterlässt er dies, so muss die Relevanz des Verweises mit Vorsicht behandelt werden – was noch lange nicht bedeutet, dass sich der Autor beim Arrangement der Kulisse nicht trotzdem von der Berliner Allee hat beeinflussen lassen.17 Kehren wir an dieser Stelle noch einmal zu den Serapions-Brüdern zurück, die in der Analyse der namensgebenden Erzählung Der Einsiedler Serapion die Verbindung zwischen den beiden Ebenen definieren:
Es gibt eine innere Welt, und die geistige Kraft, sie in voller Klarheit, in dem vollendetsten Glanze des regesten Lebens zu schauen, aber es ist unser irrdisches [sic!] Erbteil, daß eben die Außenwelt in der wir eingeschachtet, als der Hebel wirkt, der jene Kraft in Bewegung setzt. (SB 68)
Ohne die Außenwelt gibt es keine Möglichkeit, die innere Welt der Inspiration in vollendeter Form zu schauen und im Werk zu reflektieren; das ist nicht nur die entscheidende Erkenntnis für den Umgang mit Figuren, wie von Klaus Deterding,18 und für den Umgang mit Orten, wie im vorangehenden Absatz beschrieben, sondern auch die Antwort auf die Überlegungen zu den realitätsrelevanten Referenzen. Wenn wir von einer Inspiration in der Realität ausgehen, die in der Phantasie des Kunstschaffenden verarbeitet wird und dann im Werk wiedererkannt werden kann, relativiert sich die Frage nach den aus der Außenwelt einfließenden (oder anders gesagt: den autobiographischen) Elementen in einem Text insofern, als alle künstlerische Produktion von den Einflüssen der Außenwelt (oder anders gesagt: der Biographie) des Künstlers abhängig ist und es sogar sein muss, wenn sein Werk den Anspruch an die von Theodor geforderte Glaubwürdigkeit erfüllen will. In diesem »Serapionischen Prinzip« (SB 70),19 wie Lothar es bezeichnet, liegt zwar nicht die Legitimation, die Orte der Fiktion mit jenen der Realität gleichzusetzen, wohl aber, sie miteinander zu vergleichen, weil sie wie jedes Produkt der Phantasie von der Realität motiviert sind und im fertigen künstlerischen Werk sogar wiedererkannt werden s o l l e n. Wenn dies für alle Schriftsteller gilt, so auch und in besonderem Maße für Hoffmann. Er hat die autobiographischen Elemente in seinen Werken nicht nur teils stillschweigend, teils lauthals eingestreut und somit die Referenzen zur extratextuellen Wirklichkeit greifbar gemacht,20 sondern diese Vorgehensweise auf textueller Ebene selbst zur Diskussion gebracht, als mise en abyme des künstlerischen Inspirationsgeschehens – wie im Fall von Theodors Zitat. Die Überlegungen zum Wirklichkeitsanteil der Serapions-Brüder können am Ende dazu beitragen, das Prinzip von Hoffmanns Poetologie zu untermauern, und umgekehrt erklärt die Tatsache, dass die Fiktion ›qua Serapion‹ einen fiktionalisierten Teil der Wirklichkeit enthalten muss, Hoffmanns Vorgehen und Bereitschaft, seine Erlebnisse in der Literatur zu verarbeiten.
1.3. Ménage à trois: Kulisse – Autobiographie – Werk
Wo aber besteht die Verbindung zum Literaturtourismus, und wozu brauchen wir ihn in diesem Kontext überhaupt? Barbara Schaff unterscheidet verschiedene Formen von literarisch aufgeladenen Schauplätzen: Eine »literary destination« ist für sie entweder »a place connected to an author’s biography« oder aber »a location in a work of fiction which also exists in the real world«21. Anhand dieser Charakterisierung kann eine Brücke zwischen der Literaturwissenschaft und dem Literaturtourismus geschlagen werden. Man könnte sich dem Themenkomplex von real existierenden Orten in fiktionalen Werken auch auf rein theoretische Weise nähern;22 der literaturtouristisch gefärbte Blick aber scheint besonders gut geeignet zu sein, um über den Tellerrand der Literaturwissenschaft hinauszuschauen, denn Barbara Schaffs soeben erwähnte Auslegung liefert zwei wichtige Teilbereiche der Analyse in dieser Arbeit: Die drei Eckpunkte der Untersuchung sind literarische Kulisse, autobiographisches Momentum und Werk.
Die literarische Kulisse bezeichnet die im Werk beschriebenen Schauplätze und ihre extratextuellen Referenten – die authentischen Orte, die zum Entstehungszeitpunkt des Werks in der Realität wiedergefunden und -erkannt werden konnten bzw. gegebenenfalls noch immer erkannt werden können.
Das autobiographische Momentum stellt jene Elemente des Werks dar, die mit der Biographie des Schriftstellers in Verbindung stehen und von ihm teilweise oder ganz aus erlebtem Geschehen entliehen wurden.
Das Werk schließlich beinhaltet nicht nur die jeweils betrachteten literarischen Texte, sondern auch ihre wissenschaftliche Auslegung.
Dieses letztgenannte Feld, das Text und Text-Kritik vereint, befindet sich eindeutig im Kompetenzbereich der Literaturwissenschaft, die gelegentlich auch das autobiographische Momentum in ihre Untersuchungen mit einbezieht, falls sie es für die Deutung des Werks als relevant erachtet.23 Der Literaturtourismus hingegen beschäftigt sich, wie bereits beschrieben, hauptsächlich mit den Wechselbeziehungen zwischen literarischer Kulisse und Autobiographie des Künstlers, ohne ausführliches Interesse an den daraus resultierenden Konsequenzen für das Werk zu zeigen. Ich möchte im Folgenden die beiden Vorgehensweisen kombinieren, vereinfacht gesagt zu einer Gleichung:
Literarische Kulisse + Autobiographisches Momentum
= Neue Erkenntnisse für das Werk
Die zentrale Frage lautet: Welche (bestenfalls neuen) Rückschlüsse können wir auf literarische Werke ziehen, wenn wir der Vorgehensweise des Literaturtourismus folgen und die Orte der Fiktion direkt auf die Orte der real existierenden Wirklichkeit übertragen?24 Die praktische Vorgehensweise orientiert sich zunächst an der Gleichung: Ausgehend vom Originaltext erfolgt eine eingehende Analyse der Berührpunkte zwischen seinen fiktionalen Schauplätzen und den entsprechenden, real existierenden Orten, die mit der Biographie des Autors in Verbindung stehen. In einem zweiten Schritt wird nachvollzogen, wie jene aus beiden Elementen zusammengesetzte Szenerie auf den Plot einwirkt. Die Ergebnisse dieses Zweischritts können bereits neue Schlaglichter auf einen einzelnen betrachteten Text werfen; beschäftigt man sich mit den Werken verschiedener Autoren, so spielen auch deren biographische und literarische Beziehungen sowie die Korrelationen zwischen den jeweiligen Schauplätzen eine Rolle. Inwiefern sind ähnliche literarische Kulissen auf ähnliche autobiographische Momenta zurückzuführen, und inwiefern produzieren die beiden Komponenten im Zusammenspiel ähnliche Texte? Die Grenzen der beiden Summanden der oben aufgestellten Gleichung fließen im Sinne des Serapionischen Prinzips ineinander, und das Prinzip begründet auch die primäre Textauswahl für das Vorhaben. Man kann sich nicht auf jene Autoren beschränken, die autobiographische Elemente in ihrem Werk verarbeitet haben, denn, so die Grundthese: das macht ein jeder Autor. Doch es klang bereits an, dass E.T.A. Hoffmann sich dieser Tatsache besonders bewusst war und es auch nicht scheute, sie offen einzugestehen. Abgesehen von den autobiographischen Bezügen in der Rahmenhandlung der Serapions-Brüder hat er auch in die Szenen zahlreicher anderer Werke Lokalkolorit und Erfahrungen aus seinem Leben einfließen lassen; um einen Begriff von der Fülle dieser Bezüge zu erlangen, genügt es, in den Kommentarteilen der DKV-Ausgabe nach der Überschrift ›Biographischer Hintergrund‹ zu suchen – alleine im Band der Nachtstücke wird man in sechs Fällen fündig.25 Weitere Beispiele sind die ironische Verarbeitung der Affäre Julia Mark im Berganza und den Abenteuern der Sylvester-Nacht26 sowie die literarisierte Schilderung seines eigenen Spieler-Glücks in der gleichnamigen Erzählung.27 Zu spielen erlaubt er sich auch mit dem Wahrheitsgehalt selbstreferierender Bezüge, wenn der Herausgeber der Geheimnisse unter dem augenzwinkernden Pseudonym ›Hff.‹ auftritt;28 andernorts wiederum gesteht er seine Inspirationsquelle offen ein, so in der Nachschrift eines Briefs an Friedrich Rochlitz vom 16. Januar 1814 bezüglich der beiliegenden Erzählung Die Automate: »Die Erscheinung am Kurischen Hafe so wie manches andere in dem Aufsatze ist Reminiszenz aus meine〈m〉 früher〈n〉 Leben in Ostpreuß〈en〉« (SP 12).
Walter Benjamin hat Hoffmann mit seinem berühmten Beitrag über Das dämonische Berlin ein bewunderndes Panegyrikon geschrieben und seine Gabe, das selbst Erlebte und Gesehene in der Fiktion zu verarbeiten, vor allem mit der Großstadterfahrung Berlins verknüpft.29 Darüber hinaus hat Benjamin sich nicht gescheut, die literaturtouristische Brille aufzusetzen und es für ganz selbstverständlich zu halten, dass Hoffmann seine Inspiration »nicht irgendwo frei im Raume schwebend, sondern an ganz bestimmten Menschen, Dingen, Häusern, Gegenständen, Straßen«30 festgemacht hat. Im Besonderen gilt ihm das für die Erzählung Des Vetters Eckfenster (1822): »Der Vetter ist Hoffmann, das Fenster ist das Eck-Fenster seiner Wohnung, das auf den Gendarmenmarkt hinausging«31. Ob diese mit Überzeugung getätigten Aussagen Benjamins sich tatsächlich als wahr herausstellen werden, wollen wir im Folgenden untersuchen, denn diese von ihm hochgelobte Erzählung führt uns zurück zum Grundsatz des Serapionischen Prinzips. Sie nimmt unter Hoffmanns zahlreichen autobiographisch gefärbten Arbeiten deswegen einen Sonderstatus ein, weil sie zu seinen letzten vollendeten Werken zählt und sich die mutmaßlichen Selbstreferenzen in ihr tatsächlich häufen, von Gesundheitszustand und Bekleidung des Protagonisten über seine poetologischen Prinzipien bis hin zur Lage seiner Wohnung.32 Dieser Text wird allein am Anfang des Hauptteils der Arbeit stehen, um eine ausführliche Analyse der vermeintlich autobiographischen Bezüge zu ermöglichen. Danach gesellt sich jeweils ein Autorenkollege zu Hoffmann, und zwar im Sinne eines ausgewogenen Zeitstrahls zuerst ein Zeitgenosse, dann ein Vorgänger und schließlich ein Nachfolger: Während der Blick aus des Vetters Eckfenster Schlaglichter auf den Berliner Gendarmenmarkt wirft, führt die fünf Jahre zuvor entstandene Erzählung Das öde Haus (1817) den Leser weiter auf die nahe gelegene Allee Unter den Linden, die wiederum fünf Jahre später, genau im Entstehungszeitraum des Eckfensters, der junge Heinrich Heine im ersten seiner Briefe aus Berlin (1822) als Stadtführer durchwandelt. Vom Berlin des frühen 19. Jahrhunderts, dem Sinnbild einer modernen Metropole, geht die Reise – denn als solche muss der Fortgang dieser Arbeit schon aufgrund des Forschungsinteresses beschrieben werden – weiter in das Vorbild aller capita mundi: Die römischen Karnevalsfeierlichkeiten inspirierten nicht nur Goethe, der mit dem Römischen Carneval aus dem Jahr 1789 ein Standardwerk für das Rom-Bild der Daheimgebliebenen schuf, sondern auch Hoffmann, eben einen solchen nie in Arkadien Gewesenen, der sich mit der Prinzessin Brambilla (1821) an seinen liebsten Sehnsuchtsort versetzte. Obgleich er die (ausdrücklich wenigen) Urlaubstage seines Lebens nicht im sonnigen Süden, sondern in Schlesien verbrachte,33 lernte er auch im hohen Norden Orte der Sehnsucht kennen: Die Reise schließt ihren Kreis in einer Zusammenschau zweier Gebirgskulissen, dem Riesengebirge der Briefe aus den Bergen (1820) und den Dolomiten aus Arthur Schnitzlers Tragikomödie Das weite Land (1911).
Intertextuelle Beziehungen spielen in Hoffmanns Werk allgemein eine wichtige Rolle: Hartmut Steinecke hat in seinem Hoffmanns Goethe-Rezeption gewidmeten Artikel überzeugend ausgeführt, wie in der Literatur Bezüge zu musikalischen oder im Bereich der bildenden Künste angesiedelten ffiuvres stets gerühmt wurden, während der Verweis eines Schriftstellers auf das Werk eines anderen Schriftstellers, ob direkt oder kunstvoll versteckt, seit jeher und noch immer durch den derogativen Terminus ›Plagiat‹ diskreditiert wird.34 Mit dieser Verleumdung kann nur aufgeräumt werden, wenn die Zusammenschau von Texten, die biographisch wie inhaltlich in unmittelbar lokaler Nachbarschaft entstanden sind, den Beweis dafür liefert, dass ähnliche Kulissen auch ähnliche Literatur hervorrufen. Hoffmann ist als Leitfaden für dieses Vorhaben prädestiniert, weil seine Verdienste um den intertextuellen Austausch mittlerweile gewürdigt und mit der Erkenntnis geehrt werden, dass er die Arbeiten seiner Schriftstellerkollegen nicht nur konsumierte, sondern auch weiterverarbeitete und damit selbst zu einem Referenzpunkt für seine Nachfolger wurde.35 Seine Werke können nicht nur Wege zum Intertextuellen, sondern auch zum Interszenischen auftun und die Frage beantworten, was Autoren im Allgemeinen mit den Schauplätzen ihrer Werke machen – oder ob es doch die Schauplätze sind, die etwas mit den Autoren machen. Wie wird ein in der Realität existierender Ort zu einem fiktionalen Schauplatz umgeschaffen, welche Rolle spielt der Ort selbst bei diesem Arrangement, wie beeinflussen sich Schriftsteller und Schreibende gegenseitig und im Laufe der Literaturgeschichte bei diesem Vorgang? Die Antworten auf diese Fragen sollen uns dem Ziel nahebringen, zur Kenntnis einer exemplarischen Entwicklung der literarischen Kulisse zu gelangen, die nicht nur auf Hoffmanns Werk anzuwenden ist. Bestenfalls bejahen sie überdies die immerwährende Frage der Literaturwissenschaft nach dem »Sinn, literarische Texte mit ihren Schauplätzen und Handlungsorten zu konfrontieren«36: Wo ein Muster zu erkennen ist, da kann der Sinn nicht weit sein.
1.4. Ein Schlusswort zum Titel: Serapion, ein fränkischer Thebaner
Der Einsiedler Serapion – so heißt die einleitende Erzählung des ersten Bands der Serapions-Brüder, deren Titelheld als Eremit in einem fränkischen Wald lebt, jedoch von der fixen Idee beherrscht wird, als ein vom Märtyrertum erlöster Heiliger in der thebanischen Wüste Zuflucht gefunden zu haben. Er ist davon überzeugt, dass er in seiner einsamen Klause regelmäßig literarische Größen wie Ariost, Dante und Petrarca zum gemütlichen Plausch empfängt, und dass man bei günstiger Wetterlage von einer benachbarten Bergspitze aus nicht nur die Türme von Alexandria ausmachen, sondern auch allerlei im wahren Wortsinn fabelhafte Begebenheiten erschauen kann.37 Im Kontext der Erzählung fordern die Serapions-Brüder als Grundsatz ihres Zirkels, es »prüfe [jeder] wohl, ob er auch wirklich das geschaut, was er zu verkünden unternommen«, und es »strebe jeder recht ernstlich darnach, das Bild, das ihm im Innern aufgegangen recht zu erfassen mit allen seinen Gestalten, Farben, Lichtern und Schatten« (SB 69). Auf den ersten Blick erfüllt Serapion zur Gänze diese Anforderungen, denn er lebt in seiner eigenen, von der Realität ganz und gar abgelösten Wirklichkeit, die nur in seinem kranken Inneren Bestand hat.38 Würde man das Serapionische Prinzip ausschließlich auf diese Weise definieren, so hätten auch die Kulissen aller in Aussicht gestellten Werke keinerlei tiefere Bedeutung, weil nur jenes Bild der Wirklichkeit für die Dichtung als wesentlich erachtet würde, das der Dichter in seinem Inneren wahrnimmt. Wulf Segebrecht hat jedoch sorgfältig nachgezeichnet, wie in den Serapions-Brüdern durch die Erzählung Rat Krespel die zweite Bedeutungsebene des Serapionischen Prinzips offenkundig gemacht und bewiesen wird, dass Hoffmanns Argumentation sich nicht selbst widerspricht, sondern durchaus fundiert ist.39 Dem Einsiedler fehlt lediglich »die Erkenntnis der Duplizität […], von der eigentlich allein unser irdisches Sein bedingt ist« (SB 68), und gerade aus seinen Irrungen können die Serapions-Brüder ihr Prinzip des wahren Sehens ableiten, das sich nicht allein aus der Phantasie speist und auch wieder in die Realität zurückgespiegelt werden muss: Serapion »dient in dem Buch lediglich zum Exempel des Prinzips, er vertritt es nicht selbst« (SB 1249). Was aber ist die vielzitierte ›Außenwelt‹ anderes als die in der Lebenswirklichkeit des Schreibenden existierende Kulisse, die er in seinem Werk verarbeitet, und zwar nicht nur als reine Lokalität, als architektonischer Unterbau seiner Fiktion, sondern als bühnentechnischer Hintergrund, der mit allerlei Orten, Menschen und Begebenheiten angefüllt ist. Der Schriftsteller muss die Realität konstatieren, dann aber mit ihr spielen können; er muss, wie Hoffmann, vor allem ein aufmerksamer Zuschauer sein. Was Walter Benjamin ihm viel später bescheinigen sollte,40 diagnostizierte er sich selbst in einem als offenes Schreiben konzipierten Brief an den Verleger Johann Daniel Symanski:
Sie fordern, verehrtester Herr! mich auf, an der Zeitschrift, die Sie unter dem Titel ›der Zuschauer‹ herauszugeben gedenken, mitzuarbeiten. Mit Vergnügen werde ich Ihren Wunsch erfüllen, um so mehr, als der wohlgewählte Titel mich an meine Lieblingsneigung erinnert. Sie wissen es nämlich wohl schon wie gar zu gern ich zuschaue und anschaue, und dann schwarz auf weiß von mir gebe, was ich eben recht lebendig erschaut. (Murr 569)
Hier gewährt Hoffmann tiefe Einblicke in seine dichterische Vorgehensweise: Zuerst in der Welt zu-schauen (den Menschen, den Orten, den Begebenheiten, die beide verbinden), dann im Inneren an-schauen (und für sich selbst arrangieren), und schließlich die Symbiose aus beiden ›Schauen‹ als Er-schauen schwarz auf weiß von sich geben.41 Damit schließt sich der Kreis zum Serapionischen Prinzip und schlägt gleichzeitig einen Bogen zu jener Erzählung, die Hoffmann seinem Verleger hier im Herbst 1820 indirekt verspricht, wenngleich er sie erst eineinhalb Jahre später verwirklichen wird, als eine seiner letzten Arbeiten: Des Vetters Eckfenster. Mit ihr will ich gleichzeitig schließen und beginnen, stets bemüht, das Wesentliche recht lebendig zu schauen.
1 E.T.A. Hoffmann: Die Serapions-Brüder. Herausgegeben von Wulf Segebrecht unter Mitarbeit von Ursula Segebrecht. Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag 2008 (= DKV im Taschenbuch, Band 28): 176. Im weiteren Verlauf direkt zitiert als SB.
2 Den inhaltlich-historischen Unterbau bildet Wulf Segebrechts ausführlicher Kommentar zur soeben zitierten DKV-Ausgabe (v.a. SB 1228-1244 und 1257f.) sowie die Beschreibung von Klaus Deterding: Hoffmanns Erzählungen. Eine Einführung in das Werk E.T.A. Hoffmanns. Würzburg: Königshausen & Neumann 2007: 119-121. Bezüglich der Hoffmann’schen Wohnsituation vgl. Susanne Lüdemann: E.T.A. Hoffmann am Gendarmenmarkt: Des Vetters Eckfenster. In: Wolfgang Kreher und Ulrike Vedder (Hrsg.): Von der Jägerstraße zum Gendarmenmarkt. Eine Kulturgeschichte aus der Berliner Friedrichstadt. Berlin: Geisteswissenschaftliche Zentren Berlin/Gebr. Mann Verlag 2007: 8390.
3 So nannte Hoffmann laut Johann Georg Seegemund in einem Brief an Wilhelm Neumann vom 19. März 1815 die literarische Runde, vgl. Friedrich Schnapp (Hrsg.): E.T.A. Hoffmann in Aufzeichnungen seiner Freunde und Bekannten. München: Winkler 1974: 294. Im weiteren Verlauf direkt zitiert als Aufz. Mit dem Pseudonym ›Kreisler‹, das Seegemund hier verwendet, Unterzeichnete Hoffmann gelegentlich seine Briefe, vgl. E.T.A. Hoffmann: Sämtliche Werke in sechs Bänden. Herausgegeben von Hartmut Steinecke u.a. Band 6: Späte Prosa. Briefe. Tagebücher und Aufzeichnungen. Juristische Schriften. Werke 1814-1822. Herausgegeben von Gerhard Allroggen u.a. Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag 2004 (= Bibliothek deutscher Klassiker 185): 53, 66. Im weiteren Verlauf direkt zitiert als SP.
4 Vgl. zu diesem Themenkomplex Rolf Selbmann: Die Wirklichkeit der Literatur. Literarische Texte und ihre Realität. Würzburg: Königshausen & Neumann 2016.
5 Vgl. Deterding 2007: 120f.
6 Vgl. SB 1243.
7 Vgl. SB 1243f.
8 Dieser Meinung sind z.B. Klaus Deterding (vgl. ders. 2007: 120f.) und Wulf Segebrecht (vgl. SB 1204 und 1244).
9 Dieses Prozedere beschreibt Klaus Deterding im Zusammenhang mit Hoffmanns Protagonisten, vgl. ders. 2007: 132.
10 Von dieser im Werk einzigartigen und zentral bedeutsamen Zeichnung wird im Rahmen des zweiten Kapitels dieser Arbeit noch die Rede sein, vgl. Kapitel 2.2.: Der Kunzische Riss als Vorbild für Des Vetters Eckfenster.
11 [Art.] Kulisse. In: Duden. Band 5: Das Fremdwörterbuch. 10., aktualisierte Auflage. Herausgegeben von der Dudenredaktion. Auf der Grundlage der aktuellen amtlichen Rechtschreibregeln. Mannheim/Zürich: Dudenverlag 2011 (= Weltbild Sonderausgabe): 592.
12 Vgl. Barbara Schaff: ›In the Footsteps of…‹: The Semiotics of Literary Tourism. In: KulturPoetik Bd. 11,2 (2011): 166-180.
13 Schaff 2011: 171.
14 Vgl. Schaff 2011: 167 und 171f.
15 Schaff 2011: 169.
16 Selbmann 2016: 13.
17 Barbara Schaff führt hier Thomas Hardys ›Wessex‹ als Beispiel auf, vgl. dies. 2011: 170.
18 Vgl. Deterding 2007: 128, 132.
19 Ich bleibe im Folgenden bei dieser Form, wenngleich die Serapions-Brüder im weiteren Verlauf das Adjektiv ›serapiontisch‹ gebrauchen (vgl. z.B. SB 92 oder 118), das sich auch meist in der Forschung findet (vgl. dazu SB 1246).
20 Vgl. im weiteren Verlauf Fußnote 25.
21 Schaff 2011: 169. Die dritte Möglichkeit ist für sie »a place which is completely imagined« (169); dieser Unterpunkt muss hier allerdings völlig ausgeklammert werden, da die vom Tourismus erzeugte Literatur nicht in den Interessensbereich dieser Arbeit fällt.
22 Vgl. hierzu Schaff 2011: 171.
23 So hält Lutz Hagestedt in Bezug auf Hoffmanns Erzählung Des Vetters Eckfenster eine Gleichsetzung von real existierendem Gendarmenmarkt und fiktionalem Marktplatz nur dann für zielführend, wenn sie für den Text als funktional angesehen werden kann, vgl. ders.: Das Genieproblem bei E.T.A. Hoffmann. Am Beispiel illustriert. Eine Interpretation seiner späten Erzählung ›Des Vetters Eckfenster‹. München: Friedl Brehm 1991 (= Reihe Theorie und Praxis der Interpretation, Band 2): 56.
24 Vgl. Schaff 2011: 171.
25 Nämlich bei Die Jesuiterkirche in G., Das Sanctus, Das öde Haus, Das Majorat, Die Kunstverwandten bzw. Seltsame Leiden eines Theater-Direktors und Briefe aus den Bergen. Vgl. E.T.A. Hoffmann: Nachtstücke. Klein Zaches. Prinzessin Brambilla. Werke 1816-1820. Herausgegeben von Hartmut Steinecke unter Mitarbeit von Gerhard Allroggen. Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag 2009 (= DKV im Taschenbuch, Band 36): 986, 995, 1003, 1013, 1041, 1114. Im weiteren Verlauf direkt zitiert als NSt.
26 Vgl. E.T.A. Hoffmann: Fantasiestücke in Callot’s Manier. Werke 1814. Herausgegeben von Hartmut Steinecke unter Mitarbeit von Gerhard Allroggen und Wulf Segebrecht. Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag 2006 (= DKV im Taschenbuch, Band 14): 707-709 sowie 803f. Im weiteren Verlauf direkt zitiert als Callot.
27 Vgl. SB 1540.
28 Vgl. E.T.A. Hoffmann: Sämtliche Werke in sechs Bänden. Herausgegeben von Wulf Segebrecht u.a. Band 5: Lebens-Ansichten des Katers Murr. Werke 1820-1821. Herausgegeben von Hartmut Steinecke unter Mitarbeit von Gerhard Allroggen. Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag 1992 (= Bibliothek deutscher Klassiker 75): 1069. Im weiteren Verlauf direkt zitiert als Murr. Mit dem Kürzel ›Hff.‹ unterzeichnete Hoffmann gelegentlich seine Privatbriefe, vgl. z.B. SP 20.
29 Vgl. Walter Benjamin: Aufklärung für Kinder. Rundfunkvorträge. Herausgegeben von Rolf Tiedemann. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1985 (= edition suhrkamp 1317/Neue Folge Band 317): 27-32.
30 Benjamin 1985: 29.
31 Benjamin 1985: 32.
32 Vgl. SP 1416.
33 Vgl. SB 1533.
34 Vgl. Hartmut Steinecke: E.T.A. Hoffmann und Goethe: Parodie oder Hommage? In: E.T.A. Hoffmann-Jahrbuch 17 (2009): 48-61. Hier: 54.
35 Vgl. Steinecke 2009: 54.
36 Selbmann 2016: 17.
37 Vgl. SB 33f.
38 Vgl. SB 1247.
39 Vgl. v.a. auch zur Funktion des Rat Krespels SB 1249f.
40 »So war Hoffmann weniger ein Seher als ein Anseher« (Benjamin 1985: 29).
41 Vgl. Jörn Steigerwald: Die fantastische Bildlichkeit der Stadt. Zur Begründung der literarischen Fantastik im Werk E.T.A. Hoffmanns. Würzburg: Königshausen & Neumann 2001 (= Stiftung für Romantikforschung, Band XIV): 255.