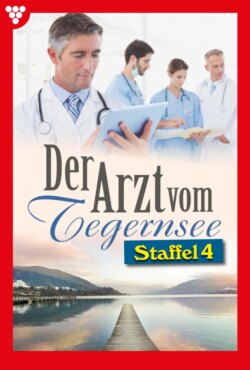Читать книгу Der Arzt vom Tegernsee Staffel 4 – Arztroman - Laura Martens - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAndrea Stanzl drückte mit einer müden Bewegung den Wecker aus. Es war halb sieben. Höchste Zeit aufzustehen und sich um den Haushalt und das Frühstück zu kümmern. Sie fühlte sich wie zerschlagen. Den größten Teil der Nacht hatte sie wach gelegen, weil die Schmerzen in ihrem rechten Bein von Minute zu Minute schlimmer geworden waren. Was konnte das nur sein? Bis vor zwei Wochen hatte sie wie ein Wiesel laufen können, jetzt mußte sie schon glücklich sein, wenn sie es schaffte, zwei, drei Kilometer ohne größere Beschwerden zu gehen oder eine Treppe hinunterzusteigen.
Die junge Frau richtete sich auf und streifte mit einem resignierenden Blick den Mann, der neben ihr im Bett lag. Zum Glück schlief Herbert noch und konnte ihr keine Vorwürfe machen, weil sie bereits gegen zwölf die Gaststube verlassen hatte und ins Schlafzimmer hinaufgegangen war. Herbert konnte sehr ungerecht sein. Für ihn zählte eine Frau nur etwas, solange sie fest anpacken konnte. »Ich möchte nur wissen, was du immer hast«, hatte er sie angefaucht, als sie ihm gesagt hatte, daß sie vor Schmerzen nicht mehr stehen konnte.
Andrea kämpfte sich ins Bad. Die ersten Schritte nach dem Aufstehen fielen ihr jedesmal besonders schwer. Als sie die Tür erreicht hatte, stützte sie sich gegen den Rahmen und hielt einen Augenblick inne. Ich sollte endlich zum Arzt gehen, dachte sie. Anfangs hatte sie geglaubt, die Schmerzen würden von allein vergehen, statt dessen wurden sie mit jedem Tag unerträglicher.
Als Herbert Freytag um halb zehn in die Küche kam, brodelte auf dem Herd bereits das Mittagessen. Wortlos setzte er sich an den Tisch und ließ sich von seiner Freundin Kaffee einschenken. »Hast mich ja gestern schön im Stich gelassen«, brummte er, als er mit beiden Händen nach dem Kaffeebecher griff. »So geht das nicht weiter, Andrea. Als ich dich vor einem halben Jahr von der Straße aufgelesen habe, bin ich davon ausgegangen, daß du mir
in der Kneipe helfen und dich nicht hinter irgendwelchen Wehwehchen verschanzen wirst.«
»Das sind nicht irgendwelche Wehwehchen, Herbert«, verteidigte sich die junge Frau und begann, das Geschirr abzutrocknen. »Im rechten Knie habe ich entsetzliche Schmerzen. Es ist, als würde jemand mit einem Messer in meinen Knochen herumstochern.
Letzte Nacht habe ich wieder kaum schlafen können. Ich kann nicht mehr. Wenn das Essen fertig ist, fahre ich zu Doktor Baumann. Er soll sich mein Knie mal anschauen.«
»Ach, und wer putzt die Kneipe?« fragte er.
»Das werde ich am Nachmittag tun«, versprach sie eilig.
»Wann denn? Um zwei kommen die ersten Gäste.«
»Herbert, ich muß nach meinem Knie sehen lassen.« Andrea hängte das Geschirrtuch über einen der Stühle. »Irgend etwas ist da nicht in Ordnung. Wenn ich ganz ausfalle, ist dir auch nicht geholfen.«
»Soll das eine Drohung sein?« fragte der Gastwirt und schlug mit der flachen Hand auf den Tisch.
Andrea zuckte erschrocken zusammen. »Nein.« Sie schüttelte den Kopf.
»Dann ist es ja gut«, sagte er und griff nach dem Brot. »Ich meine, du solltest nie vergessen, was ich alles für dich getan habe und noch tu’. Die meisten meiner Kumpel können nicht verstehen, daß ich jemanden wie dir ein Zuhause gegeben habe.« Ein boshaftes Grinsen umhuschte seinen Mund. »Schau in den Spiegel und sage mir, ob es selbstverständlich ist, daß ich dich in meinem Haus dulde?«
»Ich weiß, daß ich keine Schönheit bin«, flüsterte Andrea und griff sich in ihre kinnlangen, dunklen Haare. Schon ihr Stiefvater hatte ihr ständig vorgeworfen, daß sie eine viel zu große Nase hatte und zu dick war. »Gebe ich mir nicht Mühe abzunehmen?«
»Davon habe ich noch nichts gemerkt«, meinte Herbert Freytag brutal. »Also, denk in Zukunft darüber nach, was du sagst. Es wäre für mich ein Einfaches, dich auf die Straße zu setzen und mir eine Frau zu suchen, die in jeder Beziehung mehr zu bieten hat.« Er griff in seine Hosentasche und zog eine abgenutzte Geldbörse heraus. »Wenn du meinst, daß du zum Arzt mußt, dann geh eben. Aber trödle nicht herum.« Mit einer verächtlichen Bewegung warf er einen Zwanzigmarkschein auf den Tisch. »Für den Bus und für die Apotheke, falls dir dein Doktor ein Rezept gibt. Das Restgeld bekomme ich zurück.«
»Danke, Herbert.« Andrea schenkte ihm ein demütiges Lächeln. Froh darüber, daß er sie zum Arzt gehen ließ und ihr sogar Geld für Bus und Apotheke gegeben hatte, dachte sie nicht mehr daran, wie sie von diesem Mann ausgenutzt wurde. Sie legte die Arme um seinen Nacken. »Ich werde mich beeilen«, versprach sie und küßte ihn.
»Schon gut, schon gut«, wehrte er ab, stand auf. »Ich fahre zur Brauerei. Es gibt was wegen der letzten Bierlieferung zu klären.«
Die junge Frau zog sich in aller Eile um. Viel Auswahl hatte sie nicht, doch sie wollte wenigstens sauber angezogen zum Arzt kommen. Flüchtig fuhr sie sich mit dem Kamm durch die Haare, griff nach ihrer Handtasche und verließ das Haus. Zur Bushaltestelle war es nicht weit. Wenn sie Glück hatte, erwischte sie noch den nächsten Bus.
Es war kurz vor elf, als Andrea die Praxis von Dr. Baumann betrat. Tina Martens blickte ihr freundlich entgegen. »Guten Morgen«, grüßte sie. »Haben Sie einen Termin?« Sie konnte sich nicht erinnern, diese Frau je zuvor gesehen zu haben.
»Nein, ich habe keinen Termin«, erwiderte Andrea Stanzl und nannte ihren Namen. »Ich bin auch bisher noch nicht bei Doktor Baumann in Behandlung gewesen. Ein Gast meines Freundes hat einmal seinen Namen erwähnt und gesagt, um was für einen guten Arzt es sich bei ihm handeln würde.«
So etwas hatte Tina schon oft gehört. »Haben Sie Beschwerden?« erkundigte sie sich.
»Ja, sehr starke Knieschmerzen.«
»Gut, setzen Sie sich bitte ins Wartezimmer. Allerdings wird es mindestens eine Stunde dauern, bis Sie an der Reihe sind, Frau Stanzl.« Tina lächelte ihr zu. »Haben Sie Ihr Versicherungskärtchen dabei?«
»Ja.« Andrea zog es aus der Handtasche. »Wo geht es zum Wartezimmer?«
Tina wies ihr den Weg, dann widmete sie sich dem Mann, der nach Andrea die Praxis betreten hatte, und fragte ihn, ob es ihm inzwischen wieder bessergehen würde.
»Meine Magenschmerzen sind fast verschwunden«, antwortete er strahlend. »Sieht aus, als könnte der Herr Doktor zaubern.«
Die junge Frau öffnete die Tür zum Wartezimmer. Sie murmelte einen undeutlichen Gruß und durchquerte mit gesenktem Kopf den Raum. Ohne aufzublicken nahm sie auf einem Stuhl Platz, der in der äußersten Ecke stand. Nahe der Tür saßen zwei sehr gut aussehende Männer, die sich leise miteinander unterhielten. Andrea war überzeugt, daß sie über sie sprachen.
Franziska Löbl betrat das Wartezimmer. Sie nickte den Patienten grüßend zu, dann ging sie zu einem älteren Mann und berührte dessen Arm.
»Bin ich an der Reihe?« fragte er und schaute auf.
Die junge Krankengymnastin nickte. Seit einem Unfall in ihrer Kindheit konnte sie nicht mehr sprechen, aber es war ihr mit Hilfe ihrer Familie gelungen, über dieses Handikap zu siegen. Die Patienten von Dr. Baumann hatten sich daran gewöhnt, daß sie sich mit ihnen nur schriftlich verständigen konnte. Es gab kaum einen unter ihnen, der sich daran störte.
Franziska schaute zu Andrea Stanzl hinüber. Ihr fiel auf, wie traurig und verloren die junge Frau wirkte. »Bitte, warten Sie einen Augenblick«, bat sie ihren Patienten schriftlich, nachdem sie ihn in den Behandlungsraum geführt hatte. Sie ging hinaus, um mit Dr. Baumann zu sprechen, der in der Aufnahme in einer Krankenkartei blätterte.
»Wartest du auf mich, Franziska?« fragte der Arzt, als er sich umdrehte und die Krankengymnastin hinter ihm stand.
Sie nickte.
»Dann komm.« Gemeinsam gingen sie in sein Sprechzimmer.
Franziska schrieb rasch etwas auf ihren Block und reichte ihn Eric.
»Du meinst also, ich sollte die junge Dame nicht so lange warten lassen«, sagte er. »Fragt sich nur, wann sie an der Reihe ist. Ohne zwingenden Grund kann ich nicht einfach einen Patienten den anderen vorziehen.«
Die Krankengymnastin griff erneut nach ihrem Stift. »Sie sieht aus, als würde alles Leid der Welt auf ihren Schultern lasten«, schrieb sie. »Ich habe nie zuvor einen Menschen kennengelernt, der auf mich so einen verlorenen Eindruck gemacht hätte.«
»Also gut, ich werde sehen, was ich machen kann«, versprach er. »Doch erst einmal muß ich mich bei Tina erkundigen, um wen es sich handelt.«
»Danke«, formte Franziska mit der Hand, winkte ihm zu und kehrte zu ihrem Patienten zurück. Sie sah noch, wie Eric zum Schreibtisch trat, um per Wechselsprecher Tina zu sich zu bitten.
Es überraschte Andrea Stanzl, daß sie bedeutend früher als erwartet aufgerufen wurde. Hastig griff sie nach ihrer Handtasche und trat in den Gang hinaus. Tina zeigte ihr, wo es zum Sprechzimmer ging.
Dr. Baumann kam ihr entgegen. Franziska hatte nicht übertrieben. Die junge Frau strahlte eine Traurigkeit aus, die auch sein Herz berührte. »Bitte, nehmen Sie Platz, Frau Stanzl«, bat er, nachdem er sie begrüßt hatte, und wies zu dem Stuhl, der seinem Schreibtisch gegenüberstand.
Andrea setzte sich auf die äußerste Kante des Stuhls. »Danke, daß Sie mich drannehmen, obwohl ich keinen Termin habe«, sagte sie und starrte auf ihre Hände.
»In dringenden Fällen ist das durchaus möglich«, erwiderte er. »Stammen Sie aus Tegernsee, Frau Stanzl?«
»Nein, ich komme aus München«, antwortete sie. »Ich lebe hier bei einem Freund. Er besitzt eine Gaststätte, nun ja, es handelt sich mehr um eine Kneipe. Ich helfe ihm bei der Arbeit.« Sie holte tief Luft. »Seit etwa vierzehn Tagen habe ich furchtbare Knieschmerzen. Manchmal kann ich vor Schmerzen nicht schlafen.«
Dr. Baumann nahm ein doppelseitiges Formular aus dem Schreibtisch. »Wenn ein Patient das erste Mal zu mir kommt, gibt es einige Fragen, die ich ihm stellen muß, damit ich mir ein Bild von ihm machen kann«, sagte er. »Es sind keine schlimmen Fragen, Sie können sie also unbesorgt beantworten.«
Andrea nickte. Sie gab ihm so gut sie konnte Auskunft. An ihre früheren Kinderkrankheiten erinnerte sie sich allerdings kaum, sie wußte nur noch, daß ihr Vater ständig geklagt hatte, daß man mit ihr nichts als Kummer und Sorgen hätte und sie ihn bestimmt ins frühe Grab bringen würde. »Mein Vater ist kurz vor seinem fünfunddreißigsten Geburtstag gestorben«, fügte sie hinzu.
»Ganz bestimmt nicht durch Ihre Schuld, Frau Stanzl«, meinte Dr. Baumann.
»Meine Mutter ist da anderer Ansicht gewesen und mein späterer Stiefvater ist auch der Meinung, daß man mich gleich nach meiner Geburt hätte ertränken müssen«, erwiderte Andrea. Wieder holte sie tief Luft. Sie spürte, daß sie Dr. Baumann vertrauen konnte. »Ich bin nie ein hübsches Kind gewesen, nicht einmal niedlich. Und jetzt sehe ich aus, als würde ich mich demnächst als Sumo-Ringer in Japan bewerben wollen. Kein Wunder, daß mich mein Stiefvater gleich nach dem Tod meiner Mutter auf die Straße gesetzt hat.«
»So etwas sollten Sie nicht einmal denken, Frau Stanzl.« Eric fragte sich empört, weshalb es manche Menschen darauf anlegen mußten, andere seelisch zu zerstören. »Sie sind nicht häßlich. Sie haben sogar ein hübsches Gesicht. Natürlich sollten Sie abnehmen. Wieviel wiegen Sie denn?«
»Fast hundert Kilo«, flüsterte die junge Frau. »Ich habe schon oft eine Schlankheitskur angefangen, sie jedoch nach kurzer Zeit jedesmal abgebrochen, weil ich mir gesagt habe, daß es ohnehin nichts nützen würde.«
»Wenn Sie wollen, werde ich Ihnen dabei helfen abzunehmen«, versprach Dr. Baumann. »Und vor allen Dingen wäre es auch für Ihre Gelenke wichtig.« Er stand auf, um ihr Knie zu untersuchen.
Andrea beobachtete ängstlich, wie er ihr Knie abtastete. »Ist es etwas Schlimmes?« fragte sie, als sie die Spannung nicht länger ertragen konnte.
»Es handelt sich vermutlich um eine Arthrose«, erwiderte der Arzt und setzte sich an den Schreibtisch. »Wir machen morgen früh eine Blutsenkung. Kommen Sie bitte nüchtern zwischen acht und halb neun in die Praxis. Außerdem muß Ihr Knie geröntgt werden.« Er griff nach einem Überweisungsschein.
»Ich kann morgen früh nicht weg«, stieß Andrea erschrocken hervor. »Mein Freund rastet aus, wenn ich ihm sage, daß ich schon wieder zum Arzt muß.«
»Wenn es sich bei Ihrem Freund um einen wirklichen Freund handelt, wird er einsehen, wie wichtig es ist, daß wir etwas gegen Ihre Schmerzen unternehmen«, meinte Eric bestimmt.
»Herbert ist ein Freund«, behauptete die junge Frau. »Er hat mich aufgenommen, als ich nicht wußte, wohin ich gehen soll. Sehen Sie, ich habe keine Arbeit. Meine Mutter ist sehr krank gewesen. Ich habe sie bis zu ihrem Tod gepflegt. Und danach stand ich auf der Straße. Wenn Herbert nicht gewesen wäre, würde ich heute…« Sie sprach nicht weiter.
»Woher kennen Sie diesen Herbert?«
»Als mein Vater noch lebte, sind unsere Eltern Nachbarn gewesen. Später habe ich Herbert einmal zufällig in der Stadt getroffen, und er hat mir erzählt, daß er vor zwei Jahren von seiner Tante eine Kneipe in Tegernsee geerbt hat. Nach dem Tod meiner Mutter habe ich ihn angerufen und gefragt, ob ich vorläufig bei ihm wohnen könnte. Er ist nach München gekommen und hat mich mitgenommen.« Andrea straffte die Schultern. »Ich habe meinem Freund sehr viel zu verdanken.« Sie stand auf. »Mit der Blutsenkung und dem Röntgen wird es schon klappen.«
»Es muß.« Dr. Baumann verabschiedete seine neue Patientin. Er hätte sich gern noch länger mit ihr unterhalten, um sich ein noch genaueres Bild von ihr und ihren Lebensumständen machen zu können, doch sein Wartezimmer war voll, und er wollte seine anderen Patienten nicht über Gebühr warten lassen. Nachdenklich kehrte er an seinen Schreibtisch zurück.
*
Melanie Berger hielt vor dem imposanten Portal des Hotels ›Luisenhof‹. Es lag außerhalb Tegernsees, nur durch die Straße nach Gmund vom Wasser getrennt. Sie war kaum ausgestiegen, als auch schon zwei Pagen auf sie zukamen. Während sich der eine um ihr Gepäck kümmerte, setzte sich der andere hinter das Steuer ihres Wagens, um ihn auf den Parkplatz zu fahren.
Die junge Frau folgte Pagen und Gepäck in die weitläufige Hotelhalle. Fasziniert schaute sie sich um. Es war ein Traum, es konnte nur ein Traum sein. Gleich würde sie erwachen und…
Der Page stellte die Koffer seitlich der Rezeption ab. Melanie riß sich zusammen. Was sollten denn die Leute von ihr denken, wenn sie so um sich schaute? Es mußte ja keiner wissen, wie lange sie gespart hatte, um in einem First-class-Hotel Urlaub machen zu können. Mit einem Lächeln nannte sie dem älteren Mann, der hinter der Rezeption stand, ihren Namen.
»Bitte, füllen Sie die Anmeldung aus, Frau Berger.« Der Portier schob einen Block über den Tresen.
Melanie griff nach dem goldfarbenen Kugelschreiber, den er ihr reichte. Während sie die Anmeldung ausfüllte und bewußt die Spalte »Beruf« ignorierte, ließ der Portier die Finger über die Tastatur seines Computers gleiten.
»Sie haben Zimmer zweihundertzehn, Frau Berger«, sagte er freundlich. »Wenn Sie noch Fragen haben, Sie können sich jederzeit an mich wenden. Herzlich willkommen im Luisenhof.« Er reichte dem Pagen ihren Schlüssel.
»Danke.« Melanie schenkte ihm ein Lächeln, dann folgte sie dem jungen Mann zum Aufzug.
Ihr Zimmer lag im zweiten Stock des Hauses und bot einen wundervollen Blick auf den Tegernsee. Es besaß einen geräumigen Balkon mit einem weißen Tisch, zwei bequemen Stühlen und einem Sonnenschirm.
Melanie atmete tief den Duft der Geranien ein, die rund um die Brüstung in grünen Kästen wuchsen. Sie fühlte sich wie verzaubert. Nie zuvor in ihrem Leben hatte sie in so einem Hotel gewohnt. Es erschien ihr wie eines der Märchenschlösser, von denen sie als Kind gelesen hatte.
Die junge Frau kehrte ins Zimmer zurück, weil ihr plötzlich schwindlig wurde. Kaum hatte sie sich jedoch auf das breite Bett gesetzt, sprang sie auf und lief ins Bad, um Wasser zu trinken. In letzter Zeit litt sie an regelrechten Durstanfällen.
Als sie den Wasserhahn zudrehte, fiel ihr ein, daß es in ihrem Zimmer eine Minibar gab, allerdings hatte sie nicht vor, sie oft in Anspruch zu nehmen. Keiner würde merken, wenn sie sich in der Stadt etwas zu trinken kaufte und es mit aufs Zimmer nahm. Außerdem hatte sie wohlweislich einen kleinen Wasserkocher mitgebracht, um sich ab und zu Tee oder Kaffee aufzubrühen.
Melanie beschloß, erst einmal ihre beiden Koffer auszupacken, bevor sie das Hotel erkundete. Aus dem Prospekt wußte sie, daß es ein Hallenbad mit Sauna, Sonnenbank und Massageraum gab, zudem draußen im Garten einen großen Swimmingpool und einen Tennisplatz. Außerdem gehörte ein Reitstall zum Luisenhof, und man konnte Motor- und Segelboote mieten.
Äußern Sie einen Wunsch, und wir werden ihn erfüllen, hatte im Prospekt gestanden. Man sollte die Probe aufs Exempel machen, dachte die junge Frau, sagte sich dann jedoch, daß das sehr teuer werden konnte und es wohl besser sein würde, darauf zu verzichten.
Melanie verbrachte die nächsten Stunden damit, durch die Anlagen des Hotels zu streifen, etwas am Wasser zu sitzen und dem Treiben auf dem See zuzuschauen. Später stattete sie den kleinen Läden im hinteren Teil des Foyers einen Besuch ab, kaufte jedoch nur ein paar Ansichtskarten. Nachdem sie noch einen Blick in die Schwimmhalle geworfen hatte, suchte sie wieder ihr Zimmer auf, um sich für das Abendessen zurechtzumachen.
Die junge Frau hatte nicht nur lange für ihren Aufenthalt im »Luisenhof« gespart, sondern auch für die dementsprechende Kleidung. Als sie kurz vor halb acht den Speisesaal betrat, unterschied sie sich nicht von den anderen weiblichen Gästen. Sicheres Auftreten und gutes Benehmen hatte sie bei den Seminaren gelernt, die sie im Auftrag der Versicherung, für die sie arbeitete, von Zeit zu Zeit geben mußte. Außerdem wußte sie, daß sie gut aussah. Wenn sich die Männer nach ihr umdrehten, so lag das bestimmt nicht daran, daß sie glaubten,
sie würde nicht hierher gehören.
Ein Ober brachte sie zu einem Tisch, an dem bereits eine ältere Dame saß. Es fiel Melanie nicht schwer, mit ihr ins Gespräch zu kommen, und sie erfuhr, daß Frau Merkle bereits seit Jahren jeden Sommer für einige Wochen im »Luisenhof« abstieg.
»Es ist vor allem die Atmosphäre, die mir hier gefällt«, sagte sie, nachdem sie sich einander vorgestellt hatten. »Außerdem bin ich mit den Besitzern locker befreundet. Als ich das erste Mal in den Luisenhof kam, lebte mein Mann noch, und Gerhard Thomson hatte das Hotel gerade von seinem Vater übernommen. Sein Sohn Jörg ist damals erst sechs gewesen. Seitdem sind einundzwanzig Jahre vergangen. Jörg Thomson hat mit Erfolg die Hotelfachschule abgeschlossen und ist die rechte Hand seines Vaters geworden. Ein wirklich netter, junger Mann.«
»Ist er schon verheiratet?« fragte Melanie ohne Hintergedanken.
»Nein, bis jetzt scheint die Richtige für ihn noch nicht gekommen zu sein«, antwortete Frau Merkle. Sie stand auf, um sich am Büfett noch eine zweite Portion Salat zu holen.
Nach dem ausgezeichneten Essen verließ Melanie das Hotel, um ein Stückchen am See spazierenzugehen. Aber schon nach wenigen Schritten mußte sie sich hinsetzen, weil sie plötzlich eine so bleierne Müdigkeit spürte, daß sie sich am liebsten ins Gras gelegt und geschlafen hätte. Außerdem hatte sie schon wieder Durst. Sie mußte über sich selbst lachen, als sie plötzlich überlegte, ob man das Seewasser trinken könnte.«
Die junge Frau wartete, bis der Müdigkeitsanfall vorüber war, was immer nur ein paar Minuten dauerte, dann kehrte sie ins Hotel zurück. Sie fuhr mit dem Aufzug zu ihrem Zimmer hinauf, trank ein Fläschchen Mineralwasser aus der Minibar und suchte noch einmal das Bad auf. Nach einem prüfenden Blick in den Spiegel verließ sie das Zimmer und stieg die Treppe zum Foyer hinunter, wo an diesem Abend ein Gesangsduo auftreten sollte.
Melanie war früh genug im Foyer, um einen guten Platz zu bekommen. Sie bestellte eine Flasche Mineralwasser und eine Cola. Früher hatte sie nie soviel getrunken. Vielleicht sollte ich doch einmal zum Arzt gehen, überlegte sie, schob diesen Gedanken aber gleich wieder beiseite. Ihr fehlte nichts! Alles, was sie brauchte, waren Ruhe und Entspannung.
Die beiden Sänger, die auftraten, kannte die junge Frau bereits aus dem Radio. Sie hatte ihren Liedern nie besondere Beachtung geschenkt, doch an diesem Abend gelang es ihnen, sie völlig zu fesseln. Hingerissen lauschte sie jedem ihrer Worte und war enttäuscht, als eine Pause angesagt wurde und die hauseigene Kapelle Tanzmusik spielte.
»Darf ich bitten?«
Melanie zuckte zusammen. Sie hatte für ein paar Minuten nicht auf ihre Umgebung geachtet, sondern nur vor sich hin geträumt. Als sie aufblickte, sah sie einen dunkelhaarigen Mann vor sich stehen, dessen markante Gesichtszüge sie an Harrison Ford erinnerten. »Gern«, sagte sie, schob ihren Sessel zurück und folgte ihm zur Tanzfläche.
Die Kapelle spielte »The time of my life«, ein Stück, das Melanie besonders mochte. Sie lag so leicht in den Armen ihres Tanzpartners, daß sie vermeinte zu fliegen.
»Wie gefällt es Ihnen im Luisenhof, Frau Berger?« erkundigte sich der junge Mann und lachte über ihr verblüfftes Gesicht. »Ich habe Sie bis heute abend noch nie gesehen, deshalb habe ich mich an der Rezeption erkundigt, wer Sie sind«, gestand er.
»Und man hat Ihnen so einfach Auskunft gegeben?« fragte Melanie verblüfft.
»Dem guten Herrn Fischer blieb nichts anderes übrig«, erklärte ihr Tanzpartner. »Ich bin sozusagen sein Chef.«
»In diesem Fall müßten Sie Jörg Thomson sein.«
»Ja.« Er nickte. »Da mein Vater um dreißig Jahre älter ist, kann man uns nicht verwechseln.«
»Mir gefällt es sehr gut in Ihrem Hotel«, gab sie zu und fügte hinzu: »Da Sie ungehinderten Zugang zum Hotelcomputer haben, wissen Sie vermutlich auch, daß ich aus Stuttgart komme.«
»Ja.« Er grinste. »Es ist sehr schwer, etwas vor mir zu verbergen.«
Sekundenlang fühlte sich Melanie ertappt, dann sagte sie sich, daß er seine Bemerkung bestimmt ohne Hintergedanken gemacht hatte. Außerdem tat sie nichts Unrechtes. Schließlich zahlte sie für ihren Aufenthalt im Luisenhof. Daß sie jahrelang dafür gespart hatte, ging niemand etwas an. Auch nicht Jörg Thomson!
Die Musik endete. Jörg lud sie zu einem Glas Wein an die Bar ein. Als er ganz einfach ihren Arm nahm und sie durch das Foyer führte, folgten ihnen mehr als nur ein Blick. Die Männer beneideten ihn um die junge Frau an seiner Seite, und die Frauen wären gern selbst an ihrer Stelle gewesen. Manch eine von ihnen hatte schon tagelang vergeblich versucht, den jungen Hotelier für sich zu interessieren.
»Trinken wir auf Ihren Aufenthalt.« Jörg hob sein Glas. »Darauf und daß Sie mir gestatten, Ihnen in den nächsten Tagen die Gegend zu zeigen.«
»Haben Sie denn soviel Zeit?« fragte Melanie. Auch wenn sie Jörg Thomson überaus charmant und nett fand, sie war sich nicht sicher, ob sie ihm auch trauen durfte. Sie nahm an, daß es ihm die meisten Frauen leicht machten, sie zu erobern.
»Ich werde sie mir nehmen«, antwortete er.
»Zeigen Sie allen Gästen die Umgebung?«
»Nein«, gab er unumwunden zu. »Man hat mir schon sehr früh beigebracht, Arbeit und Privatleben zu trennen. Doch manchmal… Bitte, geben Sie Ihrem Herzen einen Stoß. Ich bin der perfekte Fremdenführer.«
»Also gut«, sagte Melanie. »Ich bin einverstanden.« Sie stieß mit ihrem Glas leicht gegen seines. »Sie sollten sich gut vorbereiten. Wenn ich irgendwo bin, interessieren mich die Sehenswürdigkeiten nicht nur am Rande, sondern ich möchte auch einiges über Hintergründe und Geschichte wissen.«
»Sie werden mit mir zufrieden sein«, versprach er und blickte ihr in die Augen. »Sehr zufrieden sogar.«
*
Melissa und Sabrina Seitter lehnten ihre Fahrräder an die Hauswand des Doktorhauses und betraten die Praxis. Tina Martens schaute den beiden Siebenjährigen überrascht entgegen. Die Kinder hatten keinen Termin, außerdem waren sie bisher stets in Begleitung ihrer Großmutter gekommen. »Wo ist denn eure Oma?« erkundigte sie sich, nachdem sich die Tür hinter den Mädchen geschlossen hatte.
»Unsere Oma ist zu Hause«, erwiderte Sabrina, die mutigere der Zwillinge. »Wir müssen ganz dringend den Onkel Doktor sprechen. Es geht um einen Patienten.«
»Und um was für einen Patienten?« fragte Tina belustigt. Sie erwartete, daß Melissa einen Hamster aus dem bunten Beutel, den sie bei sich trug, zaubern würde. Manchmal kam es vor, daß Kinder ihre Tiere brachten und hofften, hier Hilfe für sie zu finden.
»Unser Tamagotchi ist krank«, wisperte Melissa. »Unsere Oma kann ihm nicht helfen und der Opa will es sich erst gar nicht anschauen.«
»Als wir unserem Opa gesagt haben, daß das Tamagotchi krank ist, hat er nur geschimpft und gemeint, wir sollten ihn mit diesem Unsinn in Ruhe lassen«, fügte ihre Schwester hinzu. »Oma sei verrückt, für so einen Mist Geld auszugeben.«
Etwas anderes hatte Tina von Heinz Seitter nicht erwartet. Trotzdem mußte sie sich beherrschen, um nicht zu lachen. Mit einem Tamagotchi war bisher noch keiner zu Dr. Baumann gekommen.
»Wird uns der Onkel Doktor helfen?« fragte Sabrina. Sie hatte Tränen in den Augen. »Wir haben es so lieb.«
Tina brachte es nicht fertig, die Kinder einfach abzuweisen, zudem war an diesem Vormittag ohnehin nicht viel los. Drei Patienten hatten abgesagt, weil ihnen andere Termine dazwischengekommen waren. »Setzt euch ins Wartezimmer«, bat sie und hoffte, daß Dr. Baumann oder Franziska Löbl etwas von Tamagotchis verstanden.
Andrea Stanzl betrat die Praxis. »Guten Morgen«, sagte sie und bemühte sich, ihrer Stimme einen festen Klang zu geben. Sie war völlig erschöpft und hatte starke Schmerzen in ihrem kranken Knie. »Ich habe einen Termin.«
»Fein, daß Sie so früh kommen.« Die Sprechstundenhilfe lächelte ihr zu. »Es wird nur ein paar Minuten dauern. Sie können so lange dort Platz nehmen.« Sie wies auf eine gepolsterte Bank, die seitlich des Aufnahmetresens stand, und griff nach Andreas Krankenakte, um sie ins Sprechzimmer zu bringen. Dr. Baumann und Franziska sprachen gerade über die Behandlung einer älteren Frau, die seit Jahren an einem Halswirbelsyndrom litt. Tina sagte ihm, daß außer Andrea Stanzl auch die Seitter-Zwillinge mit ihrem Tamagotchi auf ihn warteten.
»Kennt sich einer von euch mit Tamagotchis aus?« fragte Eric amüsiert. »Ehrlich, ich habe bis jetzt noch keines in den Händen gehalten.«
»Ich kenne mich aus«, schrieb Franziska. »Einer meiner kleinen Patienten hat mir erst vor wenigen Tagen sein Tamagotchi erklärt.«
»Fein, dann ist das ein Fall für dich«, erklärte der Arzt grinsend. »Schicken Sie die Kinder bitte herein, Tina. Wir haben ein williges Opfer gefunden.«
Melissa und Sabrina war es ziemlich beklommen zumute, als sie allein ins Sprechzimmer kamen. Ohne ihre Oma fühlten sie sich alles andere als wohl in ihrer Haut.
»Wissen eure Großeltern, wo ihr seid?« erkundigte sich Dr. Baumann, nachdem er die Kinder begrüßt hatte.
Sie schüttelte den Kopf. »Sie hätten uns bestimmt verboten, mit dem Tamagotchi zu dir zu gehen, Onkel Doktor«, meinte Sabrina. »Aber einer muß ihm ja helfen, sonst stirbt es.«
»Franziska ist Spezialist auf dem Gebiet der Tamagotchis«, behauptete Eric und zwinkerte der jungen Krankengymnastin zu. »Zeigt es ihr, sie wird ihm bestimmt helfen können.«
»Sind Sie auch ein Doktor?« erkundigte sich Melissa.
»Franziska ist Krankengymnastin«, erklärte Dr. Baumann und sagte den Kindern, daß die junge Frau nicht sprechen konnte, weil sie als kleines Mädchen einen Autounfall gehabt hatte.
»Das ist bestimmt sehr schlimm«, meinte Sabrina.
»Ich habe mich daran gewöhnt«, schrieb Franziska. »Und nun werde ich mal sehen, was ich für euer Tamagotchi tun kann.«
Melissa nahm es vorsichtig aus ihrem Beutel und legte es der jungen Frau so behutsam in die Hände, als würde es sich nicht um ein Spiel, sondern um ein richtiges Tier handeln.
»Ich werde eure Großeltern anrufen und ihnen sagen, daß ihr bei mir seid.« Dr. Baumann griff zum Telefonhörer.
»Hoffentlich ist unsere Oma am Apparat«, sagte Sabrina und zog unwillkürlich die Schultern zusammen.
Aber es war nicht Sabine Seitter, die den Anruf entgegennahm, sondern ihr Mann. »Was gibt es denn, Doktor Baumann?« fragte er überrascht, als sich der Arzt meldete.
»Ich nehme an, Sie haben Ihre Enkelinnen bereits vermißt«, meinte Eric.
»Ja, meine Frau sucht nach ihnen«, antwortete der Steuerinspektor a. D. »Sind die beiden etwa bei Ihnen? – Weshalb? Ich…«
»Sie sind sozusagen mit einem Notfall zu mir gekommen«, fiel ihm der Arzt ins Wort und sprach von dem Tamagotchi.
»Ich werde dafür sorgen, daß so etwas nie wieder vorkommt«, drohte Heinz Seitter. »Sobald meine Frau zurück ist, wird sie die Kinder abholen. Ich kann leider im Moment nicht weg, weil ich einem Nachbarn bei seiner Steuererklärung helfe. Wäre es möglich, daß die Kinder im Wartezimmer…«
»Meine Haushälterin wird sich um Ihre Enkelinnen kümmern. Sie hat Kinder sehr gern.«
»Sie soll den Kindern auf keinen Fall Süßigkeiten geben, das haben sie nicht verdient«, erwiderte Heinz Seitter. »Und was das Tamagotchi betrifft, so…«
»So werden Sie Gnade vor Recht ergehen lassen, Herr Seitter«, verlangte Eric. »Für die Kinder ist es tatsächlich ein Notfall gewesen.«
»Gut, ich werde es ihnen nicht fortnehmen, obwohl ich nicht verstehen kann, weshalb meine Frau so dumm gewesen ist, ihnen so etwas Irrsinniges zu kaufen. Aber Vernunft und Frauen…« Er seufzte auf. »Auf jeden Fall danke, Doktor Baumann.«
»Schon gut«, meinte der Arzt und legte auf.
Sabrina wandte sich ihm zu. »Wir bekommen bestimmt Stubenarrest für die nächsten vier Wochen«, vermutete sie.
»Dafür ist unser Tamagotchi wieder gesund.« Melissa strahlte. »Danke, Franziska.« Sie stellte sich auf Zehenspitzen und küßte die junge Frau auf die Wange.
Während Franziska die Zwillinge zu Katharina Wittenberg hinüberbrachte, bat Dr. Baumann
seine Sprechstundenhilfe, Frau Stanzl aufzurufen. Ihr war leider nicht so schnell zu helfen wie dem Tamagotchi der Seitter-Zwillinge.
Als Andrea wenig später das Sprechzimmer betrat, bemerkte er auf den ersten Blick, wie schlecht es ihr ging. Das Gesicht der jungen Frau wirkte fahl, unter ihren Augen lagen tiefe Schatten. Vermutlich hatte sie in der Nacht wieder nicht schlafen können.
»Es war eine fürchterliche Nacht«, bestätigte Andrea, als er sie danach fragte. »Außerdem hatte ich Krach mit meinem Freund.« Sie hob die Schultern. »Im Grunde genommen kann ich ihn sogar verstehen. Herbert verläßt sich darauf, daß ich ihm den Haushalt führe und in der Kneipe helfe. Eine Frau, die ständig zum Arzt rennen muß, nervt jeden Mann. Er hat mir heute morgen nicht einmal das Busgeld gegeben. Zum Glück spare ich mir immer das Trinkgeld, das mir manchmal von einem Gast zugesteckt wird.«
»Mit anderen Worten, Herr Freytag gibt Ihnen für Ihre Arbeit keinen Pfennig«, sagte Eric perplex.
»Er zahlt mir meine Krankenversicherung«, erwiderte Andrea. »Außerdem wohne ich bei ihm umsonst und habe auch mein Essen.« Sie starrte auf ihre Hände.
»Und Ihnen ist nie der Gedanke gekommen, daß Herr Freytag Sie ausnutzt?« fragte der Arzt. »Sie arbeiten weit mehr, als Sie für Wohnung und Essen bezahlen müßten. Herr Freytag spart durch Sie eine ganze Menge. Eine Haushälterin oder jemand für die Kneipe würden ihm bedeutend mehr kosten, als Sie in einem ganzen Monat essen können.«
»Mag sein, doch wo soll ich hin?« fragte die junge Frau verzweifelt. »Wer gibt mir denn schon eine Arbeit? So wie ich aussehe, kann ich nicht einmal bei der Müllabfuhr landen.« Sie fuhr sich nervös durch die Haare. »Natürlich, ich könnte zum Arbeitsamt gehen und mich arbeitslos melden, nur, ich werde kaum soviel Geld bekommen, daß ich davon meinen Lebensunterhalt und die Miete für ein Zimmer bestreiten könnte. Ich bin niemals arbeiten gegangen. Gleich nach der Realschule habe ich für meine kranke Mutter sorgen müssen.«
»Frau Stanzl, wenn Sie den Mut aufbringen, Herrn Freytag zu verlassen und Ihr Leben in eigene Hände zu nehmen, dann wird sich schon alles finden.« Eric sah sie beschwörend an. »Ich bin bereit, Ihnen dabei zu helfen. Durch meinen Beruf kenne ich sehr viele Leute, und ich bin überzeugt, daß ich…«
Andrea schüttelte den Kopf. »Und wer sagt, daß ich es schaffen werde? Bei meinem Freund weiß ich, woran ich bin, mit völlig fremden Leuten würde ich bestimmt nicht zurechtkommen.«
»Dr. Baumann erkannte, daß Andrea noch nicht soweit war, sich von diesem Mann zu lösen. Jedenfalls wollte er das Seine dazu beitragen, ihr mehr Selbstwertgefühl zu geben. Aber so etwas ging natürlich nicht von heute auf morgen. Er ahnte schon jetzt, daß er sehr viel Geduld aufbringen mußte, um ihr nicht nur physisch zu helfen.
»Wie ich vermutet habe, handelt es sich bei Ihren Knieschmerzen um eine Arthrose«, sagte er. »Leider befindet sie sich nicht mehr im Anfangsstadium. Ich nehme an, daß Sie die ersten Beschwerden ganz einfach nicht wichtig genommen haben.«
»Mag sein«, gab seine neue Patientin zu. »Bei mir zu Hause hat nie jemand danach gefragt, wie es mir geht. Wenn ich mal Schmerzen hatte, habe ich versucht, sie zu ignorieren. Geholfen hätte mir sowieso keiner.«
Der Arzt zählte in Gedanken bis zehn, um sich seinen Ärger und Zorn auf Andreas Eltern und ihren späteren Stiefvater nicht anmerken zu lassen. Er sprach mit ihr darüber, daß er ihr gegen die Schmerzen mit Spritzen helfen konnte, sie allerdings auch eine ganze Menge tun mußte, um die Arthrose zum Stillstand zu bringen. »Das A und O Ihrer Behandlung ist eine Reduzierung Ihres Gewichtes«, sagte er eindringlich. »Ihre Beine müssen entlastet werden, wenn Sie nicht schon in jungen Jahren am Stock gehen wollen.«
»Ich werde alles tun, was Sie für richtig halten«, versprach die junge Frau und fügte leise hinzu: »Jedenfalls in dieser Beziehung.«
»Im Moment reicht mir das«, erwiderte Dr. Baumann und stand auf, um die Injektion vorzubereiten.
*
Seit ihrer Ankunft im »Luisenhof« erschien Melanie Berger das Leben wie ein Traum. Ihr Aufenthalt in diesem Hotel übertraf alles, was sie bisher erlebt hatte. Sie fühlte sich wie eine Prinzessin. Schon wenn sie frühmorgens zum Frühstück auf die Terrasse kam, schienen die Angestellten nur darauf zu warten, ihre Wünsche zu erfüllen. Manchmal fiel es ihr schwer, nicht zu zeigen, daß es für sie keineswegs selbstverständlich war, den Stuhl zurechtgerückt zu bekommen oder daß man vorauseilte, um ihr die Tür zu öffnen. Am schönsten war es jedoch für sie, daß sich Jörg Thomson soviel Zeit für sie nahm. Während der ganzen Woche war kaum ein Tag vergangen, an dem sie nicht mehrere Stunden miteinander verbracht hätten.
Die junge Frau saß auf der Terrasse beim Mittagessen. Viel Appetit hatte sie nicht. Sie schob es auf das reichliche Frühstück, weil sie sich nicht eingestehen wollte, daß irgend etwas mit ihr nicht stimmte.
Jörg ging quer über die Terrasse auf Melanie zu. »Guten Appetit«, wünschte er. »Darf ich mich für einen Moment zu Ihnen setzen?«
»Gern.« Melanie wies auf den Stuhl ihr gegenüber.
»Wie haben Sie den Vormittag verbracht?« erkundigte er sich und nickte grüßend zu einem älteren Ehepaar hinüber.
»Im Wasser«, erwiderte sie. »Heute nachmittag mache ich einen Stadtbummel.« Sie schenkte ihm ein Lächeln. »Wenn Sie Zeit hätten, könnten Sie mitkommen.«
»Leider habe ich keine Zeit«, erwiderte er bedauernd. »Aber ich wollte Sie fragen, ob Sie Lust hätten, mich heute abend ins Seeschlößchen nach Bad Wiessee zu begleiten. Dort findet ein Talentwettbewerb statt. Das ist immer ganz amüsant.«
»Nehmen Sie auch daran teil?« scherzte Melanie und machte sich erst gar nicht die Mühe, vor ihm zu verbergen, wie sehr sie sich über die Einladung freute.
»Nein.« Er schüttelte den Kopf. »Das Hotel gehört dem Vater eines Freundes. Ich bin überzeugt, der Wettbewerb wird Ihnen gefallen.«
»Ich komme gern mit«, sagte die junge Frau.
»Fein.« Jörg berührte flüchtig ihre Hand. »Dann bis heute abend.« Er stand auf. »Warten Sie bitte um acht im Foyer auf mich. Die Veranstaltung beginnt um neun.«
Melanie schaute ihm nach, bis sie ihn nicht mehr sehen konnte. Sie wußte, es würde ein wundervoller Abend werden. Noch immer träumte sie nachts davon, wie sie an ihrem Ankunftsabend miteinander getanzt hatten. Ob sich Jörg in sie verliebt hatte? Sie selbst war sich jedenfalls sicher, daß er ihr von Tag zu Tag wichtiger wurde. Nur, wenn er sich in sie verliebt hatte, wie sollte es weitergehen? Irgendwann würde sie ihm sagen müssen, daß sie nicht vermögend war und daß sie sehr lange für ihren Aufenthalt in diesem Hotel gespart hatte. – Würde er überhaupt dafür Verständnis haben? Es gab sicher viele Leute, die es irrsinnig finden würden, so das Geld herauszuschmeißen.
Der Nachmittag schien sich endlos hinzuziehen. Melanie kehrte schon bald aus der Stadt zurück. Außerdem fühlte sie sich nicht besonders wohl, was sie auf das heiße Wetter schob. Kaum war sie in ihrem Zimmer, trank sie mehrere Gläser Mineralwasser und legte sich dann hin.
Als die junge Frau in einem ihrer schönsten Kleider kurz vor acht ins Foyer kam, spürte sie die Blicke, die ihr folgten. Während der letzten Tage war sie schon oft von anderen Männern eingeladen worden, doch sie hatte sich nicht darauf eingelassen. Sie haßte Komplikationen, und ihr stand nicht der Sinn danach, einen Mann gegen den anderen auszuspielen.
Jörg kam mit langen Schritten auf sie zu. »Sie sehen wie eine Million Dollar aus«, bemerkte er scherzend.
»Enttäuscht, wenn es keine Million ist?« fragte sie, während ihr Herz schmerzhaft bis zum Hals hinauf schlug.
»Nein, warum auch? Geld ist nicht wichtig.« Er nahm fürsorglich ihren Arm. »Hoffentlich wird es Ihnen im Seeschlößchen nicht so gut gefallen, daß Sie morgen das Hotel wechseln.«
»Und wenn es der Buckingham-Palast wäre, ich würde nicht tauschen«, erwiderte Melanie.
Er lachte. »Also gegen den Buckingham-Palast würde ich unser Hotel auch nicht eintauschen. Dort soll es ziemlich ungemütlich sein.«
Sie gingen zu seinem Sportwagen, der unweit des Hotels in der Auffahrt stand. Zuvorkommend öffnete er für sie die Tür. Melanie setzte sich in den Wagen. Sorgfältig achtete sie darauf, daß der seidige Rock ihres Kleides keine Falten bekam.
Jörg nahm neben ihr Platz. »Sie werden meinen Freund mögen«, sagte er. »Wir kennen uns seit unserer frühesten Kindheit und haben später auch gemeinsam die Hotelfachschule besucht. Fabian ist nur ein Jahr älter als ich. Er ist mit einer bezaubernden jungen Frau verlobt. Sie haben sich kennengelernt, als sie im Seeschlößchen als Sekretärin eingestellt wurde.«
»Also kommt es nicht nur im Roman vor, daß Sekretärin und Chef heiraten?«
»Es dürfte relativ häufig sein.« Jörg wies auf den mit bunten Lämpchen geschmückten Dampfer, der auf einen der Anlegestegs zuhielt. »Eine Fahrt mit der »Seemarie« sollten wir auch noch machen«, meinte er. »Es würde Ihnen bestimmt gefallen.«
»Ja, das glaube ich auch«, sagte Melanie verträumt. Von Deck des Schiffes klang leise Musik zu ihnen herüber. Die Melodie begleitete sie noch, als sie die »Seemarie« längst hinter sich gelassen hatten.
Sie passierten die letzten Häuser von Gmund und fuhren am Wasser entlang in Richtung Bad Wiessee. Seitlich der Straße stand ein buntes Hinweisschild. Als sie ihm folgten, erreichten sie kurz darauf ein offenes Tor, das in einen weitläufigen Park führte, dessen Mittelpunkt das »Seeschlößchen« bildete.
Arm in Arm betraten die jungen Leute das Foyer des Hotels. Jörg führte seine Begleiterin einige Stufen zu dem Saal hinunter, in dem der Talentwettbewerb stattfinden sollte. Es herrschte eine ausgelassene Stimmung. Ein Großteil der Sessel, die sich um kleine Tische gruppierten, war bereits besetzt.
»Unsere Plätze sind reserviert«, sagte der junge Hotelier und steuerte mit Melanie eine Sitzgruppe in der Nähe der Bühne an. »Sehen Sie!« Er wies auf ein kleines Schildchen, das an einer Vase mit herrlich duftenden Rosen lehnte. Schwungvoll drehte er es herum.
Sie hatten kaum Platz genommen, als auch bereits eine Kellnerin kam und sich nach ihren Wünschen erkundigte. Jörg bestellte zwei Cappuccino und fragte Melanie, ob sie Lust auf ein Stückchen Kuchen hatte.
»Nein, danke.« Sie schüttelte den Kopf. »Wenn ich in Ihrem Hotel weiter so gemästet werde, kann…«
Ein junger Mann und eine sehr hübsche Frau in einem bodenlangen, dunklen Kleid kamen auf sie zu. Jörg stand auf. Er machte Melanie mit Fabian Lindenmaier und dessen Verlobten Corinna Dillmann bekannt.
»Wie schön, Sie endlich kennenzulernen«, meinte Fabian zu Melanie.
»Endlich?« Die junge Frau hob die Augenbrauen.
»Ich muß wohl ein- oder zweimal von Ihnen gesprochen haben, als ich mit meinem Freund telefonierte«, meinte Jörg schmunzelnd. Er drohte Fabian mit dem Finger. »Paß nur auf, daß ich Corinna nicht über dich aufkläre.«
»Jörg, ich bin ganz Ohr«, scherzte Corinna. »Männer«, bemerkte sie zu Melanie. »Ganz schlimm ist es, wenn sie Freunde sind und wie Pech und Schwefel gegen die übrige Welt zusammenhalten.«
»Nicht hinhören, Frau Berger«, warnte Jörg.
»Frau Berger?« Fabian hob die Augenbrauen. »Also ich bestehe darauf, daß wir einen etwas leichteren Ton anschlagen und alle du zueinander sagen.«
»Warum nicht, wenn Herr Thomson auch damit einverstanden ist?« fragte Melanie.
»Ich bin sofort damit einverstanden«, beeilte sich Jörg zu antworten. Er war froh, daß sein Freund auf diese Idee gekommen war. In Gedanken hatte er zu Melanie längst »du« gesagt.
Fabian bat die Kellnerin, eine Flasche Sekt und Gläser zu bringen. Gemeinsam stießen sie aufeinander an.
Dann begann der Wettbewerb, und Fabian mußte auf die Bühne, weil er an diesem Abend moderierte. Die Hobbykünstler, die er ansagte, erwiesen sich als ausgesprochene Talente. Unter ihnen befanden sich Tänzer, Jongleure, Akrobaten, vor allem jedoch Sänger und Sängerinnen.
Nach einer Stunde gab es eine Pause. Melanie ließ sich von Corinna Dillmann den Weg zum Waschraum zeigen, weil sie sich etwas frisch machen wollte. Jörg trank unterdessen mit seinem Freund an der Bar einen Espresso.
»Deine Melanie gefällt mir«, meinte Fabian. »Paß nur auf, daß ich sie dir nicht ausspanne.«
»Abgesehen davon, daß du nicht ihr Typ bist, würde es schon Corinna nicht zulassen«, erwiderte sein Freund.
»Hat sie dir gesagt, daß ich nicht ihr Typ bin?«
»Nein, aber ich bin davon überzeugt.« Jörg starrte in seine Espressotasse. »Mein Vater mag Melanie nicht. Er glaubt, daß irgend etwas mit ihr nicht stimmen würde«, sagte er leise. »Erst heute abend hat er mich wieder vor ihr gewarnt.«
»Inwiefern sollte mit ihr etwas nicht stimmen?« Fabian stellte seine Tasse auf den Tresen. »Auf mich macht Melanie einen ausgezeichneten Eindruck.«
»Mein Vater hört manchmal Flöhe husten.« Jörg stieß heftig den Atem aus. »Stell dir vor, er wollte tatsächlich eine Auskunftei über Melanie einholen lassen. Zum Glück konnte ich ihm das ausreden. Er mußte mir versprechen, es nicht zu tun.«
»Anscheinend glaubt dein alter Herr, daß es dich endlich erwischt hat.«
»Ich würde sagen, Amors Pfeil hat mitten ins Herz getroffen. Andererseits kennen wir uns erst eine Woche. Ich finde Melanie zauberhaft, was noch lange nicht heißen muß, daß wir auch zueinander passen. Vielleicht bin ich für sie nur ein Urlaubsflirt. Ein Mädchen wie Melanie könnte an jedem Finger zehn Freunde haben.«
»Ja, das ist wahr. Es sollte dir zu denken geben, daß es nicht so ist. Sie scheint dich sehr gern zu haben.«
»Das reicht mir nicht.«
»Sei nicht so ungeduldig«, meinte Fabian lachend. Er schaute auf seine Uhr. »Für mich wird es Zeit. Die Pflicht ruft.«
Der Talentwettbewerb dauerte bis kurz nach elf. Gewinner wurde ein junges Paar, das mit einem Lied aus »Miss Saigon« teilgenommen hatte. Sie waren mit Abstand die besten gewesen und hatten ihren Preis, ein kostenloses Wochenende im »Seeschlößchen«, durchaus verdient.
Nach dem Talentwettbewerb wurde getanzt. Melanie und Jörg beschlossen, sich aber erst einmal unten am See noch etwas die Füße zu vertreten. Sie brauchten ein paar ruhige Minuten, bevor sie sich in den Trubel stürzten.
»Hoffentlich fühlst du dich nicht überrumpelt«, meinte Jörg, als sie Arm in Arm am Wasser entlanggingen.
»Weshalb überrumpelt?« Sie blieb stehen und wandte ihm ihr Gesicht zu. Das Mondlicht zauberte auf ihre Haare einen silbrigen Schein. Es wirkte, als seien Perlen in ihnen eingeflochten worden.
»Nun, ich meine mit dem Du. Es kam ziemlich plötzlich. Wenn…«
»Nein, ich fühle mich nicht überrumpelt.« Die junge Frau blickte nach unten. Ein schwarzer Kater strich um ihre Beine. Als er bemerkte, daß sie zu ihm hinunterschaute, miaute er leise. Sie bückte sich und hob ihn hoch. Vertrauensvoll schmiegte er sein Köpfchen an ihr Gesicht.
»Kater müßte man sein«, bemerkte Jörg.
»Wenn ich Zeit habe, werde ich dich bedauern«, erwiderte Melanie. »Gehört er den Lindenmaiers?«
»Nein.« Jörg strich über den Kopf des Katers. »Das ist Rasputin. Er gehört einer alten Dame, die in Bad Wiessee lebt.« Er erzählte, wie Corinna und Fabian den Kater anfangs für einen Streuner gehalten hatten. »Sogar einen Namen hatten sie ihm schon gegeben, Merlin, nach dem großen Zauberer aus der Artus-Sage. Und dann sagte ihnen der Tierarzt, daß es sich bei ihrem Merlin um Rasputin handelt.«
»Muß ein ziemlicher Schock für sie gewesen sein«, vermutete Melanie. »Ich hatte als kleines Mädchen eine Katze namens Dorothy. Sie kam unter ein Auto, während ich in der Schule war. Es hat Jahre gedauert, bis ich darüber hinweggekommen bin.«
»Das kann ich sehr gut verstehen.«
Melanie setzte Rasputin zu Boden. Das Katerchen strich noch einmal um ihre Beine, dann jagte es einem Nachtfalter nach. Innerhalb weniger Sekunden war es ihren Blicken entschwunden.
Vom Hotel her klang leise Musik. »Tanzen wir?« fragte Jörg und schaute ihr in die Augen.
»Hier?« Melanie nickte. Die dunklen Berge im Hintergrund, das erleuchtete Hotel und der See, in dem sich Mond und Sterne spiegelten, erschienen ihr als die richtige Kulisse. Und jetzt erkannte sie auch die Melodie, die aus dem Hotel klang. Es war dasselbe Lied, das bei dem Talentwettbewerb gewonnen hatte.
Jörg nahm seine Freundin in die Arme. Ganz von allein schmiegte sie sich an ihn, als sie miteinander zu tanzen begannen. Sie fühlte sich wie verzaubert. Als sie die Augen schloß, glaubte sie, die Stimmen der beiden Sänger zu hören: … Bleib bei mir und halt mich sacht und tanz, als sei es die letzte Nacht der Welt…«
»An was denkst du?« fragte
der junge Hotelier leise. Er blieb stehen und berührte ihre geschlossenen Lider mit den Fingern.
Melanie schlug die Augen auf. »Daran, wie glücklich ich bin«, erwiderte sie, ohne seinem Blick auszuweichen. »Sogar unendlich glücklich.«
Ihr Freund antwortete ihr nicht, sondern nahm ihr Gesicht sanft in beide Hände. Noch immer spielte die Musik. Doch sie beide wußten, daß es nicht die letzte Nacht der Welt war, sondern der Beginn einer wundervollen Liebe.
*
Dr. Baumann saß mit den Walkhofers und den Löbls in der Sitzecke des großen Gartens, der sich hinter dem alten Bauernhaus erstreckte. Schon vor Jahren hatte Anton Löbl diesen Teil überdacht und mit Bänken und einen großen Tisch ausgestattet. Sie feierten den Geburtstag seiner Schwester, die ihm seit dem Tod seiner Frau den Haushalt führte.
Von den Wiesen her klang Franzls freudiges, aufgeregtes Kläffen, der mit Artus, dem alten Hofhund der Löbls, durch die Gegend jagte. Die beiden waren seit Jahren Freunde. Für ein paar Stunden mit Artus vergaß Franzl sogar, daß für ihn der Sinn des Lebens vor allem in einem vollen Freßnapf und einem Berg von Leckerbissen lag.
»Bitte, brüh noch eine Kanne Kaffee auf, Lena«, bat Magdalena Walkhofer, als sie ihrer Schwiegermutter einschenken wollte und aus der Kanne nur noch ein paar Tropfen kamen.
»Ich bin schon unterwegs.« DieHausmagd stand vom Tisch auf. »Soll ich gleich auch noch neuen Kuchen bringen?« Sie wies auf die fast leere Kuchenplatte.
»Wer möchte denn gern noch ein Stückchen?« fragte Magdalena.
»Ich auf jeden Fall«, meldete sich ihr Bruder. Er wandte sich an die Schwiegereltern seiner Schwester, die seit kurzem ebenfalls auf dem Hof lebten, weil sie zu alt waren, um länger allein zu bleiben. »Wie steht es mit euch?«
»Ich esse auch noch ein Stück«, sagte Hermann Walkhofer. »Und du, Agnes?«
Seine Frau schüttelte den Kopf. »Wo steckt eigentlich Paul?« fragte sie. »Seit dem Mittagessen habe ich ihn nicht mehr gesehen.«
Franziska wußte es, dachte jedoch nicht daran, ihren Stiefcousin zu verraten. »Er wird bestimmt noch kommen«, schrieb sie und reichte den Block der alten Frau.
Eric nahm sich noch ein Stückchen Apfelkuchen. »Er ist ganz ausgezeichnet«, lobte er.
»Franziska hat ihn gebacken«, bemerkte Anton Löbl.
»Sie weiß, wie gern Sie Apfelkuchen essen, Herr Doktor«, fügte seine Schwester hinzu. Es war ein offenes Geheimnis, daß Franziska den Arzt seit ihrer Kindheit liebte, während Eric in der jungen Frau nur eine gute Freundin sah.
Franziska errötete. »Hör nicht auf meine Tante, Eric«, bat sie schriftlich. Sie mochte es nicht, wenn man auf ihre Gefühle anspielte, zumal in seiner Gegenwart. »Ich habe den Apfelkuchen einzig und allein für dich gebacken, Tante Magdalena«, schrieb sie auf ein weiteres Blatt.
Magdalena Walkhofer wußte, daß sie einen Fehler gemacht hatte. Es tat ihr leid. Sie liebte ihre Nichte, und nichts lag ihr ferner, als sie in Verlegenheit zu bringen. »Also, am besten, du bringst noch die andere Kuchenplatte, Lena«, sagte sie. »Und… Oh, da kommt ja Paul.« Sie wies zu dem jungen, etwas stämmig wirkenden Mann, der mit einem schweren Paket den Garten betrat. »Wo bist du denn gewesen?« fragte sie und eilte ihrem Stiefsohn entgegen.
»Ich habe dein Geburtstagsgeschenk abgeholt, Mutter«, erwiderte er vergnügt. »Der Freddy ist leider erst jetzt damit fertiggeworden.« Er stellte das Paket zu Boden. »Pack es aus. Ich bin schon gespannt, was du sagen wirst.«
»Deine Mutter wird begeistert sein, Paul«, versicherte sein Onkel.
Lena stellte die Kaffeekanne auf den Tisch zurück. Sie liebte Überraschungen, selbst, wenn sie nicht sie selbst betrafen.
Magdalena Walkhofer brauchte ein paar Minuten, bis sie das Paket ausgepackt hatte. »Wie bist du denn auf diese Idee gekommen?« fragte sie fassungslos, als schließlich ein antikes Nähtischchen vor ihr stand. »So ein Tischchen habe ich mir schon immer gewünscht. Es paßt wundervoll in mein Schlafzimmer.«
»Und genau dort sollte es auch stehen«, sagte ihr Stiefsohn. »Franziska hat mir verraten, daß du dir vor einigen Wochen die Nase am Schaufenster vom Ferdinand Stangelhofer plattgedrückt hast. Als ich das Nähtischchen für dich kaufen wollte, war mir bereits jemand zuvorgekommen, aber er hat ein ähnliches besorgen können und es für dich restauriert. Auch die Malereien hat er eigenhändig erneuert.«
»Danke, Paul.« Magdalena Walkhofer nahm ihren Stiefsohn in die Arme. »Setz dich zu uns. Lena, bitte, kümmere dich endlich um den Kaffee, sonst denkt Paul noch, daß er nur Milch bekommt.«
Lena verschwand mit der Kanne im Haus. Die geräumige Küche befand sich im vorderen Teil. Während sie darauf wartete, daß der Kaffee durch die Maschine rann, schaute sie zufällig aus dem Fenster. Sie sah, wie ein junger Mann auf den Hof lief. Er wirkte irgendwie gehetzt. Flüchtig sah er sich um, dann rannte er auf die Haustür zu.
Lena öffnete. »Ja, bitte?« fragte sie.
»Ich muß dringend telefonieren«, sagte Jörg Thomson völlig außer Atem. »Meine Freundin ist etwa zweieinhalb Kilometer von hier zusammengebrochen. Sie ist bewußtlos.«
»Doktor Baumann ist gerade bei uns«, erwiderte Lena. »Frau Walkhofer hat Geburtstag. Kommen Sie.« Sie eilte ihm voraus in den Garten.
»Herr Thomson!« Eric stand auf. Die Thomsons hatten bereits zu den Patienten seines verstorbenen Vaters gehört. »Hat es einen Unfall gegeben?«
»Meine Freundin ist beim
Wasserfall zusammengebrochen!« stieß der junge Hotelier hervor. »Melanie hat sich den ganzen Tag schon nicht besonders wohl gefühlt. Leider hat sie mir das erst kurz vor ihrem Zusammenbruch gestanden. Sie ist bewußtlos.« Jörg holte tief Luft. »Gott sei Dank sind Sie hier. Ich wollte das Krankenhaus anrufen.«
»Mein Wagen steht im Hof«, sagte Dr. Baumann. Er wandte sich an seine Gastgeber: »Kümmert euch bitte um Franzl.«
»Machen wir«, versprach Anton Löbl. »Ich drücke den Daumen, daß es nichts Ernstes ist«, wandte er sich an Jörg Thomson.
Mit dem Wagen brauchten sie trotz der unwegsamen Straße, die vom Löblhof zum Wasserfall hinaufführte, nur ein paar Minuten. Eric parkte rechts neben einem kleinen Bach. Kaum hatte er gehalten, stieg Jörg auch schon aus und rannte zu seiner Freundin, die er in den Schatten einiger Kiefern gelegt hatte. »Melanie ist noch immer bewußtlos!« rief er dem Arzt zu.
Dr. Baumann war mit wenigen Schritten bei der jungen Frau. Jörg hatte ihm erzählt, daß es sich bei Melanie Berger um einen Hotelgast handelte und sie sich ineinander verliebt hatten. Er kniete sich neben sie auf den Waldboden und untersuchte sie. »Hat Ihnen Frau Berger gesagt, ob Sie an irgendwelchen Krankheiten leidet?« fragte er, während er ihr eine kreislaufstärkende Injektion gab.
»Nein, hat sie nicht«, antwortete Jörg besorgt. »Soweit ich es beurteilen kann, nimmt sie auch keine Medikamente.« Er kniete sich neben den Arzt. »Ist es sehr schlimm?«
»Das kann ich im Moment noch nicht beurteilen«, antwortete Eric, ohne aufzublicken. »Er kontrollierte Blutdruck und Puls. Langsam begann die Spritze zu wirken. Melanie wachte zwar nicht auf, doch ihre Haut fühlte sich nicht mehr so kühl an wie noch vor wenigen Minuten.
»Ich glaube, wir können es wagen, sie in die Praxis hinunterzubringen.« Der Arzt richtete sich auf.
»Ich werde Melanie zu Ihrem Wagen tragen«, bot Jörg spontan an. Er strich seiner Freundin liebevoll über die Stirn. »Es wird schon wieder werden«, sprach er fast lautlos auf sie ein. »Sieht nicht aus, als seist du es gewohnt, längere Wanderungen zu machen.«
Er hob seine Freundin hoch und trug sie so sicher, als sei sie leicht wie eine Feder, zum Wagen, wo er sie mit Hilfe von Dr. Baumann auf den Rücksitz bettete.
Auf dem Weg nach Tegernsee kam Melanie wieder zu sich. »Wo bin ich?« flüsterte sie und strich sich über die Augen, weil sie nur verschwommen sehen konnte.
»Im Wagen von Doktor Baumann, Liebes«, erwiderte ihr Freund. Er saß ebenfalls im Fond. Melanies Oberkörper lag auf seinem Schoß. »Du mußt keine Angst haben. Es wird alles gut.«
Der Arzt warf einen Blick in den Rückspiegel. »Wie fühlen Sie sich, Frau Berger?« fragte er.
»Etwas benommen«, meinte sie. »So, als sei ich mit dem Kopf gegen eine Mauer gerannt und hätte Mühe, meine Gedanken zusammenzubringen. Ich weiß nur noch, daß mir plötzlich schwarz vor Augen geworden ist.«
»Du warst bewußtlos«, sagte Jörg. »Ich bin zum Löblhof hinuntergerannt, um nach Hilfe zu telefonieren. Zum Glück ist Doktor Baumann zu Gast bei den Löbls gewesen.«
Sie hatten Tegernsee erreicht. Eric bog in die Schwaighofstraße ein. Kurz darauf hielt er vor seinem Haus.
Katharina Wittenberg kam aus dem hinteren Teil des Gartens. »Ist etwas geschehen?« fragte sie überrascht, weil sie erst am Abend mit der Rückkehr von Dr. Baumann gerechnet hatte. Sie blickte in den Wagen. »Wo ist der Franzl?«
»Es ist alles in Ordnung, Katharina«, beruhigte sie Eric und öffnete die Fondtür. Während Jörg und Melanie ausstiegen, erzählte er mit wenigen Worten, was passiert war. »Ich hole Franzl nachher ab. Mach dir keine Sorgen.« Er schloß die Praxis auf und ließ Melanie, die von Jörg gestützt wurde, an sich vorbeigehen.
Jörg nahm im Wartezimmer Platz. Er wäre gern bei Melanie geblieben, doch er sah ein, daß das nicht ging. Nervös blätterte er in einer Zeitschrift. Sein Vater hatte ihn am Morgen wieder gewarnt und gemeint, daß etwas mit der jungen Frau nicht stimmen würde. Spürte er womöglich, daß Melanie krank war? Andererseits mußte sein Vater ihn doch gut genug kennen, um zu wissen, daß ihn das nicht von einer Beziehung zu ihr abhalten würde.
Dr. Baumann nahm Melanie einen Tropfen Blut ab. Nachdenklich schaute er in den Monitor des kleinen Gerätes, das den Blutzucker bestimmen konnte. Er hatte die junge Frau zwar schon gefragt, ob sie an Diabetes litt, jetzt erkundigte er sich, ob es in ihrer Familie Fälle von Zuckerkrankheit gab.
»Meine Großmutter hatte seit ihrer Kindheit Diabetes«, antwortete Melanie erschrocken. »Sie wollen doch nicht etwa sagen, daß ich zuckerkrank bin? – Ich habe heute morgen ziemlich süß gegessen und nach dem Mittagessen auch noch eine Portion Eis.«
»Das könnte natürlich Ihren hohen Blutzucker erklären«, antwortete der Arzt, »überzeugt bin ich jedoch nicht davon.« Er stellte das Gerät auf die Seite. »Ihr starker Durst, die Tatsache, daß Sie nachts nicht durchschlafen können, die Gewichtsabnahme, von der Sie mir erzählt haben, Ihre Müdigkeit und Schwäche deuten daraufhin, daß Ihr Stoffwechsel massiv gestört ist. Wie ich vermute, auf Grund von Insulinmangel.«
»Und aus diesem Grund bin ich bewußtlos geworden?«
»Es wäre möglich, doch das muß noch genau abgeklärt werden.« Eric stand auf und lehnte sich seitlich von ihr gegen den Schreibtisch. »Heutzutage kann ein Diabetiker ein fast normales Leben führen, wenn er sich an einige Regeln hält.« Er schenkte ihr ein zuversichtliches Lächeln. »Allerdings ist es erforderlich, daß ich Sie noch heute zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus einweise. Wenn…«
»Nein.« Melanie schüttelte den Kopf. »Bis nicht hundertprozentig erwiesen ist, daß ich wirklich zuckerkrank bin, gehe ich in kein Krankenhaus. Die notwendigen Blutuntersuchungen können sicher auch Sie durchführen.«
»Das ist keine Frage, doch ich halte es für sehr gefährlich, so lange zu warten, bis genaue Ergebnisse vorliegen, Frau Berger. Sie könnten erneut bewußtlos werden oder sogar ins Koma fallen.« Er sah sie ernst an. »Im Krankenhaus könnte Ihnen dann sofort geholfen werden.«
Melanie dachte über seine Worte nach. Im Grunde ihres Herzens wußte sie, daß Dr. Baumann recht hatte. »Eigentlich sollte mein Aufenthalt am Tegernsee ein Traumurlaub werden, und kurze Zeit hat es auch so ausgesehen, als wäre ich im siebten Himmel«, meinte sie. »Und nun…« Sie atmete tief durch. »Nein, ich denke nicht daran, mir meinen Urlaub durch einen möglicherweise unnötigen Krankenhausaufenthalt zu verderben.«
»Es ist sehr leichtsinnig, was Sie vorhaben«, erwiderte der Arzt und gab sich keine Mühe, seinen Ärger zu verbergen. »Sie spielen mit einem sehr hohen Einsatz. Wenn Sie verlieren, könnte Ihr Traumurlaub der letzte in Ihrem Leben gewesen sein.«
Melanie spürte einen kalten Schauer. »Muß aber nicht«, beharrte sie. »Bitte, seien Sie mir nicht böse. Ich bin sehr froh, daß Sie zur Stelle gewesen sind, als ich Hilfe brauchte. Es wäre besser gewesen, ich hätte Herrn Thomson gebeten, den Ausflug zu verschieben. Wir hätten auch etwas anderes unternehmen können.«
»Befürchten Sie, Herr Thomson könnte sich in der Zwischenzeit einer anderen zuwenden?«
»Das ist es nicht.« Melanie hatte Angst, daß Jörg durch einen Krankenhausaufenthalt erfahren würde, wie es um ihre finanziellen Verhältnisse stand. Immerhin war sie nur gesetzlich versichert und hatte keinen Anspruch auf ein Einzelzimmer. »Darf ich morgen zur Blutsenkung kommen?« Sie stand auf.
»Gut, wie Sie wünschen«, meinte Eric kühl. Er hielt Melanie Berger für eine intelligente, junge Frau. Weshalb wollte sie nicht begreifen, daß sie mit ihrem Leben spielte? Erneut versuchte er, sie zu überreden, einer Einweisung ins Krankenhaus zuzustimmen. Es war vergebens.
Dr. Baumann brachte die jungen Leute zu der Stelle, an der Jörg seinen Wagen geparkt hatte, und verabschiedete sich dort von ihnen. Arm in Arm winkten sie ihm nach, als er zum Löblhof zurückkehrte.
»Tut mir leid, daß ich den Ausflug verdorben habe«, sagte Melanie leise.
»Da gibt es nichts, was dir leid tun müßte«, versicherte der junge Hotelier. »Unseren Ausflug können wir jederzeit wiederholen.« Er nahm sie zärtlich in die Arme. »Mach dir keine Sorgen. Doktor Baumann ist ein ausgezeichneter Arzt. Was immer dir auch fehlen mag, er wird dir bestimmt helfen können.«
Melanie fragte sich, ob es nicht besser sein würde, Jörg die Wahrheit zu gestehen. Wenn sich Dr. Baumann nicht irrte, würde sich ein Krankenhausaufenthalt nicht verhindern lassen. Zudem war es wirklich mehr als leichtsinnig, was sie tat. Sie legte die Arme um den Nacken ihres Freundes. »Ich muß dir etwas sagen«, bekannte sie.
»Daß du mich liebst?« fragte er, ohne zu ahnen, daß er mit diesen Worten ihre guten Vorsätze zunichte machte.
»Ja, genau das«, antwortete sie und küßte ihn.
*
Andrea hatte solche Schmerzen in ihrem Knie, daß sie kaum auftreten konnte, trotzdem stand sie an diesem Montagabend in der kleinen Küche der Kneipe und kochte. Am Nachmittag hatte sie einen heftigen Streit mit Herbert Freytag gehabt. Sie hatte ihn gebeten, für kurze Zeit eine Aushilfe einzustellen. Die Arbeit fiel ihr von Tag zu Tag schwerer, und sie wußte, daß ihr das lange Stehen in der Küche schadete. Aber Herbert hatte sie nur angeschrien, sie faul und undankbar genannt.
Er steckte seinen Kopf durch die Durchreiche. »Wo bleibt der Leberkäse!« fragte er fast schreiend. »Los, beeil dich ein bißchen. Wie lange sollen meine Gäste denn noch warten?« Wütend sah er sie an. »Noch langsamer geht es wohl nicht?«
»Einen Moment noch.« Andrea verteilte rasch noch gebratene Zwiebeln auf dem Leberkäse, dann stellte sie die schwere Pfanne auf den Herd zurück. Als sie sich umdrehte, stieß sie gegen das Tablett mit den vollen Tellern. Es rutschte vom Tisch. Scheppernd schlug es auf dem gefliesten Boden auf. Scherben, Leberkäse, Zwiebeln und Spiegeleier verteilten sich über die ganze Küche. Entsetzt wich die junge Frau bis zum Herd zurück.
»Du dumme Kuh!« stieß Herbert Freytag außer sich hervor. Sein aufgedunsenes Gesicht rötete sich vor Zorn. »Jetzt reicht’s mir endgültig.«
»Ja, gib’s ihr endlich!« rief einer der Gäste.
»Wir können sowieso nicht begreifen, weshalb du dich mit so einer eingelassen hast!« schrie ein anderer. »Da hättest du ja gleich ein Walroß in dein Bett nehmen können.«
Herbert Freytag riß die Küchentür auf. »Da hörst du’s!« schrie er Andrea an. »Deinetwegen spottet man über mich.« Um seine Lippen spielte ein gemeines Lächeln. »Wie gut ich heute deinen Stiefvater verstehen kann. Dein Anblick wird ihm ganz einfach zuwider gewesen sein.«
»Früher hast du nicht so gedacht«, flüsterte Andrea und versuchte, sich möglichst klein zu machen.
»Da war ich auch noch blind.« Er wies zur Tür. »Los, mach, daß du rauskommst!« Er griff nach einem hölzernen Kochlöffel. »Verschwinde! Ich will dich nicht mehr sehen.«
»Und wo soll ich hin?« fragte sie entsetzt. »Herbert, laß mich wenigstens bis morgen bleiben. Ich werde versuchen, ein Zimmer zu finden. Ich…«
»Raus habe ich gesagt!« brüllte er. »Verschwinde aus meinem Leben.« Er schlug mit dem Kochlöffel in ihre Richtung. Nur wenige Zentimeter vor ihrem Gesicht ging der Schlag pfeifend nieder.
Andrea wich zur Tür zurück. »Gut, ich werde meine Sachen packen«, sagte sie und hoffte, daß ihn das zur Besinnung bringen würde.
»Daß du dich oben verbarrikadieren kannst.« Herbert Freytag schüttelte den Kopf. »Nichts da!« stieß er hervor. »Deine Lumpen beförderte ich morgen vor die Tür, da kannst du sie einsammeln.«
»Bitte, Herbert, laß mich wenigstens meine Jacke holen. Draußen regnet es. Ich…« Die junge Frau begann bitterlich zu weinen.
»Worauf wartest du noch, Herbert?« rief einer der Gäste. »Ein Wort und wir helfen dir, dieses Weibsstück auf die Straße zu setzen.«
»Ich brauche keine Hilfe.« Herbert packte Andrea bei den Haaren. »Los, raus!«
»Herbert, du kannst mich nicht…«
»Und ob ich kann.« Er zerrte Andrea, die kaum Widerstand leistete, zur Hintertür, öffnete sie und stieß die junge Frau in den strömenden Regen hinaus. Bereits im nächsten Moment schlug er die Tür von innen zu.
»Bravo, Herbert, bravo!«
schrien die Männer, die im Gastraum der Kneipe saßen. »Endlich hast du Mumm bewiesen. So was wie die findest du an jeder Straßenecke.«
Andrea starrte auf das hellerleuchtete Küchenfenster. Sie überlegte, ob sie versuchen sollte, heimlich wieder ins Haus zu gelangen, wagte es jedoch nicht. Herbert besaß große Kräfte und wenn er so wütend war wie an diesem Abend, legte man sich besser nicht mit ihm an.
Die junge Frau blickte zum wolkenverhangenen Himmel hinauf. Der Regen peitschte in ihr Gesicht. Fröstelnd zog sie die Schultern zusammen. Wohin sollte sie? Sie mußte auf jeden Fall einen Unterschlupf für die Nacht finden. Etwas, wo es wenigstens trocken sein würde.
Niedergeschlagen verließ Andrea den kleinen Hinterhof des Hauses, schlug einen Bogen um den Eingang der Kneipe und machte sich auf dem Weg zur Schwaighofstraße. Wenn sie Glück hatte, stand die Prinz-Karl-Kapelle offen. Es würde nicht sehr bequem sein, aber besser, als im Regen zu bleiben.
Schon nach wenigen Metern glaubte die junge Frau, nicht mehr weiterzukönnen. Die Schmerzen zogen sich jetzt über ihr ganzes rechtes Bein bis hinunter zu den Zehenspitzen und hinauf in die Hüfte. Schluchzend humpelte sie die Straße entlang. Sie hatte nicht einen Pfennig Geld in der Tasche. Noch nie in ihrem Leben hatte sie so viel Angst vor dem Morgen gehabt.
Dr. Baumann hatte an diesem Abend seine Freunde Sibylle und Gunther Fischer in Rottach-Egern besucht und befand sich nun auf dem Heimweg. Mit den Gedanken war er bei Melanie Berger. Seine neue Patientin war am Morgen zur Blutsenkung gekommen. Er hatte noch einmal versucht, sie zu weiteren Untersuchungen im Krankenhaus zu überreden, doch es war vergeblich gewesen. Warum müssen nur manche Leute so unvernünftig sein, dachte er, während er die Schwaighofstraße entlangfuhr. Es gab Menschen, die gingen mit ihrer Gesundheit um, als könnte sie jederzeit ersetzt werden.
Plötzlich stutzte er. Rechts der Straße lief jemand durch den
strömenden Regen, nur mit
langen Hosen und einem halbärmeligen T-Shirt bekleidet. Automatisch trat er auf die Bremse.
Als der Wagen stand, beugte er sich über den Beifahrersitz und kurbelte das Seitenfenster hinunter. Erst jetzt erkannte er Andrea Stanzl. »Sind Sie denn von allen guten Geistern verlassen?« fragte er aufgebracht und öffnete die Wagentür. »Los, rein mit Ihnen.«
»Ich bin bis auf die Haut naß, Herr Doktor«, wandte Andrea ein, weil sie Angst hatte, den Sitz zu beschmutzen. »Sie würden es bitter bereuen.«
»Frau Stanzl, bitte setzen Sie sich in den Wagen.« Dr. Baumann löste seinen Gurt und angelte nach der Decke, die auf dem Rücksitz lag.
»Danke.« Andrea stieg in den Wagen, dann schloß sie die Tür und sperrte den Regen aus. Instinktiv strich sie ihre nassen Haare zurück.
Eric legte der jungen Frau die Decke um die Schultern. »Und nun möchte ich wissen, was um alles in der Welt Sie in diesem Zustand auf der Straße machen«, sagte er.
»Mein Freund hat mich rausgeworfen, weil ich versehentlich ein Tablett mit vollen Tellern vom Tisch gestoßen habe«, flüsterte Andrea. »Ich durfte nicht mal meine Jacke holen. Geld habe ich auch nicht.« Sie rieb sich die Augen.
Dr. Baumann gab ihr ein Taschentuch. »Heute nacht schlafen Sie in meinem Haus«, bestimmte er spontan.
»Ich wollte in der Prinz-Karl-Kapelle übernachten«, schluchzte Andrea. »Vielleicht hat sich mein Freund bis morgen beruhigt. Mit meinem kaputten Bein bin ich ihm keine rechte Hilfe mehr. Kein Wunder, daß er wütend auf mich ist. Ich habe heute solche Schmerzen, daß ich die Wände hochgehen könnte.«
»Und der Regen macht es nicht besser«, bemerkte Eric. Er gab Gas. »Unsere Gästezimmer sind gemütlicher als die Prinz-Karl-Kapelle.«
Die junge Frau wandte ihm ihr tränenüberströmtes Gesicht zu. »Wie soll ich Ihnen nur danken, Herr Doktor?« fragte sie. »Sie hatten mir zwar versprochen, daß Sie mir helfen würden, so recht habe ich daran jedoch nicht glauben können. Wenn man ständig herumgestoßen wird, fällt es einem sehr schwer, zu jemanden Zutrauen zu fassen.«
»Wenn Sie nur wollen, wird man Sie nicht mehr herumstoßen«, sagte Eric, nahm sich vor, alles zu tun, damit Andrea Stanzl Boden unter den Füßen fand.
Andrea hüllte sich fester in die Decke. Obwohl sie entsetzlich fror und bis auf die Haut naß geworden war, fühlte sie eine bleierne Müdigkeit. Sie hätte auf der Stelle einschlafen können. Nur mit äußerster Beherrschung schaffte sie es wachzubleiben.
Kaum hatte der Wagen des Arztes vor der Garage gehalten, begann Franzl im Haus zu kläffen. »Das Begrüßungskomitee«, bemerkte er. »Sie müssen sich vor meinem Hund nicht fürchten. Er ist ein lieber, gutmütiger Kerl und hat noch nie jemanden gebissen.«
»Hunde habe ich noch nie gefürchtet«, bemerkte Andrea und stieg aus. Eilig trat sie unter das Vordach, um die Decke, die um ihre Schultern lag, vor dem Regen zu schützen.
Dr. Baumann ließ seinen Wagen vor der Garage stehen. Er führte Andrea zur Haustür und schloß auf. »Gleich, Franzl«, sagte er, als sein Hund sie stürmisch begrüßen wollte. Er schob ihn beiseite, damit Andrea in die Diele treten konnte. Fürsorglich nahm er ihr die Decke ab.
Franzl bedachte sein Herrchen mit einem freundschaftlichen Schwanzwedeln, dann warf er sich vor Andrea auf den Boden und bot ihr seine Vorderseite. Die junge Frau vergaß ihre Müdigkeit und kniete sich neben ihn. »Sieht aus, als würdest du mich mögen«, meinte sie und begann, seine Brust zu kraulen. Franzl stieß leise, wohlige Laute des Behagens aus.
»Das hat er bei Fremden bisher noch nie getan«, meinte Eric beeindruckt.
»Die meisten Hunde mögen mich«, erwiderte Andrea. Zum ersten Mal, seit er sie kannte, lächelte sie.
Katharina Wittenberg, die sich im Wohnzimmer einen Videofilm angesehen hatte, kam ins Treppenhaus. »Guten Abend«, sagte sie freundlich und warf Eric einen fragenden Blick zu.
»Ich habe einen Gast mitgebracht.« Dr. Baumann stellte seine Haushälterin und Andrea, die sich inzwischen aufgerichtet hatte, einander vor. »Wärst du so gut, uns noch einen heißen Tee zu machen?« fragte er und wandte sich an die junge Frau: »Sie möchten sicher etwas trinken? Vielleicht haben Sie auch Hunger?«
»Nein, hungrig bin ich nicht, doch etwas Heißes würde mir bestimmt guttun«, gab sie zu. »Macht es Ihnen auch keine Umstände, Frau Wittenberg?«
»Darum müssen Sie sich nicht sorgen«, erklärte Katharina herzlich. »Allerdings sollten Sie erst einmal ein heißes Bad nehmen. Sie sehen aus, als hätten Sie es nötig.« Impulsiv legte sie den Arm um die Schultern der jungen Frau. »Kommen Sie, ich bringe Sie nach oben. Wenn Sie möchten, können Sie Ihren Tee im Bett trinken.« Sie drehte sich Eric zu. »Oder möchtest du erst noch mit Frau Stanzl sprechen?«
»Schlafen Sie sich erst einmal aus, Frau Stanzl«, schlug Dr. Baumann vor. »Wir können morgen über alles reden.« Er lächelte ihr zu. »Einverstanden?«
Andrea nickte dankbar.
»Fein, und machen Sie sich keine Sorgen. Es wird sich schon alles finden.«
Katharina führte die junge Frau nach oben, während der Arzt mit Franzl in die Küche ging. Da er annahm, daß seine Haushälterin noch eine Weile beschäftigt sein würde, setzte er selbst das Teewasser auf.
Franzl legte sich demonstrativ vor die Speisekammer. Als sein Herrchen diese Geste nicht gleich beachtete, seufzte er laut auf.
»Du bist unverbesserlich.« Der Arzt wandte sich um. »Aber nur einen einzigen Hundekuchen.« Er sah ihn streng an. »Mehr gibt es nicht.«
Franzl sprang auf. Er durfte sein Herrchen nicht daran hindern, die Speisekammertür zu öffnen. Erwartungsvoll wackelte er mit der Rute.
Eric warf ihm einen Hundekuchen zu. »Nichts Katharina verraten«, sagte er. »Also mach, daß du unter den Tisch kommst und sie dich nicht beim Kauen erwischt.«
»Schon geschehen«, erklärte seine Haushälterin grimmig und trat in die Küche. »Soviel zu Männern und ihren Prinzipien.« Sie blickte auf Franzl, der gerade unter dem Tisch verschwand. »Das nützt dir auch nichts mehr. Du kannst ruhig vorkommen.«
Franzl steckte den Kopf unter dem Tisch hervor. Er hatte noch keine Gelegenheit gehabt, den Hundekuchen zu fressen. Ein Stückchen davon ragte aus der Schnauze heraus. Treuherzig blickte er zu der Haushälterin auf, dann zog er den Kopf zurück, und gleich darauf hörte man ihn schmatzend kauen.
»Tischmanieren hat er keine«, bemerkte Eric schmunzelnd. »Was macht unser Schützling?«
»Liegt in der Badewanne«, erwiderte Katharina. »Ich wollte Frau Stanzl nicht ausfragen. Was ist denn passiert?« Sie bemerkte, daß das Teewasser kochte, und füllte es in die bereitstehenden Becher.
Eric erzählte es ihr. »Frau Stanzl sollte sich endlich von diesem Mann trennen. Soweit ich sie verstanden habe, hofft sie darauf, daß er sie morgen wieder aufnehmen wird.«
»Ich glaube, ihre größte Angst ist es, völlig allein auf der Welt zu stehen«, sagte Katharina. »Sie macht auf mich den Eindruck einer Frau, die glaubt, nur mit einem Mann von anderen anerkannt zu werden. Lieber eine denkbar schlechte Beziehung als gar keine.«
»Ja, da kannst du recht haben.« Dr. Baumann griff nach seinem Teebecher. »Nun, ich werde morgen versuchen, sie davon zu überzeugen, daß sie ihr Leben selbst in die Hände nehmen muß. Würde es dir etwas ausmachen, wenn sie für einige Zeit bei uns wohnt?«
»Nein, natürlich nicht, Eric«, versicherte Katharina Wittenberg und griff nach dem Tablett, auf das sie den Tee für Andrea gestellt hatte. »Wenn es eine Möglichkeit gibt, dieser armen Frau zu helfen, sollten wir es tun.«
»Ich wußte, daß ich mich auf dich verlassen kann«, meinte der Arzt und küßte sie auf die Wange, dann ging er mit seinem Teebecher ins Arbeitszimmer hinüber, um dort in Ruhe über alles nachzudenken.
*
Katharina Wittenberg huschte auf Zehenspitzen durch den Korridor. Sie wollte verhindern, daß Andrea Stanzl vorzeitig aufwachte. Eric hatte mit ihr ausgemacht, daß sie die junge Frau so lange wie möglich schlafen lassen wollten. Mit Andrea reden konnte er auch noch nach dem Mittagessen. Jetzt war es erst einmal wichtig, daß sie etwas Ruhe fand.
Dr. Baumann kam gerade mit Franzl von einem Morgenspaziergang, als Katharina den Kaffee auf den Küchentisch stellte. »Das nennt man timing«, meinte er und trat ans Spülbecken, um sich die Hände zu waschen, während Franzl sofort seine Schnauze im Futternapf vergrub.
Im Arbeitszimmer des Arztes klingelte das Telefon. »Ich bin gleich zurück«, sagte er, griff nach einem Handtuch und verließ die Küche.
»Hoffentlich kann dein Herrchen in Ruhe frühstücken, bevor er aus dem Haus muß«, meinte Katharina Wittenberg zu Franzl. »Es ist immer dasselbe. Kaum will sich Eric zu Tisch setzen, schon wird er gestört.«
»Wuw«, machte Franzl und wirkte so traurig, als hätte er jedes ihrer Worte verstanden.
»Schön, daß du darüber genauso denkst wie ich.« Die Haushälterin tätschelte seinen Rücken, was ihn sofort veranlaßte, noch einmal zu seinem Futternapf zu laufen und demonstrativ hineinzustarren.
In diesem Moment kam Dr. Baumann zurück. »Keine Angst, Katharina, mein Frühstück ist nicht gefährdet«, sagte er. »Es ist Frau Bohn gewesen. Sie wollte uns nur sagen, daß es bei ihr heute abend später wird. Ihre Tochter Michaela fliegt am späten Nachmittag nach Madeira, und sie möchte sie auf den Flughafen nach München begleiten.«
»Ein Wunder, daß sich Michaela nicht dagegen gewehrt hat«, bemerkte Katharina bissig. Sie hielt nicht viel von Erika Bohns Kindern. Die beiden jüngsten, ihre fünfundzwanzigjährige Tochter Michaela und deren Bruder Thomas, lebten noch bei ihr, gaben kein Kostgeld ab und ließen sich von ihr von vorn bis hinten bedienen. Dafür sahen sie genau wie ihre älteren Geschwister Wolfgang und Bianca auf die Mutter herab, weil diese ihren Lebensunterhalt mit Putzen verdiente.
»Vermutlich hat unsere gute
Erika regelrecht darum gebettelt, sie zum Flughafen begleiten zu dürfen«, erwiderte Eric und setzte sich an den Tisch. »Auf meinem Schreibtisch lag ein Zettel.« Leise seufzte er auf. »Wenn du meinst, Frau Stanzl würde im Gästezimmer schlafen, so irrst du dich gewaltig. Sie ist zu ihrem sogenannten Freund zurückgekehrt.« Er schob Katharina den Zettel entgegen.
»Wie kann sie nur so dumm sein?« fragte die Haushälterin fassungslos, nachdem sie Andreas Nachricht gelesen hatte. Die junge Frau hatte in aller Frühe Herbert Freytag angerufen und ihn gefragt, ob sie zurückkehren dürfte. Er hatte es ihr großzügig erlaubt.
Bitte verzeihen Sie, Herr Doktor, aber so schlecht ist der Herbert im Grunde genommen nicht. Herzlichen Dank für alles, was Sie und Frau Wittenberg für mich getan haben.
Ihre Andrea Stanzl
»Sie muß den ganzen Weg gelaufen sein«, vermutete der Arzt. »Geld hatte sie jedenfalls nicht. Dieser Mann hatte sie ja ohne einen Pfennig auf die Straße gejagt.« Stirnrunzelnd schaute er auf Franzl hinunter. »Warum hast du sie gehen lassen?« fragte er. »Du bist mir ein schöner Wachhund.«
Franzl hob erwartungsvoll den Kopf. Seine Rute bewegte sich wie ein Propeller.
»Sieht aus, als wollte er auch noch eine Belohnung«, meinte
Eric lachend und strich über den Kopf des Hundes.
»Auf ihre Art ist Frau Stanzl genauso dumm wie Frau Bohn.« Katharina schenkte Kaffee ein. »Nun, du hast wenigstens versucht, ihr zu helfen. Das ist mehr, als viele andere getan hätten.«
Und trotzdem zu wenig, dachte der Arzt und fragte sich, ob es nicht besser gewesen wäre, noch in der Nacht mit Andrea Stanzl zu sprechen. Er war überzeugt, daß Herbert Freytag sie schon bald wieder auf die Straße setzen würde.
Seine erste Patientin an diesem Vormittag war Olga Mergenthaler. Sie hatte erst vor kurzem eine Gürtelrose überstanden und litt noch immer an Nervenschmerzen. Dr. Baumann sah ihr an, daß sie in der vergangenen Nacht kaum geschlafen hatte.
»Ich bin bestimmt nicht wehleidig«, meinte sie, »aber diese Schmerzen machen mich noch verrückt. Von Zeit zu Zeit ist es, als würde man mir ein Messer in den Rücken bohren. Eine Nachbarin sagte mir, daß es noch monatelang so weitergehen könnte.«
»Die Schmerzen können tatsächlich noch lange anhalten, Frau Mergenthaler«, bestätigte Eric, »was nicht heißen muß, daß wir uns damit abfinden sollten.« Er stand auf und ging an seinen Medikamentenschrank. »Nehmen Sie Ihre B-Vitamine noch?«
»Ja.« Olga Mergenthaler nickte. »Da achtet schon mein Sohn drauf«, fügte sie hinzu. »Florian kümmert sich wirklich rührend um mich.« Kopfschüttelnd starrte sie auf ihre Hände. »Schade, daß meine Schwiegertochter nicht einsehen will, was für ein Juwel sie zum Mann hat.«
»Stimmt etwas in der Ehe Ihres Sohnes nicht?« fragte Eric überrascht. Er war stets der Meinung gewesen, daß Anna und Florian Mergenthaler eine vorbildliche Ehe führten.
»Nein, das will ich damit nicht sagen. Im Grunde genommen kann ich mich auch nicht über Anna beklagen. Sie ist eine gute Ehefrau und eine fürsorgliche Mutter. Mich stört nur, daß sie Florian nicht auch im künstlerischen Bereich unterstützt. Statt ihn zu ermutigen, kritisiert sie seine Gedichte oft. Da ist seine Sekretärin der Bank ganz anders. Frau Zange hat mir neulich gestanden, daß sie heimlich eines der Gedichte meines Sohnes zu einem Wettbewerb geschickt hat.«
»Und, hat das Gedicht einen Preis bekommen?« Der Arzt war froh, daß er mit dem Rücken zu seiner Patientin stand. Es fiel ihm schwer, ernst zu bleiben. Auch wenn er Florian Mergenthaler mochte, von dessen Dichtkunst hielt er nicht viel.
»Bis jetzt noch nicht«, erwiderte die ältere Frau bedauernd. »Aber ich wünsche es mir so sehr. Es wird allerhöchste Zeit, daß mein Florian die Anerkennung erhält, die ihm zusteht.«
Dr. Baumann wandte sich ihr mit einer Spritze in der Hand zu. »Machen Sie sich bitte frei«, bat er. »Während der nächsten beiden Wochen werde ich Ihnen alle zwei Tage eine Injektion mit einer Vitamin-B-Kombination geben. Und falls das nichts nützen sollte und Ihre Schmerzen noch weiter anhalten, werden wir es mit Neuraltherapie versuchen.«
»Was immer Sie auch vorschlagen, ich werde es tun«, versicherte Frau Mergenthaler. »So geht es jedenfalls nicht mehr weiter.«
Einige Minuten später brachte der Arzt seine Patientin nach draußen. »Grüßen Sie Ihre Familie von mir«, bat er, als er sich von ihr verabschiedete.
»Gern«, sagte sie strahlend und trat zu Tina Martens, um sich von ihr für den übernächsten Tag einen Termin geben zu lassen.
Melanie Berger kam als nächste an die Reihe. Bereits auf den ersten Blick sah ihr Dr. Baumann an, daß sie sich keineswegs wohl fühlte. Es wunderte ihn nicht. »Bitte, nehmen Sie Platz.« Er wies auf den Stuhl, der vor seinem Schreibtisch stand.
»Danke.« Die junge Frau setzte sich. An diesem Morgen wirkte sie nicht so selbstsicher wie sonst. »Sie wollen mir sicher sagen, daß sich das Ganze als ein Sturm im Wasserglas erwiesen hat«, meinte sie herausfordernd, um ihre Unsicherheit zu überspielen. »Ich bin nicht zuckerkrank.«
»Ich wünschte, ich könnte Ihnen das bestätigen«, erwiderte der Arzt. »Leider ist es nicht so. Wie ich vermutet habe, leiden Sie an Diabetes.« Er beugte sich ihr leicht zu. »Würde es sich um eine Altersdiabetes handeln, so würde es unter Umständen genügen, daß Sie eine Diät einhalten und Tabletten nehmen, doch diese Krankheitsform kann mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.«
»Kann es Vererbung sein?« fragte Melanie mit trockenem Mund.
»Unter Umständen«, sagte Dr. Baumann. »Auf jeden Fall kommen Sie um einen Krankenhausaufenthalt nicht mehr herum. Daß Sie am Sonntag das Bewußtsein verloren haben, ist ein deutliches Warnzeichen, Frau Berger. Solange Sie im Krankenhaus nicht genau auf Ihre Insulindosierung eingestellt worden sind, besteht jederzeit die Gefahr eines Stoffwechsel- und Kreislaufzusammenbruchs mit schwerwiegendsten Folgen.«
»Und Sie sind der Meinung, daß ich sofort ins Krankenhaus gehen sollte?«
»Am besten noch heute, Frau Berger.« Eric beugte sich ihr zu. »Ich kann sehr gut verstehen, wie entsetzt und bestürzt Sie sind, aber heutzutage kann auch ein Diabetiker ein fast völlig normales Leben führen. Die drei Säulen einer langfristigen Behandlung sind Insulinzufuhr, Diät und eine gute Schulung der Kranken.«
Melanie schloß die Augen und atmete tief durch. »Gut, ich werde vernünftig sein«, versprach sie leise, »auch wenn ich dadurch Gefahr laufe, meinen Freund zu verlieren.« Sie hob den Kopf und sah ihn an. »Sie werden sich bestimmt gewundert haben, daß ich gesetzlich versichert bin?«
»Ja.« Der Arzt nickte.
»Ich bin weder reich noch auch nur wohlhabend.« Melanie erzählte ihm, daß sie schon als Kind den Wunsch gehabt hatte, einmal in einem Luxushotel zu wohnen. »Sie ahnen nicht, wie lange ich Mark auf Mark gelegt habe, um mir diesen Traum zu erfüllen. Daß ich mich während meines Aufenthaltes im »Luisenhof« in den Sohn des Besitzers verlieben würde und er sich in mich, das war nicht geplant.«
»Herr Thomson ahnt also nichts von Ihren wahren wirtschaftlichen Verhältnissen?«
»Nein, ich habe ihm nicht gesagt, daß ich bei einer Versicherung angestellt bin.«
»Und Sie glauben, es würde an seiner Liebe etwas ändern?« fragte der Arzt. »Nein, so gut kenne ich Jörg Thomson. Er gehört zu den Menschen, die genau wissen, daß es kein Privileg ist, in seine Kreise hineingeboren zu werden, sondern ganz einfach nur Glück. Er wird Ihren Wunsch verstehen. Außerdem haben Sie nichts Schlimmes getan. Natürlich wäre es besser gewesen, ihm von Anfang an reinen Wein einzuschenken, doch wie schnell verpaßt man in solchen Dingen den richtigen Augenblick.«
»Dann halten Sie mich also nicht für eine Hochstaplerin?« Die junge Frau fühlte sich um einiges leichter.
»Natürlich nicht«, versicherte er. »Wenn Sie wollen, spreche ich mit Ihrem Freund.«
Melanie war versucht, das Angebot des Arztes anzunehmen, doch dann schüttelte sie den Kopf. »Ich werde es ihm selbst sagen«, beschloß sie. »Irgendwie muß es mir gelingen, ihn davon zu überzeugen, daß ich nicht in den »Luisenhof« gekommen bin, um mir einen reichen Mann zu angeln.«
»Sie werden es schaffen«, sagte Eric zuversichtlich. Er hob den Telefonhörer ab, um im Krankenhaus anzurufen und die Einweisung der jungen Frau zu veranlassen. Der Mensch ist schon ein seltsames Wesen, dachte er. Er hatte oft erlebt, daß die Angst, einen geliebten Freund zu verlieren, selbst schwere Krankheiten in den Hintergrund drängte.
*
»Ah, da kommt ja unser Sohn«, bemerkte Gerhard Thomson. »Wir dachten schon, du würdest uns versetzen.«
»Aber nicht, wenn es Sauerbraten mit Knödel zum Mittagessen gibt«, versicherte Jörg. Er trat an den Eßtisch und küßte seine Mutter auf die Wange. »Tut mir leid, daß ich mich verspäte.« Er lachte. »Allerdings dienstlich«, fügte er hinzu und setzte sich. »Die alte Frau Hofmeister hat mir von der Hochzeit Ihrer Enkelin erzählt. Ich konnte sie nicht gut mit dem Hinweis auf mein Mittagessen unterbrechen.«
»Nein, zumal sie seit über zehn Jahren zu unseren Stammgästen gehört«, pflichtete ihm sein Vater bei. »Hoffentlich hast du dir noch nichts für heute nachmittag vorgenommen. Ich möchte mit dir über die Erweiterungspläne sprechen. Wir sollten langsam Nägel mit Köpfen machen.«
»Tut mir leid, das müssen wir auf den Abend oder morgen verschieben«, sagte Jörg. »Ich möchte Melanie ins Krankenhaus bringen.« Er bemerkte, wie auf der Stirn seines Vaters eine Ader schwoll. »Sie…«
»Weshalb muß Frau Berger ins Krankenhaus?« warf Maria Thomson ein. »Ist sie krank?«
Jörg hatte seinen Eltern nichts vom Zusammenbruch seiner Freundin am Sonntag erzählt. »Doktor Baumann hat festgestellt, daß Melanie Diabetes hat«, erwiderte er. »Sie soll im Krankenhaus gründlich untersucht und auf die für sie notwendige Insulinmenge eingestellt werden.« Er wandte sich an seinen Vater: »Da Melanie nicht weiß, wie lange sie in der Klinik bleiben muß, habe ich veranlaßt, daß sie vorzeitig ihr Zimmer bei uns kündigen kann. Wir können es ohne Schwierigkeiten schon morgen wieder belegen.«
»Ich nehme an, du hast vor, Frau Berger täglich im Krankenhaus zu besuchen«, sagte Gerhard Thomson eisig.
»Ja.«
»Verbrenn dir nicht die Finger, Jörg. Ich weiß, daß ich mich wiederhole, doch mit dieser Frau stimmt etwas nicht. Wenn man einmal so lange wie ich in unserem Beruf ist, dann hat man dafür eine Nase. Es ist nicht so, daß ich Frau Berger nicht mag, sie besitzt Stil, einen guten Geschmack, hat ausgezeichnete Manieren… Trotzdem…« Er legte sein Besteck an den Tellerrand. »Du kannst sagen was du willst, mein Sohn. Diese Frau ist dir gegenüber nicht offen. Sie verbirgt etwas.«
Jörg hatte keine Lust, sich mit seinem Vater zu streiten. Deshalb ging er auch nicht weiter auf dessen Worte ein, sondern sprach von den beiden Pferden, die sie sich noch für ihren Reitstall anschaffen wollten. »Wir sollten auch an die Kinder unserer Gäste denken und uns einige Ponys zulegen«, meinte er.
»Keine schlechte Idee«, bemerkte seine Mutter.
»Gibt es auf dem Gestüt der Kordes auch Ponys?« erkundigte sich Gerhard Thomson.
»Ein paar«, erwiderte sein Sohn. »Wenn wir von den Kordes die beiden Pferde kaufen, können wir sie uns anschauen.«
»Deine Idee ist nicht schlecht«, gab der Hotelier zu. »Ich laß dir da völlig freie Hand, und was die Pferde betrifft, ebenfalls. Zum einen weiß ich, daß uns Heinz Kordes nicht übers Ohr hauen wird, zum anderen verstehst du mehr von Pferden als ich.«
»Kann deine Melanie reiten?« erkundigte sich Maria Thomson.
Jörg bedauerte, daß seine Mutter nicht mit dieser Frage gewartet hatte, bis er mit ihr allein gewesen wäre. Er befürchtete, daß sein Vater dankbar den Faden aufnehmen würde, und es überraschte ihn, als dieser darauf verzichtete. »Ich weiß es nicht«, antwortete er. »Ich werde sie danach fragen.«
Melanie saß auf der Terrasse und trank nach dem Essen eine Tasse Kaffee. Niedergeschlagen schaute sie auf den Swimmingpool und die kleinen, von Buschwerk umgebenen Nischen mit ihren Liegestühlen, Tischen und Bänken. Sie dachte wieder daran, wie lange sie für diesen Urlaub gespart hatte. Warum mußte das ausgerechnet ihr passieren?
Jörg kam auf sie zu. »Hallo, da bin ich«, sagte er und setzte sich. »Hast du alles gepackt?«
Die junge Frau nickte. »Den größeren meiner Koffer habe ich bereits in eurem Aufbewahrungsraum untergestellt. Ich nehme nur den kleineren ins Krankenhaus mit.«
»Ja, das ist sehr vernünftig.« Jörg umfaßte liebevoll ihre Hand.
»Im Moment erscheint mir das Leben ziemlich düster«, gestand sie. »Am liebsten würde ich schreiend durch die Gegend laufen. Ich werde lernen müssen, mich selbst zu spritzen. Ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, daß ich jemals dazu in der Lage sein werde.«
»Du wirst es«, versicherte er. »Es gibt sehr viele Leute, die seit ihrer frühesten Kindheit mit Diabetes leben müssen. Auch wenn es kein Trost sein mag, es gibt schrecklichere Krankheiten.«
Um Melanies Lippen huschte ein Lächeln. »Und aus dem Chaos sprach eine Stimme, sei froh und freue dich, es hätte noch schlimmer kommen können«, zitierte sie. »Ich war froh und freute mich, und es kam schlimmer.«
»Es wird nicht schlimmer kommen«, meinte der junge Hotelier zuversichtlich. »Außerdem bist du nicht allein. Ich werde immer an deiner Seite sein.« Er beugte sich vor und küßte sie auf die Wange.
Eine halbe Stunde später verließen die jungen Leute das Hotel. Ein Page brachte Melanies Koffer zu Jörgs Porsche. Sie hatten vereinbart, daß ihr eigener Wagen bis zu ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus auf dem Hotelparkplatz bleiben sollte. Die junge Frau gab dem Pagen ein großzügiges Trinkgeld, dann stieg sie in den Sportwagen ihres Freundes. Sie hatte ihm noch immer nicht gesagt, daß sie bei einer Versicherung arbeitete.
»Wir nehmen die am See entlangführende Straße«, bestimmte Jörg, nachdem sie den Bereich des Hotels verlassen hatten. Er legte eine Hand auf ihr Knie. »Kopf hoch, Melanie. Mach nicht so ein niedergeschlagenes Gesicht.«
Melanie atmete tief durch. Sie durfte nicht länger zögern. »Jörg, bitte fahr auf den nächsten Parkplatz«, bat sie. »Es gibt etwas, was ich dir sagen muß.«
Der junge Mann warf ihr einen überraschten Blick zu. »Klingt, als sei es etwas Ernstes«, erwiderte er und bog von der Straße ab. Kurz darauf brachte er seinen Wagen zum Stehen. Er löste seinen Gurt und setzte sich so, daß er seine Freundin voll ansehen konnte. »Falls du mir einen Mord gestehen willst, laß es…«
Melanie löste ebenfalls den Gurt. »Gehen wir ein paar Schritte«, schlug sie vor und öffnete die Wagentür.
Jörg mußte an die Worte seines Vaters denken. »Sie verbirgt etwas vor dir«, hörte er ihn sagen. Seine Kehle fühlte sich plötzlich furchtbar trocken an. Widerwillig stieg er aus. Er war sicher, daß er nicht hören wollte, was ihm seine Freundin zu sagen hatte.
Schweigend überquerten sie die Straße, gingen zum See hinunter und starrten auf das in der Sonne glitzernde Wasser.
»Wie schön es hier ist.« Melanie beschattete die Augen mit der Hand. »So wunderschön. Manchmal habe ich das Gefühl, schon eine Ewigkeit am Tegernsee zu leben.« Sie ließ die Hand sinken und blickte zu ihm auf. »Seit meiner Kindheit habe ich davon geträumt, in einem Luxushotel einen Traumurlaub zu verleben. Mit jedem Film, in dem die Hauptpersonen in so einem Hotel ein- und ausgingen, wurde mein Wunsch größer. Also sparte ich und sparte…«
Jörg stieß vor Erleichterung heftig den Atem aus. »Und ich dachte schon, du hättest irgendwo eine Leiche im Keller«, sagte er und riß sie stürmisch an sich. »Melanie, mir ist es völlig gleich, ob du Geld hast oder nicht. Worauf es ankommt, ist einzig und allein unsere Liebe. Ich brauche keine Freundin, die wie Dagobert Duck den größten Teil ihrer Zeit damit verbringt, im Geld zu baden.«
Melanie mußte lachen. »Und du bist nicht enttäuscht, weil ich dir nicht von Anfang an reinen Wein eingeschenkt habe?«
Der junge Mann lauschte in sich hinein. »Ein bißchen schon«, gab er zu. »Du hättest mir ruhig die Wahrheit sagen können.«
»Ich hatte ganz einfach Angst, dich zu verlieren«, gestand seine Freundin. »Außerdem ist es ein wundervolles Gefühl gewesen, einmal so zu tun, als würde es einem nicht auf das Geld ankommen.«
Er legte den Arm um sie. »Du hast nie von deiner Familie erzählt, von deinem Beruf. Wenn ich dich gefragt hätte, hättest du mir die Wahrheit gesagt?«
»Ja«, erwiderte Melanie spontan. »Ich hätte dich nicht anlügen können.«
»Das ist alles, was ich wissen will.« Jörg nahm sie in die Arme. »Du hast nichts Unrechtes getan. Manche Leute sparen, um eine Reise rund um die Welt zu machen, oder kaufen sich eine Parzelle auf dem Mond. Ich bin froh, daß du dich zu einem Aufenthalt im »Luisenhof« entschieden hast, denn sonst hätten wir uns nie
kennengelernt.« Leidenschaftlich küßte er sie, und Melanie vergaß, wieviel Angst sie vor ihrem Geständnis gehabt hatte. Jörg liebte sie, was jetzt noch kam, konnte sie nicht mehr schrecken.
*
Es geschah nicht oft, daß Dr. Baumann dazu kam, eine längere Wanderung zu machen, doch am Mittwochnachmittag beschloß er, zwei, drei Stunden mal alles hinter sich zu lassen und mit Franzl ein Stück in Richtung Neureuth zu marschieren. Er hatte keine Sprechstunde und auch keine Patienten zur Akupunktur oder Neuraltherapie bestellt.
Katharina Wittenberg hatte dafür gesorgt, daß weder er noch Franzl auf der Wanderung verhungern konnten. »Deinetwegen muß ich mich so plagen«, meinte er, nachdem er auf einem Parkplatz beim Lieberhof seinen Wagen abgestellt hatte und den Rucksack schulterte. »Ich gehe jede Wette ein, daß über die Hälfte des Vespers dir gehört.«
Franzl stellte sich auf die Hinterpfoten, stützte sich mit den Vorderpfoten am Rücken seines Herrchens ab und versuchte, nach dem Rucksack zu schnappen. Da sein Geruchssinn bedeutend besser als Erics ausgebildet war, hatte er längst wahrgenommen, daß es unter anderem auch kalten Braten und Würstchen gab.
»Nichts da, alter Freund.« Eric drehte sich blitzschnell herum. Franzls Vorderpfoten gruben sich ins Gras. Vorwurfsvoll blickte er zu seinem Herrchen auf. »Ohne Fleiß kein Preis«, erklärte der Arzt. »Also komm!«
Innerhalb weniger Minuten hatte Franzl den Rucksack und dessen Inhalt vergessen. Vergnügt rannte er Eric voraus zum Wald. Er wußte zwar, daß dort seine Freiheit ein Ende hatte, weil er in der Nähe seines Herrchens bleiben mußte, doch das tat seiner Freude keinen Abbruch.
Eric spürte, wie die Anspannung der letzten Tage von ihm abfiel. So sehr er seinen Beruf liebte, es gab Situationen, da fragte er sich, weshalb er um alles auf der Welt Arzt geworden war. Erst am Vormittag hatte er einer jungen Mutter sagen müssen, daß sie an Darmkrebs litt, und am Vortag war es seine Pflicht gewesen, einem Elternpaar zu erklären, daß ihr kleiner Sohn an akuter Leukämie litt und es sehr schlecht um ihn stand.
Plötzlich stoppte Franzl. Er stemmte die Vorderpfoten in den Waldboden und kläffte einen Mann an, der aus dem Unterholz kam. Erschrocken blieb der Mann stehen, traute sich kaum, sich zu rühren.
»Franzl, was soll das?« fragte Dr. Baumann unwillig. An und für sich war es nicht die Art seines Hundes, fremde Leute anzubellen. Er griff nach Franzls Halsband. »Entschuldigen Sie bitte«, bat er und sah den Fremden an. Im Grunde genommen wunderte ihn Franzls Reaktion nicht. Der Mann wirkte wenig vertrauenerweckend. Er schien seit Tagen nicht aus seinen Kleidern gekommen zu sein. Trotz des warmen Wetters trug er eine schmuddelige Pudelmütze. Sein Gesicht wurde zum großen Teil von einem stoppeligen Bart bedeckt.
»Schon gut«, antwortete der Fremde.
Eric stutzte. Er hatte diese Stimme schon einmal gehört, da war er ganz sicher. »Kennen wir uns?« fragte er und versuchte, das Gesicht des Mannes mit einem der Menschen in Verbindung zu bringen, die ihm im Laufe der letzten Jahre begegnet waren.
Der Mann holte tief Luft. »Ja, wir kennen uns, Eric«, antwortete er widerwillig. »Allerdings ist es schon lange her.« Er zögerte einen Moment, dann streckte er dem Arzt die Hand entgegen.
Franzl begann mit hochgezogenen Lefzen zu knurren.
»Franzl, jetzt reicht’s!« Eric ergriff die Hand des Mannes. »Tut mir leid, ich…«
Der Mann fuhr mit der linken über seinen Bart. »Vielleicht sollte ich mich mal rasieren. Andererseits…« Er hob die Schultern. »Ich bin Martin Hellwert. Wir haben zusammen studiert.«
»Martin?« Eric konnte es nicht fassen. Er schaute seinem ehemaligen Kommilitonen erneut ins Gesicht. Ja, jetzt konnte er eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Martin von früher erkennen. »Bist du auf Urlaub, oder lebst du am Tegernsee?« fragte er.
»Ich lebe hier«, antwortete Dr. Martin Hellwert. »Allerdings nicht direkt am See. Ich habe von einem Herrn Vögele aus Rottach-Egern eine Berghütte in Richtung Neureuth gemietet.«
»Arno Vögele?«
»Du kennst ihn?«
»Ja, er gehört zu meinen Patienten.«
»Stimmt, du hast die Praxis deines Vaters übernommen.«
»Und du? Praktizierst du noch in München?«
Martin Hellwert erstarrte. »Momentan nicht«, erklärte er. »Aber das ist eine lange Geschichte,
Eric.« Er beugte sich zu Franzl hinunter und hielt ihm die Hand hin. Der Hund begann, mißtrauisch an ihr zu schnüffeln, schließlich ließ er sich bewegen, einige Male mit der Rute zu wedeln. So ganz traute er dem Frieden immer noch nicht.
»Hast du etwas Besonderes vor, Martin?« erkundigte sich Eric. »Ich will noch ein Stückchen laufen und mich dann zum Vespern niederlassen. Wenn du Lust hast…«
»Ich wollte zum nächsten Bauernhof, um mich mit allem Notwendigen einzudecken«, fiel ihm Martin ins Wort.
»Schade.« Dr. Baumann dachte nach. »Was würdest du davon halten, mich am Sonntag zu besuchen?« fragte er. »Meine Haushälterin ist eine hervorragende Köchin. Sie würde sich genauso freuen wie ich, wenn du kommen würdest.«
»Es gibt kaum noch Leute, die sich in meiner Gesellschaft wohl fühlen«, sagte Martin Hellwert und blickte an sich hinunter. »Selbst, wenn ich mich anständig kleide, bin ich nicht mehr der Mann, der ich einst gewesen bin.«
»Du wirst uns so willkommen sein, wie du bist«, versprach Eric. »Wir erwarten dich also zum Kaffee und zum Abendessen. Am besten, du kommst so gegen drei.« Er fühlte, daß sein früherer Kommilitone dringend Hilfe brauchte. Irgend etwas mußte in Martins Leben total danebengegangen sein. Er konnte sich noch erinnern, wie begeistert sich Martin ins Studium gestürzt hatte. Er war einer der eifrigsten gewesen, wenn es darum ging, Wissen in sich hineinzustopfen.
»Also, ich komme am Sonntag«, versprach Dr. Hellwert. »Reden wir von alten Zeiten und unseren damaligen Illusionen. Ich dachte, als Arzt müßtest du dich in erster Linie um deine Patienten kümmern, alles andere wäre nebensächlich. Nun, das Leben hat mich eines Besseren belehrt.« Er nickte Eric zu und ging einfach davon, ohne sich mit einem Abschiedsgruß aufzuhalten.
Dr. Baumann schaute ihm nach. Martin Hellwert drehte sich nicht ein einziges Mal um. Mit hängenden Schultern marschierte er den Berg hinunter.
Franzl kläffte herausfordernd. Er wollte weiter.
»Schon gut, mein Freund.« Eric umfaßte mit beiden Händen die Gurte seines Rucksacks. »Machen wir, daß wir weiterkommen. Im Moment können wir Martin ohnehin nicht helfen.« Er drehte sich ein letztes Mal nach seinem früheren Studienkollegen um. Es war nichts mehr von ihm zu sehen. »Womöglich ist uns nur ein Geist begegnet«, sagte er zu Franzl. »Natürlich stellt sich in diesem Fall die Frage, ob ein Geist so verbittert sein kann.«
Franzl bellte erneut. Dann entdeckte er ein Eichhörnchen, das mitten auf dem Weg saß, wo es seiner Meinung nach überhaupt nichts zu suchen hatte. Also blieb ihm nichts anderes übrig, als Ordnung zu schaffen und es die nächste Kiefer hinaufzujagen. Beifallheischend schaute er sich nach seinem Herrchen um. Statt des erwarteten Lobes zeigte ihm Dr. Baumann die Leine. Erschrocken ließ sich Franzl auf sein Hinterteil fallen und hob eine Vorderpfote, als wollte er um Verzeihung bitten.
»Du bist und bleibst ein Schauspieler«, sagte der Arzt lachend. »Wenn ich dich nicht an die Leine nehmen soll, benimmst du dich anständig und läßt die armen Eichhörnchen in Ruhe.« Er schlug Franzl leicht auf den Rücken. »Also komm schon. Bevor wir nicht an der nächsten Lichtung sind, gibt es kein Vesper.«
Seine Worte wirkten wie eine Zauberformel auf Franzl.
Der Hund sprang auf und rannte unternehmungslustig ein paar Schritte voraus. Mit einem verständnisvollem Herrchen und einen Rucksack, in dem auch ein paar Würstchen für ihn steckten, konnte das Leben wirklich wundervoll sein.
*
Jörg Thomson ging zu seinem Sportwagen. Geradezu liebevoll legte er den Rosenstrauß, den er am Morgen eigenhändig geschnitten hatte, auf den Beifahrersitz. Seine Liebe zu Melanie wurde mit jedem Tag größer. Meistens wachte er schon am Morgen mit den Gedanken an sie auf. Daß sie kein Geld besaß, interessierte ihn nicht. Wichtig war einzig und allein, was sie füreinander empfanden.
»Jörg!«
Der junge Mann drehte sich um. »Ja, Vater?« fragte er. »Ich fahre ins Krankenhaus. Soll ich irgend etwas besorgen?«
Gerhard Thomson blieb kurz vor seinem Sohn stehen. »Dich scheint überhaupt nicht zu bekümmern, was wir über diese Frau denken«, bemerkte er. »Du verrennst dich da in eine Geschichte, aus der es später nur schwer ein Entkommen geben wird.«
Jörg zählte in Gedanken bis zehn. »Erstens handelt es sich bei dieser Frau, wie du Melanie in den letzten Tagen ständig bezeichnest, um meine Freundin, und zweitens will ich aus dieser Geschichte überhaupt nicht herauskommen.«
Der Hotelier berührte die Schulter seines Sohnes. Er zuckte zusammen, als Jörg seine Hand mit einer flüchtigen Bewegung abschüttelte. »Wir wollen nur nicht, daß du mit offenen Augen in dein Unglück rennst. Wie schnell macht man in solchen Dingen einen Fehler. Bei Frau Berger handelt es sich zweifellos um eine Hochstaplerin. Wir sollten froh sein, daß sie gezwungen gewesen ist, die Wahrheit zu bekennen. Wenn…«
»Melanie ist keine Hochstaplerin. Sie hat nicht ein einziges Mal behauptet, Geld zu haben. Und eines weiß ich, sie besitzt mehr Benehmen und Anstand, als man von vielen unserer finanzkräftigen Gäste behaupten kann.«
»Wenn Sie Anstand besitzen würde, wäre sie nicht unter falschen Fahnen gesegelt.«
»Ich habe keine Lust, mich mit dir zu streiten, Vater«, sagte Jörg. »Wie es aussieht, kann ich dich sowieso nicht überzeugen. Außerdem solltest du nicht voraussetzen, daß Mutter deiner Meinung ist. Sie mag nämlich Melanie.«
»Das hat damit nichts zu tun, Jörg. Ich weiß, daß wir dir in den letzten beiden Jahren ziemlich zugesetzt haben, weil du keine Anstalten gemacht hast, dich nach einer Frau umzusehen, das bedeutet jedoch nicht, daß du dich nun Hals über Kopf in ein Abenteuer stürzen mußt, dessen Folgen du nicht absehen kannst.«
»Ich weiß sehr gut, was ich tu’, verlaß dich darauf«, widersprach der junge Mann. »Außerdem ist es einzig und allein meine Entscheidung, wen ich eines Tages heiraten werde.« Er sah seinem Vater voll ins Gesicht. »Was hättest du gesagt oder getan, wenn dein Vater versucht hätte, dich von Mutter zu trennen? Ich nehme an, du hättest deine Sachen gepackt und wärst gegangen. Für jemanden mit deiner Ausbildung hätten alle guten Hotels der Welt offengestanden.«
»Das ist anzunehmen«, meinte Gerhard Thomson unsicher.
»Nun, auch mir würden sie offenstehen«, erklärte Jörg. »Bitte, denk darüber nach.« Er setzte sich in seinen Wagen. »Ich bin in etwa zwei Stunden zurück.« Entschlossen drehte er den Zündschlüssel herum und gab Gas. »Wiedersehen!« Obwohl ihm im Moment nicht der Sinn danach stand, besonders freundlich zu seinem Vater zu sein, hob er die Hand und winkte. Er wollte es nicht zu einem Bruch kommen lassen. Sie hatten niemals einen ernsthaften Streit gehabt und sich bisher stets aufeinander verlassen können.
»Wiedersehen«, antwortete Gerhard Thomson resignierend und hob ebenfalls die Hand. Wie gebannt blieb er stehen, um dem Sportwagen seines Sohnes nachzublicken. Er spürte, daß sie an einem Scheideweg angekommen waren. Bisher hatte sich Jörg stets nach seinen Wünschen gerichtet, und ihm war das als selbstverständlich erschienen. Doch er hatte sich all die Jahre nur etwas vorgemacht. Er konnte von seinem Sohn nicht verlangen, ohne nach rechts oder links zu schauen die Straße zu gehen, die er für ihn gebaut hatte. – Aber mußte es ausgerechnet jetzt sein, daß Jörg rebellierte?
Langsam drehte er sich um und kehrte ins Hotel zurück. »Du bist ein Snob«, hatte seine Frau erst am Morgen gesagt, als er mit ihr über Melanie Berger gesprochen hatte. Er hatte diese Bezeichnung weit von sich gewiesen. Ihm ging es einzig und allein darum, daß Jörg eine Frau heiratete, die zu ihm paßte und auf die er sich verlassen konnte.
Melanie Berger hatte er von Anfang an nicht recht getraut, und wie sich herausgestellt hatte, nicht zu unrecht. Sie war unter falschen Voraussetzungen in sein Hotel gekommen, und er ließ es sich nicht nehmen, daß sie vorgehabt hatte, sich einen reichen Mann zu angeln. Und wie es aussah, hatte sie sogar damit Erfolg gehabt.
Andererseits kannte sein Sohn diese Frau noch keine drei Wochen. Junge Männer verliebten sich rasch. Mit ein bißchen Glück erwies sich Jörgs Liebe zu Melanie Berger als Strohfeuer und würde schnell verlöschen.
Dem Hotelier wurde bewußt, daß er mit seinem Verhalten genau das Gegenteil von dem erreichte, was er wollte. Er mußte seinen Widerstand gegen Melanie aufgeben, wenn er ihr nicht seinen Sohn regelrecht in die Arme treiben wollte. Er beschloß, in Zukunft kein Wort mehr gegen die junge Frau zu sagen.
*
Dr. Eric Baumann befreite Franzl von seinem Halsband und hängte es an den dafür vorgesehenen Haken neben der Flurgarderobe. Herr und Hund hatten einen ausgiebigen Spaziergang gemacht. Die Küchentür stand einen Spalt breit offen. Der Arzt öffnete sie ganz. »Dein Kuchen duftet einfach wundervoll, Katharina«, sagte er. »Uns läuft das Wasser im Munde zusammen.«
Seine Haushälterin lächelte geschmeichelt. »Trotzdem gibt es kein Stückchen, bevor wir nicht mit deinem Gast draußen auf der Terrasse sitzen«, erklärte sie.
Franzl stieß einen tiefen Seufzer aus, drehte sich um, marschierte mit zwischen die Beine geklemmter Rute zu seinem Korb und ließ sich mit einem lauten Plumps hineinfallen.
»Sieht aus, als hättest du ihn gekränkt«, bemerkte der Arzt.
»Das macht nichts.« Katharina schaltete die Kaffeemaschine ein. »Hoffentlich ist dein Doktor Hellwert pünktlich.«
Eric trat ans Fenster. »Sieht aus, als wäre er es«, meinte er und wies nach draußen. Ein alter Ford hatte vor dem Haus gehalten. Martin Hellwert, gekleidet in Cordhosen und ein lose darüberhängendes Hemd, stieg aus. Er hatte sich sogar rasiert.
Kaum hatte Eric die Haustür geöffnet, drängte sich Franzl auch schon an ihm vorbei. Kläffend baute er sich vor dem Besucher auf.
»Ich habe keine Angst vor dir«, sagte Dr. Hellwert. Er nahm einen Kauknochen vom Beifahrersitz seines Wagens. »Was hältst du davon?«
Franzl dachte nicht daran, sich bestechen zu lassen, obwohl der Kauknochen genau die richtige Größe für ihn hatte. Er hielt im Kläffen inne und drehte sich zu seinem Herrchen um.
»Ich freue mich, daß du gekommen bist, Martin.« Eric reichte seinem Kollegen die Hand.
»Ich wollte dich nicht enttäuschen«, sagte Martin Hellwert. »Nimmst du jetzt den Knochen?« Er hielt ihm Franzl erneut hin. »Ich sehe doch, wie gern du ihn hättest.«
»Na, nimm ihn schon«, forderte Eric.
Bereits im nächsten Augenblick schnappte sich Franzl den Knochen und verschwand mit ihm im hinteren Teil des Gartens.
»Versteckt er ihn?« fragte Martin.
»Nein, er sucht sich nur ein ungestörtes Plätzchen, um ihn zu verspeisen.« Eric führte seinen Kollegen ins Haus. »Danke, daß du an Franzl gedacht hast.«
»Ich mag Hunde. Wie sagt man so schön, sie wären die besseren Menschen.«
»So würde ich das nicht sehen.«
»Kommt immer darauf an, was man erlebt hat.« Martin Hellwert wandte sich Katharina Wittenberg zu, die in diesem Moment aus der Küche kam, um den Gast zu begrüßen. »Sie müssen die Dame sein, deren Kochkunst Eric neulich über alle Maßen gelobt hat.«
Katharina errötete bis zu den Haarwurzeln. »Nun, ich gebe mir Mühe«, sagte sie.
»Große Mühe«, verbesserte
Eric sie. »Katharina würde jedem Hotel Ehre machen.«
»Hören Sie nicht auf ihn, Doktor Hellwert«, sagte die Haushälterin. »Sie kennen ja Eric. Er muß immer übertreiben.«
Bald darauf saßen sie am Terrassentisch bei Kaffee und Kuchen. Sie sprachen über frühere Zeiten. Eric erzählte von seinem zweijährigen Aufenthalt in Kenia und daß es ihm nicht leichtgefallen war, nach dem Tod seines Vaters dort alles aufzugeben und die Praxis in Tegernsee zu übernehmen.
»Inzwischen weiß ich, daß ich das Richtige getan habe«, meinte er. »Ich gehöre hierher. In Kenia wäre ich auch in zehn Jahren noch ein Gast gewesen.«
Katharina brachte neuen Kaffee, dann zog sie sich zurück. Sie spürte, daß Dr. Hellwert allein mit Eric sprechen wollte. Außerdem hatte sie noch einiges für das Abendessen vorzubereiten, und sie wollte auch einen Heimatfilm anschauen, der im Fernsehen lief.
»Wir haben die ganze Zeit von mir gesprochen«, sagte Eric, als sie allein waren. Er schenkte für seinen Gast Kaffee ein.
Franzl kam und rollte sich unter dem Tisch zusammen. Es war ein besonders kräftiger Kauknochen gewesen, und es hatte ihn einige Mühe gekostet, ihn aufzufressen. Jetzt brauchte er erst einmal etwas Ruhe.
»Was gibt es schon von einer gescheiterten Existenz zu reden?« fragte Martin bitter. »Ich hatte eine Familie, eine schöne Praxis und glaubte, auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen. Irrtum! Als ich eines Tages früher als erwartet von einem Kongreß nach Hause kam, fand ich meine Frau in den Armen meines besten Freundes. Bei der Scheidung wurde ich von ihr und ihrem Anwalt wie eine Weihnachtsgans ausgenommen, zudem bekam sie das Sorgerecht für unseren kleinen Sohn zugesprochen. Inzwischen hat meine frühere Frau meinen Ex-Freund geheiratet, und Claus trägt seinen Namen, weil es angeblich zum Wohle des Kindes ist. Ich habe vergeblich dagegen geklagt.«
»Ich kann mir vorstellen, wie furchtbar das alles für dich ist, dennoch solltest du dich nicht von den Menschen zurückziehen, Martin«, meinte Dr. Baumann betroffen. »Du mußt versuchen, einen neuen Anfang zu finden.«
»Einen neuen Anfang?« Martin Hellwert lachte höhnisch auf. »Womöglich hätte es mir gelingen können, einen neuen Anfang zu finden, aber dann kam die Steuerprüfung und hat mir den Rest gegeben. Ein Rachefeldzug meiner Ex-Frau, nachdem ich erneut versucht hatte, das Sorgerecht für meinen Sohn zu bekommen. Ich nehme jedenfalls an, daß sie es gewesen ist, die mich beim Finanzamt angezeigt hat.« Er strich sich mit beiden Händen durch die Haare. »Besonders ein Steuerinspektor hat sich damit hervorgetan, mir den Todesstoß zu versetzen. Er stand damals kurz vor seiner Frühpensionierung. Als Heinz, der Gnadenlose, ist er weit über München hinaus bekanntgewesen.«
Heinz? – Heinz Seitter? Konnte es sein, daß sein Studienkollege von Heinz Seitter sprach? Dr. Baumann dachte an die anonymen Briefe und Anrufe, die der Steuerinspektor a. D. seit Wochen erhielt. Einmal hatte man ihn sogar bei Dunkelheit niedergeschlagen. Konnte Martin Hellwert…
Katharina Wittenberg stürzte auf die Terrasse hinauf. »Bei der Prinz-Karl-Kapelle hat es vor fünf Minuten einen Unfall gegeben!« rief sie den Männern zu. »Frau Winkler hat eben von ihrem Auto aus angerufen. Sie hat den Unfall beobachtet.«
»Vielleicht braucht man unsere Hilfe.« Eric sprang auf. »Du kommst doch mit, Martin?«
»Natürlich«, antwortete Dr. Hellwert und schob seinen Stuhl zurück. Eilig folgte er seinem Kollegen zum Wagen.
*
Melanie saß in einem der Sessel, die im Foyer des Krankenhauses standen, und beobachtete den Eingang. Sie hatte sich mit Jörg um vier verabredet. Es war das erste Mal, seit sie ihn kannte, daß er sich verspätete. Die junge Frau nahm sich vor, ihren Freund damit gehörig aufzuziehen.
Ein verträumtes Lächeln umspielte ihre Lippen. Jetzt konnte sie sich nicht mehr erklären, warum sie solche Angst gehabt hatte, Jörg die Wahrheit zu gestehen. Er liebte sie, und es war ihm völlig egal, daß sie kein Vermögen besaß.
Plötzlich mußte sie an seine Eltern denken. Ihr Freund hatte ihr erzählt, wie ihm sein Vater am Mittwoch wieder zugesetzt hatte. Sie konnte es Gerhard Thomson nicht verdenken, daß er gegen sie war. Immerhin hielt er sie für eine Hochstaplerin, wenngleich sie niemals behauptet hatte, vermögend zu sein.
Melanie stand auf und ging langsam durch das Foyer. Obwohl sie die meisten der Anschläge schon kannte, begann sie damit, sie erneut zu lesen. Sie wäre gern zum Kiosk gegangen, um sich ein Eis oder Schokolade zu kaufen, da sie jedoch gerade auf die richtige Insulinmenge eingestellt wurde, durfte sie das nicht.
Aus der Traum vom süßen Leben, dachte sie sarkastisch. Aber es gab Schlimmeres, als in Zukunft mit Süßigkeiten sehr vorsichtig sein und eine genaue Diät einhalten zu müssen. Außerdem hatte sie Jörg. Seine Liebe würde ihr helfen, mit den Einschränkungen, die ihr durch ihre Krankheit auferlegt wurden, fertigzuwerden.
Wo blieb er nur?
Melanie ertappte sich dabei, daß sie alle paar Minuten zu der großen Uhr blickte, die in der nähe der Portiersloge an der Wand hing. Sie überlegte, ob sie im Hotel anrufen und nach ihrem Freund fragen sollte, befürchtete allerdings, daß man sie womöglich mit Gerhard Thomson verbinden würde, und mit ihm wollte sie nicht sprechen.
Es wurde fünf, dann halb sechs. Die junge Frau fuhr mit dem Aufzug nach oben. Womöglich hatte Jörg versucht, sie anzurufen. Eilig ging sie zu ihrem Zimmer und fragte ihre beiden Bettnachbarinnen, ob ein Anruf für sie gekommen sei.
»Nein«, erwiderte die jüngere von ihnen.
»Sieht aus, als hätte man Sie versetzt«, bemerkte die andere.
Auf ihrem Nachttisch stand das Abendessen. Melanie hatte zwar keinen Appetit, trotzdem aß sie etwas. Sie hatte inzwischen gelernt, wie wichtig regelmäßige Mahlzeiten für sie waren. Sie durfte keine auslassen, wenn sie ihre Gesundheit nicht gefährden wollte.
Nach dem Essen brachte die junge Frau das Tablett in den Korridor zum Servicewagen und ging danach auf den Balkon. Auf die Brüstung gestützt schaute sie über die Häuser der Stadt zum See. Langsam brach die Dämmerung herein. Sie beobachtete, wie ein hellerleuchteter Dampfer unweit des Ufers durch das Wasser glitt. Vielleicht war es die »Seemarie«. Jörg und sie waren noch nicht dazu gekommen, mit der »Seemarie« hinauszufahren.
Melanie fiel ein, daß ihr Freund während der letzten drei Tage nichts mehr davon erwähnt hatte, daß sein Vater gegen sie hetzte. Weshalb? Gerhard Thomson hatte sich bestimmt nicht von einer Stunde zur anderen mit ihr abgefunden. Ob der Hotelier erreicht hatte, daß sein Sohn ihre Beziehung überdachte? Daß er…«
Die junge Frau spürte einen Luftzug, als die Balkontür geöffnet wurde. »Jörg!« rief sie freudig aus und drehte sich um. »Ich… Doktor Baumann!« Es fiel ihr schwer, sich ihre Enttäuschung nicht anmerken zu lassen. »Ich dachte, Jörg sei gekommen«, sagte sie und reichte dem Arzt die Hand. »Wir hatten uns verabredet.«
»Das habe ich vorausgesetzt«, erwiderte Eric und wies auf einen der beiden Gartenstühle, die auf dem Balkon standen. »Bitte, nehmen Sie Platz.«
»Was ist passiert?« fragte Melanie, ohne seiner Aufforderung nachzukommen. »Hat Jörg Sie geschickt, um mir zu sagen, daß es zwischen uns aus ist? Hat…«
»Nein, Herr Thomson liebt Sie sehr«, fiel ihr Dr. Baumann ins Wort. »Seine Eltern haben mir erzählt, daß er nach dem Mittagessen zu den Kordes’ nach Rottach-Egern gefahren ist, um sich zwei Pferde und drei Ponys anzuschauen. Danach wollte er sich mit Ihnen treffen. Er…« Eric atmete tief durch. »Ihr Freund hatte bei der Prinz-Karl-Kapelle einen Unfall.«
»Einen Unfall?« wiederholte Melanie entsetzt.
»Ja.« Der Arzt nickte. »Es war nicht seine Schuld. Ein anderer Wagen ist zu schnell gefahren und hat den Sportwagen Ihres Freundes von der Straße gedrängt.«
»Was ist mit Jörg?« fragte Melanie fast tonlos. Es kam ihr vor, als würde sich vor ihr ein gewaltiger Abgrund auftun.
»Herr Thomson hat weder schwerwiegende äußere noch
innere Verletzungen«, antwortete Eric. »Durch den Unfallschock ist er jedoch ins Koma gefallen. Er liegt auf der Intensivstation.«
Melanie preßte die Hände an die Schläfen. Um sie herum schien sich alles zu drehen. Da hatte sie schon geglaubt, Jörg hätte es sich anders überlegt, dabei war er auf dem Weg zu ihr gewesen. Sie fühlte sich entsetzlich schuldig, weil sie an seiner Liebe gezweifelt hatte. »Und wie stehen seine Chancen?« fragte sie mit belegter Stimme.
»Wie gesagt, er ist wie durch ein Wunder bei dem Unfall kaum verletzt worden«, erwiderte Dr. Baumann. »Sorgen bereitet uns im Moment nur sein Koma. Je länger es anhält, um so größer könnten die Spätfolgen sein.«
»Darf ich zu ihm?«
»Ja.« Eric nickte. »Ich habe mit seinen Eltern gesprochen. Sie sind damit einverstanden, daß Sie Jörg besuchen.« Er öffnete die Balkontür. »Wenn Sie möchten, können Sie gleich mitkommen.«
Melanie folgte dem Arzt zur Intensivstation. Jörg befand sich in einem kleinen Zimmer, dessen Jalousien halb herabgelassen waren. Blind für alles um sich herum, sah sie nur ihren Freund, der mit geschlossenen Augen im Bett lag und so leblos wirkte, als hätte man ihn durch eine Schaufensterpuppe ersetzt.
Maria und Gerhard Thomson wichen zur Seite, als Melanie an das Bett trat. Die junge Frau beugte sich über ihren Freund und küßte ihn zärtlich auf die Wange, dann nahm sie seine Hand. »Ich weiß, daß du mich hörst, Jörg«, sagte sie mit fester Stimme. »Was auch geschieht, ich werde für
dich da sein und dich nie im Stich lassen.« Sie strich ihm über die Stirn. »Denk daran, wie wir unten am See miteinander getanzt haben.« Und ohne, daß es ihr recht bewußt wurde, begann sie leise für ihn das Lied zu singen, das sie in jener Nacht gehört hatten.
Die Thomsons und Dr. Baumann wagten es kaum zu atmen. Fasziniert blickten sie zu Melanie, die noch immer Jörgs Hand hielt, während ihre Stimme leise durch den Raum klang. »… Ein Lied singt uns ein Solosaxophon, verrückter Ton, verlorener Ton, ein Schrei, der uns erzählt, daß Liebe siegt. – So singt das Solosaxophon. Es sagt zu mir, halt ihn ganz sacht und tanz, als wär’s die letzte Nacht der Welt…«
Maria Thomson wischte sich über die Augen. »Gehen wir hinaus«, flüsterte sie ihrem Mann zu, weil sie ihre Tränen nicht länger zurückhalten konnte.
»Ja.« Gerhard Thomson legte für den Bruchteil einer Sekunde seine Hand auf Melanies Schulter, dann folgte er Maria und Dr. Baumann in den Korridor. Er spürte, wenn jemand seinem Sohn helfen konnte, dann war es diese junge Frau.
*
Andrea Stanzl wälzte sich in ihrem Bett von einer Seite zur anderen. Sie hatte bis spät in die Nacht hinein in der Küche gestanden und danach noch aufgeräumt. Das Schnarchen ihres Freundes dröhnte überlaut in ihren Ohren. Es tat ihr regelrecht weh. Ihre Augen brannten vor Müdigkeit. Sie sehnte sich nach Schlaf, doch die Schmerzen in ihrem kaputten Knie ließen sie nicht zur Ruhe kommen.
Es war ein Fehler gewesen, heimlich das Haus von Dr. Baumann zu verlassen und zu Herbert Freytag zurückzukehren. Was hatte sie an der Seite dieses Mannes denn zu erwarten? Es verging kein Tag, an dem er ihr nicht sagte, was für eine Niete sie war und welch große Belastung für ihn. Erst am Abend hatte er ihr vorgeworfen, daß er ein viel zu weiches Herz hätte und es ein Fehler gewesen sei, sie wieder aufzunehmen.
Andrea rollte sich zur anderen Seite. Sie konnte Herberts Anblick nicht mehr ertragen, schloß die Augen und versuchte, sich vorzustellen, unter Menschen zu sein, die sie mochten und so annahm, wie sie war. Mit einem Lächeln um den Lippen schlief sie trotz ihrer Schmerzen schließlich ein.
Einige Stunden später wurde die junge Frau brutal aus dem Schlaf gerissen. »Auf, du Vogelscheuche, mach, daß du aus den Federn kommst!« Herbert Freytag rüttelte Andrea bei der
Schulter. »Worauf wartest du noch?«
Andrea schlug die Augen auf. »Wie spät ist es denn?« fragte sie verschlafen.
»Kurz vor acht. Anständige Weiber sind schon längst bei der Arbeit.« Herbert Freytag zog seine rutschenden Boxershorts nach oben. »Hausgang und Treppe müssen geputzt werden. In der Gaststube ist auch Großputz angesagt. Und die Fenster sehen aus, als hätten sie seit Jahren kein Wasser gesehen.« Er stemmte die Fäuste in die Seiten, was seine Boxershorts sofort erneut zum Rutschen brachte. »Daß man dir alles sagen muß.«
»Ich bin erst gegen halb vier eingeschlafen.« Sie richtete sich auf. »Außerdem…«
»Es gibt kein Außerdem mehr!« stieß er hervor. »Meinst du denn, ich füttere dich für nichts und wieder nichts durch?« Er drehte sich um und stapfte nach draußen.
»Altes Ekel«, flüsterte Andrea und stand schwerfällig auf. An diesem Morgen versagte ihr Knie bereits beim dritten Schritt. Sie konnte sich gerade noch an der Tür festhalten, sonst wäre sie hingestürzt. Vorsichtig hob sie das rechte Bein und schwenkte es langsam hin und her, dann stellte sie es zu Boden und trat vorsichtig auf. Ihr Knie tat weh, rutschte aber nicht wieder zur Seite.
Die junge Frau wartete, bis Herbert Freytag das Bad verlassen hatte, dann wusch sie sich in aller Eile und zog sich an.
»Wie lange soll ich noch auf mein Frühstück warten?« fuhr er sie an, als sie in die Küche kam. »So etwas Faules wie du ist mir auch noch nicht begegnet.«
Andrea antwortete ihm nicht. Sie setzte Kaffeewasser auf und deckte stumm den Tisch.
»Sprichst wohl nicht mehr mit mir?« fragte er. »Meinst du wirklich, du könntest mich mit Schweigen fertigmachen?«
Die junge Frau reagierte nicht. Sie brühte den Kaffee auf, schenkte für ihn ein, stellte die Kanne auf den Tisch und schob den Brotkorb in seine Nähe. »Ich habe keinen Hunger«, sagte sie, als sie sich an den Tisch setzte, um eine Tasse Kaffee zu trinken.
»Ach, Madam ist noch beim Abnehmen«, höhnte der Kneipenwirt. »Komisch, daß ich davon noch nichts gemerkt habe.« Er sah sie verächtlich an. »Selbst, wenn du bis an dein Lebensende auf das Frühstück verzichten würdest, wäre deine Figur noch immer ein Witz.«
»Vielleicht solltest du dich mal im Spiegel betrachten«, meinte Andrea, obwohl sie sich vorgenommen hatte, sich nicht mit ihm zu streiten.
»Was soll das heißen?« Sein Gesicht lief rot an.
»Daß du auch keine Schönheit bist.« Andrea stand auf und trug ihre Tasse zum Spülbecken. Sie hörte, wie er seinen Stuhl zurückstieß. Bereits im nächsten Moment packte er ihren Arm und riß sie herum. »Meinst du wirklich, du könntest es dir leisten, ein freches Mundwerk gegen mich zu führen?« Herbert Freytag wies in den Hof hinunter. »Wer hat denn neulich angerufen und mich gebeten, ihn wieder aufzunehmen?«
Andrea dachte an den Spruch, den sie am Vortag in einer Zeitschrift gelesen hatte. Wer seine Träume verwirklichen will, der darf nicht schlafen.Dr. Baumann hatte ihr seine Hilfe angeboten, und sie war sicher, daß er noch zu seinem Wort stehen würde, auch wenn sie ihn enttäuscht hatte.
»Es ist ein Fehler gewesen, zu dir zurückzukehren, Herbert«, sagte sie und blickte in sein unrasiertes Gesicht. »Ich werde meine Sachen packen und gehen.«
»Aber nicht, bevor du die Küche und das Haus in Ordnung gebracht hast!« Er ließ sie los. »Und eines schreib dir hinter die Ohren: wenn du gehst, gibt es keine Wiederkehr.«
»Wer kehrt schon ein zweites Mal freiwillig in die Hölle zurück?« fragte sie. Herbert Freytag holte aus, doch Andrea war schneller als er. Sie fing seine Hand ab und hielt sie fest. »Du wirst mich nie wieder schlagen«, erklärte sie. »Nie wieder.«
Herbert Freytag entriß ihr seine Hand. »An dir mach ich mich nicht schmutzig!« stieß er hervor, stürmte aus der Küche und verschwand im Schlafzimmer. Kaum hatte er es betreten, flog auch schon die Tür ins Schloß.
Die junge Frau hörte, wie der Kneipenwirt wenig später die Treppe hinunterpolterte und kurz darauf der Motor seines Wagens aufheulte. Sie wußte, daß er einen Zahnarzttermin hatte. Ganz sicher hing seine schlechte Laune auch damit zusammen. Im Grunde seines Herzens war Herbert ein Feigling.
»Wenn du denkst, ich bringe noch dein Haus in Ordnung, irrst du dich gewaltig«, sagte sie leise vor sich hin. Viel hatte sie nicht zu packen. Ihre Kleidung, ein paar Bücher, das war schon alles.
Sie ging zum Telefon, um Dr. Baumann anzurufen. Da sie annahm, daß er um diese Zeit in seiner Praxis war, wählte sie deren Nummer. Tina Martens meldete sich. »Tut mir leid, der Herr
Doktor ist zu einem Notfall gerufen worden«, erwiderte sie, als Andrea nach dem Arzt fragte. »Kann ich ihm etwas ausrichten?«
»Nein, danke.« Die junge Frau legte auf.
Was sollte sie tun? So weh, wie ihr Bein tat, konnte sie unmöglich mit ihren beiden Koffern bis zum Doktorhaus laufen. Sollte sie ihre Sachen erst später holen? – Nein, Herbert brachte es fertig und würde sich weigern, sie herauszugeben.
Andrea ging ins Wohnzimmer. Sie tat es nicht gern, doch es blieb ihr nichts anderes übrig. Herbert bewahrte sein Kleingeld in einem Schubfach des Büfetts auf. Ihre Finger zitterten, als sie zu der Blechdose griff, die im Barfach stand. Rasch nahm sie zwanzig Mark für ein Taxi heraus, dann stellte sie die Dose zurück und machte sich daran, ihre Sachen zu packen.
Als Herbert Freytag vom Zahnarzt zurückkehrte, sah er gerade noch das Taxi, das mit Andrea abfuhr. Ohne seinen Wagen abzuschließen, stürzte er ins Haus. Auf einen Blick erkannte er, daß die junge Frau weder die Gaststube noch die Treppe geputzt hatte. Außer sich vor Zorn stieß er mit dem rechten Fuß nach dem Schirmständer. Polternd stürzte dieser um.
*
Katharina Wittenberg stand in der Küche, als das Taxi vorfuhr. Sie trocknete sich rasch die Hände ab und eilte nach draußen. Franzl, der unter dem Apfelbaum gelegen hatte, stand abwartend zwei Meter vom Wagen entfernt. Kaum war Andrea ausgestiegen, rannte er zu ihr und ließ sich von ihr ausgiebig streicheln.
Die Haushälterin nahm die junge Frau in die Arme. »Ich wußte, daß Sie zurückkommen würden«, sagte sie herzlich. »Da wird sich der Herr Doktor freuen. Und eines können Sie uns glauben, wir werden nicht eher ruhen, als bis Sie gut untergebracht sind.«
»Danke.« Andrea blickte auf ihre Koffer, die der Taxifahrer neben die Haustür gestellt hatte und die von Franzl bewacht wurden. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühlte sie sich geborgen. Es war ein Abenteuer, sich einfach so ins Leben zu stürzen, aber sie hatte sich fest vorgenommen, es zu bestehen.
*
Melanie wurde aus dem Krankenhaus entlassen. Sie nahm sich ein Zimmer in einer kleinen Pension, die in der Nähe der Klinik lag, um in Jörgs Nähe zu sein. Der junge Hotelier lag noch immer im Koma, obwohl die wenigen Verletzungen, die er bei seinem Unfall davongetragen hatte, längst verheilt waren. Melanie hatte täglich mehrere Stunden an seinem Bett verbracht. Sie hatte ihm vorgelesen, hatte ihm von ihren Untersuchungen erzählt und ihn an gemeinsame Unternehmungen erinnert.
Ich darf die Hoffnung nicht aufgeben, dachte sie, als sie zu Dr. Baumann fuhr, um mit ihm über ihre weitere Behandlung zu sprechen. Aber es war schwer, nicht den Mut zu verlieren. Unablässig sah sie das wachsbleiche Gesicht ihres Freundes vor sich, hörte das Summen der Instrumente, die ihn überwachten.
Melanie hatte die Versicherung, bei der sie arbeitete, angerufen und ihrer Vorgesetzten gesagt, daß sie zur Zeit krankgeschrieben war und noch nicht wußte, wann sie nach Stuttgart zurückkehren würde. Für sie stand fest, daß sie Jörg nicht im Stich lassen durfte. Sie mußte bei ihm bleiben, bis er aus dem Koma erwachte und sie nicht mehr so dringend brauchte wie jetzt. Notfalls wollte sie unbezahlten Urlaub nehmen.
Die junge Frau bog zum Haus von Dr. Baumann ab und parkte am Straßenrand. Als sie zur Praxis ging, kam ihr Franzl entgegen. Sie blieb stehen. »Na, paßt du auch schön auf, daß kein Unbefugter das Grundstück betritt?« fragte sie und kraulte ihn hinter den Ohren. »Weißt du was, wenn ich nicht allzu lange warten muß, werde ich dein Herrchen fragen, ob ich noch ein Stückchen mit dir spazierengehen darf.«
Das Wort »spazierengehen« wirkte auf Franzl geradezu elektrisierend. Winselnd umkreiste er sie und wedelte dabei so heftig mit der Rute, daß die junge Frau sogar den Luftzug spürte.
»Ein bißchen mußt du dich schon noch gedulden«, meinte sie, tätschelte seinen Kopf und wandte sich eilig der Praxis zu. Bevor sie die Tür öffnete, drehte sie sich noch einmal um. Franzl saß wenige Meter von ihr entfernt im Gras und starrte erwartungsvoll zu ihr hinüber. »Bis gleich!« Sie winkte ihm zu. Der Hund hob hoffnungsvoll die Ohren. Als sie die Praxis betrat, vergrub er den Kopf enttäuscht zwischen den Vorderpfoten.
Tina Martens lächelte der jungen Frau entgegen. »Wie geht es Ihnen, Frau Berger?« fragte sie freundlich.
»Danke, soweit ganz gut«, antwortete Melanie, »wenn ich mich auch erst daran gewöhnen muß, zuckerkrank zu sein. Es ist komisch. Bevor ich davon erfahren habe, hatte ich nicht den Wunsch, ständig etwas Süßes zu essen. Jetzt könnte ich mich durch Berge von Schokolade graben.«
»Solange Sie sich durch die Schokolade nur graben, kann
es nichts schaden«, entgegnete
die Sprechstundenhilfe amüsiert. »Davon abgesehen, habe ich Ähnliches schon öfters von unseren Patienten gehört. Doch das vergeht zum Glück.«
»Wollen wir es hoffen«, bemerkte Melanie skeptisch und nahm im Wartezimmer Platz.
Dr. Baumann brachte Lina Becker, die ihn erneut wegen Gallenschmerzen aufgesucht hatte, nach draußen. Sie wußten beide, daß sie um eine Operation nicht herumkommen würde, aber noch hoffte Frau Becker, daß ein Wunder geschehen würde. Sie hatte Angst vor der Operation. Weniger, weil sie befürchtete, nicht wieder aufzuwachen, als vor dem Gefühl, für einige Zeit nicht mehr Herr ihrer Selbst zu sein und sich völlig anderen Menschen ausliefern zu müssen.
»Warten Sie nicht zu lange, Frau Becker«, warnte Dr. Baumann, als er ihr die Hand reichte.
»Ich werde darüber nachdenken«, versprach Lina Becker. »Auf Wiedersehen, Herr Doktor.«
»Auf Wiedersehen«, antwortete Eric und bat Tina, den nächsten Patienten aufzurufen. Er wollte schon in sein Sprechzimmer zurückkehren, als Heinz Seitter die Praxis betrat. Dr. Baumann blieb noch einen Moment stehen, um mit dem Steuerinspektor a. D. einen kurzen Gruß zu wechseln. Erneut fragte er sich, ob es sich bei dem Finanzbeamten, von dem sein Studienkollege gesprochen hatte, um denselben Heinz Seitter handelte, der, seit er in Tegernsee lebte, zu seinen Patienten gehörte.
Melanie wurde aufgerufen. Sie legte ihre Zeitschrift beiseite und trat ins Sprechzimmer. Dr. Baumann reichte ihr die Hand. »Na, wie fühlt man sich in Freiheit?« erkundigte er sich.
»Wie neugeboren«, erwiderte die junge Frau. »Soweit man von Freiheit sprechen kann, wenn man sich jeden Tag zweimal mit Insulin spritzen muß.« Sie winkte ab. »Doch es gibt Schlimmeres.« Um ihre Lippen huschte ein flüchtiges Lächeln. »Das ist wenigstens Jörgs Meinung gewesen, als er mich ins Krankenhaus gebracht hat.«
»Und womit er zweifelsohne recht hat.« Der Arzt bat sie Platz zu nehmen.
Während der nächsten zehn Minuten sprachen sie über ihre weitere Behandlung. Dr. Baumann schrieb ein Rezept für Spritzen und Humaninsulin aus.
Melanie nannte ihm den Namen der Pension, in der sie sich ein Zimmer genommen hatte. »Es mag lächerlich klingen, doch ich halte es für sehr wichtig, so nahe wie möglich bei meinem Freund zu sein«, meinte sie.
»Ich habe heute morgen mit dem Vater Ihres Freundes gesprochen«, sagte Eric. »Herr Thomson ist sehr froh, daß es Sie gibt.«
»Dabei hat er früher alles versucht, um Jörg und mich zu trennen«, bemerkte die junge Frau. »Davon abgesehen, kann ich es ihm nicht einmal verdenken. Er muß von Anfang an gespürt haben, daß ich nicht zu den Gästen gehöre, die gewöhnlich in seinem Hotel absteigen, und später hat er mich sogar für eine Hochstaplerin gehalten.«
»Was ihm inzwischen leid tut.«
»Mag sein, gesagt hat es mir Herr Thomson jedenfalls noch nicht. Wenn wir uns an Jörgs Bett treffen, ist er höflich und sehr freundlich zu mir, aber wir sprechen kaum miteinander. Seine Frau ist da anders. Ich habe sie sehr gern.«
»Herr Thomson gehört zu den Leuten, denen es schwerfällt, einen Fehler zuzugeben«, meinte der Arzt. »Glauben Sie mir, wenn Sie ihn erst einmal näher kennengelernt haben, werden Sie ihn mögen.« Er zwinkerte ihr zu. »Spätestens, wenn Sie und Ihr Freund heiraten…«
»Und wenn Jörg nicht mehr aus dem Koma erwacht?« fragte Melanie. »Wenn…« Sie konnte ihre Tränen nicht länger zurückhalten. Aufschluchzend vergrub sie das Gesicht in den Händen.
Dr. Baumann stand auf und trat hinter die junge Frau. »Ich weiß, daß es sehr schwer ist, Frau Berger, trotzdem müssen Sie ganz fest daran glauben, daß Ihr Freund wieder zu sich kommt.« Er legte die Hände auf ihre Schultern. »Ich bin überzeugt, daß er nicht nur verstehen kann, was Sie sagen, wenn Sie an seinem Bett sitzen und mit ihm sprechen, sondern daß er auch Ihre Stimmung spürt.«
Melanie atmete tief durch. »Sie haben natürlich recht, Doktor Baumann«, meinte sie. »Nur jeder Tag, der vergeht, erhöht das Risiko, daß Jörg, wenn er aus dem Koma erwacht, behindert sein könnte.«
»Das will ich nicht abstreiten«, antwortete Eric, »andererseits gibt es sehr viele Fälle, in denen auch nach einem langanhaltenden Koma keine Spätfolgen eingetreten sind. Und ihr Freund hat sehr viel Glück im Unglück. Er hat keine schwerwiegenden Verletzungen bei dem Unfall davongetragen. Sein Koma ist einzig und allein auf den Schock zurückzuführen.«
»Ja, das ist wahr.« Melanie stand auf. »Wer weiß, vielleicht wird Jörg bereits morgen erwachen.« Sie strich sich mit einer müden Bewegung die Haare zurück. »Ach so, haben Sie etwas dagegen, wenn ich mit Franzl ein Stückchen spazierengehe? Ich habe es ihm versprochen.«
»Vermutlich wird er vor der Praxis auf Sie warten.« Dr. Baumann öffnete die Tür. »Ich habe nichts dagegen«, sagte er. »Ein Spaziergang mit Franzl wird Ihnen guttun. Am besten, Sie lassen sich von meiner Haushälterin einen Ball geben.« Er reichte ihr die Hand. »Verlieren Sie nicht den Mut. Es wird schon alles ins Lot kommen.«
»Ist das ein Versprechen?« fragte Melanie, dann schüttelte sie den Kopf. »Nein, sagen Sie nichts, Doktor Baumann, meine Frage ist mehr als unfair gewesen. Sie können genauso wenig in die Zukunft schauen wie ich.«
»So gut es manchmal wäre, einen Blick in die Zukunft zu tun, ich bin froh, daß ich es nicht kann«, erwiderte er. »Unser Leben würde um vieles ärmer sein, wenn man schon im voraus wüßte, was die nächsten Stunden bringen. Außerdem ist Hoffnung eine starke Antriebskraft im Leben jedes Menschen.«
Melanie nickte. »Und worauf sollten wir noch hoffen, wenn wir in die Zukunft sehen könnten?« Sie zwang sich zu einem Lächeln. »Ich werde Franzl in etwa einer Stunde zurückbringen.«
»Viel Spaß«, wünschte er.
»Danke«, sagte die junge Frau und verließ die Praxis.
Franzl, der die ganze Zeit vor der Praxis im Gras gelegen hatte, sprang auf. Er begrüßte Melanie so enthusiastisch, als würde er sie schon ein Leben lang kennen und hätte sie ewig nicht mehr gesehen.
»Weißt du, was ich mir wünsche?« fragte sie und nahm seinen Kopf in beide Hände. »Daß Jörg und ich dich eines Tages gemeinsam ausführen können.« Franzl drehte blitzschnell den Kopf und fuhr mit der Zunge über ihre Hand, dann rannte er zu dem Apfelbaum, unter dem er meistens lag, und kam gleich darauf mit einem Ball zurück. Herausfordernd warf er ihn der jungen Frau vor die Füße.
*
Maria Thomson nahm zärtlich die Hand ihres Sohnes und drückte sie. »Du fehlst uns so sehr, Jörg«, sagte sie und bemühte sich, nicht in Tränen auszubrechen.
»Ja, da kann ich deiner Mutter nur beipflichten«, meinte Gerhard Thomson und strich hilflos über Jörgs Haare. »Seit du dich vor der Arbeit im Hotel drückst und es dir gefällt, schlafend im Krankenhaus zu liegen, weiß ich nicht mehr, was ich zuerst machen soll. Also beeil dich mit dem Aufwachen. Wir brauchen dich, du ahnst nicht, wie sehr.« Er drehte sich halb um. »Da kommt deine Freundin, Jörg. Ihr wird es auch nicht anders gehen als uns.«
Melanie nickte den Thomsons grüßend zu. »Ich bin bei Doktor Baumann gewesen, um mit ihm über meine weitere Behandlung zu sprechen«, sagte sie.
»Geht es Ihnen gut?« fragte Maria Thomson.
»Ja, danke«, erwiderte die junge Frau. »Meine Krankheit bekomme ich bestimmt in den Griff. Andere Menschen müssen auch mit Diabetes leben, selbst kleine Kinder. Natürlich bin ich zuerst erschrocken, als Doktor Baumann andeutete, ich könnte zuckerkrank sein, inzwischen habe ich mich damit abgefunden.«
»Und das ist gut so«, warf Gerhard Thomson ein. »Wenn Jörg erwacht, braucht er eine Frau, die mit beiden Beinen fest im Leben steht.« Er griff nach seiner Handgelenkstasche, die er auf den Nachttisch gelegt hatte. »Komm, Maria, lassen wir Frau Berger und unseren Sohn allein.«
Maria Thomson beugte sich über Jörg und küßte ihn auf die Stirn. »Bis morgen, Liebling. Ich werde schon vormittags kommen.« Entschlossen richtete sie sich auf. Es fiel ihr nicht leicht, ihren Sohn zu verlassen. Am liebsten wäre sie Tag und Nacht bei ihm geblieben, andererseits wußte sie auch, wie wichtig es war, daß er und Melanie viel Zeit für sich hatten.
Melanie verabschiedete sich von den Thomsons, dann nahm sie sich einen Stuhl und setzte sich zu ihrem Freund ans Bett. Sie erzählte ihm von ihren Besuch bei Doktor Baumann und den anschließenden Spaziergang mit Franzl.
»Ich habe Franzl versprochen, daß du auch bald mit ihm spazierengehen wirst«, sagte sie. »Und du weißt, Versprechen muß man halten, also streng dich an und blamier mich nicht. Du hast lange genug geschlafen.«
Jörg rührte sich nicht.
Die junge Frau strich ihm über die Wange. »Weißt du überhaupt, wie ich mich danach sehne, wieder einmal von dir in den Arm genommen und geküßt zu werden?« fragte sie. »Ohne dich komme ich mir schrecklich verloren vor. Fast so verloren wie Kim in all den Jahren, die sie auf Chris gewartet hat.« Ganz leise begann sie zu singen, wie sie es so oft tat, wenn sie an Jörgs Bett saß und darauf hoffte, daß er die Augen aufschlug.
Es war ziemlich spät, als Melanie in die Pension zurückkehrte. Die anderen Gäste hatten längst zu Abend gegessen, und sie war froh, als ihre Wirtin anbot, ihr noch etwas Hühnersuppe zu wärmen. Doch als die Suppe vor ihr stand, hatte sie kaum Appetit. Nur um ihre Wirtin nicht zu kränken, aß sie den Teller leer, bevor sie zu ihrem Zimmer hinaufging.
Melanie wohnte im ersten Stock des alten Hauses. Sie setzte sich auf den Balkon und blickte zum nachtdunklen Himmel hinauf. Ihre Sehnsucht nach Jörg wuchs mit jeder Minute. Als sie die Augen schloß, sah sie sich mit ihm unten am See tanzen. Gott allein weiß, wie sehr ich dich liebe, dachte sie und faltete die Hände zu einem stummen Gebet.
Lange nach Mitternacht erwachte Melanie plötzlich. Verwirrt schaute sie sich um. Ganz deutlich hatte sie Jörgs Stimme gehört. Leise flüsterte sie seinen Namen und lauschte mit angehaltenem Atem in die Dunkelheit.
»Melanie!«
Die junge Frau griff zum Lichtschalter. »Jörg?« fragte sie in
das aufflackernde Licht hinein. »Jörg?«
Sie war allein im Zimmer, wie hätte es auch anders sein sollen?
Melanie lehnte sich zurück. Noch immer glaubte sie ihren Namen zu hören. Es mußte ein Wachtraum sein. Es… Und wenn Jörg ihre Hilfe brauchte? Wenn sein Unterbewußtsein nach ihr rief?
Die junge Frau stand auf. In aller Eile zog sie sich an, wusch sich flüchtig und kämmte sich die Haare, dann griff sie nach Jacke und Handtasche. Fast lautlos huschte sie die Treppe zur Haustür hinunter. Sie war froh, daß ihr die Wirtin einen Schlüssel gegeben hatte, sonst hätte sie die arme Frau erst wecken müssen.
Bis zum Krankenhaus waren es nur knapp zweihundert Meter. Melanie legte sie in einer Rekordzeit zurück. Kurz vor dem Eingang zum Foyer blieb sie stehen und schöpfte erst einmal Luft. Der Nachtportier wandte ihr gerade den Rücken zu. Deshalb hatte er sie noch nicht bemerkt. Sie wartete noch einen Augenblick, bevor sie auf die automatische Tür zu trat. Hastig schlüpfte sie hindurch und eilte zum Aufzug. Erst, als sie mit der Kabine nach oben fuhr, wagte sie es aufzuatmen. Das nennt man Glück, dachte sie, weil sie sich nicht vorstellen konnte, daß der Nachtportier sie um diese Zeit noch in die Klinik gelassen hätte.
Der Gang, der zur Intensivstation führte, war menschenleer. Die Schritte der jungen Frau hallten von den Wänden wider, obwohl sie sich Mühe gab, sehr leise
zu sein. Sie fragte sich, was wohl die diensthabende Schwester sagen würde, wenn sie ihr erzählte, daß ihr Freund sie gerufen hatte.
Und wieder hatte Melanie Glück. In dieser Nacht hatte Schwester Gabriele Dienst. Die junge Frau interessierte sich seit ihrer Kindheit für Esoterik und glaubte, daß zwischen Himmel und Erde alles möglich war.
»Um diese Zeit dürfte ich Sie nicht hereinlassen«, meinte sie, »aber es könnte durchaus sein, daß ihr Freund Sie in seinem Unterbewußtsein gerufen hat.« Sie lächelte ihr zu. »Seien Sie bitte sehr, sehr leise, wenn Sie zu seinem Zimmer gehen.«
»Werde ich«, versprach Melanie. »Danke.«
»Schon gut«, antwortete Schwester Gabriele.
Melanie zog sich rasch einen der Kittel über, die für Besucher bereitlagen, und wechselte auch ihre Schuhe. Noch immer hörte sie tief in sich Jörgs Stimme. Ihr Herz klopfte zum Zerspringen, als sie die Tür zu seinem Zimmer öffnete.
Der Raum lag im Halbdunkel. Es brannte nur eine winzige Lampe, die unscharf die Umrisse des Bettes und der Apparate erkennen ließ, an denen Jörg seit seinem Unfall angeschlossen war.
Melanie huschte auf Zehenspitzen zum Bett ihres Freundes. Liebevoll griff sie nach seiner Hand. »Du hast mich gerufen, Jörg«, sagte sie beschwörend. »Ich bin bei dir und ich bin bereit, mit dir ohne Zögern jeden Weg zu gehen, den du gehen willst.«
Die junge Frau spürte, wie mit einem Mal Leben in die Hand ihres Freundes kam. Sie fühlte sich nicht mehr so schlaff an, wie noch vor wenigen Minuten. Seine Finger griffen zu, bogen sich um ihren Daumen. Sie wagte kaum zu atmen. »Jörg, ich bin da«, sagte sie erneut. »Und ich werde stets bei dir sein.«
Langsam hoben sich die Lider des jungen Mannes. Er sah sie an. Seine Lippen bewegten sich. Es fiel ihm schwer zu sprechen, weil sein Mund so trocken war. »Ja, du bist da«, erwiderte er stockend und fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. »Ich habe dich gerufen, und du bist gekommen.«
»Und so wird es immer sein«, versprach Melanie außer sich vor Glück. »Ich bin so froh, daß du endlich aufgewacht bist, Jörg. Du ahnst nicht, wie sehr ich dich vermißt habe.« Sie strich ihm sanft über die Wange.
Ihr Freund schloß müde die Augen. »Geh nicht fort, bleib bei mir«, bat er. »Ich brauche dich so sehr.«
»Nein, ich gehe nicht fort«, versicherte sie und wischte sich über die Augen, dann klingelte sie nach der Nachtschwester.
*
Vier Wochen später feierten Melanie Berger und Jörg Thomson im kleinen Saal des »Luisenhofes« ihre Verlobung. Sie hatten ihre Freunde und all die Menschen eingeladen, die ihnen etwas bedeuteten. Seit Jörg aus dem Krankenhaus entlassen worden war, wohnte Melanie wieder im »Luisenhof«, allerdings nicht in einem der Gastzimmer, sondern in einem kleinen Appartement, das
zur Wohnung ihrer zukünftigen Schwiegereltern gehörte. Gerhard Thomson und sie hatten sich ausgesprochen, und er hatte eingesehen, wie unrecht er ihr getan hatte.
»Wie lange wirst du noch am Tegernsee bleiben, bis du nach Stuttgart zurückkehren mußt?« fragte Fabian Lindenmaier die junge Frau, als er mit ihr tanzte.
»Noch eine Woche«, antwortete Melanie. »Ich habe meiner Vorgesetzten bereits gesagt, daß ich kündige. Also werde ich wohl bis Ende des Jahres für immer an den Tegernsee übersiedeln.« Ein Lächeln umhuschte ihre Lippen. »Jörgs Vater hat mir auch schon einen Job angeboten. Er möchte, daß ich alles lerne, was mit der Führung eines Hotels zusammenhängt. Deshalb will er mich nach und nach durch sämtliche Abteilungen seines Hotels schleusen.«
»Und wie ich Herrn Thomson kenne, wird das harte Arbeit für dich bedeuten«, meinte Fabian herausfordernd.
»Davor fürchte ich mich nicht. Wenn es sein muß, kann ich zupacken«, antwortete sie. »Außerdem bin ich ziemlich gut, wenn es darum geht, etwas zu organisieren. Mein zukünftiger Schwiegervater wird bald merken, daß ich ein Gewinn für sein Hotel sein werde.«
»An Selbstbewußtsein mangelt es dir jedenfalls nicht«, stellte der junge Mann lachend fest. »Sieht aus, als hätte Gerhard Thomson seinen Meister gefunden.«
»Er weiß es vermutlich nur noch nicht«, scherzte Melanie und schaute sich nach Jörg um, der mit Corinna Dillmann tanzte. Als sie ihn entdeckte, winkte sie ihm zu. Vergnügt erwiderte er ihren Gruß.
Auch Dr. Baumann gehörte zu den Gästen dieses Abends. Zusammen mit den Thomsons und den Kordes’ saß er an einem der runden Tische, die im Halbkreis um die Tanzfläche standen. Volker Kordes erkundigte sich nach den Pferden und den Ponys, die sie an den Reitstall des Hotels verkauft hatten, dann kamen sie auf das Brautpaar zu sprechen und das Wunder, daß Jörg fast unverletzt den schweren Unfall überlebt hatte.
»Manchmal könnte man wirklich glauben, daß Engel über uns wachen«, meinte Maria Thomson. »Jörg hat unwahrscheinliches Glück gehabt. Außerdem kann ich mir bis heute nicht erklären, wie Melanie ihn hören konnte, obwohl mein Sohn im Koma lag und sie nicht einmal bei ihm gewesen ist.«
»Eine logische Erklärung wird es dafür auch nie geben«, antwortete Eric. »Liebe ist eine sehr starke Macht. Wenn zwei Menschen so miteinander verbunden sind, wie Ihr Sohn und Frau Berger, bedarf es schon mehr als eines Komas, um sie zu trennen.«
»Sie sind ein wirklich schönes Paar«, bemerkte Gerhard Thomson. »Ich bin sehr froh, daß ich mich in Melanie geirrt habe. Ich sollte in Zukunft vorsichtiger beim Beurteilen meiner Mitmenschen sein.«
»Könnte nichts schaden«, erklärte Heinz Kordes. »Ich habe schon oft festgestellt, daß man nicht immer nach seinem ersten Eindruck gehen sollte.« Er wandte sich an Dr. Baumann: »Du hast darin ja auch einige Erfahrung,
Eric. Wie ich gehört habe, hast du einer jungen Frau, die zum Strandgut unserer Gesellschaft zählt, neuen Lebensmut gegeben.«
»Meinst du Frau Stanzl?« fragte der Arzt überrascht.
»Ich weiß nur, daß sie mit Vornamen Andrea heißt«, sagte sein Freund. »Ich habe sie flüchtig kennengelernt, als ich neulich im Tierpflegenest eine Futterspende abgegeben habe. Die junge Frau scheint dort genau am richtigen Ort zu sein. Die Leiterin des Pflegenestes ist voll des Lobes über sie gewesen und hat es auch nicht lassen können, dich in den höchsten Tönen zu preisen.«
»Du kennst Frau Gabler, sie übertreibt gern«, erwiderte Eric. »Aber ich bin froh, daß ich für Andrea Stanzl einen geeigneten Platz gefunden habe.« Er erzählte, was für ein schreckliches Leben die junge Frau bei Herbert Freytag geführt hatte. »Da sie gut mit Tieren umgehen kann, dachte ich, man könnte es ja mal probieren. Frau Gabler hatte sowieso Hilfe gesucht. Viel kann sie natürlich nicht bezahlen, für Frau Stanzl ist es jedoch ein Anfang.«
»Und wie es aussieht, ist sie jetzt genau am richtigen Ort«, meinte Hanna Kordes. »Leute wie diesem Herbert Freytag sollte man das Handwerk legen. Nur leider wird es stets Frauen geben, die auf solche Männer hereinfallen. Es ist schon ein starkes Stück, einen anderen so auszunutzen.«
»Ich will zwar diesem Freytag nicht beistehen, doch es sind nicht immer nur Männer, die zu so etwas fähig sind«, warf Gerhard Thomson ein.
»Ja, das ist wahr«, pflichtete ihm Heinz Kordes bei. »Aber jetzt möchte ich endlich tanzen.« Er stand auf und reichte seiner Frau die Hand. »Ich denke nicht daran, die Tanzfläche nur der Jugend zu überlassen.«
Melanie und Jörg wurde der Trubel um sie herum zuviel. Es war ihr Abend, und auch wenn sie sich über die glanzvolle Verlobungsfeier freuten, sie wollten ein paar Minuten allein sein. Arm in Arm verließen sie den Festsaal und gingen durch den Park, bis sie zu einer Sandsteintreppe gelangten, die eine kleine Anhöhe hinaufführte. Oben stand ein nach allen Seiten offener Pavillon, in dem die Thomsons manchmal Kaffee tranken.
Jörg nahm die Hand seiner Verlobten. Gemeinsam stiegen sie die Treppe hinauf. Es duftete wundervoll nach den Rosen, die rund um den Pavillon wuchsen. Vorsichtig brach Jörg eine der vollen Blüten ab und versuchte, sie Melanie in die Haare zu stecken, nur die Rose wollte nicht halten.
»Voraussehende Männer haben für derartige Fälle stets eine Klammer dabei«, scherzte die junge Frau.
»Nicht nötig.« Jörg zog sein Taschenmesser hervor, bückte sich und schnitt ein Stückchen von seinem rechten Schnürsenkel ab. »Nun, was sagst du jetzt?« fragte er, als er mit dem Band die Rosenblüte in den Haaren seiner Verlobten befestigte.
»Daß du ein Genie bist«, erklärte sie und legte die Arme um seinen Nacken. »Weißt du noch die Nacht, in der wir zum ersten Mal miteinander getanzt haben?«
»Wie sollte ich sie je vergessen?« Zärtlich berührte er ihr Gesicht. »Ich bin so glücklich, daß es dich gibt, Melanie, und ich weiß, daß ich dich immer lieben werde. So wie seit ewigen Zeiten Tag und Nacht einander ablösen, so wird meine Liebe zu dir nie vergehen.«
»Und das macht mich unendlich froh.« Melanie schaute ihm in die Augen. »Als ich noch ein kleines Mädchen war, habe ich manchmal wach im Bett gelegen und mir meinen zukünftigen Mann vorgestellt. Es ist mir nie gelungen, ihm ein Gesicht zu geben, und doch weiß ich, daß du dieser Mann warst.«
»Weil wir vom Beginn der Zeit an füreinander bestimmt sind«, sagte Jörg und begann, mit ihr nach einer Melodie zu tanzen, die nur sie beide hörten, da sie aus ihren Herzen kam.