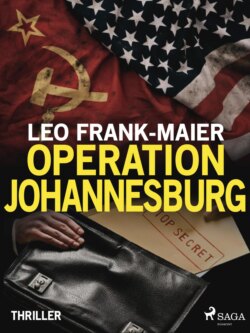Читать книгу Operation Johannesburg - Leo Frank-Maier - Страница 8
ОглавлениеNachdem John Bratt aufgehört hatte zu lügen, ging es rapide bergab mit ihm. Das hatte schon vor fünf Jahren begonnen. Damals, als er Molly sagte, wie sehr sie ihn langweile mit ihrem ewigen Getue um neue Kleider und moderne Hütchen und dem Gerede, wer mit wem gerade ein Verhältnis hatte. Das war an ihrem dreißigsten Geburtstag. Sie wurde sehr zornig und nannte ihn einen verkommenen, alten Trunkenbold. Und ganz so unrecht hatte sie nicht. Immerhin war er zwanzig Jahre älter. Molly war seine Frau. Gewesen.
Zum Glück war sein Jahresvertrag in Zypern gerade abgelaufen, und er ging zurück nach London. Und er war froh darüber. Denn in diesem großen Dorf Nicosia wäre er seiner geschiedenen Frau auf Schritt und Tritt begegnet, mit all ihren neuen Liebhabern, und das wollte er auch gerade nicht.
Sie gaben ihm einen Job in Frankfurt, weil er perfekt deutsch sprach. John Bratt war Journalist und arbeitete schon eine Ewigkeit für »World News Agency«. Und damals in Frankfurt war sein Ruf als Korrespondent noch immer recht gut, wenn auch schon ein wenig abgestanden.
Nichts ist vergänglicher als ein guter Ruf, und als sie ihn wieder nach London ins Hauptbüro zurückholten, meinten die Kollegen, es wäre schade um den alten Jonny. So ein tüchtiger Mann, aber leider immer an der Flasche. Und wenn er nicht bald aufhöre mit dem ständigen Saufen, werde es noch ein böses Ende nehmen mit ihm. Sie sagten es hämisch oder bedauernd, je nachdem.
Für eine ständige Korrespondenz im Ausland war er der Direktion zu unzuverlässig und sie steckten ihn in die ZbV-Abteilung. »Zur besonderen Verwendung« hieß das. Und es war nichts anderes als lausige Büroarbeit und leises Hoffen, daß irgendwo auf der Welt was passieren möge, wo die Agency keinen ständigen Korrespondenten hatte. Dann wurde jemand von der ZbV hingeschickt. Das bedeutete gutes Geld und ordentliche Spesen, außerdem die Chance, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. John Bratt hatte schon vor zwanzig Jahren im ZbV gearbeitet. Damals konnte er ausgezeichnet schreiben und hervorragend lügen. Ausgezeichnet schreiben konnte er auch heute noch. Nur wußte er nicht recht worüber.
Dem Alter nach hätten seine jetzigen Mitarbeiter seine Söhne und Töchter sein können. Und sie waren insgesamt recht höflich und freundlich zu ihm. Wenn er wieder einmal unrasiert und mit verknautschtem Hemd ins Büro kam, zwinkerten sie sich hinter seinem Rücken vielsagend zu. John Bratt wußte das. Auch ohne sich umzudrehen.
»Ist Jonny denn immer noch nicht da?« hörte er die Stimme Mary Owens aus dem Sprechgerät, gerade als er ins Büro kam. Und Jimmy, sein Tischnachbar, drückte den Knopf und sagte: »Jetzt ist er da, ich sag’s ihm gleich.« Er wünschte dann Jonny einen guten Morgen und sagte, er solle gleich rübergehen in die Direktion. Mary habe schon vor einer halben Stunde nach ihm gefragt.
Als John Bratt das Vorzimmer des Direktors betrat, sah er das nervöse Flackern in den Augen von Mary Owens und dann die Erleichterung in ihrem Gesicht, als sie sein frisches Hemd und rasiertes Kinn bemerkte. Mary Owens mochte den alten Jonny recht gerne. Aus Gründen, die niemand in der Agency wußte. Nur Jonny.
»Keine Sorge, altes Mädchen«, sagte er, »ich bin taufrisch heute Morgen«, und undeutlich hörte er ihr geseufztes »Gott sei Dank«. Jonny wollte noch eine Zigarette rauchen und ein wenig plaudern, nur um herauszufinden, was es denn früh am Morgen so Wichtiges gäbe, aber Mary Owens war unerbittlich und drängte ihn durch die Polstertüre, so daß er fast gestolpert wäre.
»Guten Morgen, Chef«, sagte er.
Der Direktor sah zuerst auf die Uhr und dann auf Jonny. Er machte eine einladende Handbewegung und Jonny versank in einen Polstersessel. »Wie steht es mit ihrem Buch, Mr. Bratt?« fragte er, und das war für Jonny nun wirklich eine Überraschung.
Jeder in der Agency wußte, daß Jonny schon seit Jahren an einem Buch über Rassismus arbeitete. Aber das war seine höchst private Angelegenheit und ging niemanden was an. Auch nicht den Direktor. »Wird noch eine Weile dauern, Chef«, sagte er vage und das war weder die reine Wahrheit, noch war’s gelogen.
Höchst überflüssig bemerkte der Direktor, daß man heute Freitag, den 13. Juni 1980, schreibe. Das wußte sogar Jonny. Er wäre nicht abergläubisch, meinte er verständnislos. »In drei Tagen«, sagte der Direktor, »in drei Tagen jährt sich zum vierten Male dieser grauenhafte Aufstand in Soweto. Nach unseren Informationen wird es wieder blutige Rassenkrawalle und Straßenschlachten geben. Ich dachte…«
Mühsam erinnerte sich Jonny an den Namen Soweto, und daß damit ein Vorort von Johannesburg mit über einer Million farbigen Einwohnern gemeint war. »Wann soll ich fliegen«, fragte er. Der Direktor meinte, am besten noch heute.
John Bratt war viel herumgekommen, aber noch niemals in Johannesburg gewesen. Am Flughafen fragten sie ihn, ob er Feuerwaffen oder pornografische Schriften bei sich habe, und er verneinte müde. Der Taxifahrer war ein Schwarzer, aber viel mehr als »Yes, Sir« und »No, Sir« war aus ihm nicht herauszukriegen. Er nahm ein Hotel im Zentrum, es hieß »Queen Victoria« und sah auch so aus. Auf dem Nachtkästchen lag eine Bibel. John Bratt schlief erst einmal acht Stunden.
Ausgeruht und frisch rasiert strolchte er dann durch die Innenstadt. Beeindruckend. Wolkenkratzer, tiefe Straßenschluchten, moderne Geschäfte. Ein Verkehr wie in Manhattan zur Stoßzeit. John Bratt sprang hurtig von einer Verkehrsampel zur nächsten. Er sah sich die Menschen an: Schlanke Neger mit hochgezogenen Schultern, smarte weiße Geschäftsleute mit Aktenköfferchen, elegant gekleidet. Gelangweilte weiße Damen auf Einkaufsbummel, fette Negerweiber auf unglaublich dünnen Beinen. Weiß und Schwarz friedlich nebeneinander auf den Straßen, aber niemals miteinander.
Jonny wollte ein Bier trinken, das war gar nicht so einfach. Denn es gibt in Johannesburg zehnmal mehr Banken und Juweliergeschäfte als Kneipen, wo man bei einer Flasche Bier sitzen kann. Schließlich fand er eine italienische Pizzeria. Er trank Rotwein.
Auch in der Pizzeria ausschließlich weiße Gäste, nur die Kellner sind Neger. Nach dem dritten Glas will Jonny mit einem ins Gespräch kommen. Wieviel er hier so verdient, will er wissen. Der Schwarze rollt die Augen und blickt hilflos zur Kassa, wo Donna Maccaroni thront. Dann schiebt er die Schultern hoch und geht. John Bratt zahlt und geht auch. Arrivederci, sagt er zu Donna Maccaroni.
Dann ist er wieder auf der Straße, Kragen hochgestellt und Hände in den Taschen. Denn es ist kalt in Johannesburg, es ist Winter, und er bereut, keine warme Jacke mitgenommen zu haben.
Man muß genau hinsehen, ganz genau. Dann sieht man die Autobusse nur mit weißen Fahrgästen und die anderen nur mit Farbigen. »No White Only«, steht auf den Negerbussen, da darf also kein Weißer rein. Auf den Bussen der Weißen steht gar nichts. Die Schwarzen wissen ohnehin, daß es da für sie keinen Platz gibt. Auch die Haltestellen sind getrennt. John Bratt sieht auch die öffentlichen Toiletten mit der Aufschrift »nur für Weiße« und die separierten Eingänge von Geschäften, wo Likör verkauft wird. Langsam wird er grantig, nicht nur des kühlen Wetters wegen.
Ein alter Zulu bettelt ihn an, eine Münze für einen Drink will er. Ein Wunder: Ganz in der Nähe ist ein Bierladen. John Bratt wird provokant und lädt den Alten ein, mit ihm reinzugehen. Aber der ist nicht durch die Türe zu bringen. So holt John Bratt zwei Brandys in Pappbechern, und sie trinken auf der Straße. Im Nu ein Ring von Schwarzen rundherum, die aufgeregt schnattern. Die Weißen gehen vorbei. Sie machen Gesichter, als ob sie eben Kröten geschluckt hätten.
Dann steigt John in ein Taxi. Er will nach Soweto, sagt er. Der Fahrer ist ein Bure mit grobem Gesicht und ebensolchen Ausdrücken. Heute fährt er nicht zu den Kaffern, winkt er ab. Er lasse sich sein Auto nicht mit Steinen beschmeißen, von diesen Halbaffen. John steigt wieder aus. Im Hotel gibt es eine Bar, holzgetäfelt und sehr viktorianisch und der Keeper heißt natürlich George. Die Bar heißt »The Queens Arms«, und die sinnig britischen Verhaltensregeln sind an der Tür angeschlagen. Jonny liest staunend, daß es sowohl verboten ist, auf den Boden zu spucken als auch auf den Pianisten zu schießen, und daß man im übrigen eine Krawatte tragen müsse. Die smarten Gäste unterhalten sich über das Rugby-Match zwischen den › Springbocks ‹ und den ›Lions‹. Jonny fragt nach Soweto und dem morgigen Jahrestag der Rassenunruhen, aber das interessiert niemanden. George meint, Mr. Bratt muß sich keine Sorgen machen und die Polizei wäre jederzeit Herr der Lage.
Mr. Bratt trinkt vorerst einmal sieben Whisky. Er macht sich keine Sorgen um seine Sicherheit, aber um die »Queens Arms Bar«. Beim achten Whisky fragt er George, ob er jemals in Soweto war. Natürlich nicht, aber den Kaffern dort ginge es gut, und im übrigen bekämen sie in Soweto spätestens bis 1982 elektrischen Strom, das habe die Regierung versprochen. So war das also. Und niemand soll sagen, die Regierung tue nichts für die Blacks. Beim neunten Glas findet John Bratt endlich jemanden, der geneigt ist, über Soweto und die Apartheid zu reden und nicht über die › Springbocks ‹ und › Lions ‹. Der Mann heißt van Heever, ein Farmer, im Lande geboren und sehr stolz darauf.
Die Amerikaner und Europäer seien allesamt sensible Narren, findet Mr. Heever und im übrigen hätten sie keine Ahnung von den wirklichen Problemen Südafrikas und auch nicht das Recht, sich einzumischen. Die soziale Besserstellung der Blacks sei ein komplizierter und langwieriger Prozeß und ginge nicht von heute auf morgen.
Das versteht auch Jonny.
Und die Regierung tue ihr Möglichstes.
Das bezweifelt Jonny.
Noch vor zwei Jahren wäre es den Schwarzen verboten gewesen, auf den Bänken in den Parkanlagen zu sitzen. Heute dürfen sie. Sie hätten auch das Recht, zu Gericht zu gehen, wenn man sie Kaffer schimpft. Ein eigenes Gesetz wäre dafür geschaffen worden. Und die Unruhe unter den Blacks würde von außen geschürt, von kommunistischen Agenten.
»Sie können sich überzeugen, Mr. Bratt«, sagte Mr. Heever, »meinen Negern geht es gut, und sie sind auch zufrieden.«
»Ihren Negern?« fragte Jonny.
Mr. Heever meint jene, die auf seiner Farm arbeiten.
»Kommen Sie morgen zum Abendessen«, sagt er.
»Überzeugen Sie sich selber.«
Der 16. Juni 1980 ist ein Montag. Jonny hört in den Frühnachrichten von Streiks, Demonstrationen und Zusammenstößen mit der Polizei in Soweto und in der Kap-Provinz. Die Polizei habe auf Plünderer und Brandstifter das Feuer eröffnet. Acht Tote. Schwarze natürlich.
Und die ›Springbocks‹ hätten das Match gegen die ›Lions‹ überraschend gewonnen. O’Donald von den ›Lions‹ habe sich das Genick verstaucht. Ein Interview mit dem genickverstauchten O’Donald würde es im Anschluß an die Nachrichten, sagt der Radiosprecher, geben.
John Bratt schnappt sich einen Leihwagen und fährt nach Soweto. Weit kommt er nicht. Die Polizei hat die Zufahrtsstraßen abgeriegelt und kontrolliert jedes Fahrzeug. Ein Uniformierter studiert seinen Presseausweis. Er solle wieder zurückfahren und sich hier nicht wichtig machen, sagt er mißmutig. An den Straßenrändern hängen Trauben von jugendlichen Schwarzen. Sie schreien und lachen und das Ganze ist für sie offenbar ein Riesenspaß. John sieht, wie seine Berufskollegen und Kamerateams mit den Schwarzen verhandeln, wie sie ihnen Münzen zustecken und Zigaretten. Dafür müssen die Schwarzen dann ordentlich heulen und Fäuste schütteln und ein wenig mit Steinen schmeißen.
Dann surren die Kameras, Blitzlichter zucken. Die Polizisten werden böse und schreiten ein. Wieder surren die Kameras. Jetzt haben seine Kollegen endlich die Life-Fotos, mit welchen die Agenturen der Weltpresse gefüttert werden.
»So geht es auch«, denkt Jonny. Er dreht wieder um. Im Hotel tippt er ein langes Telex für die Agency. Schließlich will der Direktor was hören von ihm. Jonny denkt an Mary Owens, an die Agency und den Direktor. Sicher steckte Mary dahinter, daß er diesen Job hier bekommen hatte. »John Bratt ist ein Fachmann für Rassismus«, wird sie dem Direktor gesagt haben. »Der richtige Mann für Johannesburg.«
Mit Jonnys geplantem Buch über die Ursachen der Rassenprobleme hatte es seine eigene Bewandtnis: Nach dem Krieg war er häufig Berichterstatter bei diesen Kriegsverbrecherprozessen in Deutschland und Österreich gewesen. Er hatte eine Unmenge historisches Material gesammelt und dann etwa vierhundert Seiten über Anfänge, Entwicklung und Auswirkung dieser grauenvollen Judenverfolgungen geschrieben. An einem Jahrestag der Gründung Israels war er in Tel Aviv, eingekeilt in einer begeisterten Zuschauermenge sah er die Militärparade vor Golda Meïr. »Sind sie nicht großartig, unsere tapferen Burschen?« sagte ein deutschsprachiger Jude zu seiner Rechten, »sind sie nicht großartig?« Der Alte war ganz gerührt, er hatte Tränen in den Augen. »Genau so stramm und zackig wie die SS, genau so«, hatte John gesagt.
Von da an freute John Bratt seine Arbeit an dem Buch nicht mehr so recht.
Er besuchte dann das Flüchtlingslager der Palästinenser im Libanon und in Syrien, und wiederum recherchierte er ehrlich die Tragödie dieses Volkes. Als er wieder etwa dreihundert Seiten getippt hatte, traf er Mehmed Khalil, der ein militärisches Ausbildungslager der PLO leitete. »Und was soll mit den Juden geschehen, wenn ihr euer Land wieder zurückerobert habt?« fragte John Bratt. Mehmed Khalil lächelte. Er strich mit seinem rechten Zeigefinger über die Kehle. John Bratt warf die dreihundert Manuskriptseiten zu den anderen vierhundert und von da an schrieb er keine Zeile mehr.
Das lag aber schon lange zurück.
Die Einladung bei den Heevers läßt sich Jonny nicht entgehen. Die Farm ist riesengroß und irgendwo weit draußen, aber Mr. Heever besitzt auch ein Landhaus drüben in Northcliff. John findet den Weg: Gepflegter Rasen, Swimmingpool, gediegener Backsteinbau, schmiedeeiserne Gittertore. John will wissen, wo die farbigen Bediensteten wohnen, und Mr. Heever führt ihn durch den Garten zu einem Betonklotz. »Hier«, sagt er freundlich und öffnet eine Holztür. John sieht zwei Räume, die ihn an einen Ziegenstall erinnern. »Sie sind zufrieden hier und wollen gar nichts anderes«, behauptete Mr. Heever wieder. »Sie können nicht lesen und schreiben, sind aber für die Hausarbeit recht gut zu gebrauchen.«
Die Heevers sind eine christliche Familie. Vor dem Abendbrot wird gebetet. »Vor Gott sind alle Menschen gleich«, sagt Jonny aufsässig und Mr. Heever lächelt nachsichtig.
»Im Himmel schon«, meint er, »aber nicht hier auf Erden. Denn sonst hätte der liebe Gott die Menschen nicht so unterschiedlich geschaffen.« Dann wird gegessen.
»Was dieses Land braucht, ist ein Abraham Lincoln«, sagt Jonny zum Abschied. Mr. Heever ist nicht dieser Ansicht. Seine Frau auch nicht.
In den Frühnachrichten sagt der Sprecher, daß nun überall wieder Ruhe eingekehrt sei und die Polizei Herr der Lage wäre. Insgesamt hätten die Unruhen dreißig Tote gefordert und nicht zweiundvierzig, wie ausländische Journalisten berichteten. Die Streiks seien beendet. Zwei Polizisten wären leicht verletzt worden.
John Bratt bucht den Rückflug.
Am Flughafen geht er in eine Bar mit der Aufschrift »nur für Weiße«. Er bestellt ein Bier. Ein gutgekleideter Schwarzer verirrt sich hinein, der Aussprache nach ein Amerikaner. Er will auch ein Bier. Der Keeper schafft ihn hinaus. Ob er nicht lesen könne, sagt er. Der Ami schaut irritiert, verständnislos. Dann geht er.
John Bratt geht auch. Das Bier läßt er stehen. Er hat das Bedürfnis, dem schwarzen Ami ein paar freundliche Worte zu sagen, aber er findet ihn nicht mehr.
Wie er so in diesen langen, marmorgetäfelten Hallen des modernen Flughafengebäudes herumschlendert, hört er plötzlich seinen Namen im Lautsprecher. »Mr. Bratt is kindly requestet…«, eine angenehme Frauenstimme fordert ihn auf, in das Büro von British Airways zu kommen. Zweimal wiederholt sie die Durchsage. John Bratt wundert sich einigermaßen und findet dann den Weg in das Büro. Die Angestellte mit der angenehmen Stimme hat eine Nachricht für ihn, einen Zettel: Dringend ihre Dienststelle in London anrufen, liest John Bratt und wundert sich wieder.
Sie klappt erstaunlich schnell, die Verbindung nach London. Das erste, was er hört, ist die aufgeregte Stimme Mary Owens. Sie plappert etwas von einer wichtigen Sache, und daß er ein Glückskind sei und jetzt seine große Chance habe. Dann verbindet sie mit dem Chef.
Der Chef ist sehr ernst und freut sich vorerst einmal, daß man Mr. Bratt noch vor dem Rückflug erwischt habe, das erspart der Agency unnötige Reisespesen. Dann erklärt er, es handle sich um eine sehr wichtige Sache. Über die er am Telefon aber nicht reden könne. Mr. Bratt möge sich unverzüglich in der Britischen Botschaft melden, bei einem zweiten Sekretär Mr. Robertson. Der werde ihm alles erklären. Und Mr. Bratt solle sich für einen mehrwöchigen Aufenthalt in Johannesburg einrichten. Dann sagte er noch zweimal, daß die Sache sehr wichtig sei, und einmal, daß Mr. Robertson alle Spesen für John Bratt übernehmen werde. Letzteres nimmt Jonny erfreut zur Kenntnis. Er legt auf und storniert den gebuchten Rückflug nach London.
Im »Queen Victoria« bekommt er wieder dasselbe Einzelzimmer, das Bett ist frisch überzogen. Dem erstaunten George erklärt er, er könne sich von dieser Bar nicht trennen, weil er so gerne Krawatten trage. Dann trinkt er in Ruhe einen Whisky und wundert sich eine Weile.
Nach dem dritten Whisky ruft er die Botschaft an. Mr. Robertson käme erst morgen um neun Uhr wieder ins Büro, erfährt er. Er hat also noch eine lange Reihe von Whiskys Zeit, darüber nachzudenken, was für eine wichtige Sache ihm dieser Robertson morgen anhängen würde.
John Bratt mochte Diplomaten nicht besonders. Das kam davon, weil er im Laufe der Jahre viele kennengelernt hatte und dabei das Gefühl niemals losgeworden war, diese Menschen könnten im nächsten Moment vor Wichtigkeit platzen oder ihm erzählen, eine Großtante wäre mit dem Königshaus verwandt oder noch Schlimmeres. Eben dieses Gefühl beschlich ihn wieder, als er nun dem zweiten Sekretär der Botschaft ihrer Majestät gegenübersaß. Er rückte seine Krawatte zurecht.
Mr. Robertson fragte höflich, ob er Tee wolle und Jonny meinte, Kaffee wäre ihm lieber.
John Bratt war mit seinem Kaffee schon lange fertig, als Mr. Robertson noch immer diplomatisch herumredete. Es handle sich eigentlich nur um einen Freundschaftsdienst des Botschafters für Direktor Morris von der WNA und habe mit der Botschaft offiziell nichts zu tun. Überhaupt nichts. Der Diplomat wiederholte dies dreimal, immer in anderen wohlgesetzten Worten, und jedesmal endete er mit der höflichen Floskel: »Sie verstehen, Mr. Bratt?« John Bratt verstand überhaupt nichts, nickte aber jedesmal ebenso höflich. Alles, was er einigermaßen begriff, war, daß er sich an einen William Vreugdenhil aus Johannesburg irgendwie heranmachen und alles an die Agency berichten sollte, was er in den nächsten Wochen rund um diesen Mann sehen oder hören konnte. Warum ihm Direktor Morris das nicht einfach am Telefon gesagt hatte, blieb für John ein Rätsel. Ebenfalls der Grund des Ganzen, worum es eigentlich ging.
Er bekam von Mr. Robertson einen Zettel mit der Adresse dieses Vreugdenhil und hörte dann erfreut die Frage, ob ihm für seine Spesen ein Scheck oder Bargeld angenehmer sei. Bargeld war ihm lieber, und er erhielt ein vorbereitetes Kuvert von beachtlicher Dicke und steckte es in die Rocktasche. Bestätigung brauche er keine, beteuerte der Diplomat, das werde alles mit Mr. Morris geregelt. Dann begann Mr. Robertson über das für die Jahreszeit kühle Wetter zu reden, und John Bratt verabschiedete sich. Er war irgendwie erleichtert, als er wieder auf der Straße war, und hatte das sichere Gefühl, sein Gesprächspartner war es ebenso.