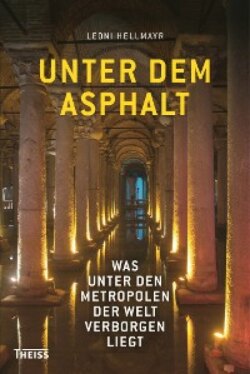Читать книгу Unter dem Asphalt - Leoni Hellmayr - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Paris
Оглавление„Arrête! C’est ici l’empire de la mort“ – Halte an, hier ist das Reich des Todes. Keine einladenden Worte, die da in großen Buchstaben über dem Eingang stehen. Aber es führt kein Weg daran vorbei. Entweder die Aufschrift ignorieren und hineingehen oder umkehren: zurück über einen schmalen, endlos erscheinenden Pfad und 131 Stufen an die Oberfläche. Alle Besucher entscheiden sich, den Eingang zu betreten. Und eigentlich wundert sich auch niemand über das Schild. Sie sind jetzt, nach 20 Metern Abstieg in die Tiefe und einem längeren unterirdischen Fußmarsch, endlich da angekommen, wo sie hin wollten: in den Katakomben von Paris.
Pfeiler aus aufeinandergestapelten Steinen stützen diesen Steinbruch unter Paris.
Das Reich des Todes wird gleich nach dem Eingang in seiner ganzen Dimension sichtbar: Menschengebeine reihen sich an beiden Seitenwänden des Ganges auf. Leere, schwarze Augenhöhlen der Totenköpfe starren die Besucher an. Weder Gitter noch Glaswand trennen sie voneinander. Die Knochen sind akkurat aufeinandergeschichtet, ab und zu unterbrochen von den dekorativ angeordneten Schädeln, manchmal sogar in Form eines Herzens. Erst nach einer halben Stunde endet der makabre Parcours. Es geht zurück an die Oberfläche.
Was die Besucher gesehen haben, ist lediglich ein kleiner Abschnitt des Totenreichs. Und die Katakomben bilden wiederum nur einen Bruchteil der Pariser Unterwelt: Seit Jahrhunderten steht die Hauptstadt auf einem 300 Kilometer langen Labyrinth aus ehemaligen Steinbrüchen. Während nahezu aller Epochen waren die Pariser fasziniert von dem, was unter ihren Füßen lag. Literaten schrieben über die Steinbrüche und Fotografen hielten die Stollen in Bildern fest. Immer wieder zog es mutige Abenteurer in die verzweigten Gänge. Zumindest, wenn die unterirdischen Räume nicht wieder einmal zu wanken drohten.
Ähnlich wie bei einem Blätterteig schichten sich unter Paris Sedimente aus 250 Millionen Jahren übereinander. Was die Menschen brauchten, um die Stadt zu errichten, fanden sie in bester Qualität direkt unter sich. Die Fundamente des Louvre, des Palais Royal und des Hôtel des Invalides, ja selbst die Stadtmauern und ein großer Teil der Kathedrale Notre Dame wurden aus dem örtlichen Kalkstein errichtet. Das Baumaterial unter Paris war nicht nur bei den Stadtbewohnern äußerst begehrt. Auch weit entfernte Gemeinden wie Étampes und Chartres bestellten hier den Kalkstein für den Bau ihrer Gotteshäuser.
Die meisten Steinbrüche liegen tiefer als die Metro und die Kanalisation. Von diesem riesigen Geflecht fällt flächenmäßig nur ein Bruchteil auf die Katakomben. Die Knochenhäuser sind erst 230 Jahre alt, während die ersten unterirdischen Stollen bereits im 12. Jahrhundert entstanden.
Als viele Jahrhunderte zuvor die Römer sich in dieser Gegend niedergelassen hatten, blieb ihnen das kostbare Baumaterial im Boden nicht lange unbemerkt: Vor allem Kalkstein, aber auch Gips fanden sie in rauen Mengen. Sie gruben die verschiedenen Gesteine aus, um die Provinzstadt Lutetia, so der antike Name von Paris, aufzubauen. Im Gegensatz zu den späteren Förderungen im Mittelalter lagen ihre Baugruben noch unter freiem Himmel. An den Stellen, wo sich der Kalkstein besonders weit oben befand, trugen sie die darüber liegende Bodenschicht ab. Das war eine einfache und kostengünstige Methode. Doch meistens lag die Kalksteinschicht viel tiefer, sodass ein großflächiges Abtragen der oberen Schichten nicht mehr möglich gewesen wäre. Stattdessen ging man dazu über, unterirdische Stollen zu bauen. Auf diese Weise blieb die oberste Bodenschicht auch für die Landwirtschaft weiterhin nutzbar.
Ab dem 12. Jahrhundert schufteten Steinbrucharbeiter in ständiger Finsternis. Es waren vor allem Immigranten aus den ärmeren Provinzen, die trotz der schlechten Bezahlung diesen gefährlichen Beruf ausübten. An hölzernen Förderrädern über den senkrechten Schächten zogen die Arbeiter unermüdlich tonnenschwere Steinblöcke aus der Tiefe empor. Mit gelblichem Staub am ganzen Körper und auf ihrer zerlumpten Bekleidung machten sie, wenn sie sich an der Oberfläche zeigten, einen eher unheimlichen Eindruck. Die Pariser Gesellschaft beäugte die Steinbrucharbeiter argwöhnisch, beschrieb sie als dreckig, abgezehrt und verwahrlost. Auch Alexandre Dumas schildert in seinem Werk „Les Mille et un Fantômes“ schaurigfasziniert das Leben der Steinbrucharbeiter: Durch die Dunkelheit ihres Arbeitsplatzes hätten diese Menschen die Instinkte von Nachttieren, seien schweigsam und wild.
Der Beruf war nicht nur gering geschätzt und schlecht bezahlt, sondern auch anstrengend und sehr gefährlich. Regelmäßig ereigneten sich Unfälle, oft mit tödlichen Folgen. Stützende Balken in den Stollen drohten einzubrechen und auf die Arbeiter zu fallen. Manchmal riss das Kabel eines oberirdischen Förderrades, das daraufhin ungebremst weiterdrehte. Die Männer, die sich zu nah daran aufhielten, wurden dann wie von einer riesigen Schleuder in die Luft katapultiert.
In den Vororten von Paris gruben sich die Arbeiter zunächst seitlich in die Hügel vor. Später bauten sie senkrechte Schächte in den Boden, weil sich dadurch die Stollen besser belüften ließen. Jahrhundertelang wurde der Steinabbau auf diese Weise extensiv betrieben. Es gab so viele Förderräder in der Gegend um Paris, dass verschiedene Künstler die auffallenden Maschinen in ihren Gemälden verewigten. Kalkstein als Baumaterial, Gips für Geschirr, Kies für die Glasherstellung, Mergel und Lehm für Ziegel und Backsteine – im Boden gab es kaum etwas, für das die Stadtbewohner nicht irgendeine Verwendung fanden.
In den Katakomben von Paris.
War der Stollen komplett ausgebeutet, geriet er zumeist bald in Vergessenheit. Währenddessen veränderte sich die Oberfläche der Stadt. Paris dehnte sich aus. Die Stadtmauern mussten mehrmals erweitert werden, die Vororte wandelten sich zu neuen Bezirken der Großstadt. Stollensysteme, die einst außerhalb von Paris lagen, befanden sich plötzlich direkt unter den Straßen und Häusern der Hauptstadt. So haben heute das fünfte, sechste sowie das zwölfte bis 16. Arrondissement eines gemeinsam: In ihrem Untergrund liegen Kalksteinbrüche. Die Arrondissements 18, 19 und 20 sind dagegen von 65 Hektar großen Gipsstollen unterhöhlt. Eine Gesamtfläche von 2350 Hektar durchlöchert die Unterwelt von Paris und den benachbarten Départements Hauts-de-Seine und Val-de-Marne.
Damit die Steinbrüche nicht einstürzten, ließen die Arbeiter zunächst massive, natürliche Pfeiler aus Kalkstein stehen, mit denen die Stollen stabilisiert wurden. Um aber auch auf dieses Material nicht mehr verzichten zu müssen, ersetzten sie ab Anfang des 16. Jahrhunderts die Pfeiler mit kleineren, aufeinandergestapelten Steinen, die bis zur Decke reichten. Zwischen diesen Pfeilern wurden Trockenmauern hochgezogen und die leeren Räume mit Steinen und Schutt aufgefüllt. Diese Technik stabilisierte die Stollen jedoch nur mittelmäßig. Jedenfalls stürzte der Boden von Paris weiterhin regelmäßig ein.
Ein solcher „Fontis“ entsteht immer auf dieselbe Weise: An der Decke der Stollen bilden sich Risse. Erst fallen nur kleine, dann größere Erdbrocken herab. Ein glockenförmiger Durchbruch wächst langsam nach oben. Es kann Jahre, manchmal auch Jahrhunderte dauern. Früher oder später aber erreicht der Durchbruch die Oberfläche. Die Gebäude über dem Fontis verlieren irgendwann ihren Halt.
Vor allem im 18. Jahrhundert brach der Boden unter Paris regelmäßig auf. Mal stürzte ein Haus ein, dann eine Häuserreihe. Sogar ganze Straßen versanken von einem Moment auf den anderen im Erdboden. Panik breitete sich in der Bevölkerung aus. Die Stadt musste handeln. Im Jahr 1777 gründete sie den „Service de l’Inspection des Carrières“. Der Architekt Charles-Axel Guillaumot wurde zum Generalinspekteur ernannt und stand an der Spitze dieser Behörde. Die Stadt erteilte ihm einen klaren Auftrag: den Untergrund von Straßen und öffentlichen Gebäuden zu stabilisieren, und zwar sofort. Um die Stollen unter Privathäusern mussten sich die Eigentümer hingegen selbst kümmern. Laut dem bürgerlichen Gesetzbuch gehört ihnen alles, was unter ihrem Grundstück liegt – bis zum Mittelpunkt der Erde! Guillaumot ließ sich von dem Mammutprojekt nicht entmutigen. Im Gegenteil: Äußerst präzise, energisch, beinahe manisch gab er sich seiner neuen Aufgabe hin. Zunächst verschaffte sich Guillaumot einen Überblick über das unterirdische Geflecht und erstellte Pläne von allen bekannten Steinbrüchen. Für seinen Arbeitsauftrag zögerte er auch nicht, persönlich in die einsturzgefährdeten Stollen hinabzusteigen, um sich ein Bild von den bisherigen Sicherungsmaßnahmen zu machen. Er kam zu einem vernichtenden Urteil: Die Steinbrucharbeiter der vorherigen Generationen hatten in seinen Augen unprofessionell und stümperhaft gearbeitet. Die Gefahr von weiteren Einstürzen in der Stadt hielt er für sehr wahrscheinlich. Daraufhin begannen Bauarbeiten, um das Stollensystem erneut, dieses Mal aber mit längerfristigem Erfolg, zu sichern. Obwohl das Ganze fernab von den Augen der Gesellschaft geschah, legte Guillaumot viel Wert auf Perfektion. Die Arbeiter ersetzten die alten Pfeiler aus aufeinandergestapelten Steinen durch massive Pfeiler, die aus Kalkstein, Beton und Mörtel bestanden. Die Stützpfeiler wurden säuberlich verfugt und in gleichmäßigen Abständen aufgestellt, die Hohlräume mit Schutt und Steinen aufgefüllt. Auf steinernen Tafeln gravierten die Arbeiter die Namen der Straßen und Gebäude ein, die parallel über den unterirdischen Galerien verliefen. So gibt beispielsweise in den Katakomben bis heute eine Tafel mit der Aufschrift „Avenue de Montsouris“ dem Besucher eine Vorstellung davon, wo er sich gerade befindet. Auf Steinen ritzten die Arbeiter statt Straßennamen kryptische Buchstaben- und Zahlenkombinationen ein. Diese informieren über das Datum und den zuständigen Chefingenieur, der den jeweiligen Stollen stabilisieren ließ. Es dauerte 100 Jahre, bis die von Guillaumot begonnenen Bauarbeiten im Untergrund abgeschlossen waren.
Trotz der umfangreichen Befestigung der Stollen kam es immer noch, wenn auch viel seltener, zu vereinzelten Einstürzen. Beispielsweise 1909, als die Rue Tourlaque unter den Füßen der Passanten nachgab. Und dennoch gilt Guillaumot dank seiner Leistung als der Mann, der Paris wortwörtlich vor dem Untergang bewahrte.
Obwohl fast alle Steinbrüche aufgefüllt wurden, ist bis heute ein großes Netzwerk aus Stollen und Beobachtungsgängen übrig geblieben. Dazu gehört auch der Kalksteinbruch unter dem Hôpital Cochin im 14. Arrondissement. Im Jahr 1983 hat die historische Gesellschaft SEADACC angefangen, diese Räume zu erforschen und einen Abschnitt wieder zugänglich zu machen. Im „Carriere des Capucins“ haben sich Spuren aller Epochen erhalten: massive Pfeiler aus der Anfangszeit des Stollens, Trockenmauerwerk aus dem 15. Jahrhundert sowie Stützpfeiler aus der Zeit Guillaumots. Es ist eine der wenigen (legalen) Möglichkeiten, den Untergrund von Paris in seiner ganzen Breite kennenzulernen.
Während die Bauinspektion im Boden von Paris gegen Fontis-Einbrüche und ungesicherte Stollen kämpfte, hatten die Bewohner auf der Oberfläche noch eine ganz andere Sorge: Es stank zum Himmel in dieser Stadt – nach Leichen! Permanent schlechter Geruch in den Pariser Gassen war an und für sich nichts Neues. Aber ab Mitte des 18. Jahrhunderts wurde neben dem Gestank nach Abfällen und Exkrementen jener der Verwesung immer penetranter. Die Toten überfüllten die Stadtfriedhöfe. Besonders auffällig war das in der Umgebung des Cimetière des Innocents. Über viele Jahrhunderte hinweg hatten sich die Gebeine von sämtlichen Pariser Kirchengemeinden auf diesem Friedhof angesammelt. Tausende Opfer der vielen Hungersnöte und Seuchen lagen hier in Massengräbern bestattet. Die Kapazität des größten innerstädtischen Friedhofes mitten im Zentrum von Paris war schon seit langem ausgeschöpft. Das Niveau des Friedhofbodens hatte sich wegen der Leichenberge um zwei Meter erhöht. Und weil die Bevölkerung ständig wuchs, nahm auch die Zahl der Toten zu. Um Platz für die Bestattung der jüngst Verstorbenen zu schaffen, wurden die Überreste der Toten aus den Gräbern in oberirdische Ossuarien umgelagert, oft bevor sie vollständig verwest waren. Über den benachbarten Stadtgebieten schwebte allgegenwärtig der süßliche Leichengeruch. Giftige Dämpfe zogen in die Häuser und blieben in den Tapeten hängen. Berichten zufolge wurde Milch in nur wenigen Stunden sauer, Wein wurde zu Essig. Erst 1780, als die Wand eines Kellers einbrach, Leichen in den Raum purzelten und mehrere Bewohner an den austretenden Faulgasen erkrankten, verbot die Stadt weitere Beisetzungen im Cimetière des Innocents. Fünf Jahre später folgte die Entscheidung, den Friedhof vollständig aufzulösen. Doch wohin mit den Toten? Steinbruchinspektor Guillaumot nahm sich der Frage an und fand einen geeigneten Ort. Die Stollensysteme kannte er mittlerweile gut und wusste, welcher Abschnitt sich für die Lagerung der Gebeine eignete. Südlich der Seine und außerhalb der Stadtmauern ließ er einen konsolidierten Sektor vom übrigen Stollensystem abtrennen. Und dann ereignete sich lange Zeit in jeder Nacht dieselbe sonderbare und unheimliche Szene. Begleitet von Fackelträgern holperten schwarz verhängte Pferdekarren über das Pflaster der Gassen. Priester folgten der Kolonne. Ihr Gesang und das Poltern der Wagen durchbrachen die Stille der Nacht. Die Ladung: Berge von Knochen aus dem Cimetière des Innocents. Das Ziel: die von Guillaumot ausgewählten Steinbrüche am linken Seineufer. Kaum dort angekommen, wurden die Knochen recht pietätlos in einen senkrechten Schacht gekippt. Arbeiter im Stollen verteilten die Knochenhaufen auf die verschiedenen Hohlräume. Und in den folgenden Jahren verschwand der Verwesungsgeruch langsam aus den Straßen von Paris.
Auch die übrigen innerstädtischen Friedhöfe wurden geschlossen, ihre Toten ebenfalls zu den Steinbrüchen, die auf den Namen „Tombe Issoire“ getauft wurden, transportiert. Die Katakomben sollten die neue Ruhestätte für die Gebeine von rund sechs Millionen Verstorbenen werden.
Ende des 18. Jahrhunderts begann ein unglaublicher Besucheransturm auf die Katakomben. Im Jahr 1809 übernahm Héricart de Thury den Posten des kurz zuvor verstorbenen Guillaumot. Stabilität, Ordnung und Ruhe – das, wonach sich die Pariser nach der Revolution so sehr sehnten, führte Thury auch in der Unterwelt ein. Unter seinen Weisungen schichteten die Arbeiter Gelenkknochen, Schienbeine und Schädel akkurat aufeinander.
Das Ergebnis können die Besucher bis heute sehen: Wände aus Knochen, 1,50 Meter hoch, viele Kilometer lang. Ob Aristokraten, Bürger, Handwerker, Bettler, Frauen oder Männer – gesellschaftliche Unterscheidungen gibt es bei den Toten in den Katakomben nicht mehr. Selbst die Überreste berühmter Persönlichkeiten wie des Revolutionärs Maximilien de Robespierre oder des Schriftstellers Jean Baptiste Racine befinden sich irgendwo zwischen den Millionen Gebeinen. Wenn sie nicht in den chaotischen Haufen hinter den dekorativ gestapelten Mauern liegen, sind sie bis heute Teil eines einzigartigen Kunstwerkes aus Knochenreihen, Totenkopfreihen und -girlanden an beiden Seiten der langen Gänge. Pilaster, Tafeln mit Sinnsprüchen und Kreuze unterbrechen die Eintönigkeit der Wände.
Thury war stolz auf das Ergebnis und vor allem darauf, dass er mit diesem Grabmonument Künstler und Reisende aus dem Ausland beeindrucken konnte. Die Katakomben wurden zum beliebten Ausflugsziel für die Bewohner wie auch für die Besucher der Stadt. Am Wochenende zog es ganze Familien in die Katakomben. Jeder wollte die neue Attraktion sehen. Fasziniert und schaudernd zugleich spazierten die Besucher an den dekorativen Wänden aus Gebeinen vorbei. Im Jahr 1830 wurden die Katakomben geschlossen, unter anderem wegen Vandalismus. 20 Jahre später bei der Wiedereröffnung begann erneut ein reges öffentliches Interesse an dem unterirdischen Ossuarium. Während der Öffnungszeiten bildeten sich lange Menschenschlangen vor dem Eingang. Für die vornehme Gesellschaft wurden in den Knochenkammern Konzerte aufgeführt und Gedichte vorgetragen. Ab und zu sollen Liebespaare sich ab sichtlich in den Gängen verirrt haben, um die Zweisamkeit zwischen Totenschädeln mit Gänsehaut und Kribbeln im Bauch zu genießen.
Lediglich ein zwei Kilometer langer Abschnitt der Katakomben ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Andere Bereiche der Steinbrüche zu betreten ist illegal und wird mit Bußgeldern bestraft. Na und? Verbote sind da, um gebrochen zu werden. Jedenfalls lassen sich die „Kataphilen“ von solchen Regeln noch lange nicht daran hindern, ihrer großen Leidenschaft nachzugehen. Im Gegenteil: Für sie liegt gerade im Verbot der Reiz, die Gänge zu durchwandern, die fernab von den vielbesuchten Katakomben liegen.
Kataphile lieben die Welt unter Paris. In den 1980er Jahren blühte die Untergrundszene richtig auf. Jugendliche stiegen durch die Kanaldeckel in den Untergrund, sprayten Graffiti an die Wände und feierten wilde Partys. Manchen Zeitungen zufolge sollen sogar schwarze Messen hier unten stattgefunden haben. Daraufhin ließ die Stadt viele Kanaldeckel verschweißen, andere Eingänge zumauern oder mit Gittern verschließen.
Wo ein Wille ist, findet man aber immer einen Weg – auch nach unten. Und die Kataphilen kennen sich auch ohne Karten in dem weitverzweigten Labyrinth aus. Zu der Gemeinschaft gehören Punks, Graffitikünstler, Fotografen, Touristen, Menschen aller Altersstufen. Im Internet tauschen sie Informationen aus, verabreden sich zu Touren, organisieren Partys, aber auch Treffen, um gemeinsam den Müll in den Stollen zu beseitigen. Bei den unterirdischen Spaziergängen riskieren sie, sich doch einmal zu verirren. Oder den Polizisten einer Spezialeinheit in die Arme zu laufen, die regelmäßig in den Gängen patrouillieren.
Nach dem Abstieg in den Untergrund steht man inmitten der Geschichte von Paris. Spuren aus 2000 Jahren haben sich überall erhalten: jahrhundertealte Wandmalereien und Steinskulpturen, Brunnen und Straßenschilder. Oder auch das Grabmal des legendären Philibert Aspairt. Im Jahr 1793 soll der Schlosser sich im Untergrund verlaufen und nie wieder herausgefunden haben. Erst elf Jahre später wurde sein vermeintlicher Körper in einem Stollen entdeckt. An derselben Stelle begrub man ihn und errichtete ihm ein Grabmal, das bis heute immer wieder von Untergrund-Liebhabern aufgesucht wird.
In wenigen Metropolen existiert eine solche Gemeinschaft wie die der Kataphilen in Paris. Neben der Abenteuerlust zieht es sie noch aus einem anderen Grund manchmal bis zu zwölf Stunden lang in die Tiefe: völlige Dunkelheit und absolute Stille – zwei Dinge, die es in der Metropole auf der Oberfläche nur selten gibt.