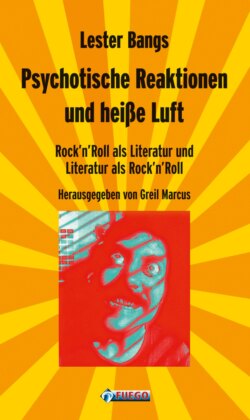Читать книгу Psychotische Reaktionen und heiße Luft - Lester Bangs - Страница 8
ОглавлениеAstral Weeks
Van Morrisons Astral Weeks wurde fast auf den Tag genau zehn Jahre bevor ich diesen Text schrieb, veröffentlicht. Für mich hatte es eine besondere Bedeutung, denn der Herbst 1968 war eine schreckliche Zeit. Ich war ein physisches und psychisches Wrack, meine Nerven total zerrüttet, Geister und Spinnen rückten bedrohlich näher und nisteten sich in meinem Verstand ein. Meine sozialen Kontakte waren praktisch nicht mehr existent, die Gegenwart anderer machte mich nervös und paranoid. Ich versank endlose Tage und Nächte in meinem Lehnstuhl im Schlafzimmer, damit beschäftigt, Zeitschriften zu lesen, fernzusehen, Platten zu hören und ins Leere zu starren. Ich hatte keine Ahnung, wie ich meine Situation ändern sollte und hätte vermutlich auch nichts unternommen, wenn ich es gewusst hätte.
Astral Weeks ist das Thema dieses Artikels, die Rockplatte mit der größten Bedeutung in meinem bisherigen Leben, völlig unabhängig davon, wie ich mich fühlte, als sie rauskam. Aber in dem Zustand, in dem ich mich damals befand, hatte sie den Stellenwert eines Leuchtfeuers, ein Licht auf der weit entfernten Küste jenseits des trüben Wassers und darüber hinaus, ein Beweis, dass es noch etwas anderes außer Nihilismus und Destruktivismus gab, dem man künstlerisch Ausdruck verleihen konnte. (Meine andere große Platte in dieser Zeit war White Light / White Heat). Es klang, als leide der Mann, der Astral Weeks gemacht hatte, fürchterliche Schmerzen, Schmerzen, die in den meisten von Van Morrisons vorangegangenen Werken nur angedeutet waren, aber wie bei den späteren Alben von Velvet Underground gab es ein rettendes Element in dieser Schwärze, ein ultimatives Mitgefühl für die Leiden anderer und einen Pfad reiner Schönheit und mystischer Ehrfurcht, der mitten durch das Herz dieses Werks schnitt.
Ich weiß nicht genau, wie wichtig es ist, dass viele Leute unterschiedliche Versionen von meiner ersten Begegnung mit Astral Weeks erzählen. Ich glaube nicht, dass das Album Menschen, die dunkle Zeiten durchleben, anzieht. Es kam zu einer Zeit heraus, in der eine Menge Dinge, an der eine Menge Leute leidenschaftlich hingen, auseinander zu brechen begannen, als die selbstzerstörerische unterirdische Strömung, die immer ein Begleiter der großen Sechziger Party war, eine Menge Fußknöchel fest im Griff hatte und nach unten zog. Obwohl es letztlich zeitlos ist, war Astral Weeks vielleicht doch das Produkt einer Ära. Es ist besser, das zu glauben, als sich zu fragen, von welchen mit Staubweben behafteten, irischen Gespenstern Van Morrison abstammen könnte.
Drei Fernsehsendungen: 1970 eine Übertragung von NET, unglaubliche Starbesetzung im Fillmore East. The Byrds, Sha Na Na und Elvin Bishop haben ihr Ding gemacht. Jetzt sehen wir drei von vier Songs aus Van Morrisons Set. Wie damals für ihn üblich bildet »Cypress Avenue« von Astral Weeks den Höhepunkt. Nachdem er alle Strophen durch hat, treibt er den Song, die Band und sich selbst zu einem Fanal, das seitdem zu einem seiner Markenzeichen und einem zeitlosen klassischen Rock’n’ Roll Setende geworden ist. Mit einer unbeschreiblichen Dynamik, die ihm erlaubt, von vollendet hingeworfener exzentrischer Phrasierung im nächsten Atemzug zu purer Leidenschaft zu springen, lässt er die Musik von Crescendo zu Crescendo anschwellen, beendet den Song und beginnt ihn neu, beendet und beginnt, wieder und wieder, erzwingt lange manische Pausen wie riesige Fragezeichen zwischen Ende und Neubeginn und beherrscht den Raum durch reine Spannung, die sich zu einem Schrei aufbaut – »Es ist zu spät, um jetzt aufzuhören« –, und genau wenn man glaubt, jetzt gerät alles aus den Fugen, macht er eiskalt einen Schnitt, hinterlässt die Leere einer krepierten Explosion, schmeißt das Mikrofon hin und verlässt die Bühne. Das gehört wirklich zu den perversesten Dingen, die ich einen Künstler in meinem ganzen Leben habe tun sehen. Und natürlich ist es sensationell, unsere Eingeweide haben sich verknotet, wir sind halb verrückt und flehen nach mehr, aber wir wissen verdammt nochmal gut, wir haben bereits etwas gesehen und gehört.
1974, die nächtliche Übertragung eines Rockkonzerts im Fernsehen: Van und seine Band kommen auf die Bühne, schlagen ein paar strahlende Akkorde an, und ungefähr zehn Minuten lang hängt er an den Worten »Way over yonder in the clear blue sky / Where flamingos fly.« Kein anderer Text. Ich glaube, auch keine Instrumentalsolos. Nur diese Worte, langsam, wieder und wieder, aufgeblasen, permutierend, zerpflückt, im Raum schwebend und dann in alle Winde zerstreut, wie ein Mantra gemurmelt, bis sie zu Silben ohne Sinn werden, dann wieder zurück zu demselben aufsteigenden Bild, während die Zeit völlig still zu stehen scheint. Er steht da, mit geschlossenen Augen, singt entrückt, während die Band zitternd über offen gestimmten, riesigen, tiefen, blauen Strömen eigener Art schwebt.
1977, Frühsommer, gleiche Art von Show: er singt »Cold Wind in August«, ein Song aus seinem kurz zuvor veröffentlichten Album A Period of Transition, das auch eine maßgeblich veränderte Version des Flamingosongs enthält. »Cold Wind in August« ist eine Ballade, die Van fein und standardmäßig interpretiert. Das einzige Problem ist, dass er die ganze Zeit, während er singt, in gerader Linie auf der Bühne hin- und herläuft, seine Augen fest geschlossen, sein kleiner hydrantenförmiger Körper drängt stromaufwärts gegen etwas an, das eine höllische Nervosität sein muss, die sich vielleicht auch auf den Kameramann überträgt.
Worum es hier geht, ist ein kompletter Satz verbaler Ticks, obwohl einige auch physischer Art und Grund genug sind, sich die Mühe zu machen, seinen Stil zu definieren. Sie sind überall auf Astral Weeks zu finden: vier gehetzte Wiederholungen der Sätze »you breathe in, you breathe out« und »you turn around« in »Beside You«; in »Cyprus Avenue« zwölf mal »way on up«, »baby«, dreizehn mal hintereinander gesungen, was klingt wie jemand, der ekstatisch den Hügel zu seiner Geliebten hinunter rennt, und die herzzerreißende Art, wie er »one by one« in der dritten Strophe dehnt; und am meisten bei »Madame George«, wo er die Worte »dry« und dann »your eye« zwanzig mal in einem sich spiralförmig drehenden melodischen Bogen singt, der so wunderschön ist, dass er einem den Atem raubt, und dann folgt: »And the love that loves the love that loves the love that loves the love that loves the love that loves.«
Van Morrison ist besessen davon, wie viel musikalische oder verbale Information er auf kleinem Raum komprimieren kann, und dann wieder im Gegensatz dazu, wie weit er eine Note, ein Wort, einen Klang oder ein Bild dehnen kann. Einen Augenblick einzufangen, sei es Zärtlichkeit oder schmerzlicher Stich. Er wiederholt gewisse Phrasen bis ins Extrem, die bei jedem anderen lächerlich wirken würden, weil er darauf wartet, dass sich eine Vision entfaltet, er versucht so unaufdringlich wie möglich, sie anzuschieben. Manchmal vermittelt er sie durch Stille, in dem er den Song mittendrin abwürgt: »It’s too late to stop now!« Er ist auf der großen Suche, angetrieben von dem Glauben, dass durch diese musikalischen und mentalen Prozesse die Erleuchtung erlangt werden kann. Oder zumindest ein flüchtiger Blick darauf.
Wenn er dies versucht, läuft das eher über Gefühle als über das Gesprochene Wort – vielleicht entstammt das Gefühl hauptsächlich dem Streben danach –, aber es bleibt auch immer die Wahrnehmung: WAS, wenn er das WORT ERGRIFFE; es gibt Zeiten, da scheint das WORT ganz in der Nähe zu schweben. Und dann gibt es Zeiten, wo wir merken, dass das WORT direkt neben uns war, dass die profansten, über Gebühr beanspruchten Phrasen transformiert werden: Nehmen wir »love« aus »Madame George.« Aus der relativen Stille heraus das WORT: »Snow in San Anselmo«. »Darauf läuft es hinaus«, will Van sagen, und das meint er auch (sind seine Interviews nicht faszinierend?) Was er nicht sagt ist, dass er in dieser Schneeflocke ist, isoliert durch den Song »And it’s almost Independence Day«.
Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wann ich endlich auf den Punkt komme und über Astral Weeks spreche. Es gibt in der Tat jede Menge Astral Weeks, über die ich nichts erzählen möchte, und zwar weil es, unabhängig davon, ob ihr es gehört habt oder nicht, nicht fair wäre, euch meine, von lapidarer subjektiver Metaphorik geprägte Interpretation aufzudrängen, und weil ich in vielen Fällen auch gar nicht weiß, wovon er spricht. Er aber auch nicht: »Es überrascht mich nicht, dass die Leute meine Songs unterschiedlich interpretieren«, sagte er einem Interviewer des Rolling Stone. »Ich möchte nicht den Eindruck vermitteln, ich wüsste, was das alles bedeutet, dem ist nämlich nicht so ... Es gibt Zeiten, in denen ich selbst vor einem Rätsel stehe. Ich sehe mir an, was ich gemacht habe, und, ja, da ist es eben und es fühlt sich gut an, aber ich kann nicht mit Sicherheit sagen, was es bedeutet.«
There you go
Starin’ with a look of avarice
Talkin’ to Huddie Ledbetter
Showin’ pictures on the walls
And whisperin’ in the halls
And pointin’ a finger at me
Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was das »bedeutet«, obwohl ich mich auf eine Art annähern möchte, die so indirekt und ausweichend wie der Text selbst ist. Weil man sowieso Schwierigkeiten bekommt, wenn man sich vornimmt, genau zu erklären, was ein mystisches Dokument, denn nichts anderes ist Astral Weeks, bedeutet. Es bedeutet zum einen, dass Richard Davis Bass spielt, was die Songs und die Texte mit einer Lyrik bereichert, die mehr sind als nur großartiges musikalisches Können: sein Spiel ist mehr als inspiriert, es hat ihn etwas berührt, etwas aus dem Reich der Wunder. Das ganze Ensemble ist so, die Streichersektionen von Larry Fallon, die Gitarre von Jay Berliner (er spielte auch bei Mingus’ Black Saint and the Sinner Lady), Connie Kays Schlagzeug. Van und sie klingen so, als würden sie die Gedanken des anderen nicht nur lesen, sondern in ihnen schwelgen. Die Tatsachen mögen ganz anders aussehen. John Cale machte zur gleichen Zeit in einem angrenzenden Studio ein Soloalbum und er sagte, dass »Morrison mit niemandem arbeiten konnte. Also ließen sie ihn schließlich allein im Studio. Er spielte alle Stücke mit einer akustischen Gitarre ein und später spielten sie den Rest auf anderen Tonspuren dazu.«
Cales Geschichte mag stimmen oder nicht, aber die Fakten sind hier ohnehin nicht allzu hilfreich. Fakt: Van Morrison war zweiundzwanzig oder dreiundzwanzig Jahre alt, als er diese Platte aufnahm; das ist Lebzeiten her. Astral Weeks hat nichts mit Fakten, sondern mit Wahrheiten zu tun. Sofern sich Astral Weeks überhaupt kategorisieren lässt, handelt es sich um eine Platte über Menschen, die vom Leben zugedröhnt sind, vollständig überwältigt, eingezwängt in ihrer Haut, ihrem Alter, ihrem Selbst, gelähmt von dem ungeheuren Ausmaß dessen, was sie in einem Moment der Vision begreifen können. Eine kostbare und eine furchtbare Gabe zugleich, geboren aus einer grausamen Wahrheit, denn was sie sehen, ist von unendlicher Schönheit und zugleich unendlich entsetzlich: die unbegrenzte menschliche Fähigkeit, je nach Laune zu erschaffen oder zu zerstören. Es hat weder etwas mit fernöstlicher Mystik noch mit psychedelischer Vision jenseits des Smaragds zu tun noch mit der Baudelaireschen Wahrnehmung der Schönheit des Abschaums oder der Groteske. Worauf es hinausläuft, ist vielleicht für einen Augenblick das Wissen um das Wunder des Lebens, mit seiner unvermeidlichen Begleiterscheinung, ein kurzer, Schwindel erregender Blick auf das Ausmaß der möglichen zu erleidenden Verletzungen und auf das Ausmaß der Verletzungen, die man zufügt.
Eingeklemmt zwischen Verzückung und Seelenqual, fragt man sich, ob es sich nicht um dasselbe handeln könnte oder ob die beiden nicht in enger Beziehung zueinander stehen. In »T.B. Sheets«, seiner letzten, dieser Platte vorangegangenen Erzählung, sah Van Morrison ein Mädchen, das er liebte, an Tuberkulose sterben. Der Song war klaustrophobisch, erstickend, übermächtige »innuendos, inadequacies, foreign bodies«.
Viele Leute konnten nichts damit anfangen, Greil Marcus hat es als Schrott bezeichnet, aber ich glaube, es hat bei ihm einen Nerv getroffen. Wie dem auch sei, der Punkt ist, dass gewisse Teile von Astral Weeks wie »Madame George« und »Cyprus Avenue« den Schmerz in »T.B. Sheets« aufgreifen und die Welt darin versenken. Denn der Schmerz, eine geliebte Person an einer grausamen Krankheit sterben zu sehen, mag schrecklich sein, aber er ist zumindest verstehbar, auf gewisse Weise messbar, und er führt irgendwo hin, denn es gibt einen Prozess: Krankheit, Verfall, Tod, Trauer, emotionale Besserung. Aber der schaurig-schöne Horror von »Madame George« und »Cyprus Avenue« besteht genau darin, dass die Leute in diesen Songs nicht sterben, wir sehen das Leben in voller Blüte und das Leiden dieser Menschen, das ist keine Krankheit, sondern ihre Natur, es sei denn, Natur ist eine Krankheit.
Ein Mann sitzt im Auto auf einer mit Bäumen gesäumten Straße und beobachtet, rettungslos verliebt, wie ein vierzehnjähriges Mädchen von der Schule nach Hause läuft. Ich habe mich mit Freunden schon fast geprügelt, weil ich darauf beharre, dass sich viele der frühen Werke Van Morrisons mit dem sich geradezu zwanghaft wiederholendem Thema der Pädophilie beschäftigen. Hier haben wir etwas, das unmittelbar und genau dies ist und doch weit darüber hinausgeht. Er liebt sie. Deswegen ist er hilflos. Zitternd. Paralysiert. Rasend. Hoffnungslos. Die Natur macht sich über ihn lustig. So wie sich nur die Natur über die Natur lustig machen kann. Oder ist Liebe in erster Linie natürlich? Egal. Am Ende des Songs erreicht er eine Art halluzinogene Ekstase; die Musik schmerzt und schmachtet in den letzten Zügen. Das ist der höchste Schmerz, zum Zuschauer verdammt zu sein. Und vielleicht gar nicht so weit weg von »T.B. Sheets«, außer dass es romantisch irgendwie einfacher ist, da zu sitzen und zuzusehen, wie jemand, den man liebt, stirbt, als jemanden in der Blüte seiner Jugend und Gesundheit zu sehen und zu wissen, dass man ihn nie nie haben kann, dass man noch nicht mal mit ihm reden kann.
»Madame George« ist der Strudel des Albums. Wahrscheinlich eines der einfühlsamsten Musikstücke, die je gemacht wurden, es bittet uns – nein, arrangiert es –, das Elend einer, wenn ich es ganz brutal ausdrücke, liebeskranken Drag Queen mit so intensivem Gefühl zu sehen, dass wir, wenn der Sänger sie verletzt, dasselbe tun. (Morrison hat in einem Interview immerhin gesagt, dass der Song nichts mit einem Transvestiten zu tun hat, zumindest seines Wissens nicht, wie er schnell hinzufügte, aber das ist Schwachsinn.) Die Schönheit, Sensibilität, Heiligkeit des Songs liegt darin, dass ihm nichts Sensationslüsternes, Ausbeuterisches oder Geschmackloses anhaftet; so gesehen hat Van Recht, wenn er behauptet, der Song handle nicht von einer Drag Queen, genau wie meine Freunde bei der Pädophilie Recht hatten, nicht ich: er handelt von einer Person, wie alle großartigen Songs, wie alle große Literatur.
Der Schauplatz ist derselbe wie im vorangegangenen Stück, »Cyprus Avenue«, offensichtlich ein Ort, wo Leute sich gehen lassen, von Sehnsucht in selbstzerstörerische, blicklose Konfrontation mit ihrem Schicksal getrieben. Ein Elementarplatz gnadenlosen Urteils – Wind und Regen spielen in beiden Songs eine Rolle. Interessanterweise ist es auch ein Ort des noch grausameren Urteils der Kinder über Erwachsene, in beiden Fällen Objekte der Liebe, die ihren erwachsenen Möchtegern-Liebhabern absolut indifferent gegenüber stehen. Die kleinen Jungs von Madame George sind geradezu verächtlich – wie die Straßenkinder in Tennessee Williams’ Plötzlich letzten Sommer, die schließlich den homosexuellen Cousin in einem kannibalistischen Akt töten –, sie sind nur zu gerne dabei, wenn es Musik, Partys, Drinks und Hasch umsonst gibt, und spucken allzu schadenfroh auf Georges Zuneigung, wenn der Stoff ausgeht und der alles begrabende Winter nicht nur mit Wind und Regen, sondern mit Graupel, Hagel und Schnee Einzug hält.
Am merkwürdigsten erscheint jedoch, dass genau jene Charakteristika – Alter, Trunksucht, die Jungs, die sein Geld nehmen und seine Liebe wegwerfen –, die George so erbärmlich wirken lassen, etwas im Herzen des Jungen anrühren, dessen Song das ist. Offensichtlich ist der Junge nicht einfach verliebt in die Liebe, »fallen in love with love« oder etwas in der Art, sondern – was? Woran liegt es, dass tief in den verdorbensten Perversionen ein menschliches Wesen ein zweites für etwas anderes als seine Menschlichkeit lieben könnte: für seine Schwächen, Makel, letztendlich seinen Verfall? Verfall ist menschlich – das ist eine der ultimativen Botschaften, und ich meine hier keinesfalls eine Auslegung in Richtung Dekadenz. Ich meine, dass Van Morrison in diesem Song, oder was ihn auch immer inspiriert haben mag, die absolute Möglichkeit sah, menschliche Wesen auch in ihrem extremsten Elend zu lieben, und dass die damit verbundenen Folgen schrecklich sein können, weitaus schrecklicher als das bloße Sehen von Körpern, die das Alter entstellt hat, oder die scheinbare Absurdität eines Mannes, der sein Leben dem wackligen Kunstgriff verschrieben hat zu versuchen, wie eine Frau auszusehen.
Man könnte auch sagen, um die Fragen zu lieben, muss man auch die Antworten lieben, die das Ende der Liebe beschleunigen, die geliebt wird, um die schreckliche Ungleichheit menschlicher Erfahrungen zu lieben, die liebend gerne sagen, wir stehen über denen, die diese Liebe zu lieben verloren haben, die Liebe, die Freiheit bedeuten könnte, der Zug in die Freiheit, den wir nicht erreichen, lieber winken wir denjenigen generös Adieu, die Opfer ihrer selbst sind. Aber wer bestimmt, dass jemand, der sich selbst zum Opfer gemacht hat, nicht genauso viel uneingeschränktes Mitgefühl verdient, wie das ausgezehrteste Dritte-Welt-Waisenkind in der Anzeige einer New Yorker Zeitschrift? Nein, es ist besser, über ihre Leichen zu schreiten, vielleicht zollt man ihnen damit den Respekt, den sie einst verdient hätten. Da, wo ich lebe, in New York (ich will nicht mehr daraus machen, als es ist, was ziemlich schwierig ist), schreitet jeder, den ich kenne, schmerzfrei über Körper, die sehr gut tot oder im Sterben begriffen sein könnten. Und ich frage mich, welches Konzept eigentlich zum Inhalt hat, dass eine solche Handlung menschlichem Abfall den ultimativen Respekt, den er verdient, erweist.
Natürlich gibt es dafür eine vernünftige Erklärung – was auch sonst –, aber sie steht nur für die Angst gegenüber unserer eigenen Hilflosigkeit angesichts der endlosen Weite des Lebens, wie es wirklich ist: eine Ebene, die sich in die Unendlichkeit jenseits aller Horizonte ausdehnt, die wir gerade erfunden haben. Komm, stirb doch. Während ich dies schreibe, lese ich in der Village Voice Anzeigen von Leuten, die in Manhattan heterosexuelle S&M-Klubs eröffnen, Sachen wie: »S&M ist nur eine andere ebenso gültige Form der Liebe. Warum die Leute das nicht akzeptieren können, verstehen wir nicht.« Da springt man doch lieber aus dem fünften Stock, als so was zu lesen, aber das ist wohl kaum das Ende der Welt; es ist nicht annähernd so schlimm wie die Verletzungen, die überall jeden Tag passieren, die wir so beiläufig als Lebenswahrheiten akzeptieren. Vielleicht läuft es auch darauf hinaus, was man sich tatsächlich aufbürden will. Wenn man sich nur einen Augenblick vorstellt, jedes menschliche Leben sei so zart und wertvoll wie eine Schneeflocke und man sich dann den Penner im Eingang anschaut, dann schmerzt das, man saugt die Probleme all der anderen Arschlöcher wie ein Schwamm auf, bis man sich selbst wie ein Arschloch fühlt, also zieht man angemessene Grenzen. Man hört auf zu fühlen. Aber dann beginnt man zu sterben. Also kämpft man ein bisschen mit sich selbst. Wie viel Horror kann ich tatsächlich zulassen? Vielleicht ist der stumpfste Knirps klüger als jemand, der erlaubt, dass seine Sensibilität ihn dazu bringt, alles zu zerstören, was er berührt – aber, den Hut von Madame George zu lüften, nur um zu erkennen, dass diese Person existiert, seine Wange zu berühren und dann vermutlich zu erlöschen, weil die Feststellung, dass man die Welt mit ihm teilen muss, so ultimativ unerträglich ist, ist nur der erste Schritt. Die Feststellung, dass das Leben so gering ist und so verherrlicht und so unerträglich und so heiß ersehnt. Bitte komm zurück und lass mich allein. Aber wenn wir alle zusammen allein sind, können wir solange wir wollen über die Universalität dieses Abgrunds reden. Es macht keinen Unterschied, der höchste trifft den niedrigsten, um irgendeine verlogene Hilfe zu leisten, UNICEF für Arme, also kratzt man und spuckt und flucht in verzweifelter Resignation vor der klaren Tatsachen, dass man nichts tun kann, außer letztendlich jeden zurückzuweisen, der größere Schmerzen als man selbst hat. In einem solchen Moment ist jeder weitere Atemzug Hochverrat. Deswegen gibt man seine liberalen Beweggründe auf, lässt die leidende Menschheit in noch größerem Elend sterben, als sie es kannten, bevor man des Weges kam. Man hat ihnen Hoffnung geschenkt. Was einen noch bösartiger macht als das skrofulöseste Aas. Bösartiger als die ignoranten Jungs, die Madame George für ein paar Zigaretten nahmen. Weil man das Verbrechen begangen hat zu wissen, und deswegen nicht nur an jemandem vorbei oder über jemanden hinweg gelaufen ist, von dem man wusste, dass er leidet, sondern auch weil man seine Privatsphäre verletzt hat, den letzten Besitz der Besitzlosen.
Derartiges Wissen ist vermutlich das Schlimmste, was einem Menschen (einem glücklichen Menschen) widerfahren kann, es ist also kein Wunder, dass Morrisons Protagonist sich von Madame George abwendet, zum Bahnhof rennt und versucht, so weit wie ihn ein Leben nur bringen kann, vor dem wegzurennen, was er gesehen hat. Und es ist auch kein Wunder, dass Van Morrison nie wieder so nah dran war, dem Leben direkt ins Gesicht zu sehen, kein Wunder, dass er sich auf Tupelo Honey und sogar auf Hard Nose the Highway auf einer ganzen Seite Songs über fallende Blätter zuwandte. In Astral Weeks und »T.B. Sheets« hat er genug für das Leben eines Einzelnen gesehen. Natürlich kann man es schlecht jemandem ankreiden, der diese unglaublich aufwühlende und gleichzeitig erschreckende Gabe von Morrison entgegengenommen hat, dass er sich nicht so furchtbar sehr um Old, Old Woodstock und kleine Sermone wie »You’ve Got to Make It Through This World on Your Own« und »Take It Where You Find It« sorgt.
Auf der anderen Seite sollte man aber darauf hinweisen, dass Verzweiflung, Schmerz und Qual nicht die einzigen Dinge im Leben oder in Astral Weeks sind. Sie sind vielleicht nur die Dinge, die wir am leichtesten erfassen und erklären können, was vermutlich zeigt, auf welcher Ebene sich unsere Seelen befinden. Ich sagte, ich würde die anderen Songs auf diesem Album nicht durch den Versuch, sie zu erklären, reduzieren, und das tue ich auch nicht. Aber das soll nicht heißen, wenn man alles in Betracht zieht, dass eine Nebeneinanderstellung von Dichtern nicht in Ordnung geht.
If I ventured in the slipstream
Between the viaducts of your dreams
Where the mobile steel rims crack
And the ditch and the backroads Stopp
Could you find me
Would you kiss my eyes
And lay me down
In silence easy
To be born again
Van Morrison
Mein Herz aus Seide
so voller Lichter
mit verlorenen Glocken
mit Lilien und Bienen
Ich werde sehr weit reisen
weiter als diese Berge
weiter als die Meere
bis zu den Sternen
um Gott unseren Herren zu bitten
mir die Seele zurückzugeben
die ich hatte als ich ein Kind war,
gereift an Legenden
mit einer gefiederten Mütze
und einem hölzernen Schwert
Frederico Garcia Lorca
Stranded, 1979