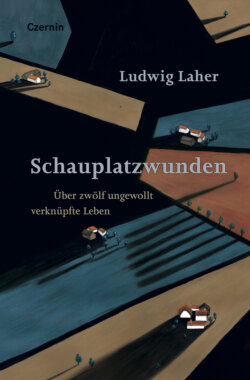Читать книгу Schauplatzwunden - Ludwig Laher - Страница 9
Blach, Amalia
ОглавлениеAm dreiundzwanzigsten Juli 1940 setzt Aloisia Blach drei unbeholfene Kreuze unter ein handschriftliches Protokoll des Amtsgerichtes Bad Ischl. Es ist binnen eines Monats bereits das zweite Mal, dass Frau Blach sich, gerade fünfzig geworden, dort einfinden muss, um über ihre Enkelin Bescheid zu geben. Acht Jahre zuvor ist das Mädchen im steirischen Gaishorn am Schoberpass geboren worden, und zwar auf der Reise, wie fahrende Sinti ihr sommerliches Unterwegssein bezeichnen, mittels dessen sie sich durch allerlei Dienstleistungen und Waren des täglichen Bedarfs ihren Unterhalt verdienen. Doch schon zwei Tage nach Amalias Geburt sei man, versichert Aloisia Blach, wieder weitergezogen. Jetzt lebe die Familie, den Umständen geschuldet, dauerhaft in Ischl.
Seit dem Festsetzungserlass Heinrich Himmlers im Oktober 1939, der die Sinti und Roma zwang, den Landkreis, in dem sie sich gerade aufhielten, nicht mehr zu verlassen, läuft eine großangelegte sogenannte Zigeunererfassung. Schon Monate davor, am einundzwanzigsten Juni, waren die Behörden von Oberdonau vorgeprescht und ließen alle Gemeinden im Gau unter dem Betreff »Behebung der Zigeunerplage« zur »Darnachachtung« wissen, das Herumziehen von Zigeunerbanden werde, »um den jetzt stark zunehmenden Fremdenverkehr nicht zu gefährden«, grundsätzlich untersagt. Als geeignete Maßnahmen, diesen Vorschriften gebührenden Nachdruck zu verleihen, wurden unter anderem Glatzenscheren bei beiden Geschlechtern sowie die Androhung der Entmannung bei männlichen Bandenmitgliedern angeführt: »Es ist der Wunsch des Gauleiters den Heimatgau des Führers zigeunerfrei zu machen und ist daher alles daran zu setzen, dieses Ziel bald zu erreichen.«
Das ledige Kind Amalia wächst wie seine zwei jüngeren Geschwister bei der Großmutter auf und besucht in Bad Ischl auch die Schule. Was kriegt es mit von der zunehmenden Gefahr, die seinesgleichen droht? Sein ganzes kurzes Leben untersteht es theoretisch einem Amtsvormund. Praktisch dürfte das bisher keine große Rolle gespielt haben, denn immer noch gilt für das Mädchen, wie sich anlässlich der Vorladung von Frau Blach herausstellt, das Amtsgericht Rottenmann als zuständig, in dessen Einzugsbereich Gaishorn liegt. Das wird sich jetzt endlich ändern, Ordnung muss sein. Zumindest auf dem Papier.
Denn die Sinti, die sich oft selbst stolz Zigeuner nennen, scheren sich traditionell, soweit es geht, nur wenig um die Bürokratie der Mehrheitsbevölkerung, die es ihrer Erfahrung nach seit einem halben Jahrtausend vor allem darauf anlegt, sie nach Strich und Faden zu schikanieren. Die abgelöste österreichische Verwaltung ihrerseits hat sich bei dieser Klientel in Fällen standesamtlicher Regelungen und daraus abgeleiteter Zuständigkeiten die längste Zeit damit begnügt, den Formalien so unauffällig wie möglich zu genügen und es tunlichst zu vermeiden, schlafende Hunde zu wecken. Je weniger an sich berechtigte Ansprüche die Zigeuner stellten, desto besser.
Jetzt aber, im Dritten Reich, geht es in erster Linie um etwas ganz anderes, nämlich um die Vorbereitung des klaglosen Zugriffs, wenn der Tag gekommen sein wird. Da müssen alle Daten auf den aktuellen Stand gebracht sein, Versäumnisse nachgeholt werden.
Aloisia Blach legt laut Protokoll Wert auf die Feststellung, wegen der Kinder ihrer Tochter, die sie aufzieht, bisher noch nie mit einem Gericht zu tun gehabt zu haben. Vinzenz, Josef und Amalia würden selbstverständlich auch in Zukunft unter ihrer Obhut stehen. Diese Zukunft wird ziemlich exakt ein halbes Jahr später unwiderruflich ablaufen.
Dass die Festsetzungsanordnung als nur dürftig verklausulierte gesellschaftliche Ächtung eine erste wichtige Vorstufe zu einem Genozid darstellt, der im Endeffekt ähnlich konsequent, im Gegensatz zu dem an den Juden aber dezentraler und widersprüchlicher organisiert werden wird, übersteigt zu diesem Zeitpunkt aber noch jedes Vorstellungsvermögen, jedenfalls das der zukünftigen Opfer.
Für viele Betroffene bedeutet der Festsetzungserlass auch eine wirtschaftliche Katastrophe, noch nie sind sie den Kommunen dermaßen zur Last gefallen. Wer vollständig sesshaft ist und einer regelmäßigen Arbeit nachgeht, erlebt die neue Rechtslage zwar als alarmierende Einschränkung der Bewegungsfreiheit, aber sonst ändert sich vorläufig nicht viel. Dagegen bricht für die reisenden Sinti, von der Nazibürokratie grundsätzlich als Zigeunerbanden tituliert, schon jetzt eine Welt zusammen. Viele werden fernab ihrer Winterwohnorte, wo sie feste Unterkünfte haben und großteils schon seit Generationen heimatberechtigt sind, von der Anordnung überrascht. Selbst die Rückkehr nach Hause ist und bleibt verboten.
Mancherorts sperrt man ganze Familien samt den kleinen Kindern einfach monatelang in viel zu kleine Gemeindekotter. Diese Arrestzellen, vorgesehen für Kurzaufenthalte, häufig zur Ausnüchterung oder bis zur Überstellung in reguläre Gefängnisse, sind meist nur schlecht beheizbar und natürlich weitgehend unmöbliert. Nicht einmal ausreichend Pritschen gibt es. Die hygienischen Verhältnisse spotten jeder Beschreibung. Auch die Versorgung mit dem Nötigsten, vor allem mit einer einfachen warmen Mahlzeit pro Tag, bereitet den Gemeinden, wie sie nach oben melden, große organisatorische Schwierigkeiten. Und wie kommen sie eigentlich überhaupt dazu, für zwielichtige Wildfremde Geld aufzuwenden? Erste Bürgermeister fordern übergeordnete Behörden deshalb mit Nachdruck auf, die Zigeunerbanden »an einer exponierteren Stelle« unterzubringen, was immer das heißen mag.
Diese ermunternden Initiativen der NS-Bürokratie haben für unzählige dem gesunden Volksempfinden verpflichtete Vertreter des gerechten Volkszorns Signalcharakter. Überall kriechen sie aus ihren Löchern und leben ihren latenten Antiziganismus jetzt ungeniert in aller Öffentlichkeit aus. Hasserfüllt stimmen sie in den Chor der Amtsträger ein und beginnen ihrerseits, Maßnahmen einzufordern, die seit jeher ungeliebte Minderheit endlich auf Dauer ganz verschwinden zu lassen.
Im dereinst mondänen, dem alten Kaiser verbundenen Kurort Bad Ischl, wo Amalia Blach aufwächst, ist der Gemeindearzt ein gewichtiges Sprachrohr der nicht länger schweigenden Mehrheit. Schon im November 1939 wendet er sich brieflich an das Stadtoberhaupt und teilt ihm wörtlich mit, dass es für die deutschen Volksgenossen keine Annehmlichkeit sei, mit diesen ungewaschenen, frechen Zigeunern den Warteraum zu teilen. Doktor Albert Meierl würde hinkünftig, wie er es süffisant mit einem Anklang an monarchische Zeiten formuliert, recht gern auf die zweifelhafte Ehre verzichten, Leibarzt der Bad Ischler Zigeunerdynastie zu sein. Deshalb bittet er den Parteigenossen Bürgermeister vertrauensvoll, für Abhilfe zu sorgen.
Nichts lieber als das. Die entsprechenden Pläne sind ohnehin längst geschmiedet, nur das Wie und Wo hat sich vorläufig noch nicht ergeben. Ein gutes Jahr später ist es dann endlich so weit. Mitten im Hochwinter wird Amalia Blach am siebenundzwanzigsten Jänner 1941 gemeinsam mit der Großmutter, den Geschwistern, der leiblichen Mutter und vielen anderen Verwandten in das erst im Aufbau begriffene Zigeuneranhaltelager Weyer-Sankt Pantaleon verfrachtet. Am selben Ort hat der Gau Oberdonau gerade mit einem Arbeitserziehungslager fürchterlich Schiffbruch erlitten und rekrutiert nun rasch neue Zwangsarbeiter für das Großprojekt der Entsumpfung von Waidmoos und Ibmer Moor. Man gibt sich zunächst überzeugt, mit dieser mittelfristigen Lösung das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden zu können. Doch schon bald folgt die Ernüchterung.
Knapp zweihundertfünfzig Kinder und Jugendliche sind wie die Frauen unerfreulicher Ballast für das Vorhaben und zwingen zur Improvisation. Vorher, im SA-Lager, war der Belag nämlich signifikant geringer. Die unbedingt nötigen Zusatzbaracken lassen noch auf sich warten. Erst am Tag vor Amalias Ankunft hat man eine Reihe von Kohleöfen bestellt. Aber was soll’s, das ist ja kein Sanatorium. Immerhin hat man nun einen beträchtlichen Teil der autochthonen Sintiminderheit des Gaues hinter Schloss und Riegel verräumt, und zum Drüberstreuen karrt man aus Kärnten gleich noch zweiundfünfzig weitere Insassen heran.
Der nächste entscheidende Schritt zum Massenmord kann somit abgehakt werden, nun hat man die Todgeweihten bereits bequem auf einem Haufen. Sie noch eine Zeitlang gewinnbringend auszunutzen, erweist sich allerdings schnell als Illusion. Der Gesamtaufwand übersteigt bei aller Zurückhaltung, was Verköstigung, Körperpflege, medizinische Versorgung, Heizaufwand und so weiter angeht, den Ertrag durch die Zwangsarbeit von Anfang an bei weitem. Schuld daran sind vor allem die vielen Kinder, ein besonders ärgerlicher Kostenfaktor. Sehr lange wird man sich diesen ineffizienten Luxus nicht antun wollen.
Dieses zweite Lager am Ort ist, weil sich die SA in der Vorgängerinstitution leider ungeschickt verhalten hat, der Kriminalpolizeistelle Linz unterstellt. Das lässt sich nicht zuletzt am offiziellen Stempel ablesen, der alle Häftlingslisten ziert. Doch der explodierende Finanzaufwand wird dem Gaufürsorgeverband angelastet, selbstverständlich ohne dessen Zustimmung einzuholen. Diese abenteuerliche Zwitterkonstellation sorgt schon jetzt für erste Reibereien und wird noch lange nach der Komplettvernichtung des hier vorübergehend gelagerten Untermenschenmaterials für das eine oder andere unwürdige, zum Himmel schreiende Bürokratieschauspiel mitverantwortlich sein.
Doch wäre es unredlich, den Leuten von der Kripo nachzusagen, sie wüssten bereits jetzt im Detail, worauf das alles hinauslaufen soll. In Weyer kommt es im neuen Lager, soweit sich feststellen lässt, auch zu keinen gröberen Übergriffen mehr, jedenfalls zu keinen gezielten Tötungen. Von der alten Wachmannschaft ist einzig SA-Sturmführer Gottfried Hamberger als Verwalter noch mit von der Partie. Er hält sich jetzt vornehm zurück. Ein Glück, dass der zuverlässige Fachmann als minder belastet gilt und deshalb nicht in Untersuchungshaft sitzt. Ihm wird erst nach dem Krieg der Prozess gemacht werden.
Was die Kriminalpolizeistelle freilich doch ein wenig irritieren könnte, ist die augenfällige Tatsache, dass ihre Beamten hier definitiv keine Kriminellen bewachen, dafür jede Menge kleine und kleinste Kinder. Aber Befehl ist Befehl, wer zuviel denkt, handelt sich bekanntlich nur Schwierigkeiten ein. Auch lassen sich eventuell aufkeimende Zweifel mit dem zur Zeit überaus beliebten Schlagwort von der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung schnell in die Schranken weisen.
Amalia Blach wird keine Schulklasse mehr von innen sehen, nur noch die Kinder der Einheimischen mit ihren Ranzen draußen auf der Straße jenseits des Stacheldrahts, denen diese gesicherte Anlage samt den darin Eingepferchten unheimlich ist. Die Eltern trichtern ihrem Nachwuchs ein, das Lager auf dem Schulweg komplett zu ignorieren. Aber wie soll das gehen?
Es ist nun einmal keineswegs abseits menschlicher Behausungen angesiedelt, sondern mitten in dem kleinen, landwirtschaftlich geprägten Weiler Weyer. Eine uralte Gaststätte, zugleich Bauernhof, mitsamt den zugehörigen Stallungen ursprünglich für das aufgelöste Arbeitserziehungslager requiriert und endlich doch um etliche Holzbaracken auf der ehemals grünen Wiese nebenan erweitert, bildet nunmehr die gesamte Welt für das Mädchen aus Bad Ischl, das auf seinen letzten Geburtstag Anfang Juni zusteuert, den neunten.
Amalia wird, davon darf man ausgehen, keinen Schritt mehr vor die Mauern und den Drahtverhau setzen, die das Lagergelände umgeben, bis sie Anfang November im frühen Schneetreiben ohne großes Gepäck einen noch harmlosen, ganz gewöhnlichen Lastwagen besteigt, der sie mit ihrer Familie zum Viehwaggon am nächsten Bahnhof bringt, der sie über Lackenbach im aufgelösten Burgenland ins besetzte Polen nach Litzmannstadt, früher Łódź, transportiert, und zwar in ein eben angelegtes, völlig überfülltes Zigeunerghetto gleich neben dem der Juden, wo Amalia mit abgezählten fünftausend Roma und Sinti aus verschiedenen Teilen der Ostmark entweder binnen zweier Monate an einer Seuche wie dem Fleckfieber, vielleicht auch an Auszehrung krepiert oder mit allen, die bis dahin noch nicht ganz tot sind, um die Jahreswende zum aktiven Vernichten ein gutes Stück vor die Stadt nach Kulmhof, früher Chelmno, gekarrt wird, wo sich bereits die Massengräber auftun. Die zu diesem praktischen Zweck adaptierten, penibel abgedichteten Lastkraftwagen, in die man während der Fahrt todbringende Gase leitet, an denen die menschliche Fracht qualvoll langsam erstickt, werden bei dieser Gelegenheit erstmals im Regelbetrieb erprobt werden. Sie bewähren sich hervorragend.
Doch so weit sind wir noch lange nicht. Die zynische, auch im Weltkrieg zum Gutteil perfekt funktionierende Bürokratie ist in Gestalt von Doktor Heinrich Kotzmann, Gerichtsvorsteher im Wildshuter Amtsgebäude, gerade damit beschäftigt, dem Mündel Amalia Blach, das, wie ersichtlich, vor kurzem ins Innviertel übersiedelt ist, wieder einmal einen neuen Amtsvormund zuzuweisen. Ein solcher, verraten die erhaltenen Pflegschaftsakten des Kindes, wird am vierten Mai 1941 in der Person Franz Königs aus dem nahen Ostermiething bestellt. Dafür, dass dieser Herr auch nur die geringste Aktivität im Interesse seines weggesperrten Mündels setzt, fehlt jeder Beleg.
Doktor Kotzmann muss das nicht weiter bekümmern, ihm beschert die Anlieferung der vielen Zigeuner mit ihren für amtliche Abläufe lästigen, unorthodoxen Familienverhältnissen in erster Linie zusätzlichen Verwaltungsaufwand. Als junger Mann hat der verdiente Oberlandesgerichtsrat ab 1912 hier in Wildshut noch dem Kaiser gedient, in der Folge unter allen anderen, die gerade an der Macht waren, ebenso gewissenhaft seine Pflicht getan, wie sehr das Rechtsempfinden über die Jahrzehnte auch variieren mochte. Auch am Beginn der zweiten Republik Österreich wird Doktor Kotzmann weitermachen wie bisher, bevor er sich 1946 endlich in den verdienten Ruhestand verabschieden kann.
Keine vier Kilometer von Schloss Wildshut entfernt, wo der Gendarmerieposten und das Amtsgericht untergebracht sind, vegetiert die kleine Amalia zu diesem Zeitpunkt schon über ein Vierteljahr ohne Unterricht, ohne Spielzeug und ohne sinnvolle andere Beschäftigungsmöglichkeiten dahin. Zu allem Überdruss grassiert im Lager momentan eine gefährliche Lungenentzündung mit hohem Ansteckungspotential. Die Inhaftierten sollen einander aus dem Weg gehen, aber die Wege sind versperrt. Tote werden weggeschafft.
Der Gemeindearzt von Sankt Pantaleon und Lagerarzt von Weyer in Personalunion lässt eine gute Bekannte, die Frau des vor dem Krieg im ganzen deutschen Sprachraum angesehenen Schriftstellers Georg Rendl, im Vertrauen wissen, ausreichende medizinische Versorgung sei in Weyer prinzipiell nicht vorgesehen. Selbst die anfänglich noch erlaubte Geburtshilfe durch eine Hebamme hat man inzwischen gestrichen, es regiert der Sparstift.
Doktor Alois Staufer ist in seiner Freizeit begeisterter Photograph und investiert viel in eine erstklassige Ausrüstung und modernes Filmmaterial. Einige Wochen später, die Seuche ist inzwischen abgeklungen, fertigt er an einem diesigen Tag Farbdiapositive der Weggesperrten an. Sie zeigen unter anderem den Wachturm und den graslosen Erdboden des Lagers, auf dem Frauen und Kinder hocken, sich für Gruppenbilder aufstellen, während die Männer bei der Zwangsarbeit sind.
Der Mediziner fängt aber nicht nur Trostlosigkeit ein. Er muss erwirkt haben, dass seine Motive, wohl an einem Sonntag, für eine weitere Photosession ein letztes Mal ihr bestes Gewand aus den rings um das Lagergelände abgestellten Wohnwagen holen dürfen. Heute strahlt zudem die Sonne von einem tiefblauen Himmel, Männer, Frauen, vor allem Kinder posieren mit dem, der Liebsten, mit Geschwistern, einem oder beiden Elternteilen. Auch Einzelaufnahmen entstehen, Seidenblusen, Perlenketten und Nadelstreifanzüge samt Fliege werden vorgeführt. Vor warmroten Ziegelwänden, die einmal verputzt waren, lächeln, grinsen manche der Porträtierten sogar, aber die verstörten Blicke anderer sprechen Bände, bilde ich mir ein. Immerhin, sträflich unterernährt scheint hier trotz des geringen Aufwandes für Lebensmittel niemand zu sein.
Es ist einigermaßen wahrscheinlich, dass auch Amalia Blach auf einer der vielen erhaltenen Photographien zu sehen ist. Ihr Gesicht bleibt mir, bleibt der Nachwelt dennoch unbekannt, namentlich zugeordnet können später nur noch verschwindend wenige der Abgebildeten aus Weyer werden. Denn nicht nur sie, sondern auch die allermeisten ihrer vorderhand durch einen glücklichen Zufall vielleicht noch auf freiem Fuß befindlichen oder in Gemeindekottern und anderen Zigeunerlagern wie jenem von Salzburg-Maxglan internierten Verwandten und Bekannten fallen in den folgenden Jahren dem Rassenwahn zum Opfer. Es wird also schlicht niemand mehr da sein, der diese Menschen identifizieren kann, als die Dias etliche Jahrzehnte später nach dem Ableben Doktor Staufers irgendwann an die Öffentlichkeit gelangen. Allein Amalias Familienname Blach findet sich dreiundzwanzigmal auf den Häftlingslisten von Weyer.
Irgendwann in den frühen Neunzehnfünfzigern, als der einundzwanzigste Geburtstag des theoretisch immer noch am Ort aufhältigen Mündels Amalia buchmäßig ansteht, nimmt ein dazu befugtes Amtsorgan im Bezirksgericht Wildshut das verstaubte Konvolut des zugehörigen Pflegschaftsaktes ein letztes Mal zur Hand und setzt einen formalen Schlusspunkt, indem es mit rotem Stift das Wort »großjährig« notiert.
Man muss, hat man solch ein Schriftstück ohne Zusatzinformation vor sich liegen, fast zwangsläufig den Eindruck gewinnen, die Ende 1941 Deportierten würden, obwohl amtswegig seither spurlos, irgendwo im Untergrund fröhlich weiterleben. Mir will scheinen, da wird entweder aus amtlichem Desinteresse, mag sein auch aus Unachtsamkeit, womöglich gar mit voller Absicht etwas für die falsche Statistik, für das unauffällige Vertuschen von schwersten Verbrechen gegen die Menschlichkeit getan. Die seit ihrer Geburt schutzbefohlene Amalia Blach ist von der Republik Österreich eines schönen Spätfrühlingstages im tiefsten Frieden, am dritten Juni 1953, aus der staatlichen Vormundschaft entlassen worden. Alles bestens.
Dem Deutschen Reich hingegen diente der kleine, ausgemergelte Körper Amalias zuletzt als Dünger. Es ist verbürgt, dass die skelettierten Leichen der tausenden ermordeten Sinti und Roma aus den Massengräbern geholt und in einer eigens errichteten Knochenmühle nutzbringend verarbeitet wurden.