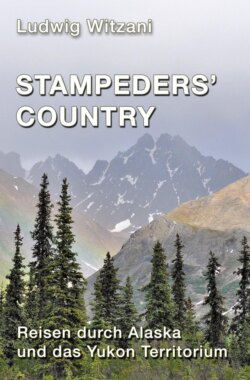Читать книгу Stampeders´Country - Ludwig Witzani - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VON ANCHORAGE NACH ALASKA – Das ungeliebte Tor nach Alaska
ОглавлениеErster Teil:
Von Anchorage nach Fairbanks
Das ungeliebte Tor nach Alaska
Anchorage
Kalte Polarwinde, die aus dem Norden eingebrochen waren, ergriffen die Maschine und schüttelten sie durch wie einen nassen Hund. Stunde um Stunde flogen wir nach Westen, der Sonne hinterher, und es wollte einfach nicht dunkel werden. Wolkengebirge - so schön wie der Abglanz des Paradieses – verwandelten sich in Wolkendecken, die fahlen Leichentüchern glichen.
Endlich wurden im Licht der Polarnacht die großen Schneeriesen Alaskas sichtbar. Seen wie zerbrochene Spiegel, Moränenlandschaften, Gletscherzungen und eine zerklüftete Gipfelwelt aus Eis. Der Kluane Nationalpark wurde überflogen, der Mount Logan tauchte tief unter uns zur Linken auf - und schließlich in der Ferne sogar der Denali/Mount McKindley, der König der amerikanischen Berge, von einem schwarz dunklen Wolkenschweif wie von einer Aureole umgeben. Schleierwolken zogen unter uns vorüber und gaben der Landschaft einen doppelten Boden. Dann begann der Landeanflug. Die Wolkenwände wurden dunkler und dichter, und kurz bevor die Maschine im Wolkenmeer verschwand, glichen die Gipfel der Berge links und rechts einer Ansammlung von Eisbergen in einem Urmeer. Eine Viertelstunde lang war nichts zu sehen als milchig weißer Nebel; dann unterschritt der Flieger, gerade mal einige hundert Meter über dem Meer, die Wolkengrenze und nahm Kurs auf das Festland.Wie ein einziger grüner Sumpf erstreckte sich die Landschaft der Kenai Halbinsel unter uns. Ein Boden, der seit undenklichen Zeiten im Rhythmus der Jahreszeiten taute und fror. Die Maschine flog einen Bogen über dem schwarzen Wasser und landete auf dem Internationalen Flughafen von Anchorage.
Es regnete, als wir eine Stunde vor Mitternacht über das Rollfeld zum Abfertigungsgelände liefen. Die Temperaturen entsprachen denen von Deutschland an einem kühlen Frühlingstag. In der Eingangshalle des Flughafens von Anchorage liefen Angehörige aller amerikanischen Ethnien wild durcheinander, Rau war der Umgangston, wenn man sich etwa am Gepäckausgabeband unbeabsichtigt vor einen anderen Reisenden stellte. Unser Taxi war ein alter Schlitten, die Taxifahrerin eine herbe Dame mit Tatoos an den kräftigen Unterarmen. Was wir auf der Anreise zum Hotel von der Stadt erblickten, waren breite, schnurgerade Straßen im Dämmerlicht. Einige Läden hatten noch geöffnet, Musik schallte über die Straßen, nur Menschen waren nicht zu sehen. Dann hielten wir von dem „Downtown Hotel“, das von innen besser aussah als von außen und in dessen Betten wir sofort todmüde einschliefen.
Irene, die Chefin des Uptwon Hotels, hatte es als Hessin vor Jahrzehnten nach Amerika verschlagen. Dem ersten Mann war sie nach Kalifornien gefolgt, dem zweiten nach Alaska, was mit in dieser Reihenfolge ungünstig vorkam. Es gefiel ihr auch nicht in Alaska, in Anchorage schon gar nicht, wie sie freimütig bekannte: zu kalt, zu teuer und „No Gentlemen's at all“. Das einzig Gute an Alaska sei, dass man hier kaum Steuern zahlte, weil der Staat jedem gemeldeten Einwohner pro Jahr einen Anteil der Steuereinnahmen aus dem Ölgeschäft überwies. Obwohl Irene auch auf Ausländer nicht gut zu sprechen war, betrachte sie uns als Abgesandte der Heimat. Wir verkörperten einen zarteren Menschenschlag, dessen Existenz sie fast vergessen hatte, so dass wir am Morgen zum spartanischen Frühstück auch noch eine Extraportion Streichkäse erhielten. „Honey, is anything ok with the Breakfast?“ fragte sie mich, und ich nickte wie ein braver Schuljunge.
Anflug auf Alaska
Anchorage war das Tor zu Alaska hieß es, aber es war ein Tor, das mit dem, wohin es führte, nur wenig zu tun hatte. Für viele war es ein subarktisches Babylon, in dem sich die Rohheit der Peripherie mit der Dekadenz einer heruntergekommenen Stadt verband. Für andere war es das wirtschaftliche Herz Alaskas, von dem aus das Ölgeschäft organisiert und ausgebaut wurde. Für den Großteil der Touristen, die Alaska besuchten, war es der unvermeidbare Startpunkt ihrer Reise in die Welt des Nordens. So auch für uns, die wir in Anchorage unseren Camper Home in Empfang nehmen würden. Bis dahin aber war noch etwas Zeit, die wir für eine Besichtigung nutzen wollten, unvoreingenommen und mit der Anteilnahme, die jede Stadt verdient, die sich am Rande der Wildnis behauptet. Allerdings waren die ersten Eindrücke wenig dazu angetan, Begeisterung zu wecken. Als wir das Hotel zu einem ersten Spaziergang verließen, lag über der Stadt ein bleigrauer Himmel ohne jede Kontur. Kein Wind, keine Wärme, keine Kälte, wenig Licht - die Stadt begrüßte uns im reduzierten Modus eines verwaschenen Morgens. Unrat und Müll waren über die Straßenränder verteilt, zwei betrunkene Halbindianer torkelten auf dem Bürgersteig an uns vorüber. Auf einem Parkplatz lagen zwei Männer auf dem Asphalt und schliefen ihren Rausch aus. Eine Stimmung von scheißegal lag über diesem Vormittag, angefüllt mit einer Spur Bedrohlichkeit, die von der ungewohnten Größe herrührte, mit der in Anchorage alles daherkam. Die Autoswaren größer, die Männer voluminöser, die Straßen breiter und nur die Häuser waren meist flach, als fürchte man eine Wiederholung des Erdbebens von 1964, das die Stadt in Schutt und Asche gelegt hatte. Auch das McDonalds Gebäude, in dem wir einen zweiten Morgenkaffee trinken wollten, war groß - laut Reiseführer sogar der größte McDonalds der USA, wahrscheinlich aber auch eines der leersten, denn als wir den Laden betraten, saß nur noch ein junges Pärchen an einem Fenstertisch. Die Haare standen ihnen zu Berge, sie waren leichenblass und sahen aus, als wäre ihnen der Stoff ausgegangen. Der Tisch vor ihnen war leer, und sie starrten sich gegenseitig an, als könnten sie gar nicht glauben, in welche Gesellschaft sie das Leben verschlagen hatte. Zwei neue Kunden betraten das Lokal. Es waren zwei junge Amerikaner, nachlässig angezogen und mit Turnschuhen an den Füßen, deren Senkel nicht zugebunden waren. Beide waren angetrunken und wurden von einem bulligen Security-Man aus dem Laden gedrängt. Er war so breit wie die beiden Jugendlichen zusammen. Er packte jeden von ihnen mit einem Arm und schob sie wie Sperrmüll einfach vor die Türe. Der Alkoholismus war in Alaska offenbar keineswegs nur auf die Natives beschränkt. Am Visitor Center in der 4th Street on Downtown waren wir die ersten Klienten, enthusiastisch begrüßt von einer Rangerin in einer olivgrünen Uniform. „So nice to see you“, flötete sie, als wir eintraten. Sie strahlte die Gesundheit der dicken Menschen im Norden aus, deren Fett durch die Kälte im Zaum gehalten wird. „Oh you came from Germany, that´s great!“ jubelte sie und überreichte uns einen ganzen Packen Pläne und Prospekte. „You will have a wonderful Time in Anchorage“, versprach sie, als wir das Gebäude verließen. Draußen sah es aber nicht danach aus. Auf der andern Straßenseite stoppte ein Van. Die Türe öffnete sich, und eine kreischende Prostituierte wurde grob auf die Straße gestoßen. Es war eine grell geschminkte Farbige, aggressiv und gewöhnlich. Sie rappelte sich auf und kreischte „Fuck you“, ehe sie auf ihren High Heels davon schwankte. Ein Feuerwehrwagen hielt vor einem kleinen Park und begann zwei Inuits abzutransportieren, die vollkommen zugedröhnt im Gebüsch gelegen hatten. All das vollzog sich in einem merkwürdigen Zwielicht, das die schnurgeraden Straßenfluchten in bizarre Schluchten verwandelte, die immer geradeaus in ein verwaschenes Halbdunkel führten. Immerhin nahm die Polizeipräsenz zu, je weiter wir nach Downtown kamen, allerdings handelte es sich vorwiegend um Fahrradpolizei, um Zweiergruppen, die mit Fahrradhelmen und in bunter Fahrradkleidung neben ihren Rennrädern an den Ecken standen und die Umgebung beobachteten. Architektonisch Bemerkenswertes gab es nicht zu sehen, eine Straße glich der anderen und viele Geschäfte hatten noch geschlossen. Als wir Downtown im Umkreis der 4th and 5th Street erreichten, setzte ein leichter Nieselregen ein, so dass wir in das „Anchorage Museum of History and Art“ flüchteten. Bildung als letztes Refugium vor dem Ansturm der Tristesse - das funktionierte fast immer.
Das Museum war der Geschichte Alaskas gewidmet – präsentiert wurden eine Sammlung von Karten, lebensgroße Puppen und Überreste aller Art, die wir an diesem Vormittag in Ruhe studieren konnten, denn wir waren fast allein im Museum. Im Mittelpunkt der Exponate stand die Geschichte der Ureinwohner Alaskas, ihre Wanderungen, Zelte, Bekleidung, Waffen und Baustoffe, die in einem eigenen Raum ausgestellt waren. Die Indianerstämme des Nordpazifiks waren wie alle Indianer vor gerade mal vierzigtausend Jahren aus Asien nach Alaska gekommen, als wegen des tieferen Meeresspiegels zwischen Ostsibirien und Nordamerika eine Landverbindung bestand.
Tlingit Totem
Doch während die meisten Proto-Indianer weiterzogen, in den Süden, in die Prärie, nach Mittelamerika oder in die Täler der peruanischen Anden bis hinunter nach Feuerland, waren die Vorfahren der heutigen Tlingit, Haisa oder Atha- basca geblieben, hatten autonome Stämme gebildet, Holzhäuser erbaut und Kulturen entwickelt, die ihnen das Überleben in einer fruchtbaren Umgebung sicherten. Sie ernährten sich von Wurzeln und Beeren, jagten die Bären mit bloßen Speeren und trugen im Winter Jacken aus zusammengenähten Tiereingeweiden, damit die Tiere gleich wussten, was ihnen blühte.
Ich blickte aus dem Museumsfenster und sah, dass der Regen zugenommen hatte. Ein regelrechter Wolkenbruch entlud sich über Anchorage, und die Häuserwände aus der anderen Straßenseite verschwanden im nassen Dunst. Kein Grund zur Eile also bei unserer Reise durch die alaskanische Geschichte. Ich studierte die Karten an den Museumswänden, die die Reisen der europäischen Entdecker in den pazifischen Norden darstellten - angefangen vom Kosaken Simon Deznew, der im Jahre 1648 als erster durch die spätere Bering Straße gepaddelt war, bis zu den Expeditionen der Russen im frühen und mittleren 18. Jahrhundert. Niemand Geringeres als Zar Peter der Große hatte den dänischen Seefahrer Vitus Bering im Jahre 1725 beauftragt, eine mögliche Verbindung zwischen Ostsibirien und Nordamerika zu erforschen. Anschließend war Virus Bering mit seinem Tross zwei Jahre lang durch ganz Sibirien gezogen, ehe er im Jahre 1727 die Halbinsel Kamschatka erreichte, wo er unter unsäglichen Mühen zwei Schiffe erbauen ließ, um mit ihnen in See zu stechen. Das eine Schiff nannte er „Peter“ das andere „Paul“, woraus sich der Name der heutigen Hauptstadt Kamtschatkas, eben Petropawlowsk, herleitet. Wie weit er mit diesen beiden Schiffen auf dieser Reise kam, ist umstritten. Alaska hat ernicht erreicht. Er soll aber das Meer zwischen Ostsibirien und Alaska durchkreuzt haben, das seitdem seinen Namen trägt. Im Jahre 1740 brach er mit seinem Stellvertreter Chirikow erneut von Kamtschatka aus gen Nordosten auf und erreichte im Juli 1740 in der Nähe von Kodiak Island endlich die Küste Alaskas. Der Hauptertrag seiner zweiten Reise, die weder er noch der größte Teil seiner Mannschaft überlebte, war die Entdeckung des alaskanischen Seeotters, dessen Fell ungeahnte Möglichkeiten der wirtschaftlichen Verwertung eröffnete. Schnell führten die sich hier andeutenden Profite russische Händler auf die Aleuten Inseln, wo sie alle Otter töteten, bis es keine mehr gab, um dann die Ureinwohner fast vollständig auszurotten.
Dann zogen sie weiter und gründeten 1773 Unalaska, die erste permanente europäische Siedlung am Nordpazifik. Nichts aber macht so schnell die Runde wie die Kunde von möglichem Reichtum, vor allem, wenn nur ein kurzes Zeitfenster existiert, in dem er ausgebeutet werden kann.
1774 kreuzte bereits eine spanische Expedition unter dem Kommando von Juan Perez vor der Küste, dann erschien 1778 der britische Weltumsegler James Cook auf seiner „Resolution“ vor Alaska - allerdings nicht der Otter wegen, sondern um eine mögliche Nordwestpassage zu erkunden. Durch diese Aktivitäten der europäischen Mächte beunruhigt, ernannte der Zar im fernen Sankt Petersburg im Jahre 1791 Alexander Baranoff zum ersten russischen Gouverneur für Alaska und übertrug der Russisch- Amerikanischen Handelsgesellschaft das Pelzmonopol für den gesamten Nordens. Die Händler und Trapper der englischen Hudson Bay Company, die von Osten her an den Yukon und bis nach Alaska vorstießen, störte das wenig. Immer stärker gerieten die Küstenindianer in das Fadenkreuz der russisch-britischen Rivalität, wobei sich die Russen von den Briten immerhin dadurch unterschieden,dass sie nicht nur Alkohol, Schusswaffen und Krankheiten, sondern auch orthodoxe Missionare nach Alaska brachten, denen die Welt die ersten russisch-orthodoxen Indianer der Weltgeschichte verdankt. Aber nicht genug damit, bald tauchten auch noch die Amerikaner auf, die 1840 nach ihrem Sieg über Mexiko den Pazifik erreicht hatten. Dort trafen sie, keine hundert Meilen von San Francisco entfernt, zu ihrem Erstaunen auf russische Pelzjäger, die sich in Fort Ross niedergelassen hatten. Einen kurzen geschichtlichen Moment lang schienen sich gefährliche Frontstellungen anzudeuten, doch dann brachte die Ökonomie eine schnelle und gewaltfreie Lösung. Nachdem die Russen den pazifischen Otter fast vollständig ausgerottet hatten und der Pelzhandel zusammengebrochen war, lohnte sich Russisch- Alaska einfach nicht mehr. So verkauften die Russen den Amerikanern im Jahre 1867 für 7,2 Millionen Dollar kurzerhand ihre riesige alaskanische Provinz. Welchen ungeheuren Wert die Amerikaner damit halb unwillig und gleichsam nebenbei erworben hatten, sollte sich erst später herausstellen. Die Ureinwohner des Landes hatte ohnehin niemand gefragt. Die Stadt Anchorage war übrigens erst lange nach dem Kauf Alaskas im Jahre 1915 gegründet worden, als sich die Amerikaner anschickten, wenigstens die Küstenregionen durch den Bau neuer Eisenbahnlinien zu erschließen.
Als wir das Museum verließen, erwartete uns eine Überraschung. Ein starker Wind hatte vom Meer her die Wolken an den Rand der östlichen Berge getrieben, und über der Stadt wölbte sich ein unerwartet strahlend blauer Himmel. Als hätte man eine neue Stofftapete von Horizont zu Horizont aufgezogen, hatte sich die Stimmung schlagartig verändert. Die Farben der Autos kamen mir bunter vor, die Menschen auf den Straßen freundlicher, und auch von den Parkplätzen waren die Betrunkenen verschwunden. ImLicht der Mittagssonne wirkte sogar das Visitor Center nun plötzlich wie ein schmuckes Trapperhaus, Tische und Stühle waren herausgestellt worden, an denen nun Touristen saßen und Stadtkarten studierten. Vor dem Denkmal des Schlittenhundes Balto, der in voller Lebensgröße und im gestreckten Lauf dargestellt war, drängelten sich Kinder für das obligatorische Erinnerungsfoto. Der Husky Balto hatte als Leithund eines Hundeschlittens im Jahre 1925 in einer atemberaubenden Fahrt quer durch ganz Alaska einen dringend benötigten Impfstoff gegen eine Diphtherie- Epidemie von Anchorage nach Nome an die Beringsee gebracht. Das haben ihm die Alaskaner nie vergessen, und ein herzzerreißender Zeichentrickfilm, siebzig Jahre später gedreht, hatte den wackeren Balto endgültig unsterblich gemacht. Balto, der unermüdliche Schlittenhund, der seinen menschlichen Musher vor dem Aufgeben bewahrte, Balto, der alle Schliche in der Wildnis kannte, war für jedes amerikanische Schulkind ein Begriff und rangierte weit von cineastischen Kunstfiguren wie Lassy, Fury oder Flipper.
Balto Denkmal in Anchorage
Mit Lassy, Fury oder Flipper haben die Alaskaner ohnehin nicht viel am Hut. Die Ebenen und Berge ihres Landes jenseits von Anchorage sind der Lebensraum von Karibus, Pumas, Waipitis, Adlern Grizzlys und Wölfen, wobei den Wölfen in der Vorstellung der Einheimischen eine ganz besondere Rolle zukommt. Für sie ist der Wolf das inoffizielle Wappentier ihres Landes, ein Wesen, in dem Eleganz, Schönheit, List und Mut ebenso zu finden sind wie ein ausgeprägtes soziales Verantwortungsgefühl für die Mitglieder des eigenen Rudels. So überraschte es nicht, dass es in Anchorage ein eigenes Wolf-Museum gab, das „Song of Wolfe-House“ in der 6th Street, in dem die Besucher den wahren Herren des Nordens auf Diorahmen, als lebensecht gestaltete Reproduktionen oder im Film bewundern konnten. Wie den Exponaten zu entnehmen war, entstammte der Alaska-Wolf einer Vermischung des grauen Wolfes mit einer besonders gewitzten Kojotenart, während seine Vettern, der Yukon- und den Polarwolf einen anderen Stammbaum aufwiesen. Gemeinsam war ihnen allen der dichte, schöne Pelz, die lange Schnauze und die unvergleichliche Grazie, mit der sie ebenso durch das Unterholz pirschten wie über flaches Gelände jagen konnten. Ein Film im „Song of Wolf-Museum“ zeigte den Alaska-Wolf bei der Jagd und bei der Aufzucht seiner Jungen. Man sah ihn während des Sonnenaufgangs durch die Wälder schleichen oder von erhöhter Warte über die Weiten Zentralalaskas schauen. „We are all part oft the Nature, and all Animals are our Cousins“, meinte einer der Museumsführer, mit dem ich versuchte nach der Filmvorführung ins Gespräch zu kommen. Er war ein junger Mensch mit treuherzigen Augen und einem spitzenGesicht, eher ein Vetter des Fuchses als des Wolfes, und auf die Tourismuswirtschaft seines Staates nicht gut zu sprechen. Seit Jahren versuchten die Geschäftemacher die Tierschutzgesetze zu ändern, um reichen Touristen eine Wolfsjagd per Helikopter zu ermöglichen, meinte der junge Mann. Das Beste wäre es, die Menschen würden in ihren Städten bleiben und die Tiere in der freien Natur, aber das sei illusorisch, weil zu viele Leute viel zu gut am Alaska- Tourismus verdienten. Recht hatte der junge Mann, auch wenn ich ihm nicht gestand, dass auch wir selbst zu dieser despektierlichen Spezies gehörten, denn auch wir würden uns bald mit dem Camperhome aus der Stadt hinaus trauen, um uns ein wenig an der Wildnis zu laben.
An der nordwestlichen Uferfront von Anchorage befand sich der Resolution-Park, ein begrünter Aussichtspunkt, von dem aus man über den Cook Inlet hinweg die schneebedeckten Ausläufer der Alaska Range im Norden sehen konnte. Der Cook Inlet war ein weiträumiger Meeresarm, der Anchorage mit dem etwa zweihundert Kilometer entfernten offenen Pazifik verband. Benannt war der Cook-Inlet nach dem britischen Entdecker James Cook, der jedem Weltreisenden, wohin es ihn auch im pazifischen Großraum verschlug, immer wieder begegnete. Auf der anderen Seite des Pazifiks stand seine überlebensgroße Statue im Hyde Park von Sydney auf einem meterhohen Sockel, eine der schönsten Inselgruppen des Südpazifiks, die „Cook Islands“ trug seinen Namen, ebenso wie die stürmische Cook-Strait zwischen der neuseeländischen Nord- und Südinsel. Es gab eine „Cook Bay“, einen „Mount Cook“, ein „Cooktown“ und jede Menge anderer Orte, Berge, Gletscher und Täler auf der Welt, die in irgendeiner Beziehung zu James Cook standen und deswegen seinen Namen trugen. Die Küsten Alaskas war der Entdecker imJahre 1778 auf seiner dritten und letzten Weltreise entlang gesegelt, immer auf der Suche nach der Nordwestpassage, von der sich die britische Admiralität eine direkte Verbindung zwischen Pazifik und Atlantik erhoffte. Die gesamte Westküste Nordamerikas nördlich von Vancouver hatte der akribische Kapitän abgesucht, in jeden Meeresarm war er hinein gesegelt, immer in der Hoffnung im Norden des amerikanischen Kontinents einen befahrbaren Wasserweg zum Atlantik zu finden. Doch immer wieder hatte er unverrichteter Dinge umkehren müssen. So auch im großen Cook-Inlet, der als tief ins Land reichender Meeresarm zu besonderen Hoffnungen Anlass gegeben hatte und am Ende doch wieder enttäuschte. An diesen Misserfolg erinnerte das Denkmal des Entdeckers auf der Aussichtsplattform des Resolution Parks. So schlank und gut gewachsen wie er wahrscheinlich gar nicht gewesen war, stand der steinerne Cook breitbeinig mit dem Rücken zur Stadt dem Cook Inlet zugewandt, als könne er gar nicht glauben, dass es wieder ein Schuss in den Ofen gewesen war. Weniger als ein Jahr, nachdem er seine erfolglose Erkundung am Turnagain-Arm im Südosten von Anchroage hatte abbrechen müssen, war der weltberühmte Entdecker auf der Insel Kauai hawaiianischer Menschenfressern zum Opfer gefallen. Ich blickte von unten in das angespannte, fast genervte steinerne Gesicht des unglücklichen Mannes, der immer nur gereist und gereist war und seine Kinder kaum gekannt hatte. Über sein Haupthaar hatte man ein Taschentuch gespannt, um ihn vor dem Taubenkot zu schützen.
Der Bus No. 7 brachte uns am späten Nachmittag zum Lake Logan im Süden Anchorages, dem größten Wasserflughafen der Welt, von dem manche behaupten, er wäre die eigentliche Drehscheibe des Alaska-Verkehrs. Denn so viel an Eisenbahnschienen, Fährverbindungen und Straßen in den letzten beiden Generationen auch gebaut worden war, die Weite des Landes erschloss sich nur mit Hilfe von Flugzeugen, genauer gesagt, kleinen Wasserflugzeugen oder Flugboote, die mit einer Besatzung von fünf bis zehn Personen bis in die entferntesten Winkel des Landes vordringen konnten. „Bush-Country“ war die Sammelbezeichnung jener neunzig Prozent Alaskas, die nur auf dem Luftweg erreichbar waren und deren Anflug Wagemut und Können erforderte. Unzählig waren die Geschichten von Unglücken, Abstürzen und Heldentaten der Piloten, wobei nie ganz klar war, wo die Tatsachenberichte endeten und das Fliegerlatein begann. Eine der berühmtesten Moritaten der alaskanischen Wasserflugzeughistorie handelte von dem Piloten Jim Dodson, dem es gelungen sein soll, während eines Inlandfluges mit rechts den Steuerknüppel zu halten und mit links einer jungen Frau zu assistieren, die während des Fluges auf dem Beifahrersitz ein Kind zur Welt brachte. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann fliegen sie noch heute.
Von dergleichen Gefahren und Eventualitäten aber war an diesem Tag am Ufer des Lake Hood nichts zu spüren. Das ganze Gelände wirkte wie ein Freizeitareal voller Touristen, die auf den Holzplanken herumliefen, es sich in Cafés gutgehen ließen oder das benachbarte Flughafenmuseum besuchten. Aus der Nähe betrachtet, erschienen die Flugzeuge erstaunlich klein, oft hatten sie nur Platz für drei oder vier Personen. Manche wirkten so grazil, dass ich mir kaum vorstellen konnte, wie sie einen Sturm über einem Gletschergebiet überstehen könnten. Der Startvorgang erwies sich übrigens als erstaunlich unspektakulär: Kurze Beschleunigungsphase, mächtiges Brummen der starken Motoren, und ab ging es in die Lüfte. Wie kleine weiße Vögel kreisten die Maschinen über dem See, ehe sie in Richtung Meer oder Berge entschwanden.
Als wir nach dem Abendessen ins Hotel zurückkamen, war Irene leicht alkoholisiert. Man merkte es an ihrer aufgekratzten Heiterkeit und den weit aufgerissenen Augen, mit denen sie mich ansah. „Honey, did you enjoy your first Day in Alaska?“ fragte sie mich, ohne sich für meine Antwort zu interessieren. Wie schon gestern Abend war von ihrem Ehemann nirgendwo etwas zu sehen. Vielleicht würde bald ein dritter kommen und sie in einen wärmeren Bundesstaat der USA mitnehmen.
Da wir noch immer an der Zeitumstellung litten, gingen wir früh aufs Zimmer. Ich las noch ein wenig in Richard Leos „Jenseits aller Grenzen“, einem zum Zeitpunkt unserer Reise vieldiskutierten Buch über einen jungen Mann, der zusammen mit Frau und Kind von Chicago aus in die Wildnis Alaskas aufgebrochen war. Ganz trübselig konnteman werden, wenn man las, wie viele Probleme ein solches Abenteuer aufwarf. Und auch das Ende des Buches war wenig erbaulich: Obwohl die Ansiedlung in Alaska gelang, brach die Familie am Ende auseinander. Die Frau hatte von Alaska die Nase voll, verließ Mann und Sohn und kehrte in die „lower 48“ zurück. Richard Leo und sein Sohn aber blieben in Alaska und richteten es sich mehr schlecht als recht in ihrem herben Utopia ein.
Der nächste Tag stand ganz im Zeichen der Wagenübernahme. Wir verabschiedeten uns von der verkaterten Irene, orderten ein Taxi und fuhren zur Mietstation in einen Vorort von Anchorage. Wir hatten bei CruiseAmerica.com den sogenannten „T19“ gebucht, nicht verwandt mit dem russischen T34 Panzer, sondern einfach nur ein Ford-Truck, auf dessen Ladefläche ein optimal angepasster Wohncontainer aufgesetzt worden war. So klein er von außen auch erschien, sein Innenleben hatte es in sich, und es dauerte eine geschlagene Stunde, ehe uns zwei junge Männer alle Bedienungsdetails unseres Alaska- Mobils erklärt hatten. Das normale Licht im Wageninnern lief über eine Batterie, die über Generatoren beim Fahrtbetrieb des Wagens regelmäßig aufgeladen wurde. Der Kühlschrank bezog seine Energie entweder durch Propangas, Batterie oder durch elektrischen Strom, wenn der Wagen auf einem Campingplatz an die Stromversorgung angeschlossen war. Nur im letzteren Fall war es übrigens möglich, die Klimaanlage anzustellen. Das Spül- und Toilettenwasser musste regelmäßig in dafür bereitstehende Dump-Stationen auf den Campingplätzen entsorgt werden. Trinkwasser wurde natürlich separat aufgefüllt, entnommen und gelagert. Gekocht wurde mit Propangas aus einem Propangasbehälter, dessen Füllung unter normalen Umständen für eine vierwöchige Reise ausreichte. Wie volldie Abwasserbehälter oder Batterien waren, konnte man besonderen Schaltern entnehmen, die neben der Spüle angebracht waren.
Von außen sah der T19 winzig aus, war aber im Innern erstaunlich geräumig. Wir verfügten über eine Spüle mit Herd, eine Dusche und eine Chemotoilette, bei deren Anblick wir uns versprachen, sie nur zu benutzen, wenn uns Grizzlys belagerten. Sogar zwei separate Schlafgelegenheiten standen zur Verfügung, eine Schlafnische über der Fahrerkabine und eine Sitzecke, die man mit wenigen Griffen in ein Bett umbauen konnte.
Am Ende entschlossen wir uns, die Versicherung auch auf Reifen- und Glasschäden aufzustocken und buchten noch ein Meilenpaket extra. Das Schulterklopfen von Seiten der Stationsbesetzung gab es gratis. Wir bedankten uns, stiegen ein, ließen den Motor an, und die Fahrt begann.