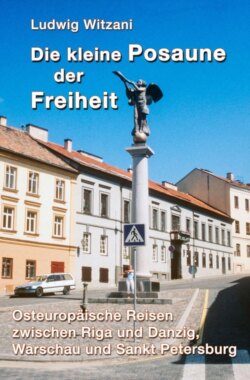Читать книгу Die kleine Posaune der Freiheit - Ludwig Witzani - Страница 9
Оглавление
LETTLAND
oder:
Die Russen
sind an allem Schuld
Manche Grenzen gleichen Inszenierungen des Übergangs. An der Grenzstation von Belize und Guatemala wird der Reisende von knapp zwei Meter großen schwarzen Zollbeamten verabschiedet und von kleinen, rundlichen Indiobeamten in Empfang genommen, die kaum größer als mehr als ein Meter sechzig sind. Am Amur kontrollieren große blonde Russen die Pässe der agilen und kleingewachsenen Chinesen beim Grenzübertritt zwischen Russland und China.
An der estnisch-lettischen Grenze zeigten lediglich zwei Flaggen und ein Zollhäuschen, dass der Bus eine internationale Grenze überfuhr. Estland und Lettland gleichen sich wie ein Ei dem anderen, sagen die Russen, und jeder Blick aus dem Busfenster zeigte, dass diese Aussage nicht übertrieben war. Es war der gleiche Menschenschlag, das gleiche Meeresufer, es waren die gleichen Städtebilder und alles in allem auch die gleichen Physiognomien, die es an den Haltestellen in Estland und Lettland zu betrachten gibt. Die 800.000 Esten und zwei Millionen Letten diesseits und jenseits der Grenzen verbindet nicht nur die gleiche Herkunft aus dem Innern Asiens, eine ähnliche Sprache, Geschichte und Küche, sondern auch die gleiche enthusiastische Liebe zu ihrer baltischen Heimat.
Natürlich war auch das Wetter in Estland und Lettland identisch. So setzte sich der Regen, der uns in Pärnu die Nerven strapaziert hatte, auch während unserer Reise nach Lettland fort. Grau und nass erstreckte sich die Küstenstraße den Golf von Riga entlang nach Süden, immer neue Regenschauer rauschten von der Ostsee über das Land, und als wir die Peripherie von Riga erreichten, verschwanden die endlosen Plattenbauten in einem geradezu amphibischen Dunst. Auf dem Busbahnhof eilten die Menschen mit Regenjacken und Rucksäcken durch die Hallen, nasse Hunde liefen bellend über den Vorplatz. Überall saßen Frauen mit Kopftüchern, Wollwesten und Plastiktüten in den Wartehallen.
Doch so schlecht das Wetter in Riga auch war, an Gästen schien es der Stadt nicht zu mangeln, denn alle preisgünstigen Unterkünfte, die wir ansteuerten, waren voll. Schließlich führte uns der Zufall in die Bahnhofsgegend zum "Aurora", einem Etagenhotel mit düsterem Treppenhaus, langen Fluren und einem Empfangschef, der uns mit kaum verhohlener Skepsis musterte. Ich konnte es ihm nicht verdenken, denn wir sahen nach der langen Tagesreise stark mitgenommen aus, und die nassen Hosen und Hemden, die uns am Körper klebten, machten unsere Erscheinung nicht einladender. Außerdem waren wir doch Westler. Was also machten wir in dieser Absteige für fliegende Händler, Liebespaare und Halunken? Ich wusste es auch nicht, war aber trotzdem dankbar, als er uns nach einigem Zögern endlich den Schlüssel zu dem letzten freien Zimmer gab. Es handelte sich um eine Etagennische, die nur durch eine dünne Wand vom Treppenhaus abgetrennt war, einen langgezogenen Schlauch mit verblichenen Tapeten an den Wänden, einem Waschbecken und zwei Schlafpritschen, die verdächtig knirschten, als wir unsere Rucksack ablegten. Die Türe hing so schief in der Wand, dass ein einziger Tritt genügt hätte, um sie aus den Angeln fliegen zu lassen. Dafür konnten wir von dem kleinen Zimmerfenster aus den Aufmarsch der Prostituierten beobachten, die zu allen Tageszeiten den Reisenden, die den Bahnhof von Riga verließen, ihre Angebote zuriefen, um bei Interesse mit ihrem Kunden sofort im Eingang des „Aurora“ zu verschwinden.
Schon in der ersten Nacht gab es im Hotel ein Riesengeschrei. Ein Freier und eine Prostituierte waren sich über Dienstleistungen und Preise in die Haare geraten. Die Türen knallten, die Fäuste flogen, und mit großem Gebrüll griffen die örtlichen Zuhälter ins Geschehen ein. Dann wurde wieder alles ruhig. Ich blickte aus dem Fenster und sah den nächtlichen Bahnhofsvorplatz im Laternenlicht. Die Straßenstricher rüsteten zu ihrer letzten Schicht, ich kroch wieder ins Bett und schlief gleich ein.
Am nächsten Tag war das Wetter wie ausgewechselt. Ein makelloser Himmel wölbte sich wie ein blaues Zirkuszelt über der größten Stadt des Baltikums. Auch das Personal vor dem „Aurora“ hatte gewechselt, nun waren Marktstände aufgebaut, auf denen Obst und Gemüse, aber auch Kehrbleche, Besen und Regenjacken zum Verkauf standen. Unter den Angeboten einer improvisierten Garküche konnten wir unter Leber, Schnitzel, Frikadellen mit kaltem Gemüse, fetten Würsten und Innereien wählen, die allesamt ebenso scharf gewürzt waren wie der baltische Alltag in diesem Bahnhofsviertel. Dass wir als Touristen am Rande der Vorstadt an einer Garküche aßen, machte uns in den Augen der Bedienung allerdings wenig Ehre. Entweder waren wir geizig, weil wir uns nichts Besseres leisteten, oder wir waren tatsächlich die armen Teufel, die sie in uns zu entdecken glaubten. Auch Stefan war mürrisch: „Herrje, wo sind denn all die wunderschönen Frauen, von denen mir mein Onkel erzählt hat? Die werden doch nicht alle schon im Westen sein?“
Ganz so schlimm war es nicht. Als wir uns der Innenstadt näherten, ein wenig die Boulevards entlang flanierten und auf den Bänken am Ufer der Düna die Menschen beobachteten, tauchten sie endlich auf: die schönen lettischen Frauen, hochgewachsen, schmalhüftig, mit ihren herrlich hohen Wangenknochen - doch leider fast niemals allein, sondern von Männern, Freunden oder Verehrern begleitet. Zu Stefans Missvergnügen mussten wir feststellen, dass es sich bei vielen dieser Begleiter nicht um Einheimische, sondern um Touristen handelte, um Gäste aus dem Westen, die sich genau wie Stefan auf Brautschau im Osten befanden. Diese ungleichen Paare traf man in der ganzen Stadt, sie saßen in den Parks, in den Restaurants oder spazierten die Straßen entlang, mal liefen sie in einem halben Meter Sicherheitsabstand nebeneinander her, mal ergriffen sie sich dann und wann scheu an den Händen. Ein heikles Spiel wurde gespielt, dessen Antrieb die Hoffnung war, die Hoffnung des Westlers, dass ihn seine Brieftasche aus der Einsamkeit erlösen möge und die Hoffnung der jungen Frauen, dass ihnen einer dieser Männer den Weg in ein besseres Leben ebnen würde. Anmut und Not, Energie und Mut war in den Augen der Frauen zu lesen, eine Kombination, aus der alles entstehen konnte: das Glück oder der Untergang. Diese Frauen glichen Spielerinnen in einem makabren Roulette, in dem alles darauf ankam, auf den richtigen Mann zu setzen. Es gab Paare bei denen es nicht ausgeschlossen schien, dass diese Kalkulation aufgehen könnte, bei anderen aber kam es mir so vor, als gingen die Elbenfrauen aus dem "Herrn der Ringe" mit jenen Uruk-hais spazieren, die der böse Zauberer Saruman zur Plage der Welt erschaffen hatte.
Inzwischen hatten wir die Peripherie verlassen und die Innenstadt erreicht. Hier hatte die Stadt die Erinnerung an die bleierne Zeit des Bolschewismus abgestreift wie eine falsche Haut. In den großen Parks flanierten die Menschen, Straßencafés hatten geöffnet, Mode wurde ausgeführt, und auf großen Werbeflächen wurde so selbstverständlich für Luxuswaren geworben, als gehörte Lettland schon seit eh und je zur Internationale der Premiummärkte. Der "Eindruck unendlicher Eintönigkeit", den noch Henning Mankell vor einem Dutzend Jahren in seinem Roman "Hunde von Riga" beschworen hatte, war einer bunten Vielfalt gewichen, die sich von ähnlichen Bildern aus Avignon, Florenz oder Amsterdam kaum noch unterschied. Aber wo war der Muff der Sowjetzeit geblieben? War denn alles nur ein böser Spuk gewesen? Nur noch das eine oder andere klobige Bolschewikendenkmal erinnerte an die bleierne Breschnewzeit - mit ihren gefühllosen Gesichtern wirken die steinernen Schlagetots neben Straßenkapellen und Flohmärkten wie Karikaturen einer untergegangen Epoche. Sogar die Straßenbahnschaffner hatten die obrigkeitlichen Attitüde abgelegt, die Polizisten gaben sich freundlich, und die Taxifahrer waren mit ihren vielfach gestaffelten Einheimischen- und Touristentarifen ohnehin längst in der Marktwirtschaft angekommen.
Soweit der erste Blick auf die große Stadt an der Düna, deren Besucherzahlen sich seit dem Eintritt Lettlands in die Europäische Union vervielfacht haben. Soweit auch der Tenor der Reiseführer, die den Eindruck vermittelten, das ganze Land mit seiner Hauptstadt Riga an der Spitze befinde sich seit dem Beitritt Lettlands zur EU in einem stürmischen Aufbruch nach Europa. Doch das war nur die halbe Wahrheit. Denn buchstäblich die andere Hälfte der Wahrheit, ziemlich genau die Hälfte der 850.000 Einwohner Rigas, war nicht lettisch, sondern russisch und damit von dem nationalen Jubel, der die Rückkehr Lettland nach Europa begleitet hatte, gänzlich ausgeschlossen. Die russische Armee war schon lange abgezogen, doch die russischen Einwohner Lettlands waren noch immer da - nicht als Freunde oder Gäste, sondern als Bürger eines Staates, den sie nicht gewollt hatten und der mit ihnen selbst nichts anderes anzufangen wusste, als sie für jedweden Missstand verantwortlich zu machen. Das Bruttoinlandsprodukt hatte sich nicht so positiv entwickelt wie erhofft? Die geplatzte Immobilienblase hatte unzählige Existenzen vernichtet? Die Kriminalitätsrate war schon wieder gestiegen? Wer lag betrunken auf den Schienen, so dass die Straßenbahn nicht weiterfahren konnte? So viele Fragen, doch die Antwort klang immer gleich in den Ohren: die Russen sind an allem schuld.
Selbst bei der Frage, wer die große St. Peter Kirche im Herzen von Riga zusammengeschossen hatte, tendierte der normale Lette zur Antwort: das waren die Russen, auch wenn die meisten insgeheim wussten, dass die Deutschen während ihrer Rückzugsgefechte im Zweiten Weltkrieg einen Großteil der Innenstadt und damit auch St. Peter, die höchste Kirche des Landes, in Schutt und Asche gelegt hatten. Inzwischen war St. Peter gottlob längst wieder aufgebaut, und ihr über einhundert Meter hoher Turm konkurrierte mit dem Glockenturm der Olafskirche in Tallinn um den Titel des höchsten baltischen Gotteshauses.
In vierundsiebzig Metern Höhe, auf der Aussichtsplattform von St. Peter ergab sich schließlich jener distanzierte Blick auf Riga, bei dem alles Lettische, Russische, Deutsche, Schwedische, Polnische oder wie immer auch die Nationen hießen, die am Stadtbild Rigas mitgewirkt hatten, in einem Gesamteindruck verschmolz. Es war der Gesamteindruck eines flachen Landes, durch das ein breiter Fluss seiner Mündung in die Ostsee entgegen floss und an dessen Ufern seit dem 13. Jahrhundert eine Stadt existierte, in der bis auf wenige Jahrzehnte acht Jahrhunderte lang immer nur die Fremden den Takt angegeben hatten. Wie ein ausgefranster Häuserteppich erstreckte sich die Stadt in der Nähe des Meeres, immer flacher zu ihren Rändern hin, als hätte der unablässig wehende Wind die Peripherien der Stadt glatt geschmirgelt. Es war ein nordischer, ein skandinavischer Wind, der an diesem Tag über die Ebenen fegte und den Himmel reinigte, es war ein Wind, der um Kirchtürme und Hochhäuser brauste, der in wilden Turbulenzen den großen Fernsehturm im Westen der Stadt umwehte und die Ausflugsschiffe auf der Düna tanzen ließ.
Im Zentrum dieser windigen Welt, gleich unterhalb der großen Kirche befand sich die Altstadt von Riga, das historische Zentrum, in dem der deutsche Bischof Albert von Buxtehude im Jahre 1211 den ersten Dom der Stadt errichten ließ. Das Rathaus, das Schwärzhäuptergildenhaus und die Roland-Statue überragten einen Platz voller schwerterschwingender Ritter mit Lanzen, Kreuzen, Drachen und allegorischen Fabelwesen, während immer neue Touristengruppen aus den Zentren des alten Europas darüber staunten, sich zweitausend Kilometer von daheim entfernt einer Kopie norddeutscher Marktplätze gegenüber zu sehen. Eine Kopie ist es sogar im buchstäblichen Sinne - denn der gesamte Marktplatz samt Kirche und Uferbebauung war am Ende des Zweiten Weltkrieges von der abrückenden deutschen Armee zerstört worden. Nun war sie als ein urbanes Fake ebenso detailgetreu und makellos wiedererstanden wie die Altstadt von Warschau.
Am Ende einer wechselvollen Geschichte mit deutschen, polnischen und schwedischen Herren fiel Lettland im 18. Jahrhundert an das Zarenreich, und es dauerte nicht lange, da verwandelte sich Riga in eine Miniaturausgabe von St. Petersburg mit Salons und Theatern und einer Monumentalstatue Zar Peters des Großen im Herzen der Stadt. "Liefland, du Provinz der Barbarei und des Luxus, der Unwissenheit und eines angemaßten Geschmacks, der Freiheit und der Sklaverei" schrieb Johann Gottfried Herder als Kolaborator der Domschule über das Riga des 18. Jahrhunderts, in der es sich die deutschbaltische Oberschicht mit kommunaler Selbstverwaltung gut gehen ließ, während sie die stadthörigen lettischen Hintersassen Mores lehrten. Erst im 19. Jahrhundert erwachte in der Auseinandersetzung mit den deutschbaltischen und russischen Oberschichten in den Städten ein lettisches Nationalbewusstsein, das unmittelbar nach der Gezeitenwende des Ersten Weltkrieg zur Gründung der ersten lettischen Republik führte. Während das benachbarte Russland im bolschewistischen Elend versank, wurde Riga innerhalb der kurzen und so trügerisch verheißungsvollen Zeit der "Goldenen Zwanziger" zu einem "Paris des Ostens", zu einem Kristallisationspunkt von Kultur, Individualität und Lebensart. In den Dreißiger Jahren, als sich die politische Großwetterlage bereits wieder zu verdunkeln begann, getraute man sich sogar, die große Monumentalstatue Zar Peters abzureißen und an ihrer statt am Ende des Kalkuleja-Boulevards eine vierzig Meter hohe Freiheitssäule zu errichten, auf deren Spitze "Mutter Heimat" als resolute baltische Mutter ihre drei Kinder in Gestalt von drei Sternen in den Himmel hob. Bei diesen drei Sternen handelte es sich nicht, wie viele Touristen mutmaßten, um die symbolische Darstellung Lettlands, Estlands und Litauens, sondern um die drei lettischen Regionen Kurzeme, Lettgalle und Vidzeme.
Mit der gerade erst gefeierten Freiheit Lettlands aber war es schon wenige Jahre nach der Errichtung der Freiheitsstatue auch schon wieder vorbei. Mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges brach eine nationale Existenzkrise über das Land herein, deren traumatische Spuren das nationale Selbstverständnis im Verhältnis zu Russland bis heute prägen. Die Letten nennen diese Zeit "die Epoche der Okkupation", und sie scheuen sich nicht, diese einundfünfzig Jahre der deutsch-russischen Fremdherrschaft zwischen 1940 bis 1991 in einer nach westlichen Maßstäben politisch höchst unkorrekten, aber durchaus nachvollziehbaren Parallelisierung zu dokumentieren. Denn im "Museum der Okkupation", das sich wie ein ästhetischer und moralischer Kontrapunkt gleich in der Nachbarschaft des so idyllisch restaurierten Marktplatzes befindet, waren die Sieger und Besiegten des 2. Weltkrieges nicht wie in den Nürnberger Prozesses fein säuberlich geschieden, sondern saßen als nationalsozialistische und kommunistische Variante eines modernen Mördertotalitarismus beide gleichermaßen auf der Anklagebank.
Die in mehreren Sprachen präsentierte Foto- und Dokumentenausstellung begann mit der Vorgeschichte des Hitler-Stalin-Paktes, in dessen geheimen Zusatzprotokoll sich die beiden Diktatoren über die Aufteilung Osteuropas verständigt hatten. Molotow und Ribbentrop grinsten auf großen Fotografien von den Wänden, und gleich nebenan sah man die Verzweiflung in den Gesichtern der Außenminister Lettlands, Estlands und Litauens, die im Frühjahr 1940 nach Moskau zitiert wurden, um die so genannten "Schutzverträge" zu unterzeichnen, die in Wahrheit nichts anderes bedeuteten als die bedingungslose Kapitulation vor der nackten Gewalt. Als die sowjetischen Truppen im Juni 1940 Lettland besetzten, begann die russische Geheimpolizei sofort mit Massenverhaftungen, Deportationen und Erschießungen aller nur irgendwie der Opposition verdächtigen politischen und gesellschaftlichen Kräfte. Eine Welle des Terrors schwappte über das Land, deren Wucht die schlimmsten Befürchtungen weit übertraf und von der das Ausland erst nach dem Zusammenbruch der UdSSR erfahren sollte. Das nationale Leben stand still, die lettische Wirtschaft befand sich bereits im Stadium des Zusammenbruchs, als im Juni 1941 die deutsche Armee die UdSSR angriff und in der ersten Phase des Krieges der Roten Armee eine Serie scheinbar kriegsentscheidender Niederlagen zufügte. Hektographierte Dokumente belegten, dass die Russen noch während ihrer überstürzten Flucht aus Riga alle politischen Gefangenen systematisch erschossen, die einheimischen Juden jedoch an der Flucht nach Osten hinderten. Dann folgten die berüchtigten Bilder jubelnder Letten, die die einrückenden deutschen Truppen in Riga mit Blumensträußen begrüßten, Bilder, die die Russen bis auf den heutigen Tag als Beweis für die Kollaboration der Letten mit dem nationalsozialistischen Gewaltregime heranziehen.
Aber auch dieser Jubel währte nicht lange. Schnell wurde deutlich, dass die Deutschen die "nordischen" Letten zwar germanisieren wollten, dem Großteil des Volkes aber überwiegend dienende Funktionen zugedacht hatten. Die Verfügungsgewalt über ihre Heimat sollten die Letten auf jeden Fall verlieren. Auf den großen Plänen und Skizzen, die hinter Glas im Okkupationsmuseum aushingen, wurde deutlich, dass nicht weniger als 160.000 deutsche Siedler nach dem Ende eine siegreichen Weltkrieges in Lettland angesiedelt werden sollten. Die Ermordung der 70.000 lettischen Juden erschien dagegen nur als Teil der nationalen Leidensgeschichte - was der Ausstellung viel Kritik eingetragen hatte. Allerdings wurde der latente Antisemitismus der Letten in der Ausstellung keineswegs verschwiegen - heimlich aufgenommene Fotografien aus lettischen Gefängnissen zeigten, wie die Nationalsozialisten mit Eisenstangen bewaffnete lettische Kriminelle auf die jüdischen Inhaftierten hetzten, ein schreckliches Kapitel innerhalb der nationalen Tragödie, das im Museum nicht ausgespart wurde.
Das Schwergewicht der musealen Dokumentation beschäftigte sich aber mit dem für Lettland katastrophalen Ende des zweiten Weltkrieges. Hunderttausenden lettischer Männer, Frauen und Kindern, nicht weniger als 10 % der gesamten Bevölkerung gelang es, vor der herannahenden Roten Armee in den Jahren 1944 und 1945 nach Westen zu entkommen, wo sie später vorwiegend in den USA und Kanada eine neue Heimat fanden. 135.000 lettische Flüchtlinge aber wurden im letzten Kriegsjahr von der Roten Armee zusammen mit Restbeständen der deutschen Ostarmee im Westen Rigas in Kurland eingekesselt. Die Bilder an den Museumswänden zeigten Szenen eines dramatischen, aber letztlich vergeblichen Widerstandes, den die Rote Armee mit ihrer überlegenen Feuerkraft nieder walzte. Lettischen Flüchtlingen, denen die Flucht über die Ostsee nach Schweden gelang, erging es schlechter als den Vietnam-Deserteuren der Sechziger Jahre: sie wurden von den Schweden inhaftiert und an die Rote Armee ausgeliefert.
Folgte man der Darstellung der Museumsdidaktik, brach mit dem russischen Sieg eine lange Nacht über Lettland herein. Die westlichen Demokratien, die für die Freiheit Polens in den Krieg gezogen waren, überließen auf den Konferenzen von Teheran und Yalta dem totalitären Sowjetkommunismus leichter Hand die Beute, die er sich schon im Nichtangriffspakt mit Hitler-Deutschland gesichert hatte. Hatten die Nationalsozialisten in ihren Okkupationsplänen die Ansiedlung von 160.000 Deutschen in Lettland innerhalb von zwanzig Jahren geplant, kamen zwischen dem Ende des zweiten Weltkrieges bis zum Zusammenbruch der UdSSR im Jahre 1991 nicht weniger als 840.000 Russen nach Lettland, ein Bevölkerungsimport, der die die Struktur des gesamten Landes bis in die Grundfesten veränderte.
Über die Art dieses Wandels gehen die Meinungen bis heute allerdings weit auseinander. In der Sichtweise der Russen wurde das Land nach 1945 mit Riesenschritten entwickelt, die Alphabetisierung ergriff endlich alle Teile der Bevölkerung, Straßen wurden gebaut, Häfen vergrößert, Eisenbahnlinien in Betrieb genommen, und zum ersten Mal entstand eine nennenswerte Industrie. Kein Wunder, dass die Russen die Letten für Schnorrer halten, für undankbare Wohnungsbesitzer, die sich ihre Bruchbuden haben renovieren lassen, um dann die selbstlosen Dienstleister unbezahlt aus dem Lande zu werfen. Für die Letten ist die Erinnerung an die Zeit der Sowjetherrschaft dagegen gleichbedeutend mit der Reminiszenz an ein nationales Desaster, bei dem Hunderttausende den spätstalinistischen Säuberungen zum Opfer fielen. Es ist die Erinnerung an eine Zeit, in der die Welt immer mehr vergaß, dass es überhaupt noch Letten, Esten und Litauer gab, die sich von den Russen kulturell und weltanschaulich unterscheiden wollten. Die Letten haben bis heute nicht vergessen, dass in der so viel gepriesenen Friedens- und Entspannungspolitik der Siebziger Jahre mit keinem Wort von den unterdrückten Völkern Osteuropas und schon gar nicht von ihnen die Rede gewesen ist.
Umso größer war die Überraschung, als der wirkliche Zusammenbruch der UdSSR, stimuliert durch die Freiheitsbewegungen in Polen, Ungarn und der Tschechoslowakei vor dem Freiheitsdenkmal in Riga und dem Parlament von Wilna in einer Region Europas begann, die die europäischen Real- und Entspannungspolitiker niemals ernsthaft auf ihrem Radarschirm gehabt hatten. Vor einer staunenden Welt erhob sich in Riga, Wilna und Tallinn der so oft beschworene Wind des Wandels und trieb die russische Besatzungsarmee aus dem Land.
Aber nur die wenigsten erkannten im allgemeinen Jubel dieser glorreichen Tage, dass mit der Wiederkehr der Freiheit die Probleme keineswegs verschwunden waren. Denn unversehens waren über 750.000 Menschen, fast ein Drittel der Bevölkerung Lettlands, in ein staatsrechtliches Niemandsland geraten, das die Beziehungen Lettlands zum übermächtigen Nachbar Russland von Anfang an belastete. Die Letten verweigern der russischen Minderheit bis heute die volle sprachliche Gleichberechtigung und verlangen von allen nach 1940 ins Land gekommenen Russen für die Ausstellung eines lettischen Passes die Ablegung eines lettischem Kulturexamens, was viele Russen, die schon seit dem Ende des 2. Weltkrieges im Lande leben, als Schikane verweigern. Auf der anderen Seite scheut sich auch die russische Regierung nicht davor zurück, die Rohstoffabhängigkeit Lettlands und die heute strittigen Grenzfragen als Druckmittel zu instrumentalisieren. Dass sich im Unterschied zum damaligen deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder die lettische Präsidentin ebenso wie viele andere osteuropäische Staatsoberhäupter weigerten, im Mai 2005 an den so genannten „Befreiungsfeiern“ in Moskau teilzunehmen, hat die Misshelligkeiten weiter angeheizt. Kein Wunder, dass der amerikanische Präsident Georg W. Bush umjubelt wurde, als er am Vorabend dieser russischen Siegesfeiern und unmittelbar vor seinem Moskaubesuch am 8. Mai 2005 einen Kranz am Freiheitsdenkmal in Riga niederlegte und zum Zorn des russischen Nachbarn die sowjetische Okkupation des Baltikums ausdrücklich verurteilte. Viele meinen, erst mit dieser Kranzniederlegung des amerikanischen Präsidenten am Freiheitsdenkmal sei die Stadt Riga wirklich frei geworden.
*
Erfahrene Sekretärinnen sagen, einen Chef erkennt man nicht unbedingt an seinem Büro, sondern an seinem Vorzimmer. Mit den Städten verhält es sich oft ebenso - ihr wirkliches Wesen tritt manchmal in den Vorstädten viel deutlicher zutage als in den Zentren. Um dies zu erkunden, lief ich vom kleinen Kanal, der die Altstadt begrenzte, die Kristina Valdemara und den Brivibas Bulvaris stadtauswärts, fuhr hier einige Stationen mit dem Bus, setzte mich hier und dort ein wenig auf die Bank, um mir die Umgebung einzuprägen und strolchte einfach aufs Geratewohl ziellos durch die Straßen. Es dauerte nicht lange, da verschwanden die Wäschereien, Supermärkte, Videotheken und Sexshops, um den eintönigen Plattenbauten Platz zu machen, die uns schon bei der Stadteinfahrt erschrocken hatten. Ich passierte graue Wohncontainer mit Satellitenschüsseln auf den Balkonen, vermüllte Wiesen und Versammlungen alter Männer, die auf wackeligen Bänken vor ihren Hauseingängen saßen. Kinder und junge Frauen waren nur wenige zu sehen, immerhin gehört die Geburtenrate der baltischen Länder mit 0,9 Kindern pro Frau zu den niedrigsten der Erde, und ein Großteil der gut ausgebildeten jungen Frauen hat sich längst in den Westen aufgemacht. Viele der jungen Männer, die mir auf meinem Streifzug begegneten, waren also einsam, folglich trugen sie Muskelshirts und hatten den Schädel kahl rasiert. In ihrer typischen Erscheinungsform hielten sie in der rechten Hand eine Zigarette und mit in der Linken hantierten sie entweder an einem Handy oder massierten sich das Gemächt. Einige kamen mir in angetrunkenem Zustand entgegen und schauten mich an wie schwer angeschlagene Boxer, die im nächsten Augenblick k.o. gehen oder einen unberechenbaren Ausfall wagen würden.
Am Ende eines solchen Streifzuges durch die Vorstädte verschlug es mich in das "Riga Motor Museum", ein großzügig ausgestattetes Oldtimermuseum, das nicht nur einen Überblick über die Geschichte des Automobils anbot, sondern auch den Werdegang einzelner Fahrzeuge dokumentierte. Der deutsche "Hansa G12/36" hatte etwa an der ersten Etappe eines Autorennens zwischen Berlin und Moskau teilgenommen, als seine Eigentümer vom Ausbruch des ersten Weltkrieges überrascht und kurzerhand verhaftet wurden. Ein im Jahre 1939 von einem Schlesier bei Rolls Royce in England bestellter "RR Wraine" wurde 1945 von der Roten Armee gleichsam als Beutekunst nach Moskau verfrachtet, wo ihn Stalin inspizierte und seinem Kumpanen Molotow schenkte, ehe das Gefährt Jahrzehnte später seine Laufbahn als landwirtschaftliches Transportgerät auf einer Kolchose beendete. Ein anderer "Rolls Royce Silver Shadow" war mit zerfetzter Vorderfront und einer blöde dreinblickenden Breschnew-Puppe im Fond als Erinnerung an einen Unfall ausgestellt, den der autovernarrte russische KP-Chef im Zustand der Volltrunkenheit verursacht hatte. Wer wollte, konnte auch die endlosen Oldtimerreihen wie eine Evolutionsgeschichte des modernen Automobilbaus betrachten. In der Darstellung des Riga Motor Museums begann alles mit dem Modell T von Ford, dessen spartanischer Innenraum noch heute jeden Besucher schockieren würde, und setzte sich fort mit den immer prachtvolleren Modellvarianten von Oldsmobile, Packard, BMW und Mercedes, die einen Trend zu immer dinosaurierhaften Größen belegten. In dem Maße, wie diese Fahrzeuge in den Städten der Welt dramatische Verkehrs- und Parkplatzprobleme verursachten, schrumpften sie wieder. Zuerst reduzierte sich der Umfang der protzig zur Schau gestellten Motorraumverschalungen, auch die Kofferräume wurden kleiner, während sich die Innenräume noch ein wenig ausdehnten. Größer wurden die Fenster, denn war man in den Ursprungstage des Automobilzeitalters abgeschirmt wie in einer Kutsche durch die Gegend gereist, so wollte man nun sehen und gesehen werden. Auch die Innenräume der Fahrzeuge demokratisierten sich, die Ausmaße der kleinen, durch Scheiben abgetrennten Vorderbänke, auf denen die Chauffeure die Wagen steuerten, und die wohnzimmerähnlichen Hinterbänke glichen sich in ihrem Raumvolumen an. Trennwände und Zwischenräume verschwanden, nun fuhren offensichtlich die Eigentümer ihre Pferdestärken selbst über Land. Gut zu sehen auch, dass alle zunächst außen befindlichen Wagenteile wie Hupen, Kupplungen, Starterschwengel zuerst zum Teil der Karosse wurden und alsbald ganz unter ihr verschwanden.
Während meiner Rundgänge durch die Vorstädte hatte Stefan bei seinen Erkundungen im Stadtzentrum einige Bars entdeckt, in denen einheimische Frauen schon am frühen Abend mit dem "Bittesprichmichangesicht" herumsaßen. Zu seiner Erleichterung gab es also doch noch alleinstehende junge Frauen, die unbehelligt von westlichen Männern in der großen Stadt zuhause waren. So verschwand er allabendlich aus unserer schlauchförmigen Dependance im Stundenhotel, nicht ohne mir vorher seine Ausweise und Wertsachen zur Aufbewahrung übergeben zu haben. Ich blieb zurück, legte mich wie eine alte Frau mit einem Kissen unter den Ellbogen noch eine Stunde ans Fenster, um das Bahnhofsviertel und die Ablösung der Prostituierten in der Abenddämmerung zu beobachten, las dann ein wenig in Mankells "Hunde von Riga", bis mir das Buch aus den Händen fiel und ich einschlief.
Was Stefan in lauen baltischen Nächten erlebte, wurde mir am nächsten Morgen brühwarm berichtet. Zuerst die gute Nachricht: bei den jungen Frauen, die Stefan in den Bars und Diskotheken ansprach, handelte es sich nicht nur um gebildete Damen, die fließend Englisch und oft auch ein hinreichendes Deutsch sprachen, sie waren nach seiner Auskunft auch immer gerne bereit, mit ihm in einen der zahlreichen Parks zu verschwinden. Schlecht allerdings war, dass diese Parks so hell erleuchtet waren, dass es diese gebildeten Mädchen aus natürlicher Scham nicht zum Äußersten kommen lassen wollten. Das war bitter, zumal sich Stefan bei der herrschenden Zimmerknappheit auch außerstande sah, auf die Schnelle ein Zimmer zu besorgen. Sprach´s und legte sich aufs Ohr, um bis in den tiefen Nachmittag zu schlafen.
*
Wieder schlug das Wetter um. Auf eine kurze Phase Sonnenschein folgte der baltische Dauerregen. Es goss zum Gotterbarmen, als wir im Busbahnhof von Riga ein Ticket nach Cesis erwarben, wo es eine der größten Burgruinen des Baltikums zu besichtigen gab. Die nassen Straßen spiegelten schon am Vormittag die entgegenkommenden Autolichter, die Dörfer links und rechts der Straße verschwanden im Regendunst, und die Wiesen glichen struppigen Frisuren, die immer aufs neue gewaschen, aber nie geföhnt wurden. Keine Landschaft strahlt, wenn die Sonne nicht scheint, aber im Nordosten Europas wabert eine intensive Tristesse über die Ebenen, sobald die Sonne verschwindet. Kein Wunder, dass es für die Deutschordensritter, die im 13. und 14. Jahrhundert das Baltikum zu großen Teilen erobert hatten, so schwierig gewesen war, Kolonisten aus dem sonnigen Zentraleuropas zu gewinnen. Es kamen nur Handwerker und Händler in die Städte und auch das nur in kleiner Zahl, während das flache Land in der Hand der lettischen Bauern blieb.
In Cesis hatten alle Geschäfte geschlossen, die Rollladen waren heruntergezogen, die Türen verrammelt, und außer uns war niemand an der Bushaltestelle zu sehen. Auch die Burg von Cesis wollte niemand außer uns besuchen, so dass wir unter Dutzenden von Schutzhelmen und Öllampen wählen konnten, mit denen wir gut gesichert die Ruinen der Burg durchstreiften. Soweit sich heute noch erkennen ließ, musste es sich um eine bedeutende Festung gehandelt haben, eine Herrin und Bewacherin des Umlandes, bis sie wie so vieles von Iwan dem Schrecklichen und seinen Horden erobert und zerstört worden war. Danach wurde sie in kleinerem Umfang als eine Art Schloss wieder aufgebaut. Nun entstanden Teichanlagen, verspielte Treppen mit Tierallegorien und Putten, ehe das Anwesen in der sowjetischen Zeit wieder verfiel. Aber auch die Sowjetunion ist nun schon wieder Geschichte, nun fließt das Geld für die Restauration der Burganlage aus den Fördertöpfen der Europäischen Union - auch wenn die ersten Raten hier in Cesis erst einmal dazu verwendet wurden, die Monumente der Kommunistenzeit zu verschrotten. So lag ein überdimensionaler Leninschädel in einem offenen Blechcontainer und verrottete umgeben von anderem Propagandamüll verdientermaßen im baltischen Sommerregen.
Aber was hatte all das mit der lettischen Geschichte zu tun? Die deutschen Herren des Livländischen Ordens, die russischen Soldaten, die schwedischen Invasoren, ihre Burgen und Festungen waren Teil der deutschen, russischen oder schwedischen Geschichte und gingen Lettland im Kern nichts an. Nun aber waren endlich nach den Deutschen und Schweden auch die Russen verschwunden, und jene Freiheit hatte Einzug gehalten, an der man sich wie an einem kalter Wind leicht verkühlen konnte. Die Mehrzahl der Letten war weit davon entfernt, die solange entbehrte Freiheit gering zu schätzen, doch sie mussten schnell erkennen, dass die Freiheit wie überall, wo die Marktwirtschaft den Kommunismus beerbt, als erstes eine geradezu schamlose Ungleichheit hervorbrachte. Eines von vielen Kennzeichen dieser neuen Ungleichheit waren die prachtvollen Sommerhäuser, die in den letzten Jahren am Strand von Jürmala entstanden waren, regelrechte Paläste in umschatteten Alleen, von Zäunen und Wächtern umgeben, während sich am kilometerlangen Sandstrand das einfache Volk zusammen drängte.
Als wir am letzten Tag unseres Aufenthaltes in Lettland den Strand von Jürmala entlang schlenderten, stießen wir auf eine Gruppe Punks, die sich am Rand einer Düne niedergelassen hatte. Nach einer Musikveranstaltung in Riga saßen sie nun erschöpft und zugekifft im Sand, jeder für sich ein Unikat und ein Beweis dafür, dass die grenzenlose Individualität nun auch an baltischen Stränden triumphierte. Glatzköpfe, auf denen rötliche Haarbüschel wie die Reste eines halb ausgerissenen Teppichs klebten, kleine Ringe, durch Lippen, Wangen und Kinn gezogen, rot gefärbte Irokesenschnitte und trotz der vom Himmel knallenden Sonne alle unisono in schwarzer Gothic-Kluft drapiert, boten sie einen Anblick, der den lettischen Familien in der unmittelbaren Nachbarschaft erkennbar das Erschrecken in die Augen trieb. Die Gesichter der Jugendlichen waren so leer, als wären ihre Schädel nichts weiter als Fassadenflächen zur möglichst flächendeckenden Bepiercung. Die Freiheit der Selbstinszenierung war wohl zu schnell über diese Jugend gekommen, ihre Ausdrucksformen wirkten wie die unfreiwillige Karikatur ihrer selbst.