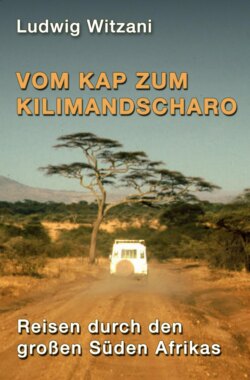Читать книгу Vom Kap zum Kilimandscharo - Ludwig Witzani - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vexierbild der Welten Am Kap der Guten Hoffnung
und in der südafrikanischen Weinprovinz
ОглавлениеDas Ende der Welt hat viele Gesichter. In der Realität und noch mehr in der Geschichte. Im Mittelalter verstand man unter dem Ende der Welt einen Rand, über den die allzu Wagemutigen ins Nichts stürzten. Deswegen blieben die meisten lieber auf festem Grund und wagten sich allenfalls vor bis an die Ränder der Kontinente, bis an die letzten Küsten, jenseits derer alles im Nebel verschwand. So jedenfalls sah es am Capo finisterre aus, dem Urbild aller Kaps im Nordwesten Spaniens. Hier lag für den mittelalterlichen Menschen über dem Ende der Welt ein Vorhang des Schreckens. Der Nebel und die Stürme am Capo finisterre waren deswegen kein Ärgernis sondern ein gnädiger Sichtschutz von den Monstrositäten des Unbekannten.
Das änderte sich mit dem Zeitalter der Entdeckungen. Nun waren die großen Landmarken der Kontinente nur noch Grenzen, die es bei der Erkundung der Welt zu überwinden galt. Fast einhundert Jahre tasteten sich die portugiesischen Seefahrer die Südküste Afrikas entlang - auf das Kap Bojador folgte das Kap Verde, auf das Kap Mount das Kap Cross, bis im Jahre 1488 endlich das letzte Kap erreicht war, eine Region wilder Orkane, jenseits derer der ersehnte Weg nach Indien frei lag. „Kap der Stürme“ nannte der portugiesische Entdecker Bartholomeo Diaz das letzte Kap, das später sein Schicksal werden sollte. Sein König änderte den Namen in „Kap der Guten Hoffnung“. Unter diesem Namen wurde es zu einem Meilenstein der Entdeckungsgeschichte.
Ich begann meine Reise zum Kap der Guten Hoffnung am frühen Morgen in Kapstadt. Es war ein Bilderbuchtag, auch wenn die Morgensonne lauter eingeschlagene Fensterscheiben in der direkten Nachbarschaft des Hotels beschien. Ich lenkte den Wagen über die Küstenstraße nordwestlich um den Signal Hill und erreichte Camps Bay, einen der Nobelvororte Kapstadts, in dem die Reichen und die Schönen noch immer ihren Urlaub verlebten, als hätte es den Wandel am Kap nie gegeben. Malerisch gezackte Berge, die sogenannten „Zwölf Apostel“ zur Rechten, der glitzernde Atlantische Ozean zur Linken, durchfuhr ich eine Landschaft, so harmonisch schön wie es Europa vor der Industrialisierung gewesen sein mochte. Idyllische Orte am Wegesrand, blitzsaubere Straßen und Fassaden in knallbunten Farben bildeten die Kulisse für eine Bilderbuchwelt weit abseits von Townships und Cape-Flats. Kaum Farbige auf den Straßen, lauter wohlhabende dicke Weiße, die am Sonntag in die Kirche gingen. Hoppla, man musste aufpassen, dass einem die Vorurteile nicht die Wahrnehmung trübten. Denn natürlich waren auch Farbige anwesend, allerdings vorwiegend als Polizisten, Kellner, Parkwächter oder Straßenhändler. Sie standen an den Ausfallstraßen, bedienten in den Restaurants und verkauften Schnitzereien, Steine oder Modeschmuck an vorbeireisende Touristen.
Hinter Houts Bay wählte ich den Umweg nach Constantia. Constantia lag im Rücken des Tafelbergmassivs in einem von Bergen umgebenen Tal, durchgrünt, leicht hügelig und üppig bepflanzt, ein Burgund im Bonsai-Format, nur mit einem angenehmeren Klima. Wie eine Armee von Zinnsoldaten standen die Rebstöcke links und rechts der Straße und kontrastierten in ihrer akkuraten Geometrie mit dem unordentlichen Schwung der Palmenblätter. Constantia hielt sich viel darauf zugute, der Ursprungsort des südafrikanischen Weinanbaus zu sein, denn seine Anbautradition reichte bis in die Anfangstage der Kolonie zurück. Simon van der Stel, der zweite Gouverneur und eigentliche Vater der Kapprovinz, hatte hier am Ende des 17. Jahrhunderts mit dem ersten zaghaft betriebenen Weinanbau begonnen.
Als befände man sich in den amerikanischen Südstaaten führte eine mächtige Eichengalerie zum Eingangstor von „Groot Constantia“, dem bekanntesten Weingut der Stadt. Es bestand aus Anbauflächen, Kellereien und Lagerhäusern, sein Schmuckstück jedoch war das Manor, der alte Herrensitz des Gouverneurs. Es war ein Gebäude, so wuchtig und solide, dass es das Ende des holländischen und britischen Imperiums locker überstanden hatte und nun frisch restauriert zur Besichtigung bereitstand. Sein Außenanstrich war in strahlendem Weiß gehalten, seine Reetdächer fielen steil ab, und die Vorderfront wurde von einem zweistöckigen Portal geschmückt. Hinter dem Eingangsberiech befand sich der Cloete Wine Cellar, eine Mischung aus Shop und Museum, in dem sich die Besucher an einer Weinverköstigung laben oder sich über die Geschichte des südafrikanischen Weinanbaus informieren konnten. Die Kurzfassung dieser Geschichte lautete, dass der Sohn Gouverneurs Simon van der Stels mit seinem Weingut bankrott gegangen war und dass sich aus der Vermögensmaße Alt-Constantias fünf Weingüter gebildet hatten (Groot Constantia, Klein Constantia, Buitenverwachting, Constantia Uitsig und Steenberg), deren Weine inzwischen in die ganze Welt exportiert wurden. Eine deutsche Reisegruppe, die mit mir das Weinmuseum besuchte, sprach den Weinproben kräftig zu, ich musste verzichten, denn ich wollte heute noch das Kap erreichen.
Ich verließ Constantia und erreichte bald wieder die Durchgangsstraße zum Kap. Die üppige Begrünung von Camps Bay oder Constantia verschwand, ich hatte das Reich von Protea und Fynbosgewächsen erreicht. Ausgedehnte Flächen von Eiskrautgewächsen schmückten wie ein violetter Teppich die Bergabhänge. Es folgten vom Wind flachgefräste Felsen, ehe die ersten Sanddünen erschienen. Manche Anblicke erinnerten an die marokkanische Kabylei - Afrika, der Kontinent, der im Norden und Süden gleich aussah und in seiner Mitte Schwüle und Tod beherbergte. Immer weiter nach Süden zog sich die Straße, ein langer steinerner Finger aus Geröll und Felsen, an dessen Ende der Wind eine orkanartige Stärke gewann.
Das eigentliche Kap bestand aus einem etwa 250 Meter hohen Berg mit Besuchertribüne und Leuchtturm auf einem flachen Plateau. Kaum hatte ich den Wagen verlassen, ergriff mich der Wind mit solcher Kraft, dass ich fast das Gleichgewicht verloren hätte. „Kap der Stürme“ wäre vielleicht doch der passendere Name gewesen. Selbst die Kabinen der Kabelbahn gerieten durch den Wind in beängstigende Schwingung. Noch schlimmer war es auf dem Besucherplateau, einem Ort, an dem sich keine Frisur und keine Kappe auf dem Kopf behaupten konnten. Karten und Schals flogen durch die Gegend, Kinder stellten sich quer gegen den Wind, ohne umzufallen, der Wind der südlichen Meere schockierte durch seine immense Kraft. Er peitschte die Brecher des Ozeans in immer neuen Wellen gegen die Felsen tief unter uns, es toste und donnerte, und die Gischt leckte wie eine Nebelzunge an den Abhängen des Kap Felsens. Wie viele Schiffe waren hier am Kap der Stürme gescheitert, wie viele Matrosen waren in Sichtweite der Küste ertrunken, wie viele Schätze lagen ungehoben auf dem Meeresgrund? Alles Vergangenheit. Gegenwärtig war nur das tosende Meer, das sich wie ein doppelköpfiges Ungeheuer gebärdete - doppelköpfig, weil hier der Atlantische Ozean und der Indische Ozean aufeinanderstießen, unterschiedlich warm ein jeder und vom Heulen permanenter Windböen begleitet, die vor der gesamten Küste gegeneinanderstießen. Es war ein Hexensabbat der Elemente, der den Betrachter glatt vergessen ließ, dass er überhaupt noch nicht am südlichsten Punkt Afrikas angekommen war. Denn das wirkliche Südkap Afrikas befand sich zweihundert Kilometer weiter südöstlich am unscheinbaren Kap Agulhas, dem Nadelkap.
***
Vom Kap aus führte eine spektakuläre Küstenstraße weiter nach Osten. Spektakulär war die Küstenstraße, weil sie hoch über dem Meer wie angepappt am Berg zu kleben schien - aus der Entfernung ein beeindruckendes Bild, das großartige Aussichten auf das Meer verhieß, aus der Nähe aber eine Herausforderung für Nervenstärke und Fahrkunst. Wie eine Aneinanderreihung spanischer Wände folgte auf der schmalen Straße ein Felsvorsprung dem nächsten, ohne dass zu sehen gewesen wäre, welche Fahrzeuge in der Gegenrichtung unterwegs waren. Manche Fahrer hupten vor den Kurven, andere rasten wie Lebensmüde einfach mit voller Kraft in sie herein. Einmal entging ich nur durch eine Vollbremsung der Karambolage.
Der Ort Muizenburg, den ich nach einer schweißtreibenden Fahrt erreichte, glich einem überfüllten Hollanddorf mit brachialer Musikbeschallung in seiner Strandzone. Es war Sonntag in Südafrika, und jede Menge Ausflügler verstopften die Durchgangsstraßen.
Jenseits von Muizenburg ließ das Verkehrsaufkommen abrupt nach. Wieder einer jener Landschafts- und Stimmungswechsel, an denen Südafrika so reich ist. Plötzlich bestimmten weitgeschwungene Dünenstrände das Bild, ein endlose Reihe feiner weißer Sandhügel vor dem Horizont des Meeres. Ich hatte die False Bay, die „falsche Bucht“ erreicht. Sie hatte ihren Namen erhalten, weil in den Frühtagen der Kapkolonie immer wieder die Segler aus Asien die Bucht mit der Tafelbergbucht von Kapstadt verwechselt hatten. So abwertend der Name der Bucht war, so schön stellte sie sich dem Durchreisenden dar, eine weite großzügige Küstenlandschaft mit weißen Sandstränden, einer flachen Brandung und einer Vorahnung der warmen Luft, mit der der indische Ozean weiter östlich das Klima bestimmen würde. Doch das Schöne nistet in Afrika fast immer in der Nachbarschaft des Gefährlichen. Denn die False Bay war Jagdgebiet des Weißen Hais, des großen Killers der Meere, der alles fraß, was ihm vor das Maul kam und auch bei schwimmenden Menschen keine Ausnahme machte. Paradoxerweise war der Weiße Hai erst in der Bucht aufgetaucht, nachdem sich unter der Federführung engagierter Naturschützer große Robben- und Pinguinkolonien in der False Bay etabliert hatten. Immer wenn der Menschen in die Natur eingreift, geht etwas schief, auch dann, wenn es gut gemeint gewesen war. Das sollte ich in Afrika noch oft lernen müssen.
In Sommerset West am östlichen Ausgang der False Bay gab es keine besondere Sehenswürdigkeiten zu besichtigen, wenn man einmal von der grandiosen Aussicht auf die Bucht absah. Weit im Westen verschwand die Kap Halbinsel im abendlichen Dunst, im Osten erglänzten die Abhänge der Hottentotten-Holland-Mountains im Licht der niedergehenden Sonne.
***
Ursprünglich war nur ein Bruchteil des weltweiten Pflanzenbestandes landwirtschaftlich nutzbar. Der frühe Mensch bewegte sich in einer Flora von 200.000 unterschiedlichen Wildpflanzen, mit der er kaum etwas anfangen konnte. Erst im Laufe der Entwicklungsgeschichte veränderte er das Gesicht der ihn umgebenden Natur. Die nutz-losen Pflanzen wurden reduziert, die Flächen, auf denen Nutzpflanzen wuchsen, nahmen zu. Heute sind es gerade mal einige Dutzend Nutzpflanzen, auf denen die menschliche Ernährung im Wesentlichen beruht. Jarred Diamond hat in seinen Büchern diesen Prozess der kulturellen Überformung der Natur eindringlich beschrieben (Arm und reich S. 137ff.). Es war nichts anderes als die Umwandlung undomestizierter Natur in einen großen Garten des Menschen.
Nirgendwo sonst in der Welt konnte man den ästhetischen Mehrwert, den diese kulturelle Überformung der Natur hervorbrachte, anschaulicher beobachten als in der südafrikanischen Weinprovinz. Schon lange bevor ich Stellenbosch, eines der drei Zentren der südafrikanischen Weinprovinz erreichte, war die Verwandlung der Landschaft unverkennbar. Als passierte ich ein afrikanisches Auenland zogen lieblich gewellte Hügel, Bewässerungsanlagen und kleine Gehöfte mit weißgekalkten Häusern vorüber. Afrikanisch waren nur der azurblaue Himmel und die Palmenhaine zwischen den Weingütern, der Rest war ein mixtum compositum europäischer Landschafts- und Siedlungsformen. Ich sah blauweiße, gelbweiße und knallweiße Hollandhäuser, zauberhafte kleine Kirchen mit verspielten Glockentürmen, gepflegte Parks, kleine Cafés und Hotels am Rande lauschiger Plätze. Kaum zu glauben, dass sich nur eine Autostunde westlich von Stellenbosch die Townships von Kapstadt befanden.
Das touristische und wirtschaftliche Herz von Stellenbosch schlug in der Dorpstraat. Hier präsentierten Dutzende von Winzern und Kooperative die Produkte, um die sich alles in Stellenbosch drehte: Chardonnay, Pinotage, Sauvignon Blanc, Shiraz, Cabernet Sauvignon und Merlot, die sogenannten „Big Six“ des südafrikanischen Weines, die als Rebsorten den weitaus größten Teil des südafrikanischen Weinexportes ausmachen.
Ich nahm ein Zimmer in einem kleinen Hotel in der Innenstadt, nicht billig aber sauber und ruhig, geführt von einer älteren Dame, die mich wie einen verirrten Wanderer aufnahm und mir zur Begrüßung eine Flasche Wein aufs Zimmer bringen ließ. Es war ein runder, vollmundiger Chardonnay mit einem samtenen Abgang und einer zarten Pfirsisch-Note, der mir so gut schmeckte, dass auf das erste Glas sogleich das zweite folgte und es nicht lange dauerte, bis die Flasche leer war. Danach spürte ich eine mächtige Woge der Müdigkeit in mir aufsteigen, verbunden mit einem allumfassenden Einverständnis mit der Welt, das ich als Grundgefühl mehr als alles andere liebe. Ich legte mich aufs Bett und schlief ein.
Am nächsten Morgen spazierte ich nach dem Frühstück durch die Stadt. Heute war der Eindruck der Unwirklichkeit möglicherweise noch stärker. Befand ich mich wirklich in Afrika oder in einer Kunststadt, einem fake, das man mit seinen bunt angemalten Häuserfassaden nach Afrika verpflanzt hatte. Wie ich im „Village Museum“ auf der Ryenefeld Straat aber lernen konnte, stimmte das nicht. Stellenbosch war die Heimat von Weißafrikanern, die schon seit Jahrhunderten am Kap ansässig waren und hier als Sprösslinge des Niederländischen, Niederdeutschen und Französischen ein Stück Europa weitab von ihrem Mutterkontinent errichtet hatten.
Die Geschichte dieser Weißafrikaner wurde in den großen restaurierten Hollandhäusern lebendig. Mit ihren dicken Wänden, offenen Kaminen, wuchtigen Balkenkonstruktionen und schweren Möbeln wirkten sie wie Symbole für die Beharrlichkeit des weißen Menschenschlags am Kap. Schon der zweite Gouverneur der Kapprovinz, der Holländer Simon van der Stel, hatte mit der Ausweitung der Kapkolonie und der Erkundung der Umgebung begonnen. Nicht einmal einhundert Kilometer östlich der Tafelbucht war er auf ein fruchtbares Tal gestoßen, in dem er Gemüse, Obst und Wein anbauen ließ und eine Stadt mit seinem Namen gründete – eben Stellenbosch, die zweitälteste Stadt des afrikanischen Südens. Die ersten Reben von Stellenbosch aber gediehen so schlecht, dass sie sogar von den räuberischen Affen verschmäht wurden, die sich jede Nacht über die Felder der Kolonisten hermachten. Erst die Einwanderung hugenottischer Winzer sollte den südafrikanischen Weinanbau professionalisieren, wenn auch niemand in den altvorderen tagen damit gerechnet hätte, dass südafrikanische Spitzenweine im 21. Jahrhundert Preise auf den Weinmessen der Welt gewinnen würden.
Im Sellenryk Weinmuseum an der Dorpstraat kam ich mit einem Angestellten des Weinmuseums ins Gespräch. Er hieß nicht nur Piet sondern sah auch noch aus wie ein waschechter Holländer mit flachsblonden Haaren, Sommersprossen und tiefliegenden schmalen Augen, die schon jede Menge guter und schlechter Weinernten gesehen hatten. Er erklärte mir geduldig die Funktion der alten Weinpressen, die verschiedenen Phasen der Flaschengärung und am Ende auch das Geheimnis des südafrikanischen Weins. „Der südafrikanische Wein ist so gut, weil er es nicht einfach hat“, begann er. Denn im Unterschied etwa zu den kalifornischen Weinen, die wegen des notorischen Wassermangels einer permanenten Tropfenbewässerung unterlägen und deswegen ihren Feuchtigkeitsbedarf jederzeit decken können, würde die südafrikanischen Spitzenweine prinzipiell nicht künstlich bewässert. Wenn der Regen einmal ausbliebe, müssten die Reben eben sehen, wie sie damit fertig würden. Die südafrikanischen Rebsorten erlebten also während ihrer Reifung viel mehr „Stress“ als andere Weine, so dass ihr Geschmack intensiver und individueller würde. Das Klima fordere den Wein, und das sei gut für ihn beendete er seine Darlegung. Ein wenig Stress schadet eben nicht, fügte er hinzu. „Weder beim Wein noch beim Menschen.“ Das leuchtete mir ein und ich erwarb zwei Chardonnay für die Weiterreise.
Nur eine dreiviertel Stunde dauerte die Fahrt von Stellenbosch nach Franshoek („Franzosenecke“), dem Zentrum der hugenottischen Traditionen im südlichen Afrika. Hier war die Außenansicht des Weinlandes womöglich noch spektakulärer als in Stellenbosch. Wuchtige Hollandhäuser mit ihren stattlichen Portalen standen inmitten sorgfältig angelegter Weinfelder. Gartenanlagen und Palmengalerien überragten die Weinkontore. Auf der Hauptstraße von Franshoek warben Weingüter wie „La Dauphine“ , „La Motte“, „Champagne“, „Bourgogne“ oder „Provence“ für ihre Erzeugnisse, in den Bäckereien lagen Baguettes und Croissants in den Körben, französischer Käse befand sich ebenso im Angebot wie Cassolet oder Charolais - man hätte glauben können, Südfrankreich sei an das Ende Afrikas verlegt worden. Das Preisniveau lag wahrscheinlich noch höher, wie ich bei der Anmietung meines Hotelzimmers bemerken musste. Allerdings war der demonstrative Bezug zu Frankreich rein deklamatorisch, die Umgangssprache auf den Straßen oder in den Geschäften war ausschließlich Englisch oder Afrikaans.
Welche lange und wechselvolle Geschichte diese französische Enklave im Süden Afrikas besitzt, wurde im Hugenottenmuseum von Franshoek dargestellt. Mit einem Federstrich hatte der französische König Ludwig XIV im Jahre 1685 das von seinem Großvater Heinrich IV erlassene Toleranzedikt von Nantes aufgehoben und den Katholizismus zur alleinigen Staatsreligion erhoben. Wer von den etwa 750.000 französischen Protestanten, den Hugenotten, nicht konvertieren wollte, wurde ausgewiesen. Etwa 200.000 Menschen, meist Angehörige gehobener Berufe, zum Teil auch Adlige, verließen daraufhin das Land. Ein gewaltiger Aderlass setzte ein, der Frankreich langfristig mehr schwächen sollte als alle Eroberungskriege Ludwigs XIV zusammengenommen. Die meisten Hugenotten fanden Zuflucht in der Schweiz, Brandenburg-Preußen, Großbritannien und skandinavischen Ländern. Nur eine verschwindende Minderheit, gerade mal 187 Familien, entschloss sich, das Angebot der holländischen Ostindienkompanie anzunehmen und zum Kap der Guten Hoffnung auszuwandern. Auf langen Listen waren im Hugenottenmuseum von Franshoek die Namen der ersten Siedler vermerkt, die auf insgesamt vier Schiffen 1688 Kapstadt erreicht hatten. Sie stammten überwiegend aus Flandern, aber auch aus den Weinregionen des Languedoc, der Provence und der Dauphine. Die Arbeitsverpflichtung, die mit der Passage verbunden war, umfasste einen Zeitraum von fünf Jahren, nach denen man auf eigene Kosten, nach Europa zurückkehren konnte. Tatsächlich erhielten die Hugenotten von Gouverneur Simon van der Stel im sogenannten Elefantental („Oliphantstrek“) hinreichend Land zur Bearbeitung, wenngleich die versprochene Unterstützung an Werkzeugen und Baustoffen zu wünschen übrig ließ. Doch die Hugenotten, im Unterschied zu den meisten Bewohnern der Kapkolonie, landwirtschaftlich kompetente Fachkräfte, kamen zurecht und wussten das günstige Mikroklima von Franshoek für den Weinanbau zu nutzen.
Allerdings gab es bald Ärger, weil die Franzosen auf die Pflege ihrer Traditionen bestanden und nicht im Holländertum der Kolonie aufgehen wollten. Erst nachdem ab 1713 jede weitere Einwanderung von Franzosen gekappt worden war, begann ein langsamer Prozess der Afrikanisierung, in deren Verlauf viele Hugenotten ihre Namen änderten. So entstammte zum Beispiel der südafrikanische Friedensnobelpreisträger de Klerk, der mit Nelson Mandela das Ende der Apartheid ausgehandelt hatte, aus der Hugenottenfamilie der Leclerc.
Der Weinanbau von Franshoek vollzog sich zunächst in einem bescheidenen Rahmen. Der südafrikanische Wein wurde entweder im Land getrunken oder den Schiffen der holländischen Ostindienkompanie als Handelsware für Asien mitgegeben. International bekannt wurden die Weinbauern vom Kap erst, als infolge der napoleonischen Kolonialsperre in Europa der französische Wein knapp wurde und man auf die Konkurrenz vom Kap aufmerksam wurde. Aber das waren alles nur Peanuts im Vergleich zu dem rasanten Aufstieg, den die südafrikanische Weinindustrie, namentlich die Erzeugnisse von Franshoek, nach dem Ende der Apartheid nahmen. Nachdem man jahrzehntelang die Produkte des Apartheidstaates mit gutem Gewissen boykottiert hatte, griff man nun im Westen gerne zum guten Tropfen aus Franshoek oder Stellenbosch und bemerkte, dass sie genauso gut schmeckten wie die Qualitätsweine aus Frankreich oder Italien, aber erheblich preiswerter waren. Auch die Befürchtungen, die neue ANC-Regierung würde der südafrikanischen Weinindustrie mit Verstaatlichungen und Regulierungen zu Leibe rücken, entpuppten sich als unbegründet - im Gegenteil: der südafrikanische Weinanbau gehört inzwischen als exportintensive Erfolgsgeschichte neben dem Rohstoffsektor und dem Tourismus zu den staatlich gehätschelten Devisenbringern des Landes.
Aus Anlass der zweihundertfünfzigsten Wiederkehr der Ansiedlung der Hugenotten in Franshoek war im Jahre 1938 das sogenannte Hugenottenmonument errichte worden. Es befand sich am Ortsausgang von Franshoek vor der imposanten Kulisse eines steil abstürzenden Berghangs inmitten eines verschwenderisch begrünten Gartens. Vor einer sichelförmig gebogenen überdachten Arkade und vier stilisierten Säulen stand eine Art protestantische Maria auf einer Weltkugel, auf der undeutlich zu erkennen war, wie Schiffe Europa verließen, um nach Süden zu segeln. In ihrer rechten Hand hielt sie eine Bibel, in der linken ein Stück gesprengter Ketten zum Zeichen dafür, dass die Hugenotten ihre Heimat um der Glaubensfreiheit willen verlassen hatten.
Diese Glaubensfreiheit hatten sie in ihrer neuen Heimat Südafrika gefunden, wenngleich es inzwischen mit der Sicherheit nicht mehr zum Besten stand. Als ich am nächsten Morgen in der Bank von Franshoek Geld wechselte, kam ich mit einer Frau ins Gespräch, die mich fragte, woher ich käme. Sie hatte ein gut geschnittenes Gesicht, sah aber erschöpft aus. Ohne dass ich sie danach gefragt hätte, teilte sie mir mit, dass sie das Land bald verlassen würde. Inzwischen sei die Kriminalität auch in der Weinprovinz angekommen. Nachts durchstreiften Banden die Felder und Weingüter und raubten, was nicht niet- und nagelfelst sei. Wer das Pech hatte, ihnen dabei zu nahe zu kommen, würde einfach umgebracht. Die Polizei sei völlig überfordert, und die Gebühren für die privaten Wachtdienste seien inzwischen so teuer geworden, dass sich die meisten Menschen diesen Schutz nicht mehr leisten könnten. „Be careful“, gab sie mir mit auf den Weg, als sie sich verabschiedete und in einer Seitengasse verschwand.
Paarl, die dritte bedeutende Weinstadt Südafrikas, war vom Städtebaulichen her wenig einladend - eine Kirche, einige Museen, einige ansehnliche alte Häuser, aber auch viel Zersiedlung und Industrie an den Rändern. Allerdings war die Lage der Stadt attraktiv, sie lag im Schatten der rostroten Paarl Mountains, einem Gebirgszug, von dem es hieß, seine Felsen würden nach dem Regen wie große Perlen („Paarl“) leuchten. An diesem Tag aber gab es keinen Regen, die Sonne knallte von einem wolkenlosen Himmel, und die Vegetation in den Hügeln rund um Paarl zeigte Zeichen von Verdorrung. Die trockene Karo des Binnenlandes deutete sich an.
Ich fand ein Zimmer im Privathaus einer Lady, die mich mit wallenden Gewändern und lila lackierten Fingernägeln empfing. Ihre Haare waren rot gefärbt, auf ihren Wangen bildete das Rouge klar umrissene Inseln. Das Zimmer, das sie mir anbot, besaß einen Gartenzugang, war aber zur Hälfte mit Schondecken über Möbelstücken verhüllt, von denen mir eingeschärft wurde, dass ich sie auf keinen Fall lupfen durfte. Nur das Bett, ein Stuhl und der Tisch waren frei, doch der Preis stimmte, und den Besuch des Hausdackels gab es gratis. Leider litt der Dackel an einem Einsamkeitskoller, er folgte mir auf Schritt und Tritt und jammerte vor der Türe, wenn ich im Bad war. Das Frauchen saß die meiste Zeit im Garten, trank Weißwein und rauchte. Wie sie erzählte, war sie seit einigen Jahren verwitwet, lebte nun allein in den Hügeln von Paarl und besserte ihr Einkommen durch gelegentliche Vermietungen etwas auf. Ein Bild ihres verstorbenen Mannes konnte ich im ganzen Haus nicht entdecken, dafür trug sie um den Hals eine Schnur, an deren Ende eine Pfeife befestigt war. Diese Pfeife, hatte ich schon verschiedentlich in Stellenbosch und Franshoek gesehen. Nun erfuhr ich, dass sie als Notfallpfeifen dazu dienten, im Falle eines Überfalles Hilfe zu rufen. Leider machten sich die Kinder von Paarl inzwischen einen Jux daraus, sich solche Pfeifen zu besorgen und grundlos auf ihnen herumzupfeifen, so dass es immer wieder blinden Alarm gäbe.
Die meisten Besucher kamen nach Paarl, um das Afrikaanermonument zu besichtigen, ein futuristisch anmutendes Denkmal, das sich auf einem Höhenzug oberhalb der Stadt befand und an die Entstehung der Sprache Afrikaans erinnerte. Das Afrikaans war eine Abart des Niederländischen, entstanden auf einsamen Farmen im Grenzbereich der Kapprovinz, wo die Bewohner mit der Zeit den Kontakt zum Niederländischen verloren und zahlreiche Lehnworte aus der Khoisan- und der Xhosa-Sprache sowie dem Malaiischen aufgenommen hatten. Als die Briten die Herrschaft am Kap übernahmen, entwickelte sich Afrikaans zur burischen Konkurrenzsprache gegenüber dem Englischen. Im Jahre 1925 wurde Afrikaans im Zuge der „kleinen Apartheid“ sogar zur zweiten Landessprache neben dem Englischen erhoben. Dass von da an auch die Schwarzafrikaner Afrikaans, die Sprache der Buren, in den Schulen lernen mussten, hatte immer wieder zu Unruhen und Aufständen gegen die Apartheid geführt, am brisantesten in Sharpeville, wo im Jahre 1960 neunundsechzig Personen bei einem Protestmarsch gegen die Zwangsunterweisung in Afrikaans erschossen worden waren. Wie eine trotzige Bekräftigung des Apartheidsregimes war noch im Jahre 1975 das Afrikaanermonument von Paarl zum Gedenken an das fünfzigjährige Jubiläum der Erhebung des Afrikaans zur Landessprache errichtet worden.
Inzwischen war das Apartheidsregime verschwunden, doch das Afrikaanermonument existierte noch immer. Es bestand aus vier unterschiedlich hohen Pfeilern, die die vier Quellen des Afrikaans darstellen sollten. Der höchste Pfeiler, der immerhin 57 Meter maß, stellte den germanischen, besser: den niederländischen Ursprung des Afrikaans dar. Ihn umstanden drei kleinere Pfeiler, die an die Einflüsse der Khoisan Sprache, des Xhosa und des Mailaiischen erinnerten. Dass das Afrikaanermonument nach dem Machtwechsel am Kap nicht abgerissen worden war, hatte damit zu tun, dass Afrikaans längst nicht mehr nur von Weißen, sondern auch von Millionen Schwarzafrikanern gesprochen wurde. Sie hatten diese Sprache während des Apartheidsregimes unter Zwang gelernt, nun aber sprachen sie sie halt und hatten sie als Teil ihres Lebens anerkannt. Mittlerweile belegte Afrikaans unter den elf offiziellen Landessprachen Südafrikas nach Xhosa, Zulu und Englisch den vierten Rang.
Ehe ich an die Küste zurückkehrte, unternahm ich einenletzten Abstecher nach Worchester gut siebzig Kilometer von Paarl entfernt. Schon während der Fahrt nach Nordosten verschwanden die freundlichen Wiesen und farbenfrohen Blumenteppiche. Geröllfelsen ohne jeden Bewuchs standen wie Wächterfiguren an der großen Ausfallstraße zur Karoo, der Vegetationszone des südafrikanischen Binnenlandes, die von nun an fast anderthalbtausend Kilometer lang das Landschaftsbild bis Johannesburg bestimmte.
Schon lange bevor die Briten die Macht am Kap übernommen hatten, waren burische Siedler im 18. Jahrhundert in der Umgebung des heutigen Worchester ansässig geworden. Im Freilichtmuseum von Worchester war ein komplettes kleines Grenzdorf wieder aufgebaut worden, in dem die altburischen Tage so genau und originalgetreu wie möglich wieder zum Leben erweckt wurden. Als Pioniere drapierte Museumsangestellte mahlten das Mehl, backten in den Backsteinöfen das harte Brot der Grenze und droschen das Heu mit alten Dreschen. Man sah Aloezäune, Vorrichtungen zum Trocknen der Tabakblätter und jede Menge Vieh in den Ställen. Dass es vorwiegend schwarzafrikanische Bedienstete waren, die diese virtuelle Realität zum Leben erweckten, passte ins Bild, denn auch die burischen Grenzer hatten ihre Farmen auf der Grundlage der Sklaverei betrieben. Als die Briten die Sklaverei am Kap verboten, hatten viele Buren auch aus Worchester ihre Habe auf große Planwagen verpackt, um sich weit weg von der gottlosen britischen Kapkolonie ein neues gelobtes Land zu suchen.