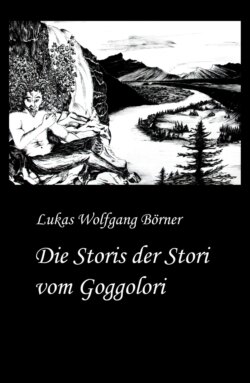Читать книгу Die Storis der Stori vom Goggolori - Lukas Wolfgang Börner - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDie Bestie im Berg
ein Rheinmärchen
Traum
Wände zittern!
Jäh erschüttern
dich die Schreie,
es zu füttern.
Nimmermehr!
Du möchtest fliehn!
Ohne rasten
wirst du hasten,
panisch nach dem
Ausgang tasten –
du indes
vermauerst ihn.
*
Ein Hoffnungsstreif
ls es bereits unerträglich war und die Wände hoch in den Himmel hinaufragten und allein das Rauschen des Rheines noch von seiner Existenz zeugte, fiel ein Schatten in dein Felsengefängnis und jäh zeichnet sich ein Gesicht gegen den grellblauen Himmel ab. Du stutzt und streichst dir hastig den Schmutz vom Hemde.
„Huch? Was tust du denn da unten – in jenem grausigen Labyrinthe?“, ertönt eine Stimme und ist die Stimme eines blutjungen Mädchens.
„Und was tust du dort oben?“, rufst du zurück und erbebst beim Klange deiner eigenen Stimme, die du doch so lange nicht mehr hörtest.
„Ich wollte mir die Burg auf dem Gipfel des Berges besehen“, erwidert es. „Sie scheint mir ja gänzlich verlassen zu sein.“
Du zauderst.
„Die … Burg steht noch?“, rufst du, aber nur, um das Mädchen zu halten. Mit zusammengekniffenen Augen musterst du es. Ein schwarzer Regen ist sein Haar, sein Gesicht ein Hoffnungsstreif. „Gewiss ist es eine bloße Ruine.“
Das Mädchen schüttelt heftig den Kopf. „Es sieht keineswegs einer Ruine gleich – die Türme stehen ja fest in ihrem Sockel und die Zinnen sind vollständig.“
Nachdenkliches Schweigen.
Erst nach einer Weile fügt es hinzu: „Ist es deine Burg?“
Du nickst und weißt nicht, ob es das Mädchen gesehen hat. „Durchaus ist es meine Burg.“
„Was tust du dann dort unten?“
Was tust du dann dort unten?
Solltest du dem lieblichen Geschöpf die Wahrheit sagen? Dass du in den Spalten und Furchen deines Berges so lange nach Schätzen grubst, dass du zuletzt ein Gefangener deiner Selbstsucht wurdest? Das aber würde das Ende der Unterhaltung bedeuten.
„Ich bin in die Tiefen des Labyrinths gestürzt und werde letztlich hier verschmachten. Es gibt zwar Pilze und durchaus schmackhafte Moose und das Rheinwasser plätschert weiter unten über die Felswände …“
„Ich kann dir helfen heraufzukommen“, unterbricht dich das Mädchen. „Ich hole ein Seil. Und dann können wir gemeinsam zu deiner Burg hinaufsteigen.“
Das Blut pocht dir in den Schläfen.
„Das … das würdest du tun?“
„Ich bin gleich wieder da!“
„Aber du kennst mich doch gar nicht!“
„Adieu!“
„Aber du kennst mich doch gar nicht!“
Stille.
*
Der letzte Ausweg ist das Seil
Ein Seil weckt dich aus dem Schlummer. Das Rot des Abends hat dem Nachtblau indes platzgemacht, drei Sterne blicken auf dich hernieder. Höhnisch. Unwillkürlich knotest du eine Schlaufe in das Seil.
„Was tust du da?“
Die Mädchenstimme durchfliegt wieder die Gänge. Du siehst auf, siehst in sein pausbäckiges Antlitz, schämst dich.
„Darin kann ich mich besser festhalten“, lügst du. „Aber du wirst das Seil kaum halten können.“
„Ich habe es um einen Eschenbaum gebunden“, erwidert es nicht ohne Stolz. Du hörst es kichern. Du … liebst dieses Mädchen.
„Komm schon!“, ruft es.
Hat es denn keine Angst? So allein im Gebirge bei Einbruch der Nacht? Weiß es denn nicht, wie gefährlich das ist?
Du kannst den Blick nicht von ihm lösen. Wie alt wird es sein? Sechzehn? Siebzehn? In jedem Fall muss es eine wohlbehütete Kindheit hinter sich haben.
„Nun komm schon!“
Du ergreifst das Seil, rührst dich aber nicht.
„Wieso hilfst du mir?“
„Wieso? Du bist in Not. Wieso sollte ich dir nicht helfen? Zumal du mich zum Dank durch die Gemächer der Burg führen kannst.“
Du ziehst dich am Seil hinauf, die Schuhe auf der Felswand. Bisweilen rutschst du an den schlüpfrigen Moosen ab, taumelst – und kommst der Kante doch Schritt für Schritt näher. Das Seil aber reibt sich an den äußeren Steinzacken, über die es gespannt ist, auf. Du hörst, wie Faden um Faden dem Strange untreu wird.
„Es ist nimmer weit“, ruft das Mädchen.
Du weißt, dass es noch weit ist – und dennoch tut es wohl, eine liebevolle Stimme zu hören.
„Nur mehr ein paar Schritte.“
In der Mitte verzagst du schier, gehst ins Hohlkreuz, forderst den Herrgott heraus. Aber das Mädchen streckt sein Händchen nach dir aus und du fasst neuen Mut.
Was wäre es wohl für ein Gefühl, wieder oben zu sein? Auf dem Berge zu stehen, den hehren Rhein dahinfließen zu sehen, deine Burg und deine Kammern wieder zu betreten – frei zu sein?
Das Seil will reißen. Nicht jetzt! Bitte nicht jetzt!
„Nimm meine Hand!“, hörst du die Stimme. Sie ist ganz nah.
Das Seil reißt, du aber tust einen Satz und bekommst die ausgestreckte Hand zu fassen.
„Ich hab dich! Ich hab dich!“, rufst du.
Du lachst, das Mädchen aber kreischt. „Herrje! Du bist zu schwer! Du bist zu schwer!“
Es versucht, sich am oberen Seilstück festgehalten, aber zu spät – schon stürzt es mit dir in die Tiefe.
*
Die Bestie erwacht
Das Mädchen liegt in deinen Armen. Nicht kosend, sondern angstgelähmt. Denn eben dröhnt es in den Untiefen des Labyrinths, dass die Felsen beben.
„Was ist das?“, wimmert es.
Seine Brüste drücken sich fest gegen deinen Bauch, du versenkst bestürzt die Nase in seinem Haar. Nach der Sonne duftet es, nach der Sonne und dem Abendwind. Und der süßesten, vollkommensten Weiblichkeit.
„Das ist die Bestie“, erwiderst du.
„Die B-Bestie?!“
„Ein Untier ist es, ein Scheusal. Eine zottige, grimme Kreatur.“
„Aber was … was will sie?“
„Jungfernblut will sie. Immerzu will sie Jungfernblut.“
„Jungfernblut?“
Das arme Mädchen dauert dich, wie es so weint und sich festkrallt, derweil das ferne Brüllen sich verstärkt.
„Es muss dich gewittert haben.“
Das Mädchen löst sich von dir, sucht die Felswand emporzuklettern. Du hilfst ihm – aber nur um ihm die Ausweglosigkeit der Lage vor Augen zu führen.
„Oh Gott, oh Gott, oh Gott!“
Eben entfernt sich das Gebrüll, doch du weißt, dass die Bestie bloß einen Umweg im Labyrinth nimmt, sich in wenigen Augenblicken aber umso schneller nähern wird.
„Gibt es denn keinen Ausweg?“, jammert das Mädchen. Sein rundes Gesicht ist blasser als der Mond des Nachthimmels. Du blickst auf. Alle Sterne sind zusammengekommen, sich am Unglück des Mädchens zu laben.
„Ich habe schon unzählige Male nach einem Ausweg gesucht. Allein – es war stets vergebens.“
„Frisst das Biest denn wirklich jedes Mädchen, das es in die Krallen kriegt?“
„Jede Jungfer“, verbesserst du es, ohne ein Zucken deines Mundwinkels unterdrücken zu können. Das Mädchen starrt dich an. Hellwach ist sein Blick.
„Er frisst nur Jungfern?“, fragt es. „Keine …“ – es zögert und fährt mit gedämpfter Stimme fort – „… keine Frauen?“
Dein Nicken geht im tosenden Gebrüll unter. Steinsplitter prasseln von den Wänden, mit weit aufgerissenen Augen sucht das Mädchen deinen Blick.
„Dann lass uns um Himmels willen keine Zeit verlieren!“, schreit es, unwillkürlich seinen Rock hochreißend. Mit einer Hand deutet es dir an, die Hose auszuziehen.
Der Gestank des nahenden Raubtiers treibt dir die Tränen in die Augen. Nichtsdestotrotz erregt dich die jähe Nacktheit des Mädchens.
Als die Bestie um eine Ecke stürmt, sitzt die Liebliche bereits auf dir. Ein Suchen, ein Ruck, ein spitzer Schrei!
Und die Bestie entfernt sich so schnell, wie sie gekommen ist.
*
Deine Frau und du
Und was seid ihr nicht schon durch die Gänge des Labyrinths gewandelt! Und habt doch all die Tage und Monate keinen Überblick über die vielfach verschlungenen, nach oben und unten führenden Wege gewinnen können. Allein an den Ort des Stelldicheins kamt ihr immer wieder zurück. Von der Bestie indes fehlte jede Spur.
„Wo gibt es Wasser?“, waren die ersten Worte deiner Frau gewesen, sowie sie ihr neues Zuhause nicht wenig beklommen begutachtet hatte.
Und du hattest dir das Blut mit feuchten Moosen vom Leibe gewischt, sie an der Hand gefasst und in die tiefsten Schlüfte des Berges geführt. Und überall hatte sie innegehalten und auf die Bestie gelauscht, doch allein das Tröpfeln der jungen Stalaktiten war an ihr Ohr gedrungen. Du aber führtest sie weiter hinab und den einzigen Weg entlang, den du gleich deiner Westentasche kanntest – denn ein unscheinbar bunter Glanz geht von seinem Ziele aus. Bald bliebst du in dem gewaltigen Höhlengewölbe stehen, das von fluoreszierenden Quarzen in maigrüne und violette Farben getaucht wird, und lachtest angesichts des offenen Mundes deiner Geliebten. Und beobachtetest mit Ergötzen, wie sie an das Wasser herantrat, das glatt wie ein Spiegel die gegenüberliegende Höhlenwand hinabregnete und im porösen Gestein verschwand, und wie sie die Verdopplung der bunten Pracht und Größe des Gewölbes bestaunte.
„Es ist ja wunderschön“, flüsterte sie endlich und ihre Lippen zogen die letzte Silbe tonlos in die Länge.
„Es ist nicht viel, was ich dir bieten kann“, erwidertest du. „Mit den Bergen und Tälern, den Burgen und dem hehren Rheine kann es durchaus nicht mithalten, gleichwohl … “
Gleichwohl standet ihr lange, fest umschlungen vor dem glatten Wasserfall und betrachtetet eure farbenfroh tanzenden Gesichter.
Und ihr aßt die Pilze und Moose des Labyrinths und zähltet des Nachts die Sterne am fernen Himmel und suchtet, nicht an die Gefangenschaft oder die grimme Bestie zu denken, derer ihr ausgeliefert wart.
Erst, als sich dein Liebling über den gleich einem Felsvorsprung gerundeten Bauch strich und sprach, dass sie ein Kind erwartete, tat dein Herz einen schmerzvollen Sprung.
„Was meinst du“, frugst du beklommen, nicht imstande, auch nur für einen Augenblick den freudig Überraschten zu mimen, „welches Geschlecht mag das Kind wohl haben.“
Da aber lachte sie: „Ein Mädchen wird es ohne allen Zweifel! In unserer Familie gab es immer nur Mädchen. Neun Schwestern waren wir daheim und selbst meine Urahne …“
Aber du hörtest nicht mehr zu. Es gellte dir in den Ohren bei dem Gedanken, wie lange es wohl dauern mochte, bis die Bestie wieder erwachen würde.
Es gab ja keine Möglichkeit, das Kind zu schützen, keine Möglichkeit zu fliehen, kein Schwert und keine Waffe, die Bestie zu bekämpfen.
Allein die Hoffnung, doch einen Knaben zu bekommen, bleibt dir indes.
*
Die Flucht
Doch wann immer das Kind im Bauche deiner Liebsten strampelt, wann immer es gegen die streichenden Hände tritt, so schält sich ein dämonisches Brummen aus der Stille des Labyrinths, so tief und dröhnend, dass die Steinsplitter auf dem Boden tanzen – und deine Hoffnungen auf einen Knaben liegen brach.
Du wirst still, wirst schwermütig, kannst die Freude deiner Frau auf ihren Nachwuchs nicht erwidern, denn immer häufiger hörst du die Bestie. Des Nachts, wenn du mit ihr – deiner Liebe, deinem Leben – umschlungen unter den Sternen liegst und sie zufrieden neben dir schlummert, hörst du das Ungeheuer die entsetzlichen Nüstern weiten und Witterung aufnehmen – und möchtest schier vergehen vor Angst.
Dann spürst du die kleinen Fäuste, wie sie gegen die Wand des Bauches ankämpfen. Wie tapfer du bist, meine Kleine, denkst du. Wie oft habe ich nicht das Nämliche probiert.
Aber, denkst du weiter, habe ich es wirklich probiert? Habe ich wirklich alles versucht? Oder waren die Versuche zuletzt nicht doch recht halbherzig gewesen?
Und du prüfst wieder und wieder die Höhe der Wände und du fragst dich, ob man die Bestie nicht töten könnte, um über ihren toten Leib die Freiheit zu ersteigen. Aber, so sehr du es auch drehst und wendest, es gibt weiß Gott keine Möglichkeit, sie zu töten.
Und dir kommen die Worte eines Traumes in Erinnerung, des letzten Traumes deiner Einsamkeit: „Ohne rasten wirst du hasten, panisch nach dem Ausgang tasten – du indes vermauerst ihn.“
Dann setzen die Wehen ein. Dein Liebling drückt unter Schmerzen die Augen zu, du streichst ihr über den Rücken, fühlst dich hilflos. Sie aber ist so tapfer. Stoisch atmet sie und überhört das ferne Schnaufen der Bestie.
In deinem Kopfe tobt ein Unwetter – nur noch wenig Zeit bleibt euch zur Flucht, das Töchterchen steht schon vor dem Eingang und wippt ungeduldig mit dem Fuße.
„Du indes vermauerst ihn.“
Stehe ich mir wirklich selbst im Wege?
„Ich meine, es geht los“, spricht deine Frau – ach, so gemessen, so tapfer.
„Was kann ich für dich tun?“, rufst du.
Sie dreht sich auf die Seite, zieht sich hoch, tappt von einer Höhlenwand zur andern. „Wasser“, sagt sie. „Kannst du mir etwas Wasser holen?“
Und du eilst los, dem stummen Glanze nach zur Wasserwand, den Lehmbecher in der Hand. Und du füllst ihn, beim Anblick deines Spiegelbilds erschaudernd. Leichenbläue zuckt auf deinen Lippen, die Augen sind zwei offene Wunden.
Du eilst zurück, die Gänge hinauf, keuchst und schwitzt. Doch nicht die Anstrengung macht dich schwitzen – die Bestie ist es, deren heiseres Schnaufen sich bereits wieder nähert.
Erst als du deiner Frau, die noch immer hin- und widerläuft, den Becher überreichst, kommt dir ein Gedanke.
Der Spiegel … der Spiegel!
„Komm mit mir!“, rufst du, dass der Becher krachend zu Boden fällt.
„Wohin?“, erwidert sie.
„Hinab, hinab! Ins Wassergewölbe!“
„Warum?“, fragt sie und rührt sich nicht, indes die Wände links und rechts erbeben. „Ich brauche Luft!“
„Hinab, hinab!“, schreist du. „Luft sollst du bekommen! Aber nun beeile dich! Um Himmels willen beeile dich!“
Und du packst die Schwangere, schiebst sie den Gang entlang, suchst sie zu stützen. Eben noch wollte sie protestieren, doch angesichts der hoffnungsvollen Panik deiner Blicke verstummt sie. Die Hände auf den Bauch gepresst tappt sie vorwärts – aber auch die Bestie nimmt soeben eine wohlbekannte Biegung des Labyrinths.
„Schneller, schneller!“, entfährt es dir – und schämst dich doch augenblicklich dafür, denn sie läuft ja schon, so schnell sie eben kann.
Dem Glanze folgend lauft ihr weiter, du stützend, sie mit rudernden Armen. Eine letzte Abzweigung noch – gleich seid ihr drinnen.
Da aber schlägt dir ein bitterer Raubtiergeruch in die Nase und deine Frau krümmt sich, langt sich zwischen die Beine. „Die Fruchtblase“, stöhnt sie, du aber achtest nicht darauf, denn eben erscheint ein entsetzlich riesenhaftes Geschöpf am Ende des Nebenganges – mit lodernden bösen Augen.
„Weiter, weiter!“, fauchst du, stößt deine wimmernde Frau vorwärts und in das prächtig fluoreszierende Gewölbe hinein. „Zum Wasserspiegel! Los, los!!“
„Ich kann nicht mehr“, wimmert sie, aber du packst sie und stolperst über das Gestein hinweg, indes die Bestie den Eingang hinter euch versperrt. Ein Brüllen hebt euch von den Füßen, die Quarze prasseln von den Wänden. Du versuchst deine Frau im Sturze abzufedern, sie schreit.
„Durchs Wasser!“, flehst du. „Wir müssen durchs Wasser hindurch!“
Mit enormer Kraft hebst du sie auf, stürzt vorwärts, den stinkenden Atem des Scheusals im Nacken. Nicht umdrehen! Um Himmels willen nicht umdrehen!!
Doch direkt vor dem Spiegel erblickst du die Bestie von neuem und in ihrer ganzen Scheußlichkeit. Sie ist direkt hinter dir, hat das Maul geöffnet und gibt den Blick auf mehrere Reihen gelber Hauer preis!
Hinein, hinein!!
Jäh stürzt ihr durch die Wasserwand und erwartet schon, gegen blanken Felsen zu schlagen, erwartet schon zu sterben, seid fest entschlossen, euch im Tode noch zu halten – doch es ist ein schier ins Endlose führender Stollen, der sich euch nun eröffnet, so eng, dass die Bestie nicht hindurchkommt.
Als bereits Säuglingsgebrüll den Stollen erfüllt, meinst du, am Ende des steinigen, stetig aufwärts führenden Weges Tageslicht zu erkennen.
*
Wiegenlied
Liebling, weine nun nicht mehr,
bete stumm dein Nachtgebet.
Durch die Himmel geht der Herr,
kehrt hinaus den Wolkenteer
und es qualmet, wo er geht.
Vater Rhein schnürt seine Landschaft.
In der Strenge seines Tuns
krümmt sich lieblich die Verwandtschaft
und verwünscht, was seine Hand schafft.
Keine Angst, du bist bei uns.
Süß verblutend auf dem Rhein
strömt der Abend Richtung Nacht.
An den Burgen spielt der Schein,
spielt von unten am Gestein.
Und die Wälder glimmen sacht.
Jeder Segenswunsch gilt dir.
Lass die Wogen ruhig peitschen.
Dein Befinden im Visier
sind doch Kahn und Wellen hier,
dich ins Träumeland zu heitschen.
Keine Stürme und Sirenen
machen unsern Kurs gefährlich.
Sieh die Nacht am Felsen lehnen,
hör die alten Drachen gähnen,
schlaf, mein Liebling, schlafe herrlich.
***