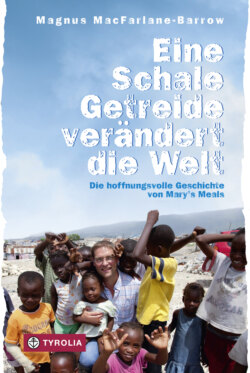Читать книгу Eine Schale Getreide verändert die Welt - Magnus MacFarlane-Barrow - Страница 7
I. Fahrstunden in einem Kriegsgebiet
ОглавлениеSei demütig, denn du bist aus Dung gemacht. Sei edel, denn du bist aus Sternen gemacht.
(Serbisches Sprichwort)
Wir wussten, dass die Männer, die von den Bergspitzen über der Stadt den Tod über die Menschen brachten, normalerweise morgens ihren Kater ausschliefen. Deshalb brachen wir früh auf – dann würden wir es schaffen, nach Mostar hinein und auch wieder heraus zu kommen, bevor die schweren Waffen ihr erbarmungsloses Werk wieder aufnehmen und die Häuser, Kirchen, Moscheen, Fahrzeuge und Menschen der Stadt in Stücke reißen würden. Auf den Beifahrersitzen neben mir quetschten sich während dieses letzten Abschnitts unserer Viertagereise von Schottland Pater Eddie, ein untersetzter Priester mittleren Alters, und Julie, eine große, schöne junge Krankenschwester. In den letzten Tagen waren wir drei gute Freunde geworden. Vor zwei Nächten hatten wir auf unserem Parkplatz neben einer Tankstelle in Slowenien bis weit in die Nacht hinein geredet. Pater Eddie überraschte und verstörte uns auch ein wenig, als er erklärte, er habe, bevor er von Schottland aufbrach, das Gefühl gehabt, er werde womöglich nicht zurückkehren, weshalb er praktisch seinen gesamten weltlichen Besitz an die Angehörigen seiner Gemeinde verschenkt hatte. Später berichtete Julie, sie sei wenige Monate zuvor mitten in der Nacht mit dem deutlichen Gefühl aufgewacht, Gott verlange von ihr, ihren Job aufzugeben, um den Menschen in Bosnien-Herzegowina zu helfen. Ihre Geschichte bewegte mich – es kam darin Julies tiefer Glaube zum Ausdruck, außerdem ähnelte das, was sie erzählte, in manchem meiner eigenen Geschichte. Ich schämte mich jetzt ein bisschen, denn als sie mich das erste Mal angerufen und wegen einer Mitfahrgelegenheit nach Bosnien-Herzegowina gefragt hatte, war ich von der Vorstellung überhaupt nicht begeistert gewesen. Mittlerweile jedoch war ich sehr froh, dass sie es geschafft hatte, mich umzustimmen.
Während wir durch die karge bosnische Landschaft mit ihren schartigen Felsen und dem Dornengebüsch fuhren, beteten wir einen Rosenkranz zusammen; dem schloss sich eine nervöse Unterhaltung an, während ich mich auf die enge, gewundene Straße konzentrierte. Bald kamen wir an den Überresten menschlicher Behausungen vorbei. Einige waren nur noch Schutthaufen, andere, die noch standen, hatten sich in ausgebrannte, mit Einschüssen übersäte Ruinen verwandelt. Wir sprachen jetzt nicht mehr. Die Straße begann, sich den Berg hinunterzuwinden, und vor uns tauchte Mostar auf. Die Stadt erstreckt sich entlang der Neretva, dem berühmten Fluss, von dem es häufig heißt, er bilde die Trennlinie zwischen der östlichen und der westlichen Kultur, und der nun die Grenze zwischen den serbischen Streitkräften und dem kroatischen und muslimischen Territorium markierte, durch das wir fuhren. Man konnte jetzt die Minarette der Moscheen im alten osmanischen Viertel sehen, und ich musste kurz an meinen ersten Besuch in dieser Stadt zurückdenken, vor vielen Jahren, als wir durch die kleinen Straßenstände am Flussufer geschlendert waren und jungen Männern zugeschaut hatten, die ihre Tapferkeit bewiesen, indem sie von der berühmten Stari-Most-Brücke herunter ihre tollkühnen Sprünge in die tosenden grünen Fluten vollführten.
Bei der Fahrt in die Stadt hinunter wurden wir an einem Kontrollpunkt angehalten, der mit einigen HVO-Soldaten (Männern der bosnisch-kroatischen Armee) besetzt war. Ein dünner Mann mit einem Maschinengewehr über der Schulter und einer Zigarette im Mund kam zu meinem offenen Fenster und starrte uns mürrisch an. Sein nach Brandy riechender Atem wehte in die Fahrerkabine. Ohne auch nur den Hauch eines Lächelns streckte er seine Hand aus, und wir gaben ihm unsere Pässe und die Zollpapiere für das medizinische Gerät hinten in unserem Lastwagen. Die Ablieferung dieser Gerätschaften war der Grund für unsere Reise, und jetzt, in ungefähr einem Kilometer Entfernung, konnten wir an den Hängen der Stadt unter uns auch schon Mostars Kreiskrankenhaus sehen, unser eigentliches Ziel. Man konnte es unschwer erkennen, und wir staunten über das moderne, glänzende Gebäude, das sich turmhoch über den benachbarten Häusern erhob. Selbst auf diese Entfernung erkannten wir, dass eine Granate ein riesiges, hässliches Loch in eine Seite gerissen hatte.
Der Soldat winkte uns durch, und wir fuhren vorsichtig durch Straßen voller verbogenem Metall, Glasscherben, Trümmerhaufen, ausgebrannten Autos, aufgerissenem Asphalt und hasserfüllten Graffiti. Schließlich erreichten wir das Klinikgelände. Vor dem Krankenhaus waren mehrere Kühllaster mit laufenden Motoren geparkt – Behelfs-Leichenhallen in einer Stadt, die schon lange nicht mehr genug Platz für ihre Toten hatte.
Unter dem Vordach des Haupteingangs hatten drei Leute vom Klinikpersonal in weißen Overalls unsere Ankunft bemerkt und winkten. Jetzt verließ mich meine Angst und machte einem euphorischen Gefühl Platz. Ich setzte dazu an, mir innerlich zu einer Aufgabe zu gratulieren, die ich gut bewältigt hatte, und stellte fest, dass ich mich fragte, ob Julie wohl beeindruckt war. Doch da merkte ich – einen Tick zu spät –, dass das Winken der Leute, die uns begrüßten, sich in dringliche Stopp-Signale verwandelt hatte und ihr Lächeln in Schreckensmienen. Mein Herz klopfte wie verrückt, als ich auf die Bremse stieg – und ein knirschendes Geräusch über meinem Kopf hörte. Das Willkommenskomitee vor uns krümmte sich jetzt vor Lachen, und nun erst kapierte ich, was passiert war: Gerade hatte ihr Krankenhaus einen weiteren Volltreffer abbekommen, diesmal von einem kleinen, verbeulten Lastwagen aus Schottland, dessen dilettantischer Fahrer die Höhe des Vordachs über dem Eingang falsch eingeschätzt hatte, und statt dass er darunter parkte, war er direkt hineingerauscht! Eine schnelle Untersuchung ergab, dass ich in die obere Ecke der Verladebox ein Loch gerissen hatte, wohingegen der Schaden am Vordach des Krankenhauses praktisch neben dem, was dem Rest des Gebäudes widerfahren war, überhaupt nicht ins Gewicht fiel. Den größten, nachhaltigsten Schaden hatte mein Ego abbekommen.
Wir luden die Sachen zügig aus und tranken mit zwei jungen Ärzten rasch eine Tasse Kaffee. Sie schlugen vor, die Stadt zu verlassen, bevor wieder Granaten geworfen würden; wir sollten ihnen hinterherfahren zu einem ungefährlicheren Ort, dort könnten wir reden. In der Nähe von Medjugorje, wo wir übernachten wollten, hielten sie vor einem Motel, das von Gewehrschüssen und Granaten beschädigt war.
Beim Kaffee erklärten uns die Ärzte, wegen des ausgedehnten Schadens an ihrem Krankenhaus könne man nur noch das Erdgeschoss benutzen. Das Gebäude war mittlerweile grotesk überfüllt, und es fehlten selbst die grundlegendsten medizinischen Geräte. Besonders erfreut waren die beiden über die Fixateurs externes, die wir mitgebracht hatten – so viele Patienten kamen mit zerschmetterten Gliedmaßen, und sie baten uns dringend, noch mehr von diesen Haltesystemen zum Ruhigstellen von Gliedmaßen zu bringen. Wir erklärten ihnen, dass Julie mit mir gekommen war, weil sie, eine ausgebildete Krankenschwester, ihre Stelle in Schottland kündigen und hier als Freiwillige arbeiten wollte. Sie antworteten, Krankenschwestern hätten sie genug, aber eben nicht genug medizinische Apparaturen. Sie schlugen vor, Julie solle mich doch bei meinen Bemühungen unterstützen, in Schottland die benötigten Hilfsmittel aufzutreiben, denn mittlerweile hatten sie gemerkt, dass ich nicht nur kein sonderlich begabter LKW-Fahrer war, sondern auch keine Ahnung von medizinischen Instrumenten hatte. Es wäre also dringend nötig, eine Person hinzuzuziehen, die etwas von der Sache verstand, wenn ich für sie von irgendwelchem Nutzen sein wollte. Ich war überrascht, wie erfreulich die Perspektive für mich klang, mit Julie zusammenzuarbeiten, murmelte aber nur, wir könnten ja mal drüber nachdenken. Julie äußerte sich ganz ähnlich, woraufhin ich beschloss, mir lieber keine Hoffnungen zu machen. Dann ging das Gespräch, wie nicht anders zu erwarten, von medizinischen Fragen zur Kriegssituation über.
Die Ärzte berichteten, dass die „Tschetniks“ in den Bergen mittlerweile nicht nur das Krankenhaus beschossen, sondern auch die Krankenwagen. Mehrere Ambulanzen, die mit Patienten zum Krankenhaus unterwegs waren, waren zerstört worden. Mittlerweile hatten unsere Gesprächspartner ihren türkischen Kaffee gegen Sliwowitz eingetauscht (einen regionaltypischen Pflaumenschnaps), und jetzt fingen sie an zu erzählen, wie sie zum Krieg standen. Sie waren voller Hass gegen ihre Feinde, die „Tschetniks“, und die Unterhaltung wurde nun ziemlich beklemmend. Die beiden Ärzte, die uns stundenlang erklärt hatten, was sie brauchten, um schwer verletzte Menschen zu heilen, fingen jetzt an, detailliert zu beschreiben, was sie einem Tschetnik-Soldaten antäten, wenn er ihnen in die Hände fiele. Mit Listen von dringend benötigten medizinischen Geräten verabschiedeten wir uns und versprachen, so bald wie möglich mit weiteren Hilfsgütern zurückzukommen.
Das war der fünfte Trip, den ich innerhalb kurzer Zeit nach Bosnien-Herzegowina unternommen hatte. Bei den Touren davor war ich immer von einem anderen Familienmitglied oder Freund begleitet worden. Jede Tour hatte für einen 25-jährigen Fischzüchter, der nie zuvor in seinem Leben daran gedacht hatte, Fernfahrer zu werden, eine steile Lernkurve bedeutet. Ich entdeckte eine ganze von Fernfahrern bewohnte Welt mit einer ganz eigenen Kultur, die mir nicht immer freundlich entgegenkam und auch nicht immer leicht zu verstehen war. Schon die Sprache war ein Problem. Es gab neue Ausdrücke zu lernen, beispielsweise „Tachograf“ (Fahrtenschreiber, also das Gerät, das die Fahrstunden und die Geschwindigkeit des Fahrers aufzeichnet), oder „Spedition“ (die Leute, die die nötigen Zollpapiere vorbereiten).
Erschwert wurde das Ganze durch den Umstand, dass wir nur Englisch sprachen – und das auch noch mit schottischem Akzent. Eine meiner ersten Touren unternahm ich mit Robert Cassidy, einem guten Freund aus Glasgow, dessen Akzent noch heftiger war als mein eigener Argyll-Zungenschlag. Wir fuhren einen 7,5-Tonner voller gespendeter Kartoffeln nach Zagreb. Es war mitten im Winter und bitter kalt. Wir schliefen hinten im Truck zwischen den Paletten voller Kartoffeln, und eines Morgens wurden wir in der Nähe der österreichisch-slowenischen Grenze wach und mussten feststellen, dass das Wasser in unseren großen Trinkflaschen komplett gefroren war. Ein Thermometer an der Tankstelle zeigte uns an, dass es sechs Grad unter null hatte.
Einer der neuen Spezialausdrücke, die wir uns aneignen mussten, war „Plomb“ (Plombe). Damit wird das kleine Bleisiegel bezeichnet, das die Zollbeamten beim Grenzübergang hinten an den LKWs anbringen; man kann so, wenn man das Land wieder verlässt, nachweisen, dass man durchgefahren ist, ohne den Anhänger geöffnet und Waren zu- oder abgeladen zu haben. Damals wussten wir allerdings noch nicht, was dieser Ausdruck bedeutet, weshalb ein Zollbeamter uns mit zunehmender Irritation wieder und wieder durch die Fensteröffnung seines Kabäuschens das Wort zubellte. „Plomb?“ – Er wollte einfach wissen, ob unser Fahrzeug versiegelt war. Nachdem Robert auf diese Frage mehrmals nur mit einem Blick blanksten Unverständnisses reagiert hatte, antwortete er schließlich in seinem schönsten Glasgow-Akzent: „Nae plums, just tatties. Loads of tatties.“ (Keine Pflaumen, nur Kartoffeln. Haufenweise Kartoffeln.) Worauf nun natürlich der Zollbeamte mit befremdet-amüsiertem Blick reagierte. Er wusste nicht einmal, in welcher Sprache er uns antworten sollte.
Damals waren einige Brücken an der großen Fernstraße entlang der Adria, über die wir die Straße nach Zentral-Bosnien-Herzegowina hinein erreichten, von Granaten zerstört. Man musste daher, wenn man diese Route benutzte, mit einer kleinen Fähre nach Pag übersetzen (einer langgestreckten schmalen Insel, die sich parallel zur Küste erstreckt), die ganze Insel entlangfahren und dann weiter im Süden die Fähre zurück aufs Festland nehmen. Einmal standen mein Schwager und damaliger Beifahrer Ken und ich in einer Schlange mit Hunderten von LKWs, die auf die kleine Aushilfsfähre warteten – auf einer Straße, die garantiert nicht für große, schwere Fahrzeuge gebaut worden war. Da brach plötzlich ein fürchterlicher Sturm los. Die Fähren stellten ihren Betrieb ein, und wie alle Fahrer um uns herum waren wir jetzt in unserer Fahrerkabine gefangen. Draußen heulte ein eisiger Wind um unseren Truck – er rüttelte das Fahrzeug so heftig hin und her, dass wir dachten, wir würden gleich umkippen. Auf der engen Straße war an Wenden nicht zu denken. Uns blieb also nichts anderes übrig als zu warten, bis der Sturm sich legte. Wir hatten in unserer Kabine an Proviant lediglich eine große Schachtel Schokoladenriegel der Marke Twix, die wir in den nächsten 48 Stunden penibel einteilten. Hin und wieder, dem Ruf der Natur folgend, kämpften wir mit der Tür, um hinauszuklettern; draußen rutschte man dann auf einem zugefrorenen Fernfahrerurinstrom aus, der sich vom Gipfel des Bergs zu dem kleinen Landungssteg am Ende der kurvigen Straße zog. Damals nahm ich mir vor, in Zukunft abwechslungsreicheren, gesünderen Proviant für Notfälle einzupacken – oder zumindest eine größere Auswahl an Schokoladenriegeln.
Auf diesen ersten Touren begriff ich auch allmählich, dass die Hilfsgüter, die wir transportierten, nicht immer das Wichtigste waren, was wir notleidenden Menschen bringen konnten. Mein Vater und ich lieferten einmal Hilfsmittel an eine kleine Einrichtung für behinderte Kinder in der Nähe des Hafens von Zadar. Damals unternahmen die serbischen Streitkräfte einen Angriff auf diesen Teil der kroatischen Küste, und wir konnten das Grollen der Granaten in der Ferne hören, als wir vor dem schäbigen kleinen Gebäude ankamen. Wir trafen auf Reihen von Kindern, die in Gitterbettchen lagen, zerlumpte Pyjamas trugen und von einer Belegschaft versorgt wurden, die sich nun in höchstem Alarmzustand befand. Sie waren nicht nur deshalb gestresst, weil sie nicht einmal mehr das Notwendigste hatten, um die Kinder angemessen versorgen zu können, sondern auch, weil der Krieg immer näher kam und sie genau wussten, dass es unmöglich war, mit diesen Kindern sofort und schnell aufzubrechen. Als wir unsere Kisten voller Hilfsmittel hinten aus unserem Truck ausgeladen hatten, verschwand die Freude der Schwestern schnell, als eine Granate nun sehr viel näher am Dorf detonierte. Und gleich danach noch eine. Sie forderten uns mit allem Nachdruck auf, uns mit dem Ausladen möglichst zu beeilen und gleich wieder in Richtung Norden zurückzufahren. Sobald ich die letzte Kiste ausgeladen hatte, verabschiedete ich mich hastig, sprang auf den Fahrersitz und ließ den Motor an, bereit, jeden Moment abzufahren. Ein paar Sekunden verstrichen, und in mir stieg Ärger hoch, weil mein Dad noch auf sich warten ließ. Als ich in den Rückspiegel schaute, sah ich, dass er die am ärgsten verängstigte Krankenschwester umarmte: Er tröstete sie und versprach, für sie zu beten. Dann erst nahm er seinen Sitz ein, und wir brausten davon.
Dreißig Jahre später sprach Papst Franziskus von der „Sünde der Effizienz“, und ich musste sofort an diesen Zwischenfall denken. Der Papst erinnerte uns, die wir mit Menschen arbeiten, die in Armut leben, daran, dass es bei wahrer Nächstenliebe nicht nur um materielle Güter oder um „Projekte“ und um deren Effektivität geht. Genauso wichtig ist es, den Menschen in die Augen zu schauen, Zeit mit ihnen zu verbringen und in ihnen unsere Brüder oder Schwestern zu erkennen. Aber irgendwie glaube ich heute immer noch nicht, dass es wirklich nötig war, dass Dads Umarmung dermaßen lang dauerte!
Bei all unseren Touren quer durch Europa machten wir die gleiche Erfahrung: Wenn wir uns unserem üblichen Zielort – Medjugorje – näherten, sahen wir alle möglichen anderen Fahrzeuge, die alle zu diesem weltbekannten Pilgerort unterwegs waren. Kleine Konvois von Lastwagen wie dem unseren, einzelne Transporter oder Familienautos mit Anhängern, in denen Kleidung, Nahrung und Medizin untergebracht war – alle strömten sie in das kleine Dorf in den Bergen von Bosnien-Herzegowina. Wimpel, Aufkleber auf den Autos oder selbstgemachte Schilder kündeten von ihrer Mission und ihrer Heimat und gaben Hinweise auf ihren Zielort. Wir freuten uns natürlich über die Gelegenheit, nach Medjugorje zurückzukehren; immerhin hatte sich dort vor vielen Jahren unser Leben radikal verändert. Doch fragten wir uns mittlerweile auch, ob wir unsere Hilfe nicht zu anderen Orten bringen sollten, die nicht so im Zentrum der Aufmerksamkeit standen – in Regionen, die weniger Hilfe bekamen, wo aber noch größere Flüchtlingsmassen Not litten.
Einer dieser Orte war Zagreb, die Hauptstadt Kroatiens, wo Tausende verzweifelter Menschen aus Gebieten eintrafen, die von den Serben „ethnisch gesäubert“ worden waren. Damals war fast ein Drittel des seit Kurzem unabhängigen Kroatien unter serbischer Kontrolle, und entlang der Frontlinien tobte der erbitterte Krieg eines Volks, das verzweifelt um seine Existenz kämpfte. Flüchtlinge und Vertriebene, Kroaten und Muslime sowohl aus Kroatien als auch aus Bosnien-Herzegowina, strömten in die Stadt. Sie hatten alles verloren – ihre Häuser, ihre Besitztümer, häufig auch ihre Familien.
In Zagreb lebte ein bemerkenswerter Mann namens Dr. Marijo Živković. Ein gemeinsamer Freund in Glasgow hatte uns vorgeschlagen, uns mit ihm zu treffen. Er erklärte uns, dass Marijo fantastische Arbeit für Flüchtlinge und Arme leistete, außerdem erwähnte er, dass er ein bekannter und bekennender Katholik war, der aus diesem Grund von den Kommunisten verfolgt worden war. Wir vereinbarten ein Treffen mit ihm im Büro von Merhamet, einer muslimischen Organisation, mit der wir bei der Auslieferung medizinischer Geräte zusammenarbeiteten. Wir waren am Morgen jenes Tages mit einer Narkoseapparatur eingetroffen, die sie dringend angefragt hatten. Wir hatten den Vormittag mit einem passionierten jungen Arzt und seinen Kollegen von Merhamet verbracht, hatten mehr über ihre Arbeit gehört und erfahren, wie wir ihnen in Zukunft noch besser helfen konnten.
Wegen des Treffens mit Dr. Marijo waren wir etwas nervös, denn tragischerweise befanden sich die Kroaten (überwiegend Katholiken) und die Muslime, die noch bis vor Kurzem in Bosnien-Herzegowina Verbündete im Kampf gegen den gemeinsamen Feind, die Serben, gewesen waren, mittlerweile gegeneinander im Krieg, und jetzt loderte glühender Hass zwischen den beiden Völkern. Wie dumm und gedankenlos war es doch von uns gewesen, einen bekannten katholischen Kroaten einzuladen und uns hier bei unseren muslimischen Freunden zu treffen! Wir spürten, dass auch unsere Gastgeber etwas besorgt waren, und ein peinliches Schweigen hatte sich in dem heißen, stickigen Raum breitgemacht, als Marijo dann endlich eintraf. Der große, breitschultrige Mann stürmte in den Raum mit einem gewaltigen Stapel gefrorener Schokoladenriegel im Arm.
„Bitte bedient euch!“, forderte er uns grinsend auf, kam auf jeden in der Runde zu und bot uns seine Leckerbissen an, als wäre er mit allen im Raum seit Langem gut Freund. Anschließend konnten wir uns die Hand geben und uns vorstellen, und lachend erklärte uns Marijo dann in sehr gutem Englisch, was es mit den Eisriegeln auf sich hatte.
„Also eine große italienische Gesellschaft wollte das Eis spenden – eine halbe Million Eisportionen! Sie haben sich an mehrere große Hilfsorganisationen gewandt. Von jeder kriegten sie die Antwort, das könnten sie nicht nehmen – ist ja auch eine verrückte, lächerliche Idee, im Hochsommer Leuten Eis zu schicken, die keine Möglichkeit haben, es im Kühlschrank zu lagern. Irgendwer empfahl den Italienern, sie sollten mich anrufen, und als die sich dann meldeten, sagte ich – natürlich Ja! Man kann doch nicht eine solche Menge Eiscreme, mit der man so viele Menschen beglücken kann, ablehnen! Bevor das Eis tatsächlich eintraf, habe ich massenhaft Leute angerufen, dass sie sich drauf einstellen sollten, einiges abzunehmen und es an all ihre Freunde weiterzugeben und an jeden, der ihnen begegnete – das Eis Kindern zu geben, an Schulen zu verteilen. Und ich bin sicher, dass das Eis auch nahrhaft und gesund ist …“ Er brach erneut in Gelächter aus und verleibte sich eine weitere Portion ein.
„Heute genießen also die Leute in ganz Zagreb gratis Eiscreme!“ Wieder lachte er und schlug seinen neuen muslimischen Freunden auf die Schulter, die mittlerweile ebenfalls schallend lachten.
So sah die erste der vielen Lektionen aus, die ich von Dr. Marijo im Lauf der nächsten Jahre lernte. Er war ein Virtuose in der Kunst, Geschenke zu machen und anzunehmen. Das Wort „Hilfe“ mochte er nicht. Er sprach lieber von „Geschenken“. Und statt angebotene Geschenke abzulehnen, fand er geniale Methoden, sie entgegenzunehmen. Er schaffte es sogar, vor dem Ende des Kriegs die famose Eiscreme-Verteilungsaktion noch zu toppen, als wir ihn nämlich fragten, ob er Hunderte Tonnen Kartoffeln von schottischen Bauern nehmen würde. Dieses Mal bewältigte er die Logistik, die andere für völlig undurchführbar hielten, indem er einfach sämtliche Kartoffeln auf einem öffentlichen Platz im Stadtzentrum als einen einzigen riesigen Haufen ablud. Dann machte er im öffentlichen Rundfunk eine Durchsage, mit der er die Leute in Zagreb aufforderte, zu kommen und sich zu bedienen! Die hungernden Einwohner der Hauptstadt reagierten prompt, und innerhalb weniger Stunden war auch noch die letzte Kartoffel abgeholt.
Dr. Marijo, eigentlich Volkswirtschaftler, hatte sich im früheren kommunistischen Staat Jugoslawien über lange Jahre hinweg mit Vorträgen für die Verbreitung der katholischen Lehre über die Familie engagiert. Er wurde zunehmend auch in andere Teile der Welt zu Vorträgen gebeten, und später lud der Papst ihn und seine Frau Darka ein, Mitglieder des Päpstlichen Rats für die Familie zu werden. Die kommunistischen Machthaber verloren irgendwann die Geduld und zogen seinen Pass ein, um ihn am Verlassen des Landes zu hindern, was ihn nicht beeindruckte – er begann stattdessen in Zagreb internationale Konferenzen zu organisieren und lud Leute aus vielen Ländern ein, bis er schließlich seinen Pass zurückbekam. Er und seine Familie gründeten außerdem das Familienzentrum, eine Organisation, die schwangeren, in Armut lebenden Frauen praktische Hilfe anbot – Babykleidung, Nahrung, Kinderwagen, Windeln und so weiter. Das verzweifelte Bedürfnis nach grundlegenden, lebenswichtigen Dingen – nicht nur solchen für Babys – war unter den Flüchtlingen und der Stadtbevölkerung rapide angewachsen, das Familienzentrum hatte sich jetzt also ganz der Aufgabe verschrieben, alle möglichen Arten von Gütern entgegenzunehmen und an sämtliche Personen in Not zu verteilen.
Nachdem wir festgestellt hatten, dass das Familienzentrum jedermann unterstützte, unabhängig von Volkszugehörigkeit oder Religion (faktisch ging ein Großteil der Hilfe an Muslime), fingen wir an, Marijos alte Eisenbahn-Lagerhalle mit LKW-Ladungen schottischer Geschenke zu beliefern. Bei jedem Besuch lernten wir Marijo, seine Frau Darka und ihre Kinder besser kennen – häufig übernachteten wir bei ihnen, bevor wir uns am nächsten Tag wieder auf unsere Heimreise machten. Marijo, ein überaus intelligenter Mann, der es liebte, öffentlich zu sprechen, beschenkte uns reich mit seinen weisen, philosophischen Sätzen. Er sprach gern und ungeniert von seinen diversen bemerkenswerten Leistungen, was er dann aber häufig mit den Worten beschloss: „Die wichtigste Leistung meines Lebens ist, dass ich Darka getroffen und geheiratet habe … meine zweitgrößte Leistung sind meine fünf Kinder … und das Einzige, was ich bedaure: dass wir nicht mehr bekommen haben …“ Er konnte wunderbar über die Familie, ihre Schönheit und ihre Bedeutung sprechen.
Ein Großteil der Dinge, die wir mit Marijo zusammen verteilten, ging an mehrere provisorische Flüchtlingslager, in denen überwiegend Frauen und Kinder untergebracht waren. In Reihen überbelegter hölzerner Hütten, die ursprünglich als Unterkunft für Wanderarbeiter gebaut worden waren, lebte eine Gruppe von Frauen und Kindern aus Kozarac, einer Stadt im nördlichen Bosnien-Herzegowina. Trotz ihres Traumas, vielleicht aber auch gerade deswegen, wollten einige über das Grauen reden, das sie durchgemacht hatten.
Vor dem Krieg hatten in ihrer Stadt überwiegend Muslime gelebt. Seit Längerem war das Gebiet unter serbischer Kontrolle, und die Einwohner von Kozarac gehörten zu den Ersten, die das Grauen „ethnischer Säuberung“ durchmachten: Die Frauen erzählten uns, wie sie in die Wälder geflohen waren, als die Serben ihre Stadt bombardierten. Als sich die letzten paar muslimischen Kämpfer dann irgendwann ergaben, hörten sie, wie die Serben durch Lautsprecher diejenigen, die sich in den Wäldern versteckt hatten, aufforderten, sich zu ergeben und zur Straße zu kommen. Keinem werde etwas angetan. Sie kamen dann massenhaft heraus, schwenkten behelfsmäßige weiße Fahnen und sammelten sich an der Straße. Granaten gingen auf ihnen nieder und töteten und verstümmelten Hunderte. Als der Beschuss vorüber war, stellten die serbischen Soldaten die Überlebenden in einer Reihe auf und holten sämtliche Männer in kampffähigem Alter heraus. Viele, die als Anführer oder wichtige Mitglieder ihrer Gemeinde identifizierbar waren, wurden erschossen, oder man schnitt ihnen am Rand der Straße die Kehle durch. Einige der Frauen, die diese Geschichten erzählten, hatten gesehen, wie ihre Männer, Väter und Söhne auf diese Weise umgebracht worden waren. Alle übrigen Männer wurden in neu errichtete Konzentrationslager verschleppt.
Die Frauen, die in ihren überfüllten Hütten kauerten, erzählten uns ihre Geschichten, weil sie davon überzeugt waren, dass keiner draußen in der Welt wusste oder verstand, was hier eigentlich passierte. Und sie bestanden darauf, etwas von den Lebensmitteln, die wir ihnen mitgebracht hatten, mit uns zu teilen, und fragten außerdem, ob es in Ordnung wäre, wenn sie ein Viertel der Geschenke zur Seite legten: Sie wollten sie zu den Flüchtlingen schmuggeln, die sich noch im Norden von Bosnien-Herzegowina versteckten und sicher noch hungriger waren als sie selbst.
Ich kam von solchen Begegnungen immer mit sehr gemischten Gefühlen zurück. Jede dieser Schreckensgeschichten ließ meine Empörung, meine Wut auf „diese barbarischen Tschetniks“ wachsen. Es fiel mir sehr schwer, in diesem Krieg, in dem ich ja eigentlich zu keiner Partei gehörte, unparteiisch zu bleiben oder nicht aus dem Blick zu verlieren, dass ich nur eine Seite dieser tragischen Geschichte zu hören bekam. Ich war auch immer wieder zutiefst bewegt von der Freundlichkeit und der geistigen Stärke derer, die mir diese Geschichten erzählten. Und das Problem der Vergebung wurde mir in einer Schärfe bewusst, wie ich sie noch nie zuvor in meinem Leben empfunden hatte. Wenn ich schon anfing, Wut und Vorurteile gegen die Serben zu entwickeln, die solche Verbrechen verübten, wie konnte ich als Christ erwarten, dass diejenigen zu Vergebung fähig und bereit waren, die so viel Bosheit selbst hatten erdulden müssen? Wie war das möglich? Wie konnte hier je wieder echter Friede entstehen?
Manchmal fuhren wir auf nicht beschilderten Wegen (die alte Autobahn war zerstört) in die Stadt Slavonski Brod. Sie lag am Ufer der Sava, dem Fluss, der Kroatien und Bosnien-Herzegowina voneinander trennt. Von der anderen Seite des träge dahinfließenden Gewässers wurde die Stadt ständig unter Beschuss genommen. Die Brücke lag zertrümmert im Fluss, und in sämtlichen Gebäuden in unmittelbarer Nähe des Ufers waren Fenster und Türen mit Brettern verbarrikadiert. Wir entluden unsere Lebensmittel, indem wir sie an die Menschen austeilten, die in einer langen Warteschlange standen; wir hatten sie aufgefordert, sich mit einer leeren Plastiktüte anzustellen (eine praktische Regel, die wir uns zur Rationierung der Portionen ausgedacht hatten). Als alles verteilt war, wurde uns Unterkunft in einem kleinen Haus auf einem Hügel oberhalb der Stadt angeboten. Es wurde damals von einem älteren Ehepaar bewohnt, Flüchtlingen aus dem Norden von Bosnien-Herzegowina.
Beim Abendessen herrschte verlegenes Schweigen, weil alle Versuche, sich zu verständigen, gescheitert waren (ihr Englisch war noch schlechter als unser Serbokroatisch). Später saßen dann unser Gastgeber Mladen und ich draußen und tranken Sliwowitz, und nach einigen Gläsern stellten wir fest, dass die Verständigung zunehmend besser klappte. Mladen erklärte mir, sein Haus liege auf der Ebene, die wir auf der anderen Seite des Flusses sehen konnten. Jetzt war das Gebiet von Serben besetzt. Er hatte ein kleines Grundstück und ein paar Pflaumenbäume besessen; der Sliwowitz, den wir tranken, war noch aus eigenen Pflaumen hergestellt. Bevor er und seine Frau flohen – alle Habseligkeiten, die sie mitnehmen konnten (auch der Sliwowitz), waren schon gepackt –, nahm Mladen seine Axt und fällte seine geliebten Pflaumenbäume. Jetzt lebten vielleicht Serben in seinem Haus, aber an seine Pflaumen kamen sie nicht mehr dran. Und er lachte laut und bitter auf, als er das sagte – er wollte mich und vielleicht ja auch sich selbst davon überzeugen, dass das eine Geschichte zum Lachen war und nicht eine, die nur so glühte vor Hass.
Allmählich begannen mir die Begriffe „Flüchtlinge“ oder „Vertriebene“ unheimlich zu werden. Natürlich sind es schlicht notwendige, nützliche Mittel, um präzise die Menschen zu beschreiben, die aus ihrer Heimat und ihren Häusern hatten fliehen müssen. Allerdings merkte ich, dass diese Wörter, bevor ich die Menschen wirklich traf und kennenlernte, die mit ihnen bezeichnet wurden, in meinem Kopf ungenaue, um nicht zu sagen falsche Stereotype hatten entstehen lassen.
In einem anderen Lager in Zagreb erfuhr ich im Lauf einer Unterhaltung mit einem liebenswürdigen, eloquenten Mann mittleren Alters, dass er früher Chef einer Frachtgesellschaft mit einem stattlichen LKW-Fuhrpark gewesen war. Dass zum damaligen Zeitpunkt zufällig ich derjenige war, der einen Lastwagen fuhr und ihm half, obwohl ich weniger gut ausgebildet war, wesentlich weniger Lebenserfahrung hatte und sehr viel weniger Wissen, wie man den Transport von Gütern mit LKWs organisiert – dieser Umstand lieferte mir ganz sicher nicht den geringsten Grund, mich ihm auch nur im Geringsten überlegen zu fühlen. Zwar war es nicht ganz leicht, mir das einzugestehen, aber ich hatte mich dabei ertappt, wie ich in diesen Kategorien dachte: Ich der Geber; dieser Fremde der Empfänger. Ich habe Macht; er hat keine. Allmählich dämmerte mir, dass diese Art von Arbeit sehr gefährlich war.
In der Zwischenzeit hatte Marijo sich eine neue Methode ausgedacht, wie man unsere Kleiderspenden an bedürftige Menschen weitergeben konnte. Ihm war klar geworden, dass für viele das größte Problem in ihrer Situation darin bestand, dass sie plötzlich von Unterstützung abhängig waren. Um ihre Würde zu respektieren, mietete er eine große Halle und legte die Kleidungsstücke auf langen Tischen aus. Dann veröffentlichte er einen Aufruf, dass die Leute kommen und auswählen sollten, was sie wollten, „um notleidenden Bekannten helfen zu können“. Auf diese Art konnte er die Leute dazu bewegen, zu kommen und die Kleider auszuwählen, die sie brauchten, ohne dass sie sich öffentlich gedemütigt fühlen mussten.
Und so ging es dann weiter – eine LKW-Ladung nach der anderen, angefüllt mit einer noch immer wachsenden Flut von Gaben aus Schottland. Julie hatte zu meiner großen Freude beschlossen, mir tatsächlich auch weiterhin zu helfen. Sie war jetzt auf den meisten Fahrten meine Beifahrerin. Als der Umfang an Hilfsgütern weiter anstieg, wurde uns klar, dass der Einsatz eines kleinen Lastwagens für den Transport großer Mengen an Waren über lange Strecken nicht die kostengünstigste Lösung war. Wir brauchten etwas Größeres. Um richtig große LKWs zu fahren, mussten wir den Führerschein für Schwerlastwagen machen, weshalb wir im November 1993 bei Julies Familie in Inverness unterkamen (die schon bevor ich Julie kennengelernt hatte zu den engagiertesten Unterstützern unserer Arbeit gehört hatten) und anfingen, den nötigen Fahrunterricht zu nehmen.
Es machte mir schwer zu schaffen, dass sich nach einigen gemeinsamen Fahrstunden ziemlich deutlich abzeichnete, dass Julie sehr viel besser im Umgang mit Sattelschleppern war als ich. Schon nach der ersten „Lektion“ mit Julie am Steuer hatte der Fahrlehrer sie in ungläubigem Ton gefragt: „Sie nehmen mich doch auf den Arm, oder? Sie sind doch keine Anfängerin, Sie haben früher schon solche Dinger gefahren, stimmt’s?“ Mir versetzte das einen ziemlichen Stich, und ich kletterte auf den Fahrersitz, denn jetzt war ich dran.
„Sie werden wohl etwas mehr Training brauchen“, bemerkte unser Lehrer am Ende meiner Fahrt taktvoll, „vor allem im Kreisverkehr.“
Das war sehr nett von ihm, vor allem im Hinblick auf die drastischen Maßnahmen, die mindestens ein Autofahrer ergreifen musste, um von meinem Anhänger nicht plattgemacht zu werden. Davor war mir nicht bewusst gewesen, woran man alles denken muss, wenn man ein 16 Meter langes Fahrzeug steuert, das sich krümmt, wenn man eine Kurve fährt. Bei dem freundlichen Kommentar des Fahrlehrers bildete sich in meinem Magen ein kleiner Knoten, der sich in den nächsten Wochen zunehmend in Richtung Panik entwickelte. Meine Angst rührte gar nicht einmal so sehr daher, dass ich mir vorstellte, wie ich einen Kreisverkehrs-Mitbenutzer zermalmte oder eine Tankstelle mit einem ungeschickten Ausscheren meines enormen Hinterteils demolierte. Es war eher die Perspektive, meinen Freunden in Dalmally berichten zu müssen, dass Julie die Prüfung bestanden hatte und ich nicht. Das würde sie auf Jahre hinaus mit Material für Witze auf meine Kosten versorgen.
Und so kam es dann auch: Julie bestand die Prüfung mit Glanz und Gloria, und ich fiel durch (mein Anhänger hatte sich leider während der Bewältigung eines Kreisverkehrs in eine andere Straße verirrt). Meine Rechtfertigung, dass ich mit den denkbar schlechtesten Voraussetzungen angefangen hatte – meine Führerscheinprüfung hatte ich damals auf einem alten Landrover in dem kleinen Dorf Inverary gemacht, einem Ort bar jeglichen Kreisverkehrs –, zog natürlich bei keinem in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Ich war unendlich erleichtert, als ich beim zweiten Anlauf die Prüfung bestand, und kurz danach erstanden wir einen riesigen, 44 Tonnen schweren Sattelschlepper. Julie hatte die Gewohnheit, all unseren Trucks Namen zu geben, und aus irgendeinem Grund, der sich mir nie erschlossen hat, nannte sie das Teil „Mary“ – so ziemlich der letzte Name, der mir für dieses gigantische Ungetüm eingefallen wäre. Es war grandios zu sehen, wie viel wir in diesem Truck unterbringen konnten, vor allem, weil wir plötzlich von einer größeren Spendenwelle überrollt wurden als je zuvor.
Mehrere Monate lang hatten wir die verstörenden Ereignisse in Srebrenica genau verfolgt. Srebrenica, eine muslimische Stadt in einer von Serben kontrollierten Region Bosnien-Herzegowinas, war mittlerweile von feindlichen Streitkräften umzingelt und völlig überbevölkert. Wie andere Städte in ähnlicher Lage war es von der UNO zu einem „sicheren Hafen“ erklärt worden: Die Organisation versprach, für die Sicherheit aller zu sorgen, die hier Zuflucht suchten. Im Juli 1995 drängten sich an diesem Ort, der zuvor lediglich eine kleine, in einem Tal gelegene Stadt gewesen war, 30.000 Muslime. Jedes Gebäude war überfüllt, und Tausende mussten im Freien schlafen. Monate vergingen, viele verhungerten; aber noch mehr Menschen wurden von Granaten aus den die Stadt umgebenden Bergen getötet.
Und während die Welt ungläubig und entsetzt zuschaute, drangen schließlich die serbischen Soldaten in die Stadt ein. Die vierhundert niederländischen UNO-Soldaten ergaben sich, ohne auch nur einen einzigen Schuss abgegeben zu haben. Die Serben selektierten sämtliche muslimische Männer in kampffähigem Alter, führten sie in eine leerstehende Fabrik und ermordeten innerhalb von zwei Tagen 8000 von ihnen. Die meisten Frauen (viele, nachdem sie vergewaltigt worden waren) und Kinder wurden laufen gelassen und flohen in die Wälder. Die Mehrheit schlug sich nach Tuzla durch, die nächste größere Stadt, wo auf einem alten Flugplatz mit Zelten ein behelfsmäßiges Auffanglager aufgebaut wurde. All das geschah vor den Augen der ganzen Welt. Wir wurden durch regelmäßige Berichte auf dem Laufenden gehalten.
Außer meiner Wut auf die Serben spürte ich jetzt einen brennenden Zorn auf die UNO und unsere Regierung, die es zugelassen hatten, dass sich diese kalt geplanten Abscheulichkeiten an einem Ort ereigneten, den sie die Stirn hatten, einen „sicheren Hafen“ zu nennen. Ich empfand tiefe Scham.
Unmittelbar nach diesen Ereignissen flossen die Spendengaben reichlicher als je zuvor, sowohl von einer empörten Öffentlichkeit als auch von Lebensmittelfirmen, die uns palettenweise Mehl, Zucker, Konserven und vieles mehr anboten. Wir machten uns also in unserem neuen LKW mit riesiger kostbarer Fracht auf den Weg nach Tuzla, um all das den Frauen und Kindern zu bringen, die dort kürzlich eingetroffen waren – keine einfache Aufgabe, denn der einzige Weg in diese Stadt führte mitten durch Bosnien-Herzegowina, wo immer noch der Krieg tobte. Wir wussten, dass wir mit unserem Truck auf den Bergstraßen, über die wir fahren mussten, nicht weiterkommen würden, daher ließen wir uns darauf ein, mit einer anderen Wohltätigkeitsorganisation aus England zusammenzuarbeiten, die kleinere Lastwagen einsetzte, um Hilfsgüter nach Bosnien-Herzegowina zu bringen.
In der kroatischen Stadt Split trafen wir mit ihnen zusammen, und in einer größeren Industrieanlage verluden wir bei sengender Hitze unsere Sachen in ihre fünf Lastwagen. Nach einem höchst willkommenen kurzen Bad in der Adria machten wir uns in Richtung Norden auf den Weg, Julie und ich jetzt jeweils als Beifahrer in den kleineren LKWs unserer neuen Kollegen. Am zweiten Tag der Tour ließen wir die Asphaltstraße hinter uns und fuhren auf sichereren Wegen in den Wald. Für mich fühlte sich das vertraut an – so ähnlich wie die Straßen in Schottland, auf denen ich als Teenager fahren gelernt hatte. Und auch die Landschaft um uns herum wirkte vertraut, obwohl die Berge etwas höher und zerklüfteter waren als die in Argyll. Bald aber musste ich feststellen, dass diese Lastwagen im Unterschied zu den Landrovern und Pickups, an die ich gewöhnt war, keinen Vierradantrieb hatten und für dieses Terrain denkbar ungeeignet waren. Die Straßen wurden holpriger und steiler. Die Räder drehten durch, und allmählich fing ich an, mir Sorgen zu machen.
Meine Sorgen hingen nicht nur mit den ungeeigneten Fahrzeugen zusammen, sondern damit, dass in dem neuen Team, zu dem wir jetzt gehörten, einige offenbar mehr am Nervenkitzel als an der sicheren Auslieferung der Hilfsgüter interessiert waren. Nördlich der Stadt Mostar hatten wir in der Ferne Granatendetonationen gehört. Ich war entsetzt, als ich hörte, dass einer unserer Mitfahrer vorschlug, eine Strecke zu nehmen, die näher an der Stelle vorbeiführte, wo noch Rauch aufstieg, damit wir „sehen können, was da passiert“. Offenbar waren einige ganz wild darauf, Soldat zu spielen. Wenn wir an UNO-Stützpunkten Halt machten, um uns über sichere Routen zu informieren, überredeten einige unserer Mitfahrer die Soldaten, ihnen ihre Maschinengewehre zu leihen, mit denen sie sich dann fotografieren ließen. Zum ersten Mal verstand ich, warum größere Hilfsorganisationen die Anstrengungen kleinerer Einrichtungen häufig als dilettantisch und gefährlich einstufen.
Als wir uns neben der Reihe unserer geparkten Trucks zum Schlafen einrichteten, besprachen Julie und ich leise unsere Sorgen bezüglich der Zusammenarbeit mit diesen Leuten, aber uns war völlig klar, dass wir jetzt, wo wir in einem Teil von Zentral-Bosnien-Herzegowina angekommen waren, den wir beide nicht kannten, keine andere Wahl hatten, als mit ihnen bis Tuzla weiterzufahren. Außerdem mussten wir ja all den Spendern zu Hause sagen können, dass ihre Gaben sicher angekommen waren.
Als ich in meinen Schlafsack schlüpfte, hatte ich schlechte Laune. Unsere Kollegen hatten nicht einmal etwas Anständiges für uns zum Essen mitgenommen, und hungrig schlafen gehen zu müssen hatte bei mir unweigerlich zur Folge, dass ich mir fürchterlich leidtat. Mitten in der Nacht wachten wir auf, weil ein Rudel wilder Hunde über uns hinwegjagte. Es war ein total merkwürdiges Gefühl. Sie flitzten – offenbar ohne jegliches Interesse an uns – über unsere Schlafsäcke hinweg und verschwanden in der pechschwarzen Nacht. Ich fragte mich, was wohl ihren Besitzern zugestoßen war und wovor sie davonliefen oder wohin sie rannten.
Am nächsten Tag verschlechterte sich der Straßenzustand noch weiter. Die stärkeren Fahrzeuge zogen jetzt andere die steilsten Abhänge hinauf, und wir kamen nur noch quälend langsam voran. Zu unserer Sicherheit mussten wir unbedingt vor Einbruch der Nacht in Tuzla ankommen, doch das wurde immer unwahrscheinlicher. Der Nachmittag rückte vor, immer öfter mussten wir anhalten, um Reifenpannen zu beheben, und so langsam befürchtete ich, dass einige der Fahrzeuge bald gar nicht mehr reparierbar sein würden. Und als es allmählich Abend wurde, begann der dichte Wald, der sich zu beiden Seiten der Straße erstreckte, einen entschieden unheimlichen Eindruck zu machen.
Als die Situation richtig trostlos aussah, kam ein Konvoi norwegischer Gelände-Trucks angefahren. Die freundlichen Fahrer – Zivilisten, die mit Leuten von der UNO zusammenarbeiteten – sahen, dass wir in einer ganz misslichen Lage waren, sie hielten an und fragten, ob sie helfen könnten. Sie waren so freundlich, nicht über uns zu lachen, und sagten, sie würden bis zu ihrem Stützpunkt in Tuzla bei uns bleiben und uns abschleppen, wann immer wir ihre Hilfe brauchten. Mit unseren unerwarteten „Schutzengeln“, die uns hinter sich herzogen, kamen wir jetzt stetig voran. Und als wir schließlich um drei Uhr morgens den UNO-Stützpunkt erreichten, fielen wir praktisch sofort in einen erschöpften Schlaf – allerdings hatte Julie vorher noch die Gelegenheit, mir aufgekratzt mitzuteilen, dass sie auf dem letzten Abschnitt unserer Reise durch die Nacht einen der riesigen Gelände-Trucks gefahren habe. Sie erzählte davon in einem Ton, als sei gerade ihr größter Lebenstraum in Erfüllung gegangen. In mir stieg der Verdacht auf, dass sie womöglich ein bisschen verrückt ist.
Am nächsten Morgen wurden wir nach Tuzla in die Stadt gefahren und von einem dankbaren, aber erschöpft wirkenden Bürgermeister empfangen. Wir waren froh, unsere kostbare Fracht – Tausende Schachteln mit Trockennahrung, Seife und Windeln – in eine kleine behelfsmäßige Lagerhalle ausladen zu können, von wo sie in überschaubaren Mengen zu den Flüchtlingen auf dem Flugfeld in der Nähe gebracht werden konnte.
Später suchten wir selbst das riesige Lager auf, in dem jetzt 30.000 Menschen lebten. Wir gingen einen Fußweg zwischen den Zelten entlang. Ein Mädchen versuchte, sich die Haare in einem Eimer zu waschen, und in der Nähe saß eine ältere Dame mit Kopftuch, die sich bemühte, mit einem kleinen Stapel Pappkarton ein Feuer zu machen. In einem Zelt wurden furchtbar unterernährte Kinder mit ausgemergelten, ausdruckslosen Gesichtern von einigen Ärzten untersucht. Ich machte mir klar, dass seit dem Fall von Srebrenica erst zehn Tage vergangen waren: zehn Tage, seit diese Frauen und Kinder, die hier abgemagert und von der Sonne verbrannt vor ihren Zelten saßen, mit ansehen mussten, wie ihre Ehemänner, Söhne und Väter kaltblütig ermordet wurden – und noch viele andere Gräueltaten mehr. Zehn Tage, in denen sie in Todesangst durch die Wälder gelaufen waren. Auf dem Weg hatte sich mindestens eine von ihnen, die einundzwanzigjährige Ferida Osmanovic, an einem Baum mit ihrem Schal erhängt. Und während sie das alles durchmachten, hatte ich herumgejammert, weil ich nicht genug Schlaf und Essen bekam.
Unsere Begleiter auf der Hinreise fuhren über dieselben Straßen zurück, auf denen wir gekommen waren. Julie und ich beschlossen, uns auf das Wagnis eines Flugs mit einem Militärhubschrauber einzulassen – eine Möglichkeit, von der uns die Norweger erzählt hatten. Man riet uns, zu einer nahe gelegenen Landestelle zu fahren und dort auf den Hubschrauber zu warten. Am ersten Tag kam er nicht. Die Soldaten, die mit uns warteten, klärten uns auf, das läge daran, dass keine nüchternen Piloten aufzutreiben waren. Ich hatte natürlich gedacht, dass sie Witze machten, doch als der riesige Hubschrauber am nächsten Tag dann endlich landete, war die ukrainische Belegschaft, die ausstieg, um die Fracht abzuladen, tatsächlich eindeutig sehr betrunken.
Unsere norwegischen Freunde hatten uns informiert, dass keiner ohne schusssichere Weste mitfliegen dürfe. Wir hatten aber nichts dergleichen. Einem freundlichen UNO-Beobachter, der ebenfalls auf eine Mitfluggelegenheit zurück nach Split wartete, erklärten wir das Problem, und er überließ uns freundlicherweise ein paar blaue Postsäcke: Er meinte, sie sähen von Form und Farbe her genauso aus wie die üblichen kugelsicheren Westen. „Nehmt sie einfach in die Hand, wenn ihr einsteigt, die Crew wird nichts merken“, riet er uns.
Er hatte recht. Als wir in den riesigen, höhlenartigen Frachtraum des Hubschraubers einstiegen, glotzten uns die Männer von der Besatzung mit leerem, betrunkenem Grinsen und wässrigen Augen an, und mir wurde klar, dass wir wahrscheinlich irgendetwas in der Hand hätten halten können oder auch gar nichts – aufgefallen wäre es ihnen nicht. Das Monster verschluckte uns wie damals der Wal den Propheten Jona, und dann hob es ab. Wir wurden in dem riesigen Metallfass hin und her geschleudert, denn die Piloten flogen „taktisch“ – also grässlich tief –, sie blieben nah an den Bergflanken oder schwenkten im Zickzackkurs von einer Seite des Tals zur anderen. Wahrscheinlich war das nötig, um das Risiko zu verringern, abgeschossen zu werden, aber ich fragte mich schon auch, wie viel einfach nur auf Trunkenheit am Steuerknüppel zurückzuführen war. Jedenfalls wünschte ich insgeheim, wir hätten beschlossen, ebenfalls über die Waldstraßen zurückzufahren. Aber irgendwann landeten wir dann doch sicher in Split und fanden Mary, unseren riesigen Truck, die treu und brav darauf wartete, uns heimbringen zu dürfen. Wir hätten sie umarmt, wenn unsere Arme lang genug gewesen wären.