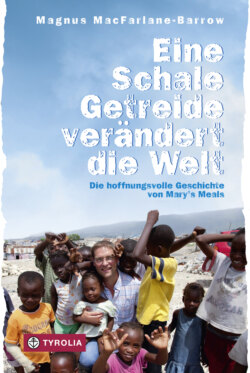Читать книгу Eine Schale Getreide verändert die Welt - Magnus MacFarlane-Barrow - Страница 9
III. Kleine Akte der Liebe
ОглавлениеGib demjenigen etwas, der in Not ist, und sei es noch so wenig. Denn es ist nicht wenig für den, der nichts hat. Und es ist nicht wenig für Gott, wenn wir gegeben haben, was wir konnten.
(Gregor von Nazianz)
Währenddessen waren Mum und Dad zu Hause damit beschäftigt, jeden anzurufen, den sie kannten. Im Lauf der Jahre waren Tausende Leute bei ihnen im Einkehrzentrum gewesen, und viele waren gute Freunde geworden. Über die Anrufe, mit denen sie von unserer Initiative für die Menschen in Bosnien-Herzegowina erfuhren, wurde schnell ein ganzes Heer von Mitarbeitern mobilisiert. Mum war noch nicht zufrieden – sie schrieb außerdem jede katholische Gemeinde in Schottland an und bat um Hilfe. Die Reaktion war unglaublich. Den ganzen Tag über riefen Leute an, die ihre Hilfe anboten. Jeden Morgen brachte der Briefträger stapelweise Briefe mit Schecks über persönliche Spenden, Kirchenkollekten oder die Erträge von Wohltätigkeitsveranstaltungen. Julie saß stundenlang an ihrer Schreibmaschine und schrieb Dankesbriefe, und ich fuhr die meiste Zeit durch die Gegend, um Materialspenden einzuladen und in die Schuppen bei der Craig Lodge zu bringen, wo wir die Sachen dann sortierten und zum Transport verpackten. Es war harte Arbeit, die wir ohne die zahlreichen Freunde, die uns regelmäßig halfen, nie bewältigt hätten.
Eine meiner Lieblingstätigkeiten war das Beladen der Lastwagen, die nach Bosnien-Herzegowina fahren sollten. Ich sah es als große Verantwortung an, sicherzustellen, dass auch noch der letzte Quadratzentimeter vollständig ausgenutzt war, sodass mit jeder teuren, zeitaufwendigen Reise so viel wie möglich zu den notleidenden Menschen gebracht werden konnte. All die diversen Hilfsgüter mit ihren unterschiedlichen Größen, Gewichten und Zerbrechlichkeitsgraden in den vorhandenen Laderaum einzupassen war wie eine Art riesiges 3-D-Puzzle. Es war außerdem harte körperliche Arbeit, aber das hatte ich eigentlich auch vermisst, seit ich nicht mehr bei der Fischfarm arbeitete, wo ich sechs Jahre lang täglich körperlich anspruchsvolle Arbeit geleistet hatte. Am wenigsten lag mir, vor Menschen Vorträge zu halten und Präsentationen durchzuführen, die verständlicherweise an Berichten und Feedback interessiert waren. Oder sagen wir genauer: Ich dachte, das läge mir am wenigsten. Eine ganze Zeitlang schaffte ich es nämlich, solchen Einladungen aus dem Weg zu gehen, indem ich Mum oder Julie bat, diese Gespräche und Vorträge in Kirchen, Schulen oder vor anderen Unterstützergruppen zu übernehmen, während ich es im Vorfeld so organisierte, dass ich in irgendeiner entfernten Ecke des Landes eine Sachspende abholen musste.
In Glasgow, der größten Stadt Schottlands, halfen uns John und Anne Boyle, ein wunderbares älteres Ehepaar. Sie organisierten in der Stadt eine freiwillige Helfergruppe und bekamen außerdem vom Gemeinderat eine kostenlose Lagerhalle sowie einen Lastwagen zur Verfügung gestellt, mit dem die Sammlungen transportiert werden konnten. Es dauerte nicht lang, bis hier der Großteil unserer Aktivitäten ablief. Das kostenlose Lager war eine hochwillkommene Gabe, allerdings war es aufgrund seiner Lage nicht so ganz ideal. Die Halle war im vierten Stock, und sämtliche Sachen mussten mit einem sehr alten Lift dorthin und von dort wieder wegtransportiert werden. An den Tagen, wenn wir den Lastwagen für den Transport ins Ausland beluden, füllte ein Team im vierten Stock den Lift immer wieder auf und schickte ihn an das Team im Erdgeschoss, das die Ladung dann in den Lastwagen trug. Mehr als einmal machte der Lift schlapp. Wir begriffen schnell, dass die städtischen Behörden nur dann sofort einen Techniker schickten, um den Lift zu reparieren, wenn sich in dem steckengebliebenen Lift eine Person befand, andernfalls konnte es Stunden oder sogar Tage dauern, bis wir mit dem Beladen weitermachen konnten. Irgendwann entdeckten wir, dass wir in den steckengebliebenen Lift durchs Dach hineinklettern konnten, und manchmal machten wir das auch tatsächlich, bevor wir bei der Stadt anriefen. Dann konnten wir die ehrliche Antwort geben: „Ja, es ist jemand drin.“ Ich glaube, ihnen war schon klar, was dahintersteckte, wenn sie ankamen und einen von uns in der Liftkabine vorfanden, mit hochrotem Gesicht und neben einen Stapel Kisten gequetscht, aber wir hatten den Eindruck, dass sie wie alle anderen in der Stadt einfach Teil unserer Bemühungen sein und dafür sorgen wollten, dass die Aktion erfolgreich weiterlief.
Anfangs kam in Glasgow ein Großteil der Unterstützung von den Kirchen, doch als die große muslimische Gemeinde von unserer Arbeit hörte, brachte sie sich ebenfalls sehr engagiert ein. Die Muslime organisierten regelmäßige Nahrungsmittelsammlungen in den Moscheen und transportierten unglaubliche Mengen in unsere Lager. Viele Leute in dieser asiatischen Gemeinde, vor allem Menschen aus Pakistan, hatten mit Lebensmittel-Großhandelsunternehmen zu tun, und häufig spendeten sie uns ihre überschüssigen Lagerbestände.
Trocken- und Konservennahrung konnten wir nie genug bekommen. Derartiges stand immer ganz oben auf den Listen mit dringend gewünschten Dingen, die wir aus Bosnien-Herzegowina erhielten. Wir wendeten uns an Supermärkte und baten um die Erlaubnis, Lebensmittelsammlungen durchzuführen. Man erlaubte uns, uns mit einem leeren Einkaufswagen an den Eingang zu stellen und Flugblätter an die Kunden zu verteilen, die den Supermarkt betraten. Darin baten wir sie, etwas von unserer Liste zu kaufen und es, wenn sie den Markt wieder verließen, in unseren Einkaufswagen zu legen. Ein kleines Team begab sich jedes Wochenende zu einem anderen Supermarkt, und die Bereitwilligkeit, mit der die Leute jeweils spendeten, war umwerfend. Es war außerdem ein sehr effizientes Verfahren, denn ein Team auf der Ladefläche unseres Lastwagens konnte gleich jedes Produkt kategorisieren und entsprechend verpacken, wenn es hereingegeben wurde. Normalerweise kamen wir dann am späten Abend mit vollen Kisten in unser Lager, die schon fertig beschriftet waren mit Aufschriften wie Dosengemüse, Pasta, Zucker und so weiter und nur noch ausgeliefert werden mussten.
Fast sämtliche Kisten, die wir zum Verpacken benutzten, wurden von Whiskyfirmen zur Verfügung gestellt. Es waren robuste Kisten, ideal für unsere Zwecke geeignet, allerdings konnten sie gewaltige Aufregung und Empörung bei Grenzkontrollen auslösen. Zollbeamten und Polizisten blieb die Luft weg, wenn wir auf ihre Aufforderung reagierten, die Ladefläche unseres Lastwagens zwecks Inspektion zu öffnen. Sie vermuteten natürlich als Erstes, dass diese „Wohltätigkeitsheinis“ in Wahrheit Whiskyschmuggler waren. Und sie machten immer einen etwas enttäuschten Eindruck, wenn wir die Kisten öffneten und der banale Inhalt zum Vorschein kam.
Im Lauf der Zeit stellten wir ein interessantes Muster bei den Supermarktsammlungen fest: Wir erhielten in den ärmeren Vierteln Glasgows – häufig in Siedlungen mit den schlimmsten Arbeitslosigkeits- und Armutsquoten in ganz Großbritannien – deutlich mehr Spenden als in den wohlhabenderen Vororten. Nicht dass ich behaupten könnte, die Gründe dafür zu kennen – aber es war jedenfalls ein reales und sehr deutlich ausgeprägtes Phänomen.
Etwas schwerer fiel es mir, „Spendermuster“ vorherzusagen, wenn ich auf der Straße eine Geldsammlung durchführte. Diese Tätigkeit fand ich wesentlich unangenehmer als die Supermarkt-Sammlungen. Mir kam es irgendwie schwieriger vor, einen Fremden um Geld zu bitten statt um Essen. Obwohl ich ganz offenkundig nicht für mich selbst sammelte, fiel es mir aus irgendeinem Grund sehr schwer, mit einer Sammelbüchse zu rasseln und zu sagen „Bitte helfen Sie den Menschen von Bosnien-Herzegowina“. Es war immer ein Moment von Erniedrigung damit verbunden; möglicherweise eine winzige Ahnung davon, was es bedeutet, für die eigenen Bedürfnisse betteln zu müssen.
Um mir die langen Stunden auf der Straße zu vertreiben, machte ich mir manchmal ein Spiel daraus, zu raten, wie die Fußgänger reagieren würden, wenn sie auf mich mit meiner Sammelbüchse zukamen: der muskulöse Typ mit den Tattoos; die Frau mit dem Kinderwagen; die Schulkinder in der Mittagspause; der Straßenmusikant, der genervt war von meiner Anwesenheit in „seinem Revier“. Immer wieder wurde ich überrascht. Ich konnte überhaupt keine Muster erkennen, keine Kategorien von Leuten aufstellen und sie in Beziehung setzen zu der Wahrscheinlichkeit, mit der sie ein paar Münzen in meine Büchse warfen. Und ich konnte auch keine unterschiedlichen Muster bei Männern oder Frauen erkennen, bei Jungen oder Alten, bei eher bescheiden oder eher selbstbewusst Auftretenden, bei Sängern alter deprimierender schottischer Lieder oder peppig, aber falsch spielenden Dudelsackspielern. Ich bin sicher, andere haben auf diesem Gebiet wissenschaftliche Experimente durchgeführt und könnten mich widerlegen; ich stellte jedenfalls fest, dass Menschen jeglicher Art extrem großzügig und extrem geizig sein können.
Einen noch sehr viel krasseren und interessanteren Kontrast erlebten wir, als wir die Erlaubnis erhielten, im Vorfeld eines nationalen Pokalendspiels eine Straßensammlung vor dem Fußballstadion zu veranstalten; das Spiel wurde ausgetragen zwischen den beiden Giganten des schottischen Fußballs, den Glasgow Rangers und Celtic Glasgow. Das Konkurrenzverhältnis zwischen diesen beiden Teams steht in dem Ruf, womöglich die leidenschaftlichste Rivalität im gesamten Weltfußball zu sein, repräsentieren sie doch die Gruppierungen der Protestanten und der Katholiken Westschottlands und den reichlich abstoßenden historischen Ballast, der damit verbunden ist. Wir waren also nicht ganz frei von gewissen Befürchtungen, als wir uns mit unseren Sammelbüchsen unter die Fans mischten, die zu Zehntausenden ins Stadion strömten. Ich fragte mich, ob sie uns überhaupt wahrnehmen oder auf unsere Bitten reagieren würden. Meine Sorgen waren unberechtigt – sie spendeten in ganz unglaublichem Ausmaß. Es war die ergiebigste Spendenaktion, die wir bis dahin erlebt hatten. Ich vermute, dass ein bestimmtes Wettbewerbselement mit hineinspielte. Vielleicht nahmen sie ja an, dass wir die Erträge getrennt ermitteln würden, einerseits die von den Fans in Blau, andererseits die von den Fans in Grün, und das Ergebnis würden wir dann an die große Glocke hängen, sodass jeder es mitbekam. Oder vielleicht begünstigten auch die vor dem Spiel konsumierten Biere das Öffnen von Herzen und Geldbeuteln. Was auch immer die Gründe sein mögen (und ich bin sicher, in Wahrheit waren sie sehr viel ehrenwerter als meine Vermutungen), jedenfalls sammelten wir in der kurzen Zeit, während die Fans ins Stadion eingelassen wurden, eine absolute Rekordsumme. Die Verbindung mit diesen Fußballvereinen in Glasgow hatte übrigens auf unterschiedliche Weise noch weiter Bestand.
Ein paar Jahre nach dieser Episode wurde ich zwei berühmten ehemaligen Fußballern vorgestellt, Frank McGarvey und Gordon Smith, die für Celtic bzw. die Rangers gespielt hatten. Sie beschlossen, ein Benefizspiel zwischen ehemaligen Spielern beider Clubs zu organisieren, um Spenden für uns einzutreiben. Als Celticfan und begeistertem Fußballspieler konnte mir natürlich nichts Besseres passieren. Sie buchten ein kleines Stadion im Glasgower East End und riefen ihre Freunde aus den beiden Clubs an. Viele berühmte Spieler waren bereit teilzunehmen.
Am Tag vor dem großen Ereignis redete ich kurz mit Frank über einige letzte Vorbereitungen. Ich wollte wissen, ob sein Team auch in Form war.
„Na ja, nicht so ganz“, antwortete er. „Einige haben auf den letzten Drücker noch abgesagt. Pack mal am besten deine Fußballschuhe ein.“
Ich lachte.
„Nein, ich mach keine Witze. Nimm deine Schuhe mit. Du bist schön groß, und du hast mir erzählt, dass du ein bisschen spielen kannst.“
Er hängte auf. Ich hörte auf zu lachen. Dann rief ich meine Freunde an, um ihnen die Neuigkeit mitzuteilen. Dann suchte ich nach meinen alten Schuhen, die ich schon seit einer Weile nicht mehr gebraucht hatte. Am nächsten Tag saß ich dann in der Umkleidekabine mit einer Gruppe von Spielern, lauter Kindheitshelden von mir, die sich über Taktik unterhielten und wie man die Rangers schlagen konnte. Ich erinnerte mich an zahlreiche Träume aus meiner Kindheit, die ganz genauso verlaufen waren. Das war schon sehr besonders.
„Wo willst du spielen?“, fragte Frank, als er begann, das Team zu organisieren, und ich brauchte eine Weile, bis ich merkte, dass er mit mir sprach.
„Hmm, also – vorne, im Sturm.“
„Prima. Dann sind wir beide die Stürmer.“ Er lächelte. „Mach dir keinen Kopf. Zusammen kriegen wir das hin.“
Und so kam es dazu, dass ich tatsächlich in einem Fußballspiel von Celtic gegen die Rangers mitkickte. Faktisch war ich gegen einen ihrer berühmtesten ehemaligen Spieler eingesetzt, den gegenwärtigen Kapitän der englischen Nationalmannschaft, Terry Butcher. Er ist ein Riese. Ich glaube, er hat mich während des Spiels geschont, obwohl seine Freundlichkeit nicht so weit ging, mir allzu viele Ballkontakte zu ermöglichen. Ich habe auch wirklich nicht sehr gut gespielt, habe einige Torchancen vergeigt. Und wir haben das Spiel verloren. Einige meiner Freunde aus Dalmally waren mit mir gekommen, um mich spielen zu sehen, was mir viel bedeutete, obwohl sie sich dann hinterher in der Kneipe damit amüsierten, meine Leistung zu analysieren.
Diese ganze Erfahrung fühlte sich an, als wolle mir Gott eine kleine süße Belohnung geben. Ein wundervolles Überraschungsgeschenk. Etwas vollkommen Unerwartetes, das aber in Beziehung zu einem Herzenswunsch von mir stand (und zwar einem kindlichen Herzenswunsch, den ich als Erwachsener nicht auszusprechen gewagt hätte) oder zu einer Sehnsucht, die nur er kannte. Und dazu das Gefühl, dass er wollte, dass ich wusste: Er versteht mich. Etwas dergleichen ist mir seither noch viele Male passiert – unverdiente, unerwartete Geschenke aus heiterem Himmel, die nur ausgepackt werden können, wenn man sich wie ein Kind fühlt.
Mittlerweile gab es auch einiges zu tun, das etwas weniger spannend war. Nun, da sich das Ganze zu einer kontinuierlichen Mission entwickelt hatte, war uns klar, dass wir eine Wohltätigkeitsorganisation anmelden mussten. Der Name, der ursprünglich auf unserem alten Truck gestanden hatte, war Scottish Bosnia Relief (Schottische Bosnien-Hilfe). Als das Wort „Bosnien“ im Lauf des Krieges politisch heikel wurde, stellte es ein Risiko dar, wenn wir durch bestimmte Gebiete oder zu Grenzstellen kamen; deshalb kratzten wir diese Buchstaben weg. Dann beschlossen wir, das Wort International in den verkratzten Raum zwischen Scottish und Relief zu setzen. Schließlich, so dachten wir uns, lieferten wir ja nach Kroatien ebenfalls Hilfsgüter, und wer wusste schon, wohin wir in Zukunft noch kommen würden? Das war jetzt also der Name der Organisation: Scottish International Relief.
Mein Bruder machte sich dann die Mühe, diverse Ideen für ein Logo zu entwerfen. Wir entschieden uns für das blaue keltische Kreuz, das er gezeichnet hatte. Darauf geschrieben waren die Buchstaben SIR, die Abkürzung, unter der wir für viele Jahre auftraten. Dieses alte Symbol, ein Kreuz auf einem kleineren Kreis, sieht man in Schottland und Irland überall. Es bezeichnet den Übergang unserer Vorväter vom Heidentum zum Christentum, von der Anbetung der Sonne (der Kreis) zur Anbetung Jesu Christi (das Kreuz).
Dann brauchten wir einen Slogan, und wieder saßen wir um den Familientisch und bastelten an diversen Ideen herum. Letztlich einigten wir uns auf „Delivering Hope“ („Hoffnung bringen“). „Hoffnung“ war schon immer mein Lieblingswort. Wir diskutierten auch kurz die Frage, ob die Organisation als Erweiterung unseres Craig Lodge Family House of Prayer laufen sollte, das als wohltätige Einrichtung schon seit mehreren Jahren registriert war. Es ging letztlich um die Frage, ob wir eine katholische oder eine überkonfessionelle Organisation wollten. Da wir alle der Meinung waren, dass dies ein Werk Gottes und eine Frucht von Medjugorje war, spürten wir auch alle sehr stark, dass die Organisation offen für alle Gläubigen und auch für Nichtgläubige sein sollte.
Wir gründeten also eine neue, überkonfessionelle Wohltätigkeitsorganisation, und außer den Familienmitgliedern baten wir in den ersten Vorstand auch zwei nichtkatholische Freunde, die in der Vergangenheit schon immens viel geholfen hatten. Wir arbeiteten mit einem Anwalt in Oban, der nächsten größeren Stadt, zusammen, der uns bei der Formulierung einer Satzung half, und bei unserer ersten ziemlich informellen Versammlung wählten wir meinen Schwager Ken, Ruths Ehemann, zum Vorsitzenden. Der Vorstand sollte sich drei- bis viermal im Jahr treffen, und Julie und ich erledigten mit enormer Unterstützung von Mum und Dad (die trotzdem auch noch das Einkehrzentrum leiteten) und mit Hilfe von zahlreichen Freiwilligen die tägliche Arbeit.
Julie, die neben all ihren anderen Gaben auch noch ein Talent für Verwaltungsangelegenheiten hatte, übernahm die Verantwortung für die Dankesbriefe an die Spender und die Speicherung ihrer Namen und Adressen. Ich erledigte die Fahrten innerhalb von Schottland, nahm die Sachspenden entgegen und kümmerte mich um die Planung und Vorbereitung für die Auslieferungen. Dazu gehörten die Kommunikation mit unseren Partnern in den diversen Regionen, in denen Hilfe gebraucht wurde; Anforderungslisten, der Papierkram mit dem Zoll, Streckenplanung und die Versuche, die Löcher im Dach unseres LKWs zu reparieren. Außerdem verfasste ich die Aufrufe und Newsletter, die wir mittlerweile an die wachsende Zahl unserer Unterstützer versandten, und zu meiner großen Überraschung machte mir diese Tätigkeit richtig Freude. Ich begann sogar, damit noch ein bisschen Geld reinkam (ich war nach wie vor ein unbezahlter ehrenamtlicher Mitarbeiter, lebte von meinen Ersparnissen, und bei Mum und Dad musste ich ja für die Unterkunft nichts bezahlen), einige Artikel über anderweitige Themen zu schreiben, und verkaufte sie an diverse Zeitungen. Und natürlich verbrachten wir einen gewaltigen Anteil unserer Zeit damit, mit unserem Truck in Europa hin- und herzufahren. In dem Jahr seit unserem ersten Trip mit dem Landrover war ich über zwanzigmal nach Bosnien-Herzegowina gefahren.
Jedes Mal, wenn ich diese Fahrten machte, lernte ich etwas, und mindestens genauso viel lernte ich von den Menschen, die auf alle möglichen Arten unsere Arbeit daheim unterstützten. Ich war tief bewegt – und herausgefordert von der Großzügigkeit, die ich erfuhr.
Mrs. Duncan Jones lebte in einem kleinen Häuschen – der Art, von der man in Märchen hört – am Ende einer arg holprigen Straße in der Nähe des Dorfs Kilmartin. Wir besuchten sie immer gern mit unserem Lieferwagen, um diverse Dinge mitzunehmen – sowohl ihre eigenen Spenden als auch Sachen, die sie von Freunden aus der Gegend bekommen hatte. Jedes Mal, wenn wir sie besuchten, servierte sie uns eine Portion ihrer fantastischen Suppe, und „um sicherzustellen, dass auf der Reise nach Bosnien das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt …“, machte sie für uns die köstlichsten Früchtekuchen, die ich je gegessen habe. Diese Früchtekuchen enthielten eine ganz erstaunliche Menge Brandy. Manchmal deponierte sie sie für uns an einer bestimmten Tankstelle auf unserer Route nach Glasgow, und dazu noch einen Zettel mit einigen aufmunternden Worten. Ihr Mann, ein Pfarrer der Episkopalen, starb kurz nachdem wir sie kennengelernt hatten, doch ihr unermüdlicher Einsatz und ihre Unterstützung ließen zu keiner Zeit nach. Ich erinnere mich an einen Tag, an dem ich sie besuchte, um wieder eine Wagenladung Spenden mitzunehmen. Als sie mir die Suppe servierte, sah ich, dass sie statt einer Schöpfkelle einen alten Becher nahm, um meine Schale zu füllen. Jetzt erst bemerkte ich die leeren Schränke und Regale in ihrer Küche – offenbar war fast alles ausgeräumt. Besorgt fragte ich, ob es ihr gut ginge.
„Ja, alles prima“, sagte sie lächelnd.
„Ziehen Sie um?“, fragte ich.
„Nein, nein. Mir gefällt es hier. Ich habe einfach über diese Familien in Bosnien nachgedacht, die in ihre Wohnungen zurückkehren und gar nichts mehr haben. Sie brauchen diese Dinge nötiger als ich. Ich meine, wozu braucht denn eine alte, alleinlebende Frau wie ich eine Schöpfkelle? Oder Extra-Platten und Schüsseln, die ich sowieso nie benutze?“
Ich rollte von ihrem Haus den Hügel hinunter, den Lieferwagen voll mit ihren Haushaltsgegenständen und neben mir auf dem Beifahrersitz den sorgfältig eingepackten Kuchen. Im Rückspiegel sah ich die winkende Mrs. Duncan Jones. Sie lächelte übers ganze Gesicht.
Es gab noch weitere Herausforderungen für mich. Wenige Wochen zuvor unterhielten sich Julie und ich (wir waren mittlerweile verlobt) auf der letzten Etappe der Rückreise von einem weiteren Trip nach Bosnien-Herzegowina, und sie begann, vorsichtig-freundliche Fragen wegen meiner Schüchternheit zu stellen – und wegen meiner Art, mich zu kleiden. Ich hatte ihr zu ihrer nicht geringen Bestürzung mit einer gewissen Selbstgefälligkeit mitgeteilt, dass alle meine Klamotten (abgesehen nur von meinem Kilt) nicht mehr als eine Waschmaschinenladung ausmachten. Es war ein ziemlicher Schock für sie, dass ich nicht deswegen so abgerissen aussah, weil ich gerade in der Gegend herumfuhr und den ganzen Tag Lastwagen belud.
„Nun, das wird dann wohl der Grund dafür sein, dass alle deine Klamotten denselben grässlichen Grauton haben“, sagte sie trocken nach kurzem Schweigen.
„Was willst du eigentlich machen, wenn wir mit dieser Sache hier fertig sind? Wirst du wieder als Fischfarmer arbeiten?“, fragte sie mich.
Ich dachte kurz nach und sagte dann: „Ich weiß es eigentlich noch nicht. Das Einzige, was ich sagen kann: Es wird nichts, bei dem ich mit Leuten zu tun haben muss!“
Im weiteren Verlauf der Monate aber, und weil ich immer mehr Zeit damit zubrachte, mit Menschen zu reden, die ich nicht kannte, wuchs mein Selbstvertrauen allmählich. Julie konnte mich sogar so weit ermutigen, dass ich manchmal nachgab und Vorträge vor Unterstützergruppen hielt. Und irgendwie fing ich an, diese Begegnungen zu mögen – ich hatte das Gefühl, dass ich etwas konnte und dass ich es gut konnte. Ich stellte fest, dass unsere Unterstützer regelrecht hungerten nach Informationen über unsere letzten Hilfstransporte. Wir fingen an, Bilder zu knipsen, und kauften einen alten Diaprojektor, um unsere Vorträge anschaulicher zu machen. Und wir erweiterten unseren Newsletter um Bilder. Ich entwickelte allmählich eine enorme Zielstrebigkeit, wenn es darum ging, den Hilfsbereiten die Bedürfnisse und Äußerungen der Notleidenden zu vermitteln. Eine Zeitlang dachte ich sogar, ich könnte doch versuchen, Journalist zu werden. Eines Tages stieß ich auf eine Anzeige, mit der eine Fischzucht-Zeitschrift einen Journalisten suchte, und ich bewarb mich. Zu meiner Überraschung luden sie mich nach Edinburgh zu einem Gespräch ein. Die beiden Männer auf der anderen Seite des Tischs waren angetan von den Texten, die ich eingeschickt hatte, und alles schien richtig gut zu laufen. Dann stellten sie mir eine hypothetische Frage:
„Was würden Sie tun, wenn Ihnen Beweise in die Hände kämen, dass eine Firma, die ein wichtiger Werbekunde für unsere Zeitschrift ist, ein Produkt herstellt – beispielsweise eine Chemikalie zur Parasitenbeseitigung bei Lachsen –, das sich äußerst schädlich auf die Schalentiere der Region auswirkt?“
„Ich würde natürlich einen den Tatsachen entsprechenden, gut recherchierten Artikel verfassen, der darüber informiert. Es wäre eine wichtige Geschichte, und die Leser hätten ein Recht, die Fakten zu erfahren“, sagte ich im Brustton der Überzeugung – nicht eine Sekunde kam mir der Gedanke, dass meine Antwort hoffnungslos naiv war. Aber dann sah ich, wie die beiden sich anschauten, der eine mit hochgezogenen Augenbrauen, der andere süffisant lächelnd. Zu spät wurde mir bewusst, dass meine Fantasien, mit Preisen überschüttete journalistische Beiträge als Waffe im Kampf um Wahrheit und Gerechtigkeit zu verfassen, nicht unbedingt mit einem Job bei einem schottischen Fischzuchtmagazin kompatibel waren.
Julie wartete draußen auf mich. Als ich ihr erzählte, wie es gelaufen war, mussten wir beide lachen – und wir merkten, dass wir eigentlich tief im Innern nie wirklich davon überzeugt gewesen waren. Faktisch waren wir von gar nichts überzeugt, wenn es nicht mit dem vereinbar war, was wir bereits machten. Und Julie, meine Verlobte, war eine Frau, die nie, nicht ein einziges Mal, irgendwelche Sorgen über unsere zukünftige finanzielle Sicherheit äußerte.
Allerdings ging uns tatsächlich das Geld aus. Es war mittlerweile ein Jahr her, dass ich meinen Job aufgegeben hatte. Wir mussten ein paar Entscheidungen treffen. Der Stiftungsrat schlug vor, ich solle mich in bescheidenem Rahmen bezahlen lassen, damit diese Arbeit, die an Umfang ständig zunahm, weiterwachsen konnte. Und nach vielem Diskutieren, Nachdenken und Beten erklärte ich mich schließlich einverstanden. Es war eine sehr schwere Entscheidung. Zu unserem ursprünglichen Plan hatte das nicht gehört, und ich fühlte mich überhaupt nicht wohl damit, auch nur einen kleinen Teil des uns gespendeten Geldes abzuzweigen, um selber davon zu leben. Wir wollten, dass unsere Organisation so kostengünstig und mit so vielen Freiwilligen wie möglich arbeitete, und auch heute ist das noch unser Bestreben. Aber die Alternative für mich war eben, mir einen anderen Job zu suchen und die organisatorische Arbeit zurückzuschrauben, und das ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, als uns immer mehr Menschen unterstützten und ermutigten, unsere Arbeit fortzusetzen. Und ein einziger geringer Lohn stellte lediglich einen sehr geringen Prozentsatz des Gesamtumfangs der Spenden dar. Ich nahm das Angebot also an, und ich bin sehr froh, dass ich es getan habe.
Wir suchten weiterhin unermüdlich nach den kostengünstigsten Möglichkeiten, die Hilfsgüter zu überbringen, die uns die Leute zur Verfügung stellten. Ich war froh, dass sich mit unserem neuen, größeren LKW die Transportkosten entscheidend reduziert hatten. Jetzt störte es mich allerdings, dass wir bei der Rückfahrt durch ganz Europa jedes Mal mit einem riesigen leeren Anhänger unterwegs waren. Ich fragte herum, ob es vielleicht irgendjemanden gab, der uns dafür bezahlen würde, dass wir etwas von Osteuropa zurücktransportierten, was die Kosten weiter senken würde. Damals lernte ich Sir Tom Farmer kennen, möglicherweise Schottlands bekanntester Unternehmer und Gründer von Kwik Fit, der riesigen Autoreifen- und Auspuff-Firma. Er hatte vor Jahren Mum und Dad in unserem Einkehrzentrum in Dalmally besucht und sie sehr großzügig unterstützt. Es stellte sich heraus, dass er damals viele Reifen aus Slowenien und Norditalien nach Schottland importierte. Er fand es prima, dass wir einen Teil des Transports als „Rückweg-Fuhre“ zu seinen Kwik-Fit-Niederlassungen übernehmen konnten, und zahlte uns den üblichen Preis. Sir Tom wurde in den nächsten Jahren ein wunderbarer Freund und Lehrer, er war immer für mich da, und ich lernte eine Menge von ihm.
„Bewerte nicht deine Ziele, sondern ziele deine Werte an“ („Target your values, don’t value your targets“), empfahl er mir, als ich Wachstumsraten oder ehrgeizige Pläne erwähnte. Bei anderen Gelegenheiten, wenn ich mich ausschweifend über neue Ideen äußerte, brachte er mich wieder auf die Kernfrage zurück, indem er sagte: „Schuster, bleib bei deinem Leisten!“ („Magnus, just stick to the knitting!“)
Die Sache mit den Rückkehr-Ladungen funktionierte großartig, und im Lauf der Zeit arrangierten wir dann über Agenten auch andere Frachtinhalte (Kühlschränke, flachverpackte Möbel etc.), die wir auf dem Heimweg mitnehmen konnten. Um das machen zu können, brauchten wir eine Lizenz für den Betrieb eines Fuhrunternehmens. Ich musste mir also ein paar Informationen über das internationale Transportwesen aneignen und eine Prüfung ablegen. Durch diese zusätzlichen Transporte konnten wir beträchtlich Kosten einsparen, allerdings stellte ich irgendwann fest, dass ich nun meine meiste Zeit damit zubrachte, eine Speditionsfirma zu leiten. Ich merkte, dass ich eigentlich Besseres zu tun hatte. Ich überdachte das Ganze also noch einmal vom anderen Ende.
Ich beobachtete auf unseren Reisen, dass es viele LKWs aus Osteuropa gab, die Waren nach England lieferten. Die hatten doch, wenn sie zurückfuhren, sicher ihrerseits leere Anhänger, die man befüllen konnte! Und genauso machten wir dann weiter. Nun, da wir verlässliche Partner hatten, beispielsweise das Familienzentrum in Zagreb, konnten wir in Schottland einen kroatischen Lastwagen beladen und einen vernünftigen Preis dafür bezahlen, dass sie unsere Transporte übernahmen. Das wurde unsere bevorzugte Vorgehensweise: Wir konnten uns jetzt darauf konzentrieren, weiter Aufmerksamkeit für unsere Arbeit zu wecken, Spenden zu sammeln und unseren Spendern zu danken. Außerdem kamen wir so auch mit dem ständigen Weiterwachsen unseres Projekts zurecht. Auf dem Höhepunkt unserer Hilfslieferungen, während der Kosovo-Krise im Jahr 1999, beluden wir vor unseren mittlerweile vier Glasgower Lagerhallen zwei Monate hintereinander fast jeden Tag einen 40-Tonnen-Truck. Wir baten eine Radiostation in Glasgow, einen Aufruf für weitere Freiwillige zu senden, und im Laufe nur eines einzigen Wochenendes meldeten sich fünfhundert Menschen in unseren Lagern, die uns halfen, die Sachen zu sortieren und zu verpacken. Mit den LKWs wurden die Spenden dann nach Split gebracht, wo sie mit tatkräftiger Unterstützung durch den genialen Dr. Marijo, unseren bewährten Freund in Kroatien, für den letzten Abschnitt der Reise nach Albanien auf Schiffe verladen wurden. Dort trafen gerade sehr viele Flüchtlinge aus dem Kosovo ein.
Im Lauf der Zeit veränderte sich die Art von Sachspenden, die wir verschickten. Als in bestimmten Gebieten Bosnien-Herzegowinas und Kroatiens wieder eine gewisse Ruhe einkehrte, begannen die Flüchtlinge, in ihre zerstörten, geplünderten Häuser zurückzukehren. Dadurch entstand ein großer Bedarf an Dingen, um wieder ein normales Leben anfangen zu können. Jetzt beluden wir unsere Fahrzeuge also mit Essbesteck, Küchenutensilien und Handwerkszeug.
Eine Gruppe von Leuten, die die Möglichkeit erwogen, wieder heimzukehren, war gut mit uns befreundet. Es waren bosnische muslimische Flüchtlinge, die in Glasgow lebten. Sie waren 1992 aus ihrer Heimatstadt Bosanski Petrovac geflohen, die in einem von Serben kontrollierten Teil von Bosnien-Herzegowina lag, und irgendwann, nach ihrer Evakuierung durch die UNO, waren sie zufällig in Glasgow gelandet. Hier kamen sie jetzt regelmäßig in unser Lager, um uns als freiwillige Helfer beim Vorbereiten der Hilfsgüter zum Transport in ihre Heimat zur Seite zu stehen. Sie wurden regelmäßige Mitarbeiter im Lager-„Team“ von Freiwilligen – sie sagten, hier mitmachen zu können gebe ihrem zerbrochenen Leben einen neuen Sinn. Sie wollten nicht nur unbedingt die englische Sprache und den Umgang mit einer ihnen fremden Kultur lernen; sie fanden auch das Leben im 17. Stock eines Wohnblocks in der City sehr anders als ihr früheres Leben auf dem Dorf. Es war eine Gruppe von zwölf Leuten, lauter enge Verwandte, und manchmal luden wir sie nach Dalmally zum Barbecue ein.
Suad und seine Frau Zlata, die einen kleinen Sohn hatten, waren ungefähr in unserem Alter, und es entstand eine enge Freundschaft. Ihr Englisch wurde immer besser, und nun wollten sie uns mehr von dem erzählen, was sie durchgemacht hatten. Sie erklärten, vor dem Krieg hätten in ihrem Dorf Serben und Muslime friedlich miteinander gelebt. Viele Nachbarn waren Serben, die sie schon ihr Leben lang gekannt hatten.
„Wir arbeiteten gerade auf den Feldern, wie wir es immer taten“, erklärte Suad. „Plötzlich wurde geschossen. Die Stimmung im Dorf war spürbar gespannt. Wir wussten alle, was in anderen Teilen von Bosnien-Herzegowina geschah. Aber nicht einmal eine Woche davor waren wir von unseren serbischen Nachbarn zu einem Fest eingeladen worden. Die Schüsse kamen aus der Nähe dieses Nachbarhauses, neben unserem Feld. Mein Vater und mein Bruder Mersad fielen zu Boden. Sie bluteten. Ich bin auch getroffen worden.“ Und er zeigte auf seinen vernarbten Arm.
„Es hat lang gedauert, bis mein Bruder Mersad gestorben ist. Er schrie immer wieder: ‚Suad, hilf mir‘, aber ich konnte nicht. Ich war selber voller Blut.“ „Wir haben vom Haus aus alles gesehen“, sagte Zlata leise. „Wir wollten zu ihnen aufs Feld hinausrennen, aber der Serbe lauerte in ein paar Büschen in der Nähe und schoss. Er hätte uns umgebracht. Edin, der Sohn von Mersad, war zehn. Er versuchte dauernd zu seinem Papa rauszurennen, und wir mussten ihn zurückhalten. Irgendwann, als es dunkel wurde, schaffte Suad es, ins Haus zu kriechen.“
Am nächsten Tag quetschten sie sich in von den Vereinten Nationen bereitgestellte überfüllte Busse, mit denen sie nach Zagreb evakuiert werden sollten. Sie gerieten unter serbischen Beschuss; es war eine entsetzliche Reise in der Hitze, ohne Proviant und Wasser.
„Ich musste mein Hemd als Windel für Zlatan benutzen – er war damals noch ein Baby“, erzählte Zlata uns mit Tränen in den Augen.
1995 wendete sich das Blatt. Die Serben hatten die Kontrolle über diesen Teil von Bosnien-Herzegowina weitgehend verloren. Wir konnten wieder anfangen, Hilfsgüter in die Stadt Bihac zu liefern, die eine entsetzliche, drei Jahre währende Belagerung hinter sich hatte, und dann auch in die Heimatstadt unserer Freunde, nach Bosanski Petrovac. Suad erhielt jetzt Nachrichten von Leuten, die in ihre Stadt zurückgekehrt waren, und sie drängten ihn, doch auch wieder heimzukommen.
Sie beschlossen daraufhin tatsächlich heimzugehen – obwohl es dort keine Arbeitsplätze gab, keine Sicherheitsgarantien, nur ein schwer beschädigtes Haus und einige Felder, in denen womöglich Minen lagen. Und wir beschlossen, sie zu begleiten. Wir befüllten einen großen Anhänger mit all den Besitztümern, die sie in Glasgow angesammelt hatten, außerdem diverse weitere Waren und Werkzeuge, die ihnen helfen sollten, wieder ganz von vorn anzufangen. In der Zwischenzeit hatten wir außerdem für ein psychiatrisches Krankenhaus in Kroatien, das wir regelmäßig mit Hilfsgütern belieferten, einen Minibus gespendet. Wir planten jetzt also, dass ich die Gruppe in diesem Minibus heimfahren, das Fahrzeug dann im Krankenhaus lassen und mit dem Flugzeug wieder zurückkehren würde. Als die BBC von unserem Vorhaben erfuhr, beschloss man dort, eine Dokumentation über unsere Reise zu drehen. Wir winkten also für die Kameramänner dem prall gefüllten LKW hinterher, als er vor uns von dem Platz vor unserem Lagerhaus in Glasgow wegrollte, und stiegen in unseren Bus. In der Gruppe waren alle Altersstufen vertreten: von einem Zweijährigen bis zur alten Großmutter. Wir brachen auf in Richtung Süden – zur Fähre und dann aufs europäische Festland.
Bei der Ankunft in Belgien hielten wir an der Grenze an und zeigten unsere Pässe. Die Polizei studierte die Papiere der Bosnier und wirkte deutlich gestresst. Sie stellten Fragen und telefonierten. Dann informierten sie uns, dass die Papiere lediglich für die Einreise in Kroatien und Bosnien-Herzegowina gültig waren, aber nicht, um damit die dazwischenliegenden europäischen Länder zu durchqueren. Sie beschlossen daher, uns wieder nach England abzuschieben. Wir stellten auch Fragen und telefonierten, aber das brachte nichts, und schließlich saßen wir dann tatsächlich wieder auf der Fähre nach England.
Mir war klar, dass die Bosnier keine Unterkunft hatten, in die sie in Glasgow zurückkehren konnten, und ihre Habseligkeiten waren – zusammen mit der Film-Crew von der BBC – bereits unterwegs nach Bosnien-Herzegowina. Ich rief Julie an und fragte sie, wie viel Geld wir noch auf dem Konto hätten und was die Flüge von Heathrow kosten würden. Wir stellten fest, dass es genau reichte, um die ganze Gruppe nach Zagreb zu fliegen. Also brachte ich sie vom Fährhafen zum Heathrow Airport und setzte sie ins Flugzeug. Dann fuhr ich erneut Richtung Süden – innerhalb von zwei Tagen bestieg ich meine dritte Kanalfähre und steuerte dann mit dem Bus Zagreb an. Mittlerweile brauchte ich keine Landkarte mehr, um unsere diversen Zielorte im ehemaligen Jugoslawien zu erreichen, und es war toll zu sehen, wie schnell ich – im Vergleich zum langsameren Vorwärtskommen mit dem LKW, an das ich mich mittlerweile gewöhnt hatte – all die Länder durchquerte.
Gleichzeitig arrangierte Julie, dass die bosnischen Familien bei ihrer Ankunft in Zagreb von Marijo in Empfang genommen wurden. Er nahm sie mit zu sich nach Hause, wo sie bleiben konnten, bis ich eintraf. Als ich dann am nächsten Tag ankam, bestiegen alle wieder den Bus für den letzten Abschnitt dieser emotionalen Reise über die Grenze nach Bosnien-Herzegowina hinein. Ich staunte über die Dokumentation, die die BBC über diese Reise gemacht hatte, wie geschickt sie ihr Material zusammengefügt hatten: Nichts deutete auf die Abschiebungen und Flüge hin, die zwischen der Abreise in Glasgow und der Ankunft in Bosnien-Herzegowina stattgefunden hatten!
Nach dem üblichen Überprüfen der Papiere an der bosnischen Grenze wurden wir durchgewinkt. Zlata durchbrach das Schweigen mit einem Ruf.
„Wir sind keine Flüchtlinge mehr!“
Alle im Bus weinten. Und das Schluchzen nahm noch zu, als wir schließlich im zerstörten Bosanski Petrovac ankamen. Jedes Gebäude war voller Einschusslöcher, und viele Häuser waren nur noch erbärmliche Schutthaufen.
Die Begrüßung durch enge Freunde, die sie seit über drei Jahren nicht gesehen hatten, war voller ungestümer Emotionen. Es gab so viele Neuigkeiten. So viele schreckliche Dinge hatten sie erlebt, die sie nie mit anderen hatten besprechen, nie hatten verarbeiten können. Und so viele Veränderungen in ihrer alten Stadt. Die Serben waren jetzt nicht mehr da. Es war nun eine muslimische Stadt – so muslimisch wie nie zuvor. Während viele Häuser noch zerstört waren, wurde bereits eine neue Moschee gebaut. Muslime wie diejenigen, mit denen ich gerade angekommen war, hatten ihre Religion zuvor gar nicht aktiv praktiziert. Ich hatte während des Krieges sogar einige junge Muslime getroffen, die mir sagten, sie hätten vor dem Krieg überhaupt nicht gewusst, dass sie Muslime waren. Lediglich ihr Familienname signalisierte ihre Religion – und besiegelte damit manchmal ihr Schicksal.
Bosanski Petrovac war zwar ihre Heimatstadt, und sie waren außerordentlich froh, wieder hier zu sein, doch in mancher Hinsicht war es ein fremdes Land. Ich kam mit der Situation nicht gut zurecht. Das Austauschen von Erfahrungen und diese Begegnungen, ich mitten darin – es war alles so persönlich und intim, dass ich eigentlich nur den Wunsch verspürte, sie möchten das, so gut sie konnten, unter sich abklären, ohne mich.
Ich brach sehr früh am nächsten Morgen von Bosanski Petrovac auf. Suad und seine Familie schliefen noch – in ihrem eigenen Haus. Ich hätte mich eigentlich beschwingt fühlen müssen, aber die Fahrt war alles andere als angenehm. Viele Meilen weit fuhr ich durch eine ländliche Gegend und durch Dörfer, in denen es überhaupt keine Menschen mehr gab. Das einzig Lebendige außer mir waren wilde Hunde, die durch Trümmer und Müll stromerten. Ich befand mich hier in einem Teil der Krajina, einem Gebiet, das im Krieg ganz überwiegend von den Serben besetzt gewesen war. Erst vor Kurzem waren sie hier besiegt worden, und mir wurde zunehmend bang, als ich so ganz allein durch diese Ödnis fuhr. Ich fing an, mich zu fragen, ob die Leute in Bosanski Petrovac, die ja auch gerade erst wieder zurückgekehrt waren, tatsächlich über die aktuelle Lage Bescheid wussten, als sie mir sagten, es sei sicher, auf dieser Straße nach Kroatien und zur Adriaküste zu fahren, wo die Leute im Krankenhaus auf den Minibus warteten. Es gab keine Straßenschilder und auch sonst keine Möglichkeit herauszufinden, ob ich auf der richtigen Straße war – ich begann mir Sorgen zu machen, ob ich womöglich in eine Gegend geraten könnte, in der ich nicht willkommen sein würde.
Die Stunden vergingen, ohne dass ich irgendwo Menschen sah. Nicht nur Angst, auch ein neuer, überwältigender Hass auf den Krieg und seine Sinnlosigkeit stieg in mir auf. Ich fragte mich, was jetzt wohl aus all den Serben wurde, die gezwungen worden waren, die jetzt leer stehenden Häuser an der Straße und die Dörfer zu verlassen, in denen sie seit Generationen gelebt hatten. Es war ganz klar, dass es in diesem Krieg keine Gewinner gab, sondern nur Menschen, die jeweils auf eigene, schreckliche Weise zu Verlierern wurden.
Irgendwann fand ich schließlich den Weg aus den Bergen Bosnien-Herzegowinas heraus, und am selben Abend war ich dann in einer anderen Welt – aß fantastischen Fisch, mit Blick auf die glitzernde Adria und in Gesellschaft einiger Freunde aus dem Krankenhaus, die sich über ihren neuen Bus freuten.
Erst im Flugzeug auf dem Rückweg fiel mir wieder unser Bankkonto ein. Die 4200 Pfund, die wir für die Flugzeugtickets nach Zagreb ausgegeben hatten, hatten es praktisch auf null reduziert. Die Bitten um Hilfe würden sich stapeln. Und ich fragte mich auch, wie wir einige offene Rechnungen bezahlen und die nächste Lieferung finanzieren sollten. Als ich zu Hause eintraf, konnte eine lächelnde Julie kaum erwarten, mir das Neueste zu erzählen.
„Heute Morgen traf ein Scheck von einem Priester in Irland ein. Wir kennen ihn nicht. Er will keinen Dankesbrief. Er möchte, dass das anonym bleibt“, sagte sie, und ihre Stimme war ganz zittrig. „Es ist ein Scheck über 4200 Pfund.“