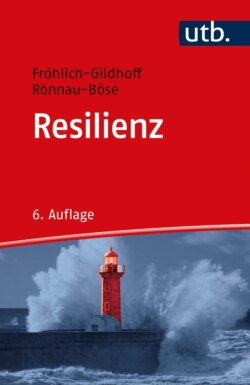Читать книгу Resilienz - Maike Rönnau-Böse - Страница 7
ОглавлениеEinleitung
Verstärkt seit den 1990er Jahren hat sich in Psychologie, Pädagogik und Gesundheitswissenschaften ein Wechsel der Blickrichtung vollzogen: Angestoßen durch Langzeitstudien, vor allen Dingen die Untersuchungen von Emmy Werner auf der Hawaii-Insel Kauai, und durch das Salutogenese-Konzept von Aaron Antonovsky, wird nicht mehr nur auf Ursachen und Bedingungen für die Entstehung psychischer Störungen oder Verhaltensauffälligkeiten geschaut, sondern es wird versucht, neben Risikofaktoren auch Schutzfaktoren zu identifizieren, die für die Entwicklung und den Erhalt seelischer und körperlicher Gesundheit maßgeblich mit verantwortlich sind. Dieser Perspektivenwechsel passt sich ein in Strategien der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Gesundheit in einem sehr umfassenden Sinne, nämlich als „Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens“ definiert und entsprechende Programme und Konzepte zur Förderung von Gesundheit propagiert.
Zugleich ergeben sich aus dieser Sichtweise neue Dimensionen für die Präventionsforschung: Es geht nicht mehr nur darum (Fehl-) Verhaltensweisen zu minimieren oder Verhältnisse zu ändern, die bei Menschen zu Erkrankungen oder Störungen führen, sondern es geht ebenso darum, Bedingungen zur Förderung seelischer und körperlicher Gesundheit zu gestalten. Hierzu gehört auch die Entwicklung von Fähigkeiten zu einer gelingenden Lebensbewältigung, sogenannten „life skills“, sowie zur Erlangung von Lebenszufriedenheit – insbesondere im Zusammenleben mit anderen Menschen.
In diesem Zusammenhang ist das Konzept der Resilienz, also der seelischen Widerstandskraft, entstanden und weiterentwickelt worden. Die Wurzeln für die Fähigkeit zur Resilienz werden schon in frühen Lebensjahren gelegt, und so hat die Förderung von Resilienz eine gewichtige Bedeutung für unterschiedlichste Disziplinen und Praxiszusammenhänge. Die Betrachtung von Schutzfaktoren, aber auch der Faktoren zu gelingender Lebensbewältigung, wie Resilienz, nimmt zunehmend in der Entwicklungspsychologie und klinischen Psychologie sowie innerhalb von Heil- / Sonderpädagogik breiteren Raum ein. Ebenso gewinnt in Sozialpädagogik bzw. Sozialarbeit das Thema Prävention und Resilienzförderung an Bedeutung: In diesen Disziplinen geht es zunehmend nicht mehr nur darum, benachteiligte oder (verhaltens-)auffällige Kinder, Familien und einzelne Erwachsene zu begleiten und zu unterstützen, sondern bereits im Vorfeld günstige Bedingungen für eine gesunde Entwicklung zu schaffen. Wesentliche Bedeutung gewinnen diese Interventionen in institutionellen Zusammenhängen, insbesondere in Kindertageseinrichtungen und Schulen – sie sollten deshalb integraler Bestandteil der Ausbildung von Lehrern und Frühpädagogen, bzw. Erziehern sein.
Das vorliegende Buch hat das Ziel, die grundlegenden Konzepte der Resilienz und Resilienzförderung verständlich darzustellen; dabei wird Bezug auf empirische Ergebnisse genommen. Weiterhin soll die Bedeutung des Resilienzkonzepts für die Praxis, insbesondere für pädagogische Zusammenhänge, verdeutlicht werden. Wir haben vielfältige Erfahrungen mit der Umsetzung von Resilienzförderung in Kindertageseinrichtungen und Schulen sammeln können und sind immer wieder begeistert von dem „Klimawechsel“, den eine unterstützende, ressourcenfördernde und kompetenzstärkende Sicht für alle Beteiligten, also für Pädagogen ebenso wie für Kinder und Eltern, hat.
Nach den Definitionen von Resilienz und einem Überblick über relevante Studien, wird ausführlicher das Risiko- und Schutzfaktorenkonzept dargestellt, bevor dann im einzelnen zentrale Resilienzfaktoren (Selbstwahrnehmung, Selbstwirksamkeit, soziale Kompetenz, Selbststeuerung, Umgang mit Stress, Problemlösen) abgeleitet und vorgestellt werden. Ein Überblick über empirische Ergebnisse und den Forschungsstand zum Thema Prävention – und die Beschreibung von Anforderungen an Präventionsprogramme – führt schließlich zur Darstellung von Präventions- und Resilienzprogrammen und -kursen für unterschiedliche Altersstufen. Ein wichtiges Kriterium für die Aus-wahl dieser Programme war die sorgfältige empirische Absicherung; die Beispiele sollen Möglichkeiten der Förderung von Resilienz und Lebensbewältigungskompetenzen, auch im pädagogischen Alltag verdeutlichen.
Das Buch ist entstanden aus den Zusammenhängen des Zentrums für Kinder- und Jugendforschung an der Evangelischen Hochschule Freiburg. Es wäre nicht denkbar ohne die intensiven Diskussionen und die Zusammenarbeit im Team, besonders seien hier Eva-Maria Engel, Stefanie Pietsch, Simone Beuter, Jutta Kerscher-Becker und Sibylle Fischer gedankt.