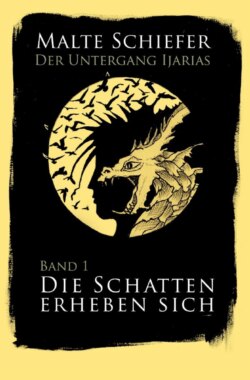Читать книгу Der Untergang Ijarias - Malte Schiefer - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеElno
Das Wasser im Holzfass war kalt und still. In ihm spiegelte sich dunkel der wolkenlose Abendhimmel. Ein Vogel krächzte in der Ferne und sein Schrei hallte einsam und traurig über den Acker.
Das Wasser im Fass begann sich zu kräuseln. Kleine, durch Erschütterungen ausgelöste Wellen liefen zum Rand des Fasses und von dort wieder zurück in die Mitte. Mit der Ruhe war es vorbei. In das Stampfen schwerer Stiefel mischten sich unterdrückte Klagelaute.
Plötzlich spiegelte sich im Wasser das schmutzige Gesicht eines Jungen von vielleicht zwölf oder dreizehn Jahren. Er hatte zotteliges, schwarzes Haar. Seine Augen waren weit aufgerissen und der Mund war zum Schrei geöffnet.
»Nicht!«, rief er, dann durchbrach sein Gesicht klatschend die Wasseroberfläche. Blasen stiegen auf. Links und rechts spritzte Wasser über den Rand, als der Junge mit ruckartigen Bewegungen versuchte freizukommen. Doch eine Hand hielt ihn an den Haaren, drückte ihn hinunter und ließ ihn nicht los.
Die Hand gehörte einem Mann. Der Mann war groß und breit und auch sein Gesicht war schmutzig. Sein Haar war schwarz. Er hatte dicke Augenbrauen und einen ungepflegten Bart. Die Augen hatte er zusammengekniffen und seine Lippen aufeinander gepresst.
Er war stark, denn während die Bewegungen des Jungen immer heftiger wurden und er alles versuchte, um sich aus dem Griff des Mannes zu befreien, blieb dieser fast unbewegt, außer wenn er den Kopf des Jungen noch tiefer ins Wasser drückte.
Ruckartig riss der Mann den Kopf des Jungen nach oben. Der Junge spuckte Wasser, hustete und schnappte nach Luft. Erfolglos versuchte er, den Griff des Mannes um seine Haare zu lösen.
Grob drehte der Mann den Jungen zu sich um. In seinem Blick lagen Zorn und Hass.
»Wo ist er?«, brüllte er den Jungen an, während er ihn hin und her schüttelte. Der Junge holte Luft, um eine Antwort zu geben, doch bevor er dazu kam, drückte der Mann den Kopf des Jungen erneut unter Wasser.
Als er ihn abermals nach oben zog, spuckte der Junge mehr Wasser als zuvor. Der Mann zerrte ihn auf die Beine. Als er jetzt sprach, war seine Stimme fast ruhig und er betonte jedes Wort.
»Wo ist mein Wein?«
»Ich weiß es nicht!«, krächzte der Junge. Immer noch versuchte er sich aus dem Griff des Mannes zu befreien.
»Ach, nein?« Der Mann presste die Hand, mit der er immer noch die Haare des Jungen festhielt, so stark zusammen, dass seine Köchel hervortraten. Er zog den Jungen auf die Zehenspitzen.
»Mehr fällt dir nicht dazu ein? Du hast ihn ganz sicher nicht selbst getrunken? Dann bist du wohl noch genauso durstig wie ich.«
Er lockerte seinen Griff und ließ den Jungen wieder zurück auf die Füße. Der Junge gab einen erschöpften Seufzer von sich und löste den Griff um den Arm des Mannes.
Darauf schien dieser nur gewartet zu haben. Erneut riss er den Jungen zurück zum Fass und drückte ihn in das Wasser, riss ihn wieder heraus, drückte ihn wieder hinein.
»Dir wird schon noch einfallen, wo mein Wein hingekommen ist!«, brüllte der Mann.
»Hier, hier! Er ist hier!«
Das war die Stimme eines Mädchens. Ruckartig drehte der Mann den Kopf. Ein letztes Mal stieß er den Jungen ins Wasser, dann ließ er ihn los. Der Junge verlor das Gleichgewicht. Verzweifelt versuchte er, sich am Fass festzuhalten.
Als der Mann das sah, lachte er und versetzte dem Fass einen kräftigen Tritt. Es neigte sich gefährlich zur Seite. Ein zweites Mal trat der Mann gegen das Fass. Einen Moment verweilte es träge in der Schwebe, dann kippte es. Der Junge schrie, als das Fass beinahe auf ihn stürzte, zusammen mit ihm auf den Boden aufschlug und sich Wasser über ihn ergoss. Wimmernd blieb er liegen.
Der Mann wandte sich wieder zu dem Mädchen. Es war etwas kleiner als der Junge. Ihr Haar war dreckig, doch zwischen dem Schmutz sah man, dass es blond war. Das Mädchen zitterte. In den Händen hielt es einen verschlossenen Krug, den es dem Mann entgegenstreckte.
Der Mann packte das Mädchen im Gesicht und drückte die Wangen zusammen.
»Wo hast du das her?«, fragte er.
Seine schmierigen Finger hinterließen schmutzige Streifen auf ihrem Gesicht.
»Es stand auf dem Regal, es stand im Schatten, man konnte es nicht sehen, es stand auf dem Regal!«, sprudelte es aus dem Mädchen hervor. Ihre Stimme war hoch und zittrig.
Mit der freien Hand nahm der Mann den Krug, mit der anderen stieß er das Mädchen unsanft zur Seite. Dann wandte er sich zu der Hütte, aus der das Mädchen gekommen war, und ging hinein. Mit einem Krachen schlug er die Tür hinter sich zu.
Das Mädchen holte zitternd Luft. Dann lief es zu dem Jungen hinüber, der zusammengekrümmt auf dem Boden lag. Er weinte und hustete.
Das Mädchen blieb neben ihm stehen. Sie sah zum Wasserfass und dann zur Hütte. Nervös verlagerte sie das Gewicht von einem Bein auf das andere.
»Elno?«, fragte sie. »Kannst du aufstehen? Wir müssen das Fass hinstellen, kannst du aufstehen?«
Elno sah zur Hütte hinüber. Dann wischte er sich die Tränen aus dem Gesicht und erhob sich.
Unter großer Anstrengung richteten sie das Fass wieder auf. Als sie es geschafft hatten, lehnte sich Elno keuchend an die Hütte und sackte erschöpft an der hölzernen Wand hinunter. Das Mädchen, das sich bereits wieder der Tür zugewandt hatte, drehte sich um.
»Kommst du nicht mit rein?«, fragte sie nervös.
»Ich schlafe draußen«, krächzte Elno.
Das Mädchen blickte ihn an und nach einer Weile nickte es. Mit langsamen Schritten ging sie zur Tür, öffnete sie und ging hinein.
Es war nicht die Dunkelheit, die Elno fürchtete, wenn er die Nacht draußen vor der Hütte verbrachte. Das tat er oft. Hielt er sich in der Hütte auf, so kam er seinem Vater Bolg in die Quere und Bolg mochte es nicht, wenn man ihm in die Quere kam. Das zu vermeiden war unmöglich, denn die Hütte war klein. Sie bestand aus zwei Räumen, dem Schlafzimmer von Ana und Bolg und der Küche mit dem Esstisch, neben dem sich das schlichte Nachtlager von Nela und Elno befand. In das Zimmer der Eltern durften sie nicht und so blieb ihnen nur die Küche. Oft saß hier Bolg am Tisch und manchmal auch Ana.
Dann stritten sie häufig, während Bolg trank. War Ana im Schlafzimmer, dann trank Bolg, ohne sich zu streiten. Das war auch nicht besser, denn wenn er schlechte Laune hatte, stand er auf und brüllte Elno an und manchmal schlug oder trat er ihn sogar.
Abends war es am schlimmsten, wenn Bolgs Rausch am stärksten und seine Laune am schlechtesten war. Dann war es besser, hier draußen zu sein, allein in der Dunkelheit.
Aber weder Einsamkeit noch Dunkelheit machten ihm die Nächte unerträglich. Er mochte die Dunkelheit. Die Schreie der wenigen Tiere, die nachts ihren Weg über den schmutzigen und fruchtlosen Acker fanden, der ihr Haus umgab, machten ihm keine Angst. Früher hatte er sich vor ihnen gefürchtet, aber nachdem er sie viele Male gehört hatte, verloren sie ihren Schrecken. Er hatte sogar gelernt, sie auseinanderzuhalten. Den Ruf einer Eule, den Schrei einer Katze oder das Bellen eines Fuchses.
Was ihm Angst machte, waren die Geräusche, die nachts aus der Hütte kamen. Manchmal waren sie leise und gedämpft, mal waren sie lauter. Da war der rasselnde und keuchende Atem Bolgs, den er hörte, oder Ana, die leise und unterdrückte Schreie von sich gab.
Und dann gab es noch einen Laut, der sein Blut jedes Mal zu Eis werden ließ. Es war das leise Weinen Nelas, das er durch die hölzerne Hüttenwand hören konnte, eine Weile, nachdem Bolgs rasselnder Atem verschwunden war.
In solchen Momenten kroch Elno zu der Stelle der Hüttenwand, von der er wusste, dass Nela auf der anderen Seite lag, presste seine dürre Hand gegen das modrige Holz und stellte sich vor, auf der anderen Seite würde Nela dasselbe tun.
Heute war eine dieser Nächte. Ana und Bolg hatten sich schlimm gestritten und etwas war im Innern der Hütte zu Bruch gegangen. Elno hatte mit zugehaltenen Ohren an der Wand gesessen und gewartet, bis der Streit vorüber war. Dann hatte er es gehört, das leise Weinen, und nun saß er da und hielt seine Hand an das Holz, mit einem schweren Kloß im Hals und dem ständigen Gefühl, schlucken zu müssen.
Wie sehr er sich wünschte, Nela könnte die Nächte mit ihm draußen verbringen. Ana hatte Nela einige Male hinausgeworfen, aber Bolg gestattete es ihr nicht. Er zog sie an den Haaren in die Hütte, wenn sie zu lange draußen blieb. Elno wusste nicht, was dann in der Hütte geschah, aber nach einer Weile hatte Nela nicht mehr versucht, draußen zu bleiben.
Jetzt wartete Elno, bis Nela aufgehört hatte zu weinen, dann schlief auch er ein.
Als er am nächsten Morgen erwachte, lagen noch die Schleier der Nacht über dem Acker rund um ihre Hütte. Elno rieb sich die Augen. Er setzte sich auf und lauschte. War da ein Geräusch gewesen? Tatsächlich, im Innern der Hütte konnte er Schritte hören. Leise kroch er vor, sodass er um die Ecke linsen und die Eingangstür sehen konnte. Es dauerte nicht lange, da wurde die Tür geöffnet und Bolg trat heraus. Elnos Herz schlug schneller. Wenn Bolg früh aufstand, bedeutete dies meistens, dass er auf einer nahe gelegenen Baustelle arbeiten ging. Das war gut, denn sobald Bolg weg war, würde Elno in die Hütte gehen können.
Bolg schien zu spüren, dass er beobachtet wurde. Er hielt inne und kurz darauf drehte er sich zu Elno. Als er ihn entdeckte, deutete er eine ruckartige Bewegung in Elnos Richtung an und Elno zog sich voller Schrecken hinter die Ecke zurück. Er hörte, wie Bolg lachte, dann Schritte, die sich von der Hütte entfernten und in der Ferne leiser wurden.
Elno wartete eine Weile, dann kroch er wieder nach vorn. Bolg war weit und breit nicht zu sehen, also stand Elno auf und schlich sich in die Hütte.
Im Inneren war die Luft stickig und auch wenn draußen langsam die Sonne aufging, war es dunkel und still. Vorsichtig schloss Elno die Tür hinter sich. Er wollte Nela nicht wecken. Wenn sie noch schlief, würde er sich ein wenig zu ihr setzen und ihr beim Schlafen zusehen.
Kaum hatte er sich von der Tür abgewandt, sah er, dass noch jemand im Raum war. Am Tisch saß Ana. Mit glasigem Blick schaute sie auf die schlafende Nela hinab, die sich unter einem alten Mantel zusammengerollt hatte.
Elnos Mutter hatte zerzaustes Haar und ihr Gesicht war fahl und faltig. Über ihrem dürren Leib trug sie ein schmutziges Nachthemd, das an vielen Stellen aufgerissen und zerschlissen war. Als sie Elno bemerkte, wandte sie den Blick von Nela ab.
»Wo warst du?«, fragte sie. Ihre Stimme war rau wie seine eigene und sie klang sehr ungehalten.
»Ich war draußen«, krächzte Elno. Er war auf der Hut. Zwar fürchtete er Ana nicht so sehr wie Bolg, aber auch sie konnte sehr gemein sein und er vermied es, sie zu verärgern. Es war schwer abzuschätzen, wieso Ana sauer auf ihn wurde.
»Wieso hast du nicht bei deiner süßen Schwester geschlafen?«, fragte Ana laut. »Gefällt sie dir nicht?«
Elno wusste, dass er jetzt sehr vorsichtig sein musste. Jedes falsche Wort konnte Ana noch wütender machen. Er versuchte es mit einer Ausrede.
»Ich bin draußen eingeschlafen!«
Ana sah ihn verächtlich an.
»Du bist ein Nichtsnutz!«, sagte sie. »Genau wie deine Schwester.«
Einen Moment sah sie schweigend auf Nela hinab, dann stand sie auf und stieß ihren nackten Fuß unsanft in Nelas Seite. Nela gab einen Schrei von sich. Ana holte aus, um Nela ein weiteres Mal zu treten. Nela rappelte sich auf und versuchte, Anas Tritt zu entkommen, aber sie schaffte es nicht. Ana traf sie am Bein und Nela stürzte.
»Nicht!«, wollte Elno rufen, aber seine Stimme war ein geräuschloses Flüstern, das er selbst kaum hören konnte.
Nela gelang es, an Ana vorbeizukommen und unter den Tisch zu kriechen. Dort kauerte sie sich zusammen und wimmerte. Ana schlug mit der flachen Hand auf die Tischplatte. Nela schrie und presste sich die Hände auf die Ohren. Ana lachte bitter. Noch einmal versuchte sie Nela unter dem Tisch zu treten. Als sie es nicht schaffte, raffte sie ihr Schlafgewand zusammen und stapfte ins Schlafzimmer.
Nela begann zu weinen. Sie hatte ihre Beine an ihren Leib gezogen und rieb sich mit den Händen über die Knie.
Elno lief um den Tisch herum, hob den alten Mantel auf, den Nela als Decke benutzte, und kroch zu Nela unter den Tisch. Vorsichtig legte er den Mantel um ihre zitternden Schultern und nahm sie in den Arm. So saßen sie eine Weile, bis Ana aus dem Schlafzimmer zurückkam. Sie hatte ihre Arbeitskleidung angezogen. Vermutlich würde auch sie auf dem Feld eines benachbarten Bauern aushelfen. Sie verließ die Hütte, nur um kurz darauf wieder zurückzukehren. Es schepperte, als sie einen alten Wassereimer unter den Tisch warf. Elno spürte, wie Nela nach seiner Hand griff.
»Du hast gestern alles Wasser verschüttet. Hol neues!«, sagte seine Mutter.
Krachend wurde die Tür zugeworfen, dann wurde es still.
»Wir müssen los«, sagte Nela nach einer Weile.
»Ja!«, krächzte Elno.
Bis zum Bach war es weit und der Eimer musste viele Male hin und her getragen werden. Gemeinsam krochen sie unter dem Tisch hervor. Elno hob den Eimer auf, dann machten sie sich auf den Weg.
Als Ana am frühen Abend zurückkehrte, war ihre Laune schlecht. Elno und Nela verzogen sich in die hintere Ecke der Küche. Dort war zwischen der Außenwand und einem alten Regal eine Lücke, in der sie sich verstecken konnten. Ana begann die Küche nach irgendetwas zu durchsuchen und räumte laut in den Schränken herum.
Elno ahnte, dass es am Abend wieder Streit geben würde. Gerade überlegte er, ob es das Beste wäre, die Hütte schon jetzt zu verlassen, als Bolg nach Hause kam. Sofort war ihm die schlechte Laune anzusehen. Er warf einen missmutigen Blick auf Ana und Elno und setzte sich dann an den leeren Tisch.
»Wo ist das Essen?«, fragte er gereizt.
»Es ist nichts da!«, antwortete Ana. »Bauer Meg hat gesagt, er hat nichts mehr für mich!«
Bolg sah Ana böse an.
»Und Bauer Ganven? Hast du auch bei ihm gefragt?«
Ana schüttelte den Kopf.
»Wie bitte soll ich das machen? Es dauert schon lange genug, zu Meg zu laufen und Ganvens Hof liegt in der anderen Richtung!«
Bolg schnaubte.
»Und was hast du gemacht, wenn Meg keine Arbeit für dich hatte? Hast du den ganzen Tag auf der faulen Haut gelegen? Oder hast du dich mit einem seiner Stallburschen vergnügt?«
Ana spuckte auf den Boden der Hütte.
»Als ob das ein Vergnügen wäre«, sagte sie und blickte Bolg finster an. »Und was ist mit dir? Warum hast du nichts zu essen mitgebracht? Du hast doch wohl etwas verdient, oder nicht?«
Bolg schüttelte den Kopf.
»Das ist mein Geld«, sagte er.
Ana lachte verbittert.
»Ach, das ist dein Geld? Und was machst du damit? Es versaufen!«
Bolg nickte.
»Genau das werde ich jetzt tun.«
»Nein!«
Ana war aufgestanden und stellte sich Bolg in den Weg.
»Geh beiseite!«, sagte Bolg mit einem bedrohlichen Unterton in der Stimme. Ana blieb stehen.
»Erst, wenn du mir meinen Teil des Geldes gegeben hast! Ich muss dir schließlich auch immer was abgeben!«, sagte sie aufgebracht. Einen Moment war es totenstill. Dann trat Bolg fast gemächlich auf Ana zu, packte sie an den Haaren und zerrte sie zu sich heran. Ana schrie auf.
Elno spürte, wie Nela sich fester an ihn drückte und ihr Gesicht in seiner Seite vergrub. Er nahm sie in den Arm, auch wenn er selbst am liebsten fortgerannt wäre. Stumm beobachtete er, wie Bolg Ana grob zu Boden stieß und nach dem Besen griff, der neben der Tür stand. Er zerbrach den Stil über seinem Bein. Den Teil des Besens, an den Elno und Nela erst kürzlich neuen Reisig gebunden hatten, um die Hütte zu fegen, warf er achtlos beiseite. Den anderen nahm er in die rechte Hand und ließ ihn durch die Luft sausen. Mit einem dumpfen Klatschen traf er die am Boden liegende Ana. Ana schrie, hielt schützend einen Arm über sich und versuchte wegzukriechen, schaffte es aber nicht. Elno schloss die Augen und presste seine Lider so fest zusammen, wie er nur konnte.
Das, was er nicht sah, hörte er. Er hörte, wie der Besenstiel die Luft zerteilte, hörte die dumpfen Aufschläge, die Schreie, das Weinen. Dann polterte es laut und krachte.
Als Elno vorsichtig die Augen öffnete, sah er Bolg breitbeinig über Ana stehen. Sie war zu einem der Regale gekrochen und versuchte, sich daran auf die Beine zu ziehen. Einige der leeren Tonkrüge waren herausgefallen und lagen in Scherben auf dem Boden. Elno sah dunkles Blut über ihr Gesicht laufen.
Bolg trat in die Scherben der zerbrochenen Krüge. Ana zuckte zusammen und stieß einen erstickten Laut aus. Sie verlor den Halt und stürzte. Bolg warf den abgebrochenen Besenstiel neben sie.
»Es ist mein Geld. Ich habe es verdient, ich gebe es aus.«
Bolg keuchte, während er sprach. Er richtete sich auf und ohne ein weiteres Wort verließ er die Hütte. Ana begann zu weinen.
Nach einer Weile löste Nela sich aus Elnos Arm und ging zu einem der Schränke. Elno hörte, wie sie mit einem Feuerstein ein paar Funken schlug, dann kam sie mit einer kleinen Lampe zurück. Ihre Hände zitterten.
Auch Elno stand auf. Vorsichtig näherten sie sich Ana.
Es schien ihm eine Ewigkeit zu dauern, den Raum zu durchqueren. Als Elno Ana im flackernden Licht der Lampe erblickte, zog sich seine Magengegend zusammen. Neben ihm stieß Nela einen Schrei aus und presste sich die Hände vor den Mund.
Ana machte einen weiteren Versuch aufzustehen und dieses Mal gelang es ihr. Wie blind streckte sie die Hände ins Leere, bis sie einen Stuhl fand und sich darauf fallen ließ.
Nach einer Weile hob sie ihren Blick und sah zu Elno und Nela herüber.
»Was glotzt ihr so?«, fragte sie, drehte sich von ihnen weg und begann, ihr Gesicht zu betasten.
»Ich gehe Wasser holen«, flüsterte Nela neben ihm. Mit dem Licht in der Hand suchte sie einen kleinen Holzbecher, dann verließ sie, so leise sie konnte, die Hütte. Beim Knarren der Tür zuckte Ana zusammen und ihr Blick fuhr unruhig durch den Raum.
»Was war das?«, fragte sie erschrocken.
»Nela holt Wasser!«, presste Elno hervor.
Seine Mutter schnaubte, doch als Nela kurz darauf mit dem Wasser hereinkam, lehnte sie es nicht ab, sondern trank. Als der Becher leer war, gab sie ihn Nela zurück und winkte mit der Hand. Nela ging hinaus und holte einen zweiten Becher. Nachdem sie auch diesen getrunken hatte, erhob sich Ana mühsam und ging mit wackeligen Beinen ins Schlafzimmer.
Nela löschte das Licht und verstaute die kleine Lampe wieder sorgfältig im Schrank. Als sie sich auf dem Boden zusammenrollte, legte Elno sich neben sie. Er würde warten, bis sie eingeschlafen war und dann hinausgehen, bevor Bolg zurückkam. Er lauschte Nelas Atem, der sich langsam beruhigte, bis er tief und gleichmäßig geworden war. Elno wollte nur noch einen kurzen Moment neben ihr liegen bleiben, dann schlief er ein.
Im Traum lief er durch eine Art Tunnel, der in ein Zimmer führte, das fast aussah wie der Innenraum ihrer Hütte. Es krachte und polterte und Elno wäre vor Schreck fast aufgewacht. Doch er schlief weiter und lauschte verängstigt dem rasselnden Atem eines verborgenen Monsters, das durch die Stollen kroch und ihn suchte. Oder suchte es vielleicht gar nicht ihn? Irgendwo weit weg hörte er Nelas Stimme, die in ein Weinen überging. Er suchte sie, konnte sie nicht finden und verlief sich in einem Dickicht aus Erde und Wurzeln, das über seine Haut schrammte.
Als er am nächsten Morgen erwachte und seinen Blick nervös durch die Hütte streifen ließ, zuckte er erschrocken zusammen.
Bolg war zurück.
Mit auf die Brust gesunkenem Kopf saß er am Tisch. In seinen schlaffen Fingern hielt er eine Flasche, aus der Reste einer dunklen Flüssigkeit tropften. Sein Schnarchen verriet, dass er schlief.
Elno drehte sich vorsichtig zu Nela. Sie war wach und schaute mit ausdruckslosen Augen an ihm vorbei ins Dämmerlicht.
Kurz darauf öffnete sich die Tür zum Schlafzimmer und Ana erschien. Sie erstarrte, als sie Bolg erblickte. Nervös begann sie, auf ihrer Lippe zu kauen und ihr Blick sprang suchend durch den Raum. Dann schaute sie zu Elno und Nela und ihr Blick traf sich mit Elnos.
»Nach draußen!«, zischte sie und wies mit dem Finger Richtung Tür. So leise er konnte stand Elno auf und schlich zu Ana. Als er sie erreichte, schob sie ihn langsam zur Tür.
»Geh los und besorge was zu essen!«, flüsterte sie und öffnete vorsichtig die Tür.
Sonnenlicht erhellte Anas Gesicht. Noch immer klebten Reste von Blut in ihren Haaren. Um ihr linkes Auge hatte sich ein dunkler Bluterguss gebildet.
»Ich kann nicht!«, krächzte Elno.
Ana funkelte ihn an und deutete auf Bolg.
»Willst du, dass er uns alle totprügelt? Wenn er aufwacht und immer noch nichts zu essen im Haus ist, wird er außer sich sein vor Wut!« Ihre Stimme war lauter geworden und Elno warf nervös einen Blick auf Bolg. Bolg war im Schlaf gefährlich zur Seite gekippt und fiel beinahe vom Stuhl. Elno hatte oft erlebt, wie Bolg herumwüten konnte, wenn er getrunken hatte.
»Wo soll ich …?«, begann er, aber Ana schüttelte den Kopf.
»Keine Fragen, geh los! Lass dir was einfallen! Geh zu einem Bauernhof, wenn es sein muss.« Sie blickte zu Bolg hinüber. »Du bist besser zurück, bevor er aufwacht!«
Elno starrte sie an. Bevor er den Mund ein weiteres Mal aufmachen konnte, packte sie ihn an den Schultern und schob ihn durch die Tür nach draußen. Plötzlich erschien Nela neben ihrer Mutter. Sie sah verängstigt aus.
»Ich komme mit«, wisperte sie.
Ana schüttelte entschieden den Kopf.
»Du bleibst!«, sagte sie, wieder etwas zu laut.
»Ich will nicht!«, flüsterte Nela.
»Und was glaubst du, was ich will? Du bleibst hier!«
»Wieso?«, fragte Nela verzweifelt. Ana sah zu Bolg hinüber.
»Weil du ihm gefällst! Und ich will nicht alleine sein, wenn er wach wird.« Sie packte Nela am Arm und zog sie zurück in die Hütte. Elno warf ihr noch einen letzten nervösen Blick zu, dann schloss Ana die Tür hinter sich.
Im Innern der Hütte gab Bolg ein unzufriedenes Schnarchen von sich und ein Bild stieg vor Elnos innerem Auge auf, wie Bolg mit dem Besenstiel auf Nela und Ana losging. Ohne genau zu wissen wohin, lief er los.
Der Weg quer über den Acker war anstrengend und beschwerlich. Immer wieder stolperte er, rappelte sich auf und lief weiter. Schon nach kurzer Zeit bekam er Seitenstiche und ihm wurde schwindelig. Keuchend blieb er stehen und stützte sich mit den Händen auf seinen Knien ab. Was sollte er nur tun? Er entschied sich, zu einem der nahe gelegenen Bauernhöfe zu laufen. Nicht zu dem von Bauer Meg, der am nächsten lag. Meg hatte viele Hunde, die ihn sicher entdecken würden. Doch ein Stück weiter gab es einen kleineren Bauernhof, auf welchem es früher nur einen alten Köter gegeben hatte. Es war zwar schon eine Weile her, dass Elno sich an einen der Höfe herangeschlichen hatte, aber er musste es versuchen. Als er wieder zu Atem gekommen war, lief er weiter.
Der Morgen war schon weit vorangeschritten, als er die Hügel erreichte, die auf der Rückseite des Hofes lagen.
Auf dem Bauch liegend kroch Elno die letzte Hügelkuppe hinauf.
Von hier aus konnte er auf den Innenhof des Bauernhauses schauen. Links lag die Scheune und auf der anderen Seite die Ställe. Ihm gegenüber lag das Wohnhaus.
Zu seinem Glück war der Hof leer. Nicht einmal der Hund war zu sehen. Gerade hatte Elno all seinen Mut gesammelt, um hinunter zum Hof zu schleichen, als ein Mann aus dem Stall kam. Er war groß, fast so groß wie Bolg, aber nicht so kräftig gebaut wie dieser. Sein Haar war kurz und er trug keinen Bart. Vor sich schob er eine Schubkarre, in der altes Stroh lag. Er pfiff ein Lied, leerte die Schubkarre auf einen großen Haufen hinter der Scheune, dann fuhr er zurück zum Stall. Elno wartete. Ein weiteres Mal kam er heraus, leerte die Schubkarre und ging zurück zu den Ställen. Das war Elnos Gelegenheit. Er sprang auf und lief den Hügel hinunter zur Scheune. Dort presste er sich mit angehaltenem Atem an die Holzwand. Er warf einen Blick zum Stall. Von dem Mann war noch nichts zu sehen, aber Elno hörte ihn pfeifen. Er warf einen Blick über den Hof. Nichts regte sich. Elno lief los und rannte zu dem Haus auf der anderen Seite. Hier angekommen lief er geduckt zu einem der kleinen Fenster und spähte hinein. Soweit er es erkennen konnte, war der Raum leer. Eine Tür, die ins Haus führte, war nur wenige Meter von ihm entfernt. Er lief hinüber und öffnete sie mit zitternden Fingern. Seine Hände waren schweißnass und sein Herz klopfte ihm bis zum Hals. Ein letztes Mal sah er sich um, dann trat er über die Schwelle ins Innere des Hauses und schloss die Tür hinter sich. Bei seinem letzten Blick nach draußen sah er den Mann aus dem Stall kommen. Dann war die Tür zu.
Im Haus war es ruhig. Elno hörte nur seinen eigenen Atem und das Pochen seines Herzens. Hatte der Mann ihn gesehen? Elno lauschte, bis er den Mann wieder pfeifen hörte.
Erst dann wandte er sich von der Tür ab. Der Raum, den er betreten hatte, war klein und dunkel. Ein paar Stiefel standen an der Wand, daneben lehnten rostige Werkzeuge. Rechts von ihm war ein Durchgang, der in einen größeren und helleren Raum führte. Vorsichtig schlich Elno hinein.
Einen Raum wie diesen hatte Elno noch nie gesehen. Er war sauberer und aufgeräumter als ihre Hütte. In der Mitte stand ein großer Tisch aus hellem Holz. Auf dem Tisch stand eine Vase, in der Blumen steckten. An den Wänden standen Regale, deren Bretter sauber und gerade waren, und in ihnen stand allerlei Gerät, das Elno nicht kannte.
Zu seiner Enttäuschung fand er jedoch nichts Essbares.
Auf der anderen Seite des Raumes entdeckte er eine weitere Tür. Elno lauschte einen Moment und als er niemanden hörte, öffnete er sie. Erleichtert stellte er fest, dass sie in die Küche führte.
Hier gab es Unmengen von Töpfen, Krügen, Flaschen, Tellern, Bechern und Besteck. Elno öffnete eine weitere Tür. Schlagartig wurde ihm schwindelig von den guten Gerüchen, die auf ihn einströmten. Er hatte die Speisekammer gefunden. Käse, Fleisch, Brot und auch Süßwaren wurden hier aufbewahrt. Am liebsten hätte er die Tür geschlossen und sich in der Kammer den Bauch vollgeschlagen. Aber dafür hatte er keine Zeit. Schnell griff er sich ein Brot, einen gut riechenden Käse und eine große Wurst.
In der Küche wickelte er alles in ein Tuch. Das Bündel klemmte er sich unter den Arm. Dann schlich er wieder in Richtung Ausgang. Elno betete, dass ihn niemand entdecken würde. Wenn ihn jetzt jemand fand, war er geliefert. Bolg hatte ihm erzählt, dass man Dieben die Finger abschnitt. Um es ihm zu zeigen, hatte er Elno ein Messer auf die Finger gedrückt. Ein Schauer lief ihm über den Rücken. Vor der Tür zum Hof blieb er stehen. Nun musste er nur noch hinüber zu den Hügeln, dann hatte er es geschafft. Gerade wollte er die Tür nach draußen öffnen, als er von draußen gedämpfte Stimmen hören konnte.
»Wir werden es wohl töten müssen«, hörte er jemanden sagen. Entsetzt trat er von der Tür zurück. Hatten sie ihn entdeckt? Redeten sie über ihn? Seine Knie wurden weich. Er wollte weg, aber seine Beine gehorchten seinem Willen nicht und er stand da wie angewurzelt.
»So sieht es aus«, antwortete eine andere Stimme. Sie war tiefer als die erste.
»Was es wohl so zugerichtet hat?«, fragte die erste Stimme.
»Vermutlich ein junger Wolf. Wäre nicht das erste Tier, was er anfällt«, antwortete die tiefe Stimme.
»Ich hole die Axt.«
Durch die Tür hörte Elno Schritte näher kommen und jetzt endlich fiel die Starre von ihm ab. Gehetzt blickte er sich um und er entschied sich, durch eine Tür links zu flüchten. Vielleicht gab es dort eine Möglichkeit, sich zu verstecken. Er riss die Tür auf und dann passierten zwei Sachen gleichzeitig.
Zum einen löste sich der Knoten seines Bündels. Was er hineingepackt hatte, fiel heraus und rollte über den Boden. Gleichzeitig öffnete sich die Tür und Elno blickte in das Gesicht des Mannes, den er zuvor bei den Ställen gesehen hatte. Für einen Moment schien er genau so erschrocken wie Elno, doch schnell fasste er sich wieder.
»Halm!«, rief er. Er stellte sich breitbeinig vor die Türe nach draußen. Elno überlegte, wohin er fliehen konnte, als der zweite Mann in der Tür erschien. Er war groß, breit und hatte wie Bolg einen dichten Bart. Doch als Elno ihm in die Augen blickte, fand er dort nichts, was ihn an seinen Vater erinnerte.
»Ein Dieb!«, rief der erste. Der ältere Mann sah Elno an und schüttelte den Kopf.
»Das ist ja noch ein Kind!«, sagte er.
In Elnos Ohren begann es zu rauschen. Seine Muskeln verkrampften sich. Jeden Moment erwartete er, dass die Männer ihn packen und schlagen würden. Seine Augen waren zwischen ihnen hindurch nach draußen gerichtet.
»Wie mager er ist«, sagte der Mann, der die Ställe ausgemistet hatte. »Er ist sicher krank.«
Der Blick des älteren Mannes wanderte von Elno hinüber zu dem Essen, das auf dem Boden lag. Dann sah er wieder zu Elno.
»Ich denke, er ist hungrig.«
Der jüngere Mann machte einen Schritt auf Elno zu und streckte die Hand aus, um ihn zu packen.
Aber Elno wollte sich nicht packen lassen. Sie würden ihn nicht bekommen, um ihm die Finger abzuschneiden. Mit dem Mut der Verzweiflung stürzte er vor und tauchte seitlich unter dem Arm des Mannes hindurch. Er schrie auf, als sein nackter Ellenbogen am Holz der Türfüllung vorbeischrammte. Etwas Warmes lief an seinen Beinen hinab, aber er schaffte es. Er war draußen.
»He«, rief einer der Männer, »warte!«
Doch Elno wartete nicht. An seinem Rücken spürte er noch eine Hand, die über sein Hemd glitt, dann rannte er los, so schnell ihn seine Beine trugen. Er rannte über den Hof, vorbei an den Ställen, den Hügel hinauf und weiter, immer weiter, ohne sich noch einmal umzuschauen.
Er lief, bis seine Beine nicht mehr wollten. Dann ließ er sich fallen, wo er war, und als er wieder zu Atmen kam, begann er zu weinen.
Als er weinte, breitete sich eine dumpfe Leere in ihm aus. Für einen Moment dachte er an nichts. Die Flucht, das Essen, die Hütte, seine Familie, alles verschwand hinter einem Schleier aus Erschöpfung.
Doch die Gedanken kehrten schneller zurück, als ihm lieb war. Die Männer vom Hof würden ihn finden, wenn er sich nicht aus dem Staub machte. Aber wo sollte er hin? Er wusste, dass er nicht einfach nach Hause zurückkehren durfte. Der Gedanke, von einem anderen Hof etwas zu stehlen, trieb ihm erneut die Tränen in die Augen. Ich schaffe das nicht, dachte er.
Bolg war höchstwahrscheinlich schon aufgewacht. Was würde in der Hütte auf ihn warten? Ob Bolg wieder zum Besenstiel gegriffen und Ana wieder verprügelt hatte? Oder dieses Mal vielleicht Nela? Die Vorstellung ließ ihn würgen. Ich muss zurück, dachte Elno, ich muss nachschauen, was passiert ist, egal was mit mir passiert. Langsam und mit zittrigen Knien stand er auf und ging los. Nach kurzer Zeit merkte er jedoch, dass er nicht zurück zu ihrer Hütte lief, sondern die entgegengesetzte Richtung eingeschlagen hatte. Tränen rannen über sein Gesicht. Er dachte an Nela, an Ana und immer wieder an Nela, doch er schaffte es nicht. Er konnte nicht umkehren. Zu groß war die Furcht vor dem, was Bolg oder Ana mit ihm anstellen würden, wenn er mit leeren Händen heim kam. Er hob den Kopf und auch wenn er erschöpft war, begann er wieder zu laufen. Wie blind rannte er los, ohne zu wissen, wohin.
Vinja
Die Sonne war gerade erst aufgegangen, aber schon jetzt war sie warm und kündigte von der kommenden Mittagshitze. Besonders heiß wurde es in der südlichen Ebene. Hier wuchs fast nichts außer dürrem Gras und vereinzelten, knotigen Bäumen. Das einzige Zeichen menschlicher Existenz in dieser Gegend waren die zahlreichen Wege, die sich quer durch die Ödnis zogen und alle auf eine einzige, breite und ausgetretene Straße zuführten, die wie ein langes und schnurgerades Band von Süden nach Norden verlief.
Über diese Straßen bewegte sich langsam und behäbig eine Reihe von Menschen, die Tiere, Vieh und Wägen mit sich führten. Seit der Morgen vorüber war, brannte ihnen die Sonne im Nacken.
Nicht nur die Hitze machte sie langsam. Viele von ihnen führten ihre gesamten Habseligkeiten mit sich. Auf den Wagen stapelten sich Koffer, Taschen, Truhen und Säcke.
Die meisten Männer und Frauen schwiegen. Nur ein pausbäckiger Mann bildete eine Ausnahme. Er lief in einer kleinen Gruppe neben einem Karren, der noch voller beladen war als die anderen. Neben den Koffern und Truhen stapelten sich Gerätschaften, Kessel und Rohre.
Dem Mann lief der Schweiß den Nacken hinunter, wo er einen dunklen Fleck auf seinem Hemd hinterließ. Trotz allem schien ihm die Hitze nichts anzuhaben. Während seine Begleiter schweigend neben ihm her liefen, redete er ohne Unterlass.
Die zwei Frauen und der Mann neben ihm hörten ihm zu. Im Gegensatz zu ihm hatte jeder von ihnen noch ein Bündel aus Habseligkeiten auf dem Rücken und sie schnauften unter der schweren Last.
»Der obere Westmarkt ist etwas kleiner als der untere Westmarkt, soviel ist sicher«, erläuterte der pausbäckige Mann. »Aber das Verrückte ist«, er machte eine Pause und warf seinen Begleitern einen Blick aus leuchtenden Augen zu, »das Verrückte ist, dass es überhaupt einen oberen und unteren Westmarkt gibt! Und nicht nur das, es gibt auch zwei Ostmärkte und je einen Nord- und Südmarkt. Vom zentralen Markt ganz zu schweigen, könnt ihr euch das vorstellen? Jeder einzelne Markt ist größer als alle Märkte, die ihr je in eurem Leben gesehen habt, und der Zentralmarkt gleicht einer eigenen kleinen Stadt!«
»Das glaube ich dir einfach nicht!«, sagte eine der Frauen. Sie war dick und hatte von den dreien das größte Bündel zu tragen. Trotz allem lief sie nahezu aufrecht. »Ein Markt so groß wie eine Stadt! Wie welche Stadt möchte ich mal wissen. Vielleicht meinst du ja Himstadt?«
Die anderen lachten.
»Nein, nein, nicht wie Himstadt«, antwortete der pausbäckige Mann verärgert. »Ich meine eher wie Dalmerstedt.«
Die Frau schnaubte.
»Wie Dalmerstedt? Das glaube erst, wenn ich es gesehen habe.«
»Nun, das wirst du ja bald«, antwortete der Mann, »aber mach dich auf etwas gefasst! Ich sage dir eins …«. Er machte eine Pause, um Luft zu holen.
»Wer Ijaria noch nicht gesehen hat, der hat noch gar keine Stadt gesehen!«
Den letzten Satz sagte er nicht alleine. Vom hinteren Teil des Wagens wurden die Worte von einer leisen Stimme aufgegriffen und mitgesprochen. Über das Geratter des Wagens war sie kaum zu hören und sie klang viel weniger begeistert als die Stimme des pausbäckigen Mannes. Viel eher klang sie missmutig, schlecht gelaunt und sie gehörte einem Mädchen, das auf der hinteren Ladefläche des Karrens saß. Jetzt sprang sie ab und ließ den Wagen ein Stück vorfahren, bis die Gruppe vor dem Karren außer Hörweite war. Dann reihte sie sich ein in den Tross aus Wagen und Leuten.
Das Mädchen war klein. Tatsächlich war sie schon 16 Jahre alt, aber die meisten, die sie anschauten, hielten sie für jünger. Sie hatte auffällig wache und konzentrierte Augen, die jetzt unter zusammengezogenen Brauen dem Karren hinterherschauten. Ihr Haar war lang und braun und fiel ihr lose über die Schultern.
»Vinja!«
Das Mädchen drehte sich um und schaute zu einer alten Frau hinüber. Das Gesicht der Frau war faltig und ihre Lippen spröde. Als sie sprach, kam ihr Atem gepresst.
»Wärst du so gut und würdest mir mein Bündel abnehmen, nur für eine Weile?«
»Selbstverständlich«, antwortete Vinja. Die alte Frau blieb stehen und setzte unter großer Anstrengung ihren Rucksack ab. Einen Moment lang stand sie schwer atmend da, dann löste sie mit zittrigen Fingern einen Wasserschlauch vom Rucksack und trank daraus. Als sie fertig war, lächelte sie das Mädchen an.
»Das ist eigentlich keine Reise für eine alte Frau, nicht wahr?«
Vinja zuckte mit den Schultern, denn sie wollte die alte Frau nicht verletzen.
»Wieso fährst du nicht hinten auf unserem Wagen mit?«, fragte sie. »Ich laufe sowieso lieber.«
Die alte Frau machte eine wegwerfende Handbewegung.
»Ich glaube nicht, dass deine Eltern das gutheißen würden.«
Vinja wollte widersprechen, doch dann nickte sie.
»Gut möglich!«
Mit einer schwungvollen Bewegung warf sie sich den Rucksack der alten Frau auf den Rücken.
»Dann werde ich dich eben so entlasten.«
Die alte Frau dankte Vinja, dann setzten sie ihren Weg gemeinsam fort.
Es war jetzt zwei Wochen her, seit Vinja und ihre Eltern aus ihrer Heimatstadt Halwar aufgebrochen waren. In Halwar war ihre Gruppe noch überschaubar gewesen. Neben ihr und ihren Eltern waren es vor allem Reisende gewesen, die den weiten Weg nach Ijaria nicht alleine zurücklegen wollten. Nur ein paar hatten wie sie vor, in Ijaria zu bleiben und nicht mehr nach Halwar zurückzukehren. Der Stiefelflicker Hoger und seine Frau Disilde, die kräftige Mara und Unto, den sie hinter vorgehaltener Hand den Einfältigen nannten. Vinja glaubte, dass er niemals auf die Idee gekommen wäre, Halwar zu verlassen, wenn er nicht den unglaublichen Berichten ihres Vaters Belfonso gelauscht hätte.
Belfonso war vor einem Jahr nach Ijaria gereist. »Einmal im Leben muss man nach Ijaria«, hatte er immer wieder gesagt, aber niemand hatte geglaubt, dass er sich tatsächlich einmal aufmachen würde. Doch dann war er gegangen und lange Zeit nicht zurückgekehrt. Als er wieder auftauchte, hatten seine Augen jenen Glanz gehabt, die sie bis heute nicht verloren hatten. Neben allerlei Plunder brachte er auch den Entschluss mit nach Hause, dass seine Familie nach Ijaria ziehen sollte.
In Halwar hatten Vinjas Eltern eine Wäscherei betrieben. Die Gerätschaften und Einrichtungen, welche zum Waschen und zur Herstellung von Seife benötigt wurden, stapelten sich nun auf dem Karren, der von einem alten Ochsen gezogen wurde. Laut ihrem Vater gab es in ganz Ijaria keine einzige Wäscherei und das Reinigen der Kleidung würde von den Badern übernommen, die aber keine große Kunst darin besaßen. »Man stelle sich vor, keine einzige Wäscherei, in ganz Ijaria!«, hatte er ausgerufen. »Eine Stadt, so groß wie hundert Städte zusammen und keine einzige Wäscherei!«
In Halwar hatte es demgegenüber sogar zwei Wäschereien gegeben. Neben der Wäscherei von Vinjas Eltern war da noch die Wäscherei Askur. Askur war ein missmutiger Kerl und die Leute mochten ihn nicht. Daher waren für Vinjas Eltern die Geschäfte gut gelaufen. Doch Belfonso war trotz allem nicht zufrieden. Er wurde nicht müde zu wiederholen, dass in Ijaria viel mehr Geld zu verdienen war.
Es war Belfonso nicht schwergefallen, Vinjas Mutter Rigund von der Idee zu überzeugen. Die Aussicht auf ein Leben in Wohlstand hatte es ihr leicht gemacht, Belfonso seine lange Abwesenheit zu verzeihen.
Vinja hingegen hielt von der Idee nichts. Sie hatte viele Freunde in Halwar und der Gedanke an Ijaria verunsicherte sie. Halwar war zwar auch eine Stadt, aber Ijaria schien ihr um ein Vielfaches größer zu sein.
Was Vinja über ihren Umzug dachte, interessierte ihre Eltern nicht. Als die Entscheidung gefallen war, hatte sie sich damit anzufreunden. Ihre Eltern wischten alle Einwände fort und sagten, es würde ihr schon gefallen, wenn sie erst einmal dort seien.
Das Verhalten ihrer Eltern war für Vinja nichts Neues. Schon immer hatten sie Pläne für Vinja gemacht, ohne zu fragen, ob sie ihr gefielen. Am schlimmsten war es für Vinja, dass sie davon ausgingen, sie würde eines Tages die Wäscherei übernehmen. Das wollte Vinja nicht, aber alle Versuche, mit ihren Eltern darüber zu sprechen, scheiterten.
Bis zum letzten Tag hatte Vinja gehofft, ihre Eltern würden sich noch einmal umentscheiden. Doch dann waren sie losgezogen und hinter ihnen war Halwar im Licht der aufgehenden Sonne immer kleiner geworden, während Vinja auf der Ecke des Karrens saß, die ihr Vater für sie ausgespart hatte. Er war der Meinung, dass sie nicht so viel laufen und erst recht nichts tragen könne. Eine Fehleinschätzung, wie Vinja fand.
Während ihrer Reise war ihre Gruppe stetig größer geworden. Andere hatten sich zu ihnen gesellt, um den Weg nach Ijaria im Schutze einer Gruppe zurückzulegen. In Stagweren waren sie auf drei Großfamilien getroffen, die ebenfalls ihr Glück in der Hauptstadt suchen wollten. Mittlerweile war ihre Gruppe auf fünfzig Personen angewachsen. Mit dabei waren Händler, Gaukler und Taugenichtse, die abends Lieder sangen und Geschichten erzählten. Aber auch einige Leute aus den Südlanden, einer weit entfernten Gegend, die, wie Vinja gehört hatte, nicht zum freien Königreich gehörte und wo die Leute eine andere Sprache hatten. Vinja verstand zwar nicht, worüber die Leute redeten, aber sie wirkten auf Vinja nicht gerade zufrieden und sie wurde den Eindruck nicht los, dass sie nicht gerade freiwillig unterwegs waren.
Unter ihren Mitreisenden hatte Vinja auch Masia kennengelernt, eine alte Frau, die ihr Hab und Gut in einem Rucksack zusammengepackt hatte. Ihr Mann war vor kurzem gestorben und zu ihrer Überraschung war das neben der Trauer wie eine Befreiung für sie gewesen. Eine lang vergessene Reiselust war wieder in ihr aufgekommen, die sie aus ihrem Heimatdorf hinaus auf die Straße gelockt hatte. Auch ihr Ziel war Ijaria, wo ihre jüngere Schwester Eleane lebte und ein Bekleidungsgeschäft führte. Vinja bewunderte die Frau, die trotz ihres hohen Alters das Land bereiste. Masia erzählte Vinja viele Geschichten und das war ihr allemal lieber als die ständigen Wiederholungen ihres Vaters über Größe und Faszination Ijarias.
Doch die Anstrengung der Reise ließen Masia wenig Luft, Vinja aus ihrem Leben zu erzählen, und der Landstrich, den sie nun durchquerten, bot so wenig Abwechslung, dass Vinja viel Zeit hatte, über das Ziel ihrer Reise nachzudenken. Zwischen Sorge und Vorfreude war sie hin- und hergerissen. Einerseits hatte sie die Reise satt und sehnte sich nach einem richtigen Bett und der Sicherheit eines Hauses. Aber gleichzeitig beunruhigte Ijaria sie. Wenn nur die Hälfte der Geschichten stimmte, die ihr Vater erzählte, dann bot Ijaria alles andere als das Gefühl von Sicherheit. Die Zweifel überwogen und so wünschte sich Vinja bei jedem Zwischenfall, ihre Eltern würden sagen: »Das war’s, wir müssen umkehren!«, doch nichts dergleichen passierte. Brach ein Rad, wurde es repariert. Ein Ochse verletzte sich am Bein und wurde unter den Händen eines Mitreisenden wundersamerweise wieder gesund. Egal was passierte, irgendjemand aus der Gruppe wusste, wie das Problem zu lösen war.
»Stell dich nicht so an«, hatte Puck eines Tages zu ihr gesagt. Er war ein mitreisender Gaukler mit meckernder Stimme. »Ijaria wird dir gefallen. Die meisten Menschen würden alles darum geben, nur einmal dort hinzukommen.«
Als sie ihn gefragt hatte, ob die Geschichten ihres Vaters stimmten, hatte er gelacht.
»Dein Vater bläht sich auf, dass er noch Platzen wird, wenn man ihn berührt. Aber seine Geschichten stimmen, ja. Ijaria ist riesig und du kannst dort alles finden, was du suchst. Wenn ich dir jetzt erzähle, dass dort ein Mann wohnt, der zwei Nasen hat, dann wirst du schon jemanden finden, auf den die Beschreibung passt.«
Vinja hatte ihn gefragt, ob auch wahr sei, dass es für jede Himmelsrichtung einen eigenen Markt geben würde. Daraufhin hatte Puck nur noch mehr gelacht.
»Ja, wenn du nur die großen Märkte mitzählst. Aber es gibt viel mehr als das. Eine Treppe, die niemand beschreiten kann, ein König, den keiner kennt, die mächtigsten Ritter der Welt und ein Schiff, das durch die Luft segelt!«
»Ist das dein Ernst?«, hatte Vinja gefragt.
Puck hatte die Brauen hochgezogen.
»Natürlich ist das mein Ernst. Sonst würde ich wohl Spaß machen und das kostet bei mir Geld!«
Mit diesen Worten hatte er Vinja zurückgelassen und in ihrem Kopf war ein Karussell aus Gedanken losgegangen. Gab es in Ijaria auch normale Menschen, hatte sie sich gefragt. Die Stadt war in ihrem Kopf noch weiter gewachsen und sie war düster und bedrohlich.
Trost bekam sie nur von der alten Masia.
»Das wird schon werden«, versuchte sie Vinja aufzumuntern, als sie ihr das Herz ausschüttete. »Es ist meistens gar nicht so schlimm, wie wir es uns vorstellen.«
Das wollte Vinja gerne glauben, doch fiel es ihr schwerer, je länger sie unterwegs waren.
»Wie weit ist es noch?«, fragte Vinja abends ihren Vater, nachdem sie ein provisorisches Lager errichtet hatten. Belfonso saß im Schneidersitz auf einer Decke in der Nähe ihres Karrens. Er studierte eine Karte und strich sich zwischendurch nachdenklich mit der Hand über seine Glatze. Als Vinja ihn ansprach, hob er den Blick.
»Ah, Vinja, Liebes«, sagte er mit freundlicher Stimme und rollte die Karte zusammen, »es ist nicht mehr weit, wir müssten schon bald da sein.«
»Sollten wir nicht eigentlich heute schon ankommen?«, fragte Vinja. Sie hatte die Tage im Kopf mitgerechnet und wusste, dass sie hinter ihrem Zeitplan waren.
»Nun, ob heute oder morgen, das macht doch keinen Unterschied, nicht?«, antwortete ihr Vater.
»Sicher macht es einen Unterschied«, schimpfte Rigund vom Wagen herüber. Sie war dabei, die Seile zu überprüfen, die ihre Sachen auf dem Wagen hielten. »Wir haben kaum noch Wasser! In dieser Hitze trinken alle wie die Esel, aber laufen tun sie wie alte Enten!« Sie stemmte ihre Hände in die Hüften und warf ihrem Mann einen giftigen Blick zu.
»Meine Liebe«, antwortete Belfonso im unterwürfigen Tonfall, »Nun mach doch Vinja nicht verrückt. Das Wasser reicht sicherlich und wenn wir erst einmal in Ijaria …«
Rigund unterbrach Belfonso mit einem unwilligen Schnaufen.
»Ijaria, Ijaria! Langsam frage ich mich, welcher böse Gott mich so verblendet hat, dir diesen ganzen Unfug abzukaufen!« Sie deutete auf Vinja. »Und um die brauchst du dir wohl keine Sorgen zu machen, die verschenkt doch unsere Vorräte noch freigiebig an diese alte Schachtel!«
Vinja zuckte zusammen. Es stimmte, sie hatte Masia von ihren Wasservorräten abgegeben, aber dafür hatte sie selbst weniger getrunken. Sie schaute ihre Mutter an, die wieder am Wagen zugange war. Gerade wollte sie ein Widerwort geben, aber ihr Vater kam ihr zuvor. Belfonso war aufgestanden und lief hinter Rigund her, die dabei war, den Wagen zu umrunden.
»Sie ist halt ein freundliches Kind, das wird ihr in der Wäscherei später nützlich sein.«
Rigunds Kopf erschien um die Ecke des Wagens.
»Nützlich? Ha! Vielleicht wenn wir eine Wäscherei für Arme und Bedürftige machen!« Sie trat hinter dem Wagen hervor und machte ein paar zappelige Gesten. »Willkommen in unserer Wäscherei«, sagte sie und versuchte dabei Vinjas Stimme zu imitieren, »wollen sie Ihre Lumpen mit Rosenduft oder vielleicht doch lieber Lavendel? Und dieser Fetzen da, das ist doch sicher mal eine Hose gewesen? Immer her damit, wir waschen alles!« Sie verschwand wieder hinter dem Wagen, nur um kurz darauf wieder mit dem Kopf um die Ecke zu schauen. »Umsonst!«, ergänzte sie ihre Einlage.
Belfonso lachte gekünstelt. »Wie schön, dass du deinen Humor nicht verloren hast. Ich verspreche dir …«
»Versprich mir besser nichts«, ertönte Rigunds Stimme hinter dem Wagen. »Guck lieber nach den Vorräten! Und wenn sie nicht reichen sollten, dann geh mal rüber zu Ulia und ihrer Familie. Ich glaube, die sind besser versorgt als wir!«
»Aber ihr Weg war ja auch viel kürzer«, antwortete Belfonso und folgte Rigund hinter den Wagen, wo Vinja sie noch weiter diskutieren hörte. Sie hatte Rigunds kleiner Darbietung schweigend zugesehen und musste sich zwingen, ruhig zu bleiben. Es war nicht Rigunds Spott, der sie ärgerte, sondern die zappeligen und unkoordinierten Bewegungen, mit der Rigund versucht hatte, Vinja zu imitieren.
Ich bin nicht so, dachte sie wütend, ich bin nicht so.
Es war nicht das erste Mal, dass ihre Mutter sie auf diese Weise nachgeäfft hatte. Was noch schlimmer war, ihre Mutter war nicht die Einzige, die es tat.
Schon von klein an hatte Vinja in der Wäscherei mitgeholfen und dabei hatte sie oft Dinge umgestoßen, war gestolpert oder hatte einen Auftrag ihrer Eltern falsch ausgeführt. Anfangs hatten ihre Eltern sie getadelt. Aber dann hatten sie bemerkt, dass die meisten Kunden die Schusseligkeit Vinjas amüsant und niedlich fanden, was ihr den Namen Wibbelinchen eingebracht hatte. Sie hasste diesen Spitznamen. Aber auch wenn sie sich alle Mühe gab, weniger ungeschickt zu sein, wurde sie ihn nicht los.
Dass sie kleiner war als die meisten Kinder ihres Alters, machte die Sache nicht besser. Sie hatte sich oft gefragt, wieso die anderen schon größer waren. Als ihre Eltern einmal eine Heilerin kommen lassen mussten, weil Vinja schwer krank im Bett lag, hatte Vinja die Gelegenheit genutzt. Während die Heilerin ihren vom Fieber heißen Körper untersuchte, hatte sie im Flüsterton gefragt, wann sie endlich wachsen würde. Die Heilerin hatte Vinja irritiert angeschaut und dann gelächelt. »Das kommt schon noch. Bei den einen früher und bei den anderen später!«, hatte sie geantwortet.
Das hatte Vinja beruhigt, aber wann war später, fragte sie sich oft, denn seitdem war sie nur wenige Zentimeter gewachsen.
Zankend bogen ihre Eltern um die Ecke des Wagens.
Ich hasse dich, ging es Vinja durch den Kopf, als sie ihre Mutter sah, manchmal hasse ich dich. Das Gefühl war heiß und stark und kaum war der Gedanke gedacht, schämte sie sich dafür. Sie drehte sich weg und war froh, als sie hörte, wie ihre Eltern streitend in einen anderen Teil des Lagers gingen. Vinja holte ihre Schlafdecke aus einer Tasche und rollte sie auf dem Boden aus. Auf dem Rücken liegend sah sie hinauf zu den Sternen. Sie sehen eigentlich genau so aus wie daheim, dachte sie. Ein Stein drückte unter der Decke.
Als sie ihn entfernt und sich wieder hingelegt hatte, drückte es an einer anderen Stelle. Wann schlafe ich endlich wieder in einem richtigen Bett, ging es ihr durch den Kopf. Dann wurde ihr klar, dass das Bett in Ijaria stehen würde, und zahllose neue Gedanken und Gefühle geisterten durch ihren Kopf. Als ihre Eltern Stunden später und immer noch streitend zurückkamen, lag auch Vinja noch wach.
Der nächste Tag begann heiß wie sein Vorgänger. Vinja fragte sich, wann es wohl endlich etwas abkühlen würde. Doch der Himmel war von strahlendem Blau und die Sonne brannte. Vinja hatte schlecht geschlafen. Schlechte Laune hatte sie auch und so trottete sie etwas abseits von ihrem Wagen alleine vor sich hin. Es war wohl gegen Mittag, als vom vorderen Teil ihrer Gruppe Stimmen laut wurden.
»Seht!«, rief jemand, »Reiter!«
Vinja blieb stehen und kniff die Augen zusammen. Tatsächlich, ein ganzes Stück vor ihnen sah sie eine Gruppe Reiter.
Sie ritten schnell, verlangsamten jedoch ihre Pferde, als sie der Reisegruppe näher kamen. Ihre Kleidung war aus bunten Stoffen. Auch ihre Pferde waren geschmückt.
Die Reisenden wichen zur Seite und die Reiter warfen ihnen abschätzige Blicke zu. Vinja sah, dass ein paar von ihnen Rüstungen unter ihren Umhängen trugen. Niemand sagte etwas, oder besser gesagt, fast niemand. Als die ersten Reiter an ihrem Karren vorbeigeritten waren, trat plötzlich ihr Vater neben dem Wagen hervor und verbeugte sich tief.
»Ihr edlen Herren und Damen«, sagte er. Dann richtete er sich wieder auf und schaute den erstbesten Reiter so erwartungsvoll an, dass dieser sein Pferd zügelte.
»Was willst du, Mann?«, fragte er streng und ungeduldig.
»Bitte, wenn Ihr es wisst, ist es noch weit bis Ijaria?«, fragte Belfonso.
Der Mann schaute ihn irritiert an, dann schüttelte er den Kopf.
»In eurem Tempo wohl noch einen halben Tagesmarsch. Gegen Abend solltet ihr da sein. Aber beeilt euch, nachts sind die Tore geschlossen.«
Belfonsos Augen leuchteten auf. Der Mann auf dem Pferd musterte ihn noch einmal, dann ritt er ohne ein Wort weiter. Als die Reiter die Gruppe passiert hatten, trieben sie ihre Pferde wieder an und schon bald waren sie außer Sichtweite.
»Hab ich es dir nicht gesagt?« Belfonso warf Rigund einen triumphierenden Blick zu.
Rigund schnaubte, aber Vinja sah, dass sie lächelte.
»Gegen Abend sind wir in Ijaria!«, rief Belfonso laut, denn nicht alle hatten mitbekommen, worüber er mit dem Reiter gesprochen hatte. Jubel brach aus und sie setzten sich wieder in Bewegung.
Nach weiteren Stunden, die sie sich durch die Hitze gequält hatten, sah Vinja etwas, das sie zuerst für einen großen Turm hielt. In der heißen und staubigen Luft zeichnete er sich vor ihnen als dunkler Umriss ab.
Sie waren immer noch ein gutes Stück weit entfernt, als Vinja erkannte, dass es kein Turm war. Es war eine riesige Statue.
Es war die Statue eines Mannes. In der linken Hand hielt er einen großen Stab, die rechte war mit den Fingern nach oben zum Himmel gerichtet. Er trug eine Kapuze und den Kopf hatte er in den Nacken gelegt.
Als sie sich der Statue weiter näherten, hatte Vinja das Gefühl, zu schrumpfen. Allein der Sockel war höher als ein großer Mensch und Vinja konnte sich nicht erinnern, schon einmal etwas Vergleichbares gesehen zu haben. Die Statue von Imius Halwar, dem Gründervater ihrer Heimatstadt, welche auf dem Marktplatz in Halwar stand, kam ihr jetzt schäbig und klein vor.
Unwillkürlich senkte sie den Blick und um sie herum taten es ihr viele gleich.
»Das ist die Statue Lurion Sternenrufers«, hörte sie plötzlich die flüsternde Stimme ihres Vaters neben sich, »einer der Gefährten des früheren Königs Grimbardts Rasgalians.«
Vinja sah in das aufgeregt und leuchtende Gesicht ihres Vaters. Sie wartete, ob er noch mehr sagen würde, doch er schwieg, ergriffen von dem erdrückenden Eindruck der Statue.
Als sie die Statue passierten, zwang Vinja sich, den Blick zu heben. Die Statue war aus weißem, glatten Stein, der hell in der Sonne leuchtete. Vinja kniff die Augen zusammen. Nirgends entdeckte sie eine Fuge oder einen Übergang. Es sah aus, als ob die Statue aus einem einzigen Felsblock gehauen worden wäre.
Um die Statue herum standen Soldaten. Viele von ihnen waren jung und die meisten lehnten gelangweilt gegen den mächtigen Sockel oder saßen in seinem Schatten. Als die Reisegruppe mit langsamen Schritten dem Weg folgte, der zu beiden Seiten um die Statue verlief, richteten sie sich auf, nahmen Haltung an und starrten geradeaus. Vinja war froh, als sie die andere Seite der Statue erreichten.
Kaum setzten sie den Weg in ihrem mächtigen Schatten fort, als Vinja am dunstigen Horizont die Umrisse einer Stadt erkennen konnte.
»Ijaria!«, rief jemand. Es war, als ob jemand einen Zauberbann gebrochen hätte. Mit dem Schweigen, das noch im Anblick der Statue geherrscht hatte, war es vorbei.
Je näher sie kamen, desto mehr verstand Vinja, dass ihr Vater nicht übertrieben hatte. Vielmehr gewann sie den Eindruck, er hätte untertrieben. Die Stadt war größer, als sie es in ihrer Vorstellung je gewesen war. Mit jedem Schritt, den sie tat, wuchs sie in Höhe und Breite. Vinja sah eine gigantische Stadtmauer und dahinter ragten Dächer, Türme und Kuppeln in die Höhe. In der Mitte der Stadt streckte sich ein Berg zum Himmel, auf dessen Spitze eine mächtige Festung erbaut war. Jetzt wurde auch Vinja von der Euphorie der anderen ergriffen. Mit einem Mal konnte sie es kaum erwarten, anzukommen, endlich da zu sein und diese ewig lange Straße hinter sich zu lassen. Doch es dauerte länger, als es aussah, und als sie die Ausläufer Ijarias erreichten, stand die Sonne tief am Himmel.
Schon außerhalb der Stadtmauern herrschte reges Treiben. Zuerst dachte Vinja, sie würden auf einen Markt zulaufen, denn sie sah Stände und Verkaufszelte. Doch als sie näher kamen, wurde ihr klar, dass sie sich irrte. Hier wurde nichts verkauft.
Die Zelte und Stände waren nicht mehr als notdürftig zusammengezimmerte Bretterbuden oder aufgespannte Decken, die an den Enden an Holzstangen geknotet waren. Ein paar Kinder in schmutziger Kleidung rannten auf sie zu und liefen ein Stück des Weges neben ihnen her. Auch ältere Personen traten an die Straße und manche fragten nach Geld oder Essen. Wie auch der Rest der Gruppe verfiel Vinja wieder in Schweigen, außer wenn sie mit groben Worten eines der Kinder fortjagten.
»Das ist ja widerlich!«, sagte Rigund plötzlich. Mit angeekeltem Blick musterte sie eine der Hütten, aus der ein beißender Geruch kam.
»Ja, nicht wahr?«, antwortete Belfonso leise. »Aber der königliche Rat lässt es regelmäßig abreißen, wenn es zu groß wird.«
Rigund schnaubte und machte ein säuerliches Gesicht, als könne sie diesen Tag kaum erwarten. Wo die Leute wohl hingehen, wenn ihre Zelte abgerissen werden, fragte sich Vinja, während sie ihren Blick über die Zeltstädte wandern ließ. Hier mussten Tausende von Menschen leben.
Kurz vor dem Tor trat Masia neben Vinja. Sie sah erschöpft, aber glücklich aus.
Vinja verlangsamte ihren Schritt, um sich mit ihr unterhalten zu können. Masia lächelte sie an.
»Nochmal danke für deine Hilfe. Ich glaube, ohne dich hätte ich es nicht geschafft.«
»Ach Unsinn«, antwortete Vinja, aber sie wusste, dass Masia vermutlich recht hatte.
Masia nahm Vinjas rechte Hand zwischen die ihren und drückte sie. Ihre Haut war heiß und trocken.
»Sicher sehen wir uns bald wieder«, sagte die alte Frau. »Ich komme in eurer Wäscherei vorbei, wenn ich kann. Es wird nicht schwierig sein, sie zu finden. Ich habe gehört, es soll die einzige in ganz Ijaria sein.«
Es dauerte einen Moment, bis Vinja begriff, dass Masia sich verabschieden wollte. Sie blickte sich um.
»Du kommst nicht mit herein?«
Die Alte schüttelte den Kopf. »Heute nicht mehr. Ich kann mir keinen Gasthof leisten und ich möchte nicht nachts durch die Straßen irren.«
»Aber dann schlaft doch lieber innerhalb der Mauern, das ist doch sicherer als hier draußen!«
Masia warf einen zweifelnden Blick Richtung Tor.
»Ich wette, das gibt nur Ärger mit der Stadtwache.« Sie schaute sich um. »Wir haben die ganze Zeit im Freien geschlafen, da wird die letzte Nacht mich nicht umbringen. Morgen suche ich dann den Laden meiner Schwester.«
Vinja merkte, dass Masia sich nicht von ihrem Plan abbringen lassen würde und nickte.
»Komm uns besuchen, sobald du kannst«, sagte sie mit belegter Stimme. Sie drehte sich nach vorn und sah, dass ihre Eltern das große Tor erreicht hatten und sich suchend nach ihr umschauten.
»Bis bald!«, rief sie Masia zu, dann drehte sie sich um und lief zum Tor.
»Da bist du ja endlich!«, schimpfte Rigund, als Vinja zu ihnen aufgeholt hatte. »Willst du hier draußen bleiben? Dann trödle nur weiter!«
Vielleicht sollte ich dass, dachte Vinja trotzig, doch sie schluckte ihre Widerworte herunter.
Der Torgang, den sie durchqueren mussten, war lang und dunkel. Fast alles wirkte fremd auf Vinja. Instinktiv trat sie näher an den Wagen.
An seinem Ende öffnete sich der Torgang hin zu einer breiten Straße, die schnurgerade auf das Zentrum der Stadt zulief. Auch hier wimmelte es von Menschen. Lärm drang auf Vinja ein, der Lärm von Karren, Füßen und Hufen, von Stimmen, die riefen, sprachen oder flüsterten. Alles ballte sich zu einem Wirrwarr von Geräuschen zusammen, deren Ursprung nicht mehr zu erkennen war. Ein fremder Geruch stieg ihr in die Nase. Für einen Moment wurde ihr schwindelig und sie musste sich am Karren festhalten. Kurz schloss sie die Augen, dann machte sie den letzten Schritt aus dem Gang hinaus.
Über die Straße hinweg, weit entfernt sah sie den Berg, den sie aus der Ferne schon bemerkt hatte. Das Licht der untergehenden Sonne tauchte die Festung auf seiner Spitze in rot-goldene Farben und ließ sie über die gesamte Stadt erstrahlen. Vinja tat einen tiefen Atemzug.
Sie waren in Ijaria angekommen.
Jorian
In einem einzigen, riesigen Schwarm flogen die Sperlinge über die Stadt. Es waren Hunderte, Tausende und nochmal Tausende. Zusammen ergaben sie eine Wolke aus Federn, Krallen und Schnäbeln, die sich in immer neuen Formen mal hierhin, mal dorthin bewegten. Trotz ihrer großen Zahl gab es nie Verwirrung über Richtung und Ziel. Sie flogen hinunter zum breiten Fluss, der sich quer durch die Stadt zog, dann stiegen sie wieder hinauf, hoch zum königlichen Palast, der majestätisch über der Stadt thronte.
Hier, entgegen der Perfektion, mit welcher sich die Sperlinge aneinander orientierten, gab es mit einem Mal ein Durcheinander. Ein kleiner Vogel geriet durch einen überraschenden Wirbel aus der Bahn, wurde gegen einen großen, älteren Vogel geworfen und stürzte dann hinab, trudelte flatternd Richtung Boden. Erst hier bekam er sich wieder unter Kontrolle.
Sofort wollte er wieder hinauf, doch er hatte die Orientierung verloren. Flatternd verfing er sich im Geäst einer Weide, die in einem kleinen, von einer Mauer umgebenen Garten stand.
Im Schatten der Mauer lag ein Hund und schlief. Als der kleine Vogel den Hund entdeckte, geriet er erneut in das Geäst des Baumes. Er brach seitlich aus, versuchte in einem Fenster zu landen, verfehlte es und schaffte es dann knapp auf der steinernen Bank eines zweiten Fensters.
Das Fenster gehörte zu einem Haus, das an den Garten anschloss. Auch die zweite Landung wäre beinahe misslungen und der Vogel gab ein erschöpftes und aufgeregtes Zwitschern von sich, bevor er in das Zimmer hineinspähte. Das Zimmer war groß, sogar sehr groß. Links und rechts standen Regale, die bis zur Decke reichten und bis oben mit Büchern vollgestellt waren. In der Nähe der Fenster stand ein Tisch mit allerlei Papier, Tintenfässchen und Federhaltern.
Am Tisch saß ein junger Mann, groß, hager und mit zerzausten dunklen Haaren. Als der kleine Vogel sein aufgekratztes, fast panisches Zwitschern von sich gab, blicke er auf und sah den Vogel an. Schnell schaute der Vogel beiseite und sah, dass im Raum ein weiterer Mann stand, breiter und älter als der andere. Er trug einen schmalen Hut, unter welchem kaum noch Haare hervorkamen, hatte ein gerötetes Gesicht und starrte schweigend an die Decke des Zimmers, einen Finger nachdenklich auf die Lippen gelegt.
Der Vogel schaute zurück zu dem Jungen und sah, dass der ihn immer noch mit fragendem Blick beobachtete. Das war zu viel der Aufmerksamkeit. Mit einem weiteren aufgebrachten Zwitschern drehte der Vogel sich um, warf sich zurück in die Luft und machte sich auf, um zu seinem Schwarm zurückzukehren.
Der Junge starrte dem Vogel noch eine Weile hinterher, doch der plötzliche Klang einer Stimme ließ ihn zusammenzucken.
»Ich hab's!«, rief der andere Mann. »Jetzt weiß ich es, schreib …«, er machte eine Pause, in welcher er mit erhobenen Händen erstarrte, »schreib: Meine allerwerteste und verehrte Mirulla, in Demut wende ich mich an Euch, wohl wissend, dass ich Eure kostbare Zeit nur flüchtig …«
Er unterbrach sich, erstarrte erneut und begann dann mit den Armen zu wedeln.
»Nein!«, rief er und warf dem Jungen einen besorgten Blick zu, »schreib das nicht, hast du das schon geschrieben? Wenn ja, dann brauchen wir einen neuen Bogen Papier, das klingt ja fürchterlich. Viel zu förmlich, viel zu unterwürfig. Ich muss noch einmal überlegen.«
Der junge Mann, der noch nichts geschrieben, ja nicht einmal die Feder in eines der Tintenfässchen getunkt hatte, nickte und stieß einen leisen Seufzer aus.
Der andere Mann begann im Zimmer auf- und abzulaufen, wobei er vor sich hin murmelte. Hin und wieder blieb er stehen und sagte »Schreib!«, bevor er dann mit einem »Nein nein, schreib noch nichts« wieder begann, im Zimmer seine Kreise zu drehen.
Der Junge wartete geduldig. Nur manchmal warf er einen nervösen Blick zum Fenster oder zur Tür, als fiele ihm etwas ein, das er vergessen hatte.
»So wird das nichts«, sagte der Mann plötzlich mit weinerlicher Stimme, »mir fehlen einfach die Worte, ich weiß einfach nicht, wie ich es ihr sagen soll.«
Der Junge nickte dem Mann verständnisvoll zu, ohne jedoch etwas zu sagen. Nach kurzer Überlegung schien dieser einen Entschluss gefasst zu haben.
»Ich …«, begann er, als hätte er sich daran gewöhnt, seine Gedanken erst hören zu müssen, um ihre Qualität zu beurteilen, »ich werde … Ich werde einen Poeten beauftragen!«
Seine Gesichtszüge entspannten sich und ein hoffnungsvolles Lächeln trat auf sein Gesicht.
»Das ist es! Ich werde einen Poeten beauftragen! Er wird etwas für mich schreiben können! Das wird klappen!«
Fast schien er einfach gehen zu wollen, als ihm einfiel, dass er nicht alleine war.
»Oh«, sagte er beschämt, »und … tut mir leid, wenn ich deine Zeit verschwendet habe, Borian, ich komme sicher ein anderes Mal auf deine Hilfe zurück. Guten Tag!«
Der Junge nickte wieder.
»Ich heiße Jorian«, sagte er leise.
Der Mann würdigte ihn kaum eines weiteren Blickes.
»Ah, sicher, wie auch immer. Nun, auf Wiedersehen!«
Mit diesen Worten verließ er das Zimmer.
Kaum war der Mann fort, begann Jorian, die Unterlagen auf dem Tisch notdürftig zusammenzuräumen.
Während er das Papier zusammenlegte und die Feder in eine dafür vorgesehene Tasche packte, dachte er über den vorangegangenen Besuch nach. Der Mann war ein Adliger namens Lut Stain. Stain hatte sich verliebt, in eine Mirulla Soundso, aber er traute sich nicht, es ihr offen zu sagen. Stattdessen war er auf die Idee gekommen, ihr einen Brief zu schreiben. Damit kam das nächste Problem. Seine Schrift war über alle Maßen unansehnlich und dauernd änderte er seine Meinung, was genau die richtigen Worte waren, um sich Mirulla anzuvertrauen. Er hatte ein Beispiel seiner vorangegangenen Versuche dabei gehabt und Jorian verstand gut, warum er sich an einen Schreiber gewandt hatte. Aber warum an ihn? Warum kamen diese Leute immer zu ihm? Lag es daran, dass er noch jünger war als seine Kollegen? Glaubten sie, er verstünde nicht, worum es bei ihren Briefchen und geheimen Schreiben ging?
Kopfschüttelnd betrachtete er den Schreibtisch. Er befand sich in einem katastrophalen Zustand und seine Mutter würde alles andere als zufrieden sein. Seine grobe Art, die Sachen zusammenzuräumen hatte Spuren hinterlassen. Zwei Bögen Papier hatten einen Knick und er hatte Tinte über den Tisch verschmiert. Normalerweise unterliefen ihm solche Fehler nicht, im Gegenteil. Er legte viel Wert auf geordnete Arbeitsmaterialien. Später würde er ordentlicher aufräumen, jetzt aber hatte er anderes im Sinn. Beinahe im Laufschritt verließ er das Haus durch die Hintertür.
Es war ein heißer Tag, aber im Garten war es angenehm schattig. Eine sanfte Brise raschelte in den Blättern der Weide. Ohne dass er sich umschauen musste, ging er zielstrebig auf die Stelle zu, wo der Hund im Schutz der Mauer lag. Es war sein Hund. Er gehörte ihm seit dem Tag, an dem seine Mutter ihm erklärt hatte, dass sein Vater nicht mehr nach Hause zurückkehren würde. Jorian erinnerte sich noch gut daran. Er wusste noch, dass er die Worte seiner Mutter nicht verstanden hatte und auch nicht, warum sie so traurig gewesen war. Er hatte sich einfach nur über den Hund gefreut, klein, tapsig, weich und angesichts seiner neuen Umgebung verunsichert. Jorian hatte sich um den Hund gekümmert, mit ihm gespielt und ihn gestreichelt, bis er auf seinem Schoß im Garten eingeschlafen war. Endlich hatte auch seine Mutter wieder gelächelt, als sie aus dem Haus kam, mit rotem Gesicht und dunklen Augen.
»Wie heißt er?«, hatte Jorian sie gefragt, leise und ohne sich zu bewegen, denn er wollte den Hund nicht wecken.
»Helma«, hatte seine Mutter geantwortet, »und es ist ein Mädchen.«
Seitdem hatte Jorian keinen Tag ohne sie verbracht. Bei den Nachbarn galt er deswegen als absonderlich. Normalerweise hielt man sich keine Hunde in der Stadt. Wenn doch, dann verfolgte man gewöhnlich eine Absicht damit. Man gab mit ihnen an, weil sie besonders edel waren. Andere ließen sich einen Straßenköter fangen, damit er bei Banketten unter dem Tisch herumlief und man sich die fettigen Hände daran abwischen konnte. Es waren Hunde, mehr nicht.
Für Jorian war Helma jedoch nicht nur irgendein Hund. Er liebte sie, so sehr man einen Hund lieben konnte.
Der Name, den seine Mutter für den Hund ausgesucht hatte, kam aus der alten Sprache und hieß »Beschützerin«. Das war Helma auch lange Zeit für ihn gewesen. Jetzt aber war sie alt und schwach. Als Jorian sich neben ihr im Gras auf die Knie ließ, hob sie müde den Kopf, öffnete die Augen und beobachtete ihn mit verschleiertem Blick. Sie schnupperte in der Luft und als sie ihn erkannte, wedelte sie kurz mit dem Schwanz, der klopfend auf den Boden schlug. Sie versuchte sich aufzurichten.
»Hey«, sagte Jorian leise und strich mit der Hand über ihr Fell. Er spürte ihren unregelmäßigen und rasselnden Atem, ihren unruhigen Herzschlag. Sie würde bald sterben, das wusste er, und dieser Gedanke lag wie eine eiserne Kette um seine Brust. Wenn er doch nur etwas tun könnte, wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, ihr neue Kraft, neues Leben einzuhauchen.
Sie war fünfzehn Jahre alt geworden und war damit fast so alt wie Jorian selbst, aber während er gerade erst dabei war, erwachsen zu werden, war Helma am Ende ihrer Zeit angekommen.
Mit rudernden Vorderpfoten versuchte sie aufzustehen, schaffte es aber nicht. Irritiert blickte sie Jorian an, als wäre ihr Geist nicht mitgealtert und verstünde nicht, wieso ihr Körper nicht auf sie hörte. Jorian half ihr auf die Beine und gemeinsam liefen sie eine Runde durch den Garten.
»Jorian?«
Jorian drehte sich zum Haus und sah seine Mutter Lia in der Tür stehen. Sie war groß und schlank und hatte ebenso dunkles Haar wie er selbst. Als er klein gewesen war, war sie die schönste Frau für ihn gewesen, die er kannte. Schön war sie auch heute noch, auch wenn ihr Gesicht immer ernst war.
Jorian hatte sich oft gefragt, warum sie sich nach dem Tod seines Vaters nie einen neuen Mann gesucht hatte. Zwischendurch war manchmal jemand da gewesen, aber nie für lange und kaum einer kam öfter als einmal. Einige wenige kamen eine Zeit lang regelmäßig zu Besuch und als Jorian jünger gewesen war, hatten sie ihm kleine Geschenke mitgebracht. Irgendwelchen Plunder, aber gefreut hatte er sich trotzdem.
Jorian machte einen Schritt in Richtung Haus. Er ahnte, was jetzt kommen würde. Trotzdem gab er seiner Stimme einen möglichst unwissenden Eindruck.
»Ja?«, fragte er.
Seine Mutter beobachtete ihn kurz und stieß dann Luft durch die Nase aus.
»Kannst du mir mal erklären, was mit unserem Arbeitstisch los ist? Und wo ist Siero Stain?«
Jorian entschied sich, zuerst auf die zweite Frage zu antworten.
»Er ist gegangen. Er findet nicht die richtigen Worte und will einen Poeten aufsuchen.«
Seine Mutter zog eine Augenbraue hoch.
»Er ist zu einem … «, begann sie aufgebracht, brach ihre Frage dann aber ab, »und, kommt er zurück?«
Jorian wurde heiß im Gesicht.
»Ich weiß nicht«, antwortete er beschämt.
»Das weißt du nicht?«, seine Mutter wurde wütend. »Hast du ihn denn nicht gefragt? Wie lange hast du für ihn da gesessen? Den ganzen Vormittag, oder etwa nicht? Und dann geht er, um einen Poeten aufzusuchen und du lässt ihn einfach so gehen?«
Jorian zuckte mit den Schultern. Was sollte er sagen? Er wusste, dass seine Mutter recht hatte. Sie schüttelte den Kopf.
»Du darfst dich nicht über den Tisch ziehen lassen, Jorian. Wenn er sich entscheidet, zu einem Poeten zu gehen, dann musst du ihm sagen, dass du vom Text eine Schönschrift erstellst. Oder dass er dich für die verbrauchte Tinte und das verbrauchte Papier entschädigen muss.«
»Ich habe nichts verbraucht«, antwortete Jorian, wohl wissend, dass er sich auch damit kaum würde rausreden können.
»Das ist doch völlig egal«, antwortete seine Mutter verärgert. Dann schien ihr etwas einzufallen. »Und weil du kein Papier fürs Schreiben verbraucht hast, zerknitterst du anschließend zwei Bögen und schmierst mit Tinte über den Tisch?«
Jorian schwieg.
»Ich weiß ja, warum du mit den Gedanken woanders bist«, fuhr seine Mutter jetzt in versöhnlichem Tonfall und einem Seitenblick auf Helma fort, »aber gerade dann solltest du doch darauf achten, dass die Zeit für die Arbeit nicht verschwendet ist. Wir brauchen das Geld, Jorian, wir können uns keine Nachlässigkeiten leisten. Bitte räum den Tisch richtig auf. Und dann frag bei Tevius nach, vielleicht hat er noch einen anderen Auftrag für dich.«
Mit diesen Worten drehte sie sich um und ging zurück ins Haus.
Jorian warf noch einen Blick auf Helma, die sich im Schatten der Mauer ins Gras fallen ließ und hechelnd liegen blieb. Dann folgte seiner Mutter nach drinnen.
Gedankenverloren begann er aufzuräumen. Er fühlte sich hilflos. Gab es denn wirklich nichts, das er für Helma tun konnte? Vielleicht sollte er einen Stadtarzt aufsuchen? Schnell verwarf er den Gedanken. Selbst wenn er es sich leisten könnte, würde sich ein Arzt wohl kaum mit Hunden auskennen. Und angenommen, er täte es, so bewahrte auch ein Arzt niemanden davor, zu altern, schwächer zu werden und zu sterben.
Während er dabei war, die Papierbögen glattzustreichen und auf einen ordentlichen Stapel zu legen, warf er erneut einen Blick aus dem Fenster. Am liebsten wäre er im Garten geblieben oder zumindest zu Hause. Nun aber würde er den Tag im Scrivorium verbringen. Unglücklich räumte er eine letzte kleine Metallfeder beiseite, die er zuvor achtlos mit dem Rest zusammengeschoben hatte.
Eigentlich vermittelte ihm der Anblick des aufgeräumten Tisches das angenehme Gefühl getaner Arbeit. Heute fand er darin keinen Trost.
Er packte seine Arbeitstasche, hängte sie sich über die Schulter und suchte seine Mutter, um sich von ihr zu verabschieden. Er fand sie draußen vor dem Haus. Sie stand auf einer Leiter und war dabei, einen der hölzernen Fensterläden zu reparieren.
Es war nicht der einzige, der beschädigt war. Auch an Jorians Zimmer hing ein Fensterladen lose in den Angeln. Er hatte sie mit einer dicken Kordel an einem Mauerhaken festgezogen, damit er nicht ständig im Wind klapperte. Dabei war eine der Angeln fast aus dem alten Mauerwerk gebrochen, aber Jorian hatte es seiner Mutter nicht gesagt. Sie hatte auch so schon genug zu tun. Neben ihrer Arbeit in der königlichen Bibliothek übernahm sie die meisten Reparaturen am Haus und es gab viel zu reparieren. Jorian wusste, dass er ihr keine große Hilfe war. Auf Leitern wurde ihm schnell schwindelig und auch wenn er in der Lage war, feinste Linien und wunderschöne Kapitalbuchstaben zu schreiben, so war er gleichsam ungeschickt, wenn es darum ging, einen Nagel in die Wand zu schlagen.
Seine Mutter warf einen Blick zu ihm hinunter. Mit der Hand, in der sie den Hammer hielt, wischte sie sich den Schweiß von der Stirn.
»Ich gehe ins Scrivorium«, rief er zu ihr hinauf.
Sie nickte ihm zu. »Das ist gut, Jorian«
Jorian wandte sich zum Gehen.
Zu seiner Erleichterung war die Straße menschenleer, denn Jorian mochte seine Nachbarn nicht. Sie redeten hinter ihrem Rücken über ihn und seine Mutter. Jorian hatte sie dabei beobachtet. Wenn er mit ihnen sprach, waren sie nicht unfreundlich, aber sie brachen ihre Gespräche ab, wenn er vorbeikam, und blickten plötzlich verlegen zu Boden.
Es störte ihn nur wenig. Wenn es nach ihm gegangen wäre, so hätten sie ihr Haus längst verkaufen und in eines der weniger teuren Viertel ziehen können.
Seine Mutter war dagegen. Sie sagte, der Weg zur Arbeit würde ihr zu weit. Jorian akzeptierte die Begründung, auch wenn er davon ausging, dass es in Wahrheit um die Erinnerung an seinen verstorbenen Vater Rusiak war, die einen Umzug verhinderte.
Ihn selbst ließ die Erinnerung an seinen Vater seltsam kalt. Er hatte ihn kaum gekannt und über seinen Tod wusste Jorian fast nichts. Als er einmal seine Mutter gefragt hatte, wie er gestorben war, hatte sie ihm erzählt, er wäre bei einem Reiseunfall ums Leben gekommen.
Jorian hatte nicht das Bedürfnis gehabt, mehr zu erfahren. Mit den Jahren hatte er begonnen, seinen Vater für die Einsamkeit seiner Mutter verantwortlich zu machen, und insgeheim hegte er einen Groll gegen ihn.
Die einzige Verbindung, die er zu seinem Vater hatte, war, dass auch sein Vater ein Schreiber gewesen war. Jorian kannte ein paar seiner Arbeiten und es war unmöglich, ihre Qualität zu leugnen. Trotzdem missfiel es ihm, wenn jemand seine eigenen Arbeiten damit kommentierte, dass sein Vater es nicht viel besser gekonnt hätte.
Jorian durfte sich noch nicht offiziell als Scrivor bezeichnen, aber er übernahm die gleichen Arbeiten und war besser als mancher, der es durfte. Er mochte seine Arbeit – oder vielmehr, er liebte sie regelrecht. Selbst an missglückten Liebesbekenntnissen wie am Vormittag konnte er gefallen finden, wenn er sich der Präzision und Exaktheit der Buchstaben und Wörter widmete.
Ins Schreiben konnte er sich versenken und er war stolz auf seine Fehlerlosigkeit. Noch besser gefiel es ihm, wenn es darum ging, die Texte eines alten Buches zu rekonstruieren oder gar ein ganzes Buch zu kopieren. Dann war es auch das Lesen, das ihn begeisterte. Er hatte begriffen, dass es nicht nur darauf ankam, den Text einfach abzuschreiben. Man musste ihn verstehen, ihn regelrecht in sich aufnehmen. Form und Ausdruck der einzelnen Buchstaben und Wörter mussten dem Inhalt angepasst werden. Sie mussten sich um den Inhalt des Textes herumlegen. Das war ihm klar geworden, als er sich mit einem besonders wertvollen Buch hatte beschäftigen müssen. ›Die Schönheit Wiwurons‹ hatte es geheißen. Im Grunde genommen war es nicht mehr als die Beschreibung einer alten Stadt, die nach der Schilderung noch größer gewesen sein musste als Ijaria.
Das Buch war anders gewesen als die meisten Bücher, die er bisher gesehen hatte. Es war ihm vorgekommen, als ob er über die Sorgfalt und Schönheit der Buchstaben den tatsächlichen Sinn des Textes erst wirklich verstehen konnte. Die Buchstaben waren schön wie die beschriebene Stadt und sie änderten sich auf kaum merkliche Weise, je nachdem welcher Teil der Stadt beschrieben wurde.
Die Abschrift hatte Jorian viel Zeit und Mühe gekostet. Als er fertig war, hatte er den Eindruck gehabt, selbst einen Beitrag zur Schönheit Wiwurons geleistet zu haben.
Trotz allem hatte sich der Auftraggeber im Scrivorium sehr über ihn aufgeregt. Weder erkannte er die Qualität der Arbeit noch schien er sich für das Buch zu interessieren. Er hatte einfach eine möglichst schnelle Abschrift haben wollen, um sie in seine Bibliothek stellen zu können.
Seitdem mahnte Tevius, der das Scrivorium leitete, Jorian stets zur Eile, wenn er ihm einen Auftrag gab.
Tevius war ein großer und breiter Mann, von dem man kaum glauben wollte, dass er eine Feder in die Hand nehmen konnte, ohne sie zu zerbrechen. Aber er konnte es, auch wenn seine Arbeiten meist schlicht waren. Der Unterschied zwischen Tevius’ und Jorians Arbeiten war unverkennbar.
Jemand rempelte Jorian an und riss ihn aus seinen Gedanken. Er war geradewegs in zwei Männer hineingerannt, die ihm auf der breiten Straße entgegengekommen waren. Schnell wurde ihm klar, dass eigentlich genug Platz gewesen wäre, um an ihm vorbeizugehen.
»Pass doch auf!«, sagte einer der Männer unfreundlich. Jorian richtete sich auf. Wenn er ging, gewöhnte er sich nach wenigen Schritten einen gebeugten Gang an, vor allem, wenn er in Gedanken war. Vorsichtig betrachtete er die beiden anderen. Sie trugen trotz der Hitze dunkle Anzüge, eine Mode, die sie als konservativen Teil des Adels auswies.
»Entschuldigung«, sagte er und deutete eine Verbeugung an, »es tut mir leid.« Er schämte und hasste sich für die Worte, aber er wusste, dass es besser für ihn war. Die anderen waren zu zweit und selbst wenn es nur einer gewesen wäre, so war sich Jorian sicher, dass er in einer direkten Auseinandersetzung kaum eine Chance gehabt hätte. Einer der Männer grinste.
»So ist’s recht!«
Auch der andere amüsierte sich, schien aber noch nicht ganz zufrieden zu sein. Ohne Vorwarnung versetzte er Jorian einen Stoß vor die Brust.
»Und was ist mit mir?«, fragte er mit einem kalten Lächeln.
Jorian verbeugte sich abermals. »Euch gegenüber tut es mir natürlich auch leid.«
Die beiden Männer lachten. Jorian machte einen Schritt beiseite, um den Weg freizugeben. Ohne ihn eines weiteren Blickes zu würdigen, setzten sie ihren Weg fort. Jorian folgte ihnen mit einem vorsichtigen Blick und beobachtete, wie sie selbstzufrieden in der Mitte der Straße liefen. Ein Zittern lief durch seinen Körper, teils aus unterdrückter Wut, teils aus Erleichterung.
Im Allgemeinen beließen es solche Leute bei dummen Pöbeleien, aber manchmal schubsten sie ihn und einmal hatte ihn sogar jemand geschlagen. Zwei Passanten hatten die Szenerie beobachtet, aber nichts gesagt. Jorian hatte schnell verstanden, wie das Viertel funktionierte, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hatte. Als Kind hatte man ihn in Ruhe gelassen, aber als er älter wurde, forderte der Adel Respekt. Respekt, den er in Jorians Augen nicht verdiente. Das Adelsviertel lag nahe dem Platz der Sonne, der am Fuße der Herzfeste lag. Seine Lage symbolisierte sowohl die Nähe zum König als auch die zentrale Bedeutung des Adels. Das Viertel existierte, soweit Jorian wusste, schon seit es Ijaria gab, und es war immer in der Hand des alten Adels gewesen. In letzter Zeit aber hatte Jorian von Spannungen gehört. Spannungen, die ihn nicht wirklich interessierten, doch deren Auswirkungen er in solchen Situationen zu spüren bekam. Er wusste nicht genau, worum es bei diesen Spannungen ging, aber etwas an der Rolle des alten Adels schien sich zu ändern.
Als die Männer aus Jorians Blickfeld verschwanden, seufzte er. Nicht zuletzt wegen solcher Menschen wäre es ihm lieb gewesen, in ein anderes Viertel Ijarias zu ziehen.
Warum eigentlich überhaupt Ijaria, ging es ihm durch den Kopf. Er seufzte. In eine andere Stadt zu ziehen, wäre wohl das Letzte, woran seine Mutter ein Interesse hatte, wenn sie schon innerhalb Ijarias nicht umziehen wollte. Und wenn er alleine fortging? Das Alter dafür hatte er fast erreicht. Was sollte ihn hier halten? Schmerzlich fiel ihm Helma ein und er zuckte zusammen wie unter einem Schlag. Sicher, solange Helma lebte, würde er alleine ihretwillen hier bleiben. Und wenn sie tot war? Was würde aus seiner Mutter werden, wenn er fortginge? Und war es woanders wirklich besser? Er hatte Ijaria nur wenige Male verlassen und er erinnerte sich kaum daran. Mit gesenktem Blick setzte er den Weg fort und achtete darauf, am Rand zu laufen, um nicht erneut mit jemandem aneinanderzugeraten.
Die Mittagszeit war vorüber, als er das Scrivorium erreichte.
Das Scrivorium hatte zwei Eingänge. Einen vorn, der auch in den kleinen Laden führte, in welchem Tevius oder einer seiner Vertreter Gespräche mit Kunden führten. Der andere Eingang befand sich auf der Rückseite, welche man über eine schmale und unscheinbare Gasse erreichte. Jorian entschied sich für den Hintereingang. Vorsichtig klopfte er an die große und einfache Holztür. Es dauerte eine Weile, dann wurde die Tür langsam und leise geöffnet. Hinter der Tür stand Beotrum, einer von zwei Bediensteten im Scrivorium, die nicht als Schreiber arbeiteten. Er musterte Jorian mit kritischem Blick und nickte dann, um ihm zu signalisieren, dass er eintreten durfte.
Das Scrivorium war ein altes Gebäude. Es hatte dicke Mauern und lag tiefer als die Straße, sodass man eine kleine Treppe hinuntersteigen musste, um in den Arbeitsraum zu gelangen. Der Raum, in welchem die Scrivoren arbeiteten, war lang und breit. An einer der Seiten waren auf ganzer Länge Fenster angebracht, durch die ein wenig Tageslicht hereinfiel. Trotz allem war der Raum dämmrig und auf vielen Tischen, die den Raum füllten, waren kleine Öllampen entzündet. Fast alle Tische waren besetzt. Überall saßen Männer und Frauen, die eine Feder in der Hand hielten und schrieben. Hin und wieder streckte sich jemand und gab ein leises Ächzen von sich und mancher las sich flüsternd den Text vor, den er kopierte. Aus einer der hinteren Tischreihen kam ein Husten, ansonsten hörte man nichts außer dem Kratzen der Federn auf Papier.
»Tevius?«, flüsterte Jorian leise zu Beotrum.
Beotrum deutete stumm auf die gegenüberliegende Seite des Schreibraums, wo sich Tevius’ persönliches Arbeitszimmer befand. Jorian nickte und machte sich auf den Weg zwischen den Tischen hindurch. Hier und da hob jemand den Kopf. Ikani, eine Scriva, die nur ein paar Jahre älter war als er selbst, lächelte ihm zu, als er vorbeiging, sonst grüßte ihn niemand.
Am anderen Ende des Raumes angekommen, öffnete er leise die Tür zu Tevius’ Arbeitszimmer.
Das Arbeitszimmer war groß und geräumig. Es wurde dominiert von einem riesigen Schreibtisch, auf welchem im Kontrast zu seiner Größe nur wenige Arbeitsutensilien lagen. Ein Glas mit Tinte, eine Feder, ein Stapel Papier. Entlang der Wände standen Bücherregale, welche bis zum letzten freien Platz mit Büchern vollgestellt war, ohne dass sie dabei voll wirkten. Jedes Buch saß genau an seinem Platz. In einer Ecke standen zwei aufwendige Sessel und ein kleiner Tisch, die den Eindruck erweckten, mehr zur Dekoration zu dienen als zum Sitzen. Tevius saß wie immer hinter seinem Schreibtisch und arbeitete. Als Jorian eintrat, hob er den Kopf.
Tevius war groß und breit, hatte ein hervorstehendes Kinn, ausgeprägte Wangenknochen und einen stechenden Blick. Er war einer der wenigen Männer, die Jorian kannte, die ihr Haar sehr kurz trugen, obwohl er nicht mal einen Ansatz zur Glatze hatte. Jorian hätte ihn sich besser als Soldaten denn als Schreiber vorstellen können.
»Jorian«, sagte Tevius zur Begrüßung, legte vorsichtig die Feder beiseite und richtete sich in seinem Sessel auf. Sein Blick wirkte geschäftsmäßig. »Was kann ich für dich tun?«
Jorian machte ein paar Schritte ins Zimmer hinein.
»Ich wollte fragen, ob du vielleicht einen Auftrag für mich hast. Ein Kunde von heute Morgen ist mir abgesprungen.«
Tevius griff in eine Schublade und zog ein Buch hervor. Er schlug es auf, blätterte vor und zurück und fuhr mit dem Finger über die Seiten. Dann hielt er inne.
»Hier habe ich tatsächlich etwas für dich«, sagte er und blickte Jorian an, »Eine Wäscherei hat in der Stadt aufgemacht und hat Werbezettel in Auftrag gegeben.«
»Werbezettel?« Jorian ahnte, worauf das hinauslief. Ein und dieselbe Seite musste abgeschrieben werden, immer und immer wieder. Tevius nickte.
»Interesse?«
Jorian zögerte noch einen Moment, dann nickte er.
»Gut!«, sagte Tevius, »Aber Jorian, es geht hier um Masse. Es sind Werbeschriften eines einfachen Wäschers. Ich weiß, wie genau du arbeiten kannst und dass das eigentlich unter deinem Niveau liegt, aber ich möchte …«
»Dass ich schnell arbeite«, vollendete Jorian den Satz resignierend.
Tevius lächelte. »Genau. Ich möchte, dass du vor allem schnell arbeitest.«
Er machte eine Notiz in das Buch, schloss den Deckel und schob es zurück in die Schublade. Dann öffnete er eine weitere Schublade und blätterte durch einige Papiere. Eines zog er heraus und reichte es Jorian. Es enthielt einen schlichten und einfallslosen Text über die Neueröffnung der Wäscherei.
»Sprich mit Alvik über die Bezahlung. Du kannst hier arbeiten, wenn du willst.«
Mit diesen Worten war das Gespräch beendet und Tevius setzte seine Arbeit fort.
Jorian ging hinaus und überlegte, ob er sofort zu Alvik gehen sollte, um über seine Bezahlung zu verhandeln. Er mochte Alvik nicht. Alvik war ein alter dürrer Mann, der zweite Mitarbeiter von Tevius, der nicht als Schreiber arbeitete. Er war für die Zahlen des Scrivoriums zuständig und auch wenn es nicht sein Geld war, das er verwaltete, tat er doch so, als müsste er sich jede Zahlung von seinem eigenen Lohn abziehen. Jorian entschied sich, erst zu ihm zu gehen, wenn er mit seiner Arbeit fertig war. Es verhandelte sich besser, wenn man seine fertige Arbeit schon vorweisen konnte. Er blickte auf den Zettel und stöhnte leise, als er die Zahl sah, die Tevius am unteren Rand notiert hatte. Einhundert Abschriften! Instinktiv griff er nach seinem Handgelenk und begann es zu lockern. Dann ging er zu einem der großen Regale, die mit Arbeitsutensilien gefüllt waren, und suchte sich Papier und Tinte zusammen. Er nahm sich einen freien Platz und wollte gerade mit seiner Arbeit beginnen, als er an einem der oberen Fenster einen kleinen Vogel sah. Der Vogel zwitscherte kurz, es klang fröhlich und melodisch. Dann flog er davon und für den Rest des Tages hörte Jorian nichts als das Kratzen von Federn und das Rascheln von Papier.