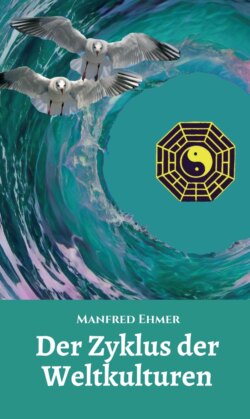Читать книгу Der Zyklus der Weltkulturen - Manfred Ehmer - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеSchöpfungstage
Eine kosmische Symphonie
Sechs Milliarden Jahre alt, 77.000 Lichtjahre lang, die großen Linsen funkelnd in kosmischer Erhabenheit, so rollt sie durch die dunklen Weiten des unendlichen Raums. Zehn Milliarden Sonnen in unendlicher Mannigfaltigkeit und Gruppierung. Kugelsternhaufen, wie tausend Brillanten zusammengeballt in strahlender Pracht. Rote Riesensonnen, einsam dahintreibend durch die Weiten des Alls. Blauweiße Supergestirne, ungeheure Energiemassen von sich schleudernd. Weiße Zwergsterne und Schwarze Löcher, gähnend im Raum und ewig gefräßig nach Materie. Ringsysteme, Doppelsonnen, Schleiernebel, glühend im fahlen Lichtschein stellarer Verbrennung. Kosmische Dunkelwolken, aufgetürmt in bizarren Formen.
Alles eingefangen in einem riesigen, ehrfurchtgebietenden Wirbel, schwebend in scheinbar erstarrter Bewegung. Schimmernde Spiralarme stellen, wie Myriaden Juwelen in herrlichen Kronen, ihre blendende himmlische Leuchtkraft zur Schau. Alles durchwoben von hauchdünnen Filamenten vielfarbig schillernder Wasserstoff-Wolken: Brutstätten feuriger Jungsonnen, die stolz ihren Daseinszyklus durchrasen, um zuletzt in grellem, selbstzerstörerischem Blitz zu enden als explodierende Super-Novae. Einmal innerhalb von 200 Millionen Jahren dreht der Sternenwirbel sich um seine eigene Achse. Da ist der flimmernde Kern des Systems, unerreichbar und ewig verboten infolge seiner überwältigenden Dichte. Hier findet man geballte Stellarwolken von ungeheurer Leuchtkraft, in Ringen gruppiert um den eigentlichen, unsichtbaren, mysteriösen Kern dieses Systems, das die denkenden Lebensformen des Alls naiv und unbefangen „unsere Galaxis” oder „unser heimatliches Milchstraßensystem” nennen. Aber dieses sogenannte Milchstraßensystem, diese gigantische galaktische Linse kann in vollem Umfang von keinem intelligenten Lebewesen des Alls begriffen werden.
In ungeheuren galaktischen Symphonien ertönt dieses Linsensystem im Sphärengesang unzähliger Sonnen und Sternsysteme. Planetentöne der verschiedensten Art, nicht wahrnehmbar für menschliche Ohren, durchmischen sich mit dem dumpfen Ton kosmischer Hintergrundstrahlung, ständiger Widerhall einer Urexplosion, die sich vor 15 Milliarden Jahren zugetragen hat. Dazwischen das leise Knistern unbekannter radioaktiver Quellen. Und, auf der tiefsten Oktave, der dumpfe Pulsschlag verborgener Pulsare. Rätselsonnen glimmen in der Ferne, eingehüllt in bläulichweiße Nebelfetzen.
Ist dieses ganze Linsensystem nicht voll von Leben, voll von Bewusstsein? Aber was wissen wir schon von unseren kosmischen Sternenbrüdern? Was wissen wir vom Bewusstsein der Myriaden Sternengeister, planetarischen Intelligenzen, morphogenetischen Felder, die dieses unendliche All bevölkern? Und diese ganze Galaxis in ihrer Gesamtheit, unbegreiflich in ihrer Ausdehnung – ist sie nicht das funkelnde Diadem und Kleinod einer Göttin, eines großen galaktischen Bewusstseins, das wir nicht kennen und niemals erfassen werden? –
Ein Weltenwanderer in den Tiefen des Alls, irgendwo am Rande der Galaxis, nicht mehr als ein Staubkorn gemessen an der majestätischen Größe dieses ganzen Milchstraßensystems, ist unsere Erde – unser blauer Planet im All. Eine einmalige Oase des Lebens, diese Erde, inmitten der sternübersäten, aber doch leeren, verlassenen, nur von Sonnenwinden und Radiowellen angefüllten Weiten des Alls. Wir sind die Kinder der Erde. Aber wir sind auch Kinder des Kosmos – Sternenstaub, Götterstaub. Aus dem Staub kosmischer Götter sind wir geformt. Und mögen noch so viele Universen untergehen – aus dem Sternenstaub der Götter entsteht immerzu Neues.
Schauen wir doch einmal in die fernste Vergangenheit hinein – in das kosmische Weltgedächtnis –, dann sehen wir den Weltschöpfungsprozess vor unserem Auge so, wie er sich vor 4,5 Milliarden Jahren abgespielt hat. Um die Sonne unseres Systems hatte sich in jenen Urtagen ein Wulst aus solarer Materie gebildet; dieser geriet in wirbelartige Bewegung und wurde wie in großen Atemstößen in das All ausgestoßen. Das Sonnenfluidum bildete rings um die Ursonne herum eine wogende Nebelmasse, in der sich hier und dort wirbelartig kreisende Bewegungen zeigten, um mehrere Zentren herum – die langsam sich verdichtenden Planetenkerne. Und was dann geschah, spielte sich in Äonenzeiträumen ab: Verlangsamung der Wirbelbewegung. Erkaltung. Verdichtung. Erstarrung. Die Urformen der Planeten bilden sich heraus. Feste, steinerne Planetenkerne. Aber noch umgeben von Atmosphären unaufhörlich wirbelnder glühender Gase.
Versuchen wir, uns ein Bild von der Ur-Erde in jenen frühen Schöpfungstagen zu machen, dann sehen wir sie als einen einzigen, ständig eruptierenden Vulkan, als einen Urozean glutflüssiger Lavamassen, über den unaufhörlich Meteoritenschauer herniedergehen. Ein übergroßer Mond, damals in nur 15.000 km Abstand die Erde umkreisend, hing über dem schwer umwölkten Himmel, dessen Atmosphäre sich gerade aus aufsteigendem Wasserdampf, Kohlensäure und anderen Gasen zusammengebraut hatte. Doch schon haben sich die ersten festen Granitblöcke kristallisiert, auf der Glut schwimmend wie Eisberge im Polarmeer, und sich langsam absenkend auf einen untergründigen Basaltmantel: Kontinente noch nicht, aber erste Kontinente im Werden. Dieses Toben der Elemente – das ist der Erste Schöpfungstag. Aber es ist noch eine Vormorgenstimmung, eine dämmerhafte Frühlichtstimmung, wo die alten Sterne noch nicht verblasst, die neue Sonne noch nicht aufgegangen ist.
Präkambrium – so nennt man üblicherweise diesen düsteren Vormorgen der Schöpfung. Der Zweite Schöpfungstag dämmerte aber erst heran, nachdem sich nach endlosen Regenfällen die ersten Ozeane auf dem nunmehr schon wesentlich erkalteten Erdplaneten gebildet hatten. Diese bargen schon Leben: im Kambrium, zwischen 600 und 500 Millionen Jahren zurück, wimmelte es in den Urwassern von Trilobiten; im Zeitalter des Ordoviciums, 500 bis 440 Millionen Jahre zurück, waren die Meere von einer Vielzahl von Seeigeln, Seesternen, Korallen, Brachiopoden und Seeskorpionen bevölkert, manche davon bereits zu riesenhafter Größe angewachsen. Im Zeitalter des Devon, vor 395 bis 345 Millionen Jahren, fand eine geradezu explosive Entwicklung der Fischwelt, mit allen nur erdenklichen Arten und Unterarten, statt. Dies war der Zweite Schöpfungstag, da alles Leben noch im Wasser ruhte.
Dann aber, im späten Obersilur, geschieht etwas ganz Revolutionäres: Das Leben erobert das Land! Zaghaft steckten die ersten Pflanzen ihre grünen Fühler in die Gezeitenzonen aus, um von dort aus schnell das trostlos öde Festland zu bewachsen und in rasender Geschwindigkeit zu erobern. Es entstand Wald – aber nicht Wald, wie wir ihn heute kennen, sondern ein von Menschenaugen nie geschauter Märchenwald: der Steinkohlenwald der Urzeit!
Riesige, dampfende Sumpfwälder bedeckten weite Teile der karbonischen Welt. Das Karbonzeitalter, von heute 345 bis 280 Millionen Jahre zurückliegend, wird auch das Zeitalter der Amphibien genannt. Zu gewaltigen Bäumen wuchsen die aus dem Urwasser gekommenen Pflanzenarten in der üppigen Nährkraft des unverbrauchten Bodens sich aus. Aber nicht zu Bäumen, wie wir sie heute kennen. Schachtelhalme ragten wie Türme in den Himmel; Bärlappgewächse wuchsen sich zu hohen Waldbäumen aus; Farne strebten auf dunklen Stämmen in schwindelige Höhen empor; unendliche Lianenstränge zogen sich von Zweig zu Zweig. Dies war der Dritte Schöpfungstag der Erde ….
Für immer versunken ist der Steinkohlenwald der Urzeit. Die märchenhaften Steinkohlenwälder mit ihren Schachtelhalm- und Bärlappbäumen waren längst als langsam erhärtende Torfmasse begraben, und von den Uferdünen der Weltmeere zogen sich weite, dunkle Forste starrer Nadelhölzer landeinwärts, unterbrochen von Beständen lichtgoldgrüner Ginkobäume und Riesenpalmen. Aus den Amphibien hatten sich die Reptilien entwickelt. Vor 195 Millionen Jahren, im Perm-Zeitalter, gewannen sie Oberhand. Denn der neue Schöpfungstag, der nun angebrochen war, der Vierte, sollte ganz im Zeichen der Riesenreptilien stehen: der Saurier!
Bei den Sauriern zeigte das kaleidoskopartige Formbildungsspiel der Natur einen Einfallsreichtum wie sonst kaum, und manche Formen wuchsen sich zum Grotesken aus. Bald wurde der ganze Körper in undurchdringliche Panzer gehüllt; bald wuchsen aus der Haut Igelstacheln wie Lanzen, und den Rücken schützten kolossale Knochenplatten, senkrecht aufgebäumt wie ein Molchkamm; bald formten sich massige Körper wie beim Rhinozeros mit mächtigen Hufen; bald liefen flinke zweibeinige Kreaturen umher mit muskulösen Oberschenkeln und winzigen angewinkelten Vorderarmen und mit einem knöchern grinsenden Krokodilskopf. Welch ein Kaleidoskop an Absonderlichkeiten! Aus dem Maul bogen sich lange krumme Walrosshörner, und der schwere keulenartige Schwanz schmetterte Bäume krachend zu Boden. An den Uferdünen des Jurameeres löste sich zur Abendstunde von den kalksteinweißen Felsklippen ein gespenstisches Geschlecht fledermausartig beschwingter, scheußlicher Reptilien, um möwengleich auf die graue Wasserfläche hinauszuschweben. Pteranodon waren das, Flugsaurier mit über 7 Metern Flügelspannweite! Und dies war der Vierte Schöpfungstag der Erde.
Eine fast märchenhaft anmutende Drachenwelt hatte die Natur in der Jura-, Trias- und Kreidezeit geschaffen. Etwa der Diplodocus: Ein auf vier hohen säulenartigen Beinen ruhender, sachte hin- und herschaukelnder Tonnenleib, an den von der massigen Beckengegend sich ein endlos langer schlangenhafter Schwanz anschloss, während nach vorne hin ein giraffenähnlicher feister Hals in einem Köpfchen endete, den man sich eher als eine Schwanzquaste hätte denken können. Aber schon breitet der Archaeopteryx seine Schwingen aus, der erste Vogel, vorerst nur taubengroß; schon läuft das erste flinke Säugetier zu Füßen der stampfenden Saurier in sein Versteck: es wartet auf seinen „Schöpfungstag“. In den Nadel- und Palmenbewuchs der alten Jurawelt haben sich unmerklich kleine Laubwaldhaine eingemischt: die Erde schickt sich an, ihr Pflanzenkleid wieder einmal zu erneuern.
Das große Sauriersterben vor 65 Millionen Jahren gehört zu den größten Rätseln der Erdgeschichte. War es eine globale Klimaveränderung? Ein Meteoritenschauer? Der Absturz eines Erdmondes oder gar das Zerbersten eines unbekannten Planeten? Wir werden es nie erfahren. Auf jeden Fall beginnt mit dem Tertiär-Zeitalter ein neuer Schöpfungstag, der Fünfte nun, in dessen Verlauf die Erde zunehmend ihre heutige Form annimmt. Auf den lichtgrünen Grasweiden der Tertiärwelt tummeln sich Mastodone, Mammute, elephantengroße Megatherien und nashorngroße Gürteltiere, dazwischen Antilopen, Giraffen, vorweltliche Okapitiere und die Vorformen des Pferdes. Auch die Kontinente besitzen annähernd ihre heutige Form; der Himalaya ist schon aufgewölbt, aber vereinzelt besteht noch altes atlantisches oder lemurisches Land, ein stummer Zeuge einer älteren erdgeschichtlichen Vergangenheit.
Eine Welle von Eiszeiten war über das Antlitz der Erde hinweggegangen. Am Rand der Gletscher dehnte sich die Ödnis unbewohnter Steppe, nur von Büffeln und Mammutherden durchstreift. Da entzündeten – niemand weiß genau, wann – die ersten Höhlenmenschen ihr Lagerfeuer unter dem sternklaren Nachthimmel der Urzeit.
Mit dem Menschen war etwas gänzlich Neues in den Strom der Evolution hineingetreten, ein qualitativer Sprung, der mehr bedeutete als bloß eine lineare Fortsetzung des Bisherigen. Mit dem Menschen war ein neuer Schöpfungstag auf der Erde angebrochen, ob der letzte, bleibt abzuwarten. Und wenn wir die Entwicklung des Menschen betrachten, vom primitiven affenähnlichen Australopithecus vor 3 Millionen Jahren über den homo habilis, der sich als erster ein Feuer anzündete, und den homo erectus, der sich als erster zu einer aufrechten Ganghaltung emporhob, bis hin zum homo sapiens, dem Jetztmenschen – dann fragt man sich, ob damit der Prozess der Evolution schon sein Ende erreicht habe: ob nicht irgendwann ein neuer Schöpfungstag im Zeichen des „Übermenschen“ anbrechen werde, des zum kosmischen Bewusstsein erwachten Allmenschen, des homo spiritualis der Zukunft.
Kaum vorstellbar dürfte uns Heutigen das Wirken dieses Zukunftsmenschen erscheinen. Zurückgekehrt zu seinem noosphärischem Ursprung, wird er nicht mehr bloß Bürger der Erde, sondern Bürger des Kosmos sein. Mit heute kaum noch vorstellbarer Gedankenschnelle wird er nicht nur andere Sonnensysteme, sondern selbst den vierdimensionalen Hyperraum durcheilen – nicht etwa mit zerbrechlichen Raumschiffen, sondern mit Methoden des Geistesfluges, die wir uns heute nicht vorzustellen vermögen.
Aber schon in seiner jetzigen Gestalt ist der Mensch ein Schöpfungswunder, das in einzigartiger Weise Natur und Geist, Biosphäre und Noosphäre miteinander verbindet. Alte esoterische Weisheit nennt die Menschheit daher ein Geschlecht inkarnierter Götter. Der Sternenstaub, aus dem wir bestehen, mag auch Götterstaub sein. Was wissen wir denn schon vom Menschen? Sollte der Mensch als intelligente Lebensform nicht älter sein als knapp 40.000 Jahre? Könnte es nicht sein, dass die Anfänge des Menschen in die Spätphase der Tertiärepoche zurückreichen? Könnte es nicht sein, dass es in grauen Vorzeiten (vielleicht lange vor der letzten Eiszeit?) menschliche Hochkulturen auf diesem Planeten Erde gegeben hat, von denen sich heute nicht die kleinste Spur erhalten hat?
Mit den prähistorischen Wandmalereien in den eiszeitlichen Kulthöhlen von Lasceau und Altamira stehen uns indes die ersten Zeugnisse menschlicher Kulturtätigkeit vor Augen. Monumentale Bildfolgen zeigen urzeitliche Jagdszenen; hier hat der Frühmensch seine „Traumzeit“ magisch eingefangen. Und doch dauert es noch Jahrtausende von dort bis zum Erblühen der ersten Hochkulturen in den fruchtbaren Schwemmtälern des Nil und des Indus, des Zweistromlandes und des Yangtze-Beckens. Denn das Wort „Kultur“ stammt vom lateinischen Verb colere – pflegen, bebauen, den Acker bestellen; erst der Ackerbau seit der „neolithischen Revolution“ (um 11.000 v. Chr.) schuf die Bedingung für das Gedeihen von Kulturen, erst auf der Grundlage von Dorfgemeinschaften, dann von Stadtstaaten.
Und damit sind wir beim Thema des vorliegenden Buches angelangt. Die kosmische Symphonie der Schöpfungstage war nur das Vorspiel dazu. Dieses Buch möchte in einem Kaleidoskop von Bildern das geistige Erbe der Weltkulturen aufzeigen – von der Frühzeit legendärer Königsdynastien bis zur Gegenwart, wo sich in ersten Ansätzen eine neue Geisteskultur zu manifestieren beginnt. Die Frage nach dem kosmischen Ursprung der Weltkulturen, nach dem Erbe versunkener Kontinente, nach den Rätseln der Prähistorie wird sich dabei ebenso stellen wie die nach der Zukunft der Menschheit. Denn der Schöpfungstag des Menschen ist noch nicht zu Ende gegangen; ja es scheint, als habe er gerade erst angefangen.
Die 7 Schöpfungstage
| Der 1. SchöpfungstagVor 4500 Millionen Jahren | PräkambriumErkaltung der Erde |
| Der 2. SchöpfungstagVor 600 Millionen Jahren | Kambrium Silur DevonLeben in den Ur-Ozeanen |
| Der 3. SchöpfungstagVor 345 Millionen Jahren | Obersilur Karbon PermZeit der Amphibien |
| Der 4. SchöpfungstagVor 225 Millionen Jahren | Jura Trias KreideZeitalter der Saurier |
| Der 5. SchöpfungstagVor 65 Millionen Jahren | Känozoikum TertiärZeitalter der Säugetiere |
| Der 6. SchöpfungstagVor 3,5 Millionen Jahren | Zeitalter des MenschenZyklus der Weltkulturen |
| Der 7. SchöpfungstagIn? Millionen Jahren | Zeit des ÜbermenschenDer Homo spiritualis |