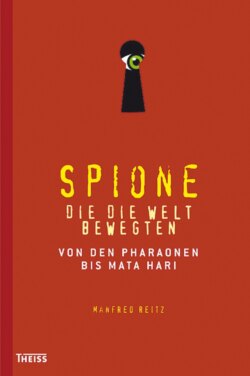Читать книгу Spione, die die Welt bewegten - Manfred Reitz - Страница 11
Geheimaktionen nach außen und nach innen – Alexander der Große
ОглавлениеFür die Erfolge von Alexander dem Großen gibt es in der Weltgeschichte nur wenige vergleichbare Beispiele. Im Alter von 20 Jahren wurde Alexander im Jahre 336 v. Chr. König von Makedonien; ein Reich, das erst kurz vorher von seinem Vater Philipp II. geschaffen worden war und das die griechische Welt dominierte. Als Alexander 323 v. Chr. im Alter von 32 Jahren starb, hatte er einen beispiellosen Siegeszug hinter sich. Er hatte eine Fläche von mehr als 2,5 Millionen Quadratkilometern erobert und die bekannte Welt seiner Zeit durchschritten. In nur etwa 10 Jahren beherrschte und prägte er ein Weltreich, das von Sizilien bis zum Himalaja reichte.
Schon unmittelbar nach seinem Tod rankten Mythen und Legenden um seine Person. Alexandersagen machten ihn zu einem Übermenschen und Liebling der Götter. Bis in die Renaissance las jeder Fürst, der etwas auf sich hielt, Alexanderromane. Sogar seine Geburt wurde später als ganz besonderes Ereignis verklärt: An dem Tag, an dem Alexander im Herbst des Jahres 356 v. Chr. zur Welt kam, soll angeblich der Tempel von Ephesos abgebrannt sein und gleichzeitig soll sein Vater drei Siegesmeldungen erhalten haben.
Alexander war ein militärisches Genie und gilt bis heute als einer der fähigsten Feldherrn überhaupt. In allen seinen Schlachten unterlief ihm kein einziger wirklich gravierender militärischer Fehler. Er war ein Meister der Strategie und Taktik und erfand Neuerungen in der Kriegsführung, die heute noch zur Ausbildung von Generalstabsoffizieren gehören. Während der Schlacht koordinierte er als erster perfekt die einzelnen Waffengattungen, er entwickelte eine ständig bewegliche Kriegsführung und ließ erstmals seine Truppenteile getrennt marschieren, um zuletzt vereint zuzuschlagen.
Sein Lehrer, der berühmte Philosoph Aristoteles, erkannte schon früh die hohe Intelligenz seines Schülers und förderte seine Zuneigung zu den Helden der griechischen Mythen sowie sein kulturelles Interesse, das ihn ein Leben lang begleitete. Alexander war früh eine ausgereifte Persönlichkeit. Mit 16 Jahren konnte er bereits mit großem Erfolg wichtige staatliche Ämter wahrnehmen, die ihm sein Vater übertragen hatte, damit er selbst in den Krieg ziehen konnte. Mit 18 Jahren war er der erfolgreiche und schlachtenerprobte Kommandeur der als vorzüglich bewerteten makedonischen Reiterei. Kaum war er König geworden, musste er einen Aufstand verschiedener griechischer Städte niederschlagen, was ihm durch sein militärisches Können rasch gelang. Dabei trat auch sein kulturelles Interesse zum Vorschein: Die Stadt Theben ließ er beispielsweise restlos zerstören und nur die Tempel sowie das Haus des Dichters Pindar blieben stehen. Aufgrund der Bedeutung der Stadt für die griechische Kultur untersagte er hingegen in Athen jegliche Zerstörung.
Neben seiner großen militärischen Bedeutung werden auch heute noch die beachtlichen zivilisatorischen Leistungen von Alexander gewürdigt. Er verschaffte dem Hellenismus Weltgeltung und Verbreitung, erweiterte den kulturellen Horizont der Europäer, tolerierte die verschiedensten Religionen und Kulturen und betrachtete sie alle als gleichwertig. Entgegen der noch von seinem Lehrer Aristoteles vertretenen griechischen Tradition sah er Angehörige fremder Kulturen nicht als Barbaren, sondern respektierte und achtete sie. Sein Ziel war es, Kulturen miteinander zu einer großen Einheit zu verschmelzen, um eine homonoia, eine Vereinigung aller Menschen, zu erschaffen. Doch sein Leben war zu kurz. Die homonoia gelang nicht, denn nach seinem Tod zerfiel das gerade erst eroberte gewaltige Reich. Insgesamt gründete Alexander in den von ihm okkupierten Gebieten rund 70 neue Städte. Erst er schuf in Europa ein Bewusstsein für Indien und andere große asiatische Kulturen. Und erst dadurch konnten neue Handelswege erschlossen werden. Das von ihm geschaffene so genannte Alexandergeld förderte den Welthandel.
Alle seine Aktionen entschied Alexander eigenständig, umgab sich allerdings mit ausgesucht guten Beratern und persönlichen Freunden, denen er vertrauen konnte. Dabei waren seine Planungen sowohl weit vorausschauend als auch spontan und intuitiv. Sein persönlicher Stab war ungewöhnlich klein und bestand nur aus 13 Personen. Als er sich entschloss, das Weltreich der Perser anzugreifen, waren seine Berater sofort skeptisch, denn das persische Heer war zahlenmäßig weit überlegen, und dem Makedonenherrscher fehlten außerdem die Finanzmittel, um einen langen Krieg durchzustehen. Doch Alexander war tollkühn und plante, um den Krieg zu finanzieren, die Plünderung der Schatzhäuser des persischen Großkönigs ein, was bis auf eine Ausnahme tatsächlich gelang. Angeblich sollen zum Abtransport des Goldes mehr als 10 000 Maulesel und 3000 Kamele notwendig gewesen sein.
Die Eroberung des Perserreiches
Bereits Philipp II. wollte gegen das Perserreich vorgehen, um die Zerstörungen des Xerxes während der Perserkriege zu rächen, doch erst sein Sohn Alexander setzte die Pläne um. Der Feldzug wurde sehr sorgfältig und vorausschauend geplant, dennoch scheute sich Alexander nicht, auch mögliche unvorhersehbare Risiken einzugehen. Sein Heer war die bestausgerüstete und leistungsfähigste Armee der Antike. Es war hochbeweglich und konnte wesentlich schneller als die Massenheere der Perser auf Befehle reagieren. Auch seine Unterfeldherren waren erstklassig und vier von ihnen, Ptolemäos, Lysimachos, Seleukos und Antigonos, sollten später einmal König werden. Alexander selbst war trotz seiner gerade 22 Jahre kampferprobt und konnte zahlreiche Siege vorweisen. Das Orakel von Delphi pries ihn als unbesiegbar. Sein Heer stellte er aus eigenen Untertanen und aus Griechen zusammen. Aus Makedonien stammten rund 30 000 Mann, dazu kamen noch rund 5000 Reiter; die griechischen Stadtstaaten stellten ihm zusätzlich etwa 7000 Mann sowie etwa 600 Reiter zur Verfügung. Das Oberkommando hatte Alexander selbst übernommen, dabei wurde er von einem relativ kleinen Stab unterstützt, so dass alle seine Befehle direkt zu den Truppen gelangen konnten. Zum Heer gehörten noch Hilfstruppen für den Nachschub, Handwerker, Pioniere, Mineure, Kanalbauer sowie Ärzte und Sanitätspersonal, aber auch Seeleute, Landvermesser, Geografen, Botaniker, Architekten, ein Stab von Schreibern und Sekretären sowie ein Geschichtsschreiber, der die Tagebücher zu führen hatte.
Schlacht bei Issos; Alexander (links) nähert sich Darius
Mit rund 160 Schiffen setzte das Heer im Frühjahr des Jahres 334 v. Chr. nach Kleinasien über. Vor dem Aufbruch wurden den Göttern in verschiedenen Tempeln Opfer gebracht und für ein gutes Gelingen des Feldzuges gebetet. Den Boden Kleinasiens betrat Alexander mit einer symbolischen Geste, indem er vom Schiff aus eine Lanze an Land warf, um seine Besitznahme zu verdeutlichen. Danach wurden den Göttern erneut Opfer dargeboten. In einem Tempel nahm er Waffen, die angeblich von mythologischen Helden stammten, an sich, um sie als Talisman weiter mit sich zu führen. Um die eigene Flotte durch persische Gegenangriffe nicht zu gefährden, schickte er die Schiffe später wieder nach Griechenland zurück; ein großes Risiko, denn bei einem Misserfolg hätte es sicherlich Probleme mit dem Rückzug geben können. Alexander setzte alles auf eine Karte.
Bei den Vorbereitungen seines Feldzuges hatte Alexander auch die Schriften des Xenophon über den persischen Großkönig und Reichsgründer Kyros studiert. Die Person des Kyros und insbesondere die Effektivität seines Geheimdienstes beeindruckten ihn. Der persische Geheimdienst war für ihn ein Vorbild und er war bemüht, die Effektivität seines eigenen Geheimdienstes noch weiter zu steigern. Alexander ließ nicht nur die feindlichen Truppen beobachten, sondern auch die eigenen Leute, um jederzeit die Stimmung im eigenen Heer beurteilen zu können. Briefe, die von den wenigen Soldaten, die schreiben und lesen konnten, in die Heimat geschickt wurden und auch Korrespondenzen der Zivilbevölkerung, wurden von einer Briefzensur gelesen. Manche Historiker halten Alexander sogar für den Erfinder der Zensur, denn es ging ihm darum, jeden Aufruhr so früh wie möglich zu erkennen, und die Rädelsführer waren erfahrungsgemäß meist jene, die schreiben und lesen konnten. Der Geheimdienst von Alexander verfügte außerdem über eigene Verschlüsselungssysteme. Für manche Befehle gab es keine schriftlichen Unterlagen, und es wurden besonders ausgewählte Boten direkt zu den zuständigen Offizieren oder Beamten geschickt. Zur schnellen Nachrichtenübermittlung wurden bereits Brieftauben eingesetzt. Für die etwa 800 Kilometer Luftlinie zwischen Babylon und Aleppo benötigte eine Brieftaube nach verschiedenen Quellen etwa 48 Stunden, während ein berittener Bote fast eine Woche unterwegs war.
Die großen Schlachten
Im Vergleich zu Alexander war der persische Großkönig Darius III. eine nur mittelmäßige Persönlichkeit, die ihm während des gesamten Feldzuges nicht gewachsen war. Der unter Kyros und Darius I. noch so wirkungsvolle persische Geheimdienst hatte schon lange seine Qualitäten verloren. In drei gewaltigen Schlachten wurde das Reich der persischen Großkönige besiegt und ging unter. Anschließend marschierte Alexander in Richtung Indien und schlug noch weitere für ihn erfolgreiche Schlachten.
In der ersten großen Schlacht, der Schlacht am Granikos (334 v. Chr.), zeigte sich bereits die enorme Beweglichkeit von Alexanders Heer, denn er überrannte aus dem Anmarsch heraus den Gegner. Im folgenden Jahr hatte Darius III. alle seine Kräfte gesammelt und die Heere trafen sich zur Schlacht bei Issos (333 v. Chr.). Dabei war der Großkönig siegessicher und führte seinen Hofstaat mit sich. Trotz aller Feindaufklärung marschierten die Heere zunächst aneinander vorbei, ohne es zu merken. Alexander erfuhr von seinen Spähern, dass der Feind in seinem Rücken stand und schwenkte um. Vor ihm präsentierte sich ein riesiges Massenheer, doch er ließ sich nicht einschüchtern. Hätte er diese Schlacht verloren, hätte es für ihn keinen Rückzug mehr gegeben. Alexander setzte durch eine geschickte Kombination von Reiterei und Fußsoldaten die so genannte schiefe Schlachtordnung ein, bei der eigene Truppenteile sowohl offensiv als auch defensiv sind und den Gegner durch ihr Kampfverhalten zu den stärksten eigenen Kräften führen. Diese Schlachtordnung kann in der Aufstellung der Truppenteile zu einem beachtlichen Durcheinander führen, so dass ein Feldherr bei seiner Kampfbeobachtung enorm konzentriert bleiben muss. Darius III. verlor in dem Gewirr seiner eigenen Truppenteile die Nerven und floh. Seine Flucht zerriss die Ordnung seiner Truppen, und die Schlacht ging für ihn verloren. Das Lager des persischen Heeres fiel in Alexanders Hände. Dabei gerieten auch die Ehefrau und die Mutter des Großkönigs sowie zwei Töchter in Gefangenschaft. Alexander behandelte die Frauen höflich und zuvorkommend. Den Großkönig selbst ließ er nicht verfolgen. Nach diesem Erfolg fielen große Teile des Reiches in seine Hände, wobei die Kriegskasse des Großkönigs die wichtigste Beute war.
Nachdem Darius III. neue Kräfte mobilisieren konnte, fanden sich die Heere zur Schlacht von Gaugamela (331 v. Chr.) erneut zusammen. Wieder hatte der Großkönig aus 24 Völkern seines Reiches ein gewaltiges, aber wenig bewegliches Massenheer zusammengestellt und setzte dieses Mal noch rund 2000 Kampfwagen mit Sicheln an den Rädern ein; außerdem wurden 15 Kriegselefanten aufgestellt. Er ließ sogar auf dem vorgesehenen Schlachtfeld Bäume und Unebenheiten beseitigen, um den Sichelwagen freie Fahrt zu gewähren. Doch seine Truppen hatten einen entscheidenden Nachteil; sie waren in aller Eile rekrutiert und nur unzureichend ausgebildet worden. Für eine rasche Beweglichkeit war das Heer viel zu groß. Die persische Übermacht war so erheblich, dass Alexander seine Truppen gestaffelt platzierte, um ein Einkesseln zu verhindern. Wegen der Präsenz der Sichelwagen hatte er darüber hinaus seine Soldaten defensiv aufgestellt. Seine Truppen sollten auf alle Fälle leicht wiederholbare Schwenkbewegungen ausführen können, um eventuell rasch in die Offensive überzugehen.
Da die Perser das vorgesehene Schlachtfeld für die Sichelwagen planiert hatten, war sich Alexander sicher, dass das Schlachtfeld nicht plötzlich von ihnen verlagert werden würde. Er ließ deshalb in der Nacht vor dem Kampf sein Heer entspannt ausruhen, während die Truppen des Großkönigs in einer ständigen Alarmbereitschaft blieben. Am folgenden Morgen waren deshalb die persischen Truppen übermüdet. Alexander selbst hatte die Nerven, vor der Schlacht fest zu schlafen und ließ sich erst am Morgen wecken.
Darius III. begann die Schlacht mit dem Angriff seiner Sichelwagen. Alexanders Reiterei wich sofort auf, so dass die Sichelwagen auf die dahinter stehenden Fußtruppen stießen. Diese öffneten jeweils eine Gasse und kesselten durch ihre gestaffelte Stellung die Sichelwagen sofort ein. Anschließend schossen Bogenschützen und Speerwerfer die Besatzungen der Sichelwagen ab. Die Reiterei des Großkönigs griff nun die ausweichende Reiterei Alexanders an, so dass von ihm ständig Truppenreserven herbeigeführt werden mussten. Schließlich gelang den Reitern des Großkönigs ein Durchbruch, der allerdings von den rückwärts aufgestellten Truppenverbänden Alexanders abgefangen wurde. Durch ihr rasches Vordringen wurden die Perser unaufmerksam und hinterließen plötzlich in ihrer Schlachtordnung eine Lücke, die Alexander sofort erkannte und ausnutzte. Seine eigene Reiterei ging umgehend durch diese Lücke von der Defensive in eine Offensive über. Sie drangen bis zu Darius III. vor, der wie in Issos erneut die Nerven verlor und floh. Genau wie in Issos zerriss er dabei wieder die eigene Schlachtordnung und der Kampf ging verloren. Damit sich das persische Heer nicht wieder zu einem Gegenangriff sammeln konnte, verfolgte Alexander es über eine Strecke von rund 55 Kilometern und zerstreute die Reste der Truppen in ungefährliche, kleinere Verbände. Anschließend besetzte er die Zentren des persischen Reiches und rückte in die Städte Babylon, Susa und Persepolis ein. Den enormen persischen Staatsschatz nahm er an sich, und als Rache für die Zerstörungen des Xerxes in Griechenland ließ er Persepolis niederbrennen. Das Grab von Kyros, den er sehr verehrte, ließ er dagegen renovieren. Das einst so mächtige Perserreich war nun endgültig untergegangen. Großkönig Darius III. wurde später von seinen eigenen Leuten ermordet.
Alexanders Geheimdienstaktivitäten
Alle Schlachten, die Alexander schlug, waren sorgfältig vorbereitet. Kleine Reitergruppen, die stets vorzüglich getarnt waren, ritten weit vor seinem Heer und meldeten alle Beobachtungen. Manchmal befanden sich Alexanders Späher viele Tagesreisen von den Truppen entfernt, so dass zur raschen Nachrichtenübermittlung Kundschafterketten notwendig waren. Vor der Schlacht bei Issos kannte Alexander beispielsweise bereits den Anmarschweg des Darius III., dennoch waren damals die Heere zunächst aneinander vorbeimarschiert. Oft war es schwierig, die Meldungen der Späher zu interpretieren. Vor der Schlacht von Gaugamela meldeten Späher einmal feindliche Truppenverbände und Alexander ließ seine Truppen sofort in Kampfstellung bringen. Doch es war nur die persische Vorhut beobachtet worden, die Alexander ohne einen Angriff passieren ließ.
Der persische Großkönig konnte sich während der Kämpfe noch lange auf eine funktionierende eigene Gegenspionage verlassen. Dabei wurde versucht, abzulenken und auch Fallen zu stellen. Alexanders Späher ergriffen einmal persische Kundschafter und verhörten sie. Die Männer verrieten, dass das Heer von Darius III. am Fluss Tigris stünde. Alexander eilte sofort in die angegebene Richtung, um das feindliche Heer beim Flussübergang zu schlagen. Doch die Meldung war falsch. Alexanders Heer sollte nur in eine verkehrte Marschrichtung geleitet werden, damit der Großkönig Zeit gewinnen konnte. Im Frühjahr 330 v. Chr. fiel Alexander auf eine weitere Falschmeldung herein. Er erhielt die fingierte Nachricht, der von ihm im vorhergehenden Jahr vernichtend geschlagene Großkönig wolle neue Verbündete treffen. Im Eilmarsch und ohne Nachschubtross eilte Alexander zu dem angegebenen Ort. Erneut war es eine Falschmeldung mit einem Ablenkungseffekt. Darius III. hatte sich genau in eine entgegengesetzte Richtung zurückgezogen.
Der persischen Gegenspionage gelang es sogar einmal, mit einem persönlichen Feind von Alexander Kontakt aufzunehmen. Es war Alexander der Lynkeste. Er war Angehöriger eines makedonischen Fürstenhauses und wollte die Ermordung seiner Brüder rächen. Darius III. sandte unter einem Vorwand seinen angeblichen Vertrauten Sisens, der einmal am Hof von Makedonien gelebt hatte, zu Alexander dem Lynkesten und bot ihm 1000 Talente Gold für die Vorbereitung und Durchführung eines Mordanschlags oder für die Anwerbung eines Mörders an. Doch auch Alexander der Große musste über gut platzierte Agenten verfügt haben, denn Sisens wurde unterwegs abgefangen, verhört und später hingerichtet. Um Alexander den Lynkesten nicht misstrauisch zu machen, schickte Alexander der Große einen vertrauenswürdigen persönlichen Boten in persischer Kleidung und mit dem mündlichen Befehl, den möglichen Attentäter gefangen zu nehmen und hinzurichten.
Zu dieser Geschichte gibt es verschiedene Versionen, so dass die Glaubwürdigkeit fraglich ist: Einmal war Sisens der Überbringer des Mordauftrages und dann wieder der potenzielle Mörder. Auf jeden Fall musste Sisens direkten Zugang zum Lager von Alexander gehabt haben. Andere Versionen behaupten, Sisens wäre trotz seiner persischen Herkunft ein Vertrauter von Alexander gewesen. Ein persischer Brief an Sisens hätte Alexander allerdings misstrauisch gemacht, so dass er in ihm einen Doppelagenten vermutete. Der Brief war von der Zensur geöffnet worden und wurde anschließend bewusst mit einem falschen Siegel wieder verschlossen; in dem Brief soll nur gestanden haben, dass sich Sisens an seine persische Herkunft erinnern solle. Weil Sisens das falsche Siegel nicht umgehend an Alexander gemeldet hatte, soll er hingerichtet worden sein.
Als eine gezielte persische Fehlinformation gilt die Behauptung, der Leibarzt von Alexander dem Großen, Philippos, wäre bestochen worden, um seinen Herrn zu vergiften. Von Darius III. gelenkte Fehlinformationen sollten in der Umgebung von Alexander das allgemeine Misstrauen verstärken.
Regelmäßig forderte Alexander hochrangige Gegner zum Überlaufen auf und bot ihnen hohe Belohnungen an. Doch der Großkönig hatte seine wichtigsten Leute durch einen Eid an sich gebunden und die Mehrheit von ihnen hielt sich daran. Insgesamt gab es nicht viele bedeutende Überläufer. Umso wichtiger waren deshalb die Kriegsgefangenen. Laomedon, ein Jugendfreund von Alexander, der die persische Sprache fließend beherrschte, war Leiter der Verhörspezialisten für die Kriegsgefangenen. Die Zweisprachigkeit von Laomedon zeigt, dass diese Verhörspezialisten wahrscheinlich die Sprache der Gefangenen beherrschten und dadurch besser ihr Vertrauen gewinnen konnten. Die gefangenen Männer wurden nicht, wie in der Antike üblich, umgehend in die Sklaverei gebracht, sondern entsprechend ihrer Position verhört. Waren die Verhöre ergiebig, konnten sie in Alexanders Heer übertreten, ohne allerdings wichtige Aufgaben zu übernehmen.
Für eine Briefzensur der Angehörigen des Heeres von Alexander sowie für das Aushorchen der Geliebten und Ehefrauen der Soldaten sprechen direkte und indirekte Hinweise. Nachdem das Perserreich untergegangen und Darius III. tot war, wollten viele Makedonier zurück in die Heimat und nicht noch, wie von Alexander möglicherweise geplant, Indien erobern und bis zum südlichen und östlichen Ende der bekannten Welt vordringen. Das Charisma des großen Feldherrn begann zu bröckeln. Mit immer größerem Widerstand folgten sie dennoch den weiterhin erfolgreichen Kriegszügen. Als Alexander einmal anbot, die Schulden seiner Soldaten zu bezahlen, machten nur wenige von dieser Möglichkeit Gebrauch, denn sie befürchteten eine weitere geheime Überwachungsmethode. Im Jahre 324 v. Chr. entließ deshalb Alexander viele Makedonier mit hohen Belohnungen in die Heimat und ersetzte sie durch Soldaten, die in den eroberten Gebieten angeworben wurden. Den verbliebenen Makedoniern war dieses Verhalten allerdings auch nicht recht, und es verstärkte sich noch einmal der Widerstand. Bald gab es im Heer offene Spannungen und deutliche Aufforderungen zum Ende der Feldzüge. Außerdem war das eroberte Reich so groß geworden, dass es kaum noch überblickt werden konnte und Separationsbestrebungen zu befürchten waren. Alexander wollte sein Gesicht nicht verlieren und ließ am Fluss Indus den Göttern Opfer bringen, um sie über die Zukunft zu befragen. Als auch diese den Rat gaben, die Feldzüge zu beenden, stimmte er zu.
Soldaten, die von Anfang an dabei waren, waren während der zahlreichen Feldzüge etwa 26 000 Kilometer marschiert und hatten alle entscheidenden Schlachten gewonnen. Sogar mit den Kriegselefanten in Indien wurde Alexander fertig. Er hatte bemerkt, dass die Pferde vor den Elefanten scheuten und durchgingen. Deshalb schob er bei Angriffen die gegnerische Reiterei vor die eigenen Elefanten, so dass die Pferde unruhig wurden und ein großes Durcheinander entstand. Wurden außerdem die Elefantenführer mit Pfeilen abgeschossen, gerieten die mächtigen Tiere meist in Panik und trampelten alles nieder.