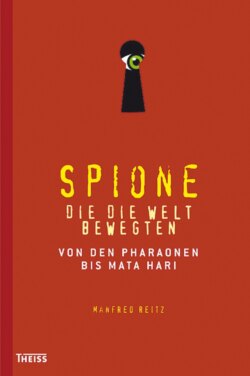Читать книгу Spione, die die Welt bewegten - Manfred Reitz - Страница 9
Verrat an den Thermopylen – Griechen und Perser
ОглавлениеIm Vorderen Orient gelang es dem Perser Kyros in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts v. Chr. sein Volk aus Bauern und Hirten zu vereinen und zu einer schlagkräftigen Nation zu entwickeln. Sein Aufstand gegen den König der Meder, dessen Vasall er war, verlief erfolgreich, und er konnte die Dynastie der Achämeniden gründen. Seine Nachfolger schufen bald das persische Weltreich, das in seinem Zenit vom Mittelmeer bis zum heutigen Indien reichte. Im Gegensatz zu seinen Nachfolgern war Kyros bei den Griechen beliebt, und der Historiker Xenophon beschrieb ihn sogar als einen vollkommenen Herrscher. In der Bibel wird er als der von Gott gesandte Befreier Israels gefeiert und erhielt den Ehrentitel „Gesalbter des Herrn“. Der Perserkönig verhielt sind humaner als andere Herrscher seiner Zeit. Er zerstörte nicht die Städte seiner unterworfenen Gegner, ließ keinen unterlegenen Fürsten töten, und es lag ihm auch fern, die Götter der Besiegten zu stürzen. Kyros verlangte nur, dass die unterworfenen Völker an ihn Abgaben leisteten und mit ihm in den Krieg zogen, um sein Reich immer weiter zu vergrößern. Das Perserreich griff den uralten orientalischen Gedanken des friedensstiftenden Weltreiches wieder auf. Dieser besagte, dass nur unter der universellen Herrschaft einer einzigen Macht der Frieden garantiert sei. Bald herrschte der König der Perser über rund 30 fremde Völker und erhob sich zum Großkönig. Sein Reich wurde in Satrapien, d.h. in Verwaltungs- und Militärbezirke, unterteilt. Jeder Satrap war allein gegenüber dem König verantwortlich. Gleichzeitig wurde jeder Satrap durch königliche Kommissare überwacht.
Trotz aller Toleranz war Kyros misstrauisch und bemüht, einen erfolgreichen Geheimdienst aufzubauen. Seine Postkuriere nahmen nicht nur Nachrichten entgegen und leiteten sie weiter, sondern mussten dem König regelmäßig auch Stimmungsberichte über die Bevölkerung liefern; sie waren die „Augen und Ohren“ des Herrschers. Die Idee des organisierten Kundschafterdienstes hatte Kyros vermutlich von den Assyrern übernommen und dann weiter perfektioniert. Der griechische Historiker Xenophon berichtete, dass im persischen Reich viele Menschen aus der Aufgabe, „Königsaugen“ und „Königsohren“ zu sein, ein Geschäft gemacht hatten. Es wurde versucht, jedermann glauben zu machen, dass der König alles höre und sehe. Kyros hatte dazu eine Nachrichtenhierarchie aufgebaut: Ausgewählte Beamte nahmen Meldungen entgegen, deuteten sie und gaben sie an den König weiter. Reitende Kuriere waren nicht nur am Tage, sondern auch in der Nacht unterwegs, so dass pro Tag etwa 250 Kilometer zurückgelegt werden konnten. Sie konnten über ausgebaute Wege mit Raststationen jeden Punkt des Reiches erreichen. Für Privatpersonen war die sehr gut organisierte Staatspost nicht zugänglich. Private Nachrichten mussten deshalb auf anderem Wege transportiert werden. Allerdings lasen dabei Beamte des Staates immer unbemerkt mit.
Nachrichten an den Herrscher wurden manchmal, um sich vor Verrätern zu schützen, getarnt übermittelt. Kyros erhielt einmal eine Information, die im geschickt zugenähten Bauch eines toten Hasen versteckt war. Ein ausgewählter Diener musste dem König mitteilen, dass nur er selbst den Hasen für seine Mahlzeit zubereiten solle. Kyros hielt sich an die Anweisung und fand das Schreiben.
Die Tricks des Darius
Einer der fähigsten Nachfolger von Kyros war Darius I. Er organisierte das Reich neu und schlug zahlreiche Aufstände nieder, wobei auch mit unterschiedlichen geheimen Aktivitäten gearbeitet wurde. Um 520 v. Chr. hatte sich die Stadt Babylon gegen den Großkönig erhoben. Die Stadt war noch aus der Zeit, als sie selbst einmal Großmacht war, hervorragend befestigt und konnte auch nach einer Belagerung von 20 Monaten nicht eingenommen werden. Darius ließ sogar Teile des Euphrat umleiten, um nach geheimen Eingängen zu suchen, doch die Verteidiger waren wachsam. Schließlich wurde mit Zopyros, einem getreuen Freund des Großkönigs, eine Geheimaktion ausgearbeitet: Zopyros sollte, um glaubhaft zu wirken, durch Misshandlungen verletzt zu den Babyloniern überlaufen und ihnen voller Rache gegen Darius seine Dienste anbieten. Er sollte zunächst das uneingeschränkte Vertrauen der Babylonier gewinnen, damit sie ihn in die Verteidigung der Stadt einbeziehen würden und er dadurch in der Lage wäre, zugunsten der Belagerer für einen erfolgreichen Angriff Schwachpunkte zu schaffen.
Verfolgt von persischen Reitern, die sich Mühe gaben, ihn nicht einzuholen, rannte Zopyros kurze Zeit später mit blau geschlagenen Augen und blutender Nase auf die Befestigungsanlagen von Babylon zu. Die Verteidiger vermuteten einen eigenen Kämpfer und warfen ihm ein Seil entgegen. In einem dramatisch vorgetäuschten letzten Augenblick ergriff Zopyros das Seil und kletterte an der Mauer hoch. Seine „Verfolger“ drohten ihm noch deutlich sichtbar, doch gaben sie später auf. Die Babylonier versorgten den Überläufer und brachten in anschließend zu einem Verhör. Zopyros verfluchte voller Hass den Großkönig und suchte nach einer Gelegenheit zur Rache. Bald glaubten ihm die Babylonier und teilten ihn den Verteidigungskräften zu.
Persischer Kampfwagen mit Sichelrädern beim Angriff
Nach diesem ersten Erfolg begann ein vorbereiteter Zeitplan in Kraft zu treten: Begleitet von babylonischen Soldaten wagte Zopyros einen vorher mit Darius abgesprochenen Ausbruch. Sie trafen auf nur schwache persische Kräfte, die außerdem rasch flohen. Es gelang ihnen noch einige Vorräte der Truppen des Großkönigs anzuzünden und sich danach wieder in die Stadt zurückzuziehen. Die Babylonier waren von dem Mut und dem Erfolg des Zopyros begeistert, so dass er immer mehr ihr Vertrauen gewann. Insgesamt wagte er drei Ausfälle, die stets erfolgreich waren. Nicht bekannt war, dass alle Angriffe vorher mit Darius abgesprochen worden waren, und die Perser an den dafür vorgesehenen Stellen ihre Truppen ausgedünnt hatten sowie Materialien lagerten, die beim Anzünden weit sichtbar loderten und viel Rauch entwickelten. Zopyros hatte nach dem dritten Ausfall die Babylonier endgültig überzeugt und wurde zum Kommandanten einer Kampftruppe ernannt, die eines der besonders stark befestigten Stadttore zu verteidigen hatte.
Jetzt wurden weitere Pläne wirksam: Genau am 20. Tag nachdem Zopyros „desertiert“ war, startete Darius einen ebenfalls vorher abgesprochenen und in der Zwischenzeit vorbereiteten Großangriff auf die Stadt. Zopyros sollte nur noch das Tor markieren, das er zu „verteidigen“ hatte. Es gelang ihm, die verabredeten Geheimsignale zu übermitteln, und Darius konzentrierte daraufhin seine Truppen für die Verteidiger nicht sichtbar vor diesem einen bestimmten Tor. Das Tor war beim überraschenden Ansturm der Truppen „nicht korrekt“ verschlossen und ließ sich leicht öffnen. Sofort strömten die Eliteeinheiten des Großkönigs in großen Scharen in die Stadt, öffneten weitere Tore und innerhalb kürzester Zeit waren wichtige Teile der Stadt Babylon durch die Perser besetzt worden. Die so hervorragend befestigte Stadt war nicht mehr zu verteidigen und musste kapitulieren.
Die absoluten Herrschaftsansprüche des persischen Großkönigs und die Demut und Abgaben, die ihm zu erbringen waren, machten insbesondere den griechischen Städten in Kleinasien zu schaffen. Sie wurden nicht von persischen Satrapen, sondern von eigenen griechischen Tyrannen beherrscht. Diese waren aber dem Großkönig ergeben und deshalb bei der eigenen Bevölkerung wenig geschätzt. Zwischen dem Großkönig und den freiheitsliebenden Griechen im kleinasiatischen Teil seines Reiches kam es stets zu Spannungen. Bald wurde ein Aufstand geplant. Doch der persische Geheimdienst war hervorragend organisiert, und es gab Probleme mit der Nachrichtenübermittlung.
Der griechische Politiker Histaios, der am persischen Hof lebte, wusste sich zu helfen, als er von Susa aus seinem Schwiegersohn Aristagoras, dem Tyrann von Milet, eine geheime Nachricht übermitteln lassen wollte. Er ließ einem ergebenen Sklaven eine Glatze scheren, um anschließend auf dessen Kopfhaut eine Nachricht für den Schwiegersohn zu schreiben. Nachdem die Haare wieder gewachsen waren und die Schrift überdeckten, wurde der Sklave als ein unverdächtiger Bote nach Milet geschickt. Er sollte Aristagoras nur ausrichten, ihm die Haare zu schneiden. Der Sklave passierte ohne Verdacht alle persischen Kontrollen, und Aristagoras konnte auf seiner Kopfhaut Nachrichten zum geplanten Aufstand erfahren und wurde sogar ausdrücklich dazu ermuntert. Der Aufstand der Ionischen Städte kam tatsächlich zustande, wurde allerdings vom Großkönig niedergeschlagen.
Nachdem Darius sein Macht in Kleinasien gefestigt hatte, traf er Vorbereitungen, auch das griechische Kernland zu erobern. Er stand dort kleineren Staaten gegenüber, die von Athen und Sparta dominiert wurden und sich permanent gegenseitig bekämpften. Da diese Staaten zum Teil auch die Aufständischen in Kleinasien unterstützt hatten, fand der Großkönig eine willkommene Gelegenheit, um Griechenland anzugreifen.
Aineias Taktikos, ein Theoretiker der Spionage
Der griechische Militärschriftsteller Aineias Taktikos veröffentlichte etwa um 360 v. Chr. ein Werk, das sich mit Schutzmaßnahmen bei Belagerungen beschäftigte. In einem Kapitel wurden auch Spionagetechniken und die Kunst der geheimen Nachrichtenübermittlung abgehandelt. Besonders raffiniert war folgende Methode: Ein Bote erhält einen völlig offenen und für jeden lesbaren Brief, den er zu einem bestimmten Empfänger bringen soll. Gleichzeitig gibt der Absender dem Boten neue Schuhe, in deren Sohlen ein Metallplättchen mit einer geheimen Nachricht eingearbeitet ist. Der Bote weiß nichts von dieser Nachricht und freut sich über die guten Schuhe für den weiten Weg. Beim Empfänger darf sich der Bote ausruhen und stellt deshalb zum Schlafen seine Schuhe ab. Während dieser Zeit wird die Nachricht aus den Schuhen entfernt und die Antwort eingefügt. Hat der Bote ausgeschlafen und sich erholt, wird er mit einem ebenfalls offenen Antwortbrief wieder zurückgeschickt. Da er sowieso nicht lesen kann, weiß er zu keinem Zeitpunkt, was in den Briefen steht. Außerdem können Feinde, die ihm eventuell den Brief abnehmen könnten, mit dem belanglosen Inhalt nichts anfangen. Vorausgesetzt, die Schuhsohlen werden immer wieder sorgfältig zusammengenäht, wissen nur der Absender und der Empfänger etwas von einer Nachrichtenübermittlung. Sogar wenn der Bote nach einer Gefangennahme gefoltert werden sollte, kann er nichts verraten, denn er weiß von nichts.
Bei einer anderen, etwas abgewandelten Methode, die in der Stadt Ephesos angewendet wurde, schickten Kämpfer einen verwundeten Krieger mit Helfern zurück. In seinem Verbandsmaterial war eine geheime Nachricht versteckt. Manchmal wurden auch attraktive Frauen zu einem freundschaftlichen Besuch ausgesandt. Sie sollten dabei besonders repräsentativ wirken und trugen verschiedene Schmuckstücke, in denen geheime Nachrichten versteckt waren.
Daneben gab es in der Schrift von Aineias Taktikos auch Anweisungen, Nachrichten in den Zügeln eines Pferdes, in Schwertscheiden oder bei angeblichen Überläufern im Brustpanzer zu verstecken. Bei einer anderen Methode wurde eine kleine Schreibtafel aus Holz durch Einritzungen beschriftet und anschließend mit Wachs überzogen. In dieses Wachs wurde eine zweite und unverfängliche Nachricht geschrieben. Erst wenn das Wachs abgekratzt wurde, kam dann die eigentliche Nachricht zum Vorschein. Eine Variation dieser Form der Nachrichtenübermittlung stellte eine kleine Holzfigur dar, die ebenfalls beschriftet und anschließend mit Farbe übermalt wurde. Sie war danach mehr als nur ein Geschenk, denn, wenn die Farbe mit Wasser oder Öl entfernt wurde, konnte die geheime Schrift gelesen werden.
Schließlich konnten geheime Nachrichten auch in Lebensmitteltransporten versteckt werden, so dass auf großen Marktplätzen durch einfachen Kauf oder Verkauf leicht kommuniziert werden konnte. Die Blase eines Tieres wurde aufgeblasen und beschriftet. Danach wurde die Luft herausgelassen, und die Blase getrocknet. Anschließend kam sie in ein kleines Ölgefäß und wurde erneut aufgeblasen, bis sie sich an die innere Wand des Gefäßes legte. Wurde die Blase nun mit Öl gefüllt und zugestöpselt, war bei Kontrollen nach dem Öffnen nur das Öl sichtbar und niemand vermutete einen weiteren Inhalt. Erst wenn das Öl abgegossen wurde, konnte die Blase hervorgeholt und die Nachricht auf ihr gelesen werden.
Um etwa Nachrichten aus einer belagerten Stadt herauszuschmuggeln, konnten Pfeile mit beschriebenem Pergament oder Papyrus umwickelt und dann abgeschossen werden. Sogar mit Wurfmaschinen wurden Nachrichten weitergegeben. Sollten Nachrichten besonders rasch ihr Ziel erreichen, so schossen sich Militärposten manchmal gegenseitig beschriftete Pfeile zu. Der Grieche Polybios erwähnt in einer Schrift aus dem 2. Jahrhundert v. Chr. optische Signalcodes, die den Buchstaben einer Schrift entsprachen und auch über große Entfernungen lesbar waren. Bei Tag dienten polierte Metallspiegel und andere optische Signalgeber der Nachrichtenübermittlung und bei Nacht Fackeln. Die Empfänger mussten jeweils den verwendeten Code kennen, ihn entschlüsseln, dann wieder verschlüsseln und die Nachricht weitergeben.
Aineias Taktikos erwähnt auch Methoden der Nachrichtenverschlüsselung. Dabei beschreibt er Vorgehensweisen, die bereits in der frühen Antike bekannt waren, etwa wenn in einem belanglosen Text nur bestimmte Schriftzeichen ausgewählt wurden und diese dann als Code für einen völlig anderen Text dienten. Außerdem schlägt der Autor Holzscheiben vor, die so viele Löcher enthalten wie das Alphabet Buchstaben hat. Durch diese Löcher wird zur Nachrichtenübermittlung ein Faden gezogen, der jeweils die Löcher markiert, die den Buchstaben eines Codewortes entsprechen. Die Scheiben werden anschließend unauffällig an dem Faden getragen.
Nicht erwähnt wird von Aineias Taktikos, die zu seiner Zeit bereits bekannte und in der Praxis erprobte Skytale der Spartaner. Zogen die Spartaner in den Krieg, erhielten sowohl das Hauptquartier als auch der Heerführer einen Stab von identischer Länge und Dicke. Zur Nachrichtenübermittlung wurde Pergament in einen in der Breite vorgeschriebenen dünnen Streifen geschnitten, spiralförmig um den Stab gewickelt und dann längs beschriftet. Anschließend wurde der Streifen wieder abgewickelt und dem Empfänger überbracht. Erst wenn der Pergamentstreifen dort ohne Zwischenraum um den Stab gewickelt wurde und exakt auf die Länge und Dicke des Stabes passte, ergab sich für den Empfänger ein sinnvoller Text, ansonsten konnte er nur Buchstaben ohne eine erkennbare Aussage lesen. Zwischen Heerführern und dem Hauptquartier konnten somit Befehle in Form von unscheinbaren Streifen mit Buchstaben ausgetauscht werden.
Perserkriege
Großkönig Darius und sein Nachfolger Xerxes führten mehrere große Feldzüge gegen das griechische Kernland. Nachdem der Aufstand der griechischen Städte in Kleinasien niedergeschlagen worden war, begann 492 v. Chr. der erste Feldzug der Perser. Unter dem Kommando von Mardonios, dem Schwiegersohn von Darius, stach eine große Flotte mit dem Ziel Griechenland in See. Nach einigen Erfolgen geriet die Flotte jedoch am Berg Athos in einen Sturm und erlitt dabei so große Verluste, dass Mardonios den Feldzug abbrach. Der nächste Feldzug startete 490 v. Chr. mit einem Flottenverband und einem Landheer. Wieder hatte der persische Geheimdienst gute Vorarbeit geleistet. Zu den Truppen gehörte auch Hippias, der letzte Tyrann von Athen, der 510 v. Chr. von den Griechen verjagt worden war, danach zum persischen Großkönig überlief und ihn nun mit Informationen versorgte. Er wollte mit Athen alte Rechnungen begleichen. Die Stadt Eretria, die den Aufstand der griechischen Städte in Kleinasien unterstützt hatte, wurde von den Persern durch Verrat nach kurzer Zeit erobert und völlig niedergebrannt. Die überlebenden Bewohner wurden verschleppt und umgesiedelt. Danach sollte der Angriff Athen gelten. Vermutlich schlug Hippias vor, bei Marathon zu landen und dann nach Athen zu marschieren.
Die Truppen von Athen zogen den Persern entgegen. Es waren etwa 10 000 Mann, die der Stadtstaat hatte aufbringen können; zu ihnen gehörte auch der Dichter Aischylos, der später den Kampf beschrieb. Die Heerführer waren sich nicht sicher, ob die persischen Invasoren sofort angegriffen werden sollten, oder ob es sinnvoll wäre, zuerst die Ankunft der kampferprobten Spartaner abzuwarten. Heerführer war Kallimachos, doch mit ihm stritten sich zehn strategoi um das Kommando. Es handelte sich um Generäle, die von der Athener Volksversammlung für ein Jahr gewählt worden waren. Glücklicherweise setzte sich Miltiades durch. Er war zwar bereits über 60 Jahre alt, hatte allerdings Erfahrung in Kämpfen mit den Persern und kannte ihre Taktiken. Es war riskant, sich außerhalb von Athen zur Schlacht zu stellen, denn bei einer Niederlage wäre die Stadt später weitgehend schutzlos gewesen. Zuletzt erhielten die Athener noch Verstärkung und rund 1000 Kämpfer aus dem befreundeten Platää schlossen sich ihnen an.
Miltiades ergriff die Initiative und ging sofort zum Angriff über. Das Gelände war für ihn günstig, denn die gefürchtete persische Reiterei würde Probleme haben, sich zu entfalten. Außerdem war das Gelände zu den persischen Linien hin abschüssig. Miltiades ließ seine Männer in breiter und gestaffelter Front, in einer Phalanx, rennen, so dass der Angriff richtig Schwung bekam, und die Griechen mit großer Gewalt auf die Perser prallten. Durch geschickte Schwenkbewegungen in den Flanken gelang es, die Schlachtordnung der Perser aufzulösen, auch konnten diese wegen der Enge des Geländes nicht ihre sonst so erfolgreiche Reiterei einsetzen. Zuletzt flohen die Perser ohne Kampfordnung und verfolgt von den Griechen auf ihre Schiffe. Angeblich sollen die Verluste der Griechen recht gering gewesen sein: 192 gefallenen Athenern standen rund 6400 gefallene Perser gegenüber. Beim Rückzug der Perser wurden Blinksignale auf Anhöhen über dem Schlachtfeld beobachtet. Es ist bis heute nicht geklärt, ob damals persische Späher Nachrichten übermittelten. Die persischen Schiffe fuhren anschließend direkt zum ungeschützten Athen, so dass die griechischen Kämpfer in Eilmärschen weiterrücken mussten. Sie erreichten rechtzeitig Phaleron, den vermuteten Landeplatz der Perser und besetzten den Strand, bevor die Perser eintrafen. Da der persischen Flotte gute Fernwaffen fehlten, konnten die Heerführer ihre Truppen nicht an Land bringen und gaben den Angriff auf. Der später vielgerühmte Marathonlauf, der Lauf eines griechischen Kriegers vom Schlachtfeld nach Athen, ist wahrscheinlich eine Legende.
Verrat an den Thermopylen
Darius verstarb 486 v. Chr. Da es nach seinem Tod im Reich zu Aufständen kam, die sein Sohn Xerxes zuerst niederschlagen musste, fanden die Griechen des Festlandes bis zum nächsten Ansturm der Perser etwas Ruhe. Die Griechen der Inseln und in Kleinasien blieben allerdings unter der persischen Gewalt und mussten dem Großkönig sogar Truppen stellen. Athen nutzte die Zeit, um seine Flotte zu verstärken. Aber auch die Perser rüsteten auf und legten in Nordgriechenland für ihre Flotte einen Kanal an; sie wollten nicht ein zweites Mal an Stürmen scheitern. Xerxes ließ sich von dem aus seiner Heimat vertriebenen Spartaner Demaratos für seinen geplanten Feldzug militärisch beraten. Es wird allerdings vermutet, dass Demaratos ein Doppelagent war, denn er soll, so berichtete später der Geschichtsschreiber Herodot, angeblich geheime Boten nach Sparta geschickt haben. Im Jahre 480 v. Chr. rückte schließlich Xerxes mit einer gewaltigen Streitmacht, die aus allen Teilen seines Reiches zusammengezogen worden war, erneut gegen den Norden von Griechenland vor. Herodot schilderte, dass die persischen Truppen rund 160 000 Mann stark waren, dazu kamen noch 1700 Kriegsschiffe und 3000 Transportschiffe. Moderne Militärhistoriker glauben jedoch, dass die Zahlen viel zu hoch gegriffen sind. Für den Vormarsch der Truppen wurde eigens eine Schiffsbrücke angelegt.
Um die zahlenmäßige Überlegenheit der Perser an Land auszugleichen, beschlossen die Griechen unter der Leitung der Spartaner die Gegebenheiten des Geländes auszunutzen und die Truppen des Großkönigs in engen Schluchten und Tälern in Kämpfen zu binden und so Zeit zu gewinnen. Dazu hatten die einzelnen griechischen Stadtstaaten einige tausend Mann abgestellt. An den Thermopylen, dem Eingangstor nach Mittelgriechenland, wollte der spartanische Heerführer und König Leonidas mit seinen hochtrainierten und kampferprobten Truppen sowie rund 7000 Mann Hilfstruppen einen Sperrriegel bilden und die Perser unter möglichst großen Verlusten so lange wie möglich aufhalten. Während dieser Zeit sollten die vereinigten griechischen Flotten auf See eine Entscheidung gegen die persische Flotte herbeiführen. Wie bei einem Schachspiel lauerten sich die Schiffsverbände gegenseitig auf und es kam zu verschiedenen Seeschlachten, die allerdings keine Entscheidung brachten. Den Griechen kam schließlich ein Sturm zur Hilfe. Teile der persischen Flotte gerieten in das Unwetter und die Perser hatten große Verluste zu beklagen. Den Griechen gelang es, auf See ebenfalls einen Sperrriegel zu errichten und parallel zu den Kämpfen auch einen psychologischen Krieg zu beginnen. Auf Felsen wurden Parolen und Nachrichten gepinselt, um griechische Hilfstruppen, die für Xerxes kämpfen mussten, zum Überlaufen zu bewegen und um die Kampfmoral der Perser zu brechen.
Währenddessen standen die griechischen Truppen an den Thermopylen wie eine Mauer und hielten das gesamte persische Landheer, das nicht ausweichen konnte, auf. Aufgrund der geografischen Enge und den natürlichen Felshindernissen konnte nur an einzelnen schmalen Fronten gekämpft werden. Den Persern war es unmöglich, ihre ganze Übermacht einzusetzen. Sie rannten drei Tage erfolglos gegen die hoch motivierten Griechen an und erlitten enorme Verluste. Sogar der Einsatz der „Unsterblichen“, der Elitetruppen von Xerxes, brachte keinen Fortschritt. Insbesondere die Kampfmoral der Spartaner war gefürchtet und löste unter den Angreifern Furcht und Schrecken aus.
Unter dem Einsatz von viel Gold ließ Xerxes schließlich unter der einheimischen Bevölkerung nach Verrätern suchen. Der griechische Verräter Ephialtes erklärte sich zuletzt für eine hohe Belohnung bereit, persische Elitetruppen über einen versteckten Weg im Gebirge direkt in den Rücken der Griechen zu führen. Im Schutz der Nacht machten sie sich auf den Weg, um die Griechen am Morgen nicht nur von vorne, sondern auch von hinten anzugreifen. Bald erkannten die Griechen, dass sie eingekreist waren und hielten Rat. Leonidas erlaubte der Mehrheit seiner Truppen den Rückzug, um an anderen wichtigen Orten zu versuchen, die Perser erneut aufzuhalten. Er selbst beschloss mit rund 300 Getreuen bis zum letzten Mann zu kämpfen und im Kampf zu sterben. Die Kampfmoral der Spartaner war legendär. Für den echten Krieger gab es beim Kampf nur zwei Möglichkeiten: Sieg oder Tod. Sich im Kampf zu ergeben, war für einen überzeugten spartanischen Krieger unmöglich und bedeutete eine ewige Schande. Zum Sterben bereit, stürmten die Spartaner gegen die Perser vor und lieferten sich ein Gemetzel. Im Kampf fielen alle Spartaner und auch die Perser erlitten in dieser letzten Schlacht unter ihren Elitetruppen enorme Verluste.
Beachtlich geschwächt und mit großer zeitlicher Verzögerung marschierte das persische Heer nun in Richtung Athen. Die Bevölkerung floh auf die Insel Salamis. Unterwegs zündeten die Perser alle Städte und Orte an, auch Athen ging zuletzt in Flammen auf und die Heiligtümer wurden zerstört. Durch die Kampfbereitschaft an den Thermopylen hatte die griechische Flotte allerdings genügend Zeit gefunden, sich von den persischen Verbänden abzusetzen und neu zu formieren. Nun stand eine Entscheidungsschlacht auf See bevor. Es sollte die berühmte Schlacht von Salamis werden. Wie an Land wurde auch auf See mit allen möglichen Tricks gekämpft, denn der Gegner sollte in allen Phasen der Schlacht desinformiert sein.
Geschicktes Täuschungsmanöver
Athener und Spartaner waren sich zunächst nicht einig, wo die Entscheidungsschlacht stattfinden sollte. Die Athener bevorzugten das flache Meer zwischen der Insel Salamis und dem Festland, während die Spartaner und Flottenteile aus anderen Stadtstaaten aufgrund einer besseren Manövrierfähigkeit für einen Kampf auf dem offenen Meer waren. Themistokles, der Staatsmann und Admiral der Athener, griff deshalb zu einem Trick: Er schickte seinen Vertrauten Sikinnos heimlich mit einem kleinen Boot zur persischen Flotte und ließ ausrichten, dass die Griechen durch die Verluste ihrer Heiligtümer völlig demoralisiert wären und dass die Athener Flotte ohne Wissen der anderen fliehen wolle. Xerxes fürchtete, er müsste seine Kräfte zeitraubend auf einzelne griechische Flottenverbände verzetteln und beschloss sofort anzugreifen, um eine Entscheidung herbeizuführen. Am nächsten Morgen blockierte die persische Flotte die Meerenge von Salamis, um die Flucht der Griechen zu verhindern. Xerxes nahm mit seinem Hofstaat auf einem Hügel an Land Platz, um das Schauspiel der bevorstehenden Seeschlacht voller Siegesgewissheit zu beobachten. Er merkte nicht, dass er in eine Falle gelockt worden war. Die zahlenmäßig überlegene persische Flotte saß durch die Blockade der Meerenge wie in einem Flaschenhals fest, während die griechische Flotte im flachen Wasser und bei guter Ortskenntnis ungestört manövrieren konnte.
Die persische Flotte eröffnete das Gefecht und musste noch beim Angriff erfahren, dass die Schiffe nicht nebeneinander, sondern nur hintereinander fahren konnten. Die Griechen hatten den Bug ihrer Schiffe zum Rammen verstärkt und rammten die gegnerischen Schiffe, die sich nacheinander näherten. Im flachen Wasser waren die griechischen Schiffe außerdem besser manövrierfähig als die persischen und konnten durch dichte Annäherungen deren Ruder kappen. Oft standen sich die persischen Schiffe direkt gegenseitig im Wege oder liefen auf Grund. Zuletzt hatten die Griechen noch Glück, denn ein für sie günstiger Wind trieb die mit hohen Bordwänden ausgestatteten persischen Schiffe gegen Felswände. Bereits gegen Mittag entschloss sich die Flotte des Großkönigs zur Flucht. Xerxes hatte rund 200 Schiffe verloren und die Griechen nur etwa 20. Allerdings war die griechische Flotte so geschwächt, dass sie die Flüchtenden nicht wirkungsvoll weiter verfolgen oder gar den Großkönig gefangen nehmen konnte. Gleichzeitig befand sich noch das große persische Heer im Land und hatte bereits beachtliche Verwüstungen angerichtet. Xerxes, der geglaubt hatte, die Schlacht wie eine Theatervorstellung genießen zu können, floh und stellte sich unter den Schutz seines Landheeres. Später kehrte er in sein Reich zurück. Vorher hatten seine schnellen Kurierreiter bereits überall die Nachricht verbreitet, dass Athen erobert und niedergebrannt worden sei.
Dem persischen Landheer in Griechenland fehlte von nun an zwar der Nachschub durch die eigene Flotte, aber es war immer noch völlig intakt. Außerdem hatte es unter den Griechen Verbündete wie etwa die Stadt Theben. Es stand noch lange auf griechischem Gebiet und seine Reiterei blieb gefürchtet. Nach einigen Schlachten zog es sich schließlich langsam zurück. Das persische Weltreich dehnte sich danach nicht mehr weiter nach dem Westen aus.