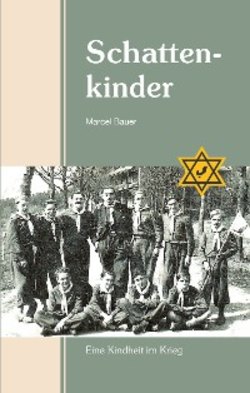Читать книгу Schattenkinder - Marcel Bauer - Страница 10
ОглавлениеAufbruch ins Gelobte Land
Im Spätsommer 1942 hatte Joshua Rozenberg zur Tarnung den unverfänglichen Namen Pierre Thonnar angenommen. Mit seinem richtigen Namen, der ihn als Juden auswies, hätte er den Krieg schwerlich überlebt. Vom ersten Augenblick an fand er, dass der neue Name ihm wie ein Handschuh saß. Er hat sich so sehr daran gewöhnt, dass er ihn am liebsten für immer gegen seinen alten ausgetauscht hätte. Er gab ihm das Gefühl, ein Junge wie alle anderen zu sein.
Joshua hatte immer Merkmale und Auffälligkeiten gescheut, die ihn zum Außenseiter oder Sonderling hätten abstempeln können. Wenn die Familie an hohen Festtagen die Synagoge4 aufsuchte, setzte er die Kippa5 erst beim Betreten des Gotteshauses auf, weil er befürchtete, er könne unterwegs einem Klassenkameraden begegnen, der ihn als Juden identifizieren würde.
Joshua Rozenberg alias Pierre Thonnar wurde am 26. Dezember 1931 im polnischen Lodz als zweiter Sohn der Eheleute Ariel und Elsa Rozenberg geboren.
An seine frühe Kindheit in Polen erinnert er sich kaum noch. Vermutlich sind die meisten Erinnerungen und Bilder, die noch in seinem Kopf spuken, das Resultat der Erzählungen seiner Eltern. Manches hat er irgendwann aufgeschnappt und so sehr verinnerlicht, dass er glaubt, es selbst erlebt zu haben. Wenn Vater oder Mutter von ihrer polnischen Heimat erzählten, tauchten in seiner Vorstellung belebte Märkte mit fremdartigen Gestalten auf, die lange Bärte und Hüte aus Zobel trugen.
Lodz war die industrielle Herzkammer Polens. Die Stadt genoss den Ruf eines polnischen Manchester. Nach einer amtlichen Zählung waren mehr als ein Drittel der Einwohner, 230.000 von 670.000, Israeliten. Entsprechend augenfällig und vielfältig war das jüdische Leben: Es gab jüdische Zeitungen, jüdische Schulen, Theater und Sportvereine, Hospitäler und Waisenhäuser. Es gab an die 250 Synagogen.
Viele Juden kamen aus den umliegenden Dörfern, den sogenannten Schtetl6. Die Suche nach Arbeit und Brot hatte sie in die Stadt gelockt. Mit der Unabhängigkeit Polens strömten auch viele Juden aus Galizien und der Ukraine ins Land, von denen viele Analphabeten waren. Sie lebten in geschlossenen Vierteln: entweder in der Altstadt von Lodz oder in Ghettos wie Brzezinv, Stryków oder Zgierz. Dort prägten orientalisch anmutende Basare das Straßenbild. Die ärmsten Juden wohnten in Baluty, einem Slum, der weder über elektrischen Strom noch über eine Kanalisation verfügte.
Die Rozenbergs wohnten in Gorna, einem Viertel mit gemischter Bevölkerung: Neben Juden und Polen gab es dort noch viele Volksdeutsche, im Volksmund Schwob oder Szwaby genannt. Zu diesen zählte auch Joshuas Mutter Elsa, geborene Meyer. Sie war die Tochter eines jüdischen Tuchhändlers und einer deutschen Mutter, die ihrerseits von schlesischen Webern abstammte, die im 19. Jahrhundert eingewandert waren.
Eigentlich hieß sie mit Vornamen Ruth, aber ihre Eltern hatten sie von klein auf Elsa gerufen. Die Meyers waren eine weit verzweigte Familie, die die deutsche Kultur angenommen hatte. Elsa Rozenberg betrachtete sich zwar als Jüdin, war aber nicht sonderlich religiös, was nichts daran änderte, dass sie in allem dem entsprach, was man mit einer »jiddischen Mame« verbindet. Ihr gingen das Wohlergehen und das Glück ihrer Familie über alles.
Joshua liebte seine Mutter abgöttisch. Sie war ein richtiger Wonneproppen. Er erinnerte sich gerne daran, wie er als kleiner Junge bei Gewitter zu ihr ins Bett gekrochen war und sie ihn dann so fest an ihre gewaltigen Brüste drückte, dass er glaubte, ersticken zu müssen. Als er sie einmal fragte, wozu diese schwabbeligen Dinger eigentlich dienten, strich sie ihm sanft durch die Haare und sagte, dass der Allmächtige die Frauen Israels mit großen Busen ausgestattet habe, damit ihre Kinder ein Ruhekissen hätten, wenn das auserwählte Volk auf seiner langen Wanderung durch die Wüste eine Rast einlegte.
Ariel Rozenberg, Joshuas Vater, kam aus Ostpolen und stammte aus ärmlichen Verhältnissen. Er hatte lange um Elsa Meyer geworben. Obwohl sie von kräftiger Statur war, während er eher klein und schmächtig war, hatte sie ihn wegen seines Fleißes und seiner Redlichkeit zuerst schätzen, dann lieben gelernt. Wie es der Anstand verlangte, ließ sie ihre deutsche Herkunft und ihre höhere Bildung nie durchschimmern und ließ ihm in der Öffentlichkeit den Vortritt, obwohl er neben ihr eher wie ein erwachsener Sohn als wie ein Ehemann aussah. Dafür durfte sie in den eigenen vier Wänden nach Gutdünken schalten und walten. Unangefochten schwang sie daheim das Zepter, egal ob es die Form eines Kochlöffels oder eines Staubwedels hatte.
Nach der Neugründung Polens 1920 hatten viele Volksdeutsche das Land verlassen. Viele kultivierte Juden, die zum aufstrebenden Bürgertum gehörten, schlossen sich ihnen an und zogen nach Berlin, Breslau und in andere deutsche Großstädte.
Elsa Rozenberg legte großen Wert darauf, dass ihre Söhne eine deutsche Schule besuchten. Erst als diese wie viele andere im Lande auf Druck der polnischen Kulturbehörde schließen musste, wechselte ihr ältester Sohn Menahim auf eine polnische Schule. Das behagte ihm nicht, denn es kam häufig vor, dass er als »niemiecki Zyd«, als deutscher Jude, von seinen Klassenkameraden gehänselt wurde. Von den Lehrern fühlte er sich benachteiligt.
Die Erziehung der Söhne überließ Rozenberg seiner Frau. Diese bezeichnete ihre Sprösslinge als Beracha, als einen Segen des Allmächtigen. Der Vater griff in die Erziehung nur dann ein, wenn ihm etwas gegen den Strich ging – etwa bei dem Zinnober, das Joshua um seinen Stoffhasen veranstaltete.
Es missfiel ihm, dass der Junge ihn überall mitnahm, sich angeregt mit ihm unterhielt und ihn wie ein menschliches Wesen behandelte. Der Bursche ist nicht leicht zu handhaben, pflegte der Vater zu sagen, womit er das Plüschtier meinte. Er konnte es nicht lassen, sarkastische Bemerkungen über Joshuas ständigen Begleiter zu machen und allerlei Hasenwitze zu erzählen.
Einer handelte von einem Hasen, der in einer Apotheke nach Möhren fragt. »Nein, ich habe keine Möhren«, antwortet der Apotheker. Der Hase kommt tags darauf wieder und fragt: »Had du Möhren?« – »Nein, ich habe keine Möhren.« So geht es die ganze Woche, bis der Apotheker am Ende verzweifelt ein Schild an die Tür hängt: »Möhren ausverkauft!« Der Hase macht dem Mann daraufhin Vorhaltungen: »Ich wusste es, du bist ein schäbiger Lügner. Had du doch Möhren gehad!«
Joshua ließ sich von solchen Hänseleien nicht beeindrucken, aber Roro war jedes Mal beleidigt, weil er es nicht mochte, dass man ihn für blöd hielt. Joshua wunderte sich manchmal, wie eingenommen Roro von sich selbst war. Der Hase ließ keinen Zweifel aufkommen, dass er etwas Besonderes sei. Angeblich stammte er in direkter Linie von Meister Lampe, dem Stammvater aller Hasen, ab. Er legte Wert darauf, dass Joshua seine einzelnen Körperteile korrekt benannte. Ein Feldhase, belehrte er ihn, habe keine Ohren, sondern Löffel, keine Beine, sondern Sprünge. Statt eines Fells habe er einen Balg, statt Augen Seher. Besonders stolz war er auf seine Hasenscharte, die seine Oberlippe in zwei gleiche Hälften teilte.
Vater Rozenberg unternahm mehrere Anläufe, um seinen Sohn bezüglich des Hasen zur Räson zu bringen. Als das nichts fruchtete, beschlossen die Eltern, ihn für eine gewisse Zeit aus dem Verkehr zu ziehen.
Tatsächlich war Roro eines Tages spurlos verschwunden. Die Mutter erzählte, der Hase habe beschlossen, sein eigenes Leben zu führen und sei ausgewandert. Doch Joshua durchschaute das Manöver, durchsuchte das ganze Haus und nörgelte so lange, bis die Mutter schließlich nachgab und den Hasen wieder herausrückte. Nach diesem Vorfall fanden die Eltern sich damit ab, dass ihr jüngster Sohn ein problematisches Verhältnis zu einem blauen Stoffhasen hatte.
Von den dreieinhalb Millionen Juden in Polen sprachen die allermeisten Jiddisch, was in polnischen Ohren verdächtig deutsch klang. Nach dem Tod des Staatsgründers Józef Piłsudski, der sich um ein gutes Verhältnis zwischen den verschiedenen Volksgruppen bemüht hatte, kam es zu antisemitischen Übergriffen. Die Israeliten wurden mehr und mehr aus dem öffentlichen und wirtschaftlichen Leben gedrängt, ihren karitativen und kulturellen Einrichtungen wurde jegliche Unterstützung entzogen.
Für Mendel bedeutete das, dass er aus dem Schachclub Rochade, die ihre wöchentlichen Wettkämpfe in der städtischen Bibliothek austrug, verwiesen wurde. Ab 1935 waren höhere Ränge in der Armee und Karrieren im Staatsdienst den Juden verwehrt. An den Universitäten wurde ein Numerus clausus verhängt.
Joshuas Vater betrieb in Gorna, wo es neben säkularen viele strenggläubige Juden gab, eine koschere7 Metzgerei, die »Kol Tiv – Das Beste für Sie« hieß. Rozenberg war Schächter8 und Metzger in einer Person. Das rituelle Schächten hatte er bei einem Onkel erlernt. Um ein von der Religionsbehörde anerkannter Schochet9 zu werden, bedurfte es einer speziellen Ausbildung. Die Vorschriften für die Ausübung des Berufes verlangten, dass man sich in den Geboten Mose genauso gut auskannte wie im Umgang mit den Schlachttieren. Zur Geschäftsgründung hatte die Mutter dem Vater zwei handgeschnitzte Schächtmesser geschenkt. Die Griffe waren mit Rinderköpfen sowie Gänsen und Truthähnen verziert.
Bei der Geschäftsgründung hatte Rozenberg sich hoch verschuldet. Da er als Jude von der polnischen Genossenschaftsbank keinen Kredit bekommen hatte, hatte er sich das nötige Kapital bei einem jüdischen Wucherer geliehen. Anfangs verlief alles zu seiner Zufriedenheit, aber nach 1935 verschlechterte sich seine wirtschaftliche Situation, weil viele Kunden auswanderten.
Der traditionelle Antisemitismus schlug hohe Wellen. Immer wieder geschah es, dass Juden auf offener Straße angepöbelt, einige sogar umgebracht wurden, ohne dass die Behörden eingriffen. Als es in Lodz zu Plünderungen jüdischer Geschäfte kam, dachte Rozenberg darüber nach, Polen zu verlassen.
Die Idee nahm mit der Zeit immer konkretere Formen an. Von der allgemeinen Verunsicherung der Juden profitierten vor allem die Zionisten, die kräftig Werbung für eine Auswanderung nach Palästina machten, um Eretz Israel10 wieder aufzubauen. Rozenberg hielt das alles für ein Hirngespinst. Er verspürte keine Lust, »Ananas in der Wüste zu züchten«, wie er es formulierte. Er träumte von einer neuen Existenz in einem zivilisierten Land.
Rasch geriet Belgien in seinen Fokus, weil er dorthin familiäre Beziehungen unterhielt. Vor dem Krieg hatte eine Kusine einen Kantor11 in Lüttich, Nathan Goldstein, geehelicht, einen Mann, den sie nie gesehen hatte, sondern nur von Fotografien her kannte. Das war durchaus üblich. Solche Ehen wurden von Heiratsvermittlern, sogenannten Schadchen, arrangiert. Goldstein war früh verwitwet, und da es sich für einen frommen Juden im besten Mannesalter nicht schickte, lange ledig zu sein, beschloss er, sich in seiner polnischen Verwandtschaft nach einer neuen Ehefrau und einer Ersatzmutter für seine vier unmündigen Kinder umzusehen. Er beauftragte Ariel Rozenberg per Brief mit der Brautschau.
Nach einigem Suchen zeigte sich eine andere Kusine, ein älteres Fräulein um die dreißig, die in einer Spinnerei arbeitete, an einer Ehe mit dem Witwer interessiert. Nach einem kurzen Briefwechsel schlossen sie die Ketubba, den in Aramäisch verfassten Ehevertrag ab.
Mit guten Wünschen versehen trat Hanna Nejmann 1934 die Reise in ein Land an, das der künftige Ehemann als Gelobtes Land beschrieben hatte. Die Ehe schien unter einem guten Stern zu stehen, denn sie war bald mit einem Kind gesegnet. Nach der Geburt eines Sohnes, der den Vornamen Benjamin erhielt, ließ Goldstein seine polnischen Verwandten wissen, er glaube, dass er damit dem göttlichen Gebot, Nachkommen in die Welt zu setzen, um den Fortbestand Israels zu sichern, Genüge getan habe.
In Rozenbergs Auswanderungsplänen nahm der ferne Cousin einen zentralen Platz ein. Er hegte die Hoffnung, dass Goldstein sich wegen seiner Verdienste bei der Ehestiftung revanchieren und ihm bei einer Übersiedlung behilflich sein werde. Er wurde nicht enttäuscht. Nathan Goldstein versprach, ihn nach Kräften zu unterstützen.
Damals wanderten viele Polen nach Belgien aus. Sie ließen sich von staatlichen und privaten Agenturen als Arbeitskräfte für das wallonische Kohle- und Stahlrevier anwerben. Die belgische Schwerindustrie erholte sich nur langsam von den Verlusten und Verwüstungen, die der Weltkrieg angerichtet hatte: Für die Arbeit in den Bergwerken und an den Hochöfen wurden vorzugsweise Italiener und Polen eingestellt, weil die im Ruf standen, genügsame, tüchtige und disziplinierte Arbeiter zu sein. Mitte der 30er Jahre lebten im wallonischen Stahlbecken 60.000 Polen. Den Behörden war es gleichgültig, welcher Konfession und Nationalität die Einwanderer waren, solange sie nur gesund und fleißig waren.
Insofern war Rozenberg guten Mutes, als er im belgischen Konsulat von Krakau vorsprach und einen Antrag auf Einwanderung stellte. Als er im Gespräch freimütig erklärte, er beabsichtige, nicht in einem Bergwerk oder an einem Hochofen zu arbeiten, sondern ein Geschäft zu eröffnen, erfuhr er eine rüde Abfuhr.
War der Ton bis dahin freundlich gewesen, wurde er mit einem Mal schroff und ablehnend. Man sei nicht gewillt, jüdische Hausierer und Hungerleider ins Land zu lassen. Alle diplomatischen Vertretungen im Ausland seien angewiesen, ein Einreisevisum nur solchen Kandidaten zu erteilen, die schon einen Arbeitsvertrag mit einem Unternehmen der Schwerindustrie vorweisen konnten.
Als Rozenberg seinem Cousin von seinem Missgeschick berichtete, ermunterte der ihn, mit seinen Bemühungen fortzufahren und sich nicht entmutigen zu lassen. Es gebe andere, verschwiegene Wege, um nach Belgien zu gelangen. Er habe von gut organisierten Schleusernetzen gehört, die Juden bei der Einreise behilflich seien. Der Kantor versprach, sich bei polnischen Juden umzuhören, die es nach Belgien geschafft hatten, um zu erfahren, wie sie vorgegangen waren. Von ihnen erfuhr er, dass sie die Hilfe deutscher Glaubensbrüder erfahren hatten, die unmittelbar an der Grenze zu Belgien lebten.
Der Kantor lieferte erstaunliche Details über die »Eifeljuden«. Eine Ortschaft namens Hellenthal diente angeblich als Drehscheibe im organisierten Menschenhandel. Dort, schrieb Goldstein seinem Vetter, gebe es einen Viehhändler namens Karl Haas, der schon viele Juden nach Belgien geschleust habe.
Um sich ein genaues Bild über die Eifel und die Situation an der Grenze zu machen, suchte Rozenberg die Bibliothek der Großen Synagoge auf und stöberte in Handbüchern und Atlanten. Eines Tages fand er in einer älteren Ausgabe des »Jiddischen Wortes« einen Beitrag über die ominösen Eifeljuden. Demnach hatten sie sich nach der Bartholomäusnacht im Jahre 1346, als die jüdische Diaspora im Rheinland ausgelöscht wurde, in die Eifel und an die Mosel geflüchtet. Obwohl sie auch dort Verboten unterworfen waren, passten sie sich gut ihrer neuen Umgebung an. Viele wurden wohlhabende Bürger und besaßen Grundbesitz. Als die Eifel 1815 an Preußen fiel, wurden alle Beschränkungen, die ihnen bis dahin noch auferlegt waren, aufgehoben.
Seitdem sie die Bürgerrechte besaßen, gingen sie normalen Berufen nach und genossen besonders als Makler und Händler hohes Ansehen bei ihren christlichen Nachbarn. Auffallend war, dass es unter ihnen viele Metzger und Viehhändler gab.
In dem Heft gab es eine Landkarte mit dem Verzeichnis jüdischer Gemeinden in der Eifel: Münstereifel, Wittlich, Gemünd, Schleiden und Hellenthal waren die wichtigsten. Aber selbst in winzigen Ortschaften wie Kyll oder Blumenthal gab es Synagogen. Erfreut unterrichtete Rozenberg seinen Vetter, dass er nun wisse, welchen Weg er nach Belgien nehmen müsse.
Mendel und Joshua blieben die Pläne, die die Eltern schmiedeten, nicht lange verborgen, denn ihr Vater verbrachte von nun an die Abende damit, Landkarten zu studieren und sich eifrig Notizen zu machen. In der freudigen Erregung, Schlupflöcher an der deutsch-belgischen Grenze gefunden zu haben, übersah Rozenberg, dass die rosigen Zustände, die in der Zeitschrift beschrieben wurden, älteren Datums waren. Das »Jiddische Wort« wusste noch nichts von den Repressionen, denen die Eifeljuden seit der Machtergreifung der Nationalsozialisten ausgesetzt waren. Inzwischen gab es die Nürnberger Gesetze, die darauf abzielten, allen Juden die existenzielle Grundlage zu entziehen und das Zusammenleben zwischen Juden und Ariern unmöglich zu machen.
Um die Jahreswende 1935–1936 traf Rozenberg Vorbereitungen für die Ausreise. Da er ein rechtschaffener Mann war, der sich nicht wie ein Dieb in der Nacht davonstehlen wollte, plante er eine geordnete Übergabe seines Geschäftes. Der Erlös aus dem Verkauf der Schlachterei reichte gerade aus, um die Restschulden bei dem Wucherer zu begleichen. Da er keinerlei finanzielle Reserven besaß, wusste er nicht, wo er die Mittel für eine Existenzgründung in Belgien finden sollte. So sehr er auch rechnete, es langte vorn und hinten nicht.
Da er mit seinem Schicksal haderte, schlug ihm seine Frau vor, ihre Verwandtschaft in Deutschland zu kontaktieren. Einer ihrer ausgewanderten Verwandten hatte in der Freien Hansestadt Bremen mit dem Handel von Kaffee ein Vermögen gemacht. Sie schlug vor, sich mit ihrem Halbvetter Siegmund Meyer in Verbindung zu setzen, in der Hoffnung, dass er ihnen finanziell unter die Arme greifen werde.
In Erwartung einer Antwort schwankte die Stimmung im Hause Rozenberg für einige Wochen zwischen Hoffnung und Entmutigung. Groß war die Erleichterung, als der Bremer Kaffeebaron wohlwollend auf die Anfrage der polnischen Kusine reagierte. Er lud sie ein, auf der Durchreise nach Belgien mit der Familie in Bremen Station zu machen. Dort würde man in aller Ruhe die Angelegenheit bereden und das Finanzielle regeln.
Im Frühsommer des Jahres 1936 war es soweit. Da die Reichsregierung im Rahmen ihrer Bemühungen um eine Revision des Versailler Vertrages gerade einen Schmusekurs mit dem polnischen Nachbarn fuhr, stellte sie problemlos Touristenvisa für die Dauer der Olympischen Spiele aus. Als im Hause bereits riesige Unordnung herrschte, weihten die Eltern ihren ältesten Sohn in ihre Reisepläne ein, während sie den jüngeren weiterhin im Ungewissen ließen, um das Projekt nicht zu gefährden.
Mendel wollte von den Eltern wissen, warum die Reise ausgerechnet über Deutschland erfolgen sollte. Die polnischen Klassenkameraden würden so schlecht über die Deutschen reden. Der Vater antwortete, das sei der direkte Weg, um nach Belgien zu gelangen. Außerdem redeten nicht nur die Deutschen, sondern auch die Polen schlecht über die Juden. Insofern solle er sich keine Sorgen machen. Es gebe überall gute und böse Menschen. Rozenberg hatte eine positive Sicht der Welt, und die wollte er sich nicht vermiesen lassen.
* * *
Am Hauptbahnhof gab es einen tränenreichen Abschied. Alle Freunde und Verwandten hatten sich auf dem Bahnsteig eingefunden. Sogar der Rabbi war gekommen, um ihnen seine Beracha, seinen Segen, für die Reise mitzugeben. Elsa Rozenberg fiel der Abschied von ihren Geschwistern und besonders von der hoch betagten Mutter schwer. Es war, als ahne sie, dass sie sie in diesem Leben nicht wiedersehen würde.
Bis auf zwei Koffer mit persönlichen Sachen ließen die Rozenbergs alles andere in Polen zurück. Alles sollte so aussehen, als ginge es auf eine Urlaubs- und Vergnügungsreise. Die Einrichtung seiner Metzgerei hatte der Vater unter der Hand verkauft. Möbel und sonstige Geräte und Wertsachen waren in der Verwandtschaft verteilt worden. Von ihrem Hausstand durfte die Mutter nur einige Familienfotos mitnehmen. Die beiden Brüder mussten sich mit einem Spielzeug und einem Buch ihrer Wahl begnügen. Nachdem er sich mit Roro beraten hatte, entschied Joshua sich für ein Bilderbuch mit Burgen und Rittern, während Mendel seinem pragmatischen Temperament entsprechend ein Handbuch für Modelleisenbahnen auswählte.
Der Vater bestand darauf, die Trompete mitzunehmen, die er sich vom Munde abgespart hatte. Seine beiden Schächtmesser, die unentbehrlichen Werkzeuge seines frommen Gewerbes, hatte die Mutter ins Futter eines der beiden Koffer eingenäht, um Schwierigkeiten am Zoll zu vermeiden.
Von Lodz aus ging es über Posen nach Frankfurt an der Oder und von dort weiter nach Berlin. Die Passkontrolle an der deutsch-polnischen Grenze bei Neu Bentschen erfolgte reibungslos. Die Schaffner waren höflich und zuvorkommend. Der Vater musste allerdings seinen gepolsterten Trompetenkasten öffnen, weil der Beamte sichergehen wollte, dass es sich wirklich um einen Behälter für ein Instrument handelte und nicht um ein Versteck für illegale Waren.
Im Rückblick kam es Joshua vor, als habe die Reise nicht siebzehn Stunden sondern eine Ewigkeit gedauert. Seinen Plüschhasen hatte er zwischen die Koffer auf dem Gepäckständer gesetzt, damit er aus luftiger Höhe alles genau verfolgen konnte, was sich im Zugabteil abspielte.
Mendel hatte seinem Bruder das Denk- und Ratespiel »Schiffe versenken« beigebracht. Mendel kommandierte die deutsche, Joshua die englische Kriegsflotte. Es gelang Joshua auf Anhieb, einen Zerstörer Mendels sowie eine Fregatte zu versenken. Als er dann auch noch das Prunkstück von Mendels Flotte, das Schlachtschiff der Bismarck-Klasse, traf, war Mendel erbost. Er beschuldigte Roro, von seiner hohen Warte aus Joshua die entsprechenden Tipps zu geben und verlangte, dass er seinen Platz wechselte. Bevor der Streit zwischen den Jungen eskalierte, schritt der Vater ein.
Bei der nächsten Fahrscheinkontrolle entdeckte ein Schaffner den Hasen in der Gepäckablage, sprach von einem blinden Passagier und verlangte dessen Fahrschein zu sehen. Während der Vater auf Polnisch eine Entschuldigung stammelte und schon nach seinem Portemonnaie griff, weil er mit einer saftigen Ordnungsstrafe rechnete, lachte der Beamte auf und sagte, es sei alles nur ein Scherz gewesen. Joshuas Vater war trotzdem verärgert. Er meinte, das blöde Stofftier bereite nur Scherereien und mache die Familie lächerlich. Joshua schloss daraus, dass er umsichtiger sein müsse, um Roro keinen unnötigen Gefahren auszusetzen.
Als sie den Schlesischen Bahnhof in Berlin erreichten, fanden sie sich in einem Fahnenmeer wieder. Im Hinblick auf die Olympischen Sommerspiele waren die Bahnsteige nicht nur mit der olympischen Fahne und der Hakenkreuzflagge, sondern mit den Fahnen aller teilnehmenden Nationen geschmückt. Aus Lautsprechern dröhnte die olympische Hymne. Die Besucher, die zum Fest der Völker anreisten, sollten einen guten Eindruck vom Dritten Reich bekommen. Alles sollte festlich und freundlich wirken.
Über Hannover erreichten sie die Hansestadt Bremen. Übermüdet, aber erleichtert verließen sie den Centralbahnhof. Wie der Vetter es beschrieben hatte, befanden sich auf dem Vorplatz des Bahnhofes die Haltestellen der Straßenbahnlinien 2 und 3, die zum Bremer Ostertor fuhren. Bis zur Humboldtstraße, wo die Meyers wohnten, waren es nur noch einige Fußminuten.
Der Besuch bei der deutschen Verwandtschaft hinterließ einen zwiespältigen Eindruck. Konsul Meyer und seine Familie bewohnten ein repräsentatives Stadthaus aus der Gründerzeit. Die Eingangshalle war so groß, dass man darin hätte Federball spielen können. Der Hausherr erwartete sie wie ein Feldherr auf der Empore zum Obergeschoss. Konsul Meyer war eine Respekt einflößende Erscheinung, hochgewachsen und herrschaftlich im Auftreten. Er trug einen etwas aus der Mode gekommenen Zwirbelbart, wie Kaiser Wilhelm ihn getragen hatte.
Der Konsul empfing die polnischen Gäste im Jagdzimmer. Der große Raum auf der Beletage war unterteilt: auf der einen Seite stand ein Billardtisch, der so groß und hoch war, dass Joshua kaum über den Rand gucken konnte. In der Mitte lagen in einem dreieckigen Rahmen neun weiße Kugeln bereit, davor eine rote Kugel. An den Kreidewürfeln konnte man erkennen, dass es schon lange her war, dass jemand gespielt hatte.
An den Zimmerwänden hingen Jagdtrophäen, Hirsch- und Rehgeweihe sowie der mächtige Kopf eines Keilers. Eigentlich, klärte der Hausherr seine Gäste auf, sei er immer noch ein leidenschaftlicher Waidmann, aber seit dieser fette Parvenü von Göring Reichsjägermeister geworden sei und das christliche Kreuz im Geweih des Hirsches durch ein Hakenkreuz habe ersetzen lassen, mache ihm das Weidwerk keine Freude mehr.
Seine Frau erzählte hinter vorgehaltener Hand, dass man ihren Mann nach Einführung des Arierparagrafen aus der Lüneburger Jägerschaft ausgeschlossen habe, was er nicht verschmerzt habe.
Auf der anderen Seite des Raumes gab es eine Leseecke mit Polstermöbeln. Die Wände waren ganz mit Bücherregalen zugestellt. Gegenüber stand ein Flügel, auf dem die Tochter des Hauses ihre Partituren übte. Über dem Klavier hing eine Fotogalerie. Auf einem Foto war die Tochter Hedwig bei ihrer Konfirmation zu sehen, ein anderes zeigte den Hausherrn in der Uniform eines Leutnants des Infanterieregiments »Bremen«. Auf seiner Brust prangte das Eiserne Kreuz, das ihm für Tapferkeit vor dem Feind verliehen worden war. Als er die fragenden Blicke der Jungen bemerkte, begann der Konsul lang und breit von seinen Kriegserlebnissen zu erzählen.
Als Reservist hatte er sich im August 1914 freiwillig gemeldet. Er war mit dem 1. Hanseatischen Regiment an die Westfront gezogen und hatte bei Noyon in Nordfrankreich seine Feuertaufe bestanden. Sein Regiment habe im Stellungskrieg schwere Verluste erlitten, was seiner Überzeugung, dass er für eine gerechte Sache kämpfte und am Ende den Sieg davontragen werde, nichts anhaben konnte. Leider war es aber anders gekommen. Die Schuld dafür wies Meyer unfähigen Politikern zu, die den kämpfenden Truppen in den Rücken gefallen seien.
Meyers Ehefrau Gerda war eine geborene Scholl und stammte aus gutem hanseatischem Hause. Neben Hedwig gab es noch den jüngeren Sohn Emil, ein aufgeweckter Junge in Joshuas Alter. Die Kinder begegneten ihren Eltern voller Respekt und redeten sie nur in der dritten Person an.
Emil hatte einen goldbraunen Teddybären, der Petsy hieß, ein drolliges Kerlchen, das allerlei lustige Geschichten zu erzählen wusste und immer zu Späßen aufgelegt war. Sehr stolz war das Bärchen auf den Knopf in seinem linken Ohr. Das zeichne ihn vor allen anderen Teddybären aus, klärte er den Plüschhasen auf. Die beiden freundeten sich an, obwohl Roro von Natur aus eher reserviert war.
Als Vertreter des hanseatischen Bürgertums und Mitglied des Deutschen Kaffeevereins war der Konsul sich seiner gesellschaftlichen Stellung bewusst. Um diese zu betonen, gab er sich Mühe, wie ein preußischer Junker zu näseln und redete in der Familie vorzugsweise Bremer Schnack, den örtlichen Dialekt. Man merkte ihm an, dass es ihn einige Überwindung kostete, Jiddisch zu reden, das er nur mangelhaft beherrschte. Von Mendel und Joshua ließ er sich mit »Oheim« anreden. Die Jungen mochten diesen deutschen Onkel wegen seiner überheblichen und herablassenden Art nicht sonderlich. Sie machten sich einen Spaß daraus, ihn abends auf ihrem Zimmer zu parodieren und nachzuäffen.
Meyers Frau war sehr viel umgänglicher als ihr Mann. Sie verstand sich auf Anhieb gut mit Joshuas Mutter. Während die Männer in der Bibliothek über hohe Politik redeten und die Kinder im Garten spielten, hielten die Frauen nebenan ihren Kaffeeklatsch. Da Joshuas Mutter von Hause aus gut Deutsch sprach, konnten sie sich zwanglos unterhalten.
Gerda Meyer klagte darüber, dass sie ohne Haushaltshilfe auskommen mussten, weil es Juden durch die Nürnberger Rassengesetze verboten war, Nicht-Juden als Hauspersonal anzustellen. Noch schmerzlicher seien die beruflichen Einschnitte, die ihr Mann in seinem Geschäft erfahren habe. Man habe ihn im Rahmen der Arisierung gezwungen, seine Anteile am Unternehmen, das seinen Namen trug, zu einem Schleuderpreis zu veräußern. Aber man habe ihn nicht entlassen, sondern auf einen untergeordneten Posten abgeschoben, weil er über viele Kontakte ins Ausland verfügte, die über die Jahre gewachsen waren und die für das Unternehmen unerlässlich waren.
Sie sagte, das antisemitische Klima, das sich selbst in der feinen hanseatischen Gesellschaft breitmache, mache ihrem Mann zu schaffen. Er leide sehr unter den Anfeindungen, die er auf offener Straße erfuhr. Hatten früher die Nachbarn artig den Hut gezogen, wenn sie dem Herrn Konsul begegneten, titulierten Lausbuben aus der Nachbarschaft ihn nun ungestraft als »Saujuden« oder »Judensau«. Vermutlich war diese Demütigung ein Grund dafür, dass Meyer sich auf seine jüdischen Wurzeln besann und bereit war, seinen entfernten Verwandten eine finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen.
Siegmund Meyer erging sich gerne in weitschweifigen Erörterungen, die er mit zahlreichen historischen Bemerkungen und Anekdoten spickte. Ariel Rozenberg war ein dankbarer Zuhörer, umso mehr als er nicht alles verstand, was der Konsul zum Besten gab. Ungeachtet der widrigen Tagespolitik bezeichnete der Konsul sich als deutscher Patriot. Was seine persönliche Zukunft betraf und die Situation der Juden im Reich, blieb er zuversichtlich. Der Nazi-Spuk werde irgendwann vorüber sein. Danach würden wieder geordnete Zustände im Reich einkehren.
Seine Überzeugung stützte sich auf die Beobachtung, dass neuerdings alle antisemitischen Parolen aus dem Stadtbild entfernt worden waren. Es fänden auch keine Übergriffe gegen Juden oder jüdisches Eigentum mehr statt. Zu den Olympischen Spielen präsentiere sich Deutschland als gastfreundliches, weltoffenes Land. Alles sei auf einmal viel entspannter. Jüdische Sportler, die aus der deutschen Nationalmannschaft entfernt worden waren, seien mit allen Ehren wieder aufgenommen worden. Deutschland sei eben eine Kulturnation, und daran würden »diese Banausen aus den bayerischen Bergen«, die derzeit in Berlin das Sagen hätten, auf Dauer nichts ändern.
Dass Meyers zur Schau gestellte Gelassenheit nur gespielt war, sollte der Metzger Rozenberg an den Umständen ersehen, mit der die Geldübergabe stattfand. Statt eine Bank aufzusuchen, begleitete er den Konsul auf den Söller des Hauses, wo dieser unter einer losen Bohle des Fußbodens sein mobiles Kapital verborgen hatte. In einer Schuhschachtel hatte er Bargeld, ausländische Devisen sowie Wechsel und Aktien gehortet. Zur Erklärung sagte er, die Reichsregierung habe Devisenstellen eingerichtet, mit dem Ziel, die Juden auszuplündern. Hier dagegen sei sein Geld sicher und gut angelegt. Dieses Geld würden diese Brüllaffen nicht kriegen, betonte er, als er Rozenberg eine beträchtliche Summe in ausländischer Währung aushändigte.
Abschließend ließ er Rozenberg einen Schuldschein unterschreiben. Da es immer öfter vorkam, dass aus dem Ausland angewiesene Beträge an jüdische Firmen oder Privatpersonen von der deutschen Bankaufsicht unter fadenscheinigen Vorwänden kassiert wurden, vereinbarten sie, dass Rozenberg die monatlichen Raten für den Kredit nicht nach Deutschland überweisen, sondern auf ein belgisches Sperrkonto einzahlen sollte.
Nachdem die Mutter die Geldscheine ins Futter ihrer Jacke eingenäht hatte, traten die Rozenbergs voller Optimismus ihre Reise ins »Gelobte Land« an. Von Bremen ging es über Köln nach Aachen. In einem Branchenbuch, das in der Bahnhofshalle auslag, fanden sie die Anschrift eines Gasthofes im Ostviertel von Aachen. Dort wollten sie übernachten, um in Ruhe die Lage an der deutsch-belgischen Grenze zu erkunden.
Die Wirtin der Pension »Zum Postillion« erwies sich als rabiate Person. Bevor sie die Gäste über die Schwelle ließ, wollte sie die Reisedokumente prüfen. Als sie polnische Pässe sah, setzte sie eine Miene auf, die offenes Missfallen bekundete. Bevor sie den Zimmerschlüssel aushändigte, verlangte sie Vorkasse. Die Einrichtung des Fremdenzimmers war bescheiden. Neben einem Doppelbett gab es zwei Kinderbetten, die für einen Siebenjährigen wie Mendel zu knapp bemessen waren. Immerhin gab es in dem Zimmer fließend Wasser.
Im Zimmer unterhielten sie sich nur im Flüsterton. Die Mutter schärfte den Jungen ein, den Raum nur auf leisen Sohlen zu verlassen. Wenn sie zur Toilette auf dem Flur müssten, sollten sie sich vorher vergewissern, dass die Luft im Treppenhaus rein sei. Ihr war aufgefallen, dass die Herbergsmutter ständig auf der Lauer lag und keine Gelegenheit ausließ, um ihre Kinder auszufragen und zu behelligen.
Am nächsten Morgen verließen die Rozenbergs getrennt die Pension. Während die Mutter und Joshua die Kleinbahn nahmen, um den Aachener Dom zu besuchen, machten der Vater und Mendel sich auf die Suche nach den Eifeljuden. Da Mendel aus seiner Schulzeit in Lodz noch einige Brocken Deutsch sprach, hatte sein Vater, der nur Polnisch und Jiddisch sprach, gemeint, dass er ihm bei der Suche behilflich sein könne. Er hatte seiner Frau versprochen, am Abend zurück zu sein.
Mit dem Zug ging es von Aachen nach Düren. Dort nahmen sie die Eifelbahn. Die erste Station war Euskirchen, eine Stadt, die im »Jiddischen Wort« wegen ihrer prächtigen Synagoge als Zentrum jüdischen Lebens beschrieben worden war. Als sie vom Bahnhof die Straße zum Alten Markt hinuntergingen, fanden sie dort eine seltsame Schautafel, auf der Namen und Fotos von Juden sowie Namen von »Judenknechten« und »Volksverrätern« geheftet waren. Der Pranger jagte ihnen einen solchen Schrecken ein, dass sie beschlossen, schleunigst umzukehren und sich gleich in die nächste Ortschaft zu begeben.
Den Ort Hellenthal unmittelbar an der belgischen Grenze hatte der Kantor in seinen Briefen mehrmals erwähnt. Als sie mit dem Schienenbus dort eintrafen, waren die Geschäfte bereits geschlossen. Sie sahen, dass auf einigen Rollläden Davidsterne gepinselt waren.
Als sie ein altes Mütterchen sahen, das über die Straße humpelte, drängte Rozenberg seinen Sohn dazu, sie anzusprechen. Ob sie den Viehhändler Karl Haas kenne, fragte Mendel. »Sitt der ooch Jüdde?«, erwiderte die Frau. Sie hatte es nicht böse gemeint, aber Mendel war erschrocken. »Nee, nee«, stammelte er: »Nix Jüd, Polack.«
»Ah, e sue is dat«, nickte die Alte. Dann zeigte sie mit dem Finger auf die Kölner Straße. »Do önne want d’r Haas.«
Tatsächlich gab es am Ende der Straße an einem Haus, das unbewohnt schien, eine Hausklingel mit diesem Namen. Nach mehrmaligem Klingeln öffnete ein Mann mittleren Alters die Tür.
Als er sah, dass es sich um Fremde handelte, wollte er die Tür gleich wieder schließen. Rozenberg hatte gerade noch Zeit den Friedensgruß »Schalom12, Schabbat Schalom« zu sagen. Es war an einem Freitag, und da es bereits dunkelte, war nach jüdischem Verständnis bereits der Sabbat angebrochen.
Als der Mann den vertrauten Gruß hörte, schaute er sich kurz um, um sicher zu gehen, dass sie niemand beobachtete. Dann zog er den Mann und das Kind zu sich ins Haus. »Kommen Sie herein«, sagte er auf Jiddisch. Er führte sie in eine Wohnküche und sagte, er müsse sich in Acht nehmen: die Nachbarn würden jeden Besucher bei der Polizei melden. Daran könne man sehen, dass die ständige Hetze gegen die Juden und die Gräuelpropaganda der Nazis ihre Wirkung zeige.
Haas schenkte Rozenberg einen Wacholderschnaps ein und fragte ihn nach seinem Anliegen. Als der erwähnte, er habe wunderbare Sachen über die Eifeljuden gelesen, wiegelte der Viehhändler ab. In der Eifel gebe es fast keine Juden mehr. Ihre Zeit sei abgelaufen. Von den dreihundert Glaubensjuden, die es noch vor ein paar Jahren alleine in Euskirchen gegeben habe, seien nur noch einunddreißig übrig. Und die seien von der Kreisverwaltung in sogenannte Judenhäuser gesperrt worden.
Alles habe damit angefangen, dass die Behörden auf den Viehmärkten getrennte Plätze für jüdische und arische Händler eingerichtet hätten. Von amtlicher Seite habe es geheißen, das sei notwendig, weil die Juden notorische Betrüger seien, die man besser kontrollieren müsse. Dann sei es immer öfter zu Handgreiflichkeiten der SA gekommen. Wenn die jüdischen Händler nicht freiwillig ihren angestammten Platz geräumt hätten, habe man nachgeholfen. Seinen Freund Andreas Baer von der Baumstraße, der im Krieg das Eiserne Kreuz bekommen habe, habe man grundlos zusammengeschlagen. Er habe selber mit ansehen müssen, wie die Braunen ihn gezwungen hätten, Schweinefleisch zu essen.
Rozenberg sagte, der Kantor der Synagoge von Lüttich habe ihm seinen Namen genannt, weil er von anderen Juden wisse, dass er ihnen geholfen habe, über die Grenze zu gelangen. Dem Viehhändler war es sichtlich unangenehm, das zu hören. Nein, das tue er schon lange nicht mehr. Das sei zu gefährlich. Die Grenze sei stark gesichert und nicht mehr so durchlässig wie vor zwei oder drei Jahren. Sein Bruder sei kürzlich als Judenschlepper enttarnt worden und dafür in einem Konzentrationslager gelandet.
Beim dritten Glas Wacholder schilderte Haas die Lage an der Grenze. Früher sei der Handel mit Flüchtlingen in der Eifel ein florierendes Gewerbe gewesen. Ganze Berufssparten, Fuhrunternehmen und Transporteure hätten sich als »Judenfänger« und »Kommunistenschieber« eine goldene Nase verdient. Ohne viel nachzufragen hätten sie gegen gutes Geld politisch und rassisch Verfolgte über die Schmugglerpfade nach Belgien geleitet. Bauern, die jenseits der Grenze Wiesen oder Äcker besäßen, hätten Flüchtlinge unter Heuhaufen oder Zuckerrüben versteckt und mit Pferdekarren über die Grenze gebracht, wo sie von belgischen Komplizen in Empfang genommen worden waren. Selbst NS-Parteigenossen und Nutznießer des Regimes hätten vom lukrativen Judenhandel profitiert, denn die Schanzarbeiter am »Westwall« und die Bauarbeiter an der braunen Ordensburg »Vogelsang« hätten sich rege daran beteiligt, um ihr mageres Salär aufzubessern.
Damit sei es nun vorbei. Die Preise, die professionelle Schleuser inzwischen verlangten, hätten astronomische Höhen erreicht: Für eine Passage würden Kopfprämien von 1.000 bis zu 10.000 Reichsmark verlangt. Früher hätte man für einen Juden höchstens ein paar Hunderter gefordert. Nun würden die Flüchtlinge regelrecht ausgeplündert, ohne dass diese sicher sein konnten, dass die Schlepper ihre Versprechen hielten. Sie nähmen ihnen nicht nur ihr gesamtes Bargeld ab, sondern auch Schmuck, Uhren und sonstige Wertsachen. Das nenne man im Volksmund »den Hut rund gehen lassen«. Er warnte Rozenberg dringend davor, sich mit solchen Leuten einzulassen.
Der Viehhändler wirkte resigniert. Er sagte, seine Familie sei bereits »nach drüben abgehauen«, und er werde ihnen bald nachfolgen, denn es gebe hier für ihn kein Auskommen mehr, seitdem sie ihn aus der Metzgerinnung geworfen hätten. Er müsse noch ein paar Dinge regeln, dann werde er verschwinden.
Inzwischen war es Nacht geworden, und Mendel war bereits am Tisch eingeschlafen. Haas lud die Besucher ein, die Nacht bei ihm zu verbringen. Für eine Rückreise nach Aachen sei es eh zu spät. Auch sei es nicht ratsam, die Nacht auf dem Bahnhof zu verbringen, und die wenigen Pensionen und Hotels, die es im Ort gebe, würden wegen der Grenznähe von der Gestapo überwacht. Die Rozenbergs nahmen das Angebot dankbar an.
* * *
Niedergeschlagen trat Rozenberg am nächsten Morgen die Rückreise nach Aachen an. Als sie in der Pension eintrafen, fand er seine Frau völlig aufgelöst vor. Sie hatte sich große Sorgen gemacht, weil sie nicht wie versprochen am Abend zurückgekehrt waren. Umso glücklicher war sie, Vater und Sohn wohlbehalten in ihre Arme schließen zu können. Für die beiden Söhne waren solche Emotionen ein ungewohntes Schauspiel.
Die Mutter berichtete aufgeregt, dass sie während seiner Abwesenheit mit der Pensionswirtin aneinandergeraten sei. Die habe ihr auf den Kopf zugesagt, dass sie keine harmlosen Reisenden, sondern flüchtige Juden seien. Solcherlei dulde sie nicht in ihrem Haus. Sie habe mit der Polizei gedroht. Nach einigen Beschimpfungen habe sie ein überraschendes Angebot gemacht. Sie kenne da jemanden, der könne ihnen helfen über die Grenze zu kommen: wenn sie bereit wären, dafür den entsprechenden Preis zu zahlen! Obwohl Haas ausdrücklich vor solchen Judenfängern gewarnt hatte, beschlossen die Eltern, auf das Angebot einzugehen.
Am Abend fand sich der Schlepper in der Pension ein. Der Mann machte einen ungepflegten und gemeinen Eindruck. Rozenberg war auf der Hut und entschlossen, sich nicht über den Tisch ziehen zu lassen. Das Gespräch verlief in angespannter Atmosphäre. Während die Mutter dolmetschte, lauerte die Wirtin im Hintergrund.
Der Mann begann damit, die Gefahren an die Wand zu malen, die ihnen drohten, wenn sie sich ohne ortskundige Führer auf den Weg machen sollten. Die größte Gefahr ginge nicht von deutschen Zöllnern, sondern von belgischen Gendarmen aus. Wer sich von denen in der Grenzzone erwischen lasse, werde sofort ins Reich abgeschoben. Und sie wüssten ja, was ihnen dann blühte. Selbst, wenn sie es auf die andere Seite schaffen würden, wären sie noch nicht in Sicherheit. Die Bewohner der Grenzgebiete sympathisierten mit den Nationalsozialisten. Sie würden sie verraten und der Gendarmerie ausliefern.
Rozenberg war verunsichert: Von solchen Schwierigkeiten hatte der Viehhändler nichts berichtet. Er wollte den Schlepper auf die Probe stellen und fragte, wie er es denn anstellen werde, um sie unbemerkt über die Grenze zu bringen, wo doch alles hermetisch abgeriegelt sei. Der Schleuser lächelte maliziös, beugte sich vor und begann zu flüstern: Es gebe immer noch ein Schlupfloch an der Grenze, ein Nadelöhr, das weder die Deutschen noch die Belgier hätten schließen können. Ob sie jemals von der Vennbahn13 gehört hätten? Rozenberg horchte auf: eine Vennbahn? Was war damit?
Der Mann erläuterte, diese Bahnstrecke sei eine von den verrückten Sachen, die in Versailles ausgeheckt worden wären. Die Bahn stamme aus preußischer Zeit und führe quer durch die Eifel. Sie verbinde das Aachener Kohlerevier mit dem luxemburgischen Stahlrevier. Um den Deutschen zu schaden, habe man die Vennbahn zusammen mit den Kreisen Eupen und Malmedy Belgien zugesprochen.
Seitdem schlängele sie sich als belgische Staatsbahn wie ein Bandwurm fünfzig Kilometer weit durch deutsches Staatsgebiet. In den Zügen gebe es streckenweise kein deutsches Personal, da einige Bahnhöfe auf belgischem Hoheitsgebiet lägen. Wenn sie sich am Bahnhof in Aachen als Wanderer und Sommerfrischler ausgeben würden, würde niemand Verdacht schöpfen. Den Rest würde er besorgen.
Rozenberg witterte Morgenluft: Das war es! Er schlug die Warnungen des Viehhändlers in den Wind und fragte den Schlepper, was eine Passage kosten würde.
Alles hinge von der Höhe der Gage ab, sagte der süffisant: je höher das Honorar wäre, umso besser der Service. Manche Kunden habe er schon komfortabel mit dem Taxi über die Grenze chauffiert. Er schaute Rozenberg etwas herablassend an. Wie viel er denn zu investieren gedenke?
Der Metzger bot 1.000 Reichsmark an, für alle vier wohlgemerkt. Der Schlepper grinste abfällig, erhob sich und tat so, als wolle er den Raum verlassen. Da packte Rozenberg ihn beim Ärmel, drückte ihn wieder auf den Stuhl und sagte, er verdoppele das Angebot. Schließlich wurden beide sich bei 2.200 Reichsmark handelseinig: 600 RM pro Erwachsenen, 500 RM für jedes Kind. Hinzu kam eine Provision von 350 RM für die Wirtin. Das Honorar solle vor Antritt der Reise bar gezahlt werden.
Auf dem Zimmer berichteten die Eltern den Söhnen, die aufgeregt gewartet hatten, dass alles geregelt sei. Morgen Abend würde ein Mann sie über die Grenze bringen. Dann wären sie in Sicherheit.
Allerdings dämpften die Eltern die Freude der Jungen, indem sie mitteilten, der Schlepper habe verlangt, dass sie ihr gesamtes Gepäck zurücklassen müssten, um keinen Argwohn zu erregen. Die Wirtin habe sich angeboten, es in Verwahr zu nehmen, wobei die Mutter sich keine Illusion machte, dass sie je etwas wiedersehen würde. Joshua fürchtete schon, er müsse Roro zurücklassen, aber die Mutter beruhigte ihn, davon könne keine Rede sein. Der Vater bestand darauf, die Trompete mitzunehmen. Mendel musste sie in seinen Rucksack stecken und dafür seinen Metallbaukasten zurücklassen.
In der Nacht hatte es geregnet. Als sie sich auf dem Regionalbahnhof Aachen-Brand einfanden, trafen sie auf dem Bahnsteig auf eine Gruppe Wanderer, die angeblich genau wie sie selber die Eifel erkunden wollten. Alle schienen auf den gleichen Wanderführer zu warten. Auch die Rozenbergs wunderten sich, dass sie den Schleuser nicht sahen.
Schließlich stellte sich ihnen kurz vor der Abfahrt ein Mann vor, der vorgab, im Auftrag des Herrn Soundso zu kommen, der leider verhindert sei. Es sei aber alles geregelt: Wie besprochen seien die Eisenbahner, sowohl die deutschen wie die belgischen, eingeweiht und hätten ihre Provisionen schon kassiert. Niemand werde sie behelligen. Allerdings habe er Fahrscheine für die gesamte Strecke, also von Aachen bis nach Luxemburg, lösen müssen, und diesen Aufschlag müssten sie extra bezahlen.
Zähneknirschend fügte auch Rozenberg dem Geld, das er schon abgezählt in seiner Hosentasche hatte, noch einige Scheine hinzu. Ihm blutete das Herz, denn er wusste, dass es ihm für eine Geschäftsgründung fehlen würde. Nachdem der Mann diskret nachgezählt hatte, überreichte er die Fahrscheine und gab allen Anweisungen über den Verlauf ihrer anstehenden Reise.
In Monschau, an der 13. Haltestation, sollten sie aussteigen. Dort erwarte sie ein Kurier, der sie über die nahe Grenze bringen werde. Im Bewusstsein, dass sie einem Betrüger auf den Leim gegangen waren, bestiegen sie den Zug. Mendel schlug dem Vater vor, den Kerl bei der deutschen Polizei anzuzeigen, aber der meinte, das sei keine gute Idee.
Unterwegs gaben sie sich Mühe, wie harmlose Reisende zu wirken. Die Söhne spielten Karten, die Eltern blätterten in deutschen Zeitschriften. Mendel hatte sich bei dem Ausflug in die Eifel erkältet und hörte deshalb nicht auf zu husten und zu schniefen, was den Vater auf Dauer nervös machte. »Reiß dich zusammen«, fuhr er ihn an, »willst du unbedingt, dass wir auffallen?«
Aber die Sorge war unbegründet, denn auf der gesamten Strecke begegnete ihnen kein Schaffner. Aus dem Zug konnten sie beobachten, dass auf den Bahnhöfen, die sie passierten, abwechselnd deutsche Schutzpolizisten und belgische Zöllner patrouillierten und die aussteigenden Reisenden kontrollierten.
Die Landschaft, die an ihnen vorüber zog, veränderte sich zusehends: Heide- und Moorflächen lösten die Wiesenlandschaft ab. Die Sonne stand schon tief am Horizont, als sie die Haltestation Monschau erreichten.
Der kleine Bahnhof, der eine belgische Enklave in Deutschland bildete, lag oberhalb des Städtchens an einem Flachhang, der mit Ginster und Dornengestrüpp bewachsen war. Es gab ein Wartehäuschen, in dem sich eine größere Menschengruppe drängte. Alle waren sommerlich gekleidet, als ginge es auf einen Jahrmarkt oder in den Biergarten: Die Frauen trugen luftige Kleider, die Männer offene Hemden. Einige hatten Wanderstöcke dabei, trugen grüne Knickerbocker und Jägerhüte mit Gamsbart. Die Frauen hatten leichtes Schuhwerk an den Füßen, einige sogar Stöckelschuhe. Ein junges Paar hatte einen geflochtenen Picknickkorb dabei, der mit einem Küchentuch abgedeckt war und aus dem verdächtige Geräusche drangen, die sich als das Gequäke eines Säuglings entpuppten.
Nachdem man sich gegenseitig gemustert und festgestellt hatte, dass alle auf den gleichen Betrüger hereingefallen waren, beratschlagten sie gemeinsam, was zu tun sei.
Den meisten schien es ratsam, nicht länger zu verweilen, sondern sich alleine auf den Weg zu machen, weil sie sonst unweigerlich einer deutschen Zollstreife in die Hände fallen würden. Eine kleinere Gruppe wollte weiterhin an der Station ausharren, in der Hoffnung, dass der Kurier doch noch auftauchen werde. Da niemand eine Landkarte besaß, übergab die größere Gruppe die Führung einem jungen Mann, der behauptete, das Gelände zu kennen. Man brauche nur der Bahnlinie zu folgen und sich irgendwann nach Westen wenden.
Bei leichtem Nieselregen zogen sie los. Elsa Rozenberg nahm ihren Jüngsten bei der Hand und drückte seine Hand so fest, dass es Joshua wehtat. Sie ließ nicht zu, dass er sich auch nur einen Fußbreit von ihr entfernte. Immer wenn er zu straucheln drohte, fing sie ihn auf.
Bald begann es zu dunkeln, und die Flüchtlinge begannen auf den Gleisen zu torkeln. Öfter rutschten sie auf nassen Bahnschwellen aus und stolperten über den Schotter, wobei etliche sich blutige Knie und Ellbogen holten. Wer so unvorsichtig war und den Bahndamm verließ, riskierte die Böschung hinab zu rutschen und in einem Wassergraben zu landen. Vor allem für die Frauen mit ihrem schlechten Schuhwerk war der Marsch beschwerlich. Immer wieder mussten die Männer warten, damit Frauen und Kinder aufschließen konnten.
Der junge Mann führte sie an eine Stelle, wo die Bahnstrecke angeblich die Staatsgrenze bildete. Nun hieß es, über Wiesenzäune zu steigen und durch Büsche und Hecken zu kriechen. Jedes Mal, wenn ein verdächtiges Geräusch sie aufschreckte, suchten sie Deckung. Joshuas Mutter warf sich auf den Boden, zog Joshua zu sich herab. Sie drückte dabei sein Gesicht so tief ins Gras, sodass er kaum noch Luft bekam. Doch jedes Mal stammten die Geräusche nur von Rindern, die neugierig nachschauten, wer da mitten in der Nacht durch die Wiesen schlich. Zu ihrem Glück begegneten sie keiner Menschenseele.
Nach einer Weile stießen sie auf ein Ortschild mit einem deutschen Adler: »Gemeinde Mützenich – Kreis Monschau«. Sie waren im Kreis gelaufen. Erschrocken kehrten sie um und tasteten sich wieder durch das Gehölz, aus dem sie gerade gekommen waren. Schließlich gelangten sie über einen Karrenweg auf eine Lichtung.
Als die Wolkendecke kurz aufbrach, konnten sie im Mondlicht eine baumlose Ebene erkennen. »Schaut her, das ist das Hohe Venn«14, sagte der junge Mann: »es gehört schon zu Belgien. Wir haben es geschafft!« Alle fassten wieder Mut, auch wenn der Weg noch mühsamer wurde, als der Steig auf einmal aufhörte.
Joshua spürte, dass der Boden unter seinen Füßen zu wabbeln und zu schwabbeln begann. Hin und wieder federte irgendetwas seine Schritte ab, aber bald gluckste in seinen Schuhen das Wasser. Es ging nur noch durch Sumpf und Morast. Statt über Bahnschwellen stolperten sie nun über Grasbüschel. Sie wateten durch Pfützen und Rinnsale, die in Tümpeln und Wasserlöchern mündeten. Vom Regen völlig durchnässt schlotterten sie vor Kälte. Die kleinen Kinder begannen zu wimmern.
Sie waren am Ende ihrer Kräfte, als unverhofft die Umrisse eines Bauernhofes auftauchten. Einige Männer pirschten sich heran, um sich zu vergewissern, dass sie die Grenze passiert hatten und wirklich in Belgien waren. Als sie näher kamen, schlug ein Wachhund an. Im oberen Stockwerk ging ein Licht an, und ein Mann mit einem Gewehr spähte aus einem Fenster, um zu sehen, wer da in Nacht und Nebel Einlass begehrte.
Als er im Schein einer Petroleumlampe erkannte, dass es sich um Männer, Frauen und Kinder handelte, schloss er das Fenster, stieg die Treppe hinunter und bat die erschöpften Wanderer einzutreten. Er hatte offenbar erkannt, dass es sich um Flüchtlinge handelte, sprach das aber mit keinem Wort an. Er entschuldigte sich nur wegen der Flinte, mit der er ihnen gedroht hatte. Man könne in diesen schlechten Zeiten nicht vorsichtig genug sein. Es gebe genügend Strolche, die sich nachts in der Gegend herumtrieben.
Während er ein Feuer im Herd anzündete, kam eine Frau im Schlafrock hinzu und reichte den Frauen Handtücher und Decken für die Kinder. Für jedes Kind gab es einen Becher Milch. Bald strömte der Duft von echtem Bohnenkaffee durch die Stube, ein Genuss, den es in Deutschland schon lange nicht mehr gab.
Wie alle anderen waren auch Mendel, Joshua und Roro von dem Marsch sehr mitgenommen. Sie waren mehrmals hingefallen und hatten sich blutige Schrammen geholt. Unter Roros linken Arm war eine Naht geplatzt, sodass Stroh hervorquoll. Als die Mutter den bedauernswerten Zustand des Hasen sah, tröstete sie Joshua, indem sie versprach, die Blessuren mit ein paar Nadelstichen zu behandeln. Nach einem ordentlichen Bad in der Wanne werde Roro wieder ganz der Alte sein.
Der Bauer eröffnete ihnen, dass sie auf Reinhardshof seien, einem Weiler im Hohen Venn, der seit 1920 zu Belgien gehöre. Er bot ihnen an, sie in die nächste belgische Stadt zum Bahnhof zu geleiten. Von dort könnten sie problemlos ins Innere des Landes reisen. Ob dieser Ankündigung begann eine Frau vor Freude und Erleichterung heftig zu schluchzen. Sie wollte der Bäuerin die Hände küssen, was diese aber zu verhindern wusste. Was sie täten, sei selbstverständlich, sagte die Frau.
Die Bauersleute machten keinen Hehl aus ihrer Abneigung gegen die Nationalsozialisten. Der Bischof von Lüttich habe schon lange vor dem braunen Gesindel gewarnt, ereiferte sich der Hausherr. In Zeiten, da Deutschland von einem hergelaufenen Landstreicher und einer Bande gottloser Burschen regiert werde, würden sie allen helfen, die verfolgt würden – ganz egal um wen es sich handele.
Als sie am frühen Morgen loszogen, machte Joshua drei weitere Bauernhöfe in der Dämmerung aus. Mit der aufgehenden Sonne wurde es wärmer, und das Moor begann nach den starken Regenfällen der vergangenen Nacht wie eine Waschtrommel zu dampfen. Aus Furcht einer Zollstreife zu begegnen, führte der Bauer sie mitten durchs Moor. Als Wegweiser dienten ihm einige verwachsene Moorbirken und die eine oder andere windschiefe Eberesche. Als sich die Wasserrinnen zu einem Bachlauf sammelten, folgten sie diesem aus dem Sumpfland hinaus bis in dichte Fichtenwälder.
Nach einigen Stunden erreichten sie, ohne einer Menschenseele begegnet zu sein, eine Stadt, die am Saum des Hertogenwaldes lag. An staunenden Passanten vorbei zog die bunte Truppe schnurstracks zum Bahnhof. Dort verabschiedeten sich die Flüchtlinge von ihrem Führer. Als einige dem Bauern Geldscheine zustecken wollen, lehnte der energisch ab. Er habe nur seine Christenpflicht getan. Dann verschwand er, ohne seinen Namen zu hinterlassen.
* * *
Am frühen Abend erreichte die Familie Rozenberg Lüttich. Als die Jungen die vielen Lichter und Leuchtreklamen vor dem Bahnhof sahen, glaubten sie sich wirklich im »Gelobten Land«: Sie hatten es geschafft. Zur Feier des Tages leistete der Vater sich ein Taxi. Er winkte eine der Limousinen, einen Peugeot 402 L, herbei und bat den Chauffeur, sie in die Rue du Parc zu bringen. Als Mendel und Joshua über den breiten Boulevard d’Avroy fuhren, kamen sie sich wie Staatsgäste vor.
Die Familie Goldstein bewohnte ein solides geräumiges Haus in der Nähe des Parks de la Boverie. Der Empfang war überaus herzlich. Nachdem vor Wochen jeglicher Kontakt abgebrochen war, waren die Goldsteins in Sorge gewesen, ob den polnischen Verwandten die Flucht nach Belgien gelungen war. Mit seinem fusseligen Bart und den langen Schläfenlocken glich der Kantor den galizischen Juden, die Joshua aus Lodz kannte. Wie es die chassidische Tradition verlangte, trug auch Hanna, seine Angetraute, einen bodenlangen schwarzen Rock, eine hochgeschlossene Bluse und eine Perücke.
Nathan Goldstein und seine Frau boten ihnen unbegrenzte Gastfreundschaft an: Sie gehörten schließlich zur Familie und die »Mischpoche15« ist den Juden heilig. Sie sollten so lange bleiben, bis sie etwas Eigenes, Dauerhaftes gefunden hätten Rozenberg war dafür sehr dankbar, weil er wusste, dass ein fester Wohnsitz bei der Suche nach einem Domizil und bei Behördengängen, die anstanden, um ein Gewerbe zu eröffnen, hilfreich sein würde. Vorübergehend bezogen sie im ersten Stock des Hauses zwei Zimmer.
Nacheinander trudelten die Kinder des Kantors ein, die neugierig auf die ferne Verwandtschaft waren. Die Familienverhältnisse der Gastgeber waren für Außenstehende schwer zu durchschauen.
Aus Nathans erster Ehe stammten vier Kinder: Leewi, der älteste Sohn, war ein Hausierer, der von Haus zu Haus zog und mit Knöpfen, Reißverschlüssen und Garn handelte. Er war ein lebenslustiger Geselle und hatte ein ausgefallenes Hobby: er züchtete Kanarienvögel. Hirsch, der zweitälteste Sohn, war der Stolz des Vaters. Er studierte im vierten Semester Zahnmedizin an der Universität. Die Tochter Bad-Sebah war Verkäuferin in der Schuhabteilung eines großen Kaufhauses und mit Aaron Rubinstein, einem Grubenarbeiter, verlobt. Elias, der jüngste Sohn aus erster Ehe, den alle Fred nannten, ging noch zur Mittelschule. Fred war das Enfant terrible der Familie. Schließlich gab es noch aus Nathans zweiter Ehe mit Hanna Nejmann den vierjährigen Benjamin. Mit seiner Namenswahl hatten die Eltern dem Allerhöchsten signalisieren wollen, dass es nun genug sei mit dem Kindersegen.
Das Haus lag ganz in der Nähe der Synagoge. Mangels eines Rabbis leitete Goldstein als Chasan16 den Gottesdienst am Schabbat17. Schon Nathans Vater Noah, der vor der Jahrhundertwende aus Kongresspolen eingewandert war, hatte das Amt des Vorbeters ausgeübt. Damals versammelten sich die Lütticher Juden noch in Privathäusern. Die prächtige Synagoge in der Rue Léon-Frédericq war erst um die Jahrhundertwende auf einer Flussinsel erbaut worden. Als Joshua sie zum ersten Mal erblickte, war er überwältigt. Die Fassade, die orientalische und italienische Elemente in sich vereinte, erinnerte eher an ein verwunschenes Märchenschloss als an ein jüdisches Gebetshaus.
Nathan Goldstein, der wie sein Vater den Beruf eines Schusters ausübte, zeichnete sich durch besondere Frömmigkeit aus. Ohne größere Studien absolviert zu haben, verstand er es, die Thora so auszulegen, dass sie einen konkreten Bezug zum Alltag der Menschen hatte. Aber in der Auslegung der Heiligen Schriften war er unerbittlich. Von den Gläubigen wurde er respektvoll »Rabbi« genannt, was ihm nicht zustand, aber ihm sichtlich schmeichelte. Goldstein war nicht irgendein namenloser Chasan. Er hatte sich als Autor verschiedener Hymnen, die nicht nur in Lüttich sondern auch in anderen Synagogen übernommen wurden, einen Namen gemacht.
Die jüdische Gemeinde in Lüttich war klein und überschaubar. Die ersten Juden, die sich in der Maasmetropole niedergelassen hatten, stammten aus den Niederlanden. Nach dem Krieg war die Zahl der Gläubigen angewachsen, weil die Lütticher Hochschulen viele ausländische Studenten anzogen. Darunter waren etliche Juden aus Osteuropa und vom Balkan, die in ihren Heimatländern einem Numerus clausus unterlagen. Bei den Neuankömmlingen handelte es sich meist um säkulare und liberale Juden, deren religiöse Kultur minimal war. Insofern fristete die Lütticher Gemeinde weiterhin ein kümmerliches Dasein, bis immer mehr gläubige Juden aus Osteuropa einwanderten. Mit der Ankunft polnischer Juden stieg die Gemeinde sprunghaft auf 2.560 Mitglieder an.
In den ersten Jahren besuchte an hohen Festtagen ein Rabbi aus den Niederlanden die Gemeinde. 1938 erhielt Lüttich mit Efraim Dombrowicz endlich einen eigenen Rabbiner. Zu dessen Aufgaben zählte die Durchführung der vorgeschriebenen Rituale bei Beschneidung, Trauung und Beerdigung. Seine Ernennung war eine Erleichterung für die Gläubigen, da sie nun nicht mehr für jede größere Amtshandlung die Synagogen in Brüssel oder Antwerpen aufsuchen mussten.
Die Ankunft des Rabbis führte zu Reibereien mit dem Kantor, weil Nathan Goldstein sich in seinem Amt und seiner Autorität geschmälert sah. Anders als Goldstein hatte Dombrowicz in Polen eine Jewiche18 besucht und an dieser religiösen Hochschule die Thora19 und den Talmud20 studiert. Er schien daher eher dazu geeignet zu sein, eine Gemeinde zu leiten.
Damit musste der Kantor das angesehene Amt eines Vorbeters, das er bisher wahrgenommen hatte, abtreten und sich mit der Rolle eines Organisten und Vorsängers begnügen. Auch die Leitung des Cheders21, der Thoraschule, fiel nun in die Verantwortung des niederländischen Rabbis. Die Leitung eines Cheders war ein einträgliches Amt, denn die Eltern mussten für ihre Sprösslinge Schulgeld zahlen. Von seinen früheren Ämtern blieb Goldstein am Ende nur das eines Mohels22, eines Fachmanns für rituelle Beschneidungen, übrig.
Von einem Kantor durfte man nicht nur eine gute Stimme und eine gründliche Kenntnis der Liturgie erwarten, sondern auch eine repräsentative Frömmigkeit und ein einwandfreies Verhalten. Entsprechend hatten sich auch die Mitglieder seiner Familie aufzuführen. Ohne dies ausdrücklich auszusprechen, erwartete Nathan Goldstein, dass sich seine polnischen Gäste als fromme Juden gebärdeten. Er achtete darauf, dass die vorgeschriebenen Gebetszeiten von allen Hausgenossen eingehalten wurden. Besondere Aufmerksamkeit widmete er dem gemeinsamen Abendgebet am Vorabend des Schabbats.
Im Hause Goldstein tauchte Joshua in die chassidische Frömmigkeit ein, wobei der Kantor sich als strenger Lehrmeister und Joshua als gelehriger Schüler erwies. Anders als sein Bruder Mendel, der nie um eine Ausrede verlegen war, um sich vor einer Gebetsübung zu drücken, begleitete Joshua den Onkel öfter zum Schacharif23, dem Morgengebet, in die Synagoge. Wenn er morgens mit dem Kantor in seinem schwarzen Kaftan und dem Hut aus Zobelfell auf dem Kopf loszog, begegneten ihnen nirgends feindselige, sondern höchstens verwunderte Blicke. Nie gab es Beschimpfungen oder Anpöbelungen, wie Joshua es in Polen erlebt hatte.
In der Synagoge beobachtete Joshua, wie der Onkel den weißen Gebetsmantel anlegte und sich die Gebetsriemen um Arme und Stirn band, bevor er die Schriftrollen aus dem heiligen Schrein holte. In der Synagoge fanden sich morgens einige alte Männer ein, um mit dem Kantor die Psalmen, das Schma Jisrael24, und das Achtzehnbittengebet, das Schmone Esre, anzustimmen.
Wenn die Männer sangen, wippten sie mit dem Oberkörper hin und her, als wären sie angetrunken. Die Männer hielten Bücher mit Goldrand in ihren Händen. Joshua hätte sich gerne eines mit nach Hause genommen, aber Onkel Nathan meinte, dafür sei er noch zu klein, weil er noch nicht einmal lesen könne.
Der Onkel besaß eine warme Baritonstimme. Sein Gesang war sehr gefühlsbetont. Offenbar legte er wenig Wert auf die Bedeutung des gesungenen Liedes, denn viele Gesänge beschränkten sich auf ein einziges Wort oder einige Silben, die der Kantor manchmal bis zur Ekstase wiederholte. Die Geräusche, die er dabei ausstieß, erinnerten Joshua an das Gebrabbel und Glucksen von Säuglingen.
Als Joshua einmal nach dem Sinn dieser Übung fragte, belehrte der Onkel ihn, dass der Mensch sich dem Allmächtigen am ehesten nähern könne, wenn er seine Gebete als kindliches Gestammel vortrage. Das ständige Kopfnicken und das Schaukeln mit dem Oberkörper hülfen der Seele, das Alltägliche zu verdrängen und mit dem Allmächtigen eins zu werden.
Joshua war von dem, was er in der Synagoge hörte und sah, beeindruckt. Wenn er sich unbeobachtet glaubte, plapperte er einzelne Silben, die er in der Synagoge aufgeschnappt hatte, nach, wobei er nach Art frommer Juden mit dem Oberkörper schockelte25. Roro hielt das alles für Firlefanz. Er mochte den Kantor und seine aufgeblasene Sippe nicht und machte dies auch gegenüber Joshua deutlich: Als dieser ihn nach den Gründen fragte, sagte Roro, er habe eines Tages mitbekommen, wie der Schuster bei seiner Frau darüber lästerte, dass der jüngste Sohn des Metzgers ein unreines Tier als Schmusetier habe. Daran sähe man, wie es um die Frömmigkeit des Metzgers und seiner Familie bestellt sei.
* * *
Unterdessen war Ariel Rozenberg bemüht, eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten, was die Voraussetzung für die Eröffnung eines Gewerbes war. Da Nathan Goldstein, der die belgische Staatsangehörigkeit besaß, ihn als Schustergesellen eingetragen und ihm so ein Bleiberecht erwirkt hatte, konnte er sich bald auf die Suche nach einer passenden Immobilie machen.
Tagelang streifte er durch die Innenstadt und die Peripherie. Anders als in Polen wurden in Belgien Mietangebote, Hauskäufe und Geschäftsübergaben nicht über Inserate in Zeitungen oder Agenturen angeboten, sondern durch Aushänge an Türen und Fenstern. Wenn Rozenberg ein interessantes Objekt entdeckte, schob er einen Brief in den Briefkasten, der sein Anliegen erklärte, in der Hoffnung, dass man darauf reagierte.
Die wirtschaftliche Situation war für Geschäftsgründungen nicht gerade günstig. Im Gefolge der Weltwirtschaftskrise von 1929 war die Arbeitslosigkeit innerhalb weniger Jahre drastisch angestiegen: von 15.000 Arbeitssuchenden auf 213.000. Gleichzeitig sanken die Löhne. In den 30er Jahren verdiente ein Arbeiter weniger als sein Vater oder Großvater. Im Lütticher Kohlerevier mussten sogar einige Zechen schließen. Gleichzeitig wurden moderne Kokereien eingeführt, die weniger Personal erforderten, was wiederum zu erbitterten Streiks führte.
Eines Tages entdeckte Rozenberg im Lütticher Vorort Seraing in der Rue du Buisson ein Aushängeschild für eine Geschäftsübergabe. Es handelte sich um eine Pferdemetzgerei. Da er der Landessprache noch nicht mächtig war, nahm er am nächsten Tag Mendel mit, um mit dem Inhaber zu verhandeln. Der Betreiber sagte, er wolle sich zur Ruhe setzen und sein Geschäft übergeben. Der Verkauf von Pferdefleisch sei nämlich stark zurückgegangen.
Die Schuld daran gab er den Briten, die im Krieg in Belgien gekämpft hatten. Sie wären ausgesprochene Pferdenarren gewesen und hätten es nicht ertragen, dass solch edle Geschöpfe in die Kochtöpfe wanderten. Die hiesigen Essgewohnheiten hätten sie als Kannibalismus bezeichnet. Mit der Zeit habe die Polemik Wirkung gezeigt. Seit dem Krieg schien das süßlich bis säuerlich schmeckende Fleisch, das doch so nahrhaft sei, selbst den Gruben- und Stahlarbeitern, die nicht wählerisch waren, nicht mehr zu munden.
Der Standort der Metzgerei kam Rozenberg gelegen, denn Seraing lag zehn Kilometer vor den Toren Lüttichs und bedeutete eine räumliche Distanz zu seinem aufdringlichen und übermächtigen Vetter. Seraing zählte 60.000 Einwohner, darunter viele italienische und polnische Gastarbeiter. Ihre Bewohner nannten ihre Stadt kurz und knapp »Srè«. Dieses »Srää« war keine schöne Stadt, denn selbst im Ortskern gab es Schmelzöfen und Fabrikhallen. Jedes Viertel führte ein Eigenleben, hatte einen eigenen Marktplatz und eine Geschäftsstraße. Die Rue du Buisson lag in einem Viertel, das im Volksmund Quartier Verrière hieß, weil dort viele Glasmacher lebten, die in der Kristallerie du Val St-Lambert arbeiteten.
Die Stadt Seraing war weit über Belgien hinaus ein Begriff, denn hier stand die Wiege der industriellen Revolution auf dem Kontinent. Am Rathaus hatte man eine Tafel angebracht mit einem Ausspruch des Schriftstellers Victor Hugo, der während seines Exils aus Frankreich die Stadt besucht hatte. »In Seraing stehen die Kathedralen der Neuzeit«, stand auf der Tafel. Der englische Industriepionier John Cockerill hatte im vorigen Jahrhundert das frühere Sommerschloss der Fürstbischöfe erworben und es in eine Eisenhütte verwandelt. Später kamen ein Stahl- und ein Walzwerk, eine Kesselschmiede sowie eine Maschinenfabrik hinzu. In Seraing wurden die allerersten Lokomotiven Europas gebaut.
Rozenberg wurde sich mit dem Ladeninhaber handelseinig. Im September 1936 kaufte er das Reihenhaus mitsamt seiner Einrichtung. Den Kaufakt tätigten Käufer und Verkäufer in einer Lütticher Kanzlei, die einem Notar Van den Berg gehörte. Da es ihm an Kapital mangelte, sah Rozenberg sich genötigt, für den Hauskauf einen Kredit aufzunehmen, was nur möglich war, weil Nathan Goldstein bereit war, für ihn zu bürgen.
Den Kredit nahm Rozenberg bei der Privatbank Nagelmackers auf. Nathan Goldstein, der kein ungebildeter Mensch war, klärte seinen polnischen Vetter darüber auf, dass diese Bank nicht irgendeine Bank sei sondern etwas Besonderes. Sie stamme aus dem Jahre 1747. Die Familie Nagelmackers zähle in ihren Reihen bedeutende Bankiers und Politiker und Pioniere des Eisenbahnbaus, die einen weltweiten Ruf genössen.
Der Lütticher Filialleiter hieß Jean-François Stevens und war – wie Goldstein nicht ohne Stolz vermerkte – mit einem seiner Söhne befreundet. Da er fließend Deutsch spreche, würden viele Israeliten, zu seinen Kunden zählen. Wie Rozenberg es mit Siegmund Meyer vereinbart hatte, richtete der Metzger neben seinem laufenden auch ein Sperrkonto ein, auf das er die monatlichen Raten für das bei ihm geliehene Geld einbezahlte.
Das Reihenhaus war um die Jahrhundertwende erbaut worden. Im Erdgeschoss war neben der Haustüre ein großes Schaufenster. Hinter dem Metzgerladen befanden sich die eigentliche Schlachterei und ein Vorratsraum. Im Obergeschoss gab es drei Zimmer und im Dachgeschoss zwei weitere Kammern. Das Haus war mit allem Komfort ausgestattet. Anders als in dem Mietshaus, das sie in Lodz bewohnt hatten, wo es nur einen Wasserkran im Flur gegeben hatte, verfügten alle Schlafzimmer über fließendes Wasser. Statt eines Plumpsklos im Hof gab es auf halber Treppe zwischen Erd- und Obergeschoss in einem Erker ein Wasserklosett. Es schwebte wie ein Schwalbennest über dem Innenhof. Auf dem stillen Örtchen war es recht gemütlich und Joshua verbrachte dort viel Zeit, vor allem wenn er sich vor häuslichen Arbeiten drücken wollte.
Das Höfchen wurde bald zu Mendels und Joshuas bevorzugtem Spielplatz. Hier konnten sie ungestört mit ihren Zinnsoldaten spielen oder in einem vom Vater gebastelten Holzkasten Sandburgen bauen, ohne dass die Nachbarn Einblick hatten. Joshua kam eines Tages auf die Idee, dort ein Terrarium einzurichten. Bald sammelte er in der Umgebung alles, was da kreucht und fleucht.
In seinem Privatzoo gab es Raupen, Regenwürmer, Schmetterlinge, Heuschrecken, Blattläuse, Marienkäfer und andere Insekten. Als Käfige dienten alte Einmachgläser, die ihm die Mutter überlassen hatte. Joshua fütterte sie mit Gras und Blattwerk. Er verbrachte viele Stunden damit, das Treiben der Tierchen zu beobachten, sodass sein Bruder ihn spöttisch nach einem berühmten Naturforscher Professor Joshua Picard nannte.
Wie in der alten Heimat herrschte auch in der neuen eine klare Arbeitstrennung zwischen Vater und Mutter. Während Ariel Rozenberg seinen Geschäften nachging, schaltete und waltete seine Frau Elsa im Hause nach Gutdünken. Ihr oblag die Erziehung der Söhne. Ariels Verhältnis zu seinen Söhnen war eher pragmatischer Natur. So gut wie möglich ging man sich gegenseitig aus dem Weg.
Das einzige private Vergnügen, das der Vater sich gönnte, war das Trompete blasen. Das Instrument hatte er gegen alle Widerwärtigkeiten bis nach Belgien gebracht. Nachdem er eine Weile alleine gespielt hatte, spürte er das Verlangen einer Blaskapelle beizutreten. Da es für ihn undenkbar war, bei einer Kapelle, die unter der Fahne der katholischen Kirche auftrat, mitzumachen, trat er schließlich der Harmonie »Polonia« bei, obwohl die meisten Mitglieder überzeugte Kommunisten und Trotzkisten waren.
Beim Einzug ins neue Heim überraschte Rozenberg die Familie mit einem Röhrenradio. Das Rundfunkgerät erhielt einen Ehrenplatz auf der Nähmaschine in der Wohnküche, die Leewi Goldstein der Mutter günstig auf dem Schwarzmarkt besorgt hatte. Die Mutter häkelte ein Deckchen und stellte rund um das Radio Familienfotos und zwei Blumentöpfchen auf, sodass alles wie ein kleiner Hausaltar aussah. Von nun an war man über Kurzwelle mit der weiten Welt verbunden. Am Sonntagabend gab es im Radio die Sportresultate, die am Montag in der Schule eifrig kommentiert wurden.
* * *
Die ersten Jahre in Belgien waren glücklich und unbeschwert. 1937 wurde Joshua eingeschult. Die Gemeindeschule war nach dem Pädagogen und Lokalpolitiker Léon Deleval benannt und lag in der gleichnamigen Straße. Als sich der erste Schultag näherte, versuchte die Mutter, ihm klarzumachen, dass er nun ein großer Junge sei und es an der Zeit wäre, sich von seinem Spielkameraden zu verabschieden. Bisher hatte sie geduldet, dass er sein Stofftier überall mitnahm und wie ein Lebewesen behandelte. Nun sei es an der Zeit, solche Kindereien abzulegen. Auf keinen Fall dürfe Roro mit in die Schule. Das schicke sich nicht.
Joshua wollte davon nichts hören. Gegen den Rat der Mutter schmuggelte er den Hasen in seinem Schulranzen ins Klassenzimmer. Als Schulkameraden ihn entdeckten, gab es Schmähungen und sogar Handgreiflichkeiten, sodass Joshua um Roros Leben fürchten musste. Danach hielt er es für klüger, ihn daheim zu lassen.
Während Joshua das Einmaleins und das Alphabet lernte, saß Roro mürrisch und untätig daheim. Abends beschwerte er sich bei Joshua, dass er sich langweile und aus dem Radio den ganzen Tag über Schlager und Schnulzen von Luis Mariano, Toni Rossi oder Ray Ventura anhören müsse, von denen Joshuas Mutter nicht genug bekam. Joshua schlussfolgerte daraus, dass Roro wissbegierig war. Um ihn zu beschäftigen, gab er ihm Papier und Malstifte, damit er sich zerstreuen konnte. Nach Schulschluss schaute Roro Joshua bei den Hausaufgaben über die Schultern. Auffallend war, dass er ständig an Klugheit und Verstand zunahm.
Die ersten Wochen waren für die Brüder Rozenberg schwierig, weil sie daheim nur Jiddisch sprachen, in der Schule aber Französisch und auf dem Pausenhof Wallonisch gesprochen wurde. Aber anders als in Polen, wo sie als Juden auf die hinteren Schulbänke verbannt und von den Lehrern weitgehend ignoriert worden waren, waren sie hier willkommen. In der Masse der Einwanderer und Wanderarbeiter fielen sie nicht auf. Antisemitismus gab es in Wallonien schon deswegen nicht, weil es kaum Juden gab. Die einzigen Kinder, die auf dem Schulhof gehänselt wurden, waren kleine Flamen, die als »dumme Bauerntrampel« beschimpft wurden und es daher vorzogen, auf dem Schulhof unter sich zu bleiben.
Mendel entwickelte sich zum Klassenprimus. Der Schulträger entsandte ihn als seinen Vertreter auf interschulische Wettbewerbe, von denen er meist mit einem Preis, etwa mit einem Lexikon oder einem Globus zurückkehrte. Die wurden von der Mutter auf einem Regal in der Wohnküche ausgestellt. Joshua bewunderte seinen Bruder grenzenlos, weil ihm das Lernen so leicht fiel. Mendel hatte eine ruhige Art, die Respekt einflößte, was ihn unter seinesgleichen als natürlicher Anführer empfahl. Für Joshua war er ein unerreichbares Vorbild. Dabei hatte er selber auch gute Schulleistungen vorzuweisen. Bezüglich seiner Zensuren lag er im oberen Mittelfeld.
Zur Belohnung für ihr gutes Zeugnis durften die Söhne sich zum Jahresende in einer Buchhandlung ein Buch aussuchen. Joshua entdeckte ein Märchenbuch mit schönen Bildern, das von einer Hasenschule handelte. Darin waren putzige Langohren abgebildet, die sich wie Menschen benahmen. Die Hasenkinder hatten ein hübsches Zuhause und gingen morgens zur Schule auf eine Waldlichtung. Wie andere Kinder spielten und rauften sie und trieben allerlei Schabernack. Wie im echten Leben wurden sie zur Bestrafung in eine Ecke gestellt, wo ihnen Schulmeister Lampe die Ohren langzog.
Als Roro das Buch sah, war er begeistert. Immer wieder schaute er sich die bunten Bilder mit den hübschen Häschen an. Da die Mutter ihnen abends im Bett Geschichten aus dem Hasenbuch vorlas, konnten sie vieles auswendig aufsagen. Vor allem die gruseligen Verse mit dem Fuchs waren Roro im Gedächtnis geblieben, weil Joshua sie gerne benutzte, um ihm Angst zu machen: »Von dem alten Fuchs, dem bösen, wird erzählt und vorgelesen, wie er leise, husch, husch, husch, schleicht durch Wiese, Feld und Busch.«
Ein Kapitel handelte vom Osterhasen. Es bestätigte Roros Annahme, dass der Feldhase nicht nur eine noble Herkunft, sondern auch eine besondere Bestimmung hatte. Das habe, so erklärte Joshuas Mutter, mit dem Osterfest zu tun. Bis dahin hatte Joshua wie alle polnischen Kinder geglaubt, dass der Storch es war, der den Kindern bemalte Eier in vorbereitete Nester legte. In Belgien erzählte man sich hingegen, dass die Kirchenglocken am Karfreitag nach Rom zögen und am Ostersonntag schwer beladen mit Ostereiern zurückkehrten. Nun stand in dem Buch aber schwarz auf weiß, dass es die Hasen waren, die sich die Eier in den Hühnerställen besorgten, sie bunt bemalten und im Gras versteckten.
Das Häschenbuch hatte unerwartete Folgen. Roro beschloss, es den putzigen Häschen gleichzutun und sich weiterzubilden. Da es in der Nachbarschaft keine eigene Hasenschule gab, beschloss er, sich Lesen, Schreiben und Rechnen im Selbststudium anzueignen. Joshua war etwas überrascht, welch seltsame Wünsche sein Plüschhase äußerte, war dann aber sichtlich stolz auf den Wissensdurst seines Spielkameraden und besorgte ihm das nötige Lehrmaterial.
Roro hatte nun keine Langeweile mehr, denn er studierte ununterbrochen. Er wollte das Alphabet beherrschen, um in dem Heft, das Joshua ihm gegeben hatte, seine Gedanken und Beobachtungen für die Nachwelt aufzuzeichnen. Da die meisten Menschen ihn nicht beachteten, schnappte er viele Bemerkungen auf, die die Gesprächspartner lieber für sich behalten oder zumindest gerne vertraulich behandelt gesehen hätten. Er würde sich kleine Notizen anfertigen. Die sollten ihm helfen, eines Tages seine eigene Biografie zu schreiben.
Im Laufe des dritten Schuljahres wurde Joshua mit der großen Geschichte seiner neuen Heimat vertraut gemacht. Er erfuhr, dass »die Belgier die tapfersten aller Gallier sind«. Das hatte schon Julius Cäsar erkannt, als er den Stamm die Eburonen und ihren Anführer Ambiorix, der einen großen Aufstand gegen die Römer angezettelt hatte, geschlagen hatte. Joshua kannte diesen Ambiorix, denn er war auf dem Karton eines Markenschuhs abgebildet, den Onkel Nathan in seinem Lädchen verkaufte.
Nachdem die Römer irgendwann verschwunden und die Franken gekommen waren, wurde Kaiser Karl der Große geboren. Das war ganz in ihrer Nähe von Lüttich in Herstal passiert. Leider gab es dort keine Spuren mehr von Charlemagne, vermutlich weil an seiner Geburtsstätte nun ein Hochofen stand.
Im Jahre 1099 zog Gottfried von Bouillon in den Ersten Kreuzzug. Nach der Eroberung der Heiligen Stadt wurde er von den Kreuzrittern wegen seiner Tapferkeit zum König von Jerusalem ausgerufen, lehnte aber die Königswürde ab. Nach der Schlacht der Goldenen Sporen im Jahre 1302, als ein belgisches Bauernheer die Blüte der französischen Ritterschaft niedermachte, ging es im Unterricht im Galopp weiter durch vier bis fünf Jahrhunderte, wobei unklar blieb, was die wechselnden fremden Landesherren in Belgien eigentlich verloren hatten.
Im Jahr 1830 erkämpften die Belgier sich ihre Unabhängigkeit von den Holländern. Unter König Leopold II. eroberten sie im Herzen Afrikas ein Kolonialreich, das 80-mal größer als das Mutterland war. Die angeborene Tapferkeit der Belgier hatte die Welt zuletzt 1914 in Staunen versetzt, als ihre Armee sich hinter gebrochenen Deichen verschanzte und diesen Flecken Vaterland vier Jahre lang heldenhaft verteidigte. Joshua war stolz darauf, Belgier zu sein.
Daheim verbrachten Joshua und Roro viele Stunden vor dem Rundfunkempfänger. Es gab zwei Höhepunkte im Wochenprogramm. Mittwochs gab es ein Hörspiel, das sich bis spät in die Nacht hinzog, was öfter zu Streit mit der Mutter führte, die darauf achtete, dass die Jungen rechtzeitig ins Bett kamen. Joshuas Lieblingssendung waren aber die »Schönen Stimmen« an jedem zweiten Freitag. Wenn Joshua das Radio lauter stellte, um besser zu hören, gab es Ärger mit den anderen Familienmitgliedern, weil die sich gestört fühlten.
Danach versuchte Joshua die eine oder andere Arie nachzusingen. Am ehesten war das auf der Toilette möglich, weil man da ungestört war. Eines Tages ertappte ihn ein Aufseher auf dem Schulhof dabei, wie er einige Takte aus dem Sklavenchor von Verdi schmetterte, was ihm unter den Klassenkameraden den Nimbus eines »polnischen Caruso« einbrachte.
Während ihre Eltern sich schwer taten mit der fremden Sprache und der neuen Umgebung, fanden Mendel und Joshua rasch Anschluss. Sie freundeten sich mit den Kindern in der Nachbarschaft an, beteiligten sich an allerlei Kinderstreichen. Einer bestand darin, Laubfrösche einzufangen, sie in trockenes Gras oder Gestrüpp zu setzen, dieses anzuzünden und nachzusehen, wer von ihnen überlebt hatte. Ein anderes Spiel bestand daraus, junge Katzen einzufangen und sie in einen Sack zu stecken, den sie in die Maas warfen, um zu sehen, wie lange sie im Wasserstrudel um ihr Leben kämpfen würden.
Als Joshua davon erzählte, war der Hase empört, denn Frösche und Katzen waren in seiner frühen Kindheit, die er im Schaufenster eines Spielwarengeschäfts verbracht hatte, seine liebsten Spielkameraden gewesen. Er sagte, er schäme sich für Joshua, dass er sich an solchen Schandtaten beteilige und es würde ihn nicht wundern, wenn er eines Tages auch ihn aufspießen und an einem Lagerfeuer braten würde.
Nach dieser heftigen Auseinandersetzung beschloss Joshua, Roro nur noch solche Sachen zu erzählen, von denen er annahm, dass sie ihm gefallen würden.
Auf der Straße herrschte ein rauer Umgangston. Die Jungen beschimpften sich gegenseitig als Korinthenkacker oder Fliegenfotze. Mit jedem neuen Schimpfwort, das sie lernten, verschafften sich die Rozenbergs unter Ihresgleichen etwas mehr Respekt. Ein beliebter Zeitvertreib war das Schwarzfahren mit der Straßenbahn. Die Jungen mischten sich an den Haltestellen unter die Wartenden oder sie sprangen auf die Trittbretter auf, wenn die Tram in einer Kurve ihr Tempo drosseln musste. Joshua und Mendel liebten es, wenn es bergab und in die Kurven ging und der Fahrtwind ihnen um die Ohren pfiff. Einige Schaffner ließen sie gewähren, aber andere drohten ihnen die schlimmsten Strafen an.
In Stoßzeiten, wenn die Stahlkocher und Bergleute von der Schicht nach Hause fuhren, fielen sie im Gedränge weniger auf. Die Proletarier saßen eng zusammen im hinteren Teil der Straßenbahn, während im vorderen gegen einen Aufpreis die Damen und Herren der besseren Gesellschaft Platz nahmen. Hinten roch es nach Schweiß und Rauch, weil ununterbrochen geraucht und auf den Boden gerotzt wurde, obwohl das verboten war. Einmal schenkte ein Schaffner ihnen das schwarze Kartenbrett, als es leer war und alle Fahrscheine abgerissen waren. Solche Bretter waren auf dem Schulhof sehr begehrt und wurden hoch gehandelt.
Ohne dass die Eltern es ahnten, schlossen Mendel und Joshua sich einer Kinderbande an. In jedem Viertel von Seraing gab es eine solche Gang. In ihrem Viertel waren es die Sioux. Die Sioux trieben sich meistens auf dem Gelände einer stillgelegten Ziegelei herum. Dort hatten sie ihr Hauptquartier, Pow-Wow genannt.
Der Anführer, ein bulliger Typ, nannte sich Donnernder Büffel und war wegen seiner Brutalität gefürchtet. Er war Herr über Leben und Tod. Wer sich gegen ihn auflehnte, der wurde aus dem Stamm ausgestoßen. Das Gesetz der Sioux verlangte, dass der Häuptling seine überragende Stellung jedes Jahr aufs Neue durch einen Boxkampf behauptete. Doch dieses Ritual wurde nicht mehr praktiziert, denn nachdem einige Jungen dabei ordentlich Prügel bezogen hatten, wagte keiner mehr, gegen den Dicken anzutreten.
Um in den Stamm der Sioux aufgenommen zu werden, musste Joshua eine Mutprobe bestehen. Sie bestand darin, dass er in einem Krämerladen um die Ecke etwas stehlen sollte, was mindestens zwei Franken kostete. Eine gefährliche Operation. Nachdem er die Prüfung bestanden hatte, musste er dem Donnernden Büffel Gehorsam und seinen Blutsbrüdern ewige Treue schwören. Dazu musste er sich mit der Faust auf die Brust klopfen und »ugh, ugh« rufen und danach, ohne einen Muckser von sich zu geben, ertragen, wie der Medizinmann ihm mit einem Messer in den Unterarm schnitt, bis das Blut triefte. Das Blut wurde in einem Becher aufgefangen, mit Wasser vermischt und allen zum Trunk gereicht. Damit war Joshua in den Stamm aufgenommen. Von nun an durfte er sich »Kleine Sturmwolke« nennen.
Von allen Straßengangs in Srää waren die Comanchen die berüchtigtsten. Da ihr Revier genau auf Mendels und Joshuas Schulweg lag, mussten sie öfter Umwege machen, aus Furcht, unterwegs ihren Erzfeinden zu begegnen.
Die Jugendbanden veranstalteten manchmal Wettkämpfe, um die Rangordnung zu bestimmen. Zu verabredeter Zeit bewarfen sie sich je nach Jahreszeit mit Kieselsteinen, Kartoffeln oder Kastanien, bis der Sieger feststand und der Unterlegene um Gnade bat. Voller Stolz zeigte Joshua Roro die Blessuren, die er bei solchen Schlachten davongetragen hatte.
Die unterlegene Gang musste den Siegern eine Geisel stellen, die an einen Marterpfahl gefesselt und so lange mit scharf gespitzten Stöckchen gepikst wurde, bis sie um Gnade winselte. Nach einer verlorenen Schlacht wurde Mendel vom Donnernden Büffel als Geisel bestimmt. Das wurde ihm nachher hoch angerechnet, denn er stieg in der Hackordnung des Stammes gleich um mehrere Ränge auf.
Weniger ruhmreich war seine Heimkehr. Als er in übler Verfassung und mit zerrissener Hose zu Hause auftauchte und keine plausible Erklärung abgeben konnte, verabreichte ihm der Vater zur Strafe eine zusätzliche Tracht Prügel.
* * *
Dank der Dokumente, die Rozenberg aus Polen mitgebracht hatte und die er von einem vereidigten Dolmetscher hatte übersetzen und beglaubigen lassen, erhielt er die Anerkennung als Schlachter durch die Lütticher Metzgerinnung. Nathan Goldstein trat wiederum als Bürge auf. Ein feierlicher Augenblick kam, als Rozenberg an der Metzgerei das Schild »boucherie chevaline« abmontierte und durch ein neues mit der Inschrift »boucherie belgo-polonaise« ersetzte: In kleinerer Schrift stand darunter: Inhaber Ariel Rozenberg. Nun war es für alle ersichtlich, dass sie im Gelobten Land angekommen waren.
Kaum im Geschäft musste Rozenberg feststellen, dass er sich den örtlichen Essensgewohnheiten anpassen musste, wenn er überleben wollte. Dass der Verzehr von Pferdefleisch rückläufig war, wusste er bereits. Aber anders als in Lodz, wo es viele strenggläubige Juden gab, die nach koscherem Fleisch verlangten, gab es deren in Lüttich und Umgebung nur eine Handvoll. Die wenigen Rechtgläubigen, die die Speisegebote beachteten, hatten die finanziellen Mittel, um sich in Brüssel oder Antwerpen Fleischwaren, die den Kaschrut26-Vorschriften entsprachen, zu besorgen. Rozenberg musste sein Warenangebot den Wünschen der Kundschaft anpassen.
Bei den ortsansässigen Wallonen, den flämischen Tagelöhnern und seinen polnischen Landsleuten stand das Hausschwein ganz oben auf dem Speisezettel. Das bedeutete, dass er vor allem treifes, nach jüdischen Vorstellungen unreines Fleisch anbieten musste. In der »boucherie belgo-polonaise« gab es neben Pferde- und Rinderfleisch bald auch Schweinefleisch in allen Variationen: Schweinshaxen, Schweinsohren und Bratwürste, den Römerbraten und polnische Delikatessen wie geschmorte Schweineleber und Schweinerippchen eingelegt in Honig.
Anfangs bot Rozenberg in einer separaten Theke noch koscheres Fleisch an. Da dies von der Kundschaft nicht honoriert wurde, stellte er das Angebot bald ein. Fortan gab es solche Ware nur noch auf Bestellung oder zu hohen jüdischen Feiertagen. Die erforderlichen Schächtungen führte Rozenberg an der belgischen Gesundheitsbehörde vorbei im Innenhof seines Hauses durch.
Mit dem Angebot von Schweinefleisch, dass Rozenberg zu Roros Empörung an Feiertagen um Kaninchen und Tauben erweiterte, verbesserte sich seine finanzielle Situation zusehends. Zumindest reichte es, um die Schulden bei der Bank und dem deutschen Vetter abzustottern.
Während im Hause Goldstein am Sabbat Grabesruhe herrschte, war in der »Boucherie belgo-polonaise« am Samstag reger Betrieb. Als der Kantor vernahm, dass der Vetter seinen Laden am Sabbat offen hielt und die Dreistigkeit hatte, unreines Fleisch anzubieten, dachte er anfangs, Rozenberg sei meschugge27 geworden. Er machte ihm bittere Vorwürfe und nannte ihn einen Chammer, einen dummen Esel. Er sagte, er solle sich schämen, um des schnöden Mammons willen die Gesetze Israels und die Vorschriften der Thora zu missachten. Er appellierte an seine Selbstachtung und erinnerte ihn daran, dass er »a jiddischen Kopp« habe.
Als das alles nichts half, sagte er ihm in Anwesenheit seiner Frau und seiner Söhne ins Gesicht, er führe sich auf wie ein Goy28. Joshua wusste nicht, was das war. Mendel erklärte ihm, das sei das hebräische Wort für »Heuschrecke!«. Es sei das schlimmste Schimpfwort, das es gebe, und gelte für Menschen, die ein lasterhaftes und törichtes Leben führten.
Auf die Vorwürfe des Kantors erwiderte Rozenberg, er könne es sich nicht leisten, seine Kundschaft zu verprellen, wenn er überleben wolle. Die meisten Arbeiter könnten sich nur einmal die Woche einen Braten leisten, und das sei eben der Schweinsbraten am Sonntag. Er versuchte, den Vetter milde zu stimmen, indem er darauf hinwies, dass sie daheim durchaus die Speisevorschriften Moses beachteten und seine Frau am Sabbat, wenn er in seinem Laden und die Jungen in der Schule wären, das kleine Oratorium in Seraing in der Rue du Marais aufsuche. Das alles ließ der Kantor nicht gelten. Er drohte mit dem Entzug der Bürgschaft, aber Rozenberg wusste, dass das nur eine leere Drohung war.
Dass sie samstags in die Schule mussten, gefiel den Jungen. Der Besuch der Synagoge hätte bedeutet, dass sie ihre besten Klamotten anziehen mussten, was wiederum zur Folge gehabt hätte, dass andere Unternehmungen am Nachmittag nicht infrage kämen. Das einzig Erfreuliche am Sabbat war das gute Essen am Vorabend. Die Mutter legte dann eine weiße Tischdecke auf und holte das beste Geschirr aus dem Schrank. Nachdem der Vater den siebenarmigen Leuchter angezündet und den Kiddusch, den traditionellen Segensspruch, gesprochen hatte, gab es gewöhnlich Tscholent, ein leckeres Eintopfgericht mit Fleisch, Bohnen, Graupen und Kartoffeln. Die Mutter bereitete es schon am Donnerstag vor, weil es mehrere Stunden bei geringer Hitze garen musste.
An hohen Feiertagen wie an Neujahr oder am Versöhnungstag besuchten alle gemeinsam die Synagoge – auch auf die Gefahr hin, dass der Kantor nachher mit dem Vater wieder Tacheles29 reden würde. Nicht nur an seinen Geschäften, sondern auch an der Erziehung seiner Kinder störte sich der fromme Vetter. Er warf Ariel vor, seine Söhne sähe man nur selten im Cheder zum Studium der Thora. Er sei mit seinen Söhnen viel strenger verfahren. Der Metzger war versucht zu erwidern, davon sei nicht mehr viel zu spüren, wenn er beispielsweise an den vorlauten Fred denke, der nicht eben ein Muster von Frömmigkeit sei. Aber er unterließ es, weil er den Streit nicht auf die Spitze treiben wollte.
Die Streitereien belasteten Joshua, weil er öfter zu hören bekam, dass derjenige, der die Gebote Moses nicht befolgte, mit Höllenfeuer bestraft würde. In seiner Fantasie sah er den Vater schon in Gehinnom, in der jüdischen Hölle, schmoren. In den Cheder gingen sie nur selten. Joshua hatte die Talmud- und Thoraschule auch deshalb in schlechter Erinnerung, weil man dort nichts Nützliches und Vernünftiges lernte. Die meiste Zeit verbrachten sie damit, die lange Liste der Gebote Gottes aus den Sieben Büchern Mose auswendig zu lernen. Es gab deren 613: 248 Gebote und 365 Verbote. Während Mendel auf Anfrage die wichtigsten auflisten konnte, tat Joshua sich unendlich schwer damit.
Trotz der unablässigen Kritik Goldsteins änderte Rozenberg nichts an seinem Geschäftsgebaren. Als der Kantor eines Tages wieder zu einer seiner üblichen Tiraden ausholte, riss dem Metzger der Geduldsfaden. Er sagte ihm, er solle sich nicht so aufspielen und es unterlassen, anderen ständig die Moral zu predigen. Er solle sich lieber an die eigene Nase fassen. Das Schusterhandwerk, das er betreibe, sei auch nicht gerade koscher. Denn wer totes tierisches Material verarbeite, stünde in der Gemeinde nicht unbedingt in hohem Ansehen. Nach diesem Schlagabtausch wurde der Kantor ziemlich kleinlaut und unterließ für einige Zeit seine Attacken.
Am Sonntag, wenn die Metzgerei geschlossen blieb, machte die Familie einen Spaziergang, der meist entlang der Maas führte. Er endete in einer Gastwirtschaft, wo es ein kühles Bier und eine selbst gebraute Limonade gab.
Soweit Joshua sich erinnern konnte, wurde dieses Ritual nur einmal anlässlich des Geburtstags der Mutter unterbrochen, als der Vater allen eine Schifffahrt spendierte. Von der Anlegestelle des Dampfers am Schloss von Seraing ging es die Maas hinab nach Visé. Dort gab es eine Insel mit einem Ausflugslokal, wo man Kuchen essen, Zwergziegen streicheln und Hühner und Enten füttern konnte. Die Kinder durften Tretboot fahren und auf einem Kettenkarussell durch die Luft schweben.
Damit die Streitereien nicht die Eintracht der Familien Goldstein und Rozenberg trübten, dafür sorgten die Mütter, die darüber wachten, dass bei den geselligen Abenden, die einmal in der Woche abwechselnd in Lüttich oder Seraing stattfanden, nicht gestritten wurde. Joshua und Mendel liebten diese Treffen, weil sie dann bis spät abends herumtollen konnten.
Ihr Idol war der 15-jährige Fred. Fred war ein Tausendsassa, ein vorlautes Bürschchen, das den starken Mann markierte. Er prahlte gern mit seinen Streichen und brüstete sich mit amourösen Abenteuern. Wenn er glaubte, die Luft sei rein, zog er ein Päckchen Zigaretten der Marke Boule d’Or aus der Hosentasche, zündete eine an und machte einen Lungenzug. Einmal stachelte er Mendel an, es zu versuchen. Mendel wurde dabei so übel, dass er sich übergeben musste.
Wenn sie ungestört waren, holte Fred eine Illustrierte hervor, die »Paris-Hollywood« hieß, und in der Fotos von halbnackten Frauen in anzüglichen Posen zu sehen waren. Er war auch der stolze Besitzer einer großen Sammlung von Piccolos, schmalen Comic-Heftchen, die »Sigurd«, »Akim«, »Fulgor«, »Kit Carson« oder »El Bravo« hießen. Es waren Groschenhefte, die bei allen Jungen begehrt waren und auf dem Schulhof unter der Hand getauscht wurden. Es galt dabei vorsichtig zu sein, denn die Lehrer betrachteten die Hefte als Schundliteratur. Wenn sie Schüler damit ertappten, gab es eine schallende Ohrfeige und die Heftchen wurden konfisziert.
Die wöchentlichen Treffen waren auch deshalb so beliebt, weil Hanna, die Frau des Kantors, eine hervorragende Bäckerin war. Sie verstand sich besser als jede andere darauf, einen traditionellen Käsekuchen aus geronnenem Lab herzustellen. Dazu gab es Kaffee oder Tee und für die Männer ein Glas Rotwein.
Wenn alle satt waren, sagte Hanna Goldstein: »Lasst uns mameloschen30!« Das war das Zeichen, einfühlsame Lieder aus der polnischen Heimat anzustimmen. Sie begannen meist mit religiösen Weisen, die von Welt- und Gottesschmerz getragen waren. Danach folgten Liebes-, Wiegen- und Kinderlieder. Zu vorgerückter Stunde wurden lustigere Lieder angestimmt, die aus dem Repertoire der Klezmorim31 stammten, jüdischen Musikanten, die von Schtetl zu Schtetl zogen und auf Hochzeiten, Festen und an Feiertagen aufspielten.
Diese Bänkelsänger genossen bei frommen Juden nicht den besten Ruf, weil sie gerne chassidische Gesänge parodierten und sich nicht scheuten, Zigeuner in ihre Reihen aufzunehmen.
Eines Tages brachte Fred ein Grammofon mit, das er ohne Wissen der Eltern gegen seine Briefmarkensammlung eingetauscht hatte. Nun konnten sie auf einmal die volkstümlichen Weisen mit musikalischer Begleitung hören. Fred hatte auch Schallplatten mit Melodien aus jiddischen Musicals besorgt. Die kamen aus Amerika und lösten bei den jungen Leuten Begeisterung aus. Als Fred einmal Anstalten machte, zu den Klängen eines Swings mit seiner Schwester Bad-Sebah zu tanzen, griff der Kantor ein. Er verbat sich diesen Unsinn. Seitdem war das gottlose Ding aus den Familientreffen verbannt.
Wenn Ariel Rozenberg ein paar Gläschen Wein getrunken hatte, konnte er sich von einer anderen, lustigen Seite zeigen. Für großes Gelächter sorgten seine nachgestellten Kundengespräche, die er in einem entsetzlichen Kauderwelsch aus Polnisch, Jiddisch und Wallonisch vortrug.
Er kannte eine Vielzahl von jiddischen Witzen. Mit großem Vergnügen nahm er die Chassidim32 aufs Korn, was seinem frommen Vetter böse aufstieß. Einer handelte von einem gewissen Moische, der jeden Tag zu Gott betet, damit er ihn reich macht. »Herr, lass mich im Lotto gewinnen«, betet er inständig. So geht das über viele Wochen, bis ihm Gott antwortet: »Moische, gib mir a Chance. Kauf dir a Los.«
Ein anderer Witz handelte von galizischen Juden, die den Vatikan besuchen und den Papst sprechen wollen. Der Schweizer Gardist, der gerade Wache schiebt, sagt, sie sollten ihr Anliegen schriftlich einreichen. Sie antworten, das sei nicht möglich, weil es sich um eine private und dringende Angelegenheit handele. Nach langer Diskussion werden sie zum Papst vorgelassen. Der fragt sie, was ihr Anliegen sei. »Entschuldigen der Herr Papst«, sagt der Wortführer, »kennen Sie nicht den Jesus Christus und seine Jünger, bittschön?« – »Aber ja doch«, erwidert der Papst, »die kenn ich!« – »Da wäre nämlich noch eine unbezahlte Rechnung für ein Abendessen.«
Neben den Chassidim und den Christen waren die Yekkers33, die Deutschen, eine bevorzugte Zielscheibe seines Spotts. Ariels Witze begannen meistens mit der Redewendung: »Ein armer Schwob sucht einen weisen Rabbi auf …« Einer handelte davon, wie ein Jude einen deutschen Metzger aufsucht, auf einen Schinken zeigt und sagt, er hätte gern diesen fetten Fisch dort. »Aber das ist doch ein Schinken«, antwortet der Schwob und will ihn belehren, dass es Schweinefleisch sei. »Nun geben Sie mir schon den Fisch«, unterbricht ihn der Jude, »mich interessiert nicht, wie er heißt!«
* * *
Bei den Wahlen von 1936 hatte die Sozialistische Arbeiterpartei in Wallonien, dem industriellen Herz des Landes, über 40 Prozent der Stimmen geholt. In Seraing, einer Hochburg der Linken, regierten sie schon lange, aber die Kommunisten waren ihnen auf den Fersen und stellten mit sechs Abgeordneten ein Viertel aller Sitze. Von den Linksparteien erhofften sich die Migranten bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen, die Juden eine baldige Einbürgerung und eine Überwindung von Diskriminierungen.
Es waren unruhige Zeiten. Wie in anderen Städten gab es auch in Seraing Aufmärsche und Kundgebungen. Unter den Freiwilligen, die über die Avenue de la Concorde paradierten, um mit den Internationalen Brigaden in den spanischen Bürgerkrieg zu ziehen, waren auch Juden. Sie trugen rote Halstücher, ballten ihre Fäuste und sangen die Internationale.
Schon von Natur aus vorsichtig, war Rozenberg als Geschäftsmann darauf bedacht, sich aus der Tagespolitik herauszuhalten, umso mehr als er nur eine befristete Aufenthaltsgenehmigung besaß. Dass er in Belgien weder an Parlaments- noch an Gemeinderatswahlen teilnehmen durfte, störte ihn nicht, weil er am politischen Gezänk sowieso nicht interessiert war. Das schade dem Geschäft, pflegte er zu sagen. Auf Fragen der Kundschaft nach seiner politischen Meinung gab er an, in diesen Dingen als Pole nicht bewandert zu sein.
Rozenberg verordnete auch den Söhnen politische Abstinenz. Er duldete nicht, dass sie sich einer Jugendorganisation anschlossen, weil die alle weltanschaulich gebunden waren. Auch die zionistischen Jugendgruppen, die am Sabbat in der Synagoge eifrig Werbung machten, waren ihm nicht geheuer. In seiner Furcht vor Vereinnahmung verbot er seinen Söhnen sogar, am Sonntag das Haus des Volkes in Seraing zu besuchen, obwohl dort kostenlose Filmvorführungen stattfanden. Er vermutete dahinter ein Ränkespiel der marxistischen Parteien, um neue Anhänger zu ködern und die Seelen unschuldiger Kinder mit linken Parolen zu vergiften.
Bei den geselligen Treffen im Familienkreis galt die Regel, nicht über Politik zu reden. Dieses Tabu wurde immer öfter durchbrochen, weil die große Politik gewaltsam ins Leben der Menschen eingriff.
Auf einmal standen die finsteren Pläne der Nationalsozialisten im Mittelpunkt des Interesses. Die deutsche Propaganda sprach von einer jüdischen Weltverschwörung, obwohl es in Deutschland nur eine halbe Million Juden gab. In vertrauter Runde wurden die Nationalsozialisten nie bei ihrem Namen genannt, denn »Nazi« bedeutet im Hebräischen »Prinz« und war ein Ehrentitel des obersten Richters im Sanhedrin34. Statt von Nazis sprach man deshalb von Swastikas35, von Hakenkreuzlern. Auch der Name Adolf Hitler wurde nie ausgesprochen. Man sprach lediglich von »diesem Schmock da«, einem Wort, mit dem man einen Tölpel oder einen Menschen mit unangenehmen Eigenschaften umschreibt.
Während die Frauen sich häuslichen Themen widmeten, begannen die Männer nun immer öfter und offener über die hohe Politik zu fachsimpeln. Mendel und Joshua saßen still dabei, um andächtig zuzuhören, was da besprochen wurde. Eines Tages schaltete sich unerwartet Nathans Frau in die Diskussion ein. Sie sagte unumwunden: »Macht euch doch nichts vor, die Deutschen haben nur das eine Ziel, die Juden zu vernichten.«
Zunächst herrschte Überraschung, dass eine Frau es wagte, sich in einer Runde zu Wort zu melden, die Männern vorbehalten war. Nathan, dem die Sache peinlich war, raunzte sie an, sie solle sich um die Gäste kümmern und nicht um Dinge, von denen sie nichts verstehe. Aber Hanna ließ nicht locker: »Sie haben nur das eine Ziel. Sie wollen uns umbringen.« Einen Moment lang herrschte betretenes Schweigen. Als sie wieder in der Küche war, meinte ihr Mann, seine Frau sei in Gedanken immer noch in Polen und nie so richtig in Belgien angekommen.
Nach dem Anschluss Österreichs und des Sudetenlandes und der Besetzung der restlichen Tschechoslowakei durch Hitlerdeutschland strömten viele deutschsprachige Juden ins Land, die schlimme Dinge berichteten. Allen Juden in Belgien war damit klar, was ihnen blühte, wenn ein Krieg ausbrechen sollte und die Deutschen ihn gewinnen würden.
Auch die Nachrichten, die sie aus Polen erreichten, gaben Anlass zur Sorge. Die Juden, die dort immerhin zehn Prozent der Bevölkerung ausmachten, wurden angesichts der internationalen Spannungen als »fünfte Kolonne« diffamiert. Die antisemitischen Maßnahmen wurden verschärft, mit dem Ziel sie zur Emigration zu treiben. Die Juden wussten nicht mehr, wohin sie sich überhaupt noch wenden sollten. Sie saßen in der Falle.
Die polnische Regierung blieb bemüht, das gute Verhältnis zum Deutschen Reich, das der Staatsgründer Józef Piłsudski gestiftet hatte, aufrecht zu erhalten. Der Marschall hatte einen Nichtangriffspakt mit Deutschland abgeschlossen, obwohl er sich keine Illusionen über die Natur des Regimes und die strategischen Ziele der Nationalsozialisten machte. Nach seinem Tod im Jahre 1935 verschlechterten sich die Beziehungen. Ein zentraler Streitpunkt zwischen beiden Ländern waren die ungeliebten Juden.
Im März 1938 bürgerte die polnische Regierung alle Juden, die mehr als fünf Jahre außer Landes waren, aus. Damit wollte sie verhindern, dass nach Deutschland ausgewanderte Juden nach Polen zurückkehrten. Umgekehrt beschlossen die Nazis, alle »Ostjuden« auszuweisen. Tausende Juden steckten im deutsch-polnischen Niemandsland bei Bentschen fest. Als Joshua den Namen der Grenzstation hörte, erinnerte er sich daran, dass er dort gewesen war.
Das Unglück nahm seinen Lauf, als ein jüdischer Heißsporn aus Rache für die Abschiebung seiner Eltern einen deutschen Botschaftssekretär in Paris erschoss. Für die Nazis war das ein willkommener Anlass, einen lang geplanten Pogrom anzuzetteln. Die Hatikwah, eine jiddische Wochenzeitung, auf die Rozenberg abonniert war, berichtete ausführlich über die Gräueltaten der Swastikas. Es brachte viele Fotos von brennenden Synagogen und geplünderten Geschäften, die in der jüdischen Diaspora Angst und Schrecken verbreiteten.
Nach der sogenannten Reichskristallnacht ergossen sich wahre Flüchtlingsströme über Westeuropa. Diese führten notgedrungen über Belgien. Viele Juden blieben wegen der Einreisebeschränkungen, die die Nachbarländer erließen, in Belgien hängen. Innerhalb von fünf Jahren wuchs ihre Zahl von 6.000 auf 65.000 an. 1939 waren es nach Schätzungen des Innenministeriums 116.000.
Durch den massiven Zustrom von Juden kam es in Belgien zu einer kurzen Blüte jüdischen Lebens, aber auch zu ersten Fällen von Antisemitismus. Da die meisten Flüchtlinge sich illegal im Lande aufhielten und nicht auf eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung hoffen konnten, tauchten sie unter und bauten eine Schattenwirtschaft auf. Sie eröffneten kleine Geschäfte, waren Hutmacher, Schuster oder Schneider. Dadurch wurden sie zu Konkurrenten des eingesessenen Mittelstandes, der ohnehin unter der Wirtschaftskrise zu leiden hatte.
Das sorgte für böses Blut. Orientalische Juden, die als Hausierer und Messerschleifer von Tür zu Tür zogen, erregten durch Kleidung und Auftreten Aufsehen und Widerwillen. Einigen Zeitungen zufolge hegten die Juden finstere Pläne, um den belgischen Staat zu unterwandern. Am rechten Rand entstanden Parteien, die den Unmut schürten. Diesen bekamen alle Israeliten zu spüren, auch jene, die wie Nathan Goldstein die belgische Staatsbürgerschaft besaßen.
Um des Flüchtlingsandranges Herr zu werden, sah sich die Regierung genötigt, Internierungslager einzurichten: eines im Kempenland, ein anderes in den Ardennen. Außerdem bemühte sie sich, die deutsch-belgische Grenze hermetisch abzuriegeln. An die Stelle der biederen Zöllner traten nun kasernierte Gendarmen ihren Dienst an. Sie hatten Befehl, unerbittlich Jagd auf illegale Grenzgänger zu machen.
Um Flüchtlinge abzuschrecken, setzte die Regierung tausend abgefangene Juden in einen Sonderzug und schob sie über die Grenze nach Aachen ab. Die Presse berichtete in großer Aufmachung darüber. In den Synagogen munkelte man schon, Deutsche und Belgier steckten unter einer Decke, denn der belgische Geheimdienst dürfe mit Duldung der Nationalsozialisten im Rheinland Fluchthilfeorganisationen ausspähen und unterwandern.
Ein Umschwung in der öffentlichen Meinung erfolgte kurzfristig, als die belgische Regierung zweihundertfünfzig jüdische Kinder abschieben ließ. Angesichts landesweiter Proteste sah sich der Innenminister gezwungen, siebenhundertfünfzig unbegleiteten Kindern die Einreise zu erlauben. Die Pressebilder von der Ankunft der aus Deutschland abgeschobenen Kinder in Herbesthal, dem ersten belgischen Bahnhof, gingen um die Welt. Sie zeigten weinende, fröstelnde Kinder, die im ehemaligen Fürstenzimmer aus der Kaiserzeit von Mitarbeitern des Roten Kreuzes versorgt wurden.
In den nächsten Wochen sollten noch sechzehn weitere Kindertransporte aus Köln nach Belgien kommen. Im ganzen Land löste das Schicksal dieser Kinder eine Welle der Hilfsbereitschaft aus. In den Synagogen wurden die Gläubigen aufgerufen, den Zehnten, der eigentlich zum Unterhalt der Leviten vorgesehen war, für die Vertriebenen zu spenden. Wie viele andere verbrachte auch Elsa Rozenberg viele Stunden damit, Winterkleidung für Flüchtlingskinder zu nähen.
Im Cheder lernte Joshua eines dieser Kinder kennen. Peter Weis stammte aus Berlin und lebte nun in einer belgischen Pflegefamilie. Er war ein stiller Junge, der meist schweigsam in einer Ecke saß, weil er weder Französisch, Polnisch oder Jiddisch sondern nur Deutsch sprach.
Trotz dieser Welle der Solidarität belastete der Zustrom der Flüchtlinge das innenpolitische Klima. Unmerklich schlichen sich judenfeindliche Maßnahmen in die Gesetzgebung ein. Als das Ehepaar Rozenberg 1939 wie gewohnt beim Einwohnermeldeamt ihre Ausweise einreichte, um sie zu verlängern, wurden diese mit einem roten »J« abgestempelt. Der Beamte behauptete, das geschehe nur auf Wunsch der Schweizer Behörden, die genau wissen wollten, wer aus Belgien in ihr Land einreisen wolle.
Rozenberg registrierte die Maßnahme mit großem Unbehagen: Sein Leben lang hatte er sich bemüht, nicht aufzufallen, und nun knallte man ihm seine jüdische Herkunft wie ein Brandzeichen auf ein amtliches Dokument.
* * *
In dieser aufgeheizten Stimmung geschah etwas, womit niemand gerechnet hatte: Eines Tages tauchten Gerda Meyer und ihre Tochter Hedwig in der Rue du Buisson auf. Die Familien hatten zwar brieflich Kontakt gehalten, aber in Seraing hatte man keine Ahnung, dass die Meyers sich mit Fluchtgedanken trugen. Die Frauen waren unversehrt über die belgische Grenze gelangt. Die Freude über das Wiedersehen wurde getrübt durch die Sorge um den Konsul, der es vorgezogen hatte, sich von Frau und Tochter zu trennen, um es auf eigene Faust zu versuchen.
Nachdem sie sich etwas erholt hatten, fanden sie in der Wohnküche einen reich gedeckten Tisch vor. Mutter Rozenberg hatte das beste Stück Kalbfleisch aus der Ladentheke, der Vater eine Flasche von dem französischen Landwein aus dem Keller hervorgeholt, die eigentlich für die anstehende Bar Mizwa36 Mendels vorgesehen war. Gerda Meyer berichtete, ihr Mann habe sich zur Flucht entschlossen, als man seinen Reisepass eingezogen und diesen durch eine Kennkarte ersetzt habe, der mit einem Judenstern abgestempelt war. Seinen Vornamen Siegmund hatte man mit Israel ergänzt, weil es sich für einen Juden angeblich nicht geziemte, einen arischen Rufnamen zu haben.
Ihr Mann habe die Zustände in Deutschland nicht mehr ertragen. Statt Recht und Ordnung, wie er sie verstand, hätten überall Willkür und blinde Gewalt geherrscht. Zunächst habe er an eine legale Auswanderung gedacht. Vermögende Juden konnten gegen ein hohes Lösegeld die Ausreise nach Palästina erkaufen, aber ihr Mann habe keine Lust verspürt, als Kameltreiber zu enden, wie er es abfällig formulierte. Eine andere Möglichkeit, das Land legal zu verlassen, hätte darin bestanden, mit einem Bananendampfer in die Karibik zu verschwinden. Für jede Schiffspassage hätte er 40.000 RM in ausländischen Devisen hinblättern müssen, wovon der deutsche Staat fünfzig Prozent einbehalten hätte. »Reichsfluchtsteuer« heiße das. Außerdem hätten die Nazis bei einer Auswanderung ihr gesamtes Vermögen beschlagnahmt.
Frau Meyer sagte, die Nacht vom 9. auf den 10. November sei zum Fanal geworden. Allen Juden im Reich hätten die blutigen Ausschreitungen vor Augen geführt, dass sie in Deutschland keine Daseinsberechtigung mehr hatten.
Am Vorabend des Pogroms habe ein städtischer Beamter, den ihr Mann aus besseren Tagen kannte, ihn gewarnt: Die Polizei habe Weisung erhalten, im Rahmen eines spontanen Volkszorns sämtliche Juden zu verhaften, zu entwaffnen und bei Widerstand über den Haufen zu schießen. Am nächsten Morgen hätten sie das Haus nicht verlassen und von ihrem Fenster beobachten können, wie SA-Männer eine größere Gruppe Juden vor sich hergetrieben habe. Die SA-Standarte habe ein Mann getragen, dem ihr Mann einst eine Anstellung in seiner Firma besorgt hatte. Auf den Bürgersteigen gafften teilnahmslos Passanten, während Kinder die Juden schmähten, ohne zurechtgewiesen zu werden.
Nachher erfuhren sie, dass die Juden ins Alte Gymnasium getrieben worden waren, wo Konsul Meyer sein Abitur gemacht hatte. Von dort seien sie ins KZ Sachsenhausen gebracht worden. Nicht nur in Bremen, auch in den Vororten hätten die Nazis gewütet. In Hastedt hätten sie den Vorsteher der jüdischen Gemeinde gezwungen, in seinen liturgischen Gewändern mit den Thorarollen auf den Schultern singend durch die Hauptstraße zu ziehen. Die Ältesten seien ihm mit einer Schelle vorangegangen. Sie seien beschimpft und bespuckt, mit Stöcken geschlagen und mit Steinen beworfen worden. Auf dem Marktplatz von Hastedt hätten sie dem Rabbiner unter dem Gelächter der Menge die Haare mit Pferdemist gewaschen.
Am Abend habe sich ihr Mann aus dem Haus geschlichen, und als er zurückkam, sei er sehr nachdenklich gewesen. Er sei in die Bremer Altstadt, ins Schnoor, gegangen, um die geschändete Alte Synagoge zu sehen. Auf der Straße wären Gebetbücher und liturgische Gewänder verstreut gewesen. Obwohl er Protestant war, habe er angesichts der Verwüstung einen tiefen Schmerz in seiner Brust verspürt.
Seine Frau meinte, in jener Nacht sei wohl sein Glaube an das »ewige Deutschland« erschüttert worden. Als Hermann Göring im Rundfunk dann noch verkündete, dass nun die große Abrechnung mit den Juden kommen werde, habe er begriffen, dass es keine Hoffnung mehr gab und die Zeit drängte. Wenn sie überleben wollten, mussten sie Deutschland schleunigst verlassen.
Ihre größte Sorge galt den Kindern. Angesichts der öffentlichen Empörung über die sogenannte Kristallnacht hatte die britische Regierung sich bereit erklärt, 10.000 jüdische Kinder unter 15 Jahren aufzunehmen. Meyer ließ seine Verbindungen spielen und sorgte mit einer Spende an den Innensenator dafür, dass ihr Sohn Emil zu den Auserwählten gehörte. Mit einem Namenskärtchen um den Hals und seinem Teddy im Arm ging es zum Bahnhof. Als sie gesehen habe, wie der Junge ihnen aus dem Fenster des abfahrenden Zuges fröhlich zugewinkt habe, als ginge es in den Urlaub, habe sie ihre Tränen nicht zurückhalten können, weil sie gespürt habe, dass es ein Abschied für lange Zeit sein würde. Die Kinder seien über Köln an die belgische Küste gebracht worden, wo eine Fähre nach Dover sie erwartete.
Nachdem sie ihr Söhnchen in Sicherheit wussten, habe ihr Mann ihre eigene Flucht vorbereitet. Als langjähriges Mitglied des Gemeindevorstandes von St. Stephani habe er vorher den Rat von Pastor Greiffenhagen eingeholt. Der Pastor gehöre zur Bekennenden Kirche und verabscheue die Nazis. Er habe von einer Organisation gewusst, die Juden über die belgische und niederländische Grenze bringe.
Der Weg habe sie zunächst ins Café Silberbach in der Kölner Glockengasse geführt. Von dort schickte man sie nach Aachen ins Schloss-Hotel, wo sie einen gewissen Simon Frankenthal trafen, einen jüdischen Studenten, der dem kommunistischen Widerstand angehörte.
Frankenthal riet den Frauen dazu, sich einer Prozession anzuschließen, die einmal die Woche von der Aachener Jakobskirche zu einem Gnadenbild der Gottesmutter nach Moresnet ins belgische Butterländchen ziehe. Viele Hausfrauen nutzten diese Wallfahrt, um sich in Belgien mit Kaffee, Schokolade und Butter zu versorgen, Waren, die im sogenannten »Tausendjährigen Reich« unerschwinglich geworden waren. Die deutschen Grenzer drückten gewöhnlich beide Augen zu, weil die Partei keinen Ärger mit der katholischen Kirche riskieren wolle. Im belgischen Pilgerkloster Moresnet, sagte der Student, gebe es einen Franziskanermönch, der allen Flüchtlingen weiterhelfe, egal ob es sich um Christen, Juden oder Marxisten handele.
Nachdem ihr Mann ihr sämtliche Wertpapiere anvertraut hatte, hatten Gerda und Hedwig Meyer sich unter die Pilger gemischt. Vorher hatten sie sich Rosenkränze zugelegt und die wichtigsten Gebete auswendig gelernt. Alles verlief nach Plan. Im Wallfahrtsort trafen sie besagten Franziskanerpater, der ihnen ein Taxi besorgte, das sie zum nächsten Bahnhof brachte.
Zwei Tage nach der Ankunft der Frauen stand auf einmal Siegmund Meyer vor der Tür. Gerda Meyer konnte es nicht fassen, auch wenn der Konsul, der immer Wert auf eine tadellose Erscheinung legte, einen fahrigen und verwahrlosten Eindruck machte. Er war von seinen Erlebnissen sichtlich mitgenommen. Rozenberg musste ihm einige Gläschen Péquet37 einschenken, damit er sich aus seiner Erstarrung löste. Als er die Umstände seiner Flucht schilderte, versetzte das alle in ungläubiges Staunen.
Über einen Bekannten im Senat hatte Meyer sich falsche Papiere besorgt: einen Reisepass, der ihn zum Kommerzienrat Dr. Richard Dorenbeek machte. In Aachen habe er sich von Frau und Tochter getrennt und beschlossen, als Geschäftsreisender getarnt auszureisen. Aber schon auf dem Bahnsteig habe eine Frau Verdacht geschöpft und ihn bei einem Bahnpolizisten angezeigt. Der Schupo habe seine Papiere überprüft, und, da ihm Zweifel aufkamen, der Gestapo überstellt. Dass seine Papiere gefälscht waren, dass er in Wirklichkeit Meyer hieß, und er jüdischen Blutes war, ließ sich nicht lange leugnen. Ein einziges Telefonat mit Bremen hatte genügt, um ihn zu überführen.
Er wurde einem jungen Untersuchungsrichter vorgeführt, der bereits das goldene Parteiabzeichen trug. Im Laufe des Verhörs erwähnte Meyer beiläufig, dass man ihm im Krieg das Eiserne Kreuz verliehen habe. Das machte offenbar Eindruck.
Nachdem der SS-Mann das anhand der Dokumente, die Meyer mit sich führte, überprüft hatte, holte er aus der Schublade »Die Brennnessel« hervor. In dem satirischen Hetzblatt gab es eine Karikatur von einem Schiff voller Juden, das auf ein tropisches Eiland mit Strohhütten und Palmen zu segelte. »Der Führer schenkt den Juden eine Insel!«, lautete die Bildlegende.
Der Kommissar habe auf die Zeichnung gezeigt und gefragt, warum er nicht gleich gesagt habe, dass er die Absicht habe, nach Madagaskar auszuwandern, da die Insel nach dem Willen des Führers doch die künftige Heimstatt des jüdischen Volkes sein werde. Bevor Meyer sich versah, gab der Kommissar ihm seine Papiere mitsamt der Geldbörse zurück. Lediglich zehn Reichsmark, die er sich quittieren ließ, behielt er als Arbeitsgebühr ein, denn Ordnung muss sein.
Noch in der Nacht habe der Kommissar ihn in seinem Dienstwagen zum Losheimer Graben gebracht, genau an die Stelle in der Eifel, wo die Landstraße die Staatsgrenze bildet. Als er kurz darauf belgischen Gendarmen begegnete, habe er nur artig den Hut gelüftet. Vermutlich hatten sie ihn für einen Touristen gehalten. Seine wundersame Errettung hatte bei Meyer seinen Glauben an das ewige Deutschland wiederbelebt. Selbst unter Nationalsozialisten, schloss er seinen Bericht, gebe es noch Ehrenmänner.
* * *
Am nächsten Morgen suchten Ariel Rozenberg und Siegmund Meyer gemeinsam die Bank Nagelmackers auf. Der Konsul ließ sich die Monatsgelder auszahlen, die sich im Lauf der Jahre angesammelt hatten. Er bedankte sich überschwänglich bei seinem polnischen Verwandten für dessen Redlichkeit.
Einige Tage später machten die Meyers sich nach Antwerpen auf. Der Konsul hatte sich für die Hafenstadt entschieden, weil es dort eine größere deutsche Gemeinde gab, mit der er geschäftliche Verbindungen unterhalten hatte. Seine Hoffnung, eine eigene Kaffeerösterei zu eröffnen, sollte sich nicht erfüllen. Der Kaffeehandel gestaltete sich schwierig, weil Deutschland Handelsschranken errichtet hatte und hohe Zölle auf Luxusgüter erhob. Im Deutschen Reich herrschte Devisenknappheit, weil alle wirtschaftlichen Ressourcen in die Aufrüstung flossen.
Immerhin fand Meyer eine Anstellung als Vertreter. Sein wichtigster Kunde war seine ehemalige Rösterei in Bremen, die ihn so schäbig abserviert hatte. Im Wesentlichen lebte die Familie von ihren Ersparnissen.
Geschäftlich fasste Meyer in der flämischen Metropole nie richtig Fuß, da er weder Französisch noch Niederländisch sprach. Die orthodoxen Juden, die das Stadtbild rund um den Bahnhof prägten, schreckten ihn ab. Zur jüdischen Gemeinde vermied er jeglichen Kontakt. Nie ließ er durchblicken, dass er jüdischer Abstammung war. Antwerpen war gleichzeitig eine weltoffene Handelsstadt, ein Zentrum jüdischen Lebens und eine Hochburg des flämischen Nationalismus. Selbst in Antwerpen war das weite Spektrum des Judenhasses präsent. Hier tummelten sich rassistische Bewegungen wie die Schwarze Brigade, VNV oder der Kampfbund De Vlag. Mit ihren martialischen Aufmärschen kamen sie Meyer wie eine Parodie der Brüllaffen von der SA vor.
Im Juni 1939 legte das Kreuzfahrtschiff der Hamburger Reederei HAPAG, die St. Louis, mit 937 deutschen Juden an Bord im Hafen von Antwerpen an. Es waren Juden, die sich in Deutschland freigekauft hatten und nun abgeschoben werden sollten. Zwei Monate lang war das Urlauberschiff über die Weltmeere geirrt, aber weder in Kuba, noch in den USA oder in Kanada hatte man die Kinder Israels aufnehmen wollen.
Schließlich hatte die belgische Regierung der St. Louis erlaubt, in Antwerpen anzulegen. Während sie mit den Nachbarländern über eine Aufnahme der aus Deutschland abgeschobenen Juden verhandelte, wurde eine Quarantäne über das Schiff verhängt. Eines Tages ging Hedwig Meyer an den Pier, um das Schiff, von dem alle Welt sprach, aus der Nähe zu betrachten. Obwohl der Zugang zum Dampfer weiträumig abgeriegelt war, konnte sie die Hilferufe der verzweifelten Passagiere hören, die auf der Reling standen. Sie war danach ganz aufgewühlt. Als sie daheim davon erzählte, meinte ihr Vater nur, er habe schon den richtigen Riecher gehabt, als er das Angebot der NS-Behörden zur Auswanderung ausschlug.
Im Sommer 1939 luden die Meyers die Rozenbergs für ein Wochenende nach Antwerpen ein. Sie wollten sich für die freundliche Aufnahme in Seraing bedanken. Anfangs waren Mendel und Joshua von der Aussicht, ein Wochenende im Hause des Konsuls zu verbringen, nicht sonderlich erbaut. Joshua war schlechter Laune, weil sein Vater ihm verboten hatte, Roro mitzunehmen. Er versuchte, den Hasen darüber hinwegzutrösten, indem er darauf hinwies, dass Petsy der Teddybär, mit dem Roro sich in Bremen angefreundet hatte, mit seinem Herrchen nach London verzogen war.
Der Besuch in Antwerpen verlief erfreulicher als erwartet. Da die Meyers nicht weit von der Centraal-Station wohnten, holten der Konsul und seine Gattin die Gäste persönlich am Bahnhof ab.
Rund um den Bahnhof lag das Diamantenviertel. Der Handel mit Edelsteinen war fest in jüdischer Hand. Seit dem 19. Jahrhundert hatte die Diamanterie jüdische Händler und Diamantenschleifer aus aller Welt nach Antwerpen gelockt. Nach dem Krieg hatte sich die Zahl der Juden versechsfacht.
Meist handelte es sich bei den Zugewanderten um orthodoxe Juden, die sich weitgehend von ihrer Umwelt abschotteten. Vom Rat der Großen Synagoge hatten sie verlangt, dass rund um das Diamantenviertel ein gesicherter Bezirk, ein Eruv38, errichtet würde, damit sie sich am Sabbat auch außerhalb des Hauses frei bewegen konnten, ohne Gefahr zu laufen, mit Ungläubigen und unreinen Dingen in Berührung zu kommen. Da eine Mauer oder ein Zaun nicht vorstellbar waren, kamen die Rabbiner auf den Gedanken, rund um das Bahnhofsviertel einen Bindfaden spannen zu lassen, der es in eine koschere Zone verwandelte.
Als Meyer mit seinen Gästen durch die Vestingsstraat ging, kreuzten sie orthodoxen Juden, die aus der Synagoge kamen und schnellen Schrittes nach Hause liefen. Ariel Rozenberg, die die Aschkenazim39 aus Polen kannte, klärte den verstörten deutschen Cousin darüber auf, dass ultra-orthodoxe Juden immer in Eile seien, weil sie fürchteten, unterwegs abgelenkt und aufgehalten zu werden und dadurch die Ankunft des Messias zu verpassen. Die Begegnung mit den Orthodoxen in ihren schlabbrigen Mänteln und den breiten Pelzmützen war dem Konsul sichtlich unangenehm. Kein Wunder, sagte er, dass diese Figuren den Judenhass nährten.
Gerda Meyer machte gegenüber ihrer Freundin keinen Hehl daraus, dass sie sehr unter der Trennung von ihrem Sohn litt. Aus seinen Briefen hatte sie herausgelesen, dass auch der kleine Emil Heimweh hatte. Anders als die jüdischen Mädchen, die leicht Pflegeeltern gefunden hätten, wären die Jungen, die schwer zu vermitteln waren, in London hängen geblieben und in Internate gesteckt worden. Die Zustände dort wären nicht erbaulich. Jüdische Kinder würden wegen ihres deutschen Akzentes ständig gehänselt. Gerda Meyer klagte, sie habe ihren Mann gebeten, ihren Sohn nach Belgien zu holen, da er hier nichts zu befürchten hätte, aber ihr Mann habe davon nichts hören wollen. Offenbar misstraute er dem Frieden, in dem sich die meisten Menschen seit dem Münchener Abkommen wähnten.
Den großbürgerlichen Lebensstil aus den Bremer Tagen hatten die Meyers aufgeben müssen. Statt eines Herrenhauses bewohnten sie nun eine Etagenwohnung. Abgesehen davon, dass die Jungen bei Tisch wieder den ungebrochenen Hochmut und den jüdischen Selbsthass des Oheims ertragen mussten, war der Ausflug für sie ein unvergessliches Erlebnis.
Nachmittags besuchten die Jungen mit Hedwig den Zoologischen Garten. In malerischen Gehegen, die altägyptischen Bauten nachempfunden waren, konnten sie Elefanten, Löwen und Giraffen bewundern. Am meisten faszinierte Joshua eine Waldantilope, die verborgen im kongolesischen Regenwald lebte und erst vor wenigen Jahren entdeckt worden war. Während der lange Hals des Okapis dem einer Giraffe glich, erinnerten die gestreiften Schenkel und Oberbeine an ein Zebra.
Die Nacht verbrachten die Rozenbergs in einem nahen Gasthof, wobei Meyer es sich nicht nehmen ließ, die Rechnung zu begleichen.
Am nächsten Morgen machten alle gemeinsam einen ausgedehnten Stadtbummel. Mit der Straßenbahn ging es zunächst zur Keyserlei, einer belebten Geschäftsstraße, wo es das höchste Haus Europas zu bestaunen gab. Die 87 Meter hohen Boerentoren waren Sitz einer Kreditanstalt. Weil diese Meyers Hausbank war, besaß er einen Passierschein, der es ihnen erlaubte, mit einem Aufzug auf das Dach zu gelangen, wo man einen wunderbaren Blick auf den Fluss, den Hafen und die Altstadt hatte. Joshua und Mendel waren begeistert.
Danach unternahmen sie eine Bootsfahrt durch den Hafen, »dem größten Güterhafen der Welt«, wie der Konsul mehrmals betonte. Sie staunten über die riesigen Stückgutfrachtschiffe, die im Schlepptau kleiner Lotsenschiffe die Schelde hinauf fuhren, um ihre Ladung in den Docks zu löschen, um danach wieder den Fluss hinunter zu dampfen und Waren in alle Welt zu transportieren.
Den Tag beschlossen sie in einer Hafenkneipe, wo Joshua und Mendel Bekanntschaft mit der Leibspeise der Belgier machten: Miesmuscheln mit Fritten. Die Eltern hatten beide Augen zugedrückt, denn Schalenfrüchte sind den Juden eigentlich verboten. Auch die Kartoffelstäbchen waren in Schweinefett gekocht. Obwohl nichts von dem Gericht dem jüdischen Speisekodex, dem Kaschrut, entsprach, aßen alle mit großem Appetit.