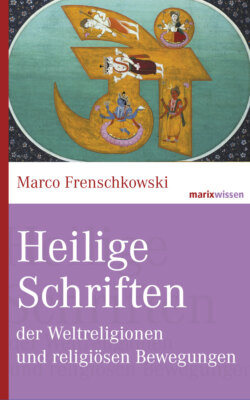Читать книгу Heilige Schriften der Weltreligionen und religiösen Bewegungen - Marco Frenschkowski - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. HEILIGE SCHRIFTEN: EINE ARBEITSDEFINITION
ОглавлениеAls heilige Schriften bezeichnet die Religionswissenschaft die normativen Texte von Religionen. Der Begriff ist damit allerdings vorerst nur ungenau bestimmt und wird in der Religionswissenschaft auch meist als eher vager Ober- oder Referenzbegriff verwendet. Die einzelnen Religionen verstehen unter ihren normativen Texten etwa je sehr unterschiedliches. Dazu treten die Außenwahrnehmung durch andere Religionen, und die vielschichtige Auslegungs- und Rezeptionsgeschichte Heiliger Texte. Es ergibt sich ein breites Spektrum von Möglichkeiten, was in einer Religion oder in einem kulturellen Umfeld als »heiliger Text« gesehen werden kann. Auch die Autorität, die diesem Text zugebilligt wird, kann ganz unterschiedlich gestaltet sein. Dennoch besteht – auch umgangssprachlich – ein gewisser Konsens, an den wir anknüpfen können. Die Bibel und den Koran, den Pali-Kanon des Theravadabuddhismus oder auch das Buch Mormon wird jeder sofort als heilige Schriften lebender Religionen identifizieren. In vielen Fällen ist die Entscheidung aber sehr schwierig. Schon die klassische griechische Kultur und Religion besaß kein »heiliges Buch« im Sinne einer Bibel. Aber Homer war mit seinen beiden großen Epen Ilias und Odyssee eine konstante Referenzgröße für die gesamte hellenistische Welt, und viele kleinere religiöse Gruppen (Orphiker, Pythagoreer, Hermetiker, manche Mysterienreligion) besaßen normative und von ihren Anhängern verehrte Texte. Wir werden sie aus unserer Betrachtung jedenfalls nicht von vornherein ausschließen, sondern fragen, wie sich die Rezeptionsphänomene solcher Texte dem Existenzmodus einer Heiligen Schrift zumindest annähern.
Wir bezeichnen als »Heilige Schriften« im Sinne einer »Familienähnlichkeit« Schriften, die eine größere Anzahl der folgenden Eigenschaften innehaben (wobei jede einzelne der genannten Eigenschaften aber auch fehlen kann):
1. Die Schrift wird von einer Religionsgemeinschaft als normativ betrachtet, d.h. Fragen des Glaubens, des Rituals und der Ethik werden unter Berufung auf sie entschieden. Diese Entscheidung wird meist als letztgültig betrachtet.
2. Die Schrift spielt eine grundlegende Rolle im Gottesdienst, in Kult und Ritual einer Religionsgemeinschaft und wird dort – oft in einer besonderen und feierlichen Art und Weise – im Wortlaut zitiert.
3. Die Mitglieder einer Religionsgemeinschaft betrachten die Schrift als Gründungsdokument, als zentralen Text oder zentrale Referenzgröße ihrer Religion.
4. Die Schrift wird intensiv ausgelegt, d.h. interpretiert; eventuell haben sich eigene Richtungen und Schulen um verschiedene Auslegungsmöglichkeiten gebildet.
5. Die Schrift gilt als in besonderer Weise von der Gottheit bzw. den Göttern inspiriert oder mit einer Gründerpersönlichkeit verbunden. Oft ist sie das eine und wesentliche Dokument (bzw. Sammlung von Dokumenten), welches die Lehre der Gründerpersönlichkeit (wenn die Religionsgemeinschaft eine solche kennt) ausdrückt. In jedem Fall legitimiert sich eine Heilige Schrift oft durch einen besonderen, mit dem anderer Bücher nicht zu vergleichenden Ursprung. Dabei spielen Interpretamente einer Offenbarung bzw. eines Offenbarungsempfanges eine besondere Rolle, z. B. die biblische Idee einer Inspiration, einer Eingebung durch den Heiligen Geist.
6. Umfang und Text der Schrift oder Schriftensammlung waren in einer Anfangsphase der Religion noch weniger bestimmt, wurden aber – oft in einem formalen, institutionell abgesicherten Akt – fixiert (»kanonisiert«). Im Falle einer Schriftensammlung ist der Umfang der Bücher, welche Teil der Sammlung sind, präzise festgelegt, oft gilt das auch für ihre Reihenfolge. Daneben existieren oft andere Gruppen von Texten (»Apokryphen«), die ehemals oder nur bei einer Teil- und Splittergruppe der Religionsgemeinschaft als Teil derselben Sammlung heiliger Schriften galten oder gelten. Aber die Geltung einer Heiligen Schrift hängt nicht unbedingt an einer Kanonisierung; diese ist nur ein möglicher Modus der Stabilisierung heiliger Bücher in ihrer Funktion für eine Gemeinschaft.
7. Die Schrift oder Schriftensammlung sammelt in als besonders authentisch geltender Weise die Überlieferungen, das Erzählgut, die Offenbarungsinhalte, Lieder, Rituale oder weisheitlichen Texte einer Religionsgemeinschaft.
8. Die Schriftensammlung sammelt oft die – faktisch oder der Überlieferung zufolge – ältesten Texte und Zeugnisse einer Religionsgemeinschaft.
9. Die Schriften werden in der Frömmigkeit einer Religion mit besonderer Liebe und Verehrung gelesen und zitiert, sie inspirieren Kunst, Ethik, Literatur, Musik und Erzählkultur stärker als andere religiöse Texte.
10. Die Schrift gilt als in einer himmlischen oder jenseitigen Welt sozusagen »archetypisch« präsent. Oft besteht die Vorstellung, daß sie den Menschen eigens offenbart wird, aber bei Gott oder den Göttern schon vor ihrer irdischen Niederschrift existiert hat.
11. Die Schrift wird von einer Religionsgemeinschaft begrifflich oder in einem rituellen Vollzug von anderer religiöser Literatur unterschieden. Sie hat einen qualitativ anderen und höheren Stellenwert als sonstige religiöse Literatur, auch wenn diese andere Literatur durchaus hochgeschätzt wird. Besondere Zitationsformeln können das verdeutlichen.
12. Es gelten besondere Regeln für den respektvollen Umgang mit dem materiellen Träger der Schrift, d.h. mit dem Buch, der Schriftrolle o.ä. Diese unterscheiden Heilige Texte deutlich von sonstiger Buchkultur.
Keines dieser Kriterien definiert allein eine Heilige Schrift. Jedes dieser Kriterien kann auch fehlen. Insofern handelt es sich um eine »Familienähnlichkeit« von Texten. Familienähnlichkeiten definieren sich über eine Reihe von (optischen oder Verhaltens-) Eigenschaften, von denen jede einzelne auch ausfallen kann, die aber doch zusammengenommen das »Typische« einer Familie beschreiben. Einige weitere Erklärungen und erste Beispiele werden hilfreich sein.
Zu 1. Dabei sind Heilige Schriften – um eine Unterscheidung aus der altprotestantischen Orthodoxie zu verwenden – eher Norma normans (verbindliche Norm, die selbst anderes normiert) als Norma normata (Norm, die sich ihrerseits an einer übergeordneten Norm messen lassen muß). Mit dieser Begrifflichkeit unterschieden die lutherischen Kirchen im späten 16., frühen 17. Jhdt. zwischen der Art von Verbindlichkeit und Normativität, welche der Bibel (als der christlichen Heiligen Schrift) einerseits und den lutherischen Bekenntnisschriften (Texten wie der Confessio Augustana von 1530 oder dem zusammenfassenden Konkordienbuch von 1580) andererseits zukamen. In der Religionsgeschichte ist dieses Kriterium oft weniger zentral als vom Christentum her zu erwarten: viele Heilige Schriften normieren z. B. eher Rituale und Gebete (die Veden, das Avesta) als Glaubensvorstellungen.
Zu 4. Oft werden Streitigkeiten und Diskussionen in einer Religion unter Berufung auf ihre Heiligen Schriften geführt. Wörtliche Zitate sind dabei von großer Bedeutung. Auch gibt es – parallel in verschiedenen Religionen – verschiedene Typen von Auslegungen. »Puristen« wollen die Religion freihalten von späteren Entwicklungen, und vertreten oft ein »sola scriptura«-Prinzip wie der christliche Protestantismus. »Mystiker« wollen einen verborgenen Tief- und Hintersinn heiliger Schriften entdecken, der sich oft erst in der Versenkung oder existentiellen Berührung mit der Gottheit erschließt. »Dogmatiker« wollen die inhaltlichen Aussagen Heiliger Schriften in kohärente gedankliche Systeme fassen und diese vor den Fragen ihrer Gegenwart verantworten, usw. Die Muster der Schriftauslegung ähneln sich in den verschiedenen Religionen erstaunlich, auch wo es keine direkten kommunikativen Kontakte gegeben hat. Es ließe sich geradezu eine Typologie des interpretierenden Umganges mit Heiligen Schriften aufstellen, wie er in den verschiedenen Religionen praktiziert wird. Wichtig ist die nahezu universelle Gültigkeit des Phänomens »Auslegung«. Heilige Texte sind konstante Referenzgrößen für die gedankliche Entwicklung und Vertiefung von Religionen.
Zu 5. Offenbarungsliteratur – also Texte, die beanspruchen, aus einer göttlichen Offenbarung zu stammen, oder von denen das geglaubt wird – und Heilige Schriften überschneiden sich, sind aber keineswegs identisch. Während im jüdisch-christlichen Bereich das zentrale Interpretament der Offenbarung die Inspiration ist – Heilige Texte gelten als vom Heiligen Geist inspiriert (s. unter Kap. 2.) – existieren in anderen Religionen auch andere Interpretamente religiöser Legitimation. Die tibetische Literatur etwa – um ein uns kulturell fernerliegendes Beispiel zu kontrastieren – kennt eine eigenen Kategorie des »Schatzfundes«: Bücher, die nach der Legende vorzeiten von bedeutenden heiligen Männern geschrieben und in der Erde (etwa in Gräbern), in Klostermauern oder Götterstatuen verborgen und zu einem späteren Zeitpunkt »entdeckt« werden. Diese Texte heißen auf tibetisch gTer-ma »Schatz, Lagerhaus«, der Entdecker ist ein gTer-ston »Schatzfinder«. In der Nyingma-Schule des tibetischen Buddhismus sind sie v.a. mit dem hochverehrten Namen Padmasambhavas verbunden (tibetisch Guru Rinpoche), der den Buddhismus in Tibet im 8. Jhdt. begründete. Die tibetische Überlieferung kennt sogar Texte, welche der Sage nach mehrere Phasen der »Verborgenheit« erlebt haben, und jeweils wiederentdeckt wurden.
Eine Erzählung von der Auffindung Heiliger Bücher im Grab des altrömischen Königs Numa im Jahr 181 v. Chr. wurde in der späten Republik von Varro überliefert (bei Plinius d. Ält., Naturalis historia 13, 84–87; Augustinus, De civitate dei 7, 34, 1-15). Auch an das Buch Mormon und seine Auffindungsgeschichte wird man denken dürfen (s. Kap. 23), und eine arabische Legende wohl aus dem 8. Jhdt. weiß zu erzählen, wie der griechische Weise Balinas (Apollonius von Tyana, 1. Jhdt. n. Chr.) in einer Grabkammer die Urfassung der »Tabula Smaragdina« gefunden habe, des Grundtextes der arabischen Alchemie, die ein mumifizierter König auf einem goldenen Thron in Händen hält. Weitere und ganz unterschiedliche Legitimations- und Autorisierungsmuster Heiliger Schriften werden uns im folgenden passim begegnen. Wichtig ist es, hier nicht einfach die jüdisch-christlichen Vorstellungen zu verallgemeinern. Was eine Schrift »heilig« (o.ä.) macht, wird in den verschiedenen Religionen ganz unterschiedlich bestimmt bzw. narrativ ausgefüllt. Den Topos, die Heiligen Schriften seien einmal »vergessen« worden, und hätten dann neu von Esra veröffentlicht werden müssen, kennt freilich auch das Judentum (babylonischer Talmud, Sukka 20a); doch ist nicht an einem materielle Wiederauffindung gebracht (doch vgl. in Kap. 2 zur Auffindungslegende des Deuteronomiums). Er erreicht aber nie jene Bedeutung, die er v. a. in Tibet hat.
Noch eine weitere, dem heutigen Menschen fremde Vorstellung kann das verdeutlichen. Eher eine volkstümliche Form von Offenbarungsliteratur ist auf den ersten Blick der Himmelsbrief, ein Text (oft in Briefform), der beansprucht, im buchstäblichmateriellem Sinn aus dem Himmel zu stammen, also z. B. von einem Engel überreicht worden zu sein. Solche Himmelsbriefe spielen in der christlichen, aber z. B. auch der chinesischen Sagen- und Legendenbildung eine Rolle, sie werden vielfach als Amulette und Talismane verwendet (z. B. als Stallsegen, als Sprüche gegen Kriegsgefahr oder Feuersbrünste, oder als Orakeltexte), und gehören meist in den Bereich des Schutzzaubers und seiner Legitimitionsvorstellungen. In den Bereich eigentlicher Heiliger Schriften im engeren Sinn führen sie zwar kaum, sondern bilden eher ein Stück verbreiteten Volksglaubens. In Deutschland waren noch in den 1920er Jahren in Form bedruckter Bilderbogen wohlbekannt. Dabei hatten sich bestimmte feste Typen herausgebildet (Gredoria-Typ, Holsteiner-Typ, Graf-Philipp-Brief, Kaiser-Karl-Brief u.a.). Die christlichen Kirchen haben ihre Verbreitung meist als abergläubisch zu verhindern versucht, allerdings ohne großen Erfolg. »Himmesbriefe« gab es jedoch auch schon z.B. in der antiken jüdischen und altchristlichen Literatur (Hesekiel 2, 9-3, 2; vgl. Apk. 10 und die »Adlerbriefe« Paralipomena Jeremiou 7f.), in altkirchlichen Sekten (Eusebius, Historia ecclesiatica VI, 38 von den Elkesaiten), und auch schon im alten Ägypten (Totenbuch). In der hellenistischen Literatur ist das Motiv nicht selten (Briefe des Asklepios), zuweilen satirisch verfremdet (so bei Lukian im 2. Jhdt.). Vielleicht verwendet 2. Kor. 3, 3 den Himmelsbrief als Metapher für den von Gott gesandten Apostel.
Zu 8. Manche Sammlungen Heiliger Schriften enthalten daher – wie das Alte Testament – auch durchaus profane (weltliche) Texte, weil diese eben Teil der wenigen wirklich »alten« erhaltenen Schriften sind. »Alter« hat im Kontext Heiliger Schriften oft eine besondere, religiöse Qualität. Heilige Schriften sind oft Dokumente eines sakralen »Anfangs«, einer heiligen Zeit.
Zu 9. Zum besonderen Umgang mit den heiligen Schriften einer Religion gehört insbesondere das Auswendiglernen von Texten. In vielen islamischen Ländern sind z. B. Wettbewerbe in der Kenntnis des Korans beliebt – mittlerweile auch als Fernsehinszenierungen mit Showelementen (etwa im ägyptischen Fernsehen). Zahlreiche Heilige Schriften wurden jahrhundertelang überhaupt nur mündlich übermittelt, bei vielen hat die mündliche Tradition immer ein Eigengewicht neben der schriftlichen Überlieferung gehabt. So gilt es etwa für den hinduistischen Raum, wo die Veden bis in die jüngste Zeit immer eher von einem Lehrer und daneben im kultischen Vollzug als allein aus Büchern erlernt wurden. Zahlreiche gebildete Hindus können zumindest die (jüngere) Bhagavadgita auswendig. Die evangelischen Kirchen in Deutschland haben sich erst seit wenigen Jahrzehnten von der alten Praxis des Auswendiglernens heiliger Texte etwa im Konfirmandenunterricht verabschiedet (beziehungsweise sie auf ein Minimalmaß reduziert). In anderen Religionsgemeinschaften wäre eine solche Minimierung des religiösen Lernstoffes undenkbar, so ist es in den Ländern des Theravada-Buddhismus üblich, daß Kinder eine Reihe elementarer ethischer Regeln (z. B. die 5 silas), daneben aber auch manche Verse aus dem Dhammapada auswendig lernen, wenn irgend möglich auch auf Pali. Daneben wird die Schrift selbst oft an Texten aus den Heiligen Büchern erlernt. So erwerben bereits 4- und 5-jährige Kinder in Koranschulen (Madrassen) Koran- und damit auch Arabischkenntnisse. Zumindest die 1., die 96. und die 112. Sure kann sehr bald jedes islamische Kind auswendig; bis zum Erwachsenenalter tritt auch bei nicht-akademisch gebildeten Muslimen nicht selten praktisch der ganze Koran hinzu. Wer alle 6236 Verse des Koran (die Zählungen variieren) auswendig und auch tatsächlich aufsagen kann, darf sich stolz »Hafiz« nennen – eine Ehre, die in allen islamischen Ländern mit Prestige und Ansehen verbunden ist. Auch blinde oder sonst körperbehinderte Menschen werden gerne »Hafiz«, und können sich auf diese Weise Prestige und eventuell eine Einnahmequelle erwerben, wenn sie zu feierlichen Koranrezitationen geladen werden. Der traditionelle (rabbinische) jüdische Unterricht begann mit der Lektüre des Buches Leviticus und orientierte sich die ersten Jahre fast ausschließlich an Texten der hebräischen Bibel, eher er später zu Mischna und Talmud fortschritt. Auch dabei hatte das Auswendiglernen einen altgeheiligten Platz inne.
Häufig sind bestimmte, für andere Bücher nicht übliche Methoden und Stile des Rezitierens, des öffentlichen Vortrags, überhaupt der inszenierenden Performanz. Die jüdische Tora und der islamische Koran werden traditionell in ganz spezifischer, kantilierender Weise vorgetragen, die eigens erlernt werden muß. Auch im christlichen Kontext hat eine Schriftlesung im Gottesdienst einen anderen »Klang« als ein sonstiges Zitat. (Selbst evangelischer und katholischer Vortragsstil lassen sich dabei oft deutlich unterscheiden). Diese Besonderheit des »Klangs« macht die Heiligen Texte einer Religion für die Gläubigen leichter identifizierbar, und drückt eine besondere Wertschätzung aus. Das »Chanten« heiliger Texte in buddhistischen Klöstern, das in gleichbleibendem Rhythmus und meditativer Versenkung geschieht, gehört zu den unvergesslichen Eindrükken für jeden Besucher. (Ihm korreliert die inhaltliche Redundanz vieler buddhistischer Texte, die eben für einen solchen meditierenden Vollzug geschrieben sind, der mit abendländischen Lesegewohnheiten praktisch unvereinbar ist). Das »Chanten« dient für Mönche und Nonnen im Buddhismus sowohl meditativen Zwecken als auch der Überwindung böser (z. B. unangemessener libidinöser) Einflüsse. Es schaltet den Geist von unruhiger Bewegtheit zu ruhiger Betrachtung um, und darf keinesfalls als »mechanische« rituelle Übung mißverstanden werden. Die Nachahmung des typischen Rezitationsstils für Heilige Schriften mit profanen Texten in einer nichtreligiösen Situation (z. B. einem Kabarett) hat für Gläubige oft etwas absichtlich Provozierendes, Religionsverachtendes, zuweilen geradezu Blasphemisches. Das Wissen um solche Empfindlichkeiten (die in hohem Maße kulturell variabel sind) gehört zur notwendigen Allgemeinbildung einer künftigen multireligiösen Gesellschaft (womit noch keineswegs präjudiziert sein soll, wie mit dabei entstehenden Problemen umzugehen sein wird).
Eine verehrende Rezeption muß nicht primär inhaltlicher Art sein (und dann pädagogisch vermittelt werden), sondern kann z. B. auch Ikonographie, Theater, Musik prägen. Heilige Schriften bestimmen nicht nur, was Religionen glauben – sie spannen einen Symbolraum aus, ein symbolisches Universum, in dem Gläubige leben und das ihre Lebenserfahrungen deutet und verstehbar macht. Sie prägen nicht nur ethische Praxis, sondern auch und oft vor allem rituelle Vollzüge. Dieser rituelle Bezug Heiliger Texte ist für Christen oft gewöhnungsbedürftig, die geneigt sind, Texte in erster Linie als Träger von »Inhalt«, »Bedeutung« zu verstehen. Aber viele Heilige Texte sind rituelle Handlungsanweisungen (z. B. im Falle von Avesta und Veden), die daher oft nur in Form von Andeutungen und Anspielungen erzählendes Gut tradieren. Begrifflich entfaltete »Theologie« kann aus solchen Texten oft überhaupt nicht entnommen werden; diese liegt nicht in ihrem Blick.
Zu 10. Die Tora gilt in manchen Richtungen des Judentums als Bauplan der Welt, d.h. es besteht die Vorstellung, Gott habe die Welt nach der schon vor Beginn der Welt (»präexistent«) bestehenden Tora geschaffen und gestaltet. Ähnlich glauben viele Muslime, der Koran existiere im Himmel als himmlisches Urbild bzw. sogar als eine Art »Urexemplar«, welches dem Propheten Mohammed sukzessive offenbart worden sei. Damit wird die Welt in ihrer Geschöpflichkeit zu einer Art Entfaltung der Tora bzw. des Korans. Solche Gedanken eignen sich zur philosophischen Vertiefung und Ausdeutung. Sie stehen im allgemeinen nicht am Anfang der Geschichte der betreffenden Religionen, sind aber doch von hohem Alter. Verwandt ist im Judentum z. B. die schon sehr früh bezeugte Idee, die Stiftshütte oder später der Tempel, also das zentrale Heiligtum der Überlieferung, sei nach einem »himmlischen Bauplan« erbaut worden (Ex. 25, 9. 40: die Stiftshütte wird nach dem tabnit »Modell« geschaffen, das Mose auf dem Berg Sinai gesehen hat). In einem weiteren Schritt wurde die Tora mit der präexistenten Weisheit, mit deren Hilfe Gott die Welt geschaffen habe, identifiziert (Sirach 1, 1-5. 26; 15, 1; 24, 1ff.; 34, 8; vgl. schon Sprüche 8, 22-31). Zur Annahme einer förmlichen Präexistenz der Tora war es dann nicht weit (Genesis Rabba 1, 4; babylonischer Talmud, Pesachim 54a u.ö. gehört die Tora zu den sechs bwz. sieben Dingen, die vor der Welt selbst erschaffen wurden). Nach dem Jerusalemer Talmud, Scheqalim 6, 1, 49d war sie in schwarzem Feuer auf weißem Feuer geschrieben. Nach Rabbi Aqibah (2. Jhdt.) war sie das Instrument, mit dem Gott die Welt schuf (Mischna Abot 3, 14). Andere jüdische Denker wie Saadja Gaon haben solche Ideen abgelehnt; sie waren für Juden nie »Dogma«, sondern ein traditionelles Interpretament der Toraverehrung. Auch der Koran wurde nach islamischer Überzeugung »herabgesandt« (Koran, Sure 26, 195 u.ö.), d.h. er existiert bereits vor seiner Offenbarung an den Propheten. Damit wird er zur »Mutter des Buches« (Sure 43, 3f.). Nur die Engel können diese Urschrift berühren (Sure 56, 77-80). Zwar versuchten auch im Islam die Mu taziliten u.a. eher rationalistisch geprägte Theologien, die Vorstellung eines »himmlischen Buches« zu vermeiden, haben sich damit aber nicht durchsetzen können. Andere mythologische Interpretamente für den Ursprung Heiliger Schriften werden uns im folgenden immer wieder begegnen.
Das Motiv des Heiligen Buches überschneidet sich hier mit dem an und für sich nicht identischen Motiv des »Himmlischen Buches«. Schon altorientalisch sind die »Schicksalstafeln« der Götter, die auch im Schöpfungsgeschehen eine Rolle spielen. Seltener ist die Verehrung eines irdischen »Urexemplares«, obwohl alte Papyri, Inschriften o.ä. mit Heiligen Texten, die dicht an der Zeit ihres Ursprunges liegen, immer besonderes Interesse gefunden haben. Im Normalfall aber verfügen Religionen kaum über die Autographen ihrer Heiligen Schriften; die ältesten Textzeugen des Neuen Testaments etwa stammen aus dem 2. Jhdt.
Zu 12. Muslime wundern sich oft über den von ihnen als respektlos erlebten Umgang von Christen mit der Bibel, d.h. mit dem materiellen Gegenstand eines Bibelbuches. Muslime selbst dagegen waschen sich z. B. meist die Hände, bevor sie einen Koran aufschlagen, sie bewahren ihn in einer besonderen Hülle, an einem geschützen und hervorgehobenen Ort und auf jeden Fall getrennt von anderen Büchern auf. Sie würden den Koran niemals auf dem Boden oder an einem unreinen Ort liegenlassen. Viele Religionen haben feste Tages- oder Wochenzeiten, zu denen das Studium oder die Lektüre der heiligen Schrift zur festen Gewohnheit gehören. Oft ist dies z. B. der frühe Morgen, so bei den Sikhs oder den Mitglieder der koreanischen Vereinigungskirche (vgl. auch Koran, Sure 17, 78). Häufig sind auch im privaten Vollzug besondere Traditionen des Zitierens oder Kantilierens der Texte, die ein Schriftzitat oder eine Schriftlesung sofort erkennbar machen.
Im traditionellen Judentum werden unbrauchbar gewordene Heilige Schriften (auch andere Bücher, die den Gottesnamen enthalten) nicht weggeworfen, sondern in einem besonderen Raum der Synagoge gesammelt (der »Geniza«), der schließlich, wenn er angefüllt ist, zugemauert wird. Ähnlich werden auf Sri Lanka schadhaft gewordene Texte in Dagobas aufbewahrt, den »Hügelschreinen«, die auch als Reliquienstätten dienen und weithin sichtbar sind (andernorts im indischen Raum heißen sie Stupas).
Literatur (Allgemeines): Außer den im Vorwort genannten Büchern vgl. u.a. Frederick F. Bruce, Ernest G. Rupp (Hrg.), Holy Book and Holy Tradition. Manchester 1968 * Frederick M. Denny, The Holy Book in Comparative Perspective. Columbia, SC 1985 * Harold G. Coward, Sacred Word and Sacred Text. Scripture in World Religions. Maryknoll, NY 1988 * Jacob Neusner (Hrg.), Religious Writings and Religious Systems. Systematic Analysis of Holy Books in Christianity, Islam, Buddhism, Graeco-Roman Religions, Ancient Israel, and Judaism. Atlanta, GA 1989 * Wilfred Cantwell Smith, What is Scripture? A Comparative Approach. Minneapolis, MN 1993.
Von heiligen Schriften zu unterscheiden sind Klassiker. Diese gelten in Inhalt und Stil oft als vorbildlich, besitzen aber nicht den begründenden Rang, den Heilige Schriften für eine Religion innehaben. Insbesondere verbinden sich mit ihnen meist nicht die spezifischen Legitimationsvorstellungen, die Heilige Schriften kennzeichnen (»göttliche Inspiration« oder sonst übernatürlicher Ursprung). Doch sind die Grenzen fließend. Zusammenfassende Studien über Heilige Schriften enthalten z. B. oft auch ein Kapitel über die jüdischen Talmude (den babylonischen und palästenischen Talmud, die in der Spätantike entstanden sind). Diese galten im Judentum niemals als Heilige Schriften, sind aber in gewissem Maße für das rabbinische Judentum normativ (vor allem der babylonische Talmud) und stellen in jedem Fall Klassiker einer wesentlichen Richtung des Judentums dar. Und etwa im Buddhismus gelten auch viele späte Texte, die niemals Teil eines Kanons im engeren Sinn wurden, als »übernatürlich verursacht bzw. offenbart«. Andere Schriften sind im religiösen Alltag als Bild- und Metaphernspender und Quelle wesentlicher Vorstellungen allgegenwärtig, aber dennoch keine Heiligen Schriften. Viele solcher Grenzfälle werden in diesem Buch näher zu diskutieren sein. Puristische Grenzziehungen und allzu enge Definitionen sind für unser Thema nicht nützlich. Doch sind verehrte religiöse Texte einer Tradition deswegen noch keine Heiligen Schriften. Eine zu weite Ausweitung des Begriffs entspricht nicht dem Verständnis der Religionen von ihren schriftlichen Überlieferungen und ist deshalb auch religionswissenschaftlich nicht sinnvoll. Im allgemeinen betrachten wir als die Heiligen Schriften einer Religion solche Texte, die von diesen selbst – etwa im interreligiösen Gespräch – mit einem solchen Rang und Status versehen werden. Die unterschiedlichen Legitimationsmodelle u.ä., die dabei zum Tragen kommen, sind selbst Gegenstand religionswissenschaftlicher Forschung, nicht aber Bewertung.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist zur Sprache zu bringen. Heilige Schriften sind dies als Ausdruck einer Religionsgemeinschaft. Sie sind eine soziale Größe, d.h. sie erhalten ihren Rang, ihren Status, ihr Ansehen wesentlich durch eine Gemeinschaft. Innerhalb dieser Gemeinschaft können sie in ganz unterschiedlicher Weise Verwendung finden, aber ohne Religionsgemeinschaft gibt es keine Heiligen Schriften. Auch dies unterscheidet sie von »spirituellen Klassikern«, vor allem in der modernen westlichen Welt. Klassiker sind Teil einer allgemeinen Kultur; sie werden nicht durch ihre Funktion für eine Religionsgemeinschaft bestimmt. Viele Heilige Schriften werden zu spirituellen Klassikern – oft gerade auch, manchmal sogar in besonderer Weise, außerhalb der sie tragenden Religionsgemeinschaft, wie es mit der Bhagavadgita oder dem Daodejing im Westen geschehen ist. Aber umgekehrt sind Klassiker deswegen noch keine Heiligen Schriften, vor allem wenn ihre Rezeption nur ein individueller Akt bleibt, und sie keine in irgendeinem Sinn »offizielle« Funktion für eine Religionsgemeinschaft haben.
Nicht alle Religionen sind Schriftreligionen. Tatsächlich ist der Typ der Schriftreligion erst historisch entstanden, und zwar keineswegs parallel zur Entstehung von Schriftlichkeit bzw. einer Schriftkultur überhaupt. Carsten Colpe hat vor Jahren die These vertreten, es habe überhaupt nur zwei voneinander unabhängige Prozesse der Kanonisierung Heiliger Texte in der Religionsgeschichte gegeben: denjenigen des Alten Testaments (der Hebräischen Bibel), und denjenigen des Tripitaka, des ältesten buddhistischen Kanons. Alle anderen Kanonisierungsprozesse seien in Anknüpfung und Widerspruch von diesen letztlich abhängig – das Neue Testament, der Koran, das Buch Mormon etc. vom Alten Testament, der jainistische und hinduistische Kanon und auch die diversen Kanones der chinesischen Religionen letztlich vom buddhistischen Kanon (z. T. in bewußter Nachahmung, die aber auch der Abgrenzung dienen kann). Diese These ist mit einiger Sicherheit überzogen – sie ist z. B. weder für das Avesta noch für den chinesischen Raum plausibel. Sie weist aber doch darauf hin, daß sich viele Heilige Schriften – gerade als Heilige Schriften, als Kanon einer Religionsgemeinschaft – im stillschweigenden oder auch lauten kritischen Gespräch mit anderen Religionen befinden. Der Koran ist ohne die islamischen Theorien über angebliche Verfälschungen der jüdischen und christlichen Heiligen Texte nicht zu verstehen. Der Pali-Kanon polemisiert heftig gegen die Welt des älteren Brahmanismus, einer frühen Form des Hinduismus. Das Buch Mormon ist von Anfang an als »3. Testament«, als Ergänzung der christlichen Bibel geschrieben, usw. Andererseits versteht sich etwa das Neue Testament des Christentums als Zeugnis einer »Erfüllung« der Prophetien des Alten Testaments, setzt dieses also ständig voraus. Diese sehr unterschiedlichen Formen der Bezugnahme auf frühere »Kanones« als Referenzgrößen müssen in eine vergleichende Analyse der Heiligen Schriften einbezogen werden. Man kann dies die durchgehende Referentialität Heiliger Texte nennen.
Literatur: Carsten Colpe, Art. Heilige Schriften, Reallexikon für Antike und Christentum 14 (1988), 184–223 * Ders., Sakralisierung von Texten und Filiationen von Kanons. In: Aleida und Jan Assmann (Hrg.), Kanon und Zensur. München 1987, 80–92.
Es besteht die sehr auffällige Tendenz, daß alle Religionen, die im Kontakt mit – oder im Schatten – einer Schriftreligion stehen, Züge einer solchen annehmen. Dies geschieht durch Verschriftlichungs-, Kanonisierungs- und Sakralisierungsprozesse von traditionellen Inhalten. Dies Beobachtung gilt keineswegs nur im Umfeld von Christentum und Islam. Z. B. bildet die alttibetische Bonreligion im Umfeld des buddhistischen Kanons (in seiner tibetischen Gestalt als Kanjur und Tanjur) selbst nicht nur Heilige Schriften, sondern einen organisierten Kanon ihrer Heiligen Texte heraus. Im islamischen Kulturraum hat die Differenzierung zwischen Religionen, die ein Offenbarungsbuch besitzen (ahl al-kitab »Volk des Buches«), und solchen, bei denen das nicht der Fall ist, zu weitreichenden Veränderungen in der »religiösen Landschaft« des Orients geführt. Religionsgemeinschaften konnten sich in der islamischen Welt nur behaupten, wenn sie Schriftreligionen waren. Als solche waren sie im Islam zumindest grundsätzlich geduldet (mußten aber z. B. eine Kopfsteuer zahlen), während Polytheisten ohne »Heilige Texte«, die sich auf eine nach islamischer Theologie authentische Offenbarung nicht berufen konnten, im Zuge der Ausbreitung des Islam regelmäßig vor die Wahl Tod oder Konversion gestellt wurden. Mandäer, Zoroastrier und andere Gruppen haben sich im Zuge dieser Rahmenvorgaben klarer als vormals als Buchreligionen und Gründungen durch eine biblische bzw. koranische Prophetengestalt profiliert; die erwähnten gnostischen Mandäer etwa haben Johannes den Täufer zum zentralen Gewährsmann ihrer Überlieferung gemacht, was er in vorislamischen mandäischen Traditionen noch nicht ist.
Sinnvoller als eine zu enge literarische Abgrenzung Heiliger Schriften ist eine mehrschichtige Typologie, die auch Rand- und Grenzphänomene berücksichtigt, insbesondere in religions-soziologischer Hinsicht. Dabei sind verschiedene Unterscheidungskriterien möglich. Eine auf den ersten Blick schlichte Unterscheidung nach der Länge der Texte führt in Wahrheit bereits auf wichtige soziologische Differenzen:
1. Manche religiöse Gruppen besitzen ein heiliges Buch von beschränktem Inhalt und Umfang, welches in vielen Fällen v.a. die Differenz gegenüber einer Mutterreligion definiert. So wird man sich den judenchristlichen Gebrauch von Varianten des Matthäusevangeliums vorzustellen haben (»Hebräerevangelium«, »Nazoräerevangelium« etc.; sie alle waren Varianten des großkirchlichen Matthäusevangeliums und sind heute nur noch in Fragmenten erhalten), und ähnlich auch das Buch Elxai oder Elchasai der oben schon einmal erwähnten altkirchlichen Gruppe der Elkesaiten aus dem frühen 2. Jhdt. (ebenfalls in Fragmenten erhalten). Manche gnostischen Gemeinschaften haben sich offenbar ebenfalls durch einen einzelnen Text definiert, so vielleicht eine »Thomas-Gruppe« durch das gnostische Thomasevangelium. Über die Details wissen wir leider nur wenig. Deutlichstes Beispiel ist der Islam, dessen Koran sehr dezidiert ein Buch ist (im Gegensatz zu AT und NT, die Büchersammlungen darstellen). Auch viele Mahayana-Richtungen kennen zwar einen großen Kanon mit vielen Schriften, verehren aber in ihrer religiösen Praxis doch ganz überwiegend einen Text, z. B. das Lotossutra oder die drei zusammengehörigen Reines-Land-Sutras (s. Kap. 14).
2. Manche religiöse Gruppen besitzen einen kleinen Kanon mit wenigen Texten, die aus zahlreichen möglichen anderen Texten ausgewählt wurden. Ein solcher Kanon hat oft ebenfalls klar abgrenzenden Charakter. Er soll vielfach genau definieren, was in einer Glaubensgemeinschaft geglaubt wird – und was nicht. Zugleich bestimmt er oft die soziale Gestalt der Religionsgemeinschaft. Hier ist an das Neue Testament der christlichen Kirchen zu denken, oder an Sammlungen vieler Neuer Religiöser Bewegungen wie der Bahai. Auch der konfuzianische Kanon mit seinen 5 »Klassikern« und ergänzenden 4 »Büchern« (die erst in der Song-Dynastie zusammengestellt wurden) ist in seinem Umfang überschaubar. In seiner in China jahrhundertelang staatstragenden Funktion (v. a. in der Beamtenausbildung) dient er ebenfalls einer Grenzziehung gegen alles »Fremde«.
3. Andere religiöse Gruppen besitzen größere Sammlungen, die eine längere Geschichte der Religion, etwa in einer Gründungsphase, oder auch über mehrere Jahrhunderte einer »Frühzeit«, dokumentieren. Das Alte Testament – die Hebräische Bibel bzw. der Tenach des Judentums – enthält Texte aus fast einem Jahrtausend. Ähnliches dürfte für das Avesta gelten. Diese und ähnliche Sammlungen dokumentieren die frühe Zeit einer Religion; manchmal stellen sie faktisch die einzigen literarisch überlieferten Quellen für diese Epoche dar. Umgekehrt definieren die Heiligen Texte einer Religion in diesem Sinn eine »kanonische«, d.h. maßgebende Zeit. Nach einer altjüdischen Auffassung (die von der alttestamentlichen Wissenschaft nicht mehr geteilt wird) endet der Kanon zeitlich mit Esra – dem letzten der Propheten, der dann manchmal mit Maleachi identifiziert wird (nach dem babylonischen Talmud, Traktat Megillah 15a; vgl. im apokalyptischen 4. Esra-Buch 12, 42). Es ist nicht die Heilszeit, die hier den Kanon definiert, sondern eher umgekehrt der Kanon, der eine frühere Zeit der Offenbarungsgeschichte abgrenzt. Mit dem zeitlichen Ende bzw. Abschluß des Kanons ist auch eine maßgebliche »Urzeit« vorbei, auf welche die gegenwärtige Zeit nur sehnsuchtsvoll zurückblicken kann. Die japanischen Sammelwerke Kojiki und Nihongi definieren die mythischen und legendären Anfänge Japans und damit zugleich den nationalen Charakter vor aller Durchdringung mit »Fremden«. Sie sind daher ebenso kulturelle wie religiöse Referenzgrößen. Ähnliches gilt auch für viele andere kanonische Sammlungen.
4. Wiederum läßt sich ein weiterer Typ beschreiben, der aus sehr umfangreichen, additiv angelegten Sammlungen besteht, die hunderte, oft sogar tausende von Texten umfaßen. Hierher gehören die Sammlungen des Daoismus und des chinesischen Buddhismus (Daozang und Sanzang), die große Teile der jeweils erreichbaren älteren religiösen Literatur dieser Religionen vereinen, und auch die tibetischen Sammelwerke Kanjur und Tanjur, die ein Vielfaches des Umfanges der Bibel besitzen. Solche »umfangreichen Kanones« gibt es auch – mutatis mutandis – in jüngeren Religionen. Die Church of Scientology etwa verehrt das gesamte nichtliterarische Werk ihres Gründers L. Ron Hubbard nach Gründung von Scientology 1954 als ihre Heiligen Texte. Diese haben einen Umfang von mindestens etwa 300 Bänden (wenn man transkribierte Vorträge hinzurechnet). Nur in einem weiteren Sinn hierzu gehören die frühen dianetischen Texte Hubbards (1950–1954), während das umfangreiche späte Romanwerk Hubbards (das zeilich jünger ist als seine scientologischen Schriften!) nicht den Status einer Heiligen Schrift innehat, sondern nur als »klassische Literatur« gilt (weitere Details hierzu in Kap. 26).
Kleine Kanones, also Sammlungen mit sehr begrenztem Umfang, haben oft eine abgrenzende Funktion, vor allem, wenn sie einen größeren älteren Kanon als Referenzgröße benutzen. Sie definieren dann nicht die Summe einer Religion, sondern nur ihre Differenz etwa gegenüber einer Mutterreligion. Das gilt in gewissem Sinn für das Neue Testament, aber z. B. auch für viele Mahayana-Schriften, die je in einer bestimmten Richtung die Stellung eines Grundtextes einnnehmen. Sehr große Kanones – die Hunderte, manchmal mehrere Tausend Texte umfassen – dagegen sind eher additiv angelegt: sie wollen die Summe einer religiösen Überlieferung sammeln. Dazu hat es im Christentum kaum Ansätze gegeben. In den orientalischen Kirchen wurden allerdings immerhin zum Teil auch Schriften tradiert, die in den westlichen Kirchen als apokryph gelten. Insbesondere hat die äthiopische Kirche eine Reihe jüdischer Texte (zum Teil in christlichen Überarbeitungen) innerhalb ihres »Alten Testaments« bewahrt, die im Westen keine Rolle spielen, so das »äthiopische Henochbuch«. Wir können hier erste Ansätze eines »additiven« Kanons beobachten, die sich jedoch nicht weiterentwickelt haben. Insgesamt besitzt keine jüdische, christliche oder muslimische Gruppe einen additiven Kanon im engeren Sinn, der etwa mit Sanzang oder Daozang vergleichbar wäre – ein solcher verträgt sich offenbar nicht mit den präzisen Abgrenzungsbedürfnissen monotheistischer und prophetischer Religionen. Extrem umfangreiche Kanones sind eher ein Kennzeichen asiatischer Religionen, aber auch einiger Neuer Religiöser Bewegungen. Oft (keineswegs immer) entspricht ihnen eine inhaltliche Toleranz für ein breites Spektrum religiöser Ausdrucksmöglichkeiten. Manche Religionen betrachten auch das gesamte (manchmal sehr umfängliche) Schrifttum der Gründerpersönlichkeit als Analogon zu den traditionellen Heiligen Schriften. So ist es der Fall bei den Bahai (die zahlreichen Schriften des Bahá’u’lláh), in der Church of Scientology (mit Einschränkungen, s. Kap. 26), in etwas anderer Form auch in der Anthroposophie (Rudolf Steiner).
Heilige Schriften können weiter nach ihrem sozialen Ort bzw. ihrer Performanz unterschieden werden. Manche Texte unterliegen extremer Geheimhaltung (d.h. die entsprechenden Schriften werden nur gegen den Willen der betreffenden Religionsgemeinschaft öffentlich gemacht), so Schriften der Yeziden und Drusen. Andere sind einem Klerus vorbehalten, der mit exklusivem Zugang ein Deutungsmonopol verteidigt. Hier wird man an die mittelalterliche und frühneuzeitliche Katholische Kirche zu denken haben. Die Heftigkeit, mit der die mittelalterliche und teilweise auch noch die neuere Katholische Kirche gegen die Bibel in Laienhand, vor allem aber in den Volkssprachen gekämpft hat, wird zwar von der heutigen Römisch-Katholischen Kirche in keiner Weise mehr fortgesetzt. Um der historischen Wahrheit willen muß aber doch gesehen werden, daß sie ein prägendes Stück abendländischer Kulturgeschichte gewesen ist. Die Bibel wurde jahrhundertelang als klerikales Herrschaftswissen gebraucht; jeder Versuch einer Verbreitung im Volk wurde unterbunden. Ein anderes Beispiel wäre die ältere Literatur der Veden, die in der alten Gelehrtensprache Sanskrit überliefert wird und deren Kenntnis bis ins 19. Jhdt. grundsätzlich den drei oberen Kasten, faktisch aber weithin den Brahmanen (Priestern) vorbehalten war.
Andere Heilige Schriften sind immer offen zugänglich gewesen oder wurden und werden sogar offensiv beworben. Der traditionelle Umgang der katholischen und der evangelischen Kirchen mit der Bibel unterscheidet sich bekanntlich in diesem Punkt, hat sich aber spätestens mit dem 2. Vaticanum weithin angeglichen. Viele (gerade neuere) Religionsgemeinschaften werben auch oder sogar primär mit ihren heiligen Texten. Auch hier können wir ein breites Spektrum des möglichen Umganges mit einem geheiligten Traditum beobachten. Ähnliches gilt für die zahlreichen Performanzformen zwischen privater Lektüre (in manchen Gruppen zu einer festgelegten Zeit, z. B. am frühen Morgen) und öffentlicher Inszenierung, etwa in einem Gottesdienst oder einer Opferzeremonie. In jedem Fall ist eine eurozentrische Sichtweise zu vermeiden, welche die Modelle christlicher Bibelrezeption (manchmal sozusagen stillschweigend) auf nichtchristliche Religionen überträgt. Insofern ist der Sammelbegriff »Heilige Schriften« nicht ohne Risiken: er suggeriert eine phänomenologische Einheitlichkeit, welche in der Religionsgeschichte so nicht gegeben ist. In manchen Religionen sind z. B. Formen des Gebrauchs wichtig, die das Christentum marginalisiert oder nie besessen hat. Man wird etwa an Verwendungen als Amulett und Talisman (im Christentum durchaus möglich), in Gebetsmühlen oder als Wahrsagebuch denken (das »Däumeln«, zu dem Vorformen schon aus der Alten Kirche bekannt sind), zur »Belebung« einer heiligen Statue (Ägypten, Indien, Tibet) u.ä. Bücher werden nicht nur gelesen – und dienen nicht nur der Belehrung. Einige Sufimeister lehren, der arabische Text des Koran wäre von solcher Heiligkeit, daß bei Unkenntnis der arabischen Sprache die Betrachtung der arabischen Kalligraphie einer Koranausgabe immer noch verdienstvoller und heilbringender wäre als die Lektüre einer nichtarabischen Übersetzung. Und das bloße andächtige Rezitieren des Titels des Lotossutras gilt in der Schule des japanischen Reformers Nichiren (1222–1282) als verdienstvolles Werk (japanisch: Nam(u) Myōhō Renge Kyō »Ich weihe mich dem Lotossutra«). Dies alles erinnert uns daran, die »Heiligkeit« von Heiligen Schriften nicht etwa nur in ihrem – etwa pädagogisch zu vermittelnden – Inhalt zu sehen. Als Heilige Schriften sind Texte »machtvoll«; sie können zu Heil und Unheil dienen. Dies wird in verschiedenen Religionen zwar ganz unterschiedlich zum Ausdruck gebracht, ist aber doch eine gemeinsame Überzeugung nahezu aller Religionsgemeinschaften.
Literatur: Johannes Leipoldt u. Siegfried Morenz, Heilige Schriften, Leipzig 1953, bes. 161–189 (Brauchtum und Zauber in Hinsicht auf Hl. Texte) * Geo Widengren, Religionsphänomenologie, Berlin 1969, 546–593 (vom Ansatz her überholt, aber gelehrt und voll wertvoller Einzelbeobachtungen) * Hermann Harrauer, Christian Gastgeber, Bibel und Amulett, in: Jürgen Schefzyk (Hrg.), Alles echt. Älteste Belege zur Bibel aus Ägypten, Mainz 2006, 37–43 (zum magischen Gebrauch biblischer Texte) * Iona Opie u. Moira Tatem, A Dictionary of Superstitions, Oxford 1989, 35f. s.v. Book: Opening at Random (Bibel als Wahrsagebuch) * Pieter W. van der Horst, Sortes: het gebruik van heilige boeken als lotsorakels in de oudheid. Amsterdam 1999 * Alfred Bertholet, Die Macht der Schrift in Glauben und Aberglauben. Berlin 1949 (allgemein zum »Machtaspekt« heiliger Texte).
Der Begriff Kanon. »Kanon« ist ursprünglich ein phönizisches Fremdwort im Griechischen und bezeichnet ein Rohr, inbesondere ein Meßrohr bzw. einen Meßstab, sowie dann die »Richtschnur, Norm«. In dieser Bedeutung wird der Begriff in der Alten Kirche im 4. Jhdt. wichtig, um die Sammlung Heiliger Schriften zu charakterisieren, die wir Bibel nennen. In religionswissenschaftlicher Anwendung wird der Begriff in allgemeinerer Bedeutung gebraucht, um inhaltlich fixierte, stabile Sammlungen Heiliger Schriften zu bezeichnen. Ein Kanon ist immer das Ergebnis eines Kanonisierungsvorganges. Dieser muß aber keineswegs »institutionell« getragen sein (etwa durch den Beschluß eines Konzils), sondern kann auch auf einer langsam gewachsenen Übereinkunft beruhen. Indem Kanonisierungsprozesse ab- und ausgrenzen, stehen sie jedoch oft in einem komplementären Verhältnis zu Zensurvorgängen, an denen die Religionsgeschichte nicht arm ist. Diese können ein unterschiedliches Maß an Aggression enthalten: von der stillschweigenden Übergehung über den expliziten Widerspruch bis zur aktiven Vernichtung von Texten, nicht zuletzt in der in manchen Kontexten (Mittelamerika, Spätantike, klassisches China) nicht seltenen Form der öffentlichen Bücherverbrennung. Das »Heilige Buch« findet dann seinen Schatten im »verbotenen Buch«, das ebenfalls als mit besonderer sakraler Mächtigkeit aufgeladen erscheinen kann.
Das Wort Kanon hat – was hier doch noch angemerkt werden sollte – im Christentum eine Reihe weiterer Bedeutungen angenommen. So bezeichnet es einen Abschnitt eines Textes, den ein Konzil verabschiedet hat (z. B. das Konzil von Nizäa oder Chalkedon), und in der orthodoxen Kirche eine von einer Synode oder einem Kirchenvater festgelegte Verhaltens- oder Verfahrensregel, von der ein Bischof jedoch in Ausnahmefällen abweichen kann. In der katholischen Kirche heißt darüberhinaus ein Abschnitt in Kodex des Kirchenrechts (Corpus Iuris Canonici, 1582 bzw. Codex Iuris Canonici, 1917 und völlig überarbeitet 1983) »Canon« (Mehrzahl Canones). »Kanonisierung« ist hier speziell außerdem die kirchenamtlich festgelegte Aufnahme in die Liste der kultisch geehrten Heiligen (die »Heiligsprechung«).
Literatur: Heinz Ohme, Kanon ekklesiastikos. Die Bedeutung des altkirchlichen Kanonbegriffes. Berlin u. New York 1998 * Aleida und Jan Assmann (Hrg.), Kanon und Zensur. Beiträge zur Archäologie der literarischen Kommunikation 2. München 1987 * Wolfgang Speyer, Büchervernichtung und Zensur des Geistes bei Heiden, Juden und Christen. Stuttgart 1981 * Ulrike Müller u. Gerd Schmidt, Bücherverbrennungen: Motive, Formen, Auswirkungen; mit einer Bibliographie. Stuttgart 1990 * Hans J. Schütz, Verbotene Bücher. Eine Geschichte der Zensur von Homer bis Henry Miller. München 1990 * Arie van der Kooij and K. van der Toorn (Hrg.), Canonization and Decanonization. Leiden u.a. 1998.
Übersetzungen Heiliger Schriften. Naturgemäß ist die Übersetzung Heiliger Schriften eine delikate, mit Sensibilität zu handhabende Angelegenheit. Dazu treten besondere Erschwernisse. Viele Heilige Schriften sind sehr alte Texte, nicht selten die ältesten, die wir in den betreffenden Sprachen besitzen. Manche Religionen haben auch Bedenken, überhaupt eine Übersetzung ihrer Heiligen Schriften zu fördern oder auch nur zu erlauben. Das bekannteste Beispiel ist sicher der Islam, der Übersetzungen des Koran in eine nichtarabische Sprache immer als hochproblematisch angesehen hat. Jahrhundertelang hat die durch den arabischen Koran geschaffene (wenn auch immer nur relative) religiöse Einheit die islamische Welt auch über das Religiöse hinaus kulturell zusammengehalten. Der Begründer der Unification Church (Vereinigungskirche), Reverend Sun Myung Moon hat vielfach seine Anhänger darauf hingewiesen, daß sie eigentlich alle die koreanische Sprache erlernen müßten (spätestens im Himmel werde ohnehin koreanisch gesprochen), und seine Vorträge und Schriften bevorzugt nicht auf Englisch (oder Deutsch), sondern auf Koreanisch lesen sollten. Diese Forderung wird allerdings nicht rigoros erhoben. Weniger bekannt ist, daß nach einer (wohl legendären) Überlieferung auch der historische Buddha Einwände gegen eine Übersetzung seiner Worte in eine andere Sprache als das ursprüngliche Māgadhī erhoben hat. Diese Bedenken haben allerdings die Entstehung einer buddhistischen Übersetzungstätigkeit kaum behindert. Die Sprache Buddhas sei nach dieser Überlieferung mūla-bhāsā gewesen, die Wurzelsprache der Menschheit, die ein Kind sprechen würde, hörte es keine andere Sprache. Solche Mythologisierungen einer konkreten Sprache sind in den Annalen der Heiligen Schriften außerordentlich häufig, etwa in Hinsicht auf das Hebräische, Arabische und Chinesische.
Auch wo Übersetzungen zur kulturellen Selbstverständlichkeit geworden sind, haftet dem Original eine Aura besonderer Heiligkeit und Authentizität an. Im christlichen Kontext hat die Reformation des 16. Jahrhunderts sich nicht nur um Übersetzungen in die Volkssprachen bemüht (welche es in Ansätzen auch schon im europäischen Mittelalter gegeben hat, wenn auch nur gegen heftige Widerstände), sondern ist sich mit dem älteren Humanismus in einer Wiederentdeckung der hebräischen und griechischen Originale einig gewesen. Darin hat die Reformation das allgemeine Kulturprogramm der Renaissance »ad fontes« »zurück zu den Quellen« in den religiösen Bereich übertragen. Johannes Reuchlin, einer der großen Humanisten und Verteidiger der jüdischen Literatur gegen obskurantistische Bücherverbrenner, schreibt am 17. Febr. 1512 in einem Brief an Johannes Stocker: »Nos Latini paludem bibimus, Graeci rivos, Iudaei fontes« »Wir Lateiner trinken also Wasser aus dem Sumpf, die Griechen aus den Bächen, die Juden aus den Quellen« (Johannes Reuchlin, Briefwechsel Bd. 2. 1506–1513. Leseausgabe. Stuttgart – Bad Cannstatt 2004, 160). Gemeint ist natürlich: Juden können (wenn sie hinreichend gebildet sind) die hebräischen Originale des Alten Testaments lesen. Hier wird das Pathos deutlich, welches hinter der wissenschaftlichen Neuerschließung der hebräischen und griechischen Bibel stand, ein Pathos, das die Reformation aus dem Humanismus übernommen hat. Aus dem Kontext dieser Passage läßt sich allerdings auch erkennen, in wie hohem Maße sich freilich auch ein Mann wie Reuchlin dabei in einem mythologischen bzw. sogar rein fiktionalen Weltbild bewegt hat (der Engel Raphael lehrt Noah und später »jenen berühmten Juden« Mose die Medizin, die von da zu den Griechen wandert). Nicht selten war eine begleitende Mystifikation der hebräischen Sprache, die auch bei vielen Christen des 16. und 17. Jhdts. als »Ursprache der Menschheit« galt. Das zugrundeliegende Pathos – »zurück zu den Quellen« – teilen auch andere Religionen, wenn sich Übersetzungen über lange Zeit sozusagen verselbständigt haben. Umgekehrt können klassische Übersetzungen als solche selbst Züge einer Heiligen Schrift annehmen, wie wir öfters beobachten werden.
Konzeptuelle Ablehnung Heiliger Schriften. Eine Reihe von älteren und modernen Religionen lehnt das Konzept Heiliger Schriften ab. Damit sind nicht jene Religionen gemeint, die nie Heilige Texte besessen haben (jedenfalls nicht in einem mit dem Begriff »Heilige Schriften« assoziierbaren Sinn), sondern solche, die aus einer Schriftkultur stammen bzw. geradezu eine Buchreligion als Ausgangspunkt und Referenzgröße besitzen, aber aus inneren religiösen Gründen das Konzept eines heiligen Textes negieren. Das bekannteste Beispiel ist der japanische (in Vorstufen auch chinesische) Zen-Buddhismus, der in vielen seiner Ausprägungen zwar klassische Texte, aber dezidiert keine Heiligen Schriften kennt. »Fu-ritsu Mon-ji« »es steht nicht auf Buchstaben« heißt die japanische programmatische Formulierung für diesen Sachverhalt, der vor allem als radikale Infragestellung der buddhistischen Schuldogmatiken zu verstehen ist. Mit dieser Ablehnung einer letzten schriftlichen Autorität erfährt andererseits die Linie der mündlichen Lehrüberlieferung, vor allem diejenige der Zen-Patriarchen eine immense Aufwertung: sie werden zu alleinigen Garanten der Authentizität der religiösen Praxis. Die »Koans« (koan < mittelchinesisch »gongan«, wörtlich: »öffentlicher Aushang«) – meditative Sinnsprüche, Sentenzen und paradoxe Erzählungen des Zen-Buddhismus – werden zwar sorgfältig gesammelt, sind aber keine Heiligen Schriften und verstehen sich im Widerspruch zur Buchorientierung des sonstigen Buddhismus. Sie sind »ein Kanon, der doch kein Kanon sein will« (Wilhelm Gundert). Das im Westen bekannteste Zen-Koan ist die Frage nach dem Geräusch einer einzelnen klatschenden Hand (Meister Hakuin Ekaku, 1686–1769). Diese kurzen Texte haben hohe Bedeutung für die spirituell-meditative Praxis des Zen-Buddhismus, fügen sich aber auch in ihren klassischen Sammlungen programmatisch nicht zu Heiligen Schriften im Sinne der Kanones anderer buddhistischer Schulen zusammen.
Ein andere Form einer konzeptuellen Negierung Heiliger Bücher ist die Ablehnung einer schriftlichen Fixierung von religiösen Texten zugunsten einer (stabilen) mündlichen Überlieferungsform, der wir v.a. in verschiedenen älteren indogermanischen Kontexten (Iran, Indien, Gallien u.a.) begegnen (vgl. Kap. 7).