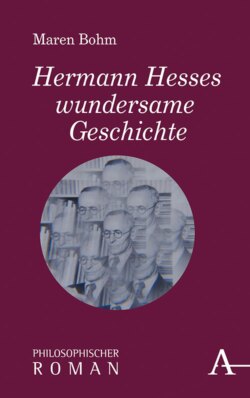Читать книгу Hermann Hesses wundersame Geschichte - Maren Bohm - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Hamburger Hauptbahnhof –
Berlin 1972
Оглавление»Komm mir nicht zu nahe! Ich habe die Pest.«
Unwillig sah Bernd, wie die junge Frau im schwarzen Lackmantel unbeeindruckt auf ihn zusteuerte.
»Begrüßt man so eine alte Freundin?«, entgegnete Karla, blieb vor Bernd stehen und setzte ihre glänzende Ledertasche auf dem Bahnsteig ab.
»Du erschreckst die Leute«, bemerkte sie amüsiert. »Schau, wie sie ihre schweren Koffer wegschleppen und weit abrücken.«
»Ich meine es ernst. Ich gehöre zu den Unberührbaren. Wer sich mit mir einlässt, der wird den Dreck sein Lebtag nicht mehr los.«
Karla schüttelte belustigt den Kopf.
»Du warst schon früher ein Spaßvogel.« Sie zwinkerte ihm zu: »Und ich hab als Journalistin ein Faible für Extravaganzen.«
Missmutig ließ er sich es gefallen, dass sie unbeirrt neben ihm stehen blieb und auf denselben Zug wartete. Er würde sie wohl bis Berlin nicht mehr los. Bernd machte ein abweisendes Gesicht und schwieg, was Karla nicht zu stören schien. Allerdings versuchte sie auch kein Gespräch, sondern zündete sich eine Zigarette an und wartete geduldig, während Bernd immer wieder auf die Bahnhofsuhr starrte.
Er fühlte sich keineswegs erleichtert, als der Interzonenzug schrill quietschend in den Bahnhof einlief, die Reisenden um ihn herum zu den schmuddelig grünen Waggons stürzten und sich durch die schmalen Türen drängelten.
»Wo ist denn dein Gepäck?«, fragte Karla und sah Bernd von der Seite an.
»In Berlin«, antwortete er mürrisch.
»Ich habe noch einen Koffer in Berlin«, improvisierte sie mit rauchiger Stimme.
»Hör bloß auf, mir mit sentimentalem Kitsch zu kommen.«
»Richtig, suchen wir uns lieber ein Abteil«, entschied sie die gemeinsame Zugfahrt und stieg energisch in den Waggon.
Im Gang roch es muffig und nach Schweiß. Sie schauten in die Abteile hinein, ob da wohl noch zwei Plätze frei wären. Als sie endlich eines gefunden hatten, bat Bernd eine Frau mit Hut und Feder, ihren Koffer vom Mittelsitz zu nehmen, er werde ihn auch gerne auf die Gepäckablage hieven.
»Im Koffer ist ein Porzellanweihnachtsengel. Wehe, wenn der kaputtgeht!«, wurde er von ihr angemeckert. Trotz ihres unfreundlichen Tons war er beruhigt, offensichtlich hatte sie den Auftritt auf dem Bahnsteig nicht mitgekriegt. Überhaupt beachtete ihn keiner der Mitreisenden. Ein junger Mann eben, mit Hornbrille und dicken Gläsern, schulterlangen braunen Haaren, der einen Parka trug. Karla hingegen, so stellte er fest, zog die Blicke auf sich, wie sie im Rollkragenpullover und schwarzem Minirock, hohen schwarzen Lackstiefeln, die Beine übereinandergeschlagen, elegant auf dem Platz bei der Tür saß, sich eine Zigarette anzündete, den SPIEGEL aus ihrer Croco-Handtasche nahm und sich in einen Artikel vertiefte.
Über die Schienen klackernd setzte sich der Zug Richtung Hamburg-Bergedorf in Bewegung. Bernd nahm wie abwesend wahr, wie sie langsam aus dem Hauptbahnhof fuhren. All die Jahre war es ein erleichterndes, wenn nicht gar erhebendes Gefühl gewesen, Hamburg zu entkommen. Nun aber … Nun aber, würde er schon morgen hier wieder sein. Für immer? ›Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne‹, fiel ihm ein Hesse-Zitat ein. Aber Hesse hatte es anders gemeint, sinnierte er. Anfangen hieß bei Hesse ein neues unbekanntes Leben beginnen, nicht aber den Schritt zurück in das stickige elterliche Mietshaus. Wie es ihn anwiderte, das nach Bohnerwachs riechende Treppenhaus, die abschätzenden Blicke der Nachbarn, die sich hinter seinem Rücken darüber ausließen, ob er als verlorener Sohn zu bemitleiden oder als Terrorist zu fürchten sei. Jedenfalls, mit so einem wollte man nicht unter einem Dach leben. Noch mehr grauste es ihn vor dem verbitterten, schmalen Mund seiner Mutter, sie hatte einen feschen Leutnant geheiratet und einen cholerischen einbeinigen Mann aus dem Krieg wiederbekommen. Bernd hielt sich innerlich schon jetzt die Ohren zu vor dem endlosen Streit, dass sie arbeiten gehen wollte, um der häuslichen Enge zu entkommen und etwas eigenes Geld zu haben, und dem strikten Nein, das sein Vater ihrem Willen entgegensetzte. Er sei Manns genug, um für die Familie zu sorgen, außerdem sei das Gesetz auf seiner Seite. Ohne seine Erlaubnis dürfe sie nicht arbeiten – und damit basta.
Bernd starrte zum Fenster hinaus, grau im schalen Licht sah er Menschen auf einem S-Bahnhof stehen, trostlos. Der Zug schlug über eine Weiche. Fabrikgebäude, Parkplätze, dann Wiesen wurden von der einbrechenden Dunkelheit verschluckt. Obgleich er genau wusste, dass sich sein Pass in der Jackentasche befand, fingerte Bernd danach. Noch knapp zwei Jahre war der Ausweis gültig, genauer, er hatte sich das Datum wie eine Todeslinie eingeprägt, bis zum 30. November 1974. Würde dann sein Pass eingezogen und er niemals wieder einen erhalten? Er wusste es nicht.
Unruhe erfasste ihn, als der Zug in Büchen hielt und bundesdeutsche Grenzpolizisten den Zug bestiegen. Angstschweiß brach aus, als sie das Nebenabteil kontrollierten, dann die Tür zu seinem Abteil aufrissen und die Pässe verlangten. Umständlich kramte die Frau mit dem Weihnachtsengel in ihrer Handtasche, bis sie ein freudiges: »Ich habe ihn« ausrief. Der Polizist stand nun direkt vor Bernd, der ihm seinen Pass reichte. Ein kurzer Blick auf den Pass, auf Bernd: »Überprüf das mal«, wandte sich der Polizist an einen Kollegen, der in der Tür stehen geblieben war. »Und Sie kommen mit. Na, wird’s bald. Ziehen Sie Ihren Parka aus. Haben Sie Gepäck?« Bernd verneinte. »Und nun raus hier aus dem Abteil. Stellen Sie sich im Gang mit den Händen ans Fenster!«
Bernd konnte die Schatten der Gaffenden in der Fensterscheibe sehen. Aus den Augenwinkeln nahm er wahr, wie sich die Reisenden aus den anderen Abteilen dieses entwürdigende Schauspiel nicht entgehen ließen. Karla stand dicht hinter ihm.
Bernd gehorchte. Mit schnellem, hartem Griff tastete der Polizist seinen Pullover ab, stülpte die Taschen seiner Cordjeans um, untersuchte seine Hosenbeine.
»Schuhe ausziehen!«, befahl er, die Pistole auf Bernd gerichtet.
Bernd zitterte. Der schießt wirklich, dachte er. Der erschießt mich wie der schottische Handelsvertreter im Juni erschossen wurde. Ian Mc Leod hieß er und man hatte ihn für einen Kontaktmann der Terrorgruppe Baader- Meinhof gehalten.
»Komm hoch«, kommandierte der Polizist und wechselte vom Sie aufs Du.
Mit den Händen am Fenster stand Bernd, wartete, wartete bis der Polizist mit seinem Pass wiederkam.
»So weit in Ordnung«, stellte der in sachlichem Ton fest.
»Schuhe anziehen. Na wird ’s bald.«
Hastig band Bernd seine Schnürsenkel zu, griff nach seinem Pass und taumelte zurück ins Abteil. Die Mitreisenden rückten so weit von ihm weg, wie es die engen Sitze und ihr Leibesumfang gestatteten. Karla starrte ihn an, sagte nichts und vertiefte sich unverzüglich wieder in ihren SPIEGEL.
Türen wurden zugeschlagen, der Zug fuhr langsam an, um nach kurzer Zeit zu halten.
Schwanheide, hier ist Schwanheide! Werte Reisende, wir begrüßen Sie in der Deutschen Demokratischen Republik! Alle Reisende, die nicht nach Berlin fahren, werden aufgefordert, sofort auszusteigen, da dieser Zug bis Berlin nicht hält! Ich wiederhole, Schwanheide …, tönte es aus dem Lautsprecher.
Ein hagerer Mann am Fenster dozierte, wie lange vor dem Transitabkommen die Züge an der Grenze aufgehalten und die Reisenden schikaniert wurden. Nun erfolge die Passkontrolle von ›denen da drüben‹ zum Glück im Zug. Er verstummte erschrocken, als ein Mann der Passkontrolleinheit des Ministeriums für Staatssicherheit hineinkam. Bernd befürchtete Schlimmstes, war angenehm überrascht, als sein Pass mit demonstrativer Nachlässigkeit betrachtet wurde, worüber er im Nachhinein erschrak. Vermutlich hatte ein Spitzel der Stasi den Vorfall beobachtet. Er galt offenbar als Freund der DDR? Bernd fing wieder an zu zittern und konnte nur mit Mühe das Klappern der Zähne unterdrücken. Fast hätte er geweint.
Karla beobachtete es hinter ihrem Journal, nahm ihn, als sie endlich am Bahnhof Zoo hielten, unter den Arm und schob ihn aus dem Waggon. Er hatte Mühe, die Stufen zum Bahnsteig hinabzusteigen, fasste sich dann aber, machte sich los, behauptete: »Es geht schon«, und stolperte die Bahnhofstreppe hinunter. Zielstrebig kämpfte sich Karla zu einer Imbissbude auf dem Bahnhofsvorplatz, kaufte auf die Schnelle zwei halbe Grillhähnchen mit Pommes und steuerte auf eine Taxe zu. Unschlüssig blieb Bernd stehen.
»Na, komm«, rief sie, die Wagentür schon in der Hand. »Steig ein. Wir fahren zu mir.«
Wie getrieben, hechtete Bernd auf den Rücksitz des Wagens. Der Taxifahrer fuhr los, noch ehe Karla den Straßennamen genannt hatte. Ampeln, dichter Verkehr, Reklame, Weihnachtsbeleuchtung. Bernd starrte hinaus wie in eine fremde Welt.
Der Kurfürstendamm erstrahlte im Glanz funkelnder Weihnachtsbäume, über die künstlicher Schnee ein zauberhaftes winterliches Flair verbreitete. Menschenmengen vor den Restaurants, den Schaufenstern, an den Straßenkreuzungen. Auch wenn Bernd sich nicht von ihrer Reklamefröhlichkeit täuschen ließ, auch wenn wohl viele von ihnen unglücklich waren, so hatten die Menschen da draußen doch eines gemeinsam: eine Existenz. Sie alle hatten ein Auskommen, ein Zuhause. Er aber, er war verflucht, von Ort zu Ort zu fliehen, wie Kain rastlos und heimatlos auf Erden zu sein. Nein, so sinnierte er weiter, während sie Richtung Schönebeck abbogen und der Geruch der Grillhähnchen sich im Wagen ausbreitete, das Kainszeichen würde ihn nicht schützen vor den Nachstellungen der anderen. Noch weniger wäre es, dachte er bitter, eine Auszeichnung, ein Zeichen des Adels des edlen Menschen vor der Masse der Feiglinge, wie Hermann Hesse es in seinem Buch Demian hingestellt hatte. Denn Hesses Romanheld Demian gelingt es wie von Zauberhand, den Weg nach innen, des Gewissens zu gehen und gleichzeitig gesellschaftlich Achtung und Respekt entgegengebracht zu erhalten. Hesse hatte fein säuberlich unterschieden zwischen der inneren Welt des Geistes und der rohen Außenwelt. Hesses Demian verkörpert die Vollkommenheit der Menschwerdung, der Individuation und sagt gleichwohl von sich, er sei nie gerne nach außen aufgefallen und habe immer eher etwas zu viel getan, um korrekt zu sein. Er selbst aber, er war gebrandmarkt, geächtet.
»Hey, Bernd, aufwachen! Wir sind fast da«, wandte sich Karla zu ihm um.
Bernd schreckte auf. Die Taxe bog links in eine Seitenstraße ab. Zwischen den heftig sich hin- und her bewegenden Scheibenwischern sah er Mietskasernen aus der Gründerzeit, hohe Kastanienbäume im fahlen Licht der Straßenlaternen.
»Sie können dort vor dem Antiquitätenladen halten«, sagte Karla und fingerte in ihrer Handtasche nach ihrem Portemonnaie. Der Taxifahrer fluchte über den strömenden Regen, Bernd ergriff ihre Reisetasche und hetzte hinter Karla zwischen den parkenden Autos über das spiegelnde Kopfsteinpflaster.
Reifen quietschten. Lautes Hupen. Der Autofahrer zeigte ihm einen Vogel. Verdattert überquerte Bernd die Straße und blieb neben Karla vor einem grauen Mietshaus mit Balkonen stehen. Mit einem langen altertümlichen Bartschlüssel schloss Karla die Flügeltür auf. Licht aus einer Messinglampe flackerte über dem mit rötlichem Marmor ausgelegten Gang.
»Ich wohne im Hinterhaus«, sagte sie, durcheilte den Flur, öffnete die Hintertür und trat auf den regenüberschwemmten Hof. Bernd trat in eine Pfütze. Im Hinterhaus stieg sie die anfangs breite, dann von Stockwerk zu Stockwerk schmaler werdende Holztreppe hinauf. Bernd folgte ihr, die Reisetasche umklammert, und kam nicht umhin, ihre schönen Beine zu bemerken. Es fiel ihm sogar ein, dass sie früher einen langen schwarzen Zopf hatte, und er befand, dass die kurzen Haare mit den großen runden Ohrringen ihr gut standen.
»VoilÆ, Monsieur, treten Sie ein«, lächelte Karla und öffnete die Tür zu ihrer Wohnung. Bernd betrat ein edel eingerichtetes Apartment, welches durch seine leichte Unordnung sympathisch wirkte. Er sah sich um, wo er seinen Parka lassen konnte. Hinter der weißen Flügeltür war ihr Wohn- und Arbeitszimmer, vermutete er. Hinten im Flur stand eine Tür offen, die Karla sofort schloss. Einen Raum mit einem riesigen Hochbett hatte er auf die Schnelle erkennen können.
Seinen Parka hängte Karla über eine Büste von Goethe. Dann schon schob Karla ihn in die Küche, knipste das Deckenlicht an, holte zwei Teller aus dem weißen altmodischen Küchenschrank und forderte ihn auf: »Setz dich.«
Bernd überlegte, ob er auf dem grünen Plüschsofa Platz nehmen sollte, zog dann aber vom Fenster einen Küchenstuhl heran.
»Ich sitze da gerne und schaue auf den Hof«, gestand Karla zu Bernds Verwunderung, denn es klang fast wie eine Entschuldigung.
»Bier?«, fragte sie und nahm auf Bernds Nicken hin zwei Flaschen aus dem Kühlschrank.
Genüsslich ließ sie sich auf dem Sofa nieder, biss in ihr Grillhähnchen und sagte kauend: »Nun erzähl mal. Was ist eigentlich los?«
Er sah sie an und sagte tonlos: »Ich bin vom Radikalenerlass betroffen. Ich habe Berufsverbot. Ich wollte Lehrer werden, weißt du. Aus – vorbei der Traum, für immer.«
Bernd ließ die Schultern hängen und sah Karla unglücklich hinter seinen dicken Brillengläsern an.
»Duuuuu?« Karla zog die Stirn kraus. »Wieso denn du? Du hast dich doch schon als Schüler mehr für Philosophie als für Politik interessiert. Du – ein Verfassungsfeind? Das ist doch lächerlich!«
»Lächerlich ist gar nichts. Wie heißt es im Radikalenerlaß vom 28. Januar 1972?:
Ein Bewerber, der verfassungsfeindliche Aktivitäten entwickelt, wird nicht im öffentlichen Dienst eingestellt.«
Bernd zog die Mundwinkel verbittert herunter. Schluckte. Und wischte sich mit dem Handrücken über die Lippen. »Zu ewigem Schweigen verurteilt. Mundtot gemacht. Von wegen Menschenrechte. Recht auf freie Meinungsäußerung.«
»Nun ja, unser Bundeskanzler Brandt, immerhin SPD, prahlt mit dem Slogan:
Mehr Demokratie wagen«, bemerkte Karla.
»Daran habe ich auch geglaubt. Ich muss schon zugeben, das Berufsverbot hat mich überrascht, um es einmal neutral auszudrücken. Ich habe im Sommer mein Zweites Staatsexamen gemacht und habe mich darauf für den Schuldienst beworben. Zuerst habe ich mir nichts gedacht, als ich auf meine Bewerbung keine Antwort erhielt. Verunsichert war ich, als Günther, mit dem habe ich in einer WG gewohnt, also als der zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen und kurz danach eingestellt wurde. Wie man das so macht, habe ich versucht, mich zu beruhigen. Behörden arbeiten eben langsam und so. Trotzdem …«
Bernd schnappte nach Luft: »Ich halte das nicht aus. Ich ersticke. Können wir mal das Fenster aufmachen?«
»Es ist reichlich kalt draußen. Aber meinetwegen«, sagte Karla und kam von ihrem Sofa hoch. »Hörst du, wie es regnet?«
Auch Bernd stand auf, stellte sich neben Karla ans Fenster, atmete tief die kühle Luft ein.
»So, jetzt ist es genug. Sonst erfriere ich. Erzähl lieber weiter.«
Folgsam setzte er sich wieder.
»Von Tag zu Tag wurde ich nervöser, besonders als andere Freunde eine positive Antwort erhielten. Kennst du das Gefühl, du wartest auf einen Anruf oder auf einen Brief und weißt genau, da kommt nichts. Jeden Tag habe ich auf den Postboten gelauert, bin zum Briefkasten gehetzt und wusste genau, da ist kein Brief für mich drin.«
Ohne es selbst wahrzunehmen, griff Bernd nach ihrer Zigarettenpackung und zerknüllte sie zwischen seinen Fingern.
»Mensch, da ist noch eine drin.«
»Tut mir leid.« Er schwieg und sein Gesicht war so eingefallen und grau, dass Karla meinte, alles, sein ganzes junges Leben tue ihm leid. Dann raffte er sich auf:
»Ende November erhielt ich von der Senatsverwaltung die Vorladung zu einer Anhörung, da ›Erkenntnisse‹ über mich vorlägen.«
»Erkenntnisse?«, wiederholte sie skeptisch.
»Anhörung, weißt du, was das bedeutet? Oh, die Sprache kann so verlogen sein. Anhörung bedeutet ein Verhör, das bereits Teil des Verfahrens ist. Bedeutet, du bist verurteilt, bevor du überhaupt gehört wurdest.
Überpünktlich erschien ich zu dem anberaumten Termin. Ging im Gang auf und ab. Da kam so ein junger smarter Typ mit Fliege auf mich zu, ich vermute Gerichtsreferendar, und bemerkte hämisch: ›Die hier warten, zittern alle vor Angst.‹
Ich sage dir, ich hätte ihm am liebsten eins in die … du weißt schon geschlagen. Natürlich habe ich geschwiegen. Vielleicht war das ja auch eine bewusste Provokation und gehörte mit zum Verfahren. Dann wurde ich hereingerufen und konfrontiert mit Vorwürfen aus mir nicht bekannten Berichten, aus denen man meine Gesinnung meinte ableiten zu können. Stell dir vor, ich war überwacht worden – und habe davon nichts geahnt. Jedenfalls musste ich zu den Anschuldigungen Stellung beziehen. Faktisch waren alle Punkte korrekt, nur die Interpretation stimmte nicht.«
»Was hat man dir denn vorgeworfen. Wofür warst du angeklagt?« Karla konnte die Spannung kaum in ihrer Stimme zurückhalten.
»Kontakt zur Terrororganisation Rote Armee Fraktion, zu Ulrike Meinhof und Gudrun Ensslin, um es genau zu sagen.«
Karla starrte ihn an und schüttelte den Kopf.
»RAF? Neee.«
»Diese, diese«, er rang nach einem Schimpfwort. »Diese Leute vom Verfassungsschutz haben mein ganzes Leben so gedeutet, als liefe es zielstrebig auf Terrorismus hinaus.
Du glaubst es nicht, meine Vorliebe für Karl Jaspers hat man mir vorgehalten. Was ich tatsächlich an ihm schätze, ist seine menschliche und philosophische Humanität. Menschenwürde ist für ihn kein Abstraktum, sondern Grundfeste menschlicher Existenz. Beeindruckt hat mich Jaspers’ tiefe Überzeugung, dass jeder Mensch das Recht hat, zu sich selbst zu finden. Sein philosophischer Grundgedanke, dass Existenz keine Form des Seins, sondern eine Form menschlicher Freiheit ist, in der sich der Mensch für seine Möglichkeit entscheidet und sich gegen sein Resultatsein wendet, hat mich fasziniert. Möglichkeit, Karla! Ich habe keine Möglichkeiten mehr. Ich bin mit meinen 27 Jahren am Ende. Weißt du, was das offizielle Ziel des Berufsverbotes ist? Materielle Existenzvernichtung! Als könnte man ›nur‹«, betonte er höhnisch, »die materielle Existenz vernichten.«
Hoffentlich tut er sich nichts an, durchfuhr es sie. Laut sagte sie: »Ich brauche einen Kaffee. Magst du auch einen?«
»Ja, danke«, antwortete er zerstreut. »Die Mitmenschen sind für Jaspers nicht störendes Element der Existenz, sondern umgekehrt, nur in der Kommunikation, im Zusammen der Menschen kann sich Existenz verwirklichen. Jaspers wagt es bei aller philosophischen Präzision sogar von Liebe zu sprechen. Dass aber die politische Elite das Volk, das doch nach dem Grundgesetz der Souverän ist, als Störung behandelt, dieser Kritik Jaspers’ habe ich zugestimmt.«
Karla schüttelte ungläubig den Kopf, während sie das Kaffeepulver aus dem Schrank nahm. »Karl Jaspers ist weltweit anerkannter Philosoph und hat den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten.«
»Tja, aber er trennt nicht die Philosophie von der Politik. Und da übt er heftigste Kritik.
Also, Grundlage des Verfahrens und der Deutung meiner politischen Aktivitäten war Jaspers’ Buch: Wohin treibt die Bundesrepublik? Tatsachen – Gefahren – Chancen sowie ein langer Artikel von ihm im SPIEGEL, den ich für die Fachschaft Philosophie letztlich nur zusammengefasst und kaum kommentiert habe. Jaspers geht darin vom Widerstandskämpfer Stauffenberg aus, der für eine Ordnung gekämpft hat und gestorben ist, in der alle Deutschen, also jeder Einzelne Träger des Staates ist. Dieses Ziel sieht Jaspers keineswegs in der Bundesrepublik verwirklicht, im Gegenteil. Es handelt sich heute um eine Parteienoligarchie, in der allerdings nicht einmal das einzelne Parteimitglied Möglichkeiten der Einflussnahme hat. Für Jaspers heißt Parteienoligarchie Verachtung des Volkes, Verachtung des Menschen. Sie neigt laut ihm dazu, dem Volk Informationen vorzuenthalten. Man will es lieber dumm lassen. Das Volk brauche auch die Ziele nicht zu kennen. Stattdessen werde es mit Phrasen abgespeist. Jaspers wirft den Politikern Schamlosigkeit vor, sie fordern Respekt, insbesondere Kanzler, Minister, Amtspersonen. Wir, so denkt diese Elite, sind durch die Wahl des Volkes geheiligt. Kraft unserer Ämter haben wir die Macht und den Glanz, der uns zukommt. Und Jaspers sieht nur einen kurzen Schritt von der Parteienoligarchie zur Diktatur. Dagegen muss sich nach Jaspers das Volk wehren und selbst die Verantwortung übernehmen: In seinem Artikel fällt das Wort Gewalt: Gegen die Freigabe der Gewalt an eine absolute Herrschaft kann nur noch die Gewalt ein Schutz sein.
Mit diesem Satz von Jaspers hatten sie mich natürlich. Und darauf bauten alle weiteren Anklagepunkte auf: Meine Teilnahme an Demonstrationen gegen Fahrpreiserhöhung, gegen den Vietnamkrieg, gegen die Notstandsgesetze, den Schahbesuch, für die Rechte der Frau. Mein Protest gegen die Ermordung des Studenten Benno Ohnesorg durch einen Berliner Polizisten.«
»Naja, wer hat nicht dagegen demonstriert?«, wandte Karla ein. »Ich habe mich sogar an dem Trauermarsch durch die DDR, pardon, durch die sowjetisch besetzte Zone beteiligt, weil Benno nicht in Berlin, sondern in seiner Heimatstadt beigesetzt werden sollte. Es war natürlich sehr verdächtig, dass die Grenze so bereitwillig geöffnet wurde für uns Protestler.
Aber das ist ein anderes Kapitel. Was hat man dir denn noch vorgeworfen? Du warst doch gar nicht in einer kommunistischen Gruppe oder Partei?«
»Parken. Ganz im Ernst. Ich hatte für kurze Zeit einen alten VW-Käfer und den habe ich, ohne dass ich es gewusst habe, in der Nähe einer Versammlung der Kommunistisch- leninistischen Partei Deutschlands abgestellt. Ich hatte bei dem Verhör überhaupt keine Erinnerung mehr an diesen Tag und mir fiel auch gar kein Alibi ein, was ich wohl gemacht haben könnte.«
Er schwieg und es war Karla, als grübelte Bernd immer noch darüber nach.
»Dazu hatte ich mal eine Freundin in Göttingen«, er räusperte sich, was Karla mit gleichgültigem Gesicht zur Kenntnis nahm. »Also, Gudrun wohnte neben dem Roten Buchladen. Und da wurden alle gefilmt, die daran vorbeigingen. Wenn du aber dazu noch stehen bliebst und dir die Plakate und Bücher anschautest, dann war das wieder ein Nagel zum Sarg Berufsverbot.«
Karla schob ihren Teller mit ihrem abgenagten Hähnchen beiseite und warf ein: »Irgendwie kann ich es noch nicht glauben, dass dies alles ein Berufsverbot rechtfertigt.«
»Na, da bin ich mir nicht so sicher. Aber du hast recht: Das Schärfste kommt noch, nämlich eben diese Anklage, ich sei ein Sympathisant, ja einer Unterstützer der Terrorgruppe RAF.«
»Andreas Baader und Ulrike Meinhof und Gudrun Ensslin? Kennst du die denn wirklich, ich meine persönlich?«
»Ja, das ist der Punkt, den ich mir nicht verzeihe. Meine eigene Feigheit. Wie jeder wusste ich, dass Gudrun Ensslin in Frankfurt einen Kaufhausbrand gelegt und deswegen verurteilt worden war, aber wegen der Revision auf freiem Fuß lebte. Ich wusste auch, dass Ulrike Meinhof sie interviewt und viel Verständnis für ihre Auffassung, dass nur Gewalt die Verhältnisse ändern könne, gezeigt hatte. Und ich wiederum hatte bei Ulrike Meinhof ein Seminar über Publizistik gehört, wir haben zusammen Filme gedreht. Jedenfalls kurz bevor Gudrun Ensslin untertauchte und nach Rom abhaute, schob ich mit meinem Tablett nichts ahnend durch die Mensa der FU und suchte nach einem stillen Plätzchen. Da rief plötzlich Ulrike Meinhof mir zu, ich möge mich doch an ihren Tisch setzen. Natürlich erkannte ich Gudrun Ensslin, wusste, dass sie kriminell war, ja, mehr als das, nämlich eine Terroristin, auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt noch keine Mordanschläge verübt hatte. Blitzschnell versuchte ich die Nachteile, die sich daraus für mich ergeben könnten, abzuschätzen. Aber ich gebe es zu, mir war klar, dass ich falsch handelte mich dazuzusetzen. Es ist verrückt, man scheut sich mehr davor, eine Unhöflichkeit zu begehen als den Mut aufzubringen, sich aus einer Lebensgefahr zu retten.«
»Hm«, kommentierte Karla.
»Was soll ich sagen. Das Essen verlief äußerst unangenehm. Dass ich Lehrer werden wollte und diesem Scheißsystem dienen wollte, belustigte Gudrun Ensslin zunächst, dann beschimpfte sie mich aufs Widerwärtigste. Sie hat ja diese Art des bornierten aggressiven Hochmuts. Schließlich stand sie auf und erklärte, ihr werde übel, mit so einem Kapitalistenlecker an einem Tisch zu sitzen und zu essen. Stand auf und ging.«
»Und Ulrike Meinhof. Wie hat die sich verhalten?«
»Stumm. Sie hat nichts dazu gesagt. Ich glaube, sie bewundert die Ensslin und wagt es nicht, einen eigenen Standpunkt zu vertreten. Das hat sich ja gezeigt, als sie selbst in die Illegalität bei der Befreiung des Terroristen Baader gegangen ist. Vollkommen verrückt, ist eine anerkannte Journalistin, geradezu berühmt, und springt aus dem Fenster der Ensslin und Baader nach, ist ab da kriminell.«
»Ich sehe das anders«, entgegnete Karla entschieden. »Ulrike Meinhof hat mit sich gerungen, ob sie für eine Veränderung der Gesellschaft lediglich schreiben oder aber ihrer wahren Auffassung folgen sollte, dass dies nur mit dem bewaffneten Kampf zu erreichen sei. Sie hat es um ihrer Selbstachtung getan. Sie hat, um es mit deinem Jaspers zu sagen, ihre Existenz erschaffen.«
»Naja, wie du meinst. Jedenfalls damals in der Mensa ist sie wortlos aufgestanden. Und ich, ich bin fotografiert worden und seitdem werden mir alle früheren Aktivitäten als Vorbereitung in den Terrorismus, zumindest als Kampf gegen die freiheitliche Grundordnung ausgelegt. Pech hatte ich dazu auch noch, denn ich war zum selben Zeitpunkt in Rom wie die Ensslin. Das alles und noch ein paar Details dazu, zum Beispiel ein Vortrag von Marcuse, bekam ich bei der sogenannten Anhörung vorgesetzt. Kurz danach, schon Anfang Dezember entschieden dann Verwaltungsbeamte, dass ich mich nicht positiv im Sinne des Grundgesetzes zur demokratischen Grundordnung bekenne und deswegen im gesamten öffentlichen Dienst nicht eingestellt werden darf. Berufsverbot«, sagte er bitter.
»Und nun? Was machst du nun?«
»Ich? Was ICH mache? Nichts, denn mit mir wird gemacht. Ich kann gar nicht mehr frei über mein Leben bestimmen.«
»So philosophisch habe ich das nicht gemeint. Ich dachte eher ganz konkret«, bemerkte Karla, zündete sich eine Zigarette an und lehnte sich auf ihrem Sofa zurück.
»Ganz konkret werde ich morgen meine letzten Habseligkeiten aus Berlin holen, nach Hamburg fahren, zu meinen Eltern zurückziehen, ihnen auf der Tasche liegen und ihr Gejammere anhören, dass ich mein BAföG zurückbezahlen muss und nicht kann. Nach Weihnachten werde ich mich nach einem Hilfsarbeiterjob umschauen. Ich bezweifele allerdings, dass ich einen bekommen werde. Wenn so ein Arbeitgeber sieht, dass ich ein Prädikatsexamen habe, Erste und Zweite Staatsprüfung mit 1, dann wird der doch misstrauisch, fragt, was ist faul an dem Jungen. Und natürlich wird er auf Terrorismus tippen, schließlich werden alle jungen Leute, insbesondere Studenten von der älteren Generation verdächtigt, Terrorist zu sein. Da wäre es besser, ich hätte einen Bruch begangen, hätte meine Zeit im Knast abgesessen und hätte einen Bewährungshelfer, der sich dafür verbürgt, dass ich sauber bin.«
Karla schüttelte unwillig den Kopf und drückte ihre Zigarette aus:
»Puh. Ich kann nicht mehr. Es ist spät und ich muss ins Bett.«
Wie betäubt stand Bernd auf.
»Ich gehe dann«, sagte er und graute sich davor, im Regen durch die Nacht zu laufen. Unbeholfen stand er da, nahm seine Hornbrille ab und rieb sich die Augen.
Sie fühlte seine Not.
»Wenn du magst, kannst du hier gerne übernachten. Das Hochbett ist frei, ich selbst schlafe immer in meinem Zimmer.«
Als hätte er nichts gehört, ging er in den Flur, nahm seinen Parka von der Goethe-Büste.
Karla folgte ihm. Mit einer Kopfbewegung zum hinteren Zimmer schlug sie ihm vor:
»Schau es dir doch einmal an.«
Sie öffnete die Tür, knipste das Deckenlicht an. Bernd erkannte mit einem Blick, warum Karla vorhin die Tür so schnell geschlossen hatte. Die rückseitige Wand war von der hohen Decke bis zum Parkettfußboden mit Aktfotos ausgefüllt. Es war anscheinend immer dieselbe Frau, auf der Seite liegend, den Rücken dem Betrachter zugewandt. Ihr langes Haar floss verführerisch über ihre Schulter hinab. Keines der Fotos zeigte die Frau in ihrer Nacktheit, sondern künstlerisch verfremdet wie eine Düne in der Sahara, eine Welle im Ozean, ein Gebirge vor einem tiefen Himmel, eine Wolkenwand in der Klarheit des Kosmos. In der Mitte der Wand fehlte ein Bild und Bernd vermutete, es war der Akt. Sonst war der Raum bis auf das überdimensionale Hochbett fast leer, eine Arbeitsplatte aus Glas auf einer verschlungenen Metallkonstruktion, davor ein mit dunkelrotem Königssamt bezogener Armsessel zog den Blick auf sich.
Karla deutete auf einen ziemlich ramponiert aussehenden Mahagonischrank: »Da müsste noch Wäsche für dich drin sein. Ich mag da nicht hineingucken.«
Sie schluckte und Bernd hatte den Eindruck, sie schämte sich, dies zugegeben zu haben.
»Du brauchst noch eine Zahnbürste«, bestimmte sie und schob ihn resolut in das Badezimmer, in dem es wundervoll roch und die Parfums, Seifen, Schminke in einem offenen Wandschrank schön drapiert waren. Umso mehr verwunderte es Bernd, dass genau gegenüber der Toilette an der Tür ein Plakat mit Reißnadeln befestigt war, auf dem auf schwarzem Grund mit roten Lettern stand:
MACHT KAPUTT
WAS EUCH KAPUTT MACHT!
»Ich hole dir noch Bettwäsche«, sagte sie und wollte rasch entschwinden.
»ÄH, könntest du mir auch einen Wecker geben. Ich muss tierisch früh aufstehen. Ich bin auch ganz leise und stör dich nicht.«
Karla sah ihn abwartend an.
»Ich muss morgen früh meine letzten Sachen aus Berlin holen. Die sind in einem Kohlenkeller in Charlottenburg. Und der wird kurz vor 4 Uhr aufgeschlossen und kurz nach halb fünf zugeschlossen. Ich muss genau zwischen 4 und halb 5 da sein, damit ich niemanden treffe.«
Karla zog die Stirn kraus.
»Der Kohlenkeller gehört zu der WG, in der ich gewohnt habe. Als meine Mitbewohner hörten, dass ich Berufsverbot habe und dann auch noch wegen Terrorismusverdacht, musste ich auf der Stelle ausziehen. Sie, auch Günther, du kennst ihn doch auch noch aus der Schulzeit in Hamburg, also auch der hat mir gerade gestattet, meinen Kram im Keller unterzubringen. Was ich nicht transportieren konnte, mein Bett, meinen Schreibtisch und so hat mir Günther für 20,- Mark abgekauft.«
»So ein Schwein«, entfuhr es Karla.
»Ja und nein. Ich habe viel darüber nachgedacht. Er hat Angst, sie alle haben Angst, dass auch sie erfasst werden und Berufsverbot erhalten. Das ist ja der Sinn des Radikalenerlasses, einige zu vernichten, um alle zu treffen und zu Duckmäusern zu machen.«
»Ja, wohl wahr«, seufzte sie. »Deutschland wird ein Totenhaus. Das steht fest«, fügte sie entschieden hinzu. »Aber unser reformfreudiger linker SPD-Bundeskanzler Willy Brandt hat sich ja nicht einmal durch einen Brief von dem bekanntesten Christen Deutschlands, von Helmut Gollwitzer, erweichen lassen. Nicht einmal dessen Warnung, dass die ganze junge Generation zum Verstummen gebracht wird, hat irgendwie das Gewissen dieser Politiker berührt.«
»Hör mir auf mit Gewissen, das ist was für dämliche Idealisten.«
Sie warf einen Blick auf Bernd, wie er aschfahl und verbittert mit seiner Zahnbürste und seinem Handtuch vor ihr stand.
»Genug geschwätzt. Ich bringe dich morgen mit meiner Ente dahin.«
»Gut geschlafen?«, fragte Karla fünf Stunden später, als sie durch das nächtliche Berlin fuhren, in dem für kurze Zeit der Verkehr fast zum Erliegen gebracht schien.
»Seh ich so aus?«, erwiderte er und fand sich reichlich unhöflich. Schließlich hatte sie ihn geweckt und sogar einen Kaffee oben ans Hochbett gebracht.
»Du siehst gut aus«, bemerkte er, um etwas Nettes zu sagen.
»Ach was, nur Jeans und blauer Pullover«, erwiderte sie lächelnd.
Stumm saß er neben ihr, schaute zu den Häusern hinauf, nur selten brannte irgendwo ein Licht.
»Ich kann eigentlich überhaupt nicht mehr schlafen, seitdem mir das passiert ist«, begann er mühsam. »Sobald ich mich hinlege, flattern meine Nerven, besonders in den Armen. Ich merke jeden Nerv einzeln, wie er vibriert. Geht dir das manchmal auch so?«
Ohne ihre Antwort abzuwarten, fuhr er fort.
»Ich fühle mich wie eine Scholle.«
»Häh, du spinnst.«
»Wirklich. Du kennst doch im Fischgeschäft diese Bassins, in denen hinter einer Glasscheibe Dorsche, Schollen, kleine Aale und Heringe dichtgedrängt so was wie schwimmen, sich kaum bewegen können.«
Karla nickte. »Ich mochte als Kind da nicht mit hineingehen, weil die Fische mir so leid taten.«
»Also, ich fühle mich wie eine solche Scholle. Da kommt dann ein Herr mit Hut, Mantel und Fliege, zeigt auf mich, also auf die Scholle. Mit festem Griff packt die Fischhändlerin den Fisch, gibt ihm einen Schlag mit dem Holzhammer auf den Kopf, schneidet unversehens mit einem scharfen Messer den Kopf ab und nimmt mit dem Finger die Gedärme heraus. Der Fisch zappelt, er krümmt sich, alle Nerven vibrieren, denn er ist doch immer noch ein Fisch. Sie aber wickelt ihn in Fettpapier und dann noch in rosa Einwickelpapier und der Mann läuft eilends zu seiner Frau in die Küche. Die nimmt die zappelnde Scholle, salzt sie ein, wendet sie in Ei und Paniermehl, erhitzt die Butter, dass sie brutzelt, und legt den Fisch in die heiße Pfanne. Die Scholle aber springt aus dem siedenden Fett, die Hausfrau ergreift sie und legt sie wieder in die Pfanne. Die Scholle krümmt sich vorne und hinten, bäumt sich auf, denn die Nerven sind immer noch lebendig. Die Frau drückt sie mit dem Küchenfreund nieder, denn sie soll ja platt und braun und knusprig werden. Irgendwann hört die Scholle auf zu zappeln, dann ist sie tot.«
»Unsinn, der Vergleich stimmt nicht. Du sagst es ja selbst, die Scholle soll schön knusprig werden. So eine Scholle ist eine Delikatesse.«
»Siehst du, nicht einmal dazu bin ich noch gut. Ich bin ungenießbar. Mich will keiner mehr haben. Ich bin zu nichts mehr nütze und meinen Kopf hat man abgeschnitten mit allem, was ich gelernt habe. Meine flatternden Nerven werden sich irgendwann nicht mehr auflehnen und ich werde ganz stumm werden. Ich lande auf dem Müllplatz der Geschichte.«
»Wir sind gleich da«, bemerkte Karla trocken und bog in eine enge Straße mit Mietshäusern aus der Kaiserzeit ein. »Zeig mir mal, wo der Kohlenkeller ist. Ziemlich schwierig, einen Parkplatz zu finden. Die Bourgeoisie schläft noch und alle ihre piekfeinen Autos verstellen uns ein hübsches Plätzchen. Na, stehen wir eben im Halteverbot«, riskierte sie und öffnete die Wagentür.
»Nein, fahr weiter. So wichtig sind die Sachen auch nicht.«
»Immerhin so wichtig, dass du extra nach Berlin gefahren bist, um sie zu holen. Was ist es denn, was du aus dem Kohlenkeller holen willst?«
»Vier Plastiktüten voll mit Büchern von Hermann Hesse. Aber, wie ich schon sagte, so wichtig sind sie mir nicht. Das wird mir jetzt klar. Hermann Hesse hat mir nichts genützt. Nachdem ich dieses ›wundervolle‹ Erlebnis mit der Ensslin und Ulrike Meinhof in der Mensa hatte, habe ich mich von jedweden politischen Aktionen ferngehalten und mich stattdessen auf mein Innenleben konzentriert. Ich habe die Bücher von Hesse nur so verschlungen. Aber, du siehst, auch das hat mir nicht geholfen. Fahr mich einfach zum Bahnhof.«
»Ach, was. Hermann Hesse ist mein Lieblingsdichter. Raus hier, holen wir uns seine Bücher.«
»Hermann Hesse«, begann Karla beinahe träumerisch, als sie rund eine Stunde später ihren Kaffee umrührte, während Bernd es kaum fassen konnte, dass er sich jetzt nicht mit den vier Plastiktüten zum nächsten S-Bahnhof abschleppte, sondern avantgardistisch in der Kantstraße im Schwarzen Café saß, das zu dieser nachtschlafenden Zeit schon geöffnet hatte.
»Weißt du, was mir Hesse bedeutet«, fuhr sie fort. »Das war schon in der Schulzeit so. Immer wenn ich ein Buch von ihm gelesen habe, dann war mein Leben der Sinnlosigkeit und der Einsamkeit entrissen und ich hatte es wieder ein Stück weit für mich gewonnen.«
Bernd sah verwundert von seinem Frühstücksteller hoch.
»Du hast doch wohl alles von Hermann Hesse gelesen?«
Er nickte kauend.
»Mir ging es wie dem Musiker Kuhn in Hesses Roman Gertrud«, erklärte Karla. »Der ist vor seinem Unfall und bevor er ein Krüppel wird, mitten in so einer Clique, hat Spaß, ist sogar so was wie der Hahn im Korb. Aber innerlich ist er ausgelaugt, entfernt sich immer weiter von sich selbst, wird sich selbst zuwider und ist inmitten der Lustigkeit einsam. Schrecklich einsam.«
Bernd sah Karla verdutzt an und verkleckerte etwas von der Marmelade, die er auf sein Mohnbrötchen streichen wollte.
»Du und einsam? Ich bitte dich. Das könnte man wohl eher von mir sagen, weil ich nicht zur Blankeneser High Society gehörte. Du warst doch auf allen Partys immer dabei.«
»Sei nicht albern und verbittert. Was weißt du schon von meinem Innenleben. Nein, ganz ernsthaft gesprochen. Es hat mich damals angeekelt, dieses seichte Getue, diese Markenklamotten, und selbst die Lehrer, manche zumindest, fielen darauf rein und bewunderten und beneideten das Image und das Geld, das hinter uns oberflächlichen Gören stand. Und dann sollten wir ständig über ethische Themen schreiben und wie wir Eitelkeit und Streben nach Geld und Macht verachten sollen. Mich hat das aufgeregt und angewidert. Jetzt als Journalistin schreibe ich natürlich auch häufig seichtes Zeug, ich schreibe regelmäßig für eine Wurfzeitschrift unter dem Pseudonym Simone Müller, aber bisweilen gelingt mir auch ein Artikel, den ich selbst achte. Über das Zechensterben im Ruhrgebiet und über die Armut alter Menschen in Berlin habe ich vor kurzem einen Artikel in der ZEIT veröffentlichen können.«
»Hast du denn keine Angst, mit mir hier zu sitzen? Ich meine, auch dir könnten Nachteile daraus erwachsen. Als Journalistin bist du angreifbar, besonders wenn du nur freie Mitarbeiterin bist. Fürchtest du dich nicht vor Ansteckung?«
»Du mit deiner Pest«, amüsierte sie sich. »Nein, ich habe meine Prinzipien. Eines heißt: Zivilcourage. Aber lassen wir das.«
Naja, dachte er, schließlich hat sie reiche Eltern.
»Also«, fuhr Karla fort in dem Bedürfnis, endlich einmal darüber zu sprechen. »In Wirklichkeit ging es mir damals als Schülerin hundsmiserabel und ich wusste gar nicht, wie ich da wieder rauskommen sollte. Da bin ich, meine Eltern waren glaube ich in Paris und mein Bruder hat schon studiert, da hoffte ich, dass ich in der wilden rauen Natur am Meer zu mir selbst finden könnte und bin Ende März nach Sylt getrampt. Hesses Steppenwolf, dieses Buch voll verzweifeltem Lebensüberdruss und Ekel vor der Seichtheit der Zeit und der Gedankenlosigkeit der Menschen in der Tasche.«
»Na, Sylt ist nicht gerade die Insel, um der Leere und Partys zu entgehen«, wandte Bernd ein.
»Ich war nicht im Schickimicki Kampen, sondern in der Jugendherberge in List. Um die Jahreszeit war fast kein Mensch da. Die erste Nacht habe ich ganz allein in einem 6- Bett-Zimmer geschlafen. Morgens Frühstück an einem langen blank geschrubbten Tisch, eine große Blechkanne mit dem typischen roten Jugendherbergstee vor mir. Nachmittags kam auch so eine Hoffnungslose dazu, Evelyn aus Ulm. Mit der habe ich dann endlose Spaziergänge gemacht. Jedenfalls schlug sie mir vor, mit ihr und zwei anderen Jungen in den Sommerferien mit dem Auto nach Italien zu fahren. Kurz bevor wir dann im Sommer starteten, habe ich mir in einer Ulmer Buchhandlung Hesses Siddhartha gekauft. Dann ging es ziemlich zügig bis nach Sorrent, wo wir mitten in der Nacht ankamen. Der Campingplatz hatte noch nicht geöffnet. Evelyn und die Jungen haben sich irgendwo in ihrem Schlafsack zum Pennen hingelegt. Ich aber habe mir von der Terrasse eines Cafés einen Stuhl genommen, ihn unter eine Straßenlaterne gestellt und Siddhartha gelesen. Von Zeile zu Zeile bin ich in mir glücklicher, ja glücklich geworden. Ich habe damals durch Hesse erkannt, dass wir einsam sind und bleiben müssen, dass der Weg zu uns selbst nur in uns ruht und gegangen werden muss.«
Bernd verschluckte sich fast, dachte an die Aktfotos an der Wand, das Hochbett und den roten Samtsessel und äußerte sich nicht. Es war ihm unangenehm, von Karla mehr zu erfahren, als ihm zustand.
Auch ihr war es peinlich, sie stand auf, ging zur Toilette und kam mit einer arroganten, abweisenden Miene zurück, fuhr sich mit der Hand durch ihr kurzes schwarzes Haar, schaute in einen der goldumrandeten Wandspiegel, wischte einen Krumen vom weißen Tischtuch und setzte sich.
»Und was verbindet dich eigentlich mit Hesse?«, fragte sie herausfordernd.
»Ich habe meine Examensarbeit über ihn geschrieben. Genau genommen über Narziß und Goldmund.«
»Sehr originell. Hesse ist der weltweit meistgelesene Autor.«
Bernd zuckte die Achseln. »Es hat mich halt interessiert und, wie gesagt, ich wollte weg vom Politischen. Und Narziß und Goldmund ist eben unpolitisch, so dachte ich jedenfalls, insbesondere weil es im Mittelalter spielt und im Zentrum zwei Menschen stehen, die diametral entgegengesetzte Existenzweisen versinnbildlichen: die vita contemplativa und die vita activa. Narziß verkörpert, ich möchte es einmal modern ausdrücklichen, den Intellektuellen, den Geistigen und dabei den Asketen. Goldmund hingegen ist demgegenüber der Lichte, er verkörpert den Sinnlichen, den Erotischen, den Künstler. Diese sich eigentlich abstoßenden Existenzweisen schließt Hesse durch das Band der Freundschaft zu einer harmonischen Einheit zusammen. Darüber hinaus hat sich Hesse in seinem Werk ja schon früher mit der Möglichkeit des Menschen, seine Sinnlichkeit zu leben, auseinandergesetzt, auch mit seinen Hemmungen. Hier aber gelingt es ihm, den sinnlich begabten Mann, sozusagen den Casanova, als Idealgestalt zu fokussieren und ihm gleichzeitig Lebendigkeit, Individualität zu verleihen. Wenn du noch irgendwie etwas Politisches darin sehen willst, so ist es die sexuelle Revolution, die nun in aller Munde ist. Übrigens hat man bei der Anhörung diesen Aspekt nicht unerwähnt gelassen.«
Karla kommentierte Bernds Erklärung mit einem »Hm«, zündete sich eine Zigarette an und blickte dem Rauch nach. Schließlich sagte sie: »Ich habe eigentlich so ziemlich alle Werke von Hesse gelesen, nur gerade Narziß und Goldmund nicht.«
»Das ist ziemlich verwunderlich, in Deutschland ist Narziß und Goldmund Hesses beliebtestes und meistverkauftes Buch«, konterte er ihren Einwand, über Hesse zu schreiben, sei nicht originell.
»Also gut, dann erzähl mir mal von deinem Liebeskünstler und seinem asketischen Gegenteil.«
»Im Ernst?«
Karla nickte.
»Die Erzählung spielt wie gesagt im Mittelalter. Als einzigen zeitlichen Hinweis finden wir die Pest. Wir können also annehmen, dass die erste europäische Pestwelle gemeint ist, also die Zeit um 1348. Die Handlung beginnt in einem Kloster, Mariabronn, wobei Hesse das ehemalige Zisterzienserkloster Maulbronn, das zu Hesses Zeit evangelisch theologisches Seminar war, im Blick hatte.«
»Von dem er als 14-Jähriger ausgerissen ist«, bemerkte Karla.
»Dieses Motiv des Fortlaufens, der Flucht greift Hesse in der Erzählung auf. Aber eins nach dem anderen. Goldmund, der Junge heißt wirklich so, wird von seinem strengen, unnahbaren, kalten Vater nach Mariabronn gebracht, auf dass er nicht nur die Schule dort besuche und dann ins tätige Leben gehe, sondern um Mönch zu werden. Goldmund hat sich den Zielen seines Vaters ganz untergeordnet, ja strebt mit seinem ganzen Willen danach, sie zu verwirklichen, insbesondere da er Narziß, einen nur wenige Jahre älteren Novizen, mit Hingabe und Liebe bewundert. Narziß wird beschrieben als schöner Jüngling mit höfischen Manieren, der ein elegantes Griechisch spricht. Goldmund wirbt um Narziß’ Liebe und Anerkennung, die er meint, nur durch unermüdlichen Fleiß erwerben zu können. Narziß hingegen erkennt die mächtigen Urtriebe in Goldmunds Wesen und lenkt ihn, diese zu bejahen, was allerdings erst durch die Katastrophe, den Zusammenbruch Goldmunds möglich wird. Ohne sich über die Konsequenzen klar zu sein, sagt Narziß eines Tages, Goldmund habe seine Kindheit vergessen. Damit bricht die Erinnerung an Goldmunds geliebte, schöne Mutter auf, die Mann und Kind verlassen hat, um ein flüchtiges, den Sinnen hingegebenes Leben zu führen.
Im Alter von ungefähr 18 Jahren wird Goldmund ausgeschickt, um Kräuter zu sammeln, wird dabei von einer Zigeunerin verführt, worauf er nachts dem Kloster entflieht, allerdings nicht ohne vorher von Narziß Abschied zu nehmen, der sich mit strenger Askese und Kontemplation auf die ewigen Gelübde vorbereitet.
Es beginnt für Goldmund ein Leben, das vom Erzähler mit den Worten: Geschlecht, Frauenliebe, Unabhängigkeit, Wanderschaft zusammengefasst wird. Es wird eine Episode bei einem Grafen dargestellt, zu dessen Tochter Lydia Goldmund ein inniges erotisches Verhältnis hat, fast so etwas wie Liebe, das für ihn aber zu keiner Erfüllung kommt und letztlich durch die eifersüchtige jüngere Schwester zerstört wird. Goldmund muss fliehen, die Natur, der Winter, der Hunger, die Kälte werden beschrieben, die kurze, flüchtige Liebe zu Frauen. Die Schuldproblematik wird zwar angerissen, Goldmund tötet einen Landstreicher, der ihn berauben will und ihn getötet hätte, jedoch gleichzeitig wird die Schuld verharmlost, weil es Selbstverteidigung war.
Nach Jahren der Wanderschaft fällt sein Blick auf eine hölzerne Madonna, die ihn zutiefst berührt. Verwandelt tritt Goldmund aus der Kirche, er hat zum ersten Mal ein Ziel, nämlich den Meister zu finden, der diese Madonna geschnitzt hat, und selbst eine solche Figur anzufertigen, Künstler zu werden. Er wird vom Meister Niklas in einer namentlich nicht genannten Stadt, es könnte jedoch Würzburg sein, aufgenommen und unterwiesen, nicht als Lehrling, sondern als begabter, vielleicht genialer Künstler. Von dieser Zeit heißt es, sie sei die fröhlichste und unbeschwerteste in Goldmunds Leben gewesen, von außen käme ihm die reiche Bischofsstadt mit allen Künsten, Frauen, mit hundert angenehmen Spielen und Bildern entgegen. Er liebt insbesondere die jungen Mädchen, er ist aber gegen die Schöne nicht liebevoller als gegen die Unschöne. Es heißt von Goldmund, er liebe niemals halb. Dabei gibt es Frauen, die ihn erst nach drei oder zehn Liebesnächten an sich bänden, und andere, die von ihm schon nach einer Nacht vergessen werden, weil sie ihm nichts mehr zu bieten hatten.«
Bernd hatte beim Erzählen mehr nach innen und auf den Marmortisch geschaut, nun blickte er hoch und sah eine strenge, scharfe Stirnfalte auf Karlas Gesicht.
»Besonders die jungen Mädchen. Ist dir eigentlich klar, was das fürs Mittelalter heißt? Mit zwölf konnte man verheiratet werden, und das galt als Fortschritt.«
»Entschuldige, es handelt sich um Dichtung. Außerdem betont Hesse oder der Erzähler, wie du es nimmst, dass Goldmund niemals ein Kind verführt hätte.«
»Nun ja, man sollte nicht die Elle Realität an die Dichtung legen. Bleiben wir textimmanent. Ich vermute, der Meister Niklas hatte eine Tochter.«
»Die unnahbar und schön und kalt ist und die Goldmund nicht verführt. Allerdings, jetzt kommen wir zu dem künstlerischen Aspekt, nachdem er seine Holzfigur vollendet hat, es ist der Jünger Jesu Johannes, der die Züge von Narziß trägt, bietet Meister Niklas ihm an, zu bleiben, ebenfalls ein Meister zu werden und die stolze Tochter Lisbeth zu heiraten. Goldmund lehnt dies ab, obwohl ihm bewusst ist, dass er sich als Künstler noch weiter vervollkommnen könnte, und geht wieder auf Wanderschaft. Mit der Johannesfigur hat er das geschaffen, was in ihm ruht. Seine Sehnsucht gilt der Mutter, der Urmutter, die Leben spendet und den Tod bringt. Sie ist Liebe und Lust und zugleich Grab und Verwesung. Sie darzustellen ist sein höchstes Ziel. Goldmund ahnt, dass ihm dies noch nicht, vielleicht niemals möglich ist. So lehnt er ein bürgerliches Leben und die Ehe ab, die ungebundene Liebe und Wollust scheinen ihm das Einzige zu sein, wodurch das Leben wahrhaft erwärmt wird und mit Wert erfüllt werden könne. Er will die Freiheit und verlässt Meister Niklas, die schöne Lisbeth und die Kunst.
Was dann beschrieben wird, ist das Grauen der Pest. Mit einem Gesellen, Robert, zieht Goldmund umher. Goldmund trifft in einer durch die Pest nahezu ausgestorbenen Stadt auf ein Mädchen, Lene, das im Fenster sitzt und sein Haar kämmt. Er lockt sie, sich ihnen anzuschließen. Den Sommer über verbringen sie im Wald in einer Hütte, wobei von vornherein klar gestellt wird, dass Lene nur Goldmund gehört. Bisweilen plagt sie Goldmund damit, dass sie Angst vor einer Trennung hat, weswegen sie von Goldmund ein ›kleines dummes Kind‹ geheißen wird. Besonders Ungemach bereitet ihm ihre Vermutung, dass sie schwanger sein könnte. Jedenfalls eines Tages wird Lene beim Beerensammeln überfallen, Goldmund, der ihr Schreien hört, tötet den Mann. Sie allerdings ist von diesem gebissen, wird krank und stirbt an der Pest.«
»Das ist nun eine Problemlösung. Die Frau stirbt und der Mann ist frei, ohne schuldig zu werden, und kann sich in seiner Entwicklung vervollkommnen«, bemerkte Karla in sarkastischem Ton.
Bernd sah erschrocken hoch in ihr bleiches Gesicht.
»Aber es ist nur ein Roman, genauer eine Erzählung. Es ist doch nur Dichtung«, versuchte er Karla zu beschwichtigen.
»Eben. Im realen Leben sterben die Frauen auch nicht so schnell.«
Er war fassungslos und wusste darauf nichts zu sagen. Dann fiel ihm ein, dass Hesse gerade diese Textstelle vergessen hatte, als er die Erzählung nach über 20 Jahren wieder las. Sollte er das Karla mitteilen oder nicht?
Möglichst unbemerkt zog Bernd den Ärmel von seinem braunen Wollpullover zurück und sah auf die Uhr. Den nächsten Zug nach Hamburg könnte er noch erreichen, wenn Karla ihn fuhr und sie sich beeilten. Wie teuer war wohl dieses Frühstück?
»Wollen wir gehen?«, fragte er behutsam.
»Gehen? Jetzt? Das Buch ist wohl noch nicht zu Ende.«
»Natürlich nicht. Gut, also. Goldmund zieht weiter, die Pest wütet noch immer. Er trifft auf ein Judenmädchen, Rebekka, dessen Vater bei einem Pogrom verbrannt worden ist. Sie ist die einzige Frau, die sich Goldmund verweigert und in Hass und Ekel ihrem Untergang entgegenstrebt.«
»Stirbt sie denn?«
»Wahrscheinlich, letztlich bleibt dies offen. Goldmund stürzt sich darauf in Pestorgien, wird ergriffen von der Sehnsucht nach der Kunst, die allein dem Tode entreißen kann. Hoffnungsvoll sucht er Meister Niklas auf, der jedoch gestorben ist. Seine schöne Tochter ist verblüht.
Dann wird der Höhepunkt seines Liebeslebens geschildert, eine Nacht mit der Konkubine des Grafen Heinrich. Der Augenblick erscheint günstig. Der Fürst hat hohe geistliche Gäste. Allerdings nach dieser ekstatischen Nacht im Palast des Grafen wird Goldmund in der zweiten gefasst und zum Tode verurteilt. Da wird er selber zum Opfer der Frau. Agnes, so heißt die Kebse des Grafen, verrät ihn. Sie hat ihn gewarnt: ›Ich kann nur Männer lieben, die im Notfall ihr Leben daran wagen.‹ In der gemeinsamen Liebesnacht nennt sie ihn Goldfisch, ein Symbol bei Hesse für Schönheit und Hingeschlachtetwerden. Dir also zum Trost, dass es auch Goldmund schlecht ergeht, ist er in der zweiten Liebesnacht auf der Flucht vor dem Grafen in der Kleiderkammer eingeschlossen und wird ohne langes Fackeln zum Tode verurteilt.«
Bernd schwieg, sah sich nach dem Kellner mit der langen schwarzen Schürze um, holte sein Portemonnaie aus seiner Parkatasche und meinte: »Wollen wir zahlen?«
»Noch nicht«, erwiderte Karla und legte zu Bernds Verwunderung ihre Hand auf die seine.
»In dem Zimmer, in dem du letzte Nacht geschlafen hast, hat so ein Typ wie Goldmund gewohnt. Ich kam aus Köln zurück, sehr zufrieden, ich hatte Heinrich Böll für den TAGESSPIEGEL interviewt, kurz bevor er in Stockholm den Nobelpreis entgegennahm. Da schloss ich abends die Wohnungstür auf, hatte zuvor noch Sekt und Austern im KADEWE besorgt, ging leise den Flur entlang, ich wollte meinen Goldmund überraschen, da klebte an der Goethebüste ein Zettel mit den Worten: ADIEU, DU SCHÖNE!
Ich erspare dir zu schildern, wie ich mich gefühlt habe. Aber das ist nicht alles. Jetzt macht mein Goldmund, Hubertus heißt er, Karriere mit den Fotos, die du an der Wand gesehen hast. Eine Ausstellung in Düsseldorf, beste Kritiken. Und ich, ich habe ihm schriftlich die Erlaubnis gegeben, das eigentliche Aktfoto zu veröffentlichen. Man kann mich zwar nicht erkennen, aber ich bin nackt.«
Mit einem Mal war ihr Gesicht eingefallen, tiefe Ränder unter den Augen. Bernd mochte gar nicht hinsehen. Sie raffte sich auf, steckte ihre Zigarettenpackung in ihre Handtasche.
»Wann fährt dein nächster Zug?«, fragte sie nüchtern.
»Einen haben wir gerade verpasst. Der nächste fährt in drei Stunden.«
»Okay. Wenn du willst, kannst du noch mal zu mir kommen«, schlug sie vor.
Bernd nickte, rief den Kellner, bezahlte und dachte beim Herausgehen durch die Holzdrehtür:
Sie fürchtet sich vor ihrer Wohnung.
»Da sind wir wieder«, bemerkte Karla, während sie die schwere Eingangstür zum Treppenhaus aufschloss, und es klang eher resigniert als erleichtert.
Bernd folgte ihr die frisch gebohnerte Holztreppe hinauf. Was sollte er hier? Die vier Plastiktüten mit den Hermann Hesse Büchern hatte er ohnehin im Auto gelassen. Aber was sollte er in Hamburg? Was sollte er überhaupt irgendwo?
Wie der Steppenwolf, durchfuhr es ihn. Wie Hesses Harry Haller. Dessen Leben war auch zuerst in Scherben zerbrochen, bevor er der Steppenwolf, der heimatlose, der einsame Hasser der kleinbürgerlichen Welt, bevor Vereinsamung sein Schicksal wurde. Der hatte seinen bürgerlichen Ruf, sein Vermögen verloren und hatte es lernen müssen, auf die Achtung derer zu verzichten, die bisher vor ihm den Hut gezogen hatten. Nun hatte er selbst zwar kein Vermögen verloren, so doch, noch schlimmer, die materielle Grundlage für sein ganzes Leben. Und den Hut hatte auch nie jemand vor ihm gezogen, was ohnehin unüblich geworden war, aber als Lehrer hätte er doch ein Mindestmaß an Respekt erwarten dürfen. Es war zum Verzweifeln. Der Duft nach Weihnachtsbäckerei, der ihm aus einer Wohnung im ersten Stock entgegenströmte, verursachte ihm Ekel. Und noch mehr der vor der Wohnungstür herausgeputzte Weihnachtsbaum, dessen unzählige Glühbirnen zu allem Überfluss auch noch bunt leuchteten. Sonderbar diese Ähnlichkeit, wie er sich als Steppenwolf fühlte, was er bisher immer von sich gewiesen hatte. Im Roman stand eine Araukarie auf dem Vorplatz der Wohnung im ersten Stock, zeugte von Ordnung, ängstlich-rührender Hingabe an kleine Gewohnheiten und Pflichten. Der Steppenwolf verachtet diese bürgerliche Reinheit und Anständigkeit nicht einmal, obgleich er sie doch hasste. Was für ein Widerspruch. Wie ihn selbst diese bürgerliche Anständigkeit anwiderte, wie er sie verabscheute. Und doch war auch er wie der Steppenwolf der Sohn seiner Mutter – er war einmal Kind gewesen, hatte aufgeregt auf den Weihnachtsabend gewartet und auf den Augenblick, wo er ins Wohnzimmer durfte und die Kerzen am Tannenbaum brannten. Das war vorbei – für immer. Was blieb, war Entwurzelung. Was blieb, war eine Welt, von der er selbst aber ausgeschlossen war. Und während Bernd nun im Treppenhaus neben Karla stand, die sich lebhaft mit einer Frau im braunen Wintermantel mit grünem Hut unterhielt, fasste Bernd den Entschluss: Er wollte sich wie der Steppenwolf ein Datum setzen, an dem er Selbstmord begehen konnte. Beim Steppenwolf war es der 50. Geburtstag, bei ihm selbst wäre es der 30. Wenn bis dahin nicht irgendein Sinn in seinem Leben erkennbar wäre, dann würde er sich die Erlaubnis erteilen, zum Rasiermesser zu greifen.
Der Entschluss erleichterte Bernd augenblicklich und er war sogar in der Lage, dem Gespräch Karlas mit der Frau zuzuhören. Es ging um Mieterhöhungen in Berlin, konkret um die Mieterhöhung, die im neuen Jahr für ihr Wohnhaus zu erwarten war. Karla aber schien wie verwandelt. War sie auf der Rückfahrt wortkarg gewesen, die Stimmung überhaupt beinahe schmerzhaft bedrückend, blühte sie nun auf. Sie war schön, selbstbewusst, engagiert, so wie Bernd sie aus der Schulzeit in Erinnerung hatte, als sie zusammen für ihre Schülerzeitung, sie für das Mädchengymnasium, er für das Jungengymnasium, einen glühenden Artikel gegen die nach Geschlecht getrennten Schulen schrieben. Gegen den Verdacht aufkommender Unzucht wandten sie ein, dass Sexualität etwas Natürliches und nichts Auszuschließendes sei, ein gemeinsames Lernen jedoch vor allem Teamgeist, ungezwungenen, respektvollen Umgang fördern würde. Für letzteres waren er und Karla ein beredtes Beispiel, niemals hätte er es gewagt, sich ihr mit seiner dicken Brille auch nur zu nähern. Jetzt wirkte sie ebenso engagiert, arrogant und unnahbar. Doch, wie er so neben ihr stand und sie von oben herab mit der Frau sprechen hörte, da widerte ihn Karla an. Als gäbe es für sie nichts Bedeutsameres, Dringlicheres und Hässlicheres als diese Mieterhöhung, in die sie ihr Selbst hineinzuwerfen schien.
»Bringen Sie das in die Zeitung«, rief ihnen die Frau noch nach, als sie schon die Treppe hinaufgingen. Karla redete denn auch bis zu ihrer Wohnung in zwar sachlichem Ton von der Mieterhöhung, gleichwohl war ein Misston nicht zu überhören.
Dann waren sie in ihrer Wohnung. Karla hängte ihre Wildlederjacke an einen Messinghaken, Bernd packte seinen Parka über die Goethebüste.
»Willst du einen Kaffee?«, fragte sie und setzte Wasser auf.
»Nee, mein Magen.«
»Kamillentee?« Klang es ironisch oder einfach mitfühlend?
Bernd nickte.
Sie setzten sich wieder einander gegenüber, Karla auf das Sofa, Bernd auf den Stuhl. Der Kamillentee roch nach Krankheit.
Schweigen.
Karla zündete sich eine Zigarette an, lehnte sich zurück und schlug die Beine übereinander.
»Was hat dich eigentlich an Narziß und Goldmund fasziniert?«
»Die Fische.«
Unwillig zog Karla ihre schöne Stirn in Falten und tippte mit dem Zeigefinger auf ihre Zigarette, dass die Asche in den Meißenaschenbecher fiel, in dessen Mitte eine rosa Rose ihre zarten Blätter zur Knospe verschlossen hatte.
»Fische sind ein Schlüssel zu Hermann Hesses Werk«, fuhr Bernd unbeirrt fort. »Nach dem großen Sterben, nach der Pest geht Goldmund über den Fischmarkt. Es wird wohl in Würzburg sein, denn wie Hesse schrieb, finden sich im Goldmund Spuren davon. Goldmund also schlendert über den Fischmarkt, wo ein paar Fischweiber ihre lebende Ware feilbieten. Er starrt in die Bottiche zu den schönen schimmernden Tieren hinein und er hat Mitleid mit den Fischen und ist wütend auf die Weiber und die Käufer und er erinnert sich, wie er schon früher die Fische bewundert und bemitleidet hat und sehr traurig geworden ist. Er kann sich nur nicht erinnern, worüber. Goldmund ist eben kein Intellektueller.
Hesse selbst gibt darüber Aufschluss. Er beschreibt einen Gang durch Würzburg. Er sieht auf einem nach Stein und Wasser riechenden Plätzchen in Brunnentrögen und aufgestellten Bütten die Main-Fische zu Markte gebracht, die mit schönen goldenen Augen glotzen. Er empfindet Liebe für sie, grüßt sie als stumme Brüder, weil er weiß, wie es ist, gefangen zu sein, aus der eigenen Welt entrissen, verurteilt zu einer Luft, die man nicht atmen, zu einem Licht, an dem man nur sterben kann. Mit feisten Händen packt eine Händlerin einen langen edlen Fisch, einen Augenblick schwebt er mit goldenen, wehen Augen vor Hesses Gesicht, entgleitet mit einer verzweifelten Bewegung und springt glitzernd über das nasse Steinpflaster hinweg. Hesse floh davon.
Karla, in diesen wenigen Zeilen steckt eine ganze Welt. Mit den wenigen Adjektiven schön, schimmernd, golden, edel umfasst Hesse die Vollkommenheit der Fische, die darauf beruht, dass sie wie jeder Stein, jeder Grashalm, jede Blume, jedes Tier nach ihrem eigenen Sinn wachsen und leben. Vollkommen machtlos jedoch sind die Fische den feisten Händen der Fischweiber ausgeliefert. Selbst da, wo ein Barbe noch zu entkommen versucht, ist er ohnmächtig und dem Sterben preisgegeben.
Schon viel früher, in Hesses Roman Roßhalde, bildet ein Fisch das Leitmotiv für das Weh der Kreatur. Es ist eine Szene auf dem Rhein von unerbittlicher Wirklichkeit, verewigt durch das Bild des Malers. Dargestellt ist die zugreifende Hand des Fischers, das offene Maul des Fisches. Das Ganze ist kalt, bis zur Grausamkeit traurig. Das offene Maul findet sich wieder in dem grässlich verzogenen Mund, in dem Schrei des sterbenden Kindes. Und die Züge des toten Kindes sind voll unbegriffenem Leide. Hesse erklärt es selbst, das unentrinnbare Ausgeliefertsein des Fisches, das verzweifelte sinnlose Sterben des Kindes hat keine andere Symbolik als die bedrückende Unbegreiflichkeit der Natur.«
Karla, die sich anfangs lässig zurückgelehnt hatte, beugte sich vor, blickte in Bernds Gesicht, das, je mehr er erzählte, weicher, offener und dabei konzentrierter geworden war. Jetzt nahm er seine Brille in die Hand, wischte seine Gläser an seinem Pullover ab, schaute auf zu ihr, bevor er die Brille wieder aufsetzte. Karla erschrak, wie schöne, und erstaunlich große braune Augen Bernd hatte.
Sie schluckte und fragte dann in spöttischem Ton: »Und was hat das nun mit Goldmund zu tun?«
»Goldmund stellt das Gegenteil zu unbegriffenem Leid dar«, erwiderte Bernd, verwundert über den Wandel von Interesse zu Abwehr.
»Goldmund verkörpert das Glück oder genauer: das geglückte Leben. Hesse sagt selbst, seine Vorstellung vom Glück, diesem, wie er schreibt, holden, kurzen, glänzenden Wort, kristallisiert sich in der goldenen Spur des Goldmund.
Was aber heißt Glück für Hesse? Es heißt nicht, wie man meinen könnte, ein permanentes Glücksgefühl, zum Glück können durchaus Schmerz und Leid gehören, Glück heißt für Hesse, das eigene Schicksal zu finden, dem eigenen Sinn zu gehorchen, der Stimme des eigenen Lebens zu folgen. Sünde ist es, von sich wegzukommen. Konkret heißt es für Goldmund: Frauenliebe, Unabhängigkeit und Kunst.«
»So so«, sagte Karla und stand abrupt auf. »Wenn ich Goldmund richtig verstanden habe, liebt er wahllos Frauen, die er verlässt, wenn er sie ausgekostet hat. Das ist denn wohl das Gegenteil von unbegriffenem Leid.«
Irritiert schaute er Karla an, wie sie so aus dem Fenster starrte, rauchte, die Mundwinkel nach unten gezogen.
»Du nennst es Egoismus. Hesse nennt es Eigensinn, nämlich nach dem eigenen Sinn zu leben.
Hesse sieht seinen Goldmund keineswegs als Ideal an, ebenso wenig wie es seine Aufgabe als Dichter ist, sich ideale, vollkommene, erlogene, ja erlogene Figuren auszudenken. Hesse ist ehrlich genug zuzugeben, dass ihm von der Geschlechtsliebe nicht viel mehr zu erleben möglich gewesen sei als Goldmund, wobei zu bedenken ist, dass Hesse streng und fromm erzogen wurde, wovon er sich niemals wirklich gelöst hat. Jedoch ist Hesse nicht gewillt, zugunsten irgendeiner Vollkommenheit in seinen Büchern Erlebnisse darzustellen, die ihm das Leben selbst versagt hat.«
»Entschuldige«, sagte Karla und wandte sich Bernd zu. »Ich verwechsele für gewöhnlich nicht die Kunst mit dem Leben. Erzähle einfach weiter.«
»Frauen bedeuten also Goldmund nichts als sinnlichen Genuss. Das Verhältnis zum Weibe, um einmal Hesses Ausdruck zu gebrauchen, führt nicht zur seelischen Selbstfindung. Goldmund erreicht die Sublimierung der Liebe erst in der Kunst. Hesse bekennt sich auch persönlich dazu, er möchte um der Frau willen nicht lieben, er bedürfe des Umweges über die Kunst, um das Leben erträglich zu finden.«
Oh Gott, wie wird sie das nun auffassen?, bangte Bernd und dachte an die Aktbilder im Nebenzimmer und gar in der avantgardistischen Galerie in Düsseldorf, wo snobistische Reiche sich an Karlas Nacktheit delektieren mochten.
»Kunst«, sagte er behutsam, »der Künstler, so wird Goldmund bewusst, schafft doch Bilder, um irgendetwas aus dem großen Totentanz zu retten, etwas hinzustellen, was längere Dauer hat als wir selbst. Er denkt, dass jeder Mensch dahinrinnt, sich immerzu verwandelt und endlich auflöst, während sein vom Künstler geschaffenes Bild immer unwandelbar das gleiche bleibt. Goldmund arbeitet mit tiefer Liebe an der Narzißfigur, die er Johannes nennt und von der er sagt, nicht eigentlich er, Goldmund habe das Bild gemacht, sondern Narziß habe es ihm in die Seele gegeben.«
»Ist schon gut«, sagte Karla leise und strich sich über ihre Wange. Dann sah sie beherrscht munter auf:
»Was ist aber nun mit Narziß? Du erzählst ständig von Goldmund. Der Roman heißt schließlich Narziß und Goldmund. Der eigene Sinn von Narziß kann sich schließlich nicht darin erschöpfen, Goldmund zu sich selbst geführt zu haben«, bemerkte Karla und setzte sich wieder auf ihr Sofa.
»Ach Karla. Was fragst du nach Narziß. Was soll das Reden«, erwiderte Bernd und sein Gesicht wurde grau und alt. »Seitdem mir meine Existenzberechtigungskarte entzogen wurde, hat doch alles keinen Sinn …«
»Deine was?«
»Nichts weiter. Bloß ein Ausdruck aus einer Satire von Hermann Hesse.«
Nervös zog Bernd seinen Ärmel hoch, schaute auf die Uhr, stand rasch auf.
»Karla, ich muss los. Fährst du mich zum Bahnhof?«
»Du bist mir ein komischer Kauz«, rügte sie und folgte ihm langsam in den Flur.
»Weißt nicht, was du in Hamburg machen sollst, und hast Angst, den Zug zu verpassen.«
»Tja, so sind die Menschen eben, immer in Eile und ohne Ziel.« Er lachte unglücklich: »Der Satz könnte von Hesse stammen.«
Er nahm seinen Parka von der Goethebüste und stand ungeduldig bereits an der Eingangstür.
Kannst du dich nicht ein bisschen beeilen, lag es ihm auf der Zunge, als er Karla hektisch vom Flur in die Küche und in den Flur zurücklaufen sah. Ratlos starrte sie auf den leeren Schlüsselhaken und stellte dann in nüchternem Ton fest: »Der Autoschlüssel ist weg.«
»Das ist doch nicht zu fassen. Hast du denn keinen zweiten?«
»Hab ich nicht«, erwiderte sie gereizt. »Den hat Hubertus mitgenommen.«
Bernd wurde es heiß, er schwitzte in seinem dicken Parka: »Ich halt es hier nicht mehr aus.«
»Musst du auch nicht, ich habe einen zweiten Haustürschlüssel. Wir gehen nach draußen.«
Verdrossen trottete Bernd hinter ihr die Treppen hinunter. Draußen vor der großen Haustür blieb er stehen, ein kalter, modrig nach Laub riechender Wind streifte sein Gesicht. Es nieselte leicht, die Häuser, die dunklen entblätterten Kastanien waren in eine neblige Dämmerung gehüllt. Sie überquerten die Straße. Bernd warf Karlas Auto einen scheelen Blick zu. Schweigend, die Hände tief in den Jackentaschen, gingen sie in ziemlichem Abstand nebeneinander her über feuchte, mit nassem Laub bedeckte quaderförmige Steinplatten. Es fiel ihm ein, wie er schon als Schüler und sogar noch vor kurzem, noch vor wenigen Wochen, solche finsteren und trüben Spätnachmittage im Herbst und Winter gierig und berauscht eingesogen und es geliebt hatte, mit den Füßen im tiefen Laub zu wühlen. Es war eine wohlige Einsamkeit, voll tiefen Genießens. Bisweilen hatte er dann, kaum war er in sein Zimmer zurückgekehrt, mit noch klammen Fingern eine Geschichte geschrieben, selten Gedichte. Das war vorbei, das war vorbei, wie es auch beim Steppenwolf vorbei war. Einen Augenblick fühlte sich Bernd ihm verbunden. Dann überkam ihn ein Anfall gänzlicher Vereinsamung. Regen, Wind und das feuchte Laub waren nicht mehr Stimmung, der Regen war nass, der Wind kalt und das Laub schmutzig. Aufdringlich und laut schrillte O du fröhliche, O du selige, Gnadenbringende Weihnachtszeit aus einer Parterrewohnung zu ihnen auf die Straße. Bernd litt unsäglich und hatte vergessen, dass Karla neben ihm ging.
»Sag mal«, sprach sie ihn an, so dass er hochschreckte. »Der Narziß muss doch wohl auch ein eigenes Leben haben. Ich meine, so was wie eine Biographie.«
»Was soll ein Mönch schon für eine Biographie haben?«, erwiderte er unwirsch. »Außerdem sind Hesses Werke ausgesprochen handlungsarm. Er sagt selbst, er habe vor ›spannenden‹ Handlungen den größten Abscheu, insbesondere in seinen eigenen Büchern. Deswegen hat Hesse sie auch möglichst vermieden.«
Dann sagte Bernd nichts mehr, sah missmutig zu Boden, die Hände tief in den Taschen seines Parkas vergraben.
»Naja«, beharrte Karla, »wenn jeder Mensch nach Hesse einen eigenen Sinn hat, dann müsste das auch für einen Mönch zutreffen, und schon gar für Narziß, wenn er Held, oder nüchtern ausgedrückt, Protagonist ist.«
Bernd zuckte die Achseln.
»Was soll ich sagen. Eigentlich hat Narziß keine Biographie.
Am Anfang der Erzählung ist er Novize, Griechischhilfslehrer und führt Goldmund zu sich selbst. Dann, während der vielen Jahre der Wanderschaft, der Pest kommt er nur in den Gedanken Goldmunds vor. Narziß taucht erst wieder auf, als er Goldmund aus dem Kerker befreit. Er kommt also nur am Anfang und am Schluss vor. Was in all den Jahren dazwischen passiert, erfährt der Leser nicht. Es ist schon merkwürdig. Es wird richtig Spannung aufgebaut. Zwei Mal kündigt Narziß regelrecht an, dass er Goldmund von seinem Leben berichten will. Einmal sagt er: Wir werden also genug Zeit haben, einander dies und jenes zu erzählen und dann noch direkter: Auch ich habe dir dies und das zu erzählen. Ich freue mich darauf. Man wartet ständig darauf, aber Narziß tut es nicht.«
»Nee – doch«, gab Karla von sich und schüttelte verwundert den Kopf. »Das hätte ich bei Hesse nicht erwartet. Er hat doch sonst seine Komposition genau im Auge. Er sagt selbst, er habe das Ganze des Buches im Gefühl immer gegenwärtig. Warum also hat er Narziß ausgelassen?«
»Aus welchen Gründen auch immer. Jedenfalls fehlt dieser Teil. Was du Biographie nennst, ist in einem einzigen Satz zusammengefasst: Ich bin nicht sein Nachfolger, ich bin erst seit einem Jahr Abt.«
»Kann ich mir nicht vorstellen. Du irrst dich.«
»Karla, über seinen Lebenslauf gibt es nur diesen einen Satz mit nur einem Komma. Wenn du ihn ergänzen willst, dann, um es mit Narziß’ Worten zu sagen: Es ist rasch berichtet. Abt Daniel ist vor acht Jahren gestorben, ohne Krankheit und Schmerzen. Ich bin nicht sein Nachfolger, ich bin erst seit einem Jahr Abt. Sein Nachfolger wurde Pater Martin.
Schluss aus – nichts mehr. Es wird nicht gesagt, welches Amt oder welche Ämter Narziß in der langen Zwischenzeit innehatte, ob er beispielsweise der Sekretär des Abtes wurde oder politische Aufgaben als Gesandter des Klosters übernommen hatte. Vieles Wichtige wurde ja im Mittelalter nicht schriftlich, sondern durch Boten persönlich und im Geheimen überbracht und verhandelt. Narziß könnte nach Rom gepilgert oder in einer Mission geschickt worden sein. Dass Hesse dies sehr wohl in Erwägung hätte ziehen können, wird deutlich am Benediktinerpater Jakobus in Hesses großem Werk Das Glasperlenspiel. Bei Pater Jakobus laufen politisch alle Fäden zusammen, er vertritt außenpolitisch die Angelegenheiten des Ordens.
Also, bei Narziß – nichts anderes als ein langes Leerzeichen.«
»Hm«, kommentierte Karla, ziemlich unzufrieden mit Bernds Antwort. Sie nestelte in ihrer Jackentasche nach ihrer Zigarettenpackung und ihrem Feuerzeug, blieb stehen, zündete sich eine Zigarette an, ging rauchend weiter, blieb nachdenklich wieder stehen.
»So blutleer kann Narziß gewiss nicht sein. Vorstellen kannst du dir Narziß doch sicher.«
»Das Erstaunliche ist, dass Narziß, obwohl er den Geistigen, Intellektuellen verkörpert, detaillierter beschrieben wird als der sinnliche Goldmund. Narziß hat eine straffe Gestalt, kühl blitzende Augen. Von ihm heißt es, dass er bezaubert, dass er ein Wunderknabe, ein schöner Jüngling mit dem ritterlich tadellosen Benehmen, mit dem stillen, eindringlichen Denkerblick und schmalen, schön und streng gezeichneten Lippen ist. Er hat lange schwarze Wimpern. Er ist schön, vornehm, ernst wie ein Gelehrter und fein wie ein Prinz.«
»Und so ein Mann soll kein eigenes Leben haben, sondern nur eine Funktion als Führer von Goldmund, als sein Gegenpart?«
Bernd ging darauf nicht ein. Mit gesenktem Kopf schlich er neben Karla her, grübelte, ob er aussprechen sollte, was er empfand, fürchtete, von ihr verlacht zu werden. Wie um seinen Druck loszuwerden, nahm er Anlauf und sprang in einen nassen Blätterhaufen.
Karla lachte, nicht herablassend, sondern freundlich, fast fröhlich, wie er verwundert feststellte.
»Weißt du, was das Merkwürdige ist«, begann er und streifte sich braune, feuchte Blätter von der Hose ab, »obwohl von Narziß gesagt wird, dass er lange, zarte Hände hat, kann ich ihn mir gut mit dem Schwert in der Hand vorstellen. Es ist ein goldenes, blitzendes Schwert, wie es der Erzengel Michael im Kampf gegen den Satan trägt.«
Er sah Karla von der Seite an: »Nun halt mich bloß nicht für einen Spinner. Das habe ich natürlich nicht in meiner Arbeit geschrieben.«
»So blöde finde ich das gar nicht. Ich habe vor kurzem einen Konstanzer Literaturwissenschaftler interviewt, Wolfgang Iser, und der vertritt die Auffassung, dass ein literarischer Text erst beim Lesen seinen Sinn entfaltet. Der Text enthält Leerstellen, die der Leser ausfüllt, so dass Bilder, Vorstellungen entstehen. Solche Leerstellen wird es gewiss auch von Narziß geben.«
»Ja, tatsächlich. Goldmund bewundert, was aus Narziß geworden ist: ein Mann.«
»Das reicht doch für einen Roman«, sagte Karla leichthin.
Sie waren wieder bei Karlas Auto angekommen. Bernd guckte in die Ente, sah die Plastiktüten mit den Hesse-Bänden auf dem Rücksitz stehen und klopfte beim Fortgehen gegen die Scheibe.
»Eigentlich müsste jetzt nach Hesse ein Wunder geschehen«, bemerkte er, während sie das nach Tannennadeln und gebratenen Zwiebeln riechende Treppenhaus betraten.
»Wunder bedeutet bei Hesse nicht, dass plötzlich eine Macht von oben etwas tut, sondern ein Wunder geschieht, wenn wir unseren Willen, unsere Aufmerksamkeit auf eine Sache richten. Dann geschieht sie auch. Es gibt keinen Zufall. Wenn der, der etwas notwendig braucht, dies ihm Notwendige findet, so ist das kein Zufall, der es ihm gibt, sondern er selbst, sein eigenes Verlangen und Müssen führt ihn dahin. Vielleicht erinnerst du dich an diese Sätze, sie stehen im Demian.«
Karla nickte und dachte für sich, nur haben sie sich bei mir noch nie bewahrheitet.
Sie schloss die Haustür auf, hängte ihren Mantel an den Haken. Da blitzte und blinkte es in dem hohen, langen Lackstiefel, der unter dem Kleiderhaken fein säuberlich neben dem anderen stand.
Sie bückte sich, griff in ihren Stiefel, zog den Autoschlüssel heraus und hielt ihn Bernd triumphierend unter die Augen.
»Jetzt holen wir deine Hesse-Bände aus dem Auto.«
»Und wozu?«, fragte er verwundert.
»Für Narziß. Ein Satz mit nur einem Komma ist zu wenig für seine Lebensgeschichte. Wir füllen die Leerstellen aus. Wir schreiben einen Roman. Wir nennen ihn, sagen wir mal, Narziß ohne Goldmund. Das ist doch ein hervorragender Arbeitstitel.«
Kaum hatten sie die Plastiktüten aus dem Auto geholt, die Treppen hinaufgeschleppt und auf dem Küchentisch abgesetzt, als Karla schon darin zu wühlen begann.
»Was suchst du denn?«, fragte Bernd, der noch unentschlossen in der Küche herumstand.
»Ist doch klar. Ich suche das Buch Narziß und Goldmund«, antwortete Karla ohne aufzusehen.
»Ich habe Hunger«, erklärte Bernd.
»Prima, dann mach uns einen Toast Hawaii.«
Bernd hockte sich vor den Kühlschrank, worin sich außer Butter, Marmelade und einem Gläschen mit Kaviar ein halbes Toastbrot, eine geöffnete Dose Ananas und Schmelzkäse befanden.
»Du hast keinen Schinken«, bemerkte er und es klang tadelnd.
»Dann nimm Frühstücksfleisch«, antwortete sie und deutete mit dem Kopf zum altmodischen Küchenschrank, dessen oberer Teil aus mit Gazegardinen verhangenen Glasscheiben bestand und in dessen unterem bauchigen Teil allerlei Konservendosen standen.
Bernd schloss mit dem geraden dunklen Eisenschlüssel die Schranktür wieder zu und betrachtete skeptisch die Dose mit dem Frühstücksfleisch, kontrollierte sogar das Verfallsdatum.
Er rümpfte die Nase und sagte besserwisserisch: »Toast Hawaii ohne Schinken ist ein Sakrileg.«
»Wohl etwas übertrieben ausgedrückt«, antwortete Karla, ohne die Suche nach dem Buch zu unterbrechen. »Es wird schon schmecken. Welche Farbe hat denn der Einband?«
»Rot.«
»Ah, da ist es ja. Narziß und Goldmund«, freute sie sich und es klang beinahe andächtig. Unverzüglich schlug sie das Buch auf und begeisterte sich schon nach wenigen Augenblicken. »Hör dir das an. Narziß wird eingeführt als Einzelner, Besonderer, von dem im großen Kloster jeder weiß, auf den jeder achtet. Er hat vor kurzem sein Noviziat angetreten, unterrichtet wegen seiner besonderen Gaben und gegen alles Herkommen schon Griechisch, besitzt Geltung im Hause, wird beobachtet und erweckt Neugierde, wird bewundert, beneidet und heimlich gelästert. Höre weiter«, triumphierte sie: »Er trägt das Schicksal des Auserwählten, herrscht auf seine Art, leidet auf seine Art, der Abt Daniel hält ihn für einen gefährdeten Bruder.«
»Ja ja, das weiß ich doch«, antwortete Bernd, während er den unechten Toast Hawaii in den Backofen schob.
»Bernd, daraus lässt sich was machen«, rief sie erregt, ohne seine Bemerkung zu beachten. »Narziß ist vollkommen, das steht hier wörtlich! Er ist allen überlegen, es umgibt ihn Vornehmheit wie eine erkältende Luft. Er ist einsam.«
»Das sind alle Figuren Hesses«.
»Einsam zu sein, ist eine hervorragende Eigenschaft für einen Protagonisten«, urteilte Karla.
»Dazu ist er auch noch unheimlich. Hier steht: dieser Unheimliche. Unheimlich zu sein ist eine wundervolle Eigenschaft für eine Story. Und es kommt noch besser«, begeisterte sie sich:
»Er hat ein Gefühl für die Art und Bestimmung der Menschen. Er kann ihr Schicksal voraussagen, sogar, wie sie sterben, jedenfalls tut er dies beim Abt Daniel. Stirbt der sanft und in Frieden?«
Bernd nickte.
»Es ist nicht zu fassen, wie häufig auf diesen paar Seiten Narziß’ Aussehen beschrieben wird, viel öfter als das von Goldmund, der doch der Sinnliche von den beiden sein soll. Von dem heißt es nur, dass er blond ist, lange blonde Wimpern hat, dass er leuchtend und blühend ist. Im Gegensatz zu ihm sei Narziß dunkel und hager, was viel konkreter ist.«
Sie blätterte zurück:
»Er ist ein schöner Jüngling mit ritterlich tadellosem Benehmen, mit dem stillen durchdringenden Denkerblick und den schmalen, schön und streng gezeichneten Lippen.
Lies doch mal selbst: Hier wird er schön genannt: so schön, so vornehm, so ernst. Und hier steht schon wieder schön.«
Mit Hingabe blätterte sie in dem Buch.
»Hör doch Bernd, wie Hesse Narziß beschreibt: Glühend bewunderte Goldmund seinen schönen, überlegen klugen Lehrer. Und hier wieder wird er beschrieben als der Feine, Vornehme, der Kluge mit dem schmalen, leicht spöttischen Mund.
Bernd«, rief sie und schaute vor Begeisterung vom Buch auf, während Bernd sich bückte und den Toast-Hawaii aus dem Ofen nahm.
»Dein Narziß hat Sex-Appeal.«
»Nun ist aber Schluss«, sagte er ärgerlich, kam blitzschnell auf Karla zu und klappte das Buch zu.
»Was willst du überhaupt?«
»Das habe ich doch schon vorhin gesagt«, antwortete Karla mit Engelsmiene, »ein Buch über Narziß schreiben.«
»Wozu das?«
»Also, genaugenommen schreibst du einen Roman über Narziß. Wenn er fertigt ist, gehen wir zum Suhrkamp Verlag und sagen, wir hätten ein verschollenes Manuskript von Hermann Hesse gefunden und bieten es dem Verlag zur Veröffentlichung an.«
Sie lächelte unschuldig mädchenhaft.
»Erstens ist Hesses Buch Narziß und Goldmund kein Roman, sondern eine Erzählung. Und zweitens: das ist Betrug. Das ist eine Straftat, was dir nicht entgangen sein dürfte. Es handelt sich nicht einmal um die Kollision zweier Grundrechte, der Würde des Menschen und der Freiheit der Kunst, denn, was dir vorschwebt, ist keine Kunst, sondern eine Fälschung.«
»Ja, weißt du«, entgegnete sie trocken. »Einige Jahre Knast können dir auch nicht mehr schaden. Im Gegenteil, es ist weitaus ehrenhafter als Fälscher denn als Terrorist zu gelten.«
Verblüfft sah Bernd sie an, er schluckte und setzte sich aufs Sofa.
»Vielleicht hast du recht. Aber es geht nicht nur um mich, sondern um die Würde von Hermann Hesse. Erst vor kurzem, vor einem Jahr hat das Bundesverfassungsgericht im ›Mephisto-Urteil‹ festgestellt, dass die Würde des Menschen auch über den Tod hinausreicht.«
»Wann ist denn Hesse eigentlich gestorben?«, warf Karla dazwischen.
»1962.«
»Also vor 10 Jahren. »Und wann ist seine Frau gestorben? Oder lebt die etwa noch?«
»Seine Frau Ninon ist auch tot. Sie ist 1964 gestorben.«
»Das ist gut, dann kann sie nicht aussagen, Hesse hätte den Roman, pardon, die Erzählung nicht geschrieben«, kommentierte Karla.
»Du bist verrückt.«
»Im Steppenwolf heißt es: Nur für Verrückte.«
»Der Toast wird kalt«, rügte er.
Karla stand auf, entnahm dem Küchenschrank zwei blaue Teller mit friesischem Zwiebelmuster.
»Wein?«, fragte sie und schaute Bernd an.
»Meinetwegen.«
Stumm aßen sie. Der Käse war zäh, weil kalt geworden. Er fand, es schmeckte scheußlich.
»Lassen wir mal das Bundesverfassungsgericht und das Gefängnis beiseite. Was, meinst du, würde Hesse antworten, wenn wir ihn fragen könnten, ob wir seine Geschichte von Narziß weiterschreiben dürfen«, begann Karla wieder.
»Nun ja. Hesse besaß selbst eine ziemliche Portion, na sagen wir, Skrupellosigkeit, obwohl, das Wort ist wohl zu hart. Jedenfalls hat er als über 40-Jähriger den Fischer-Verlag hinters Licht geführt und seinen Roman Demian als das Werk eines anderen, Sinclairs, eines jungen Autors ausgegeben. Auf wiederholte Anfragen des Verlages, dass man doch diesen Sinclair einmal kennenlernen möchte, hat Hesse geantwortet, dieser sei krank und äußerst menschenscheu. Als Sinclair sogar einen Literaturpreis für das beste Buch eines Debütanten erhielt, hat sich Hesse immer noch nicht als Autor zu erkennen gegeben. Nur als die Sache aufflog, weil ein Leser dahinterkam, musste er zugeben, dass Sinclair nichts als eine erfundene, fiktive Figur war.«
»Und wie ist er dahintergekommen?«, fragte Karla gespannt.
»Durch die Formulierung ›nimmer‹ für niemals. Die ist typisch für Hesse, du findest sie auch bei Gertrud und auch später in Narziß und Goldmund.«
»Hm, dann musst du halt aufpassen.«
»Hör auf, Karla.«
Ungerührt fuhr sie fort und steckte sich eine Zigarette an: »Wenn ich nun an Hesses Buch Demian denke, so finde ich, dass Hesse unmissverständlich sagt, jeder Mensch müsse das tun, was als Schicksal in ihm angelegt ist, selbst wenn er ein Verbrecher ist. Hesse führt das dann auch lang und breit am Beispiel der Geschichte mit den Schächern am Kreuz aus. Derjenige, der weinerlich seine Taten bereut, wird verachtet. Derjenige Verbrecher aber, der sich auch angesichts des Todes und der Hölle zu seinen Taten bekennt, der ist ein Kerl und hat Charakter. Der geht seinen Weg zu Ende und sagt sich nicht im letzten Augenblick feig vom Teufel los, der bis dahin ihm hat helfen müssen. Das ist doch die Botschaft von Hesse:
Geh den Weg zu dir selbst. Wahrer Beruf für jeden Menschen ist nur das eine: zu sich selbst zu kommen. Seine Sache ist es, das eigene Schicksal zu finden. Er mochte als Dichter oder als Wahnsinniger oder als Prophet oder Verbrecher enden. Aber von sich selber wegzugehen, ist Sünde.«
Karla schwieg und sah Bernd erwartungsvoll an.
»Lass uns aufhören.« Er schob das Weinglas beiseite, stand auf und fragte: »Du hast doch bestimmt einen Fernseher.«
»Drüben in meinem Zimmer.«
»Dann lass uns zur Abwechslung mal ein bisschen Fernsehen gucken.«
»Mach du ihn schon einmal an. Ich schaue, ob ich was zum Knabbern finde.
Und stell die Antenne richtig ein«, rief sie Bernd nach, als er schon die Türklinke von der weißen Flügeltür runterdrückte.
Bernd machte das Deckenlicht an und stand einen Augenblick verblüfft in dem großen herrschaftlichen Raum. Zu seiner Linken Bücherregale aus dunklem Holz bis an die Decke, sogar mit einer Trittleiter, so dass Karla bequem an die oberen Regale herankam. Davor ein mächtiger Schreibtisch aus Eichenholz, der jedem ostpreußischen Gutsbesitzer zur Ehre gereicht hätte. Darüber ein auslandender Kronleuchter. An der rechten Wand jedoch befand sich ein mit grobem rotem Stoff bezogenes Couchbett, davor ein niedriger Glastisch und ein viel zu hoher Bistrostuhl. Bernd hockte sich vor ein ovales niedriges Tischchen mit schief gestellten Beinen und Messingumrandung, worauf der portable rote Fernseher stand. Er drehte an der langen spitzen Antenne, bis das Bild einigermaßen akzeptabel war.
»Zimmermann, Aktenzeichen XY – ungelöst. Du kannst die Sendung ruhig anlassen«, entschied Karla und stellte ein Schälchen mit Chips und Schokoriegeln auf den Glastisch.
»Der sieht immer so bieder aus mit seinem dunklen Anzug, so seriös und amtlich und dabei ein bisschen schmierig«, bemerkte sie, während sich Bernd zu ihr auf die Couch setzte.
Er mochte die Sendung nicht, sah nur halb hin. Es ging um Mord. Man sah einen Wald an einer Landstraße, das Fleckchen Gras, wo die Tote gelegen hatte. Düster, obgleich Karla einen Farbfernseher hatte.
Der Ton fing an zu rauschen, weiße Punkte erschienen auf der Bildfläche, graue Streifen, ein einziges Flimmern.
»Du solltest dir mal eine zweite Zimmerantenne anschaffen«, bemerkte er und hockte sich wieder vor den Fernseher.
»Die hat Hubertus mitgenommen«, antwortete sie.
Schweigen. Am liebsten hätte er den Kasten ausgemacht. Aber Karla blieb beharrlich auf ihrer Couch und schwieg.
Dann plötzlich – ein klares Bild.
»Und nun bitte ich um Ihre besondere Aufmerksamkeit. Es handelt sich um einen Mann von außergewöhnlicher krimineller Energie und Kaltblütigkeit«, tönte es aus dem Fernseher.
Man sah einen jungen Mann mit Lederjacke über den belebten Vorplatz des Bremer Hauptbahnhofs gehen. Kurz vor den Straßenbahnschienen fiel ihm eine Pistole aus dem Ärmel, es löste sich ein Schuss. Der Mann hob die Pistole auf, lächelte die Umstehenden an und ging seelenruhig weiter. Kurz darauf stand er in einer Bank, bedrohte den Kassierer, hielt die Angestellten in Schach und entkam mit der Beute.
»Der hätte Hermann Hesse gefallen«, bemerkte Karla möglichst beiläufig und steckte sich Chips in den Mund. »Höre doch, Bernd«, flehte sie, »Hermann Hesse ermutigt selbst dazu, sich sein Werk anzueignen. Er sagt doch selbst, ob sich das Verstehen eines Lesers mit dem deckt, was er selbst als Absicht und Sinn seiner Arbeit empfindet, das halte er für ganz belanglos.«
Abrupt stand Bernd auf und sagte in drohendem Ton:
»Karla, ich mache es nicht.«
Traurig fügte er hinzu: »Ich kann nicht so schreiben wie Hermann Hesse.«
Erschrocken sah Karla ihn an. Dagegen gab es kein Bitten, Überreden, kein Argument.
»Ich gehe jetzt schlafen. Wenn es dir recht ist, bleibe ich noch eine Nacht hier. Morgen fahre ich nach Hamburg, du brauchst mich nicht zum Bahnhof zu bringen.«
Regungslos blieb Karla auf ihrer Schlafcouch sitzen, das Gesicht in den Händen vergraben. Sie hörte, wie Bernd ins Badezimmer ging, nach einer Weile herauskam und in Hubertus’ früherem Gemach verschwand. Dann war es still.
Irgendwann erhob sie sich mühsam, knipste das Licht aus und ging in die Küche. Auf dem Tisch lag neben den Tellern und Weingläsern noch das Buch Narziß und Goldmund.
Sie nahm es in die Hand, schlug irgendeine Seite auf und las im Stehen:
Und nun blickte er dem Abt ins Gesicht. Es war ein hageres Gesicht, fest und klar geschnitten, mit sehr dünnen Lippen. Es war ein Gesicht, das er kannte. Wie verzaubert blickte Goldmund in dies Gesicht, das ganz von Geist und Wille geformt war.
Gedankenverloren blätterte sie einige Seiten weiter.
›Immerhin‹, sagte Narziß zögernd, ›es war ein recht häßlicher Plan. Hättest du wohl wirklich einen Priester, der als Beichtvater zu dir kam, totschlagen können?‹
›Dich nicht, Narziß, natürlich nicht, und vielleicht auch keinen von deinen Patres, wenn er die Mariabronner Kutte trug. Aber einen anderen beliebigen Priester, o ja, verlaß dich drauf.‹
Karla wiegte den Kopf. So weit ließ Hesse Goldmund sich in Schuld verstricken und bewahrte ihn zugleich davor, tatsächlich ein Verbrechen zu begehen. Wie aber reagierte Narziß auf dieses Geständnis?
›Also über diese Sachen‹, sagte Narziß mit kühler Stimme, ›sprechen wir ja später. Du kannst mir einmal beichten, wenn du magst. Oder du kannst mir sonst von deinem Leben erzählen. Ich freue mich darauf. Auch ich habe dir dies und das zu erzählen. Ich freue mich darauf. – Wollen wir gehen?‹
Es war Karla, als hörte sie Narziß sprechen, als stände er dicht hinter ihr. Narziß freute sich darauf, von Goldmunds Leben zu hören, obwohl dieser ihm gerade von seinem Mordplan erzählt hatte? Wer war Narziß, dass er nicht urteilte, nicht verurteilte, sondern sich freute? Dies und das wollte er erzählen, hätte Freude daran gehabt – und tat es nicht.
Narziß, es war ihr, als wäre er wirklich anwesend, als würde er sie betrachten. Nein, er bat nicht darum, dass sie seine Geschichte erzählte, dieses Dies und Das, wie er es vornehm zurückhaltend beiläufig bezeichnete. Aber sie müssten seine Geschichte schreiben, weil sie erzählenswert war.
Wie nur Bernd dazu bewegen? Die Antwort darauf, das wurde Karla eisesklar, konnte nur Hermann Hesse geben. Irgendwo in seinen Büchern müsste stehen, dass er einverstanden damit war, wenn sie das Buch über Narziß’ Leben schrieben.
Hastig räumte Karla den Küchentisch leer, wischte die Tischplatte sauber, griff nach den Plastiktüten, packte ein Buch nach dem anderen aus und legte die Bücher ordentlich dicht nebeneinander auf den Tisch.
In welchem Buch könnte die Antwort stehen? Sie ließ ihre Hand über Hesses Werk gleiten, überlegte: Siddhartha? Steppenwolf? Peter Carmenzind? Knulp? Gedichte? Klingsors letzter Sommer? Das Glasperlenspiel? Demian? Wohl dort am ehesten, denn der Demian war ja nicht nur ein Roman, sondern so etwas wie eine Theorie, wie ein Schlüssel zu Hesses Werk.
Ihr Blick fiel auf die Morgenlandfahrt.
Da ging es darum, dass der Erzähler eine Beschreibung dieser Morgenlandfahrt machen wollte, einer Reise in das Reich des Geistes, der Musik, der Poesie. Zugleich waren die Mitreisenden eben jene Männer des Geistes, der Musik und Poesie:
Es waren unter uns viele Künstler, viele Maler, Musikanten, Dichter, es war der glühende Klingsor da und der unstete Hugo Wolf, der wortkarge Lauscher und der glänzende Brentano – aber mochten auch diese Künstler, oder einige von ihnen, sehr lebendige und liebenswerte Gestalten sein, so waren die von ihnen erdachten Figuren doch ohne Ausnahme viel lebendiger, schöner, froher und gewissermaßen richtiger und wirklicher als die Dichter und Schöpfer selber. Pablo saß da in entzückender Unschuld und Lebenslust mit seiner Flöte, sein Dichter aber schlich schattenhaft, vom Mond halb durchschienen, am Ufer hin und suchte Einsamkeit.
So sah sich also Hesse selbst, schattenhaft, seine Figuren aber lebendig. Und sie fühlte irgendwie konzentriert den Blick von Narziß auf sich gerichtet. Sie blätterte weiter – und erschrak.
Da stand die Antwort. Hesse gab sie selbst. Das Buch ans Herz gedrückt, lief sie in Bernds Zimmer, knipste das Licht an und rief aufgeregt:
»Bernd, ich muss dir was von Hesse vorlesen«, sprach sie und kletterte die Leiter zu seinem Hochbett ein Stück weit hinauf.
Verschlafen richtete er sich auf, stützte seinen Kopf auf seinen Ellenbogen.
»Hör dir das an. Also, der Erzähler will einen Bericht über die Morgenlandfahrt schreiben, kommt aber dabei nicht gut voran und fragt einen Autor, der ein Buch gegen den Krieg geschrieben hat, wie es ihm möglich gewesen sei, das Buch zu schreiben.
Er besann sich einen Augenblick, aus Gedanken zurückkehrend. ›Es war mir bloß darum möglich, weil es notwendig war. Ich mußte entweder dieses Buch schreiben oder verzweifeln, es war die einzige Möglichkeit meiner Rettung vor dem Nichts, vor dem Chaos, vor dem Selbstmord. Unter diesem Druck habe ich das Buch geschrieben, und es hat mir die erwartete Rettung gebracht, einfach weil es geschrieben ist, einerlei wie gut oder schlecht.‹
Bernd, hast du gehört. Einerlei wie gut oder wie schlecht, das sind Hesses eigene Worte. Wir stehen doch vorm Abgrund. Schau dir dieses Zimmer, diese Bilder an. Und du? Was wird aus dir? Es ist gewiss nicht dein Schicksal, durch das Berufsverbot vernichtet zu sein.«
Sie fasste ihn leicht an seinem Ärmel.
Bernd machte ihre Hand los und erklärte hart:
»Und deines ist es nicht, verlassene Geliebte zu sein.«
»Autsch, das tut weh«, klagte sie, kletterte die Leiter hinunter und verließ leise den Raum.
Kurz darauf kam er, noch in dem geliehenen Schlafanzug, zu Karla in die Küche, stand bedröppelt vor ihr und murmelte: »Es tut mir leid.«
»Du hast ja recht«, antwortete sie nüchtern, tapfer, sie schluckte.
»Wenn du magst, erzähl mir doch, was passiert ist.«
Karla nickte. »Aber nicht hier.«
Wenig später verließen sie die Wohnung, gingen das Treppenhaus hinab und standen unschlüssig vor der Eingangstür. Es regnete, es goss, es stürmte.
»Setzen wir uns ins Auto«, schlug Karla vor und rannte über das glitschige Kopfsteinpflaster. Bernd hechtete ihr nach, schlug vor dem Regen schnell die Wagentür hinter sich zu und verkroch sich in seinem Parka. Kalt und feucht war es im Auto. Karlas Gesicht hinter dem Lenker verschwand im Dunkeln, wurde einen Augenblick von den Scheinwerfern eines entgegenkommenden Autos erhellt. Bernd wartete. Sie zündete sich eine Zigarette an, inhalierte, die Asche glimmte, sie drückte die Zigarette aus, wandte sich ein wenig seitwärts Bernd zu und sagte nüchtern: »Ich habe meine Seele verkauft.«
Bernd erwiderte darauf nichts, wartete.
»Der Satz hat sich in mein Gehirn gefressen. Ich wiederhole ihn jeden Tag. Zwanghaft. Er hat sich wie eine Zecke in mir festgebissen.«
Sie schwieg und zündete sich erneut eine Zigarette an.
»Aber es ist natürlich nicht der Satz, es ist die Wahrheit.«
»Wie das?«, fragte Bernd zögernd. Er mochte nicht hinzufügen: ›Du bist eine erfolgreiche Journalistin, siehst fantastisch aus, wirst bestimmt von vielen beneidet. Vergiss den Kerl.‹
»Du hast es ja schon gesehen, Hubertus ist ein Künstler der Fotografie. Aber er verdiente kaum Geld damit, lief sich die Hacken ab, um einen Galeristen zu finden, der endlich seine Bilder ausstellte. Aber ohne Namen und ohne Vitamin B? Also, er war ständig pleite, kellnerte, um sich über Wasser zu halten. Die Miete, die wir eigentlich gemeinsam tragen wollten, hat er fast nie bezahlt. Aber das ist nebensächlich.
Jedenfalls hatte er die fixe Idee, dass mit einer eigenen Galerie auch der Ruhm käme. Und es fand sich, wie er meinte und es wohl auch war, die ideale Gelegenheit: ein repräsentativer Altbau, Nähe Savigny-Platz. Das Haus war zwar ein bisschen heruntergekommen, aber die Belle Etage mit Stuckdecken, Parkett hätte sich wunderbar für eine Galerie geeignet. Hubertus malte mir aus, wie die feine Gesellschaft hier ein immer neues Kunstevent erleben könnte, und er schlug mir vor, unterm Dach, wie einstmals Rahel Varnhagen, einen literarischen Salon zu etablieren. Dazwischen hätten wir dann unsere Wohnung und wären für immer glücklich.«
»Hm«, kommentierte Bernd das Gehörte und wischte die vom Atem beschlagene Scheibe seines Seitenfensters. Er beobachtete, wie einige Paare laut redend und lachend aus einer Gastwirtschaft kamen. Alle trugen dicke Wintermäntel und Hüte. Das Gestänge eines Regenschirms wurde vom Wind umgestülpt, allgemeines Gelächter. Bernd verstand etwas wie ›miese Qualität‹.
»Natürlich, das mit dem Glück habe ich bezweifelt, allein die Sehnsucht danach. Jedenfalls das Haus war für Berliner Verhältnisse nicht zu teuer, aber unbezahlbar für mich. Von Zeit zu Zeit verdiene ich zwar gut für ein Interview, eine aufwändige Reportage, aber letztlich lebe ich von meiner Arbeit für die Wurfzeitung, die mir ziemlich regelmäßige Einkünfte bringt. Ich habe mich bei der Bank nach einem Kredit erkundigt, die Zinsen waren horrend. Ich hätte mich mein Leben lang verschuldet. Jedenfalls rief eines Tages der Makler an, ich war nicht zu Hause, und wollte eine definite Antwort haben, es gäbe noch weitere Interessenten. Hubertus sagte zu! Ich habe Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um das wieder rückgängig zu machen. Mein Bitten und Flehen beim Makler fand endlich Gehör. Doch die Stimmung zu Hause war eisig. Hubertus bestrafte mich, indem er mich konsequent ignorierte. Nach ein paar Tagen hielt ich es nicht länger aus, stieg zu ihm in sein Hochbett und bettelte, was ich denn für ihn tun könnte. Da antwortete er: Aktfotos. Nein, nur ein einziges Aktfoto. Ich müsste allerdings die Rechte an ihn abtreten.
Kurz darauf war er fort. Und nun macht er Karriere in Düsseldorf, hat Erfolg. Letzte Woche las ich im TAGESSPIEGEL, dass ein argentinischer Haziendabesitzer die Fotos für 250 000 Dollar gekauft hat. Doch bevor sie in seinen Privatgemächern verschwinden, werden sie in Paris, Rom und New York ausgestellt.«
»Das ist doch gar nicht so schlimm«, versuchte Bernd die Sache herunterzuspielen. »Ich kenne das Aktfoto zwar nicht, aber man sieht dich doch nur von hinten. Niemand erkennt dich. Dazu hast du jetzt noch deine Haare kurz geschnitten. Nacktsein ist kein Tabu mehr. Die prüden Zeiten sind vorbei, seit die Kommune 1 sich nackt vor eine weiße Wand gestellt hat, ebenfalls den Rücken dem Betrachter zugewandt. Keine Zeitung, die das Bild nicht gedruckt hätte.«
»So freiwillig war das gar nicht, Kollegen haben mir gesagt, die hätten das gar nicht gewollt. Seien von ihren eigenen Ideen von sexueller Freiheit überrumpelt worden. Betrachte dir das Foto genau. Sie sehen alle sieben so aus, als würden sie jeden Augenblick erschossen.«
»Die Ikone der Emanzipation, Simone de Beauvoir. Von ihr gibt es auch ein Foto, wie sie nackt in einem Hotelbadezimmer steht und sich die Haare macht. Ihr Gesicht sieht man im Spiegel.«
»Danke, dass du mich zu trösten versuchst. Es hilft nicht. Simone de Beauvoir hat unter den ständigen Affären Sartres sehr gelitten. Wer wie sie schreibt, die Frau tue nichts als auf den Mann warten, selbst wenn sie anderweitig beschäftigt ist, der hat sich sexuell nicht befreit.«
»Gut, dann nimm Hermann Hesse selbst. Auch von ihm gibt es ein Foto, das ihn nackt von hinten zeigt. Es ist beim Klettern aufgenommen.«
Karla schüttelte energisch den Kopf.
»Bernd, das macht keinen Sinn für mich. Es mag sein, dass Hesse mit diesem Foto einverstanden war. Meistens sieht man ihn ja im Anzug, sogar oftmals mit Hut. Aber ein Nacktfoto oder Aktfoto verletzt, verwundet nur dann nicht, wenn du es genauso gerne betrachtest wie ein Kinderfoto.«
Er wusste darauf nichts zu antworten. Seine Finger wurden klamm und die Füße in seinen Halbschuhen kalt. Er fühlte seine Müdigkeit.
Entschlossen setzte Karla sich auf. »Ich erzähle dir das nicht, um mein Unglück in alle Ewigkeit zu wiederholen. Im Steppenwolf ist Harry Haller angeklagt, weil er aus seinem Leben eine scheußliche Krankengeschichte gemacht hat. Das habe ich nicht vor. Und das willst du vermutlich auch nicht.«
»Also gut. Fahr los, Karla. Du kennst sicher eine nette Bar. Wie sagt es Hesse:
Der Vogel kämpft sich aus dem Ei. Morgen fangen wir mit Narziß an. Ich mach’s.«
Während Karla Hubertus’ Schreibtischsessel in die Küche trug, allerdings ohne den tiefroten Samtbehang, fragte sie: »Wie nun beginnen?«
Bernd, der schon am Küchentisch saß und sich zu ihr umwandte, fand, dass der Stuhl mit seinen hellgrün gestrichenen Armlehnen und dem gelb geblümten Sitzkissen ziemlich schäbig aussah, wie vom Sperrmüll. Sie schob den Stuhl zu ihm heran an den Küchentisch, auf dem noch zugeklappt Narziß und Goldmund lag. Bernd wunderte sich ein wenig darüber, dass sie, ohne sich darüber verständigt zu haben, es als selbstverständlich ansahen, dass sie weder an Hubertus’ futuristischer Glaskonstruktion noch an Karlas Gutsherrenschreibtisch arbeiten würden. Auch das nostalgische Küchensofa erschien irgendwie unpassend.
»Zunächst lesen wir gemeinsam den ganzen Roman Narziß und Goldmund, so dass wir Narziß kennenlernen«, beantwortete Bernd ihre Frage. »Dabei notieren wir uns die Textstellen, die als Anknüpfungspunkt für eine Story geeignet sind.«
Karla nickte zustimmend, den Kopf über das Buch gebeugt.
»Damit wir aber nicht unserer Fantasie freien Lauf lassen, sondern Hesse schreiben, entwickeln wir die Handlung in Verbindung mit dem Werk Hesses. Hesse hat einmal gesagt, dass für ihn Demian, der Steppenwolf, Siddhartha, Goldmund jeder ein Bruder des anderen, jeder eine Variation desselben Themas sei. Es gibt somit eine Kontinuität zwischen all seinen Werken und Figuren. Das bedeutet für uns, wir suchen Motive, Situationen, Gedanken, Gefühle aus anderen Büchern, die für die Szenen unseres Buches geeignet erscheinen.«
»Das heißt«, schlussfolgerte Karla, Narziß und Goldmund ist unser Ausgangspunkt. Das Manuskript über Narziß hat Hesse danach, also später, verfasst. Wir müssen uns allerdings als erstes überlegen, wann zeitlich Hesse unser Manuskript Narziß ohne Goldmund geschrieben hat, damit wir wissen, welche Werke wir berücksichtigen können.«
»Du sagst es.«
»Also, im Januar 1929 hat Hesse das Schlusskapitel von Narziß und Goldmund beendet. Am 21. Januar hat er die handschriftliche Fassung abgeschlossen.«
»Himmel«, rief Karla entsetzt. »Hat Hesse etwa mit der Hand geschrieben? Eine ganze Erzählung mit der Handschrift Hesses vorzutäuschen, das schaffen wir nie.«
»Nun gib nicht so schnell auf. Hesse hat es abgetippt, jedenfalls gibt es eine Menge Fotos, die ihn an der Schreibmaschine zeigen. Wir müssen allerdings sein Modell herausfinden. Aber wir weichen ab. Im April hat er das Typoskript an seinen Verlag nach Berlin geschickt. Im Juli erfolgte die Korrektur der Druckfahnen, im Oktober der Vorabdruck in Die Neue Rundschau, im August 1930 ist dann Narziß und Goldmund als Buch erschienen. 1929 oder 1930 ist also unser Fixpunkt. 1932 erschien Die Morgenlandfahrt. Von 1932 bis 1942 hat Hesse am Glasperlenspiel gearbeitet.
Nun gibt es also drei Möglichkeiten für uns: Hat Hermann Hesse unser Manuskript über Narziß gleich nach der Veröffentlichung des Buches Narziß und Goldmund geschrieben oder noch während der Arbeit am Glasperlenspiel oder aber viel später, nach 1942? Was meinst du, Karla?«
»Ist das nun eine ernst gemeinte Frage?«, erkundigte sie sich skeptisch.
»Ja, schließlich müssen wir später Unseld, den Verleger, überzeugen, dass das Manuskript von Hesse ist. So stellst du dir das doch vor?«
Bei dem Namen Unseld zuckte Karla zusammen. Zögernd gab sie zu: »Der soll sehr schwierig, kritisch und launisch sein. Auch wenn wir natürlich nicht wissen können, wann Hesse das Manuskript geschrieben hat, muss unsere Antwort plausibel klingen. Sag, was meinst du, Bernd?«
»Hesse hat nach dem Glasperlenspiel kein großes Prosawerk mehr veröffentlicht, es ist sein letztes großes dichterisches Werk. Wenn er 1942 Das Glasperlenspiel beendet hat und 1962 gestorben ist, dann sind das 20 Jahre. Für einen Dichter eine sehr lange Zeit. Warum hat er danach keinen Roman mehr geschrieben?«
Karla starrte vor sich hin, dachte intensiv nach.
»Ich glaube, Hesse gibt im Glasperlenspiel selbst den Schlüssel für diese Antwort«, erinnerte sie sich. »Da entscheidet sich Josef Knecht, dass, wenn er einmal Unlust verspüren würde, wenn es ihm schwer fiele, das Jahresfest des Glasperlenspiels vorzubereiten, er sein Amt niederlegen würde. Mit dem Glasperlenspiel hat Hesse sein Höchstes geleistet. Es gilt als Gipfel seines dichterischen Schaffens, als Summe seines dichterischen Lebens. Ich meine, das hat Hesse auch selbst so gesehen. Darum, um auf unsere Frage zurückzukommen, wann Hesse eine Erzählung über Narziß geschrieben haben könnte: Es erscheint unwahrscheinlich, dass er danach sich einem Teilaspekt seines Werkes wieder zuwendet. Außerdem tauchen gleich ganz andere Fragen auf: Warum hat er es nicht veröffentlicht oder weshalb wurde es nicht posthum veröffentlicht? Und wie sollen wir ein Manuskript aus dem Nachlass finden, der von seiner Frau sicher extrem gut verwaltet wurde?«
»Das habe ich mir genauso überlegt«, sagte Bernd. »Es ging mir wirklich nicht darum, dich irgendwie lächerlich zu machen, sondern nur darum, ob du so denkst wie ich.«
Karla zündete sich eine Zigarette an und kommentierte: »Männer.«
Verdutzt sah Bernd sie an. »Wollen wir aufhören?«
»Nein. Was spricht für die Zeit kurz nach 1930?«
»Die Morgenlandfahrt. Ich habe sie gestern Nacht noch durchgelesen. Sie war ja Hesse so wichtig, dass er sogar sein Werk Das Glasperlenspiel den Morgenlandfahrern gewidmet hat. In Die Morgenlandfahrt kommt Goldmund zweimal namentlich vor, aber kein Mal Narziß. Deshalb nehme ich an, dass er unser Manuskript nach der Morgenlandfahrt geschrieben hat. Das Buch endet ganz merkwürdig, nämlich dass der Autor immer mehr abnimmt und schließlich in der erdachten Figur verschwindet. Ich stelle mir vor, dass Hesse einen Mangel empfunden hat, indem er das Leben des Narziß ausgelassen hat. Oder anders ausgedrückt, dass Narziß immer mehr an Leben gewann, immer mächtiger wurde und sozusagen Hesse keine Ruhe gelassen, ihn quasi gezwungen hat, ihn sichtbare Realität werden zu lassen. Ja, man kann sogar weitergehen. Hesse hat es auch selbst gesagt, dass Das Glasperlenspiel, genauer Josef Knecht und Narziß zusammengehören, ja dass Josef Knecht im Narziß präformiert sei. Wie ebenfalls die pädagogische Provinz Kastalien und das Kloster Mariabronn zusammengehören. Das heißt, Hesse hat Narziß ohne Goldmund vor oder zu Beginn des Glasperlenspiels geschrieben. Wir können also auch Das Glasperlenspiel in unsere Erzählung einbeziehen.«
»Wie überhaupt das ganze Werk Hermann Hesses.«
Bernd nickte. »Ja, das stimmt. Wie gesagt, für ihn sind der Knulp und der Demian, der Siddhartha, der Klingsor und der Steppenwolf oder Goldmund jeder ein Bruder des anderen. Von Peter Camenzind bis zum Steppenwolf und Josef Knecht können sie alle als eine Verteidigung, zuweilen auch als Notschrei der Persönlichkeit, des Individuums gedeutet werden.«
»Das heißt«, schlussfolgerte Karla, »wir können für Narziß’ Leben alle Werke Hesses zu Rate ziehen.«
»Noch mehr, und umso besser. Hesse hat den vierten Lebenslauf Josef Knechts in zwei Fassungen geschrieben. Bei der zweiten Fassung zitiert er über lange Strecken seine erste Fassung. Er hat viele Passagen der ersten Fassung Wort für Wort in die zweite Fassung hinübergenommen.«
Bernd strahlte: »Das können wir also auch machen oder ebenso Formulierungen und Motive aus anderen Werken übernehmen und in den neuen Kontext integrieren. Hesse macht es ja selbst.«
Karla strich Bernd sanft über den Ärmel.
»Warum bloß hat er es nicht veröffentlicht?«, fragte sie. »Da sehe ich noch ein Problem.«
»Nach 1933 mit der Machtübernahme wurde es schwierig. Narziß und Goldmund wurde nicht wieder aufgelegt, angeblich aus Papiermangel, in Wirklichkeit weil ein Pogrom geschildert wird, das Hesse nicht streichen wollte. Hesse sagte, er habe dadurch viele 1000 Mark eingebüßt.«
Bernd schwieg entsetzt und biss sich auf die Lippen. Das Letztere hätte er nicht sagen müssen. Karlas Gesicht verwandelte sich in eine Fratze, weinerlich, gekränkt fand er, nein, noch schlimmer seelenlos, starr. Dieser gottverdammte Kerl, dachte er, machte Profit mit ihrer Seele. Bernd hätte, so wunderte er sich über sich selbst, ihm eins in die Visage geschlagen, wäre Hubertus plötzlich hereingekommen.
Karla fasste sich: »Fragt sich dann aber, warum Hesse das Manuskript über Narziß nicht nach 1945 veröffentlicht hat.«
»Vielleicht hat er es vergessen.«
»Du spinnst.«
»Nein, ganz im Ernst. Hesse hat tatsächlich in seiner Schublade ein Fragment vom Goldmund gefunden, das er völlig vergessen hatte. Er hatte es 1907 verfasst und 1943 wiederentdeckt.«
»In seiner Schublade, sagst du. Und wie kommen wir an das Manuskript?«
Bernd zuckte die Schultern. »Keine Ahnung. Wir müssen darauf vertrauen, dass uns dazu was einfällt.«
»Ich koch uns erst einmal einen Kaffee. Ich nehme an, dein Magen hat sich beruhigt.«
»Mensch, ich habe ganz vergessen, meine Eltern anzurufen, dass ich nicht nach Hamburg komme.«
»Das Telefon steht auf meinem Schreibtisch.«
Als Bernd nach einem heftigen und unerfreulichen Telefongespräch mit seiner Mutter, in dem es vornehmlich um Geld, nämlich die Rückzahlung seines BAföG gegangen war, wie auch um die Schande, die Bernd seiner Familie machte, den Telefonhörer auflegte, hatte sich Karla über das Buch gebeugt, sah dann auf und wandte sich seitwärts Bernd zu: »Sag mal, ich suche etwas über Narziß’ Kindheit und Jugend. Über Goldmunds steht so viel, über Narziß finde ich nur ein Wort Zögling. Es gab den Zögling Narziß, der erst seit kurzem das Noviziat angetreten hatte.«
»Mehr steht auch nicht drin. Zögling kann im Mittelalter viel bedeuten, dass Narziß als Gottesgabe von seinen Eltern dem Kloster übereignet worden ist, dass seine Mutter eine arme Frau war, die ihr Kind nicht ernähren konnte oder keines haben durfte, weil es unehelich war, und sie den Säugling auf das Rad in der Klostermauer gelegt, das Glöckchen geläutet hat und verschwunden war. Das Rad wurde dann gedreht und das Kind von den Mönchen in Empfang genommen. Die Mutter könnte sogar eine Adelige gewesen sein, das wäre eine Erklärung für Narziß’ höfische Manieren.«
»Das ist Spekulation«, bemerkte Karla streng.
»Ja, und es passt nicht zu Hesse. Über Josef Knecht, der ja sozusagen mit Narziß verwandt, sein Bruder ist, heißt es: Über Josef Knechts Herkunft ist uns nichts bekanntgeworden. Gleich vielen anderen Eliteschülern hat er seine Eltern früh verloren oder ist von der Erziehungsbehörde aus ungünstigen Verhältnissen losgelöst und adoptiert worden.«
»Hm«, zog Karla die beiden Buchstaben in die Länge und zündete sich eine Zigarette an. »Dann lassen wir die frühkindliche Sozialisation ganz weg. Warum wollte wohl Hesse nichts über die Herkunft sagen? Er selbst war doch der Ansicht, dass in den ersten sechs Lebensjahren die Eindrücke am mächtigsten seien.«
»Da ist zwischen Autor und Figur zu unterscheiden. Hesse ist Künstler und da spielt wie bei Goldmund das Mütterliche eine große Rolle, wenn auch zusehends nicht als konkrete Mutter, sondern als Urmutter. Narziß aber verkörpert das Geistige – und das wird nicht geboren, es stirbt auch nicht, es ist ewig, zeitenlos. Narziß ähnelt darin Demian, der ebenfalls seinen Freund Sinclair zu sich selbst führt. Von dessen Gesicht heißt es, es sei irgendwie tausendjährig, irgendwie zeitlos, von anderen Zeitläufen geprägt als wir leben.«
»Das klingt nach Idealisierung und Abstraktion. Das sehe ich bei Narziß nicht, auch wenn es von ihm heißt, er sei vollkommen. Er gehört zwar zu den Auserwählten, leidet jedoch und ist gefährdet, das steht gleich am Anfang und wird dadurch betont. Dass er gefährdet ist, könnte unser Ausgangspunkt sein. Wirklich, hier steht es wieder:
Dieser junge Schüler ist ein wenig gefährdet.«
Sie blätterte kribbelig erregt weiter:
»Hier erneut der Ausdruck Gefahr und dass sich Narziß den Kern seines Lebens nicht berühren lassen dürfe. Ja, was ist denn die Gefahr?«
»Hochmut. Narziß sagt selbst von sich: Es mag wohl sein, daß ich hochmütig bin, gnädiger Vater. Und später: Sein Leben war ein Dienst am Geiste, ihm war sein strenges Leben gewidmet, und nur heimlich, in seinen unbewachtesten Augenblicken, erlaubte er sich den Genuß des Hochmutes, des Besserwissens, Klügerseins. Nein, mochte die Freundschaft mit Goldmund noch so verlockend sein, sie war eine Gefahr, und den Kern seines Lebens durfte er von ihr nicht berühren lassen.«
»Wird dieses Motiv der Gefährdung im zweiten Teil des Romans, ich meine, als vom Abt Narziß die Rede ist, wieder aufgenommen?«
»Teil – teils. Da ist von Kämpfen die Rede: Lesen wir doch einmal: Du solltest mich nicht beneiden, Goldmund. Es gibt keinen Frieden, wie du so meinst. Es gibt den Frieden, gewiß, aber nicht einen, der dauernd in uns wohnt und uns nicht mehr verläßt. Es gibt nur einen Frieden, der immer und immer mit unablässigen Kämpfen erstritten wird und von Tag zu Tag neu erstritten werden muß. Du siehst mich nicht streiten, du kennst weder meine Kämpfe beim Studium, noch kennst du meine Kämpfe in der Betzelle. Es ist gut, daß du sie nicht kennst. Du siehst nur, daß ich weniger als du Launen unterworfen bin, das hältst du für Frieden. Es ist aber Kampf, es ist Kampf und Opfer wie jedes rechte Leben, wie das deine auch.«
»Ja, und inhaltlich? Wogegen, gegen was kämpft denn Narziß. Was oder wer ist der Gegner?«
»Das bleibt offen. Noch mehr, Narziß will es nicht preisgeben. Er sagt ja selbst, es sei gut, dass Goldmund nichts von seinen Kämpfen wisse.«
»So ein Schelm. So müssen wir ihm das Geheimnis entlocken.«
»Schelm? Wenn sich da nicht irgendwelche Dämonen auftun.«
»Lassen wir das mal«, entschied Karla nüchtern. »Ich meine, dass die Gefährdung und die Kämpfe, und Narziß spricht ja selbst davon, dass nur sie ein rechtes Leben ausmachen, das Leitmotiv unseres Romans sein sollten. Gucken wir, was wir im Text zu Narziß’ Kämpfen herauslesen können. Und daraus basteln wir den Roman. Genauer, schreibst du den Roman.«
»Mach mir bloß nicht Angst.«
»Weißt du, was ich unheimlich an Narziß finde«, bemerkte Karla, während sie sich mit Bernd über das Buch beugte, »dass Narziß, dass er ›Gesichte‹ hat, dass er vorhersehen kann, wie jemand stirbt. Darin sieht ja Abt Daniel eine Gefährdung. Ich glaube, daraus lässt sich was machen. Dem Abt Daniel sagt Narziß ja ein schönes, ruhiges Ende voraus, was ist aber, wenn Narziß einen grausamen Tod in einem Gesicht sieht? Wie verhält er sich dann? Kann er ihn abwenden? Er sagt ja von sich: Diese Eigenschaft, ein Gefühl für die Art und – höre! – Bestimmung der Menschen zu haben, zwingt mich, den anderen dadurch zu dienen, daß ich sie beherrsche. Beherrschen klingt nicht sehr sympathisch, klingt nach Manipulation. Aber ich glaube, das meint Narziß nicht. Er meint wohl, sie zu führen, zu sich selbst zu führen. Aber das könnte doch wiederum bedeuten, dass diese Leitung in ein grauenhaftes Sterben führt, weil es das Schicksal des Menschen ist.«
»Es könnte Narziß’ Kampf sein«, schlussfolgerte Bernd, »wie weit er in das Leben eines anderen eingreifen darf. Oder anders: Inwiefern das Schicksal vorherbestimmt ist, Narziß zwar die Gabe besitzt, eben dieses Schicksal vorauszusehen, sich deshalb bemüht, es aufzuhalten, und dennoch die Katastrophe nicht verhindern kann.«
»Damit hätten wir das Problem der Schuld«, stellte Karla fest.
»Ja und nein. Es gibt für Hesse wohl nur diese eine Sünde, nicht man selber zu sein. Lies mal, was er zu Goldmund sagt: Auch wenn du morgen unser ganzes hübsches Kloster niederbrennen würdest, ich würde keinen Augenblick bereuen, dir auf den Weg geholfen zu haben.«
»Das ist irre«, rief Karla begeistert und schlug vor Freude mit der flachen Hand auf den Tisch. »Das müssen wir verwenden.«
»Schon sonderbar«, stimmte Bernd zu. »Besonders da Hermann Hesse selbst als Schüler einmal in den Verdacht geraten ist, in Maulbronn das Pfründhaus in Brand gesteckt zu haben. An seine Eltern schrieb er zwar einen Brief, in dem er ausführlich schildert, wie er die ganze Nacht mit anderen versucht hat, den Brand des großen Hauses zu löschen. Aber als er dann als Vierzehnjähriger so plötzlich nach dem Mittagessen aus Maulbronn davonlief, ohne Mantel, ohne Geld, mitten im Winter, aber mit seinen schweren Schulbüchern, da traute man ihm diese Tat zu. Übrigens hat ein anderer Schüler auf dem Totenbett die Brandlegung gestanden.«
Karla blickte ihrem Zigarettenrauch nach und sagte dann in nachdenklichem Ton: »Ich wollte auch mal fortlaufen.«
Bernd ging darauf nicht ein, nahm das Buch in die Hand.
»Ob wir das verwenden wollen? Sachte. Ich wollte nur andeuten, Narziß wird Abt. Für ihn bedeutet dieses Amt Dienen: Das Ziel ist dies: mich immer dahin zu stellen, wo ich am besten dienen kann, wo meine Art, meine Eigenschaften und Gaben den besten Boden, das größte Wirkungsfeld finden. Es gibt kein anderes Ziel.«
»Da sehe ich durchaus einen Konflikt«, überlegte Karla, ruhiger geworden, obwohl sie von dem Bild des abgefackelten Klosters noch eingenommen war. »Lies mal: Ich will weder den Reichtum des Klosters vermehren noch den Orden reformieren noch die Kirche. Ich will innerhalb des mir Möglichen dem Geist dienen, so wie ich ihn verstehe, nichts anderes. Ist das kein Ziel? Aber Abt zu sein, ist ja nicht nur ein geistliches Amt, sondern ebenso sehr ein politisches, ein wirtschaftliches, ein rechtliches. Viel Land, Rechte und Leibeigene hat so ein Kloster. Es geht tatsächlich um Macht, um Geld, Besitz. Sündenvergebung gab es ohnehin nur gegen Geld. Also wie verträgt sich dies mit dem Dienen am Geist?«
»Gut, halten wir das fest«, sagte Bernd und schrieb auf seinen Notizblock: Zwiespalt, Kampf zwischen Anspruch des Geistes und weltlichen Forderungen.
»Wenn wir diesen Zwiespalt darstellen, müssen wir die Handlung auch zeitlich verorten«, überlegte Karla. »Hesse gibt ja durch die Pest einen Hinweis auf die Zeit um 1348. Und Narziß hat, wie er selbst sagt, einen politischen Auftrag.«
Bernd nickte. »Ja, im vierten Lebenslauf von Josef Knecht hat Hesse historisch genau gearbeitet und die Zeit zwischen 1700 und 1750 in Württemberg zum Leben erweckt. So genau müssen wir es nicht machen, denn Narziß und Goldmund spielt ja sonst allgemein im Spätmittelalter. Aber die politischen Kämpfe, die Narziß auszutragen hat, müssen schon handlungsrelevant sein.«
»Du, ich habe keine Zigaretten mehr. Machen wir mal ’ne Pause und gehen kurz zum Automaten.«
»Weißt du, Bernd«, sagte Karla, als sie wieder in der Küche saßen, »was ich besonders schön und gelungen finde, den Kontrast zwischen dem jungen Narziß, der seine extremen, den Leib abtötenden Exerzitien macht, und Goldmund, der zum ersten Mal mit einer Frau geschlafen hat und nun zu Narziß in die Büßerzelle kommt, um Abschied zu nehmen. Die Nacht brach an, Narziß schloß die Zelle hinter sich und ging zur Kirche hinüber, seine Sandalen klapperten auf den Steinfliesen. Goldmund folgte der hagern Gestalt mit liebendem Blick, bis sie am Ende des Ganges wie ein Schatten verschwand, von der Finsternis der Kirchenpforte eingeschluckt, aufgesogen und eingefordert von Übungen, Pflichten, von Tugenden. O wie wunderlich, wie unendlich seltsam war doch alles! Wie seltsam und erschreckend war auch dies gewesen: mit seinem überströmenden Herzen, mit seiner blühenden Liebesberauschtheit zu seinem Freunde gerade in einer Stunde zu kommen, wo dieser meditierend, von Fasten und Wachen verzehrt, seine Jugend, sein Herz, seine Sinne ans Kreuz schlug und zum Opfer brachte und sich der strengsten Schule des Gehorsams unterzog, um nur dem Geiste zu dienen und ganz zum minister verbi divini zu werden.«
»Sagte ich doch«, bemerkte sie schnippisch, »Narziß hat Sex-Appeal, und zwar nicht nur, weil er auf andere sexuell anziehend wirkt, sondern weil er Jugend, Herz und Sinne besitzt, die er sich mit Gewalt ausmerzt. Ich wette, da gibt es noch mehr Textstellen, die einen liebesfähigen Narziß zeigen.«
»Karla, du willst Narziß doch wohl nicht eine Liebesgeschichte andrehen?«
»Wer weiß. Vielleicht finden wir für ihn eine passende Frau.«
»Narziß ist Mönch und bleibt Mönch – und damit basta.«
»Ja, hier lies mal«, rief sie begeistert. »Da sagt Narziß zu Goldmund: Weißt du nicht, daß einer der kürzesten Wege zum Leben eines Heiligen das Leben eines Wüstlings sein kann?«
Bernd stöhnte, stand auf, ging zum Küchenschrank, öffnete die mit einem Vorhang behangene Glastür, nahm sich ein Glas, ging zum Wasserhahn und füllte es. Währenddessen überlegte er fieberhaft, ob er Karla verraten sollte, was Hesse selbst über Narziß gesagt hatte. Er hörte Hesse geradezu sprechen: Es wäre auch ein Wort über Narziß zu sagen. Unter anderem das: Narziß ist ebenso wenig der reine Geistmensch, wie Goldmund der reine Sinnenmensch.
Er gab sich einen Ruck. Wenn sie wirklich zusammen ein Manuskript Hesses fälschen wollten, dann musste er Karla gegenüber ehrlich sein.
»Eben genau, das meine ich doch, was da Hesse zu seiner Figur sagt. Schließlich zweifelt sogar Goldmund es einmal an, dass Narziß nur ausschließlich Asket, ganz und gar keusch ist. Er greift ihn geradezu an. Hör mal: Hast denn auch du selber noch keine Weihe, hast noch kein Gelübde getan, und doch würdest du dir niemals erlauben, ein Weib anzurühren! Oder täusche ich mich da? Bist du gar nicht so? Bist du gar nicht der, für den ich dich hielt?«
Karla hielt inne und schaute zu Bernd, der mit seinem Glas am Fenster stand und innerlich noch immer rang, denn er ahnte, worauf Karla hinaus wollte.
»Hör doch, Bernd, mir zu. Auf diesen Angriff gibt Narziß nur eine indirekte Antwort. Er sagt, er halte sich an das unausgesprochene Gelübde. Aber ist, sich an ein Gelübde zu halten, dasselbe wie keine Gefühle zu haben, kein Begehren zu kennen? Hesse schreibt ja, dass Narziß Jugend, Herz und Sinne dem Geist zum Opfer bringt. Was erhält er übrigens dafür zurück? Wir Geistigen leben nicht im Vollen, wir leben in der Dürre. Euch gehört die Fülle des Lebens, das schöne Land der Kunst. Eure Heimat ist die Erde, unsere die Idee. Eure Gefahr ist das Ertrinken in der Sinnenwelt, unsere das Ersticken im luftleeren Raum. Selbst wenn Narziß dieses karge Leben bejaht, es akzeptiert, dass Goldmund einen schöneren Lebensweg hat als er selbst, obwohl es auch heißt, dass er Neid empfindet, so hat er, auch wenn er im sicheren Kloster lebt, doch keinen dauerhaften Frieden, sondern täglichen Kampf. Fragt sich nur, ob auch gegen die Sinne. Meinst du tatsächlich, dass Narziß wirklich für ewig und immer seine Sinne durch Exerzitien abtöten kann?«
»Nun ja«, antwortete Bernd und zog die Worte in die Länge. »Irgendwie hat Hesse so etwas vorgeschwebt, jedenfalls in seinem Spätwerk, im Glasperlenspiel. In dieser pädagogischen Provinz ist zwar das Geschlechtliche nicht grundsätzlich verboten, es ist kein Mönchsorden, aber es wird durch Meditation nivelliert, das Triebleben ist meditativ gebändigt. Von Josef Knecht werden die Triebe kurz am Rande erwähnt, sind jedoch nicht handlungsleitend: Also, ich lese dir das mal vor.« Bernd blätterte im Glasperlenspiel:
Und natürlich kannte er das Vorhandensein dieser Welt auch im eigenen Herzen. Auch er hatte Triebe, Phantasien, Gelüste, welche den Gesetzen widersprachen, unter denen er stand, Triebe, deren Zähmung nur allmählich gelang und harte Mühe kostete.
Na, siehst du. Es gelingt allmählich, das heißt, auf Dauer gelingt es ganz. Jedenfalls ist Sinnlichkeit ganz gewiss nicht das Problem und der Kampf Josef Knechts. In der Geschichte des Josef Knecht geht es um das Einordnen und Dienen des Einzelnen in eine sinnvolle Ordnung und es handelt von der Verantwortung dessen, der diese Ordnung aus Gewissensgründen durchbricht.«
»Aber Narziß ist die Vorstufe zu Josef Knecht. Du hast doch vorhin selbst vorgelesen, dass Narziß die Figur Josef Knecht präformiert habe. Das heißt, wir können uns bei Narziß an Josef orientieren. Und wir haben uns doch entschieden, dass Narziß zeitlich kurz vor oder zugleich mit dem Glasperlenspiel geschrieben ist. Das könnte bedeuten, dass Hesse mit Narziß noch eine Zwischenstufe gewählt hat, gerade weil er ihn so außerordentlich sinnlich wahrnehmbar beschreibt. Eine Person, die für den Leser körperlich so präsent ist, kann selbst nicht ganz unsinnlich sein. Ist er ja auch nicht.«
»Du willst also unbedingt eine Liebesgeschichte haben. Ich soll einen verliebten Narziß darstellen?« Bernd schüttelte den Kopf. »Unmöglich.«
»Lassen wir das. Du kannst ja erst einmal anfangen.«
»Karla, mir fällt gerade auf, in Narziß und Goldmund wird eigentlich bis auf die Szene bei der Geliebten des Grafen nie was gegessen. Goldmund bemerkt nur einmal tadelnd, er sei nicht wegen des Essens gekommen. Ganz anders ist es im Steppenwolf, wo einem fast das Wasser im Munde zusammenläuft, wenn Hermine den Haller mit einem Happen Gans füttert. Wollen wir den Sinnen frönen und Essen gehen? Kurz vor Weihnachten müssten wir in einem guten Restaurant einen köstlichen Gänsebraten bekommen. Ich lade dich ein. Wir verspeisen meine Fahrkarte nach Hamburg. Und mit vollem Magen denke ich noch mal über die Sinneslust nach.«
Später dann, nachdem Bernd und Karla in einem mit dunklem Holz getäfelten Restaurant einen vorzüglichen Entenbraten verspeist hatten, der Ober diskret und geradezu unsichtbar und geräuschlos die Teller, Schüsseln und die Sauciere abgeräumt hatte, betrachtete Bernd seine Nachbarin, wie sie ihrem Zigarettenrauch nachblickte.
»Woran denkst du?«, unterbrach er die Stille, als Karla immer noch in sich versunken wirkte.
»Ich wüsste gerne«, flüsterte sie, »ob Hermann Hesse unser Vorhaben billigt und welche Botschaft er für uns Heutige hat.«
»Fragen wir ihn doch selber«, antwortete Bernd leichthin, ohne zu zögern.
Karla schüttelte unwillig den Kopf.
»Ich rede im Ernst. Schon der Demian endet damit, dass Demian, obgleich er tot ist, kommt, wenn Sinclair ihn ruft. Und Narziß gibt Goldmund sein Wort: ›Nie wirst du im Augenblick, wo du mich ernstlich rufst und zu brauchen meinst, mich dir verschlossen finden. Niemals.‹ So geschieht es auch. Als Goldmund gefangen im Kerker des Grafen eine angsterfüllte Nacht vor seiner Hinrichtung verbringt, Narziß nicht gerade ruft, wie sollte er auch ahnen, dass Narziß nicht in seinem Kloster ist, jedoch voller Liebe an ihn denkt, da erscheint Narziß im Morgengrauen und führt ihn zurück ins Leben.«
»Dichtung«, bemerkte Karla skeptisch belehrend.
Am Nachbartisch räusperte sich auffällig ein korpulenter Herr.
Erschrocken sahen sich Bernd und Karla zu ihm um.
»Verzeihen Sie, ich möchte mich nicht in Ihr Gespräch einmischen. Aber bei Hermann Hesse kann ich halt nicht weghören.«
Der fremde Herr rückte seinen Stuhl näher heran und beugte sich zu Bernd und Karla vor. Leise sagte er: »Meine Herrschaften. Keine Sorge. Ich weiß nicht genau, was Sie vorhaben. Es klang etwas geheimnisvoll. Was es auch immer sei, Hesses Antwort darauf lautet gewiss, Sie müssen Ihren eigenen Weg finden, ohne irgendjemanden, und sei es der Dichter selbst, um Erlaubnis zu bitten.«
Er setzte ab und schwieg, nahm dann sein Weinglas, betrachtete es und lobte: »Dies ist ein verlässlicher Rotwein, wie Hermann Hesse ihn geschätzt hätte.«
Er prostete Karla und Bernd zu und blickte sie dabei aufmunternd an.
Auch sie erhoben verdutzt ihr Glas.
»Um Ihnen die Sache zu erleichtern, möchte ich Ihnen Folgendes erzählen. Nach etwas mehr als 20 Jahren, also so um 1953, las Hermann Hesse Narziß und Goldmund zum ersten Mal wieder. Es war ein freundliches und wohltuendes Wiedersehen, und nichts in dem Buche forderte ihn zu Tadel und Reue auf. Nicht dass er mit allem ganz und gar einverstanden gewesen wäre, das Buch hatte natürlich Fehler.«
Hier lächelte der Herr mit einem wissenden Ausdruck: »Und es schien ihm, wie beinah alle seine Schriften beim Wiederlesen nach sehr langer Zeit, ein bisschen zu lang, ein wenig zu gesprächig, es war vielleicht zu oft das Gleiche mit etwas anderen Worten gesagt. Doch der Tonfall dieser Dichtung, ihre Melodie, das Spiel der Hebungen und Senkungen, war ihm nicht entfremdet und schmeckte nicht nach Vergangenheit und abgewelkter Lebensepoche, obwohl Hesse die Leichtigkeit des Flusses nicht mehr aufzubringen fähig gewesen wäre.«
Bernd und Karla atmeten erleichtert auf, insbesondere das Wort ›Fehler‹ trug sehr zu ihrer Ermutigung bei. Und dann ging es doch um Tonfall, um Melodie, es ging um Narziß. Es ging um Narziß, den edlen, den zum Herrscher geborenen, den Einsamen.
»Nun aber, um auf Ihre Frage zurückzukommen, denn deswegen, nur deswegen wollte ich gerne Ihre Bekanntschaft machen. Also die Frage, wie Hermann Hesses Botschaft für die Menschen lautet, ist mit zwei Worten beantwortet:
ßzßKEIN KRIEG!«