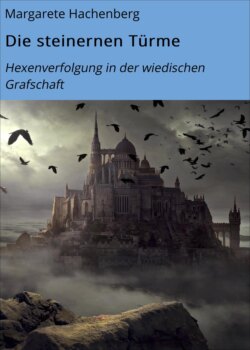Читать книгу Die steinernen Türme - Margarete Hachenberg - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Krieg
ОглавлениеDie Stadtmauer mit ihren Türmen und Toren umschloss die Hütten und Häuser des Städtchens wie die Arme einer Mutter ihr Kind, das sie beschützt. Dick wie die Faust eines starken Mannes hafteten die Steinbrocken mit getrocknetem Lehm aufeinander.
Man munkelte unter den Bewohnern, es seien etwa drei Jahrhunderte vergangen, dass Kaiser Karl IV diesem Ort die Rechte einer Stadt gab. Also machten sich damals beflissene Bauarbeiter ans Werk und knieten in ihren hautengen Beinlingen auf dem harten Lehmboden. In den Händen hielt jeder einen Hammer - 40 oder 50 Handwerker mochten es gewesen sein – die mit all ihrer Kraft und voller Wucht auf die Quarzsteine schlugen. Wer ihnen zuschaute, mochte glauben, die Arme mit den Hämmern drehten sich im Kreis. In jahrzehntelanger Arbeit fügten die Männer Stein auf Stein, lösten Lehm aus dem Boden und tauchten ihn in mit Wasser gefüllte hölzerne Eimer und füllten damit die Lücken in den Steinen.
Manche Hütten bestanden aus Stroh, andere aus Holz in verschiedenen Maserungen. Sie waren klein und standen ohne erkennbare feste Anordnung. Diese Hütten wirkten winzig im Gegensatz zu den massiven Stadttürmen, die jeden Verschlag überragten, nur die Spitze des Kirchturmes erhob sich darüber.
Weiße Wolken türmten sich über Thierdorff am blauen Himmelszelt, Hügel erhoben sich geschmeidig, Büsche und ein paar wenige Bäume spendeten Schatten.
Jede Truppe, die sich der Stadtmauer näherte, sah drei eckige und einen runden Turm aus Quarzsteinen, dazu die Tore und die Torhäuser. Das Untertor war der einzige Rundbau und der höchste Turm der Stadt.
Zwischen dem Ludwigsturm und dem Unterturm befand sich das städtische Rathaus. Gegenüber der reformierten Kirche thronte der Marstall des Grafen, in dem seine Pferde angebunden standen.
Um den rauschenden Holzbach verteilten sich zerbrochener Hausrat, Knochen von Mensch und Tier, Gedärme und Fäkalien und dazwischen wuchs das Gras.
Im Glockengeläut des Mittelturmes, hoch über der Stadt, stand der Türmer, schaute weit hinaus ins Morgengrauen. Seit den Thesen Luthers hatte sich die Kirche gespalten und alles war in hellem Aufruhr. Bereits seit Jahren tobte der Krieg.
Johann Henrici schaute über die kleinen Katen der Stadt, was sich außerhalb der Stadtmauern in der Ferne zeigte. Da lag der Dernbacher Kopf, an dessen Anhöhe der Galgen noch in der Dämmerung lag. Unter der Stelle, auf dem der Türmer thronte und nach Gefahren Ausschau hielt, befand sich im Inneren des eckigen Mittelturmes die Folterkammer.
„Das Auge der Stadt“ nannten die Bürger den Türmer. Johann Henrici schlug entsetzt mit seinem Hammer gegen die Glocke, die sich sofort in Bewegung setzte. Sie schwang nach rechts und nach links und mit ihrem lauten Schall schreckte sie die Bewohner aus ihren Strohstätten.
Wind und Regen peitschten über das Land. Über die sanft geschwungenen Donnerhügel preschte das Heer Tillys mit großem Kriegsgeheul. Ein Gespann von acht Pferden zog eine Kanonenlafette. Die Reiter schwangen ihre Peitschen und trieben ihre Pferde voran. Vom Merzberg her kommend zwischen Meyscheid und Giershoven ritten die Söldner über den Spitzbubenweg in einem Waldstück auf Thierdorff zu. Die Donnerhügel, an denen sie entlang stürmten, schmiegten sich eng aneinander. Viele Truppen ritten bereits über diese Hügel, das zertretene Gras erzählte vom lang anhaltenden Krieg zwischen den Religionen.
Federn schmückten die breitkrempigen Hüte der Söldner und die einstmals weißen Kragen schauten über ihre dunklen Wamse. Sie trugen Pluderhosen, die unter den Knien endeten und darunter braune Reiterstiefel mit breiten Stulpen. Viele der Söldner trugen zerfetzte Kleider, die von ihren Schlachten erzählten.
Die Hufe der Pferde warfen dicke Lehmklumpen hinter sich her, als sie durch das Tor der steinernen Mauer ritten. Doch weder diese Mauer noch die aus Steinen errichteten vier Türme und Tore hielten die anpreschenden Reiter auf. Trotz dicker Baumstämme, die die Bürger vor die Tore gerollt hatten, erstürmte das Heer die Stadt. Das einzige Ansinnen der Soldateska war es, ihren Hunger, ihren Durst zu stillen, denn seit Monaten hatten sie den Sold nicht ausgezahlt bekommen.
Über Tausende von Kilometern waren sie galoppiert, lagerten mal hier, mal dort und dann ging es wieder weiter. Zwischen den Allianzen der Katholiken und der Protestanten tobte der Krieg.
Thönges rieb sich die Augen und richtete sein langes Hemd, in dem er in der Nacht geschlafen hatte. Schnell nahm er sich seine Bauernhose und streifte sie über. Dann zog er sich den Strick über der Hüfte fest, die Kappe auf den Kopf mit den verfilzten Haaren und weckte seine Frau Agathe.
„Weib, haltet Euren Mund. Schon wieder diese Drecksschweine. Macht Euch hinfort von Eurem Lager.“
Gehorsam zog Agathe ihr bodenlanges Kleid an und richtete ihren Rock. Angst um ihren kleinen Ludwig stand ihr in die Augen geschrieben. Sie ging in die Ecke ihrer Hütte und setzte sich schützend neben ihren kleinen Jungen.
Die Truppen des Grafen Anholt und die Spanier unter Spinola, dann die Söldner des Kratz von Scharfenstein hatten bereits in Thierdorff das Quartier am Friedhof bezogen. Gerade erst hatte das Heer Wallensteins seine Zelte abgeschlagen und zog weiter, da meldete der Türmer den nächsten Durchzug der Soldaten an.
„Her mit Vorräten und Geschirr!“ schrie einer der Männer. Zielstrebig verteilten sich Hunderte von Söldnern auf ihren Pferden und auch das Fußvolk um alle Häuser oder das, was von ihnen übriggeblieben war. Die Musketen im Anschlag vor der Brust, mit hoch erhobenen Hellebarden in ihren Händen stürmte das Fußvolk, um Steuern einzuziehen und sich zu holen, was sie brauchten.
„Nein! Wir geben nichts mehr!“ Darauf nahmen die Soldaten keinerlei Rücksicht. Wer nicht freiwillig gab, bezahlte mit seinem Leben. Sie raubten Geschirr, den Hausrat, Herden von Schweinen zogen sie mit sich fort, Korn, Schmuck, einfach alles, was die Not in dieser Zeit linderte. Selbst die Kirche verschonten sie nicht, sie brachen die Fenster heraus und gossen aus dem Blei die todbringenden Kugeln. Die Söldner schlugen die Hütten mit ihren Äxten ein. Das Holz stapelten sie in ihrem Quartier am Friedhof, machten Feuer, kochten und brauten Bier. Die Männer plünderten dort, wo sie nicht aus freien Stücken erhielten und machten sich alles zu Eigen.
Mit ihren brennenden Fackeln zündeten die Soldaten die Dächer an. Dunkelgrauer Rauch stieg in den Himmel auf. Wer nicht durch die Hand der Soldaten starb, den raffte die Pestilenz dahin.
Erstarrt vor Entsetzen stoben die Menschen schreiend auseinander. „Nehmt die Kinder und flieht in den Wald!“ schrie Caspar Kretzer seinem Weib zu. „Versteckt Euch im Dickicht!“ Seine Gedanken jagten. Er führte seine beiden Kühe und die verbliebenen drei Schweine, trieb sie vor sich her und folgte seiner Familie. So machten es dann auch andere Familien. Andere flohen zur eichenen Eingangstüre der Kirche, gingen hinein in die heiligen Hallen und flehten kniend um Hilfe.
„Macht Euch ab in das Erdloch!“ schrie Jacob Meier, denn in den ruhigen Zeiten, in denen das Heer abgezogen war, hatte er ein tiefes Loch in die Erde gegraben zwischen zwei Pfähle für sich und seine Familie. Über dem Loch lagen abgeholzte Baumstämme, Erde und Laub, so dass man es von oben nicht sofort entdecken konnte.
„Herrgott, sei uns gnädig. Der Teufel lebt mitten unter uns! Befreie mich und die Meinen aus der Knechtschaft dieses verheerenden Krieges!“ Tränen rannen über die Wangen Irmels, die zitternd betete. Das Dach ihres Hauses brannte lichterloh und Rauch stieg in die Luft. Die Söldner hatten den hölzernen Zaun mit ihren Beilen in Stücke geschlagen. Bestürzt suchte Irmel das Weite.
Friedrich Kaulbach wiederum, der in dem prächtigen Patrizierhaus mit den vielen dunklen Balken rechts neben dem Mittelturm lebte, versteckte sich gleich nach dem Glockenläuten im Gewölbe seines Kellers.
Seine Wohnstube sah sehr schön und reich eingerichtet aus. So war die Decke mit Holz getäfelt, dicke Querbalken hielten die dünnen Bretter, die in Zweierreihen angeordnet waren. In goldenen Rahmen steckten Bilder edler Frauen und zierten den Rand unter der Decke. Ein sechseckiger Spiegel mit einem runden Aufhänger hing an einem Nagel. Drei genietete, mit Leder bezogene Stühle reihten sich nebeneinander. Daneben standen einige geschnitzte Holzfiguren auf einem schmal geschwungenen Sims und gleich nebenan zwei kleine Schränkchen. An der Wand am Ende der Stube gliederte sich ein großes Fenster in vier kleine Quadrate, von kleinen metallenen Dreiecken und Streben durchzogen. Eine lange Kommode stand an der anderen Wand, die durch Pfeilornamente in jeder Ecke sehr edel aussah.
Er war unter den vielen Bauern hier in Thierdorff der einzige Kaufmann, der sehr gut lebte. Mit seinem Kuhkarren fuhr er sogar bis Coblentz, verkaufte das Vieh auf dem Markt. Sein Geschäft lief gut, so lange er auch das Heer Soldaten bediente und von seinen Tieren und etwas von seinen Einnahmen abgab. Ständig kaufte und verkaufte er Hühner, Gänse, Schweine, Pferde und Kühe. Ihm ging es auch in diesen Kriegszeiten gut.
Im Gewölbe seines Kellers hatte Friedrich sein Vieh untergebracht und versorgte es. So bekam niemand mit, auch die Söldner nicht, welchen Bestand er tatsächlich besaß. Außerdem fühlte er sich in dem kalten Gewölbe seines Kellers sehr sicher. Die Wände waren so dick, dass ihnen das Pulver aus den Musketen nichts anhaben konnte. Nur eine Kanone konnte es zerstören. „Gott bewahre, dass mir das geschieht!“ flüsterte er. Ein dicker Balken innen verschloss die breite Holztüre zu seinem Haus.
Einer der Söldner schwenkte eine Fahne, andere schossen auf die Leute in und außerhalb ihrer Hütten. Niemand war vor ihnen sicher. Die Soldaten auf ihren Pferden hetzten den in den Wald fliehenden Menschen hinterher. Sie schwangen ihre Hellebarden und nahmen auf das Leben der Menschen keine Rücksicht. Die Soldaten schnappten sich Mädchen und Frauen, auch die hochschwangeren, zerrten sie mit sich, banden sie an der Sattelnase fest und bedienten sich an ihnen.
Es regnete in Strömen, die Höhe des Wassers auf den lehmigen Pfaden stieg. Das stetige Rauschen der Fluten wurde lauter. Die Ölmühle zerbarst, Menschen und Kühe ertranken. Schreie wie Schüsse hallten durch das Städtchen, Steine flogen aus den Händen der Thierdorffer gegen die Soldaten. Auch Granaten fielen und fanden ihre Ziele. „Macht Euch hier weg, Ihr Dreckspack! Wir werden es Euch zeigen!“ schrien die aufgebrachten Leute, während die Soldaten ihr Leben ließen. „Der Teufel soll Euch holen!“
„Weib, pack Eier, Speck und Gemüse in Eure Schürze und bring das dem Kriegsvolk. Nur so bleiben wir vielleicht verschont.“ Das war Thönges, der mit seiner Frau sprach und an seinen kleinen Sohn dachte.
Bettbezüge stahlen sich die Soldaten von der Bleiche, schüttelten sie aus und packten dort alles hinein, was sie in der Nachbarschaft plündern konnten.
Zaghaft, Angst stand in ihren Augen, ging Agathe langsam nach draußen. Ludwig weinte, denn vom Lärm der Soldaten war er wach geworden. Agathe schaute noch einmal zurück auf ihren kleinen Sohn. Sie wagte es nicht, ihn mitzunehmen.
„Allmächtiger! Wann findet dieses Gemetzel endlich ein Ende. Herr, erbarme dich unserer kleinen Familie!“ Zitternd stolperte Agathe durch die Gassen, die übersät war mit Toten, die im Krieg ihr Leben gelassen hatten. Krumm, mit weit aufgerissenen Augen, aus denen noch die Fassungslosigkeit sprach, drangen die Därme aus den offenen Bäuchen, die Köpfe lagen hier, die Körper dort. Der Regen bildete Rinnsale, die sich mit dem Blut mischten und zu Bächen heranwuchsen, die die Fäkalien aus den Häusern wegschwemmten in den Holzbach, dessen Rauschen durch das Donnern der Kanonen und der Musketen gar nicht mehr zu hören war. Agathe kämpfte sich durch das Gewühl. Zitternd hielt sie, am Ziel angekommen, ihre Schürze vor einen der Männer, der sofort danach griff.
„Schon lange keine Frau mehr in den Händen gehabt:“ Ein lautes Rülpsen entfuhr seiner Kehle, seine Hände streckten sich Agathe entgegen. Angewidert lief Agathe zurück zu ihrer Kate. Bisher blieb das Holzhaus mit dem angrenzenden Stall verschont so wie auch sie selbst. Die Soldaten zogen von ihrer Hütte ab.
„Der Teufel tut sein Werk, es ist abscheulich!“ Lieschens Hände griffen den Rock des knöchellangen Kleides, schreiend rannte sie dem nahen Wald entgegen. „Herrgott, sei mir gnädig“, winselte sie, Tränen perlten an ihren Wangen herunter. Schnell versteckte sie sich im dichten Gestrüpp. Agathe sah ihr nach.
„Genau wie die vorherigen Armeen wird auch dieses Heer hier sicher Quartier beziehen. Das dauert, bis sie abziehen. Was sollen wir bloß machen?“ fragte Gertrude ihren Mann Hinrich. Die Frau war abgemagert, schon lange hatten weder sie noch ihr Mann Gemüsebrei oder ein winziges Stück Fleisch, auch kein Stück Brot gegessen. „In mein Haus will ich nicht mehr zurück.“ Sie schlug ihre Hände vor das Gesicht. Agnes beobachtete die beiden und schüttelte ihren Kopf.
„Alles haben uns die Soldaten genommen!“ Heinrich Abresch konnte das alles gar nicht fassen. Sein Haus lag in Trümmern. Mit Hilfe seiner Nachbarn und begrenzten Mitteln wollte er sich eine Hütte aus Stroh aufbauen.
Zerstörerisch war dieser Krieg, der kein Ende nahm. Verzweifelt waren die Bürger dieser kleinen Stadt. Der kleine Ludwig spielte in einer Ecke mit bunten Murmeln. Der Junge lachte, seine blauen Augen strahlten. „Mama!“ stammelte er und kam auf Agathe zugelaufen und legte seine Ärmchen um das knöchellange Kleid mit Schürze. Agathe beugte sich mit ihrer weißen Haube auf dem Kopf herunter zu Ludwig, ihre Augen leuchteten und der Kleine zauberte ihr ein Lächeln ins Gesicht, als sie ihn in den Arm nahm. Für einen kurzen Moment vergaß sie den Krieg.
Agathe hob ihren Kopf und schaute zu ihrem Mann. „Thönges, schon wieder ein Überfall von Soldaten. Ich habe Angst. Was sollen wir bloß machen?“ Als ältester Sohn hatte Thönges den Hof seines Vaters übernommen. „Was haben wir nur falsch gemacht? Ihre Worte kamen sehr zaghaft über die Lippen.
„Verdammt Weib, lasst Euer Jammern!“ sagte Thönges unwirsch. Wir müssen an Ludwig denken, Euer Klagen nutzt nichts. Gott wird uns nur dann helfen, wenn wir uns selbst helfen. Also reiß dich zusammen!“ Thönges war mehr als doppelt so alt wie Agathe, die gerade einmal siebzehn Jahre alt war.
Das Hemd unter seinem Wams hatte Löcher, es war an vielen Stellen zerfetzt, die Ärmel hochgekrempelt. Seine dunklen Haare waren struppig und seine Kopfhaut juckte. Er kratzte sich.
Mit diesem verheerenden Krieg und den ständig durchziehenden Armeen begann eine schreckliche Zeit. Korn wie Kraut und die Früchte der Bäume schleppten die Soldaten in ihr Lager. Abgemagert waren sie selbst nach all den Jahren des Hungers und der Not, noch ärger sah es bei den Thierdorffern aus. Sie stoben auseinander und suchten sich allesamt bei diesem Wüten der Söldner ein Versteck für ganze Familien und ihr Vieh, das ihnen noch geblieben war.
Ein quadratischer Bau erstreckte sich mit vielen kleinen Fenstern, Türme mit einem spitz zulaufenden Dach standen an jeder Ecke. Erhaben thronte die Burg auf der kleinen Insel des Weihers. Neben der Burg stand die Hofkapelle, die zur Kirche des Ortes gehörte. Stolz zeigten die Pfauen dort in einem schön angelegten Garten ihr buntes Gefieder und es wuchsen allerlei bunte Blumen. Hier lebte der Graf zu Wied mit seiner Frau Juliane Elisabeth und seinen 14 Kindern.
Seine Ritter überwachten genau das Treiben hinter den Mauern der Stadt. Alle hofften, dass das Wasser des kleinen Sees das Eindringen in die Burg unmöglich machte. Dazu hätte ein Wallgraben und eine Mauer noch zusätzlich überwunden werden müssen, zudem für die Nacht eine Zugbrücke hochgezogen und die Tore fanden Schutz durch ein Fallgitter. Danach erst folgte die Vorburg mit den Vorräten an Wasser und Nahrungsmitteln, die Ställe für die Ziegen und die Hühner. Außerdem gab es den Bergfried, in den die Bewohner der Burg flüchteten, sollte es Angriffe geben. Im Palast befanden sich der Rittersaal und das Zimmer für die Frauen. Leise Musik klang heraus wie auch Kinderlachen. Es war der Wohnbereich des Grafen Hermann II. Gleich daneben tagten die Grafen.
„Erbarme dich, Gütiger!“ Kopfschüttelnd stampfte Graf Hermann II durch sein Gemach. Am hölzernen Tisch saßen die Grafen von Sayn und Westerburg. „Ständige Erpressungen, Plünderungen, Belagerungen – es geht nicht mehr!“ Bei jedem Schritt knarrten die Bretter auf dem Boden. Humpen aus Zinn, gefüllt mit Bier, standen vor den hohen Herren mit den lockigen Perücken und den Schnallenschuhen.
Vornehm sahen die Herren aus. Über einem weißen Hemd mit einem großen, den Hals umschließenden Spitzenkragen trugen die Grafen ein enganliegendes Wams mit Ärmeln. Ein Rock mit glitzernden Streifen und Mustern umschloss die Beine.
Diese Burg lag etwas entfernt von der lehmigen Straße , die auf der rechten Seite nach Coblentz führte und links nach Altenkirchen. Hier rumpelten ratternd, wenn Markttag war, die Karren mit den vorgespannten Kühen in beide Richtungen. Kaufleute, Bauern und Handwerker machten sich früh morgens auf den Weg, um ihre Waren zu verkaufen. An manchen Tagen waren die Gassen unbefahrbar, immer dann, wenn es in Strömen geregnet hatte. Durch diese Wolkenbrüche bildeten sich Rillen im Boden. Da rumpelten Fuhrwerke daher mit Gewürzen, Zitronen und Apfelsinen, mit Johannisbrot und Zimt, Baumwolle, Pfeffersäcken und Muskat, Safran, Rosinen, Ingwer, Papier zum Schreiben, die schönsten Stoffe hatten sie geladen und noch vieles mehr. Diese Dinge blieben verdeckt unter einer Plane.
Jeder einzelne Raum in dieser Burg glich einer Halle. Die Bibliothek, in der die Grafen ihr Gespräch führten, war mit Pechfackeln an der Wand hell erleuchtet.
Im Erdgeschoss gab es eine riesige Küche und sogar ein Zimmer, in dem gebacken wurde. Die angereisten Grafen würden wohl in den Kammern nebenan übernachten und morgen in den Wäldern jagen.
Knechte huschten über den Hof, eilten von den Wirtschaftsgebäuden direkt zur Küche, sie holten Fleisch, Kräuter und andere Lebensmittel. Am Brunnen schöpften sie Wasser in Zinneimern und schleppten Holz zum Heizen der Kochstelle. Die Grafen wollten bewirtet werden.
Die Notlage der kleinen Stadt, die sehr gelitten hatte, wollten die Grafen miteinander besprechen und versuchten, eine Lösung zu finden, die Soldaten zur Ruhe zu bringen.
„Wir müssen weitere Übergriffe und Einfälle auf jeden Fall verhindern. Ich habe sehr viele Pferde an diese Armeen verloren und habe kaum noch Schweine. Die letzte Kuh aus dem Stall hat sich die Horde auch noch genommen. Es ist ein Jammer!“ sagte Hermann II zu seinen Gästen.
„In unserem Hoheitsgebiet haben die Häuser keine Dächer, keine Türen und keine Tore mehr. Alles wurde eingeschlagen oder in Brand gesetzt!“ Es war der Graf von Sayn, der seine Lage schilderte. Aus seinem Humpen nahm er einen großen Schluck und ließ den Krug polternd auf den Tisch fallen. „Da habt Ihr es gut, Eure Burg ist noch unbeschädigt.“
„Diese Bande hat die Glocken aus dem Kirchturm gestohlen und das Gebäude so beschädigt, dass es repariert werden muss, sonst kann Dionysius Franzius, unser Pfarrer, keinen Gottesdienst an Weihnachten halten. Um das zu bezahlen, muss ich mir Geld leihen. „Thierdorff hatte im vergangenen Jahr nur 100 Gulden Einnahmen.“ Es war Graf Hermann, der jetzt redete.
„Bei uns ist es dasselbe Übel. Dieses Kriegsvolk hat unser Korn von den Äckern gemäht, alles, was unsere Bauern aussäten, verfütterte die Horde an ihre Pferde. Wir haben nur noch zwei Pferde, zwei Kühe und ein paar Hühner in der ganzen Stadt. Nichts ist uns geblieben.“ Das Elend stand dem Grafen von Westerburg ins Gesicht geschrieben. Auf seiner Stirn bildeten sich Sorgenfalten.
„Alles wird teurer, unsere Scheunen und die Ställe sind ausgeräumt. Was können wir machen, damit die Soldaten mit den Erpressungen und Plünderungen aufhören?“ Die Gedanken des Grafen zu Wied quälten ihn und er war froh, gerade jetzt nicht alleine zu sein.
„Die Auswüchse des Elends nehmen überhand und es wird immer ärger! Die Leute verkaufen das, was ihnen noch geblieben ist.“ Der Graf von Sayn schlug aufgeregt mit seiner Hand auf den Eichentisch.
Die Zustände, die im Moment in der unteren Grafschaft Wied herrschten, müssen irgendwie abgewendet werden. Die Frage, die sich dazu stellte: Wie? Wie schaffen wir das?
Graf Hermann II genoss bereits als kleiner Junge eine wissenschaftliche Ausbildung, für die er mit vier Jahren sein Elternhaus verlassen musste. Auf das, was jetzt in den letzten Jahren geschehen war, war er nicht vorbereitet. Hätte er doch bloß genügend Geld, würde er es dem Heer zur Verfügung stellen, aber genau daran mangelte es ihm. Alles hatten sich die Soldaten bereits genommen und Unmengen an Geldsummen erpressten sie. Woher sollte er die geforderte Summe denn nur nehmen?
Tag und Nacht hatte er darüber nachgedacht, doch Gott wollte ihm keinen einzigen klaren Gedanken schicken.
„Die Bürger unserer Städte müssen uns Steuern zahlen. Etwas ist da sicher noch zu holen und wie wäre es, wenn sich auch Euer Bruder aus Runckel daran beteiligt, Geld aufzutreiben, um die Soldaten mit dem Geld von den Angriffen abzuhalten?“ Hoffnung schöpfend sprach der Graf von Westerburg.
„Glaubt Ihr denn, dass dann die Soldaten wirklich Ruhe geben und nicht noch mehr Geld verlangen?“ Es war Graf Hermann II, der seine Zweifel äußerte.
„Wir werden sehen. Uns bleibt nichts anderes übrig, als es darauf ankommen zu lassen. Je mehr Leute wir sind, desto mehr Geld bringen wir letztendlich zusammen.“ Das war der Graf von Sayn.
Die Bediensteten des Grafen brachten geschmorten Truthahn auf silbernen Schalen, tischten das zusammen mit Eiern und Senf auf, dazu gab es dann Äpfel und Nüsse.
„Lasst Euch das munden, gnädige Herren.“ Graf Hermann II forderte seine ebenbürtigen Gäste auf zu speisen. Sollte da etwas übrig bleiben, würden seine Knechte das unter den Thierdorffern verteilen.
Die Kirche Sankt Jacobus bestand ebenso wie die Stadtmauer aus verschieden dicken Steinen und einem Glockenturm. Das Dach glich einem schiefgelegten Viereck, mit Schiefertafeln bedeckt. Agathe war gemeinsam mit Thönges und dem zweijährigen Ludwig auf dem Weg zum Gottesdienst. Es war Sonntag.
Angst und Schrecken breiteten sich aus, denn dieser Krieg nahm kein Ende, die Pestilenz raffte Mensch wie Vieh dahin und dann noch diese frostige Kälte, die kein Korn und keine Frucht gedeihen ließ. Elend und Not, vor allem der Hunger ließ die Bürger verzweifeln. Es war Mai und die Blätter der Bäume schwarz vom Frost.
Blitze jagten über den mit aufgetürmten Wolken übersäten Himmel und es regnete in Strömen. Das Wasser stand hoch im Weizen der Felder. Dieses Unwetter dauerte Wochen an, das Korn zerfiel, Schweine, Rinder und Schafe ertranken in den Fluten.
Gleich würde der Gottesdienst beginnen. Agathes Blick streifte den Turm mit den zwei nebeneinanderliegenden Bögen in den Giebeln. Der Klang der Glocken, der von dieser Stelle kam, lud die Thierdorffer zur Messe ein.
Im Inneren der Kirche gab es ein Langhaus mit einem viereckigen Chor. Kalt war es innerhalb der Mauern, Agathe zog ihr grob gewebtes Tuch fester um ihre Schultern. Eine weiße Haube bedeckte ihren Kopf. Ihr Leinenkleid war dunkel mit weißem Kragen und Armaufschlägen. Sie zitterte. Ludwig quengelte: „Mama, Arm.“
Agathe bückte sich zu ihrem Sohn und nahm ihn auf den Arm. „Sei ganz ruhig. Mama ist ja bei dir“, flüsterte sie. Zärtlich legte sie seine Wange an die ihre. Kleine Locken um seine Stirn kitzelten ihre helle Haut. Ein Lachen zeigte sich in ihrem Gesicht und ihre Augen funkelten vor Freude. Wie sein Vater trug auch der Junge eine dunkle Kniebundhose und ein weißes Wams.
Der Priester betrat den Raum. Die Kirche hatte sich gefüllt, auch andere aus Thierdorff hatten sich eingefunden. Der Mühlsteinkragen fiel über die Schultern des bodenlangen Gewandes des Geistlichen, der nun seine Predigt eröffnete.
„Ich freue mich, dass sich so viele hier eingefunden haben.“ Bei den nächsten Worten erstarrte Agathe.
„Eure Mütter, Schwestern, Tanten und Eure Cousinen, Eure Weiber, keinem könnt Ihr mehr trauen. Sie alle sind so leicht zu beeinflussen. Schaut ganz genau auf das, was sie tun, achtet auf alle Schritte, auf jede Handlung. Ich versichere Euch hier vor dem Kreuze unseres Herrn, dass sich jedes Weib mit dem Teufel verbündet und sich von Gott abwendet. Glaubt Ihr, Gott hätte dieses Elend auf dieser Erde gewollt? Nichts mehr ist in Ordnung. Wir alle leiden Hunger, wir werden ausgeplündert, die Soldaten nehmen uns alles weg. Dann ist da noch die Beulenkrankheit und viele Menschen, aber nicht nur die, auch unser Vieh stirbt daran, dann diese bittere Kälte mit Wolkenbrüchen, Graupel- und Hagelschauer sowie der Sturm. Das können nur die Weiber getan haben, die mit dem Teufel buhlen. Sie schließen einen Bund mit ihm und kommen so in die Lage, Schadenszauber zu begehen.“ Die Stimme erhob sich derart gewaltig, dass die Männer entsetzt lauschten und die Weiber vor Scham erstarrten.
Nun war es nicht nur die Kälte draußen und innerhalb dieser Mauern, sondern es waren die schrecklichen Worte des Dionysius Franzius, der mit tiefster Überzeugung gesprochen hatte. Agathe schaute sich um und sie sah das Entsetzen in den Augen vieler hier stehender Frauen.
„Achtet darauf, wer von den Weibern einen schlechten Ruf hat. Wartet auf keinen Fall länger und zeigt sie alle an! Diese Weiber müssen vom Teufel befreit und ihre Seelen rein werden! Unsere Weiber sind voller List, sie sind rachsüchtig und sie sind gierig und jähzornig und welcher Mann will das schon?“
Thönges Augen wanderten zu Agathe hinüber, die neben ihm stand. Sie war noch ein Mädchen, fast noch ein Kind. Traf das, was der Priester da redete, wirklich auf sie zu? Ob auch Agathe den Teufel schon gesehen, ihn vielleicht schon getroffen und mit ihm gebuhlt hatte? Wo mag sie sich mit ihm getroffen haben? Ludwig ahnte davon nichts.
Wind war aufgezogen, die Wolkendecke grau verhangen, als die kleine Familie die Kirche wieder verließ. Die Gassen waren kaum zu erkennen, dicker Hagel fiel auf den Lehm. Ein Unwetter war aufgekommen. Agathe zog sich das Tuch über den Kopf und die Familie eilte der Hütte entgegen.
Der vergangene Winter hatte sich mit unerbittlichem Frost gezeigt und eisiger Kälte, das Frühjahr hielt Einzug mit Hagel und Frost. Es war so kalt, dass die Saat, die Thönges ausgestreut hatte, nicht aufgehen würde. Auch im Garten würde es dieses Jahr kein Gemüse geben, auf dem Acker weder Hafer noch Weizen und auch Obst würde nicht an den Bäumen gedeihen. In dieser Zeit war sich jeder selbst der Nächste.
„Gott straft uns mit Plagen, mit dem Unwetter und dem Krieg, Agathe.“ Thönges hatte mit seiner tiefen Stimme das Wort ergriffen. „Ein Unglück jagt das nächste.“
„Was haben wir denn verbrochen?“ Agathes Stimme brach, sie hielt ihre Tränen zurück.
„Ihr hört ja, was der Priester von der Kanzel predigt. „Habt Ihr auch schon den Teufel gesehen und mit ihm gesprochen?“
„Nein, Thönges. Wo denkt Ihr hin?“ Agathe konnte nicht glauben, dass Thönges so etwas von ihr dachte. „Ich liebe Euch.“ Sie stellte sich auf ihre Zehen, umarmte ihren Mann und küsste ihn.
„Mama, Hunger!“ Ludwig, der kleine Blondschopf, packte mit seiner kleinen Hand an die Wange seiner Mutter und erinnerte sie sanft an ihre Pflichten. Agathe lachte herzlich, sie liebte ihren Sohn. Sie setzte Ludwig wieder in seine Ecke, in der er eben noch gespielt hatte und ging in den Garten. Der strömende Regen durchnässte in nur wenigen Augenblicken ihr Kleid. Mit beiden Händen hob sie die nasse Erde zur Seite. An dieser Stelle hatte sie im vergangenen Jahr den Boden mit Holz ausgelegt und sich da einen Vorrat an Korn, Erbsen und Pilzen angelegt. Das holte sie sich, denn sie hatten Hunger. Das Korn legte Agathe in eine Schale aus Holz, stellte sie neben sich und füllte dann eine andere Schale mit den Erbsen.
Das Jahr zuvor hatte eine sehr reiche Ernte gebracht. Nach langer Zeit hatte es warme und auch heiße Zeiten gegeben, die sich mit dem Regen abgewechselt hatten. Das war ein Segen des Herrn. Hafer wie auch Weizen wuchsen dicht an dicht auf ihrem Acker. Um ihn zu pflügen, spannte sich Thönges selbst vor den Pflug, denn die Soldaten hatten sein einziges Pferd gestohlen.
Birnen und auch Äpfel, sogar Pflaumen erntete Thönges im Herbst und der Garten brachte einige Leinensäckchen voller Erbsen. All das reichte, um die Soldaten, die am Friedhof ihr Lager aufgeschlagen hatten, für einige Zeit zu versorgen und auch auf dem Markt konnten sie verkaufen. Alles andere vergrub Agathe im Garten.
Im vorigen Jahr, daran erinnerte sich Agathe, neigte sich der Sommer so langsam seinem Ende zu, als sie in den Wald ging, um Pilze zu suchen. Wann immer es ihre Zeit zuließ und es in diesen Kriegszeiten möglich war, machte sie sich auf die Suche nach essbaren Pilzen.
Schon als kleines Mädchen hatte sie die Großmutter an der Hand mitgenommen und so lernte Agathe auf diese Weise recht schnell, die guten Pilze von den giftigen zu unterscheiden. Alle Pilze sprossen aus dem mit Nadeln oder Laub bedeckten Boden. Regen und Sonne mussten sich zu gleichen Teilen abwechseln, sonst brauchte sie im Wald gar nicht zu suchen.
„Das hier sind Pfifferlinge“, richtete die Großmutter das Wort an Agathe. „Seht Ihr hier die schmalen Lamellen, die am Stiel herunterlaufen? Die Pfifferlinge selbst leuchten orange, der Hut nach innen zum Stiel gewölbt. Daran erkennt Ihr sie. Schaut Ihr ganz genau hin, seht Ihr sie an dieser markanten Farbe.“ Diese Pilze wuchsen im Laubwald.
„Das hier, Agathe, sind Champignons. Bei denen müsst Ihr ganz genau hinschauen, denn sie sehen von oben ganz genauso aus wie die Knollenblätterpilze. Nur wenn Ihr unter den Hut schaut, erkennt Ihr den Unterschied. Während die Knollenblätterpilze einen weißen Hut und weiße Lamellen haben, sind die Lamellen junger Champignons rosa und die der großen braun. Hier seht Ihr es.“ Die Großmutter hielt in jeder Hand einen Pilz, beide mit den Stielen in der Hand, so dass Agathe die Unterseite betrachten konnte.
Dann gab es noch die Habichtpilze mit den großen weißen Schirmen und Agathe staunte damals nicht schlecht. Auf diesen Schirmen waren braune Muster, die dem Gefieder eines Habichts ähnelten. „Den Stiel davon dürft Ihr nicht essen. Den Hut zieht Ihr durch ein verquirltes Ei und dann durch Mehl. Das schmeckt köstlich, wenn Ihr das in einem Topf bratet. Dieser Pilz ersetzt ein Stück Fleisch.“
An einer anderen Stelle wieder fand Agathe mit ihrer Großmutter Maronen und Steinpilze, beides Pilze mit braunen Hüten und gelben Schwämmen. Der Fuß des Steinpilzes sah sehr interessant aus. Er verbreiterte sich nach unten und sah aus wie ein zu klein geratener Baumstamm. „Das Gegenstück dazu“, erklärte die Großmutter, „ist der Gallenröhrling. Während der Steinpilz einen gelblichen oder olivgrünen Schwamm auf der Unterseite hat, ist der bei dem Gallenröhrling rötlich. Lasst die Finger von diesem Pilz, er ist bitter wie Galle.“
Langsam, immer noch in Gedanken, ging Agathe zurück in die Küche. Sie entfachte ein Feuer auf der Brandstelle in der Mitte der Küche, über der ein großer Topf an einer eisernen Kette baumelte. Da hinein gab Agathe etwas Wasser, Salz und die Erbsen. Nun zu dem Mehl dachte Agathe und schritt zu einem dunklen Regal. Sie holte sich zwei Reibsteine von einem Regal aus Holz. Müde rieb sie sich die Augen und setzte sich auf einen Schemel an dem großen Holztisch vor der Feuerstelle. Das Korn hatte sie bereits auf dem Tisch liegen. Sie nahm die Steine und drückte damit das Korn entzwei und rieb die Steine über das Korn, bis es zu Mehl wurde. Mit ihrer Hand stäubte sie dann das Mehl in eine hölzerne Schale, gab Wasser dazu und knetete es zu einem festen Teig. Der kam dann ins Feuer. Das Brot würden sie zu dem Erbsenbrei essen. Solch eine Mahlzeit gab es jeden Tag. Nur an Ostern und Weihnachten aß die kleine Familie Fleisch dazu.