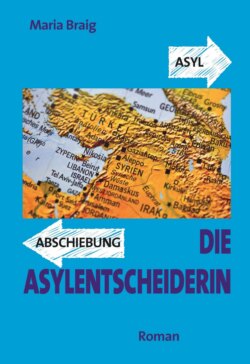Читать книгу Die Asylentscheiderin - Maria Braig - Страница 6
2.
ОглавлениеEs hatte einen Unfall auf der Autobahn gegeben und ich war zu lange im Stau gestanden. Die Zeit reichte gerade noch zum Einchecken im Hotel, dann musste ich los. Ich griff mir die vorbereitete Tasche mit Schreibzeug, Lesebrille und allem was ich an diesem ersten Tag möglicherweise brauchen würde, und rannte los. Die Frage nach dem passenden Outfit hatte sich damit von selbst erledigt. Vor dem Schulungsraum traf ich auf zwei weitere Nachzüglerinnen und als wir die Tür hinter uns schlossen, stellten wir fest, dass alle Plätze außer dreien belegt waren. Wir waren also die Letzten – kein wirklich guter Einstand, dachte ich bei mir, aber der Kursleiter nahm es gelassen. „Kein Montagmorgen ohne Stau, darauf müssen Sie sich einstellen. Aber vom Hotel aus haben Sie das Problem ja in den nächsten Tagen erst mal nicht.“
Fünfundzwanzig Frauen und Männer, mehr Frauen als Männer, saßen in einem sterilen Schulungsraum dem Kursleiter gegenüber, gespannt darauf, was sie hier erwartete. Alle waren schon lange dem Schulalter entwachsen, die meisten zwischen 40 und 50 Jahre alt, ein paar wenige Ausreißer nach oben und unten.
Thermoskannen mit Tee und Kaffee auf den Tischen verteilt, Säfte, Wasser, Cola, Tassen, Gläser und Kekse und auf jedem Platz ein Schreibblock und ein Kugelschreiber. Das Übliche. In jeder Schulung, die ich erlebt hatte, war es so gewesen.
Der Kursleiter verteilte Namensschilder, die wir vor uns aufstellen sollten, und zusätzlich noch welche zum Anstecken.
„Für die Pause und die ersten Abende an der Bar“, lachte er.
Wer den Aufsteller in Empfang nahm, stellte sich kurz vor. Ein paar Worte zum Privatleben und ein kurzer Bericht zum bisherigen beruflichen Werdegang.
Die meisten waren Beamte aus verschiedenen Behörden. Auch dort hatte man dringend um Verstärkung geworben, um schneller Entscheidungen treffen zu können. Einige Postkollegen befanden sich unter den Anwesenden, die ebenso wie ich ihre ursprünglichen Aufgaben verloren hatten und nun nach neuen Möglichkeiten suchten. Einige wenige waren direkt nach einem Verwaltungsstudium hierhergekommen und noch ganz neu im Arbeitsleben. Sie waren es, die den Altersdurchschnitt stark nach unten senkten. Man sah ihnen an, dass sie sich in unserem Seniorenclub etwas fehl am Platz fühlten.
Nach der Vorstellungsrunde war schon Zeit für die Mittagspause.
Am Nachmittag hielt der Kursleiter auf einem Flipchart unsere Gründe fest, warum wir uns für den Kurs beworben hatten, in einer zweiten Runde unsere Erwartungen an den Einsatz als Entscheider. Im Anschluss bekamen alle einen noch ziemlich leeren Ordner mit dem Schulungsplan für die nächsten vier Wochen – dann waren wir für heute entlassen mit dem Auftrag, uns ein wenig kennenzulernen und uns mit den Freizeitmöglichkeiten des Hotels und der Umgebung vertraut zu machen.
Beim gemeinsamen Abendessen hatten sich bereits die ersten Grüppchen gefunden. Als ich mich nach einem gemütlichen Abschluss des Tages an der Hotelbar in mein Zimmer zurückzog, hatte ich das Gefühl, dass wir eine gute Truppe waren. Ich hatte mich richtig entschieden, da war ich mir jetzt endgültig sicher. Die letzten Zweifel, die ich während der letzten Monate zwar verdrängt hatte, die aber doch immer noch da gewesen waren, hatten sich im Lauf des Abends in Luft aufgelöst. Wir würden gemeinsam lernen, um danach an den uns jeweils zugeteilten Stellen unseren gemeinsamen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Wir würden den Ärmsten der Armen ermöglichen, in unserem Land Schutz, Sicherheit und eine Zukunft zu finden, die man ihnen zu Hause genommen hatte.
Ich war stolz auf mich und schlief mit einem großartigen Gefühl für meine eigene Zukunft ein. In meinen Träumen sah ich viele glückliche Menschen. Weiße, braune, schwarze Gesichter. Frauen, Männer, Kinder, Alte und Junge, die mir dankbar waren für die Hilfe, die ich ihnen bot.
Zwischen all diesen Menschen, die sich bei mir bedanken wollten, sah ich plötzlich Cochise, die mir zuwinkte. Sie schien mir etwas mitteilen zu wollen und ich wollte zu ihr hin, versuchte mich durch die Menschenmenge zu drängen, aber da war sie schon wieder verschwunden.
Ich wachte auf, versuchte die Fäden des Traumes zu fassen, wollte weiterträumen und herausfinden, was Cochise von mir gewollt hatte. Ihr Auftauchen hinterließ ein beunruhigendes Gefühl in mir, aber ich fand nicht mehr zurück, verlor die letzten Fäden und fiel schon gleich wieder in einen dieses Mal traumlosen Schlaf.
Vier Wochen lang lernten wir all das, was wir als Grundlage für unseren Einsatz als Entscheider benötigten.
Wir sahen Filme über das Leben in den Herkunftsländern unserer künftigen Klienten, erfuhren Hintergründe über ihre Kultur und über die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in ihrer Heimat. Wir lernten die Welt einzuteilen in Regionen, die zur Flucht und der anschließenden Aufnahme bei uns berechtigen, „weil dort Krieg herrscht und das Leben für niemanden sicher ist und sich alle in dauernder Lebensgefahr befinden“, und in Länder, „in denen nur vereinzelt Menschen in Gefahr sind.“ Genau diese Einzelnen mussten wir lernen unter all den anderen herauszufiltern, die nur zu uns kamen, weil sie vom europäischen Wohlstand gehört hatten und daran teilhaben wollten. Diejenigen sollten wir aus der großen Menge heraussuchen, die als politische Oppositionelle verfolgt wurden, die aus religiösen Gründen in Gefahr waren oder weil sie der falschen Volksgruppe angehörten. Frauen, die zur Ehe gezwungen wurden und Mütter die mit ihren Töchtern flohen, weil diese beschnitten werden sollten. Homosexuelle, die von der Todesstrafe oder von hohen Gefängnisstrafen bedroht waren wegen ihrer Liebe zum gleichen und in diesem Fall falschen Geschlecht. Unter all diesen wirklich Verfolgten sollten wir wiederum die herausfiltern, die sich bereits durch einen Ortswechsel im eigenen Land in Sicherheit bringen könnten. Wir sahen Filme vom Elend auf dem Land und von einem ganz normalen Leben in den Großstädten, das sich von unserem nicht groß unterschied. Hier würden Homosexuelle nicht auffallen, wenn sie sich einigermaßen bedeckt hielten. Schließlich konnte man auch ganz gut leben, ohne auf der Straße Händchen zu halten, meinte unser Ausbilder und erntete vielfaches Grinsen. In den großen Städten konnten auch Angehörige bedrängter Volksgruppen wie Roma oder Kurden Schutz finden, so lernten wir. Sie blieben dadurch in ihrem eigenen Kulturraum, was für sie ja viel besser wäre, als sich bei uns einer ganz anderen Ordnung und Kultur anzupassen.
Auch diejenigen die aus rein wirtschaftlichen Gründen ihre Heimat verließen, konnten stattdessen in die Städte ziehen und dort Arbeit finden. An dieser Stelle unterschieden wir noch einmal: Es gab immer solche und solche. Diejenigen, die nur mehr Wohlstand wünschten, obwohl es ihnen gar nicht so schlecht ging, und solche, die in wirklicher Not waren und sich und ihre Kinder nicht ernähren konnten. Die Ersten hatten keinen Grund zur Flucht, denn man konnte auch mit wenig ganz gut leben, die Letzteren mussten ihre Dörfer verlassen, keine Frage. Aber auch sie hatten keinen Anspruch auf Asyl bei uns, sondern waren gehalten, in den Städten im eigenen Land Arbeit zu suchen.
„Und wenn sie keine finden?“, fragte jemand.
„Wer sich wirklich bemüht, findet Arbeit“, antwortete der Kursleiter wie aus der Pistole geschossen. „Aber viele gehen eben lieber den leichteren Weg, lassen sich blenden vom Reichtum in Europa und setzen alle Hebel in Bewegung, um zu uns zu kommen.“
Hier machte er eine bedeutungsschwere Pause.
„An dieser Stelle sind Sie gefragt“, fuhr er dann nicht weniger nachdrücklich fort, „denn unser Asylrecht sieht das nicht vor. Diese Leute müssen Sie zurückschicken, damit andere, die wirklich in Not sind, bleiben können.“
Ich erinnerte mich an die überfüllten Boote, die wir in Filmen gesehen hatten, an die vielen Menschen, die mit Sack und Pack auf dem Weg waren zur Grenze oder in verschlammten Zeltdörfern hausten und warteten, dass sich die Grenze für sie öffnete, und war mir nicht ganz sicher, ob das wirklich der leichtere Weg war. Aber vermutlich wussten sie es eben nicht besser, ließen sich täuschen und wenn sie bemerkten, worauf sie sich eingelassen hatten, war es zu spät. Dann waren sie mitten drin im Schlamassel. Sie taten mir leid, aber es gab Gesetze und nach dem Gesetz hatten sie keinen Grund und keinen Anspruch darauf, bei uns zu bleiben. Ich holte die Bilder an zerstörte Städte in Syrien und weinende Kinder inmitten von Schutt und Panzern vor mein inneres Auge und wusste wieder, wie ich in einem solchen Fall entscheiden musste.
Wir lernten die Welt einzuteilen, die Regionen und die Länder, die Kulturen und die Menschen. Wir lernten die Gesetze kennen, die regelten, wer bei uns Anspruch auf Hilfe hatte und erfuhren, wie diese Hilfe aussah.
Anhand von Fallbeispielen und später auch mit Rollenspielen sortierten wir in richtige Flüchtlinge und falsche Flüchtlinge, in gute und schlechte . Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen – dieser Satz setzte sich in meinem Gehirn fest und wollte sich nicht mehr entfernen lassen, obwohl ich doch genau wusste, dass niemand ins Kröpfchen geschickt wurde, sondern lediglich wieder nach Hause. Und zu Hause ist es doch immer noch am besten. Wir lernten den Unterschied zu erkennen zwischen Not und wirklicher Not, legten genaue Kriterien fest, um zwischen berechtigten Fluchtursachen und vorgeschobenen Gründen zu unterscheiden. Wir übten herauszufinden, wer bei uns bleiben durfte. Laut Gesetz – und nicht weil unser Gefühl dafür sprach!
Ein ganz wichtiger Teil unserer Ausbildung war auch, Techniken zur Befragung der Klienten zu erlernen.
Was mussten wir erfahren und wie konnten wir die Flüchtlinge dazu bringen, uns genau das zu sagen, was für unsere Entscheidung wichtig war? Wie konnten wir die wichtigen Dinge erfragen und die unwichtigen beiseitelassen? Und vor allem, wie konnten wir die Wahrheit herausfinden?
Zum Schluss dieses Unterrichtsblocks bekamen wir zwei Sätze mit auf den Weg, die uns als Grundlage dienen sollten:
„Wer unbedingt in Deutschland bleiben will und keinen wirklichen Grund dafür hat, der lügt eben. Sie müssen herausfinden was die Wahrheit ist. Werden Sie Detektive und spüren sie die Lüge auf!“
Und: „Wer einmal lügt – lügt immer! Wer Sie in kleinen Dingen belügt, tut dies auch in großen, da müssen Sie gar nicht mehr weiter fragen.“
Dann folgte eine Unterrichtseinheit, die uns persönlich als Entscheider betraf. Wir bekamen Hilfestellungen mit auf den Weg, um uns nicht zu sehr in Einzelschicksale zu vertiefen.
„Sie dürfen das nicht persönlich nehmen, wenn Sie jemanden abweisen müssen und deshalb beschimpft werden. Oder noch schlimmer, wenn diese Menschen Ihnen verzweifelt erscheinen, wenn sie in Tränen ausbrechen. Nicht Sie entscheiden, sondern das Gesetz. Sie wenden lediglich das Gesetz an, Sie verantworten es nicht.“
Ich schluckte. Erinnerungen an früher kamen hoch, als ich hinter dem Postschalter alles getan hatte, um die Probleme, mit denen die Leute zu mir kamen, zu lösen. Und ich erinnerte mich, wie schlecht es mir gegangen war, wenn ich nicht helfen konnte, wenn einfach nicht mehr zu helfen war. Im Vergleich zu dem was mir jetzt bevorstand, war das mit Sicherheit noch harmlos gewesen.
„Nehmen Sie nichts mit nach Hause“, hörte ich, als ich aus meinen Gedanken auftauchte.
„Wenn Sie abends die Tür des Büros hinter sich schließen, spätestens wenn Sie das Gebäude verlassen, betreten Sie Ihr eigenes Leben und das hat nichts, rein gar nichts mit dem Leben der Flüchtlinge zu tun. Lassen Sie keine Verbindung zu. Stellen Sie sich notfalls vor, dass Sie im Kino gewesen sind und einen Film gesehen haben.“
Bevor ich wieder in meine Gedanken abtauchen konnte, folgte noch ein Satz, der mir im Lauf meiner Tätigkeit als Entscheiderin sehr wichtig werden sollte, jedenfalls so lange, bis ich feststellen musste, dass zumindest der erste Teil der Aussage nicht immer stimmte:
„Seien Sie sich bewusst, dass Sie nicht über Tod und Leben entscheiden. Ihre Klienten haben immer noch die Möglichkeit vor Gericht gegen Ihre Entscheidung zu klagen.“
Und dann waren wir so weit.
Vier Wochen lang hatten wir gemeinsam unendlich viel Neues erfahren und gelernt. Vier Wochen lang hatten wir von unzähligen menschlichen Schicksalen gehört und sie genauestens analysiert. Wir waren der Überzeugung, nichts könne uns mehr überraschen und vor allem: niemand könne uns noch etwas vormachen. Wir waren gut genug geschult, so glaubten wir, um herauszufinden, wer uns die Wahrheit erzählte und wer uns nur mit allen möglichen tragischen Geschichten und geschickten Tricks um den Finger wickeln wollte, um bleiben zu dürfen.
Es würde nun in der realen Welt noch ein Abgleich mit dem erfolgen, was wir gelernt hatten. Ein zweiwöchiges Praktikum musste von uns noch absolviert werden, bevor wir ins eigenständige Entscheiderleben entlassen wurden. Hier sollten wir überprüfen, was wir in der Theorie gelernt hatten. Sollten erst assistieren und dann mit „unterstützender Beobachtung“ selbst die ersten Schritte machen, die nötigen Informationen aus den Klienten herausholen und erste eigene Entscheidungen treffen. Ich freute mich darauf, endlich in Kontakt mit den Menschen zu kommen denen ich helfen wollte. Das Wissen um einen erfahrenen Kollegen oder eine erfahrene Kollegin im Hintergrund gab mir Sicherheit.
Ich würde meine Sache gut machen, davon war ich überzeugt, hatte ich doch immer wieder positive Rückmeldungen von den Kursleitern bekommen. Ich würde gewissenhaft untersuchen wer wirklich in Not und Gefahr war und Anspruch auf Hilfe hatte. Für diese Menschen würde ich den Weg frei machen in ein neues Leben in der deutschen Gesellschaft, indem ich die aussortierte, die ihnen ihren Platz streitig machen wollten, obwohl es doch andere Möglichkeiten für sie gab. Aber auch diesen Leuten gegenüber würde ich fair und hilfsbereit bleiben. Sie wussten es nicht besser, gingen davon aus, dass Platz für alle wäre, ganz egal aus welchem Grund sie kamen. Und hier musste ich ansetzen. Musste ihnen mit Geduld und Überzeugung klar machen, dass es für sie andere Wege gab, bessere Wege sogar. Dass sie sich nur ein wenig anstrengen müssten, um diese zu finden und dann könnten sie in ihrer Heimat, in ihrer Kultur – in ihrer eigenen Welt eben – ganz gut weiterleben und hätten somit ein viel besseres Schicksal als jene, die nicht in die Heimat zurück konnten, weil ihnen Gefahr für Leib und Leben drohte.
Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, hörte ich es in meinem Kopf raunen. Ich schüttelte mich und jagte den Gedanken davon. Woher kam nur dieser blöde Spruch, der sich immer wieder in meinem Gehirn Bahn brach? Es gab nicht gut oder schlecht, sondern lediglich richtig und falsch. Und es gab kein Kröpfchen, es gab nur eine Rückführung in die Heimat für jene, die keinen Platz an unseren westlichen Töpfen bekommen konnten. Und wer wollte denn wirklich freiwillig auf Dauer fern der Heimat leben? Sie würden mir eines Tages dankbar sein, dass ich ihnen den richtigen Weg gewiesen hatte, auch wenn sie das im Moment vielleicht noch nicht verstehen konnten oder wollten.
Ich hatte Glück, meine künftige Einsatzstelle war nicht weit von meinem Wohnort entfernt. Dort sollte ich bereits das Praktikum absolvieren, um dann, wenn ich allein meinen Posten ausfüllen und meine Frau stehen musste, die nötigen Kontakte zu haben, wenn ich doch einmal rückfragen musste oder sonstige Unterstützung benötigte.
Unser Kurs feierte am letzten Freitagabend noch mal ausgiebig. So schnell würden wir uns wohl nicht mehr sehen, wenn überhaupt. Dabei war im Lauf der vier Wochen ein gutes Team aus uns geworden. Nur einer hatte nicht bis zum Schluss durchgehalten und war einfach eines Tages nicht mehr aufgetaucht, ohne zu erklären warum. Wir hatten uns nicht lange damit aufgehalten zu überlegen, warum er nicht mehr dabei war, denn er war immer sehr still und unauffällig gewesen und hatte sich, sobald der Unterricht beendet war, zurückgezogen.