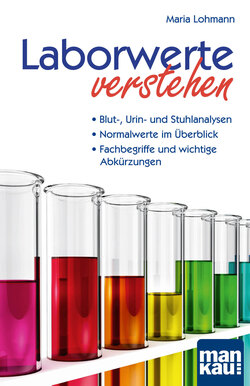Читать книгу Laborwerte verstehen. Kompakt-Ratgeber - Maria Lohmann - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDas Blut
Dass Blut ein »ganz besonderer Saft« ist, wusste schon Goethe. Das Blut besteht aus festen Blutkörperchen und flüssigen Bestandteilen (Plasma). Es gibt rote und weiße Blutkörperchen sowie Blutplättchen. Das Plasma ist eine klare, gelbliche Flüssigkeit, die zu 90 Prozent aus Wasser besteht und lebensnotwendige Substanzen enthält. Heute spielen Laboruntersuchungen in der Medizin eine zentrale Rolle bei der Diagnose und Überwachung von Therapien. Da das Blut bei nahezu jeder Krankheit seine Zusammensetzung verändert, lässt sich aus seinen Werten viel über den Zustand der meisten Organe schließen.
Die Blutentnahme
Wenn eine Blutanalyse im Labor durchgeführt werden soll, muss der Arzt dazu eine ausreichende Menge an Blut entnehmen, das in Kunststoffröhrchen abgefüllt wird. Diese sind mit einem Stoff präpariert, der die Blutgerinnung verhindert. Im Labor wird das Blut zentrifugiert, d. h. es wird mit hoher Geschwindigkeit geschleudert, wodurch seine festen und flüssigen Bestandteile voneinander getrennt werden. Für viele Bluttests wird Serum benötigt, das im Gegensatz zum Plasma kaum Gerinnungsfaktoren und auch keine Blutzellen enthält und deshalb besser untersucht werden kann. Die Bestimmung von Blutkörperchen und vielen weiteren Werten erfolgt in den Labors vollautomatisch.
Blutentnahme aus der Kapillare erfolgt an der Fingerkuppe oder am Ohrläppchen und ist für die Untersuchung von Blutzucker und Hämoglobin geeignet. Das Kapillarblut stammt aus den kleinsten Blutgefäßen und ist mit etwas Zellflüssigkeit vermischt. Das erklärt, warum die Laborergebnisse von Kapillarblut und von Blut aus der Armvene nicht völlig übereinstimmen; gewisse Abweichungen sind dabei normal. So ist die Glukosekonzentration im Kapillarblut etwas höher als im Venenblut.
Blut aus der Vene ist sauerstoffarm und wird am Arm bzw. in der Ellenbeuge mit einer Nadel abgenommen. Dies ist die häufigste Art der Blutentnahme, vor allem, wenn größere Mengen benötigt werden.
INFO
AUFBEREITUNG DES BLUTES
Vollblut = Blutzellen plus flüssige Bestandteile plus Gerinnungsstoffe
Plasma = Flüssige Blutbestandteile plus Gerinnungsstoffe
Serum = Plasma ohne Gerinnungsstoffe
Blut aus der Arterie ist sehr sauerstoff reich. Es wird für eine spezielle Untersuchung zur Bestimmung von Sauerstoff und Kohlendioxid sowie zur Festlegung des pH-Wertes entnommen. Diese Untersuchung wird in aller Regel im Krankenhaus und bei Spezialisten, wie z. B. Lungenfachärzten, durchgeführt.
INFO
WARUM NÜCHTERN ?
Nahrungsmittel können die Blutwerte erheblich beeinflussen, dies gilt besonders für die Blutzucker- und Fettwerte. Die letzte Nahrungsaufnahme sollte also zwölf Stunden zurückliegen. Das gilt auch für die morgendlichen Medikamente; ein kleiner Schluck Wasser ist erlaubt. Alle in diesem Buch angegebenen Normalwerte beziehen sich auf die Nüchtern-Blutentnahme.
Was sind Normalwerte?
In einigen Büchern werden auch die Begriffe »Referenzbereich« oder »Referenzwerte« verwendet, die nahezu die gleiche Bedeutung wie der Begriff »Normalwertbereich« haben, also einen bestimmten Bereich definieren, in dem alle Werte als normal gelten. Wer sich näher mit Laborwerten beschäftigt, wird feststellen, dass die in diesem Buch genannten Normalwerte von anderen Angaben häufig leicht nach oben oder unten abweichen. Das liegt daran, dass von Labor zu Labor die Werte methodenabhängig geringfügig unterschiedlich sein können, z. B. aufgrund einer etwas anderen Labor- und Messtechnik oder unterschiedlicher Laborgeräte und Testsubstanzen. Deshalb werden auf dem Laborbefundblatt hinter jedem Wert die Referenzbereiche (mit oberen und unteren Grenzwerten) des jeweiligen Labors angegeben.
Falls also Ihr Arzt etwas andere Normalwerte als die hier Genannten benutzt, ist das kein Grund zur Verunsicherung, solange Ihre Werte nicht übermäßig von den Normwerten abweichen.
Alte und neue Maßeinheiten
Bei Laborwerten wird noch immer mit zweierlei Maß gemessen. Die »alten« konventionellen Werte werden bevorzugt in der Maßeinheit Milligramm oder Gramm angegeben.
Um aber Messwerte international verwerten zu können, ist in den Naturwissenschaften ein standardisiertes System eingeführt worden: die sogenannten SI-Einheiten (Système international d’unités). Für die Labormedizin bedeutet das: Bei allen Substanzen, deren Molekulargewicht bekannt ist, soll die Angabe in Mol erfolgen anstelle der bisherigen Einheiten Gramm und Milligramm. Nur wenn die Molekülmasse nicht bekannt ist, verzichtet man auf die SI-Einheiten und verwendet weiterhin g/mg/µg. Soweit möglich, sind in diesem Buch beide Angaben genannt.
Welche Faktoren beeinflussen die Blutwerte?
➧ Geschlecht: Bei vielen Laborwerten werden für Männer und Frauen unterschiedliche Normalwerte angegeben. Diese Werte stehen im Zusammenhang mit Unterschieden in der Körpergröße, im Gewicht, in der Muskelmasse und beim Hormonstatus.
➧ Alter: Eine ganze Reihe von Blutwerten steigt ab dem 50. Lebensjahr an. Hierzu gehören vor allem: Rheumafaktoren, Cholesterin, Triglyzeride, Homocystein, Harnstoff, Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit (BSG), Zuckerbelastungstest und die Kreatinin-Clearance.
➧ Ernährung: Abhängig von Zusammensetzung und Menge einer Mahlzeit und dem zeitlichen Abstand zur Blutentnahme steigen die Blutspiegel von Blutzucker, Triglyzeriden und Fettsäuren an. Deshalb sollte die Blutentnahme in nüchternem Zustand (nach zwölfstündiger Nahrungspause) erfolgen. Zwei Tage vor der Blutabnahme jegliche Vitaminpräparate absetzen!
➧ Alkohol: Der Konsum von Alkohol hat sowohl kurzfristig als auch langfristig Einfluss auf die Laborwerte, besonders auf die Leberwerte.
➧ Medikamente: Zahlreiche Medikamente beeinflussen die Laborwerte, daher sollten dem Arzt alle Arzneimittel bekannt sein, die Sie einnehmen.
➧ Körperliche Anstrengung und Stress: Körperliche Anstrengung, die weniger als drei Stunden zurückliegt, sogar längeres Stehen, führt zu einer Verfälschung der Messwerte z. B. von Hämatokrit, Hämoglobin, Cholesterol sowie Muskelenzymen. Vor der Blutentnahme ist es daher ratsam, sich auszuruhen.
➧ Körperlage: Die Körperlage bei der Blutentnahme beeinflusst die Konzentration einzelner Stoffe erheblich. Deshalb sollte das Blut immer in derselben Körperlage – entweder im Sitzen oder im Liegen – entnommen werden.
➧ Tageszeit: Der Hormonspiegel ist mehr oder weniger großen tageszeitlichen Schwankungen unterworfen, so ist z. B. der Kortisonwert morgens am höchsten. Daher ist bei Kontrollen die Blutentnahme zur gleichen Tageszeit wichtig.
Die Aufgaben des Blutes
Der Körper eines erwachsenen Menschen enthält zwischen vier und sechs Liter Blut (etwa acht Prozent des Körpergewichts), das über das weit verzweigte Netz der Blutgefäße jeden Winkel des Körpers erreicht und versorgt. Das »flüssige Organ« Blut wird im Knochenmark gebildet und hat eine ganze Reihe von wichtigen Aufgaben zu erfüllen:
➧ Transportfunktion (Sauerstoff, Kohlendioxid, Nährstoffe, Hormone, Enzyme, Abfallstoffe)
➧ Abwehrfunktion (Bekämpfung von Krankheitserregern, Abbau degenerierter körpereigener Zellen)
➧ Pufferfunktion (pH-Wert des Blutes liegt im engen Bereich von 7,35–7,45 (leicht alkalisch):
Puffer für ein stabiles Säure-Basen-Gleichgewicht)
➧ Blutgerinnung (Fibrinogen, Schutz vor übermäßigen Blutverlusten)
➧ Regulierung der Körpertemperatur (ständige Blutzirkulation garantiert gleichbleibende Körpertemperatur von 36,5 Grad Celsius)
Das Blutbild
Die Bestimmung des Blutbildes ist eine der häufigsten Laboruntersuchungen. Dabei wird zwischen dem kleinen Blutbild (es umfasst die Untersuchung von roten und weißen Blutkörperchen, Blutplättchen, Hämoglobin und Hämatokrit, MCV, MCH, MCHC) und dem sogenannten Differenzialblutbild unterschieden.
Im Differenzialblutbild werden die verschiedenen Unterarten der weißen Blutkörperchen (Leukozyten) und deren Form genau bestimmt und differenziert – daher auch der Name Differenzialblutbild.
Kleines (»rotes«) Blutbild und (»weißes«) Differenzialblutbild zusammen ergeben das große Blutbild.
INFO
BESTANDTEILE DES BLUTES
Unser Blut enthält feste Bestandteile (ca. 45 %):
Das sind Blutkörperchen, also rote Blutkörperchen (Erythrozyten), weiße Blutkörperchen (Leukozyten) und die sogenannten Blutplättchen (Thrombozyten).
Zudem gibt es flüssige Bestandteile (ca. 55 %), das sogenannte Blutplasma: Es besteht aus 90 % Wasser, 8 % Eiweißen, aus Fetten, Zucker, Mineralstoffen und Spurenelementen, Enzymen, Vitaminen, Gerinnungsstoffen, Stoffwechselabbauprodukten und Hormonen.
Erythrozyten (rote Blutkörperchen)
Normalwerte:
Männer 4,5–5,9 Millionen/µl
Frauen 4,1–5,1 Millionen/µl
Die roten Blutkörperchen stellen mit 99 Prozent die größte Gruppe der Blutzellen dar. Ihr wichtigster Bestandteil ist das eisenhaltige Hämoglobin, das dem Blut die rote Farbe gibt. Die roten, scheibchenförmigen und kernlosen Blutkörperchen sind für den Transport von Sauerstoff zu den Zellen und den Abtransport von Kohlendioxid zuständig. Nach einer Lebenszeit von etwa vier Monaten werden die roten Blutkörperchen in Leber und Milz abgebaut.
INFO
WUNDERWERK MENSCH
Es ist kaum vorstellbar, dass im Blut insgesamt etwa 30 Billionen rote Blutkörperchen fließen. Ihre Lebensdauer beträgt nicht mal ein halbes Jahr. Jede Sekunde gehen durch einen natürlichen Alterungsprozess mehr als zwei Millionen davon zugrunde, die im Knochenmark neu gebildet werden müssen. In einem kleinen Würfel mit einer Kantenlänge von einem Millimeter haben etwa fünf Millionen rote Blutkörperchen Platz. Wenn die roten Blutkörperchen vermehrt auftreten, bezeichnet man dies als Polyglobulie. Eine Verminderung bezeichnet man als Anämie.
Ursachen für Vermehrung der Erythrozyten (Polyglobulie):
➧ Flüssigkeitsmangel
➧ chronische Herz- und Lungenerkrankungen ➧ Höhentraining bei Sportlern, Hochleistungssport ➧ Knochenmarkerkrankungen ➧ chronische Kohlenmonoxidvergiftung ➧ Schwangerschaft
Ursachen für Verminderung der Erythrozyten (Anämie):
➧ Eisenmangel
➧ verlängerte oder zu häufige Menstruation
➧ erhöhter Bedarf, während des Wachstums und in der Schwangerschaft
➧ einseitige Ernährung, Fehlernährung
➧ verminderte Eisenresorption (z. B. Zöliakie)
➧ Mangel an Vitamin B12 oder Folsäure
➧ chronische Blutverluste (im Magen-Darm-Bereich)
➧ gestörte Produktion der Erythrozyten
Hämoglobin (Hb)
Normalwerte:
Männer 13,6–18,0 g/dl (8,44–11,2 mmol/l)
Frauen 12,0–16,0 g/dl (7,45–9,9 mmol/l)
Hauptbestandteil der Erythrozyten ist der rote Blutfarbstoff Hämoglobin (Hb). Er bindet Sauerstoff und transportiert ihn zu den einzelnen Organen und Zellen, wo er im Austausch Kohlendioxid aufnimmt. Eine Senkung des Hb-Gehaltes weist auf eine Anämie hin. In der Regel entsprechen Veränderungen des Hämoglobinwertes denen der roten Blutkörperchen. Hämoglobin ist ein wichtiger Wert zur Feststellung einer Anämie.
Ursachen für erhöhte Hämoglobin-Werte:
➧ Höhentraining (Sportler)
➧ Polyglobulie (zu viele Erythrozyten im Blut)
➧ starkes Rauchen
➧ Austrocknung
➧ Eigenblutdoping
Ursachen für erniedrigte Hämoglobin-Werte:
➧ alle Formen der Blutarmut (Anämie)
➧ Blutverlust
➧ Schwangerschaft
➧ Überwässerung
MCV, MCH und MCHC
Hinter diesen drei Abkürzungen verbergen sich die Erythrozyten-Indizes. Sie dienen der Klassifizierung von Form und Größe der roten Blutkörperchen und werden beim kleinen Blutbild mitbestimmt. Zu ihrer Berechnung werden Hämoglobin- und Erythrozytengehalt sowie der Hämatokritwert herangezogen. Damit lassen sich Störungen der Blutbildung und Mangelerscheinungen erkennen sowie verschiedene Formen der Anämie unterscheiden.
MCV (Mittleres Zellvolumen der Erythrozyten, Normalwert: 81–96 fl (81–96 µm3), die mittlere Größe eines einzelnen roten Blutkörperchens, dient der Unterscheidung von Anämieformen. Erhöhte Werte weisen hin auf Folsäure- und Vitamin-B12-Mangel, chronische Lebererkrankungen, chronischen Alkoholmissbrauch (bei zwei Dritteln der Betroffenen erhöht) und starkes Rauchen. Erniedrigte Werte deuten auf Eisenmangel, Infektionen, Tumoren, Anämie durch chronischen Blutverlust oder Kupfermangel hin.
MCH (Mittlerer zellulärer Hämoglobingehalt, Normalwert: 27–34 pg (1,67–2,11 fmol/Zelle) gibt Auskunft über den mittleren Hämoglobingehalt eines einzigen roten Blutkörperchens und die Fließfähigkeit des Blutes. Der mittlere zelluläre Hämoglobingehalt dient der Unterscheidung von verschiedenen Anämieformen. Erhöhte Werte weisen hin auf Vitamin-B12- oder Folsäuremangel, erniedrigte Werte auf Eisenmangel, Vitamin-B6-Mangel oder Kupfermangel.
MCHC (Mittlere zelluläre Hämoglobinkonzentration, Normalwert: 32–36 g/dl (19,85–22,34 mmol/l) gibt Auskunft über die mittlere Hämoglobinkonzentration eines einzigen roten Blutkörperchens. Erhöhte Werte weisen hin auf eine spezielle Anämieform, erniedrigte Werte auf Eisenmangel, Vitamin-B6-Mangel, Mittelmeeranämie oder Kupfermangel.
Retikulozyten
Normalwert: 0,5–2,0 % (Anteil an den Erythrozyten)
Retikulozyten sind junge rote Blutkörperchen, die vom Knochenmark ins Blut ausgeschwemmt werden. Mit dem Retikulozytenwert gewinnt der Arzt genaue Erkenntnisse über die blutbildende Aktivität des Knochenmarks und kann auf diese Weise verschiedene Anämiearten differenzieren.
Der exakt bestimmte Wert wird auch zur Therapiekontrolle, z. B. bei Eisenzufuhr im Rahmen einer Mangelanämie, eingesetzt.
Ursachen für Vermehrung der Retikulozyten:
➧ nach akutem Blutverlust ➧ Behandlung von Eisen, Vitamin B6, B12 oder Folsäure bei Anämien
➧ Leberzirrhose
➧ längerer Aufenthalt im Hochgebirge
➧ bei Neugeborenen ist die Vermehrung physiologisch bedingt
Ursachen für Verminderung der Retikulozyten:
➧ gestörte Bildung der roten Blutkörperchen im Knochenmark
➧ Eisenmangel, Kupfermangel, Vitamin-B12- oder Folsäuremangel
➧ Knochenmarkerkrankungen
➧ Chemotherapie
RDW
Normalwert: 10–15 %
RDW (Red Cell Distribution Width) ist die Abkürzung für die Verteilungsbreite der Erythrozyten. Der Wert gibt an, ob die roten Blutkörperchen gleichmäßig groß sind und ob sie die gleiche Form besitzen. Wenn viele unterschiedlich große Erythrozyten vorhanden sind, führt das zu einer Erhöhung des RDW-Wertes, z. B. bei verschiedenen Anämieformen oder Knochenmarkerkrankungen.
Leukozyten (weiße Blutkörperchen)
Normalwerte: 4000–10 000/µl
Hauptaufgabe der weißen Blutkörperchen ist die Abwehr von Krankheitserregern und Fremdstoffen. Die weißen Blutkörperchen, die nur ein Prozent der Blutzellen ausmachen, können die Blutbahn verlassen und ins Gewebe wandern, um dort direkt ihre Abwehrfunktion zu erfüllen. Nur zehn Prozent aller Leukozyten zirkulieren im Blut.
Der Rest befindet sich im Gewebe, in den Lymphknoten, im Knochenmark und kann bei einer Entzündung rasch freigesetzt und mobilisiert werden. Erhöhte Leukozytenwerte weisen auf ein alarmiertes Abwehrsystem hin.
Ursachen für Vermehrung der Leukozyten (Leukozytose):
➧ bakterielle Infektionen
➧ starke körperliche oder seelische Belastungen
➧ Schwangerschaft
➧ rheumatische Erkrankungen
➧ akuter Blutverlust, Schockzustände
➧ Leukämie
➧ Rauchen
➧ Tumoren
➧ chronische Entzündungen (Darm, Bronchien, Gelenke)
➧ Medikamente (Antibabypille, bestimmte Antibiotika)
Ursachen für Verminderung der Leukozyten (Leukopenie):
➧ Virusinfektionen
➧ Masern, Mumps, Röteln und Influenza
➧ Autoimmunerkrankungen, Immunschwäche
➧ Strahlen- und Chemotherapie
➧ Schmerzmittel, Schilddrüsenhormone, Antibiotika
INFO
NORMALWERTE IM KLEINEN BLUTBILD
| Laborwerte | Frauen | Männer |
| Erythrozyten | 4,1–5,1 Mill./µl | 4,5–5,9 Mill./µl |
| Hämoglobin | 12–16 g/dl | 13,6–18 g/dl |
| Hämatokrit | 34–44 % | 36–48% |
| Leukozyten | 4000–10 000/µl | |
| Thrombozyten | 150 000–400 000/µl | |
| MCV | 81–96 fl | |
| MCH | 27–34 pg | |
| MCHC | 32–36 g/dl |
Beim sogenannten Differenzialblutbild werden die Leukozyten genau betrachtet. Mithilfe einer besonderen Färbemethode lassen sich die weißen Blutkörperchen in weitere Untergruppen aufschlüsseln. Aus der prozentualen Verteilung, der Größe und dem Reifegrad der Blutzellen kann der Mediziner Rückschlüsse auf bestimmte Krankheiten ziehen.
Die drei Hauptgruppen der Leukozyten sind:
➧ Granulozyten (neutrophile, eosinophile und basophile)
➧ Lymphozyten
➧ Monozyten
INFO
DIFFERENZIALBLUTBILD: LEUKOZYTEN
| Anteil | Absolute Zahl | |
| Alle Leukozyten | 100 % | 4000–10 000/µl |
| Segmentkernige neutrophile Granulozyten | 50–70% | 3000–5800/µl |
| Stabkernige neutrophile Granulozyten | 3–5 % | 150–400/µl |
| Lymphozyten | 25–45% | 1500–3000/µl |
| Monozyten | 3–7 % | 285–500/µl |
| Eosinophile Granulozyten | 1–4 % | 50–250/µl |
| Basophile Granulozyten | 0–1 % | 15–50/µl |
Die neutrophilen Granulozyten bekämpfen Bakterien, Viren und Pilze; die eosinophilen und basophilen Granulozyten wehren Parasiten ab. Lymphozyten sind spezialisierte Zellen, während Monozyten die größten weißen Blutkörperchen sind.
Monozyten haben die Fähigkeit, sich in bewegliche Fresszellen zu verwandeln (siehe Kapitel Immunsystem, die Schutzpolizei des Körpers).
Ursachen für Vermehrung der neutrophilen Granulozyten:
➧ bakterielle Infektionen sowie auch chronische Entzündungen
➧ rheumatische Erkrankungen
➧ Pilzerkrankungen
➧ Leukämie
➧ akute Blutungen
Ursachen für Verminderung der neutrophilen Granulozyten:
➧ Virus-Infektionen (Masern, Röteln, Influenza, Epstein-Barr)
➧ Autoimmunerkrankungen
➧ Malaria
➧ Schädigungen des Knochenmarks (Strahlen, toxische Stoffe)
➧ Medikamente (z. B. Immunsuppressiva, Malariamittel, Chemotherapie)
Ursachen für Vermehrung der Lymphozyten:
➧ Keuchhusten, Röteln, Masern, Tuberkulose
➧ chronische Infektionen
➧ Überfunktion der Schilddrüse
➧ Virusinfekte, Hepatitis
Ursachen für Verminderung der Lymphozyten:
➧ Autoimmunkrankheiten
➧ hochdosierte Kortisontherapie
➧ starker Stress, starke körperliche Belastung
➧ Schwangerschaft
➧ HIV-Infektion
Ursachen für Vermehrung der Monozyten:
➧ abklingende Infektionen (Hinweis auf Genesung)
➧ Tuberkulose
➧ entzündliche Darmerkrankungen
➧ Malaria
Ursachen für Vermehrung der eosinophilen Granulozyten:
➧ allergische Erkrankungen, z. B. Asthma
➧ Parasitenbefall, z. B. Würmer
➧ Scharlach
➧ abklingende Infektionen (Hinweis auf Genesung)
Ursachen für Verminderung der eosinophilen Granulozyten:
➧ hochdosierte Kortisontherapie
➧ Erkrankungen der Nebennieren (Morbus Cushing)
➧ Hormonbehandlung
Ursachen für Vermehrung der basophilen Granulozyten:
➧ allergische Reaktionen
➧ schwere Nierenerkrankungen
➧ Schwangerschaft
➧ Einnahme der Antibabypille
➧ Darmentzündungen (Colitis ulcerosa)
➧ Unterfunktion der Schilddrüse
➧ Stress
➧ Nachwirkungen bei Entfernung der Milz
➧ Leukämie
Thrombozyten (Blutplättchen)
Normalwert: 150 000–400 000/µl
Die Blutplättchen sind winzige, unregelmäßig geformte Zellen, die im Knochenmark gebildet und ein bis zwei Wochen später in Milz und Leber wieder abgebaut werden. Die Thrombozyten spielen eine wichtige Rolle bei der Blutgerinnung. Wird ein Blutgefäß verletzt, lagern sich die Thrombozyten an die Wundränder an, und binnen Minuten entsteht ein Pfropf, der die Wunde – wenn sie nicht allzu groß ist – verschließt. Bei Thrombozytenzahlen unter 30 000/µl Blut besteht akute Blutungsgefahr. Ein Gefäßverschluss droht bei mehr als 1 Million/µl. Ein Medikamentenwirkstoff, der die Zusammenlagerung der Thrombozyten hemmt, ist die Acetylsalicylsäure (ASS). Sie wird in niedriger Dosierung zur Vorbeugung einer Thrombose eingesetzt. Vor Operationen dient die Bestimmung der Thrombozyten dem Ausschluss einer erhöhten Blutungsneigung.
Ursachen für Vermehrung der Thrombozyten (Thrombozytose):
➧ Infektionskrankheiten, chronische Infekte
➧ Erkrankungen des Knochenmarks
➧ Tumoren
➧ chronische Entzündungen (wie z. B. der Atemwege oder Harnwege)
➧ Reaktiv nach Blutverlusten und Operationen
➧ Nachwirkungen bei Entfernung der Milz
Ursachen für Verminderung der Thrombozyten (Thrombozytopenie):
➧ Autoimmunerkrankungen
➧ Strahlen- oder Chemotherapie
➧ Milzvergrößerung
➧ Medikamente, unter anderem Antibiotika und Schmerzmittel
➧ Alkohol
➧ Nachwirkungen von Infektionen
➧ Leukämie
➧ Vergiftungen (Arsen, Benzol, Gold)
Der Hämatokrit
Normalwert:
Männer 36–48 %
Frauen 34–44 %
Der Hämatokrit gibt den Anteil der festen Bestandteile (rote und weiße Blutkörperchen und Thrombozyten) im Blut an. Um ihn zu ermitteln, wird das Blut in einer Zentrifuge in feste und flüssige Bestandteile getrennt. Feste Bestandteile (durchschnittlich 45 Prozent) lagern sich im unteren Teil des Reagenzglases ab. Zu einer Erhöhung des Hämatokrits kommt es durch eine Vermehrung der roten Blutkörperchen (Polyglobulie) oder durch Austrocknung des Körpers (Flüssigkeitsmangel, Eindickung des Blutes). Dieser Zustand ist ungünstig, da die Fließeigenschaften des Blutes eingeschränkt sind. Bei einer Anämie, Blutverlust oder Wassereinlagerungen im Gewebe (Ödeme) ist der Hämatokritwert durch den Mangel an roten Blutkörperchen erniedrigt.
Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit (BSG)
Dieser Wert (kurz »Blutsenkung«) gibt an, wie schnell die roten Blutkörperchen in einem langen, senkrecht stehenden Röhrchen absinken. Nach einer Stunde wird abgelesen, um wie viele Millimeter sich die Blutzellen abgesetzt haben. Sinken die Blutkörperchen schnell ab, spricht man von einer beschleunigten Blutsenkung, was auf eine Entzündung im Körper hinweist. Die BSG-Ergebnisse beruhen darauf, dass bei stärkeren Entzündungen die Blutzellen schneller nach unten sinken. Dieser unspezifische Wert sagt jedoch noch nichts über die Ursache und den Ort der Entzündung aus. Um diese zu ermitteln, sind weitere Untersuchungen notwendig. Die Ergebnisse werden maßgeblich durch die Menge und die Zusammensetzung der Blutkörperchen und den Eiweißgehalt im Blut beeinflusst.
Blutsenkung-Normalwerte nach einer Stunde:
| Frauen | Männer | |
| unter 50 Jahre | unter 20 mm | unter 15 mm |
| über 50 Jahre | unter 30 mm | unter 20 mm |
Die Blutgerinnung
Nach jeder Verletzung der Blutgefäße versucht der Körper die Wunde abzudichten. Dabei werden innerhalb von wenigen Sekunden die Blutplättchen, verschiedene Gerinnungsfaktoren und Fibrinogen mobilisiert. Fibrinogen ist ein löslicher Eiweißstoff, der im Blutplasma vorkommt. Daraus entsteht bei der Blutgerinnung unter Einwirkung von Thrombin der Blutfaserstoff Fibrin. Die Thrombozyten setzen Enzyme und Gerinnungsfaktoren frei und leiten damit die Blutgerinnung ein. Es entsteht ein Fibrinnetz, in dem die Blutplättchen hängen bleiben. Durch Zusammenziehen des Fibrinnetzes verkleinert sich die Wunde nach und nach. Eine mangelhafte Blutgerinnung kann durch eine gestörte Funktion der Blutplättchen oder der Gerinnungsfaktoren entstehen. Krankhafte Störungen der Blutgerinnung werden unter dem Begriff »hämorrhagische Diathesen« zusammengefasst. Dazu zählen die Bluterkrankheit, die Verbrauchskoagulopathie und die Blutfleckenkrankheit. Bei diesen Krankheiten gehen mit der verminderten Gerinnungsfähigkeit häufig auch Schädigungen der Blutgefäße einher, wodurch die Blutungsneigung noch mehr zunimmt. Solche Gefäßschäden können auch durch schweren Vitamin-C-Mangel, Leukämie oder bestimmte Infektionen entstehen.
Fibrinogen
Normalwert: 1,5–4,0 g/l (150–450 mg/dl)
Fibrinogen nennt man auch Gerinnungsfaktor I. Nach einer Aktivierung der Blutgerinnung entsteht daraus Fibrin. Der Fibrinogenwert wird bestimmt, wenn Verdacht auf einen krankhaft vermehrten Verbrauch von Gerinnungsfaktoren besteht, z. B. bei Sepsis, Verbrennungen oder bei schweren Blutungen, die zum Absinken der Fibrinogenkonzentration führen. Bei einer Schädigung der Leber kann die Fibrinogenkonzentration ebenfalls erniedrigt sein. Bei Entzündungen sowie chronischen Nierenerkrankungen ist der Wert oft erhöht. Fibrinogen wird außerdem im Rahmen einer gerinnselauflösenden Therapie, etwa bei einem akuten Herzinfarkt, kontrolliert.
Anzeichen einer Störung der Blutgerinnung
➧ lange Nachblutungen
➧ spontane Blutungen, z. B. Nasenbluten
➧ häufig blaue Flecken
➧ winzige Blutungspünktchen an den Beinen
INFO
LABORBASISPROGRAMM
➧ Blutplättchen (Thrombozyten)
➧ Partielle Thromboplastinzeit (PTT, APTT)
➧ Blutungszeit
➧ Quicktest
Blutungszeit
Normalwert: 2–6 Minuten
Dabei wird der Zeitraum gemessen, der zwischen einer künstlich gesetzten Blutung, z. B. an der Fingerkuppe, und dem Stillstand der Blutung liegt. Dieser Test gilt lediglich als erste Untersuchung bei Verdacht auf eine Störung der Blutgerinnung.
Quicktest und INR
Quicktest Normalwert: 70–130 %
INR-Normalwert: 0,9–1,15
INR-Wert bei Behandlung mit
Gerinnungshemmern: 2,0–3,5
Der Quickwert, auch als Prothrombinzeit oder Thromboplastinzeit bezeichnet, dient der Überwachung von bestimmten Gerinnungsfaktoren. Mit dem Quicktest wird ermittelt, wie lange das Blut für die Gerinnung braucht. Der Quickwert dient unter anderem dazu, die Blutgerinnung vor Operationen zu kontrollieren sowie die optimale Dosierung von gerinnungshemmenden Medikamenten (z. B. Marcumar) zu ermitteln, wie sie etwa nach Thrombosen und Herzinfarkt eingesetzt werden. Bei einer Therapie mit diesen Medikamenten liegt der ideale Quickwert im Bereich von etwa 15 bis 25 Prozent. Auch bei schweren Lebererkrankungen ist der Quickwert erniedrigt, denn die Gerinnungsfaktoren werden in der Leber gebildet. Weil sich der Quickwert je nach Messverfahren und Labor erheblich unterscheiden kann, verwendet man den INR-Wert (International Normalized Ratio) anstelle des Quickwertes. Die Werte ändern sich gegenläufig: Sinkt der Quickwert, steigt der INR-Wert. Labore geben in der Regel beide Werte an.
Partielle Thromboplastinzeit (PTT, APTT)
Normalwert: 28 bis 40 Sekunden
Der Überprüfung von Gerinnungsfaktoren dient auch die partielle Thromboplastinzeit. Bei der PTT wird nach Zusatz eines bestimmten Stoffes die Zeit bis zum Einsetzen der Gerinnung gemessen. Die PTT ist wichtig für die Überwachung und Kontrolle einer Therapie mit Heparin, wie sie beispielsweise bei einer Thrombose eingeleitet wird. Bei der Bluterkrankheit (Hämophilie) besteht eine Störung bestimmter Gerinnungsfaktoren, und die PTT ist in diesem Fall extrem verlängert. Als Synonym für PTT wird auch vielfach die Abkürzung APTT (Aktivierte partielle Thromboplastinzeit) verwendet.
Die tägliche Spritze zur Blutverdünnung