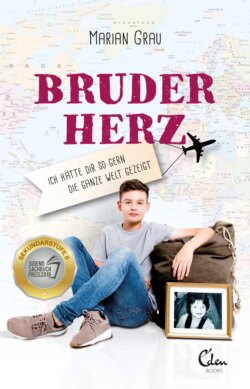Читать книгу Bruderherz - Marian Grau - Страница 5
Kapitel 2
ОглавлениеMeine Mutter sagt immer, dass wir etwas ganz Besonderes sind. Das stimmt, wir sind wirklich eine ganz besondere Familie. Wir verbrachten unsere Wochenenden weder im Freizeitpark, noch im Zoo, und machten auch keine anderen Ausflüge. Wir empfingen meist Besuch und besuchten selten. Wir gingen nicht in Restaurants essen, und Urlaub machten wir nur ein einziges Mal im Jahr. Das Reiseziel war dabei immer klar: das Kinderhospiz in Olpe.
Wir, das waren meine Mutter, mein Vater, mein Bruder Marlon und ich. All unsere Vornamen beginnen mit »M«. Das ist eines dieser Dinge, die uns wohl zusammenhalten lassen, auch wenn meine Eltern schon lange, genau gesagt seit 2005, kein Paar mehr sind. Dafür aber beste Freunde; auch gut.
Mein Vater hat blonde lange Haare und ist etwa einen Meter achtzig groß. Heute, 2018, bin ich endlich fast so groß wie er. Seine Haare trägt mein Papa schon seit Urzeiten lang und offen. Er ist ein unglaublich lieber und guter Mensch. Er hält, was er verspricht, und sorgt sich um uns. Er ist immer für seine Familie da, auch wenn er nicht der große Redner ist, sondern lieber meinen Rücken krault. Macht nix, reden kann ich ja mit meiner Mama. Die krault nicht, redet aber umso mehr.
Mama hat dunkles Haar, zu Marlons Lebzeiten immer lang, die sie ebenfalls meist offen trug. Lieber zieht sie einen Blazer an, darunter eine Bluse und Schuhe im Leo-Look. Mama ist eine gute Mama, eine sehr gute sogar, finde ich. Sie ist nicht eine dieser Mütter, die in Babyforen nach dem besten Kindersitz suchen oder sich bei ihren Freundinnen über die wohl saugstärksten Windeln austauschen. Sie entscheidet aus dem Bauch heraus – und liegt immer richtig damit. Sie ist eine tolle, starke Frau und vielleicht sogar mein Lieblingsmensch. Sorry, Papa!
Mein Bruder heißt Marlon und ist ebenfalls Teil meines Lebens. Als ich die Welt erblickte, war er schon da. Wir sind zweieinhalb Jahre auseinander, doch einen wirklich großen Altersunterschied habe ich nie gespürt. Mein Bruder war anders als alle anderen, das wussten die anderen, und das wusste ich. Jeder meiner Freunde hatte ein Geschwisterkind zum Spielen, Lachen und Kuscheln, zum Lernen und Austauschen von Gedanken. Aber nur, weil Marlon nicht so war wie die anderen, und auch so anders als ich selbst, hieß das nicht, dass wir uns nicht verbunden fühlten. Im Gegenteil: Ich habe meinen Bruder wahrscheinlich noch mehr geliebt als alle anderen, und das tue ich heute noch.
Es war mir bewusst, dass ich keine Antwort von ihm erwarten konnte, wenn ich ihn etwas fragte, und mir war klar, dass immer ich derjenige sein würde, der vorliest oder die Musik auswählt. Dass wir nie Hausaufgaben zusammen machen oder auf den Spielplatz gehen würden. Das war absolut normal und okay, denn Marlon war mein Bruder – und er war der beste Bruder der Welt.
Marlon konnte nicht laufen und lag viel. Ein Leben lang hat meine Mutter ihn herumgetragen; noch heute habe ich das Bild vor meinen Augen, wie sie mit ihm auf dem Arm ins Zimmer kommt. Marlon hatte einen Rollstuhl mit etlichen Stützen, den er allerdings nicht selbst bewegen konnte. Sprechen konnte er ebenso wenig, dennoch war er in der Lage sich zu äußern. Wenn ich ihn etwas fragte, erwartete ich keine konkrete Antwort, stattdessen hoffte ich auf eine Reaktion, auf ein Lachen oder eine Bewegung seiner Arme. Auch wenn wir es nicht zu einhundert Prozent wissen können, so sind wir uns trotzdem sicher, dass wir ihn richtig verstanden haben. Für andere ist so eine Unterhaltung, in der immer nur man selbst redet, sicher gewöhnungsbedürftig, aber ich kannte das gar nicht anders.
Marlon hatte Morbus Leigh, eine Stoffwechselkrankheit, die so unendlich selten vorkommt, dass wir eigentlich mindestens einmal im Lotto hätten gewinnen müssen. Denn auf einen Sechser im Lotto kommt ein Kind mit Morbus Leigh. Tja, aber das große Geld ist leider ausgeblieben.
Jeder Mensch hat unzählig viele Gene, um die dreißigtausend. Jedes davon ist doppelt vorhanden. Außerdem hat jeder Mensch im Durchschnitt sieben genetische Defekte. Meist bemerkt man diese kaputten Gene gar nicht, da zu jedem Gen ein zweites, gesundes Gen gehört, das den Defekt ausgleicht. Das nennt man autosomal-rezessiv, also wenn das Merkmal eines Gens (»krank«) nicht zutage tritt, weil es durch das Merkmal seines Partnergens (»gesund«) unterdrückt wird.
Auch meine Mutter und mein Vater haben ungefähr sieben kaputte Gene. Weil die aber eben doppelt vorliegen und das zweite jeweils intakt ist, sind meine Eltern nicht krank und werden es auch nicht. Zufälligerweise ist nun aber bei meiner Mutter und meinem Vater das gleiche Gen kaputt, nennen wir es Gen 3.682. Bei beiden liegt 3.682 doppelt vor, einmal intakt, einmal beschädigt. Wenn diese zwei Genpaare nun aufeinandertreffen und miteinander verschmelzen, weil meine Eltern ein Kind bekommen, stehen die Chancen wegen der autosomal-rezessiven Vererbung also eins zu vier, dass das Kind krank wird: Trifft das defekte Gen 3.682 meiner Mutter auf das intakte 3.682 meines Vaters, ist das Kind gesund. Genauso ist es andersrum. Aus gesund auf krank, krank auf gesund und gesund auf gesund entsteht ein gesundes Baby. Nur die Kombination krank auf krankes Gen führt zu Marlons Erkrankung. So einfach ist das.
Weil ich dieselben Eltern habe, hatten Marlon und ich dieselben Chancen. Der einzige Unterschied: Ich hatte Glück, Marlon nicht. Eine scheiß Krankheit.
Mit Morbus Leigh ist man nicht imstande, Nahrung in Energie umzuwandeln. Damit Marlon nicht verhungerte, musste er über eine Magensonde ernährt werden. Seine Nahrung war meistens flüssig und gelangte über einen Schlauch direkt in seinen Bauch, was ich als kleiner Junge sehr befremdlich fand. An guten Tagen konnte er Joghurt oder auch mal einen Grießbrei über den Mund zu sich nehmen. Feste Nahrung durfte Marlon nicht essen, da sein Schluckmechanismus kaum ausgeprägt war, und er sich deshalb andauernd verschluckt hätte. So »aß« er fast jeden Tag dasselbe – »Astronautennahrung« wie wir das nannten, denn da diese Flüssignahrung alle lebenswichtigen Elemente enthält, wird sie tatsächlich von Astronauten im Weltraum gegessen bzw. getrunken, wie auch immer.
Wenn ich morgens die Treppe herunterlief, stand meine Milch immer neben Marlons Flüssignahrung, und viel zu oft passierte es, dass ich die Tassen vertauscht und aus Versehen an Marlons Nahrung genippt habe. Eklig! Da bin ich froh, dass er die Nahrung zumindest nicht schmecken musste. Denn er bekam sie ja direkt in den Magen gepumpt, ohne dass sie an den Geschmackszellen der Zunge vorbeikam. Auf der anderen Seite kann ich mir gar nicht vorstellen, wie es sein muss, nicht zu wissen, wie die Welt schmeckt. Ich meine, keine Vorstellung vom Geschmack beispielsweise eines Gummibärchens zu haben – wie krass! Armer Marlon!
Um mit meinem Bruder irgendwohin zu fahren, bedurfte es viel Vorbereitung und Planung. Da waren die vollständige Anzahl Medikamente, die Marlon immer bei sich haben musste, seine ganzen Spielzeuge, mit denen er sich den ganzen Tag lang beschäftigen konnte, Proviant, Decken, sein Korsett, Spritzen für seine Sonde, der Inhalierer und vieles mehr. Es war quasi unmöglich, nur mal »einfach so« irgendwohin zu fahren. Das ging nur in absolut seltenen Fällen, und auch dann nur ohne Marlon, wenn wir eine Pflegekraft zu Hause hatten, die sich um ihn kümmerte.
Und dann war da ja noch Marlons Rollstuhl. Der musste natürlich auch immer mit. Um mit Marlon zumindest halbwegs irgendwie fast mobil zu sein, kauften wir uns ein großes Auto mit hohem Dach. Ich weiß noch, wir hatten einmal einen blauen Renault Kangoo – nicht das schönste Auto der Welt, aber darum ging es nicht – um Schönheit geht es doch eigentlich nie, oder?
Wenn wir mit Marlon reisten, wurde er in seinem Rollstuhl durch den Kofferraum bis hinter den Sitz des Fahrers (das war meist Papa) geschoben. So saß er direkt neben mir, denn ich hatte einen einzelnen Sitz hinter dem Beifahrer (das war dann Mama). Während der Fahrt hielten wir Marlon immer bei guter Laune, sangen mit ihm Lieder, raschelten mit irgendwas oder spielten laut Spiele. Zum Beispiel »Spiegelei«, bei dem man Vorfahrtsschilder suchen muss. Wer zuerst eines davon entdeckt, ruft »Spiegelei« und bekommt einen Punkt. Dabei konnte er zwar nicht mitspielen, aber ich hatte immer das Gefühl, dass es ihm von uns am meisten Spaß machte.
Natürlich machten wir viele lange Pausen, in denen wir an die frische Luft gingen, Marlons Decken auf irgendeinem Rastplatz ausbreiteten und etwas vesperten. Denn einfach und unbeschwerlich war das Reisen für Marlon sicher nicht. Das war es für keinen von uns. Aber es ist wie mit so vielen Dingen im Leben: Irgendwann klappt es, weil man sich angepasst hat. Weil man dazugelernt, und weil man es einfach akzeptiert hat. Aufgeben gibt’s nicht!
Überhaupt war Marlon zu pflegen sehr schwer und zeitintensiv. Trotz Pflegedienst, der tagsüber fast immer bei uns im Haus war, hatten meine Eltern neben der Arbeit also eine Menge zu tun. Da kam es nicht selten vor, dass der gemeinsame Nachmittag auf dem Spielplatz ausfallen musste, weil es Marlon nicht gut ging, oder eine Frau vom Pflegedienst ausfiel und meine Eltern spontan einspringen mussten. Dann war ich eben auf mich allein gestellt. Aber ich lernte schon früh, mich selbst zu beschäftigen, und es machte mir nichts aus. An solchen Tagen war ich oft mit unserer Hündin Nele unterwegs. Sie war ein Tibetterrier-Mischling und seit Marlons Diagnose an unserer Seite, und wir waren beste Freunde. Sie hatte schwarze, lange Zotteln und war etwa fünfzig Zentimeter hoch, durch ihr Fell schimmerten treue, dunkelbraune Augen. Und als vollwertiges Mitglied der Familie durfte sie sogar aufs Sofa. Von klein auf ging ich mit Nele allein um den Block spazieren, später durfte ich mit ihr bis in den Wald. Das war vielleicht nicht ganz so cool wie das Schaukeln mit Papa, oder das Sandeln mit Mama auf dem Spielplatz, aber wenigstens wusste ich, was ich mit mir anfangen sollte und war nicht allein. »Seelenhund«, so nannte Mama unsere Nele immer, weil sie in der Zeit von Marlons Diagnose immer für sie da war.
Einmal pro Woche versprach mir meine Mutter einen gemeinsamen Abend, Zeit nur für uns zwei. Diese Abende waren jedes Mal das Highlight, der Abend, auf den wir beide uns am meisten freuten. Der »Bestimmer« an diesen Abenden war natürlich ich.
Ich erinnere mich noch genau an einen bestimmten Samstagabend, denn er war etwas ganz Besonderes für mich – und das nicht nur, weil es einer dieser Abende zu zweit war, sondern auch, weil ich zum ersten Mal meinem Bruder helfen konnte, also wirklich helfen und nicht nur etwas aufheben, das ihm runtergefallen war.
Ich bin acht Jahre alt und begeisterter Fan von Wetten dass ...? mit Thomas Gottschalk – also steht das Fernsehprogramm für heute Abend schon mal fest! Bevor es losgeht, ziehe ich mich schnell um (im Schlafanzug guckt es sich einfach besser! ☺) und schlüpfe in meine Lieblingssocken: braune, dicke Wollsocken mit einem gehäkelten Bärenkopf darauf. Mit denen ist es immer besonders schwer, nicht die große Treppe in unserem Haus hinunterzufallen, weil ich mit den dicken Köpfen auf den Socken nicht mehr in meine Hausschuhe passe und deswegen sehr rutschig unterwegs bin. Für diese Socken nehme ich das aber gern in Kauf und schleppe Decken und Kissen aus meinem Bett ins Wohnzimmer hinunter. Ich mag es heute noch, wenn man es sich richtig gemütlich macht (wenn ich krank bin, vergrabe ich mich immer inmitten meiner Kuschelausstattung auf der Couch – mehr brauche ich nicht, um schnell wieder gesund zu werden).
Bequeme Kleidung, Kissen und Decken – der gemeinsame Abend kann losgehen! Meiner Mutter, die es an unseren Abenden natürlich genauso schön haben sollte wie ich, schenke ich ein Glas ihres Lieblingsweins ein. Dafür nehme ich das größte und schwungvollste Glas, das der Schrank zu bieten hat.
»Daraus muss der Wein doch sicher am besten schmecken!«, denke ich. Für mich gibt es Sprite – aus einem weniger eleganten Glas, aber lecker ist es trotzdem. Natürlich dürfen auch Snacks nicht fehlen. Anlässlich unserer besonderen Abende haben wir immer viel Süßes im Schrank, gleich im Fach unter den Weingläsern. Während meine Mutter sich um meinen Bruder kümmert und dafür sorgt, dass er gut einschlafen kann, baue ich auf dem Sofatisch ein regelrechtes Snack-Buffet auf: große Schüsseln, kleine Schüsseln, Gläser vollgefüllt mit Haribos, Salzstangen und, ganz besonders wichtig, unseren Lieblingschips.
Als die Couch vor lauter Decken und Kissen nicht mehr zu sehen ist und das Buffet mit dem Wein, der Sprite und den Snacks (inklusive der passenden Chips!) angerichtet, bin ich startklar. Die Tagesschau läuft noch, und ich schaue ein wenig zu. Viel verstehe ich allerdings nicht, und ich bin der festen Überzeugung, dass die Erwachsenen auch nicht jedes einzelne Fremdwort der Sprecher kennen und nur aus dem Kontext kapieren, worum es eigentlich geht. Und was soll ich sagen? Das glaube ich heute noch.
Meine Mutter ist heute ungewöhnlich lange bei meinem Bruder. Normalerweise ruft sie mich, wenn sie fertig ist, und dann komme ich immer noch vorbei und sage: »Gute Nacht, Marlon«, bevor sie das Licht ausknipst. Das ist meistens gegen acht Uhr.
Weil das Zimmer meines Bruders im Erdgeschoss liegt, wo er ein eigenes, ebenerdiges Bad hat und leicht aus dem Haus kommt, ohne eine Treppe heruntergetragen werden zu müssen, habe ich es nicht weit bis zu seiner Tür.
»Was ist los, Mama?«, frage ich durch einen Spalt hinein. »Geht es ihm gut? Gleich geht’s los!«
Meine Mutter sieht durcheinander und irgendwie fertig aus.
»Du, dem Marlon geht’s gerade nicht so gut. Er krampft die ganze Zeit. Aber mach dir keine Sorgen.« Sie klingt ein wenig verzweifelt.
Diese Krampfanfälle, die mein Bruder manchmal hat, sind nicht ohne. Oftmals gehen sie nur wenige Minuten, aber dieser scheint schon eine Weile anzudauern. Ich weiß zwar, dass sie nicht gut für Marlon sind, und dass man so gut wie nichts tun kann, aber warum es zu diesen Anfällen kommt, weiß ich nicht.
Mama versucht, Marlon zu beruhigen, indem sie ihm etwas vorsingt, ihn streichelt oder irgendwie anders ablenkt. Aber so einfach ist das nicht. In diesen Momenten sind wir froh, wenn eine Schwester vom Pflegedienst da ist. Sie kann zwar ebenso wenig tun, entlastet uns jedoch dadurch, dass sie unsere Rolle einnimmt. Diese Frauen sind fast immer bei meinem Bruder, und ohne sie wäre unser Leben mit Marlon ein ganz anderes. Ständig zur Stelle, frühmorgens um sechs, noch bevor ich überhaupt aufwache, kümmert sich schon jemand um meinen Bruder. Ich glaube, dass ich meinen Eltern aus dem Herzen spreche, wenn ich sage, dass wir diesen Frauen unendlich dankbar sind für all das, was sie für uns und vor allem für Marlon tun.
An diesem Samstagabend sind wir allerdings allein. Meine Mutter ist sichtlich aufgelöst, denn normalerweise gehen diese blöden Anfälle nach wenigen Minuten vorbei.
»Geh doch zurück auf die Couch und guck dir schon mal die Saal-Wette an«, schlägt sie vor. Weil ich weiß, dass man bei so einem Anfall wenig tun kann, ich schon gar nicht, tue ich, was sie sagt, kehre ins Wohnzimmer zurück und sinke in die Kissen der Couch. Ein paar wenige Minuten lang schaue ich Thomas Gottschalk zu, auf den ich mich seit einer Woche gefreut habe. Doch mir ist nicht nach Fernsehen und auch nicht nach dem Buffet, das vor mir auf dem Tisch wartet.
Ich entschließe mich, noch einmal zum Zimmer meines Bruders zu gehen. Der Krampf hat noch nicht aufgehört, und meine Mutter wird immer nervöser. Ich gebe mir einen Ruck und sage: »Mama, geh doch du schon mal zum Fernsehen. Vielleicht kann ich ihn ja beruhigen.« Viel falsch machen kann ich nicht, das wissen wir beide. Sie lässt mich also tatsächlich allein und geht ins Wohnzimmer, wo immer noch lautstark die Gäste des Abends vorgestellt werden. Ich schließe die Tür und versuche mein Glück.
»Selbst, wenn es nichts bringt, habe ich ihr immerhin ein kleines bisschen helfen können, indem ich es versuche«, denke ich, als ich zu Marlon ins Bett steige, was gar nicht so leicht ist, weil die Bettkante so hoch ist, und ich so klein bin, und ich auch noch über ihn drüber klettern muss. Aber darin bin ich mittlerweile schon geübt, denn ich steige oft zu Marlon ins Bett, um Zeit mit ihm zu verbringen.
Das ist natürlich kein normales Bett, sondern ein besonders hohes, damit man Marlon leichter pflegen kann und sich nicht immer bücken muss. Es lässt sich fernsteuern, und man kann die Position und den Winkel der Lehne verändern. Das lieben wir beide, an den Knöpfen herumspielen und das Bett in die unmöglichsten Stellungen bringen.
»Jetzt fliegen wir zum Mond, Marlon«, spiele ich immer wieder und lasse uns aufwärts fahren. »Achtung, wir landen.« Damit kippe ich die Rückenlehne flach nach hinten. Obwohl ich es hundertmal wiederholt haben muss, lacht Marlon jedes Mal wieder vor Vergnügen auf und lässt seine Rassel durch die Luft kreisen.
»Ja, scannen Sie die Umgebung nach fremden Lebensformen«, fordere ich ihn dann auf, und er lacht erneut, wenn ich ihn auch noch »Lieutenant« nenne, obwohl wir beide nicht wissen, was das eigentlich ist.
Der Rahmen des Bettes besteht aus hellem Holz und die Zwischenräume aus Plexiglas mit Tieren darauf. Auf mich wirkt das Bett immer wie eine Festung, was ich total gut finde, denn wo ist man schon geschützter als in einer Burg? Oder eben in einem Raumschiff. Oh, was besuchen wir für viele Planeten! Und lachen uns jedes Mal kaputt dabei.
Marlon ist immer fröhlich und gut gelaunt, er lacht viel und spielt mit seinen Spielsachen – am liebsten hat er ein Teil, das ich am ehesten als »Atommodell« bezeichnen würde. Es besteht aus mehreren Holzkugeln, die mit Stäben und straffen Schnüren miteinander verbunden sind. Auf den Stäben befindet sich jeweils eine bewegliche Holzkugel, die, wenn man das Teil schüttelt, hin- und herrutscht und dabei ein leises, klackendes Geräusch macht. Marlons Lieblingsspieli, wie wir es nennen, haben wir zusätzlich mit raschelnder Folie umwickelt, was ein unverwechselbares Geräusch verursacht, wenn er es herumschwenkt. Er liebt das und kann sich stundenlang damit beschäftigen.
Doch jetzt ist es anders. Wenn er krampft, ist Marlon nicht er selbst, und ich erkenne ihn kaum. Er ist dann sehr ruhig, die Hände liegen geballt neben ihm, und er bewegt sich, als würde er sich nach einem langen Schlaf recken wollen, die Bewegung aber nicht zu Ende bringen können. Das Schlimme ist nicht, dass er so verkrampft daliegt, das Schlimme ist, dass er so anders aussieht und es ist, als läge ein Fremder in seinem Bett.
Ich beginne, Marlon ein wenig zu erzählen, und lege meine Hand auf seinen Bauch. Worüber ich rede, weiß ich gar nicht, und es ist auch egal, Hauptsache, er kann mich hören. Lange muss ich nicht reden, da bemerke ich, dass sich die Spannung in seinem Körper löst – wie ein Aufzug, der sein Stockwerk erreicht hat und langsam stoppt. Ich atme auf und hoffe, dass es wirklich vorbei ist – und es ist vorbei.
Ich drücke mich an ihn, raschele erleichtert mit seiner Folie und küsse ihn zwei Mal auf die Wange. Marlon lacht vergnügt und schlingt seine Hand um die Rassel, die ich ihm reiche. Da ist er wieder, mein Bruder.
Das Lachen muss meine Mutter ebenfalls bemerkt haben, denn ich höre, wie sie vom Sofa aufsteht und zu uns ins Zimmer kommt. Sie ist erleichtert und froh, genauso wie ich. Wir umarmen uns und freuen uns alle drei, dass es vorbei ist. Ich habe es geschafft, und dabei habe ich gar nichts anders gemacht als meine Mutter! Ich bin wahnsinnig stolz, dass Marlon und ich das so gut hinbekommen haben.
Aus Wetten dass ...? wird an diesem Abend übrigens nichts mehr. Wir verlegen das Buffet und die Kissen zu Marlon ins Zimmer, worüber er sich wahnsinnig freut: noch mehr Kissen! Und dann auch noch Gesellschaft, die genauso über beide Ohren strahlt wie er selbst.