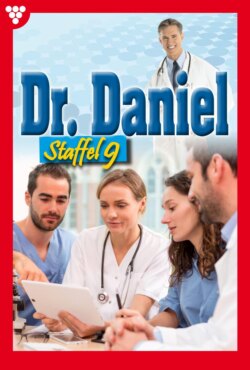Читать книгу Dr. Daniel Staffel 9 – Arztroman - Marie-Francoise - Страница 10
ОглавлениеDer Krankenwagen hielt mit blinkendem Blaulicht vor der Klinik an, während das Martinshorn mit einem letzten Aufjaulen verklang. Der Sanitäter, der am Steuer gesessen hatte, sprang heraus, lief nach hinten und riß die Hecktüren auf. Zusammen mit seinem Kollegen, der sich im hinteren Teil des Wagens aufgehalten hatte, holte er die Trage heraus, auf der die Patientin lag. Mit einem stählernen Rasseln klappten die Räder nach unten, dann schoben die beiden Sanitäter die fahrbare Trage durch die doppelflügeligen Eingangstüren. Ihnen folgte ein junger Mann, dessen Gesicht Angst und Sorge widerspiegelte, doch seine Augen blieben dabei seltsam unbeteiligt.
Oberschwester Lena Kaufmann kam den Sanitätern im Laufschritt entgegen.
»Was ist…«, begann sie, doch in diesem Moment erhaschte sie einen Blick auf die Patientin. Ihr Gesicht verlor sofort alle Farbe. »Hanni! Um Himmels willen…«
Die junge Frau auf der Trage wandte ihr schmerzverzerrtes Gesicht ab. Deutlicher hätte sie ihre Abneigung gegen die Oberschwester gar nicht zeigen können.
»Verdacht auf akute Appendizitis«, meldete jetzt der Sanitäter.
Oberschwester Lena nickte ein wenig zerstreut und wies zum rechten Flügel der Klinik. »In die Chirurgie.« Sie lief schon voraus, um den Chefarzt Dr. Gerrit Scheibler zu informieren.
»Alarmieren Sie das Team«, befahl er, während er in die Notaufnahme eilte und zu der jungen Patientin trat. Das erste, was ihm an ihr auffiel, war das wohlgerundete Bäuchlein, das auf eine Schwangerschaft hinwies.
»Ich bin Dr. Scheibler, der Chefarzt dieser Klinik«, stellte er sich vor.
»Hannelore Jung«, erwiderte die junge Frau leise, wobei sich in ihrem Gesicht noch immer Schmerzen abzeichneten.
»Keine Sorge, Frau Jung«, beruhigte Dr. Scheibler sie. »Sie sind hier in guten Händen.« Er schwieg kurz. »Haben Sie Ihren Mutterpaß bei sich?«
Hannelore zögerte, dann schüttelte sie den Kopf. »Ich war bei keinem Arzt.«
Entsetzt starrte Dr. Scheibler sie an, ging aber dann nicht näher auf diesen in seinen Augen unverzeihlichen Leichtsinn ein, sondern erkundigte sich: »Wann hatten Sie zuletzt ihre Tage?«
Nach kurzem Überlegen nannte Hannelore ihm das Datum. Dr. Scheibler rechnete rasch nach und kam zu dem Ergebnis, daß die junge Frau jetzt etwa in der achtzehnten Schwangerschaftswoche sein mußte. Vorsichtig tastete er nach dem Blinddarm und stellte fest, daß die Bauchdecke in diesem Bereich hart und angespannt war. Als er leichten Druck ausübte, zuckte die Patientin zusammen.
»Mußten Sie sich übergeben?« wollte Dr. Scheibler wissen.
Hannelore nickte. »Zweimal.« Sie schwieg kurz. »Mein Mann hat vier Semester Medizin studiert, bevor er auf Jura umsattelte. Er meint, es könnte nur der Blinddarm sein.«
Der Chefarzt nickte. »Das ist vermutlich sogar richtig, aber ich kann auch andere Ursachen noch nicht völlig ausschließen. Ich werde mir Ihren Bauch auf Ultraschall ansehen und dann entscheiden, ob wir operieren müssen.«
»Wäre das… gefährlich? Ich meine… für das Baby?«
Dr. Scheibler blickte die junge Frau an. »Ich will Sie zwar nicht kritisieren, aber aufgrund der Tatsache, daß Sie in achtzehn Wochen nicht ein einziges Mal beim Arzt waren, sich also um das Gedeihen Ihres Kindes wohl nicht allzu viele Gedanken gemacht haben, kann ich Ihre jetzige Sorge nicht ganz nachvollziehen.«
Hannelore errötete. »Ich weiß schon, was Sie jetzt von mir denken, aber… es ist alles ganz anders…«
»Im Moment haben wir leider keine Zeit, um eingehender darüber zu sprechen«, meinte Dr. Scheibler, dann verteilte er das spezielle Gel auf dem Bauch der Patientin und ließ den Schallkopf darübergleiten. Ursprünglich hatte er sichergehen wollen, daß keine gestielte Eierstockzyste die Ursache für den akuten Bauch der jungen Frau wäre, doch was er jetzt entdeckte, war noch weit besorgniserregender.
»Das Team steht bereit«, meldete Oberschwester Lena in diesem Moment. Zögernd trat sie näher und wollte gerade etwas sagen, doch Dr. Scheibler kam ihr zuvor.
»Rufen Sie bitte Dr. Daniel her, schnell«, drängte er.
Lena warf der Patientin einen raschen, überaus besorgten Blick zu, leistete der Aufforderung des Chefarztes aber unverzüglich Folge und eilte in den Nebenraum.
In der Praxis von Dr. Robert Daniel meldete sich wie immer die junge Empfangsdame Gabi Meindl. Oberschwester Lena hielt sich gar nicht damit auf, sich weiterverbinden zu lassen.
»Fräulein Meindl, hier ist Lena Kaufmann«, gab sie sich zu erkennen. »Schicken Sie Dr. Daniel bitte unverzüglich in die WaldseeKlinik. Ein dringender Notfall.«
Dann legte sie auf und blieb mit bebenden Händen neben dem Telefon stehen.
»Was ist denn nun mit Hanni?« erklang hinter ihr plötzlich eine ungeduldige Männerstimme.
Lena drehte sich um und sah sich unvermittelt ihrem Schwiegersohn Harald Jung gegenüber.
»Das fragst du ausgerechnet mich?« entgegnete sie in eigenartigem Ton, bevor sie voller Bitterkeit hinzufügte: »In den letzten Jahren war ich doch immer die Letzte, die etwas über Hanni erfahren hat.«
»Müssen wir das etwa jetzt ausdiskutieren?« fragte Harald gereizt.
Lena senkte den Kopf. »Hanni ist meine Tochter…«
»Stieftochter«, verbesserte Harald nachdrücklich. »Und das hast du sie auch immer spüren lassen.«
»Das ist nicht wahr!« verteidigte sich Lena. »Das bildet sich Hanni erst ein, seit sie weiß, daß sie nicht meine leibliche Tochter ist, aber…« Mit plötzlicher Niedergeschlagenheit winkte sie ab. »Was rede ich überhaupt. Ihr glaubt mir ja sowieso nicht.«
Sie drückte sich an Harald vorbei auf den Flur und sah im selben Moment Dr. Daniel durch die undurchsichtige Glastür kommen. Spontan eilte sie ihm entgegen.
»Eine schwangere Patientin mit Verdacht auf akute Appendizitis«, informierte sie ihn sofort.
Dr. Daniel kannte Lena Kaufmann lange genug, um ihren verstörten Gesichtsausdruck zu bemerken. Immerhin hatte sie lange als Sprechstundenhilfe in seiner Praxis gearbeitet. Seit Eröffnung der WaldseeKlinik war sie nun hier als Oberschwester tätig, trotzdem bestand zwischen ihr und Dr. Daniel noch eine gewisse Vertrautheit, die von jahrelanger Zusammenarbeit herrührte.
»Ist alles in Ordnung, Frau Kaufmann?« fragte er besorgt, während er an ihrer Seite zur Notaufnahme eilte.
Lena nickte nur, und dann gab es für Dr. Daniel ohnehin keine Möglichkeit mehr nachzuhaken, denn Dr. Scheibler kam ihm schon entgegen.
»Robert, gut, daß Sie so schnell kommen konnten«, meinte er und dämpfte seine Stimme. »Ich habe da drinnen eine Patientin mit einer akuten Appendizitis, aber das ist noch nicht das Schlimmste. Sie ist ungefähr in der achtzehnten Schwangerschaftswoche, doch der Fetus…« Er schwieg kurz. »Zuerst ist mir nur aufgefallen, daß er zu klein ist, aber bei näherem Hinsehen… er bewegt sich nicht, und es ist auch keine Herztätigkeit auszumachen.«
Erschrocken preßte Lena eine Hand vor den Mund. Erstaunt sahen die beiden Ärzte sie an, doch bevor einer von ihnen auch nur eine Frage stellen konnte, lief die Oberschwester bereits in Richtung Eingangshalle davon.
Dr. Daniel wäre ihr gerne gefolgt, doch im Moment war die Patientin einfach wichtiger.
»Weiß sie es schon?« fragte er.
Dr. Scheibler schüttelte den Kopf. »Ich möchte, daß Sie sich das vorher auch noch anschauen. Vielleicht habe ich mich ja getäuscht.«
Das hielt Dr. Daniel allerdings für sehr unwahrscheinlich, denn Dr. Scheibler war nicht nur ein erstklassiger Chirurg, sondern verfügte auch auf gynäkologischem Gebiet über viel Erfahrung. Immerhin hatte er einige Jahre in der ThierschKlinik gearbeitet, und der dortige Chefarzt, Professor Rudolf Thiersch, verlangte seinen Ärzten wirklich alles ab.
Dr. Daniel betrat die Notaufnahme, stellte sich der jungen Frau vor und machte dann seinerseits noch eine Ultraschallaufnahme, die Dr. Scheiblers Diagnose aber bestätigte.
»Frau Jung, ich habe da eine sehr schlimme Nachricht für Sie«, begann Dr. Daniel so behutsam, wie es in diesem Fall überhaupt möglich war.
Hannelore erschrak. »Ist mein Kind behindert?«
Dr. Daniel schüttelte den Kopf. »Nein, Frau Jung, es geht um etwas völlig anderes.« Er überlegte einen Moment, doch es gab keine schonende Art, ihr die Wahrheit beizubringen – schon gar nicht, wenn es so eilte wie jetzt. »Die Aufnahmen, die Dr. Scheibler und ich gemacht haben, bestätigen, daß das Ungeborene… nicht mehr am Leben ist.«
Aus weit aufgerissenen Augen starrte Hannelore den Arzt an, dann schüttelte sie den Kopf – erst langsam, dann immer heftiger.
»Das glaube ich nicht!« stieß sie hervor. »Das hat sie Ihnen nur eingeredet! Sie kann es nicht ertragen, daß ich ein Kind bekomme! Sie kann es nicht ertragen, weil ihre leibliche Tochter unfruchtbar ist!«
»Wer kann das nicht ertragen?« hakte Dr. Daniel vorsichtig nach.
»Meine Stiefmutter! Sie will, daß Sie mein Kind abtreiben! Wieviel bezahlt sie Ihnen dafür?«
»Frau Jung, beruhigen Sie sich doch«, bat Dr. Daniel in seiner warmherzigen Art, die in seinen Patientinnen normalerweise so viel Vertrauen weckte, aber zu Hannelore war selbst damit kaum durchzudringen. »Wir sind Ärzte… sehr verantwortungsbewußte Ärzte sogar. Was Sie da vermuten, wäre nicht nur eine illegale Abtreibung – es wäre darüber hinaus ein Verbrechen.« Seine Stimme wurde noch eindringlicher. »Frau Jung, bitte glauben Sie uns, Ihr Baby ist im Mutterleib gestorben und zwar nicht erst heute, sondern vermutlich schon vor mehreren Tagen, und wenn wir dieses tote Kind nicht schnellstens holen, dann geraten Sie selbst in Lebensgefahr.«
Dr. Daniel bemerkte den noch immer skeptischen Blick der Patientin und schaltete den Bildschirm wieder ein.
»Sicher kennen Sie Ultraschallaufnahmen von den üblichen Vorsorgeuntersuchungen«, meinte er, doch Hannelore schüttelte nur den Kopf.
»Ich war nie beim Arzt«, gestand sie leise.
»Sie waren nie…«, begann Dr. Daniel fassungslos.
»Ich weiß schon, was Sie jetzt denken«, entgegnete Hannelore voller Bitterkeit. »Sie glauben, das Baby wäre mir gleichgültig, aber so ist es nicht. Es ist mir alles andere als gleichgültig!«
»Das glaube ich Ihnen«, meinte Dr. Daniel und fing dabei den drängenden Blick des Chefarztes auf. Sie hatten jetzt nicht mehr viel Zeit, wenn Hannelore nicht in einen lebensbedrohenden Zustand geraten sollte. Der Blinddarm konnte durchbrechen, ganz zu schweigen von der Gefahr, die von dem toten Fetus ausging.
»Sehen Sie, hier ist das Herz Ihres Babys«, erklärte Dr. Daniel und wies auf eine Stelle des Bildes, von dem Hannelore nur helle und dunkle Schatten erkennen konnte. »Würde es noch leben, könnten Sie die Herztätigkeit sehen.«
»Sie können mir viel erzählen«, entgegnete die junge Frau starrköpfig. »Wenn Sie mein Baby töten, verklage ich Sie. Ich werde die ganze Klinik verklagen!«
»Begreifen Sie doch, es ist tot«, versuchte Dr. Daniel es noch einmal. »Und Sie werden auch sterben, wenn wir nicht bald operieren.« Er griff nach ihrer Hand. »Vertrauen Sie mir, Frau Jung. Ich würde einen solchen Eingriff niemals vornehmen, wenn das Baby noch am Leben wäre.« Er schwieg kurz. »Im übrigen kenne ich Ihre Stiefmutter gar nicht.«
Hannelore sah ihn eine Weile an, dann flüsterte sie: »Doch, Sie kennen sie. Sie wissen wohl nur nicht, daß sie meine Stiefmutter ist.« Sie zögerte einen Moment, ehe sie nickte. »Führen Sie die Operation durch.«
*
»Mit der Narkose muß es jetzt ganz schnell gehen!« drängte Dr. Daniel seinen zukünftigen Schwiegersohn Dr. Jeff Parker, der hier in der Klinik als Anästhesist tätig war.
»Da behaltet ihr die Patientin eine halbe Ewigkeit in der Notaufnahme, aber bei mir muß es dann immer ganz schnell gehen«, grummelte Dr. Parker.
»Du sollst dich nicht beklagen, Jeff, sondern zusehen, daß du…« begann Dr. Scheibler streng.
Abwehrend hob Dr. Parker beide Hände. »Nun friß mich nicht gleich auf. Ich beeile mich ja schon.«
»Hoffentlich«, knurrte Dr. Daniel, während er hinter Dr. Scheibler den Waschraum betrat.
Währenddessen leitete Dr. Parker bei der Patientin die Narkose ein, und dabei kam sogar die routinierte OPSchwester Petra Dölling ins Schwitzen. Sie kannte Dr. Parkers schnelle Arbeitsweise zur Genüge, doch heute war sein Tempo wirklich rekordverdächtig.
»Wollen Sie mich vor der Operation schon fertigmachen?« fragte Petra, als Dr. Parker dabei war, die Patientin zu intubieren.
»Tut mir leid«, murmelte der junge Anästhesist, während er den Tubus schnell aber mit der gebotenen Vorsicht tiefer schob. »Befehl von ganz oben. Der Direktor persönlich hat angeordnet, daß es schnell gehen muß.«
»Bei Ihnen geht’s doch sowieso schnell«, wandte Petra ein, dann nahm sie ihren Platz am OPTisch ein, während Dr. Daniel, Dr. Scheibler, die Oberärztin Dr. Lisa Walther und der Assistenzarzt Dr. Rainer Köhler in den Operationssaal traten.
»Tubus ist drin«, meldete Dr. Parker. »Ihr könnt anfangen.«
Völlig außer Atem stürzte nun auch die zweite OPSchwester Monika Merten herein.
»Sie brauchen mich hier?« stieß sie hervor.
»Ja, Monika, kommen Sie zu mir«, bat Dr. Daniel. »Wir haben eine Missed abortion.«
Monika wußte, was das bedeutete, und bereitete routiniert alle Instrumente vor, die Dr. Daniel dafür benötigen würde. Währenddessen setzte Dr. Daniel bei Hannelore eine Injektion, und Schwester Monika wußte, daß er der Patientin Prostaglandine gespritzt hatte, die eine Wehentätigkeit auslösen sollten.
In der Zwischenzeit hatte Dr. Scheibler schon den Schnitt für die Appendektomie gesetzt.
»Das war wirklich in letzter Minute«, urteilte er aufatmend, während er fachmännisch den entzündeten Blinddarm entfernte.
Dr. Daniel begann indessen vorsichtig, mit Dehnungsstiften die Zervix zu weiten, dann nahm er die Sprengung der Fruchtblase vor.
»Blutdruck fällt, Pulsfrequenz steigt«, meldete sich Dr. Parker zu Wort. »Schockgefahr.«
»Blutgruppenbestimmung und Kreuzprobe«, ordnete Dr. Daniel an. »Danach Dauertropf mit PPL und Venenkatheter. Sobald genügend blutgruppengleiches, gekreuztes Blut bereitsteht, Transfusion einleiten.« Er wandte sich dem Chefarzt zu. »Ich bräuchte Sie jetzt dringend im Labor.«
Dr. Scheibler nickte. »Ich bin hier soweit fertig.«
Ohne Aufforderung übernahm Dr. Lisa Walther seinen Platz und beendete den Eingriff, während der Chefarzt schon die Anweisungen von Dr. Daniel entgegennahm.
»Ich brauche eine Bestimmung des Fibrinogengehalts, außerdem Thrombozyten und Thrombinzeitbestimmung«, erklärte Dr. Daniel.
»In Ordnung«, entgegnete Dr. Scheibler, nahm von Schwester Monika, die die Situation auf Anhieb richtig eingeschätzt und der Patientin Blut abgenommen hatte, die Probe entgegen und eilte damit ins Labor.
»Blutdruck steigt wieder, Puls fast im Normbereich«, meldete sich der Anästhesist.
Inzwischen war das tote Kind durch die Kontraktionen der Gebärmutter in den Geburtskanal gepreßt worden. Blut strömte nach, und Dr. Daniel vermutete, daß die heftigen Blutungen durch die sich ablösende Plazenta verursacht wurden.
»Fibrinogengehalt liegt bei 90 mg%«, erklärte Dr. Scheibler im Hereinkommen.
Dr. Daniel nickte. Er hatte das bereits erwartet. »Also eine massive Gerinnungsstörung.« Er brauchte keine Sekunde, um die nächsten Schritte zu entscheiden. »Geben Sie der Patientin zehn Milligramm Humanfibrinogen als i. v. Infusion. Wenn Sie die Trockenampulle in ein Wasserbad von 37 Grad stellen, dann verkürzt sich die Lösungszeit. Das Fibrinogen schnell einlaufen lassen. Ich muß inzwischen den Uterus ausräumen.«
Dr. Scheibler nickte nur, dann machte er sich an die Arbeit. Er hatte die Infusion gerade angeschlossen, als Dr. Daniel fortfuhr: »Bluttransfusion anschließen, und wenn das Fibrinogen eingelaufen ist, spritzen Sie in die Armvene zweihunderttausend Einheiten Trasylol. Anschließend DauertropfInfusion von Trasylol, hunderttausend Einheiten pro Stunde – vorerst für vier Stunden.«
Während Dr. Scheibler diese Anordnungen befolgte, holte Dr. Daniel das tote Kind mit Hilfe der Zange, dann nahm er eine vorsichtigte instrumentelle Ausräumung vor, wobei er besonders darauf achtete, den brüchigen Gebärmutterhals nicht zu verletzen.
Mit unverhohlener Bewunderung sah Dr. Scheibler ihm zu. Er hatte selbst lange genug im gynäkologischen Bereich gearbeitet, um zu wissen, daß die Ausräumung bei Missed abortion einer der riskantesten Eingriffe der Abortbehandlung überhaupt war, eben weil es infolge der Gerinnungsstörung zu lebensbedrohlichen Blutungen kommen konnte und wegen der gefährlichen Brüchigkeit der Zervixwand.
»Die Blutung kommt zum Stehen«, stellte Dr. Scheibler jetzt fest.
Dr. Daniel nickte nur. Der äußerst riskante Eingriff hatte ihn erschöpft, dazu kam noch die Niedergeschlagenheit, weil es ein totes Baby war, das er hatte holen müssen.
»Ich bringe den Fetus in die Pathologie«, bot Dr. Scheibler an, weil er Dr. Daniel gut genug kannte, um zu wissen, wie nahe ihm ein solcher Zwischenfall ging.
»Danke, Gerrit«, murmelte er und kontrollierte noch einmal die Blutung, doch unter Einwirkung der angeordneten Medikamente kam sie jetzt wirklich zum Erliegen. Er wandte sich dem Anästhesisten zu. »Jeff, du bringst die Patientin bitte auf Intensiv. Ich kümmere mich nachher persönlich um sie.«
»In Ordnung«, stimmte Dr. Parker zu, zögerte noch einen Moment und fuhr dann fort: »Robert, du solltest nicht gleich in die Praxis zurückgehen, sondern dir erst mal eine kleine Pause gönnen.«
»Diese Pause werde ich bei einem Gespräch mit dir haben, Jeff«, entgegnete Dr. Daniel mit unüberhörbarer Schärfe.
Dr. Parker erwiderte seinen Blick. Er wußte genau, was für ein unerfreuliches Gespräch ihn erwartete.
»Robert, ich mache mir ernsthafte Sorgen um dich«, stellte er klar.
»Völlig unnötig«, erwiderte Dr. Daniel. »Ich habe so etwas schon öfter durchgestanden. Es ist immer wieder schwer, aber es gehört eben leider auch zu meinem Beruf.« Er wollte den Operationssaal verlassen, doch an der Tür drehte er sich noch einmal um. »Ich erwarte dich in meinem Büro.«
Dr. Parker nickte ergeben, sah ihm noch nach und kümmerte sich dann um die Patientin.
Währenddessen war Dr. Daniel in den Waschraum getreten und ließ kaltes Wasser über seine Hände laufen. Er nahm sich dafür mehr Zeit, als nötig gewesen wäre, aber das war für ihn die einzige Möglichkeit, wenigstens ein bißchen Abstand zu gewinnen, bevor er mit dem Mann der Patientin sprechen mußte. Dr. Scheibler hatte ihm gesagt, daß Herr Jung draußen wartete. Inzwischen wußte er zwar sicher schon, daß die Blinddarmoperation ohne Komplikationen verlaufen war, doch für alles andere war Dr. Daniel zuständig.
Bedächtig trocknete er seine Hände ab, schlüpfte aus dem grünen OPKittel und trat dann auf den Flur. Hier marschierte ein junger Mann unruhig hin und her. Als Dr. Daniel auf ihn zukam, blieb er so abrupt stehen, als wäre er gegen eine Mauer gerannt.
»Herr Jung?« vergewisserte sich Dr. Daniel.
Harald nickte. »Ist Hanni…« Er räusperte sich, weil seine Stimme plötzlich ein wenig heiser klang. »Geht es meiner Frau gut?«
»Den Umständen entsprechend«, entgegnete Dr. Daniel, dann begleitete er den jungen Mann zu einer der Bänke, die hier im Flur standen. »Ich konnte Sie vor dem Eingriff leider nicht mehr informieren, weil es ziemlich eilte. Wir mußten ohnehin fast zuviel Zeit in der Notaufnahme investieren, um Ihre Frau von der Richtigkeit unserer Diagnose zu überzeugen.«
»Was heißt das?« fragte Harald argwöhnisch. »War es denn nicht nur der Blinddarm?«
»Der entzündete Blinddarm löste die Beschwerden aus, allerdings verlief dieser Eingriff ohne wesentliche Komplikationen.« Er schwieg kurz, weil es ihm doch schwerfiel, dem jungen Mann die grausame Wahrheit zu sagen. »Ihre Frau war schwanger…«
»War?« fiel Harald ihm energisch ins Wort. »Wollen Sie damit etwa behaupten, Hanni hätte durch diesen Eingriff eine Fehlgeburt erlitten?«
Dr. Daniel schüttelte den Kopf. »Eine Blinddarmoperation birgt heute auch während einer Schwangerschaft kein allzu großes Risiko mehr. Nein, Herr Jung, es verhielt sich anders. Ursprünglich wurde die Ultraschallaufnahme nur gemacht, um andere Ursachen für die Beschwerden ihrer Frau auszuschließen…«
»Ich habe auch vier Semester Medizin studiert«, unterbrach Harald ihn ungeduldig. »Sie müssen mir also nicht alles haarklein erklären.«
»Das ist gut«, meinte Dr. Daniel. »Ihre Frau hatte bei ihrer Einlieferung hier einen sogenannten akuten Bauch. Die Ursache dafür ist oftmals eine Blinddarmentzündung, aber es kommen eben auch Differentialdiagnosen in Frage. Eine davon ist eine gestielte Eileiterzyste. Aus diesem Grund wurde eine Ultraschallaufnahme gemacht, die allerdings etwas weit Schlimmeres zutage brachte. Das Kind, das Ihre Frau trug, war im Mutterleib gestorben – aller Wahrscheinlichkeit nach sogar schon vor einigen Tagen.«
Aus weit aufgerissenen Augen starrte Harald den Arzt an.
»Wie bitte?« fragte er, dann packte ihn die Wut. »Das ist nur ihre Schuld! Hanni wäre niemals so leichtsinnig gewesen, auf die nötigen Arztbesuche zu verzichten, wenn sie nicht ständig…«
»Von wem sprechen Sie da eigentlich?« fiel Dr. Daniel ihm behutsam ins Wort.
»Von meiner Schwiegermutter!« Harald spuckte das letzte Wort förmlich aus, dann bedachte er Dr. Daniel mit einem beinahe feindseligen Blick. »Meine Schwiegermutter betet Sie wie einen Gott an, und Hanni wollte sich nun mal nicht vorschreiben lassen, zu wem sie zu gehen hat.«
»Das ist doch überhaupt nicht wahr!« mischte sich in diesem Moment die Oberschwester ein, die offensichtlich einen Teil dieses Gesprächs mitbekommen hatte.
Verständnislos blickte Dr. Daniel von Harald zu Lena Kaufmann, wunderte sich noch über ihr bleiches, von Kummer gezeichnetes Gesicht und sah dann plötzlich klar.
»Sie, Frau Kaufmann? Sie sind die Stiefmutter meiner Patientin?«
Oberschwester Lena nickte, dann brach sie in Tränen aus.
»Du mußt hier kein Theater spielen!« herrschte Harald sie an. »Du willst doch nicht ernsthaft behaupten, es täte dir leid, daß Hanni…«
»Herr Jung, bitte«, fiel Dr. Daniel ihm jetzt energisch ins Wort. »Es ist sicher nicht nötig, in einer solchen Situation verletzend zu werden. Im übrigen bin ich sicher, daß Frau Kaufmann nicht Theater spielt. So gut kenne ich sie denn doch.«
Abschätzig blickte Harald ihn an. »Es war ja klar, daß Sie zu ihr halten würden.« Er machte auf dem Absatz kehrt und ging den Flur entlang, doch nach einigen Schritten drehte er sich wieder um. »Ich werde Hanni aus dieser Klinik holen, sobald es möglich ist. Und ich werde veranlassen, daß das tote Kind untersucht wird, und wenn es vor der Operation nicht schon tot gewesen ist, dann sind Sie die längste Zeit Arzt gewesen, das versichere ich Ihnen.«
*
Dr. Daniel brauchte ein paar Minuten, um sich von Harald Jungs dramatischen Abgang zu erholen, dann nahm er die noch immer heftig schluchzende Lena fürsorglich beim Arm und brachte sie in ein ruhiges Einzelzimmer.
»So, Frau Kaufmann, jetzt legen Sie sich erst mal ins Bett«, ordnete Dr. Daniel an. »Ich werde Ihnen ein leichtes Beruhigungsmittel geben und wenn Sie sich ein bißchen ausgeruht haben, sprechen wir in Ruhe über alles.«
Doch Lena schüttelte den Kopf. »Ich kann mich jetzt nicht einfach ins Bett legen und schlafen. Herr Doktor, ich bin schließlich im Dienst und…«
»Sie sind mit ihren Nerven am Ende, und ich vermute, die heutigen Ereignisse auf der Station waren nur noch der Tropfen, der das Faß zum Überlaufen gebracht hat«, meinte Dr. Daniel. »Die Reibereien mit Ihrer Stieftochter und Ihrem Schwiegersohn gehen ja anscheinend schon länger.«
Die Oberschwester nickte. »Seit Hanni die Wahrheit weiß…« Mit einem Taschentuch versuchte sie der vielen Tränen Herr zu werden, doch das war ein sinnloses Unterfangen.
»Sie werden sich jetzt ein bißchen ausruhen«, beschloß Dr. Daniel kurzerhand, weil er spürte, daß mit Lena in diesem Zustand nicht zu sprechen war. Er verließ für einen Moment das Zimmer, bereitete eine Injektion vor und kehrte dann zu Lena zurück. Sie saß noch so auf dem Bett, wie er sie verlassen hatte – zusammengesunken, ein Häufchen Elend.
Mit raschen, geschickten Bewegungen legte Dr. Daniel einen Gurt um ihren Oberarm, wählte gewissenhaft eine Vene aus und stach vorsichtig ein. Dann injizierte er ganz langsam die wasserhelle Flüssigkeit. Das Medikament wirkte fast augenblicklich. Widerstandlos ließ Lena es geschehen, daß Dr. Daniel ihr half sich hinzulegen, dann fielen ihr die Augen zu.
Besorgt und zutiefst erschüttert blieb Dr. Daniel noch einen Moment neben ihr stehen. Dabei wurde ihm bewußt, wie wenig er eigentlich über die Frau wußte, die so viele Jahre lang seine Sprechstundenhilfe gewesen war.
Er verließ das Zimmer, wies die Stationsschwester an, Lena nicht zu stören, und ging zur Intensivstation, um nach Hannelore Jung zu sehen, doch die diensthabende Schwester sagte ihm, die Patientin wäre in Dr. Parkers Anwesenheit kurz erwacht, aber unter den Nachwirkungen der Narkose gleich wieder eingeschlafen.
Bei der Erwähnung des Anästhesisten fiel Dr. Daniel das Gespräch wieder ein, das er noch mit Dr. Parker führen wollte.
»Ich sehe in ein paar Minuten noch einmal nach der Patientin«, erklärte er, bevor er sich auf den Weg zu seinem Büro machte.
Bei seinem Eintreten stand Dr. Parker auf und zeigte ein etwas schiefes Grinsen.
»Nun hatte ich schon fast gehofft, du hättest mich vergessen«, meinte er.
»Hätte ich auch beinahe«, gab Dr. Daniel zu. »Hoffen mußt du das allerdings nicht.«
Dr. Parker zog die Augenbrauen hoch. »Heißt das, du brummst mir keine Strafschicht auf?«
Dr. Daniel antwortete mit einer Gegenfrage: »Hattest du das denn erwartet?«
»Natürlich«, bekräftigte Dr. Parker sofort. »Immerhin habe ich es gewagt, dich zu kritisieren, und da kann ich mir an fünf Fingern ausrechnen, daß du mir das nicht ungestraft durchgehen läßt.«
Unwillig runzelte Dr. Daniel die Stirn. »Paß bloß auf, Jeff. Dein Ton fängt langsam an, mir zu mißfallen.«
Die beiden Ärzte maßen sich mit Blicken, dann senkte Dr. Parker den Kopf.
»Ich habe mich geärgert«, gestand er. »Als Oberschwester Lena gesagt hat, es gäbe einen Notfall, habe ich alles stehen und liegen lassen und bin zum Operationssaal gehetzt, dabei war ich mitten in einem Gespräch mit einem äußerst schwierigen Patienten, den ich nur mit viel Geduld dazu gebracht habe, sich mit mir zu unterhalten… seine Ängste vor der Narkose in einem eingehenden Gespräch mit mir abzubauen. Aber gut – ein Notfall ist natürlich wichtiger. Doch wenn ich dann eine halbe Stunde im OP stehe und warte, bis die Patientin, die sich während dieser ganzen Zeit ja schon in der Notaufnahme aufgehalten hat, endlich kommt, und zu guter Letzt auch noch gesagt kriege, ich solle mich mit der Narkose beeilen…«
»Es tut mir leid«, fiel Dr. Daniel ihm ins Wort.
Überrascht sah der junge Anästhesist ihn an. »Wie bitte?«
»Es tut mir leid«, wiederholte Dr. Daniel, dann seufzte er. »Hör mal, Jeff, ich weiß genau, wie dir zumute war, und ich wollte auch gar nicht, daß es zu einer solchen Verzögerung kam. Als Gerrit das OPTeam angefordert hat, mußte er noch davon ausgehen, daß es sich nur um eine akute Blinddarmentzündung handeln würde. Die Missed abortion entdeckte er erst danach, und auch für uns war es ein hartes Stück Arbeit, die Patientin davon zu überzeugen, daß ihr Baby tot ist und schnellstens geholt werden muß. Im übrigen waren meine Worte gar nicht persönlich gemeint. Ich weiß ja, wie schnell du bist.«
»Also ein typischer Fall von Überreaktion – und zwar auf beiden Seiten«, urteilte Dr. Parker, dann streckte er die rechte Hand aus. »Vergessen wir’s, Robert?«
Dr. Daniel schlug ein. »Ja, und zwar so schnell wie möglich.«
Aufmerksam betrachtete Dr. Parker seinen zukünftigen Schwiegervater. »Was bedrückt dich denn jetzt noch?«
»Mein lieber Jeff, du bist ein scharfer Beobachter«, urteilte Dr. Daniel und bemühte sich um ein Lächeln, das aber mißlang. »Was weißt du eigentlich über die Familienverhältnisse von Oberschwester Lena?«
Dr. Parker versuchte nicht einmal, seine Verwunderung zu verbergen. »Das fragst du mich? Mensch, Robert, ich bin doch hier nur Anästhesist.«
»Nur ist gut«, entgegnete Dr. Daniel. »Ohne dich und Erika könnten wir anderen Ärzte doch einpacken.«
»Übertreib mal nicht«, wandte Dr. Parker ein. »Du mußt mir keinen Honig um den Bart schmieren.« Er grinste. »Schließlich werde ich für meine Arbeit hier bezahlt.« Dann wurde er wieder ernst. »Ist etwas mit der Oberschwester?«
Dr. Daniel nickte. »Ich fürchte sogar, daß sie sehr ernsthafte Probleme hat, und dabei habe ich festgestellt, wie wenig ich über sie weiß, obwohl wir über Jahre hinweg eng zusammengearbeitet haben. Als ich mit meiner Frau und unseren beiden Kindern damals nach Steinhausen gekommen bin und die Praxis eröffnet habe, hat Frau Kaufmann bei mir als Sprechstundenhilfe angefangen. Sie hat alles mitbekommen, was mich und meine Familie anging – wie Stefan und Karina groß geworden sind, Christines Tod…« Er schwieg einen Moment mit gesenktem Kopf, weil die Erinnerung an den tragischen Tod seiner Frau sogar jetzt noch schmerzte. »Als ich nach der Beerdigung Steinhausen den Rücken kehrte, hatte Frau Kaufmann dafür vollstes Verständnis und beharrte nicht auf Einhaltung der vertraglich geregelten Kündigungsfrist. Fünf Jahre später kam ich wieder nach Steinhausen und nahm den Praxisbetrieb auf. Frau Kaufmann kehrte als Sprechstundenhilfe zu mir zurück, als hätte es die dazwischenliegenden Jahre nicht gegeben, und als Wolfgang ihr damals die Stelle der Oberschwester in der WaldseeKlinik angeboten hat, hat sie rundheraus abgelehnt, weil sie mich und die Praxis nicht im Stich lassen wollte. Erst als ich in Sarina von Gehrau eine wirklich tüchtige Nachfolgerin für Frau Kaufmann gefunden hatte, nahm sie Wolfgangs Angebot an.«
»Du magst sie sehr«, stellte Dr. Parker fest, der Dr. Daniel zugehört hatte, ohne ihn zu unterbrechen.
»Ja, Jeff, ich mag sie, und ich schätze sie, deshalb war ich auch so betroffen, als ich diese wüsten Anschuldigungen hörte, die…« Er stockte, dann seufzte er. »Darüber muß ich mit ihr selbst sprechen.« Er zwang sich zu einem Lächeln. »Danke, daß du meinem langen Vortrag so geduldig zugehört hast.«
»Schon gut«, meinte Dr. Parker lächelnd und ging zur Tür, doch dort drehte er sich noch einmal um. »Erinnerst du dich noch daran, wie ich nach Steinhausen gekommen bin – unsicher und todunglücklich?«
Dr. Daniel nickte. »Das werde ich nie vergessen, Jeff. Warum fragst du?«
»Karina hatte mir so viel von dir erzählt, und bei dem Gedanken, dich kennenzulernen, hatte ich gleich ein gutes Gefühl, aber dann… im Gespräch mit dir… mir war auf einmal, als hätte ich wieder einen Vater bekommen und daran hat sich nichts geändert.« Er schwieg kurz. »Ich bin froh, daß du mein Schwiegervater wirst.«
Dr. Daniel war über diese Worte sehr gerührt, verstand aber dennoch nicht ganz den Zusammenhang.
»Du bist mir auch auf Anhieb ans Herz gewachsen, Jeff, und ich freue mich, wenn das auf Gegenseitigkeit beruht«, meinte er, »aber was hat das alles mit Frau Kaufmann zu tun?«
Dr. Parker zuckte die Schultern. »Vielleicht… als ich auf Karinas Drängen hierherkam, da hatte ich schreckliche Angst, in meinem Beruf zu versagen. Diese Angst kam nicht von ungefähr, denn damals, in den Staaten, ist meine Verlobte bei einer Operation gestorben, wo ich die Anästhesie machte. Ich konnte nichts dafür… es lag an ihren schweren Verletzungen, aber… ich hatte trotzdem Angst. Durch dein Vertrauen in mich… durch die Sicherheit, die du mir gegeben hast, wurde ich mit meiner Angst fertig – mehr als das. Ich bin wieder ein guter Anästhesist, und das verdanke ich größtenteils dir… vielleicht verdanke ich es sogar ausschließlich dir.« Wieder schwieg er kurz. »Du hast die seltene Gabe, auf Menschen einzuwirken – in einer sehr positiven Art. Du gibst Sicherheit, behutsame Hilfen, du setzt dich für andere ein… so sehr, daß du manchmal sogar dich selbst… deine eigenen Bedürfnisse vergißt, und du kannst erst zufrieden sein, wenn die Menschen in deiner Umgebung es ebenfalls sind.« Er lächelte. »Auf diese Weise wirst du auch Oberschwester Lena helfen. Dabei ist es gar nicht so wichtig, ob du ihre Probleme wirklich lösen kannst – das einzige, was zählt, ist, daß du für sie dasein wirst… mit ihr sprechen, sie wieder aufrichten – was auch immer nötig sein wird.«
Dr. Daniel war zutiefst ergriffen, so daß er eine ganze Weile kein Wort hervorbrachte.
»Mensch, Jeff…«, murmelte er schließlich.
»Das wollte ich schon lange mal loswerden«, entgegnete Dr. Parker, dann grinste er. »Na komm, sehen wir mal nach unserer Patientin.«
Dr. Daniel war beinahe froh, daß Jeff die dienstlichen Belange wieder in den Vordergrund zog. Für das, was er für seine Patienten und auch für die Menschen in seiner Umgebung tat, wollte er gar nicht gelobt werden – wenn ihm Jeffs Worte auch sehr gut getan hatten. Ab und zu braucht jeder ein bißchen Anerkennung.
*
Als Dr. Daniel und Dr. Parker die Intensivstation betraten, merkten sie sofort, daß Hannelore Jung noch nicht ansprechbar war. Sie erwachte zwar kurzzeitig, schlief unter den Nachwirkungen der starken Narkose jedoch gleich wieder ein, und es war zu vermuten, daß sich das innerhalb der nächsten zwölf, vielleicht sogar achtzehn Stunden nicht ändern würde.
»Ich werde in regelmäßigen Abständen nach ihr sehen«, sicherte Dr. Parker zu, weil er wußte, wohin es Dr. Daniel zog.
»Danke, Jeff«, meinte er, dann machte er sich eilends auf den Weg zu dem Zimmer, wo Lena Kaufmann im Bett lag und schlief.
Dr. Daniel zog sich einen Stuhl heran und warf einen Blick auf die Uhr. Er hatte Lena kein übermäßig starkes Beruhigungsmittel gespritzt, aber sie war derlei Medikamente nicht gewohnt. Trotzdem rechnete Dr. Daniel damit, daß sie bald aufwachen müßte.
Es dauerte allerdings fast eine Stunde, bis Lena allmählich zu sich kam. Sie wollte sich rasch aufrichten, doch die Nachwirkungen des Medikaments ließen das nicht zu. Beruhigend legte Dr. Daniel eine Hand auf ihren Arm.
»Langsam, Frau Kaufmann, lassen Sie sich ruhig Zeit«, bat er mit sanfter Stimme.
»Hanni«, brachte Lena ein wenig mühsam hervor. »Was ist mit ihr?«
»Sie liegt auf der Intensivstation«, antwortete Dr. Daniel. »Allerdings nur zur Sicherheit. Die beiden Eingriffe hat sie gut überstanden.« Er schwieg kurz. »Die Seele wird zum Heilen allerdings ein bißchen länger brauchen als der Körper.«
Lena nickte. Sie war lange genug Krankenschwester, um zu wissen, wie schlimm für eine werdende Mutter eine Fehlgeburt war. Erneut wollte sie aufstehen, doch Dr. Daniel hielt sie wiederum zurück.
»Lassen Sie Ihrem Kreislauf ein bißchen Zeit, um in Schwung zu kommen.« Er lächelte ein wenig. »Sie müssen nicht gleich wieder Ihren Dienst antreten.«
Es widerstrebte der Oberschwester sichtlich, hier im Bett zu liegen.
»Ich hätte mich nicht so gehenlassen dürfen«, meinte sie und wurde dabei ganz verlegen.
»Sie haben sich nicht gehenlassen«, widersprach Dr. Daniel energisch. »Was Sie durchlitten haben, war fast ein Nervenzusammenbruch, und damit ist nicht zu spaßen. Ich möchte unter allen Umständen verhindern, daß sich Ihr momentan sehr labiler Zustand noch verschlimmert.« Er schwieg kurz. »Vorhin… als ich Sie in dieses Zimmer brachte… als Sie schlafend vor mir lagen, da wurde mir zum ersten Mal wirklich bewußt, wie wenig ich eigentlich über Sie weiß.«
Mit einer fahrigen Handbewegung strich Lena durch ihr kurzes dunkelblondes Haar.
»Das war Absicht«, gestand sie dann ein. »Ich wollte immer Beruf und Privatleben trennen. Ich habe in Ihrer Praxis und auch hier in der Klinik niemals über meine Ehe gesprochen, ebenso wie ich zu Hause auch nichts von meinem Beruf erzählte. Das war für mich die beste Lösung, um allen gerecht zu werden. Sobald ich die Praxis oder später dann die Klinik betreten habe, war ich nur noch Sprechstundenhilfe beziehungsweise Oberschwester, daheim dagegen nur Ehefrau und Mutter.« Traurig senkte sie jetzt den Kopf. »Dachte ich jedenfalls.«
»Sie haben außer Ihrer Stieftochter noch eine leibliche Tochter, nicht wahr?« hakte Dr. Daniel jetzt behutsam nach.
Lena nickte. »Hanni war vier, als Uschi geboren wurde. Horst und ich hätten gern noch mehr Kinder gehabt, doch es hat nicht mehr geklappt.«
»Uschi kann angeblich keine Kinder bekommen«, fuhr Dr. Daniel fort. »Jedenfalls behauptete das Ihre Stieftochter.«
Lena seufzte tief auf. »Das ist nicht ganz richtig. Georg, Uschis Mann, ist nicht zeugungsfähig. Allerdings haben die beiden das Thema Kinder vorerst zurückgestellt. Sie sind ja noch so jung und wollen sich mit der Familienplanung ein wenig Zeit lassen. Uschi und ich haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander, deshalb hat sie mir anvertraut, daß sie für alle Wege offen wäre – Adoption oder künstliche Befruchtung.« Sie seufzte noch einmal, dann schlug sie die Bettdecke zurück und erhob sich. »Ich muß wieder an meine Arbeit gehen.«
Dr. Daniel stand ebenfalls auf und berührte Lenas Arm. »Ich will mich nicht aufdrängen, Frau Kaufmann, aber wenn Sie mit der Situation allein nicht mehr fertig werden, dann finden Sie hoffentlich den Weg zu mir.« Er schwieg kurz. »Die massiven Anschuldigungen gegen Sie, die von Ihrer Stieftochter kamen, haben mich tief erschüttert. Sie sollen wissen, daß ich diesen Anschuldigungen keinen Glauben schenke. Ich kennen Sie nur als Sprechstundenhilfe und Oberschwester, aber in all den Jahren habe ich Sie als eine sehr warmherzige Frau kennengelernt. Das Bild, das Ihre Stieftochter gezeichnet hat, paßt überhaupt nicht in diese Vorstellung.«
Lena brachte ein mühsames Lächeln zustande. »Danke, Herr Doktor. Ich weiß Ihr Vertrauen in mich zu schätzen, und Sie können sicher sein, daß ich mich an Sie wenden werde, wenn ich das Gefühl habe, Ihre Hilfe zu brauchen.« Ein wenig verlegen senkte sie den Kopf. »Fassen Sie es nicht als mangelndes Vertrauen auf, aber… im Moment bin ich einfach noch der Ansicht, daß wir unsere Probleme innerhalb der Familie regeln müssen.«
»Dafür habe ich vollstes Verständnis«, bekräftigte Dr. Daniel. »Ich wollte Sie nur wissen lassen, daß da jemand ist, der bereit ist, Ihnen zu helfen, wenn Sie die Situation allein nicht mehr bewältigen können.«
Dankbar drückte Lena seine Hand, dann verließ sie das Zimmer und ging an ihre Arbeit, als wäre nichts geschehen.
*
Als Dr. Daniel am Abend noch einmal nach Hannelore Jung sehen wollte, saß Lena Kaufmann an ihrem Bett und streichelte behutsam über das dunkle Haar ihrer Stieftochter. Dr. Daniel zog sich so leise, wie er gekommen war, wieder zurück. Vielleicht brauchten Mutter und Tochter diese Gelegenheit, um miteinander zu sprechen, zumal Hannelore jetzt nicht mehr allzusehr unter den Nachwirkungen der Narkose zu leiden haben würde.
Dr. Daniel blieb jedoch in der Nähe, um notfalls eingreifen zu können. Schließlich wußte er, wie tief der Riß zwischen Hannelore und Lena sein mußte. Falls es also zu irgendwelchen Überreaktionen kam, wollte er rasch dazwischengehen können.
Er mußte dann auch nicht lange warten, bis Lena in Tränen aufgelöst aus der Intensivstation kam. Spontan ging Dr. Daniel ihr ein paar Schritte entgegen.
»Sie haßt mich«, stieß Lena hervor und man merkte ihr an, wie weh ihr das tat. Dann drängte sie sich an Dr. Daniel vorbei und flüchtete in Richtung Eingangshalle.
Der Arzt sah ihr besorgt nach, doch er wußte, daß es keinen Sinn hätte, ihr zu folgen. Lena mußte selbst entscheiden, ob und wann sie sich ihm anvertraute.
Mit einem Seufzer wandte sich Dr. Daniel der Intensivstation zu und trat ein. Hannelore war wach und sah ihm entgegen, wobei es dem Arzt schwerfiel, ihren Blick zu deuten.
»Wie fühlen Sie sich, Frau Jung?« fragte er besorgt.
»Wenn sie nicht an meinem Bett gesessen hätte, hätte ich mich besser gefühlt«, antwortete Hannelore prompt.
Dr. Daniel schwieg dazu. Nach dem schweren Eingriff, den Hannelore hinter sich hatte, wollte er sie nicht zur Unzeit mit einer Diskussion aufregen, die vermutlich ohnehin zu nichts führen würde. Später, wenn sie sich von der Operation erholt hatte, würde sich bestimmt eine Gelegenheit ergeben, um mit ihr zu sprechen.
»Haben Sie Schmerzen?« hakte Dr. Daniel nach.
Hannelore nickte. »Mein Bauch tut schrecklich weh.«
Spontan setzte sich Dr. Daniel zu ihr und griff nach ihrer Hand. »Die Bauchschmerzen kommen von dem gestrigen Eingriff und von den Kontraktionen der Gebärmutter, die sich jetzt wieder zurückbilden muß. In ein paar Tagen wird das vorbei sein.« Er schwieg einen Moment. »Ich weiß nicht recht, was ich Ihnen sagen soll, Frau Jung. Trostworte sind hier fehl am Platz. Für den Verlust, den Sie erlitten haben, gibt es keinen Trost, aber die Zeit wird es dennoch besser machen.«
Skeptisch sah Hannelore ihn an. »Sie denken doch etwas völlig anderes über mich. Immerhin war ich trotz meiner Schwangerschaft nicht beim Arzt und…«
»Ich finde ein solches Verhalten verantwortungslos«, stellte Dr. Daniel fest. »Aber deshalb kann ich noch lange nicht ausschließen, daß Sie sich auf Ihr Baby gefreut haben.« Er dachte einen Moment nach. »Vor einigen Jahren war bei mir einmal eine Patientin. Sie war damals ungefähr im achten Monat schwanger und ist auch nie zum Arzt gegangen, weil sie der Meinung war, es wäre nicht nötig. Als Argument brachte sie vor, ihre Großmutter hätte zehn Kinder zur Welt gebracht und wäre auch nie beim Arzt gewesen.«
Aufmerksam sah Hannelore ihn an. »Und? Brachte sie ein gesundes Kind zur Welt?«
»Ja, weil sie glücklicherweise im letzten Moment noch zu mir gekommen ist. Ihre Plazenta hatte sich vorzeitig gelöst, und wir mußten umgehend in die Klinik meines Freundes nach München fahren, denn damals gab es die WaldseeKlinik noch nicht. Ein schnellstens durchgeführter Kaiserschnitt hat sie und ihr Baby gerettet.«
Hannelore biß sich auf die Unterlippe. »Seien Sie ehrlich, Herr Doktor. Wäre mein Kind noch am Leben, wenn ich zum Arzt gegangen wäre?«
»Ich weiß es nicht«, räumte Dr. Daniel ein. »Für den sogenannten intrauterinen Fruchttod gibt es eine Vielzahl von Ursachen, darunter einige, die auch der beste Arzt nicht verhindern kann. Dazu kommt, daß Sie erst in der achtzehnten Schwangerschaftswoche waren, was bedeutet, daß Ihr Baby außerhalb des Mutterleibs auch dann nicht hätte überleben können, wenn wir noch rechtzeitig hätten eingreifen können, beispielsweise bei einer vorzeitigen Plazentalösung.« Sehr sanft drückte er Hannelores Hand. »Machen Sie sich wegen dieser nicht stattgefundenen Arztbesuche keine Gedanken mehr. Die Wahrscheinlichkeit, daß irgendein Arzt den Tod Ihres Babys hätte verhindern können, ist in meinen Augen sehr gering, wenn sie auch nicht völlig auszuschließen ist. Aber Sie machen sich verrückt, wenn Sie nur darüber nachdenken, was hätte sein können.«
Hannelore schluckte, dann gestand sie leise: »Zum ersten Mal kann ich meine Stiefmutter verstehen. Sie sind wirklich ein toller Arzt.«
Dr. Daniel lächelte. »Danke für das Kompliment.« Er zögerte, weil er zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich kein Gespräch über Lena und ihr Verhältnis zu Hannelore beginnen wollte, doch die Bemerkung der jungen Frau verführte ja beinahe dazu, dieses Thema zu ergreifen. Dr. Daniel beschloß also, zumindest einen Ansatz zu versuchen und das Gespräch unverzüglich abzubrechen, falls sich bei Hannelore Erschöpfung oder Müdigkeit zeigen würden.
»Ihre Stiefmutter arbeitet seit ungefähr zwanzig Jahren für mich«, begann Dr. Daniel, »abgesehen von einer fünfjährigen Pause, in der ich Steinhausen den Rücken gekehrt habe und nach München gegangen bin, aber das hatte rein private Gründe. Während dieser ganzen Zeit wußte ich nicht, daß es Sie und Ihre Stiefschwester überhaupt gab. Ich wußte nicht einmal etwas von Ihrem Vater.«
»Noch vor ein paar Stunden hätte ich Ihnen das nicht geglaubt, doch jetzt… ich bin sicher, daß Sie die Wahrheit sagen, auch wenn ich nicht begreifen kann, weshalb meine Stiefmutter ein solches Geheimnis um ihre Familie gemacht hat.« Sie wich Dr. Daniels Blick aus. »Dabei könnte ich noch verstehen, daß sie meine Existenz verschwiegen hat. Aber Uschi… sie ist doch ihre leibliche Tochter.«
»Ihre Stiefmutter wollte Beruf und Privatleben stets strikt trennen – das hat sie mir heute gesagt«, entgegnete Dr. Daniel, dann griff er nach Hannelores Hand und hielt sie fest. »Warum sind Sie so überzeugt davon, daß Ihre Stiefmutter Sie nicht mag? In all den Jahren habe ich Frau Kaufmann als eine sehr warmherzige Person kennengelernt.«
»Das kann schon sein«, räumte Hannelore ein. »Ich streite auch gar nicht ab, daß sie mich anfangs vielleicht sogar gemocht hat, aber als Uschi geboren wurde… es ist doch ganz natürlich, daß sie ihre leibliche Tochter lieber mag als mich.«
»Ich habe von meiner ersten Frau zwei leibliche Kinder«, erklärte Dr. Daniel. »Mein Sohn Stefan macht in München gerade seinen Facharzt, und meine Tochter Karina arbeitet als Assistenzärztin in der ThierschKlinik. Darüber hinaus haben meine zweite Frau und ich vor einem Jahr ein kleines Mädchen adoptiert – Tessa. Sie ist jetzt sechs und unser ganz besonderer Sonnenschein.«
Hannelore nickte. »Ihr Sohn und Ihre Tochter sind erwachsen, die Kleine noch ein Kind. Da ist es ganz normal, daß Sie sie liebhaben. Aber was glauben Sie, was passieren würde, wenn Sie und Ihre jetzige Frau ein leibliches Kind bekommen würden?« Sie ließ Dr. Daniel gar nicht erst antworten, sondern fügte leise hinzu: »Tun Sie das Ihrer Tessa niemals an.«
Übergangslos schlief Hannelore nach diesen Worten ein. Nachdenklich blieb Dr. Daniel an ihrem Bett sitzen und dachte ernsthaft darüber nach, wie er empfinden würde, wenn Manon von ihm ein Baby bekommen würde. Im Grunde war es Utopie, an so etwas überhaupt noch zu denken. Immerhin war er Anfang Fünfzig und Manon auch schon über vierzig. Trotzdem wäre es ja nicht unmöglich für sie, noch ein eigenes Kind zu haben. Vielleicht würden sie dann, ohne es zu wollen, Tessa tatsächlich ein wenig vernachlässigen?
Dabei kam Dr. Daniel der Gedanke, daß im Fall von Hannelore und Lena beide Frauen in gewisser Weise recht hatten. Er war sicher, daß Lena ihrer Stieftochter niemals hatte wehtun wollen, und wenn sie Uschi ihrer Stieftochter vorgezogen hatte, dann war das sicher nicht absichtlich geschehen. Andererseits lag Hannelore mit ihren Empfindungen möglicherweise nicht ganz falsch, und Lena hatte sie im Vergleich mit Uschi wirklich ein wenig vernachlässigt.
*
Harald Jung hatte seine Drohung wahrgemacht und durchgesetzt, daß der tote Fetus von einem unabhängigen Arzt untersucht wurde. Allerdings gab das Ergebnis dieser Untersuchung Dr. Daniel und Dr. Scheibler in vollem Umfang recht. Bereits fünfzehn Tage vor dem Eingriff durch Dr. Daniel war der Fetus im Mutterleib abgestorben.
Das rasche Handeln der Ärzte aus der WaldseeKlinik bewahrte die werdende Mutter vor dem sicheren Tod, führte der Arzt zum Ende seines Gutachtens noch aus.
»Da hatten Sie aber Glück«, knurrte Harald Jung unwillig, als er das Gutachten gelesen hatte.
»Nein, Herr Jung, mit Glück hatte das wenig zu tun«, widersprach Dr. Daniel ernst. »Dieses Gutachten beweist, daß an der WaldseeKlinik keine Stümper, sondern qualifizierte Ärzte arbeiten.«
Harald zuckte die Schultern. »Wie auch immer. Sobald Sie meine Frau endlich aus der Intensivstation entlassen, werde ich sie unverzüglich in ein anderes Krankenhaus bringen.«
»Und warum?« hakte Dr. Daniel nach. »Hat Ihre Frau Ihnen gegenüber erwähnt, daß sie sich hier nicht gut versorgt fühlt?«
»Das hat damit überhaupt nichts zu tun«, entgegnete Harald von oben herab. »Ich will nicht, daß meine Frau mehr Zeit als unbedingt nötig mit ihrer Stiefmutter verbringen muß. Und auch Ihre Anwesenheit stört mich. Sie stecken mit meiner Schwiegermutter doch unter einer Decke.«
»Hier steckt niemand mit irgend jemandem unter einer Decke«, stellte Dr. Daniel klar. »Im übrigen bin ich der Meinung, daß Sie den Unfrieden zwischen Ihrer Frau und deren Stiefmutter nicht noch zusätzlich anfachen sollten. Es wäre doch allen gedient, wenn man versuchen würde, einigermaßen…«
»Das geht Sie überhaupt nichts an«, fiel Harald ihm energisch ins Wort.
»Das ist nur bedingt richtig«, entgegnete Dr. Daniel mit unerschütterlicher Ruhe. »Ihre Frau ist zur Zeit meine Patientin, und Ihre Schwiegermutter ist meine Angestellte. Daher geht mich diese unerfreuliche Familiensituation sehr wohl etwas an. Immerhin muß ich dafür sorgen, daß Ihre Frau wieder gesund wird, und da sie durch die Fehlgeburt vor allem seelisch sehr angeschlagen ist, wäre ein harmonisches Umfeld außerordentlich wichtig. Darüber hinaus trage ich die Sorge für meine Angestellte, die unter derart ungünstigen Bedingungen nicht so zuverlässig arbeiten kann, wie es aufgrund ihrer Stellung hier wohl nötig wäre.«
Angewidert schaute Harald den Arzt an. »Sie verstehen es ja ausgezeichnet, alles so hinzudrehen, daß Sie sich kräftig einmischen können.«
Sehr ernst erwiderte Dr. Daniel seinen Blick. »Sie haben es vielleicht noch nicht begriffen, aber ich will mich nicht einfach einmischen, wie Sie es bezeichnen, sondern ich versuche zu helfen. Das ist ein sehr großer Unterschied.« Er schwieg kurz. »Im übrigen wäre meine Mithilfe vielleicht gar nicht nötig, wenn die Familienmitglieder nur untereinander versuchen würden, wenigstens einigermaßen friedlich und harmonisch miteinander zu leben.«
Harald zuckte bei Dr. Daniels Worten zusammen wie unter einem Schlag – für den Arzt ein untrügliches Zeichen, daß der junge Mann an den unerfreulichen Zuständen nicht ganz unschuldig war.
Mit einem Ruck drehte sich Harald um, ließ Dr. Daniel einfach stehen und betrat die Intensivstation.
»Hanni, ich möchte dich so schnell wie möglich aus diesem Krankenhaus holen«, hörte Dr. Daniel ihn sagen. Er vermutete ganz richtig, daß Harald absichtlich so laut gesprochen hatte.
Erstaunt sah Hannelore ihren Mann an. Sie fühlte sich körperlich schon wieder recht gut, und Dr. Daniel hatte ihr gesagt, daß er sie höchstens noch einen oder zwei Tage auf der Intensivstation behalten würde.
»Warum denn?« fragte sie jetzt. »Ich fühle mich hier sehr gut versorgt.«
»So? Und was ist mit deiner Stiefmutter? Gefällt es dir jetzt plötzlich, ihr jeden Tag zu begegnen?« erkundigte sich Harald ihn herausforderndem Ton.
»Ich begegne ihr nicht jeden Tag«, entgegnete Hannelore. »Genaugenommen habe ich sie seit jenem Abend nach der Operation gar nicht mehr gesehen, weil sie meine Wünsche in dieser Richtung respektiert. Auch Dr. Daniel tut das.« Sie schwieg kurz. »Im übrigen ist er ein erstklassiger Arzt, zu dem ich großes Vertrauen habe. Ich möchte nicht weg von hier.«
»Auf einmal hast du zu ihm großes Vertrauen«, entgegnete Harald beinahe höhnisch. »Dabei hast du früher jedesmal rot gesehen, wenn nur sein Name gefallen ist.«
»Da war ich noch voreingenommen«, gab Hannelore unumwunden zu, dann senkte sie den Kopf. »Ich wünschte, ich hätte… ich wäre nicht so stur gewesen. Der Gedanke, daß Dr. Daniel meinem Baby vielleicht hätte helfen können… daß es nicht gestorben wäre, wenn ich zu den Vorsorgeuntersuchungen gegangen wäre…«
»Hat er dir diesen Unsinn etwa eingeredet?« fiel Harald ihr barsch ins Wort.
Hannelore schüttelte den Kopf. »Nein, ganz im Gegenteil.« Sie schwieg kurz. »Ich selbst mache mir diese Gedanken.« Unwillkürlich berührte sie ihren Bauch. »Ich hatte mich auf das Baby gefreut.«
Harald ergriff für einen Augenblick ihre Hand. »Du solltest nicht weiter darüber nachgrübeln. Wir werden wieder ein Baby haben können.« Seine Worte sollten tröstlich klingen, aber es fehlte ihnen jegliche Wärme und Herzlichkeit. Er sagte es, als hätte Hannelore ein nicht besonders wertvolles Schmuckstück verloren, das man bei Gelegenheit durch ein neues ersetzen könnte.
*
Die Nachmittagssprechstunde in der Praxis von Dr. Daniel zog sich wieder einmal in die Länge, aber das war ja nichts Außergewöhnliches. Sowohl Dr. Daniel als auch seine Sprechstundenhilfe und seine Empfangsdame waren an Überstunden gewöhnt. Trotzdem atmete der Arzt an diesem Abend auf, als er gegen acht Uhr endlich die letzte Patientin verabschieden konnte.
Dr. Daniel warf einen Blick ins Labor, wo seine Sprechstundenhilfe Sarina von Gehrau noch immer beschäftigt war.
»Gehen Sie nach Hause, Fräulein Sarina«, bat er. »Der Tag war heute lang genug.«
»Ich wollte eigentlich noch…« begann Sarina, doch Dr. Daniel fiel ihr ins Wort.
»Wenn Ihnen Ihr Chef sagt, daß Sie die restliche Arbeit morgen erledigen können, dürfen Sie das auch ruhig tun«, meinte er lächelnd, dann wandte er sich der jungen Gabi Meindl zu, die jetzt ihren Computer ausschaltete und die Ansage auf dem Anrufbeantworter überprüfte.
»Fräulein Meindl, seien Sie doch bitte noch so lieb, und rufen Sie kurz bei meiner Frau oben an«, bat Dr. Daniel. »Sagen Sie ihr, daß ich zur WaldseeKlinik muß und voraussichtlich erst in einer Stunde zu Hause sein werde.«
Mißbilligend schüttelte Gabi den Kopf. »Sie sollten jetzt aber auch Feierabend machen, Herr Doktor. Wie Sie zu Sarina sagten – der Tag war lang genug.«
Die junge Sprechstundenhilfe nickte zustimmend zu den Worten ihrer Kollegin.
»Gabi hat ganz recht«, bekräftigte sie nun.
Die Besorgnis seiner beiden Damen rührte Dr. Daniel, aber dennoch ließ er sich von seinem gefaßten Entschluß nicht abbringen.
»Ich verspreche, daß ich mich in der Klinik nicht lange aufhalten werde«, versicherte er schmunzelnd.
Gabi seufzte abgrundtief.
»Das glauben Sie ja selber nicht«, entfuhr es ihr.
Dr. Daniel mußte lachen. »Sie kennen mich leider viel zu gut.« Er sah auf die Uhr. »Jetzt muß ich aber wirklich los.«
»Ich sage Ihrer Frau Bescheid«, versprach Gabi, »und anschließend sperren wir die Praxis ab.«
Dr. Daniel bedankte sich, verabschiedete sich von seinen beiden Damen und eilte aus der Praxis. Kurz darauf betrat er die WaldseeKlinik und ging sofort zur Intensivstation.
»Es tut mir leid, daß ich so spät komme«, entschuldigte er sich bei Hannelore, überprüfte mit geschultem Blick ihre Werte, die von den Monitoren angezeigt wurden, und nahm eine behutsame Untersuchung vor, dann lächelte er sie an. »Ich glaube, Sie waren jetzt lange genug auf Intensiv. Gleich morgen früh werde ich veranlassen, daß Sie auf die normale Station kommen.« Er schwieg kurz. »Ich glaube, Ihr Mann würde Sie gern in eine andere Klinik verlegen lassen.«
»Ich möchte aber hierbleiben«, entgegnete Hannelore entschieden. »Sie haben mir schließlich das Leben gerettet, also wäre es in höchstem Maße undankbar von mir, jetzt einfach zu gehen. Im übrigen fühle ich mich hier sehr gut versorgt.«
Dr. Daniel lächelte. »Das höre ich natürlich gern. Also, Frau Jung, gleich morgen früh bekommen Sie ein hübsches Zimmer mit Blick auf den Park.«
Auch Hannelore lächelte. »Danke, Herr Doktor – und zwar für alles.«
*
Nach dem Gespräch mit Hannelore suchte Dr. Daniel die Nachtschwester Irmgard Heider auf und informierte sie über die geplante Verlegung der Patientin auf die normale Station.
»Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Doktor, ich werde morgen früh gleich veranlassen, daß Frau Jung auf die Gynäkologie kommt«, versicherte Irmgard und machte sich gleich eine Notiz für die morgige Dienstübergabe.
Dr. Daniel wußte, daß er sich auf die Nachtschwester verlassen konnte. Auf die ihm eigene, herzliche Art verabschiedete er sich von Irmgard, wünschte ihr eine ruhige Nachtschicht und wollte dann die Klinik verlassen, doch als er die Eingangshalle durchquerte, entdeckte er eine Frau, die zusammengesunken auf einer der Kunststoffbänke saß.
Verwundert ging Dr. Daniel auf sie zu und erkannte erst beim Näherkommen, daß es sich bei dieser Frau um die Oberschwester Lena Kaufmann handelte.
»Frau Kaufmann, was ist denn los?« fragte er besorgt.
Langsam hob sie den Kopf, und Dr. Daniel erkannte mit Schrecken, wie sehr sie sich in den vergangenen Tagen verändert hatte. Ihre Unterlippe zitterte, und in den traurigen Augen, die von schlaflosen Nächten zeugten, standen Tränen.
»Herr Doktor«, brachte sie mit bebender Stimme hervor. »Ich glaube… ich glaube, jetzt brauche ich Ihre Hilfe doch.«
Fürsorglich legte Dr. Daniel einen Arm um ihre Schultern und begleitete sie zu seinem Auto.
»Kommen Sie, Frau Kaufmann, fahren wir zu mir nach Hause«, schlug er vor. »Da können wir uns ungestört unterhalten.«
Lena blickte in die herrschende Dunkelheit. »Es ist schon so spät. Ihre Frau wird auf Sie warten.«
»Sie kennen meine Frau und wissen, daß sie Verständnis haben wird«, entgegnete Dr. Daniel ruhig.
Lena nickte. »Ich bin heute allein zu Hause – jedenfalls bis zehn Uhr abends. Mein Mann hat Spätschicht…«
Dr. Daniel verstand. Offensichtlich wollte Lena ihm Einblick in ihr Privatleben geben. Dieses Angebot durfte er nicht ausschlagen.
»Gut, Frau Kaufmann, fahren wir zu Ihnen«, stimmte Dr. Daniel zu, dann griff er nach dem Hörer des Autotelefons. »Ich sage nur rasch meiner Frau Bescheid, damit sie sich keine Sorgen macht.«
Wie Dr. Daniel erwartet hatte, zeigte Manon tatsächlich Verständnis.
»Ich bin auch nicht allein«, beruhigte sie ihren Mann. »Jeff und Karina sind auf ein Gläschen Wein herübergekommen.«
Das schmerzte Dr. Daniel nun ein wenig. Seit seine Tochter zu ihrem Verlobten gezogen war, sah er sie nur noch selten, obwohl die beiden hier in Steinhausen, nur ein paar hundert Meter von der DanielVilla entfernt lebten, aber Karina war durch ihre Tätigkeit als Assistenzärztin in der Münchener ThierschKlinik eben auch sehr eingespannt.
»Grüß’ die beiden ganz lieb von mir«, bat Dr. Daniel. Seine Frau wußte genau, was er gern hinzugefügt hätte, doch das konnte er nicht, ohne in Lena ein schlechtes Gewissen zu wecken, weil sie ihn durch ihre Belange von seiner Familie fernhielt.
»Sie werden bestimmt noch da sein, wenn du kommst«, versicherte Manon.
»Danke, Liebes«, erwiderte Dr. Daniel mit einem zärtlichen Lächeln, dann verabschiedete er sich und legte auf.
»Ich halte Sie von Ihrem verdienten Feierabend ab«, stellte Lena leise fest.
Spontan legte Dr. Daniel eine Hand auf ihren Arm.
»Nein, Frau Kaufmann, ich bin doch froh, daß Sie sich mir anvertrauen«, entgegnete er.
Wenig später hielt er vor dem schmucken Reihenhaus an, das die Kaufmanns bewohnten. Üppige Blumenrabatten zierten den gepflasterten Weg, der zur Haustür führte, und obwohl es jetzt dunkel war und die Straßenlaternen nur ein schwaches Licht gaben, konnte sich Dr. Daniel vorstellen, wie schön diese Blumen bei Tageslicht aussehen mußten.
Hinter Lena betrat er das Reihenhaus und war nicht sonderlich überrascht, als er die geschmackvolle Einrichtung sah. Von der Diele führte ein ganz mit Zimmerefeu bewachsener Durchgang in das gemütliche Wohnzimmer. Handgeknüpfte Läufer gaben dem Raum eine warme, heimelige Atmosphäre. Die Blumen an dem großen Fenster zeugten von einer glücklichen Gärtnerhand.
Dann fiel Dr. Daniels Blick auf ein gerahmtes Familienfoto, das zwischen nostalgischen SchwarzweißAufnahmen an der Wand hing. Lena folgte seinem Blick.
»Das ist ein Bild aus glücklichen Tagen«, erklärte sie leise. »Damals war unsere Welt noch in Ordnung.« Sie trat neben Dr. Daniel und betrachtete wehmütig das Foto, das sie, ihren Mann Horst und die beiden Mädchen Hannelore und Uschi zeigte, die damals zehn und zwölf Jahre alt gewesen sein mochten. Dazwischen saß ein großer, wuscheliger Hund, dessen offenes Maul mit der heraushängenden Zunge den Anschein gab, als würde er lachen.
»Was ist denn das für ein fröhlicher Zeitgenosse?« wollte Dr. Daniel dann auch schon wissen.
Ein Lächeln erhellte Lenas Gesicht für einige Augenblicke. »Das war Major«, antwortete sie. »Horst hat ihn als Welpen mit in die Ehe gebracht. Er trug seinen Namen zu Recht. Wir standen alle unter seinem Regiment.« Ihr Gesicht wurde wieder traurig. »Als er starb, haben wir wochenlang geweint, und ohne daß wir je darüber gesprochen hätten, waren wir uns einig, daß Major keinen Nachfolger haben sollte.«
Dr. Daniel nickte. »Das kann ich gut verstehen. Man kann ein Tier, das ein langes Stück Weg mit einem gegangen ist, nicht einfach durch ein neues ersetzen.«
Noch einmal betrachtete Lena das Foto voller Wehmut, dann drehte sie sich um. Ihre Bewegung hatte etwas Endgültiges an sich – so, als wolle sie nie wieder an die Vergangenheit erinnert werden.
»Bitte, Herr Doktor, nehmen Sie doch Platz«, bot sie an. »Darf ich Ihnen etwas zu trinken bringen? Wein, Bier oder vielleicht einen Kaffee?«
Mit einer Hand fuhr sich Dr. Daniel durch das blonde Haar. Die Aussicht auf ein kühles Bier war nach dem langen, anstrengenden Tag sehr verlockend, doch der Arzt gab dem Drang nicht nach.
»Angesichts der Tatsache, daß ich mit dem Auto hier bin, wäre wohl ein Kaffee das Beste«, meinte er.
»Fühlen Sie sich in der Zwischenzeit ganz wie zu Hause, Herr Doktor«, entgegnete Lena. »Ich werde mich beeilen.«
Es dauerte auch wirklich nicht lange, bis sie mit einem Tablett zurückkehrte, Tassen und Teller auf den blankpolierten Tisch mit der Marmorplatte stellte und schließlich eine Kanne Kaffee und einen Teller mit Gebäck holte.
»Ich nehme an, es geht um die unerfreuliche Situation zwischen Ihnen und Ihrer Stieftochter«, eröffnete Dr. Daniel das Gespräch, weil Lena beharrlich schwieg.
Jetzt schüttelte sie den Kopf. »Nein, Herr Doktor.« Mit einer Hand bedeckte sie ihre Augen und versuchte vergeblich, ein heftiges Aufschluchzen zu unterdrücken. Erst nach einigen Minuten konnte sie fortfahren: »Verstehen Sie mich nicht falsch. Das gestörte Verhältnis zu Hanni macht mir schwer zu schaffen, doch jetzt… jetzt ist unsere ganze Zukunft in Gefahr. Horst… mein Mann…« Sie preßte eine Hand vor den Mund. »Er hat kein Wort darüber verloren, aber… ich habe es gesehen. Herr Doktor, er hat… er hat Blut im Urin und ich kenne ihn… er geniert sich viel zu sehr, um mit solchen Beschwerden zum Arzt zu gehen, noch dazu… Ihre Frau ist hier in Steinhausen die einzige Allgemeinmedizinerin. Wenn Horst zu ihr sagen müßte…« Sie schluchzte auf. »Ich habe Angst um ihn. Seit Hanni mir so feindselig gegenübersteht, ist unsere ganze Familiensituation schwierig geworden, aber wenn ich nun auch noch den Menschen verliere, der mir auf dieser Welt neben meinen Töchtern das meiste bedeutet…« Sie konnte den Satz nicht beenden.
Dr. Daniel ahnte, welche Art Hilfe Lena erwartete.
»Sie wollen, daß ich mit Ihrem Mann spreche, nicht wahr?« meinte er und fügte hinzu: »Glauben Sie nicht, daß es für Ihren Mann ebenso unangenehm sein könnte, von einem Gynäkologen auf sein Problem angesprochen zu werden?«
Lena vergrub das Gesicht in den Händen. »Was müssen Sie nur von mir denken?«
Behutsam legte Dr. Daniel eine Hand auf ihre Schulter. »Frau Kaufmann, ich verstehe Ihre Angst. Sie wissen, unter welch tragischen Umständen ich meine erste Frau verloren habe, ich kann also sehr gut nachfühlen, was in Ihnen vorgeht.« Er überlegte kurz. »Wann kommt Ihr Mann heute nach Hause?«
Lena warf einen Blick auf die Uhr. »In einer halben Stunde.«
Dr. Daniel überlegte einen Moment. »Vielleicht wäre es das Beste, wenn wir gemeinsam mit ihm sprechen würden. Dabei sollten wir aber nicht auf sein persönliches Problem eingehen, sondern das Gespräch über einen erfundenen Vergleichsfall führen.«
Lena verstand, was Dr. Daniel meinte. »Ja, Sie haben recht. Damit würden wir möglicherweise mehr erreichen.«
»Darüber hinaus hätte Ihr Mann nicht das Gefühl, bloßgestellt zu werden.« Dr. Daniel schwieg kurz. »Wenn er sich vor meiner Frau wirklich genieren sollte, dann könnte er zur Untersuchung ja auch in die WaldseeKlinik kommen. Dr. Scheibler würde die nötigen Tests jederzeit vornehmen.«
»Ja, ich weiß«, flüsterte Lena. Dr. Daniel hörte die Angst aus ihrer Stimme heraus.
Tröstend griff er nach ihrer Hand und hielt sie fest.
»Frau Kaufmann, Sie sind Krankenschwester, daher wissen Sie, daß Blut im Urin ein ernstes Zeichen ist«, meinte er. »Sie wissen aber auch, daß es keineswegs hoffnungslos sein muß.«
Lena nickte nur, dann blickte sie zur Tür. Fast im selben Moment wurde der Schlüssel im Schloß gedreht und ein großer, schlanker Mann trat in den Flur. Als er das Licht einschaltete, konnte Dr. Daniel ihn von seinem Platz aus sehr gut sehen. Er schätzte ihn auf Mitte Fünfzig, sein früher dunkles Haar war von zahlreichen Silberfäden durchzogen, die Schläfen hatten sich schon völlig grau gefärbt. Trotzdem war er ein äußerst gut aussehender Mann mit schmalem Gesicht und wachen grauen Augen, die von sehr viel Herzenswärme zeugten.
Mit einem zärtlichen Lächeln stand Lena auf, ging ihm entgegen und begrüßte ihn sehr liebevoll.
»Wir haben Besuch, Horst«, erklärte sie dann. »Das ist Dr. Daniel.«
»Herr Dr. Daniel, wie schön, daß ich Sie endlich kennenlernen darf«, meinte Horst Kaufmann, und sein Lächeln zeugte davon, daß seine Worte ehrlich gemeint waren. »Wissen Sie, meine Frau hat nie über ihren Beruf gesprochen und auch über Sie nur sehr wenig erzählt, aber jedesmal, wenn sie Ihren Namen aussprach, schwang darin so viel Hochachtung mit, daß ich mir vorstellen konnte, was für ein außergewöhnlicher Mensch Sie sein müssen.«
»Na, jetzt machen Sie mich ja richtig verlegen, Herr Kaufmann«, entgegnete Dr. Daniel und lächelte ebenfalls. »Bei mir war es ähnlich. Mir gegenüber hat sich ihre Frau, was ihr Privatleben betrifft, in absolutes Schweigen gehüllt. Ehrlich gesagt, habe ich erst vor ein paar Tagen erfahren, daß es Sie und Ihre beiden Töchter überhaupt gibt.«
Ein Schatten huschte bei diesen Worten über Horsts Gesicht, doch er hatte sich rasch wieder in der Gewalt.
»Hast du für mich auch Kaffee gemacht?« fragte er. »Oder darf ich bei eurem vermutlich beruflich bedingten Gespräch nicht dabeisein… wegen der Schweigepflicht?«
Dr. Daniel beschloß, die günstige Gelegenheit gleich beim Schopf zu ergreifen.
»Nein, nein, Herr Kaufmann, so berufsbezogen war unser Gespräch gar nicht, obwohl…« Er sah Lena an. »Der Fall dieses jungen Mannes ist tatsächlich recht tragisch, nicht wahr?«
Lena nickte nur, dann verließ sie rasch den Raum, um eine weitere Tasse zu holen, während Horst und Dr. Daniel Platz nahmen.
»Wir hatten uns vorhin über einen Patienten unterhalten, der unglücklicherweise sehr spät zu uns in die Klinik gekommen ist«, fuhr Dr. Daniel fort. »Dabei hatte er sehr ernste Symptome wie Blut im Urin.« Er sah, wie Horst errötete, ging aber darüber hinweg und seufzte. »Es ist nur schwer verständlich, warum manche Leute wirklich bis zum Schluß warten, ehe sie sich einem Arzt anvertrauen.«
Horst nickte, obwohl wenig überzeugt.
»Sind Sie nicht dieser Meinung?« hakte Dr. Daniel sofort nach.
»Doch, eigentlich schon«, murmelte Horst. »Allerdings… gerade in einem solchen Fall… ich glaube, ich würde mich ebenfalls genieren, so etwas einem Arzt zu sagen.« Er zuckte die Schultern. »Vielleicht wurden wir einfach noch zu… wie soll ich sagen… zu altmodisch erzogen. Alles, was unterhalb der Gürtellinie war, durfte nicht erwähnt werden.«
»Blut im Urin kann ein erstes Anzeichen für eine sehr ernste, manchmal lebensbedrohende Krankheit sein«, entgegnete Dr. Daniel. »In einem solchen Fall könnte falsche Scham das eigene Todesurteil bedeuten.«
Horst erschrak sichtlich. »Wirklich?« Er hatte Mühe, sich zu fassen, und schwenkte dann auf das ursprüngliche Thema ein. »Bei diesem jungen Mann… ist es da schon… zu spät?«
Dr. Daniel schüttelte den Kopf. »Nein, er kam gerade noch rechtzeitig in unsere Klinik. Dr. Scheibler, unser Chefarzt, hat gleich die nötigen Untersuchungen durchgeführt. Jetzt können wir den jungen Mann gezielt behandeln.«
Horst versank in nachdenkliches Schweigen.
»Was für Untersuchungen werden in einem solchen Fall eigentlich gemacht?« erkundigte er sich schließlich und fügte errötend hinzu: »Ich frage nur aus Interesse.«
Dr. Daniel nickte. Er sah, wie Lena mit der Kaffeetasse abwartend an dem Durchgang zum Wohnzimmer stehenblieb, weil sie dieses Gespräch nicht unterbrechen wollte.
»Zuerst werden Untersuchungen aus dem Urin durchgeführt, anschließend Ultraschallaufnahmen und möglicherweise Röntgenbilder gemacht«, antwortete Dr. Daniel. »Letzteres oftmals mit Hilfe eines Kontrastmittels. Wenn sich nach diesen Untersuchungen ein begründeter Verdacht auf Tumore in der Harnblase ergibt, wird sich dann auch noch eine sogenannte Zystoskopie, eine Blasenspiegelung anschließen.«
Horst schluckte schwer. »Das klingt aber ziemlich unangenehm.«
»Dr. Scheibler ist ein erstklassiger Arzt«, betonte Dr. Daniel, »der sämtliche Untersuchungen äußerst rücksichtsvoll vornimmt. Eine Blasenspiegelung wird in solchen Fällen sogar oftmals unter Vollnarkose durchgeführt, weil sie für Männer allgemein unangenehmer, meistens sogar schmerzhafter ist als für Frauen.«
Horst nickte, dann wechselte er abrupt das Thema. In diesem Moment trat auch Lena wieder zu den beiden Männern und stellte die Kaffeetasse für Horst auf den Tisch. Dabei fing Dr. Daniel einen dankbaren Blick von ihr auf.
Er plauderte noch ein bißchen mit dem Ehepaar, bemerkte die tiefe Verbundenheit, die zwischen Lena und Horst herrschte, und verabschiedete sich schließlich.
»Ich glaube, ich habe ihn zumindest nachdenklich gemacht«, meinte Dr. Daniel, als Lena ihn hinausbegleitete. »Nun sollten Sie versuchen, ihn mit seinen Beschwerden direkt zu konfrontieren. Vielleicht können Sie es einrichten, daß Sie ihn einmal in der Toilette überraschen.« Mit einem verlegenen Lächeln zuckte er die Schultern. »Das ist vermutlich nicht die feinste Art, aber wenn er innerhalb der nächsten Tage nicht von sich aus etwas unternimmt, wird es wohl Ihre einzige Möglichkeit sein, ihn zum Arztbesuch zu drängen.«
Dankbar drückte Lena seine Hand. »Ich bin wirklich sehr froh, daß Sie mit Horst gesprochen haben.«
Dr. Daniel lächelte. »Das war doch selbstverständlich, Frau Kaufmann.« Er wurde wieder ernst. »Ich hoffe, daß er bald zu uns in die Klinik kommen wird.«
*
Hannelore Jung erholte sich in körperlicher Hinsicht relativ schnell von den beiden Eingriffen. Wie sehr sie unter dem Verlust ihres Babys litt, konnte Dr. Daniel nur vermuten, denn in dieser Richtung erzählte Hannelore ihm kaum etwas. Das lag nicht an mangelndem Vertrauen, sondern daran, daß es ihr schwerfiel, darüber zu sprechen.
Auch zu Harald sagte sie nichts mehr über den Schmerz, der noch in ihr tobte, weil sie fühlte, daß er dafür wenig Verständnis aufbrachte. Er empfand die Fehlgeburt vermutlich schon als schlimm, dachte aber wohl, daß Hannelore jung genug sei, um erneut schwanger zu werden.
Vorsichtig versuchte Hannelore aufzustehen. Dr. Daniel hatte ihr kleine Spaziergänge erlaubt, und die junge Frau sehnte sich nach dem langen Aufenthalt in der Intensivstation und den vergangenen Tagen, die sie zwar hier in dem hübschen Einzelzimmer aber eben auch im Bett hatte verbringen müssen, nach ein bißchen frischer Luft.
Langsam, weil die Bauchschmerzen beim Gehen schlimmer waren, verließ Hannelore ihr Zimmer und ging zum Lift, der sie das eine Stockwerk nach unten brachte. Durch den rückwärtigen Ausgang verließ sie die Klinik und spazierte gemächlich über die gewundenen Pfade, die durch den Park führten. Entzückt sah sich Hannelore um. Dieser Klinikpark mit den schattenspendenden Bäumen und dem blumenübersäten Rasen hatte mehr Ähnlichkeit mit einer natürlich entstandenen, bunten Almwiese als mit einem eigens angelegten Park.
Hannelore war von diesem beschaulichen Fleckchen so angetan, daß sie bis zum Waldsee hinunter ging, der idyllisch zwischen alten Baumriesen lag. Unwillkürlich dachte Hannelore, wie schön es sein müßte, in diesem zauberhaften See zu schwimmen. Vorsichtig ging sie in die Hocke und tauchte die Fingerspitzen in das glasklare Wasser, zog sie aber schnell wieder zurück.
»Puh, ist das kalt«, murmelte sie.
»Der See wird von einer eisigen Bergquelle gespeist«, erklang hinter ihr ganz unerwartet die Stimme eines Mannes.
Erschrocken blickte sich Hannelore um und wollte wieder aufstehen, was ihr jedoch nicht ganz einfach fiel. Der junge Mann griff helfend an ihren Arm.
»Fühlen Sie sich nicht gut?« fragte er dabei besorgt.
»Doch, doch, es geht schon«, beeilte sich Hannelore zu versichern, dann lächelte sie ein wenig. »Ich schätze, ich habe mir mit diesem Spaziergang doch ein bißchen zuviel zugemutet. Dr. Daniel würde sicher schimpfen, wenn er wüßte, wie weit ich gegangen bin. Eigentlich hat er mir nämlich nur kleine Spaziergänge erlaubt.«
»Da drüben steht eine Bank«, meinte der junge Mann hilfreich. »Ich würde vorschlagen, wir setzen uns ein wenig und wenn Sie sich ein bißchen ausgeruht haben, begleite ich Sie zur Klinik zurück.« Er lächelte auf eine sehr einnehmende, sympathische Art. »Ich bin nämlich ebenfalls auf dem Weg dorthin, weil ich meine Schwester besuchen möchte.«
»Ist sie auch eine Patientin von Dr. Daniel?« fragte Hannelore impulsiv, dann errötete sie ein wenig. »Entschuldigen Sie, das geht mich natürlich gar nichts an.«
Der junge Mann lachte. »Nicht so tragisch. Und um Ihre Frage zu beantworten: Nein, meine Schwester ist nicht als Patientin in der Klinik, sondern als Ärztin. Dr. Alena Reintaler.«
Hannelore nickte. »Frau Dr. Reintaler ist bei der Visite immer dabei. Sie ist sehr nett.«
Der junge Mann grinste. »Es wird sie freuen, das zu hören. Mich natürlich auch«, fügte er mit schelmischem Blick hinzu. »Immerhin verdankt Alena es ausschließlich mir und meinem streikenden Auto, daß sie hier ist.«
Verständnislos blickte Hannelore ihn an. »Wie soll ich das verstehen?«
»Ganz einfach. Mein Schwesterchen und ich waren damals auf dem Weg nach Südtirol, doch kurz vor Steinhausen hat mein Auto seinen Geist aufgegeben. Wir mußten uns hier im Ort für einige Tage ein Zimmer nehmen und als Alena während eines Spaziergangs mit mir die WaldseeKlinik gesehen hat, stand ihr Entschluß fest: Hier wollte sie arbeiten, sonst nirgends.«
Die Art, wie dieser junge Mann die kurze Geschichte erzählt hatte, gefiel Hannelore. Er schien ein fröhlicher Mensch zu sein, was seine schalkhaft blitzenden blauen Augen noch unterstrichen. Kurzes dunkles Haar drehte sich widerspenstig nach allen Seiten und gab ihm etwas Lausbubenhaftes. In krassem Gegensatz dazu stand sein schmaler, sensibler Mund, der seine sicher nur versteckte Verletzlichkeit verriet.
Hannelore mußte schmunzeln. »Nun weiß ich schon so viel über Sie und Ihre Schwester, aber Ihren Namen haben Sie mir immer noch nicht verraten.«
»Ach, du Schande«, entfuhr es dem jungen Mann. »Sie müssen mich ja für einen Flegel halten.« Er legte eine Hand auf sein Herz. »Ich schwöre Ihnen, daß das ein einmaliger Ausrutscher war.« Dann stand er auf und deutete eine Verbeugung an. »Manfred Kern. Meine Schwester sagt Fredi zu mir.« Er grinste wieder. »Meine besten Freunde auch.«
Hannelore lächelte fast ein wenig kokett. »Ist das vielleicht ein Angebot?«
Manfred nickte. »Selbstverständlich.« Forschend sah er Hannelore an. »Darf ich Ihren Namen jetzt auch erfahren?«
Sie nickte. »Ich heiße Hannelore Jung.« Noch immer lächelnd fügte sie hinzu: »Meine Freunde sagen Hanni zu mir.«
»Freut mich, Hanni.« Sein Blick wurde ernster. »Gibt es auch jemanden, der ein besonderes Vorrecht hat, Sie Hanni zu nennen? Ich meine… es geht mich zwar nichts an, aber… na ja, ich wüßte ganz gern, woran ich bin.« Er lächelte wieder. »Schließlich will ich ja nicht riskieren, daß mich ein eifersüchtiger Ehemann zum Duell fordert, nur weil wir uns ganz harmlos unterhalten haben.«
Hannelores Lächeln erlosch. »Zum Duell würde er Sie sicher nicht fordern, aber… ja, es gibt tatsächlich einen Ehemann in meinem Leben.«
Aufmerksam sah Manfred sie an. »Das klingt nicht so, als würden Sie eine glückliche Ehe führen.«
Hannelore erschrak. »Doch, sie ist glücklich«, behauptete sie. Für einen Moment senkte sie den Kopf. »Na ja, im Augenblick vielleicht nicht, aber… das liegt an… an meinem Aufenthalt hier. Ich hatte… eine Fehlgeburt.«
»Das tut mir leid.« Manfreds Gesichtsausdruck bewies, daß diese Worte keineswegs floskelhaft gewählt waren. »Ich glaube, so etwas ist das Schrecklichste, was einer Frau passieren kann.«
Hannelore nickte mit zusammengepreßten Lippen, bevor sie plötzlich in Tränen ausbrach. »Wenn man dann auch noch das Gefühl hat, selbst schuld zu sein…«
Manfred war tief betroffen angesichts der Tragödie, die sich anscheinend in Hannelores Leben abgespielt hatte.
»Haben Sie darüber schon mit Dr. Daniel gesprochen?« fragte er behutsam.
Hannelore nickte unter Tränen. »Er sagt, die Ursachen für das Absterben des Kindes könnten so vielfältig sein… und ich war erst in der achtzehnten Schwangerschaftswoche. Selbst wenn Komplikationen hätten entdeckt werden können, wäre das Baby außerhalb des Mutterleibs nicht lebensfähig gewesen, aber…« Mit verzweifeltem Blick sah sie Manfred an. »Ich war während der gesamten Schwangerschaft nicht ein einziges Mal beim Arzt, und nun mache ich mir Vorwürfe deswegen. Harry… mein Mann… er versteht das nicht. Er denkt, wir könnten ja wieder ein Baby haben, aber… für mich wäre das nicht dasselbe.«
Manfred nickte verständnisvoll. »Es kann auch niemals dasselbe sein.« Spontan griff er nach Hannelores Händen und hielt sie fest. »Ich gebe Ihnen einen guten Rat, Hanni, sprechen Sie über all das noch einmal mit Dr. Daniel. Nur er kann Ihnen sagen, ob die Vorwürfe, die Sie sich machen, irgendeine Berechtigung haben.«
»Und… wenn es so wäre?« wollte Hannelore wissen und fragte sich dabei, wie es kam, daß sie mit diesem fremden Mann über Dinge sprechen konnte, die sie nicht einmal Harald anvertraut hatte.
»Dann müssen Sie damit fertig werden«, entgegnete Manfred ernst. »Das wird bestimmt sehr schwierig sein, aber… Sie können die Zeit nun mal nicht einfach zurückdrehen und von vorn beginnen. Sie können sich nur vornehmen, beim nächsten Mal alles anders zu machen.«
Hannelore schluckte. »Danke, Fredi… für Ihre Offenheit.«
Er lächelte ein wenig. »Das haben Sie von mir ja offensichtlich auch erwartet, nicht wahr?«
»Ja, ich denke schon«, gab Hannelore leise zu, dann erhob sie sich. »Ich muß wieder zurück.«
Manfred stand ebenfalls auf und bot ihr seinen Arm. »Ich glaube, so geht es sich für Sie ein bißchen leichter. Der Weg bis zur Klinik ist ja doch ziemlich weit.«
Eine Weile gingen sie schweigend nebeneinander her. Erst als man schon die Türen des rückwärtigen Eingangs erkennen konnte, sah Hannelore ihren Begleiter an.
»Es schickt sich für mich wahrscheinlich nicht, das zu fragen… immerhin bin ich eine verheiratete Frau, aber… werden Sie mich einmal besuchen, solange ich noch hier bin?«
Manfred nickte ohne zu zögern. »Von Herzen gern, Hanni.«
*
Eine Woche hatte Lena Kaufmann abgewartet, dann befolgte sie Dr. Daniels Rat und überraschte ihren Mann in der Toilette. Erschrocken zuckte er zusammen und wollte sofort den Druckspüler betätigen, doch Lena legte ihm eine Hand auf den Arm.
»Wie lange willst du noch davonlaufen, Horst?« fragte sie sanft.
Scham und Verlegenheit überzogen sein Gesicht. »Woher weißt du…«
»Liebling, wir sind seit dreiundzwanzig Jahren verheiratet, und seitdem wasche ich nicht nur meine Wäsche, sondern auch deine«, entgegnete Lena. »Glaubst du wirklich, da würden mir diese rötlichen Flecken nicht auffallen?«
Die Röte auf Horsts Gesicht vertiefte sich noch, und plötzlich sah er den Besuch von Dr. Daniel in einem anderen Licht.
»Er weiß es also auch«, vermutete er. »Deshalb hat er dieses Thema angeschnitten.« Er schwieg kurz, bevor er voller Bitterkeit hinzufügte: »Und ich bin darauf reingefallen.«
»Horst.« Zärtlich legte Lena beide Hände um sein Gesicht. »Ich liebe dich, und ich habe Angst um dich. Deshalb wußte ich mir einfach keinen anderen Rat, als Dr. Daniel ins Vertrauen zu ziehen. Ich dachte, wenn er dir sagt, wie gefährlich das sein kann…«
Horst wich ihrem Blick aus. »Jetzt hältst du mich für einen Feigling, nicht wahr? Ein Mann, der sich vor ein paar harmlosen Untersuchungen fürchtet.«
Doch Lena schüttelte entschieden den Kopf. »Du bist kein Feigling, Horst. Diese Angst ist doch ganz natürlich. Glaubst du denn, ich hätte im umgekehrten Fall keine Angst? Aber es hat keinen Sinn, sich vor der Diagnose zu verstecken. Liebling, bitte, laß dich untersuchen. Dr. Scheibler ist ein guter und überaus rücksichtsvoller Arzt.«
Horst zögerte noch, dann nickte er. »Also schön, fahren wir in die Klinik.«
Lena atmete auf, obwohl sie sich bereits vor dem Ergebnis der Untersuchungen fürchtete. Wenn sich Horst nun zu spät zu diesem Schritt entschlossen hatte? Wenn diese Krankheit, an der er zweifellos litt, ihr den liebsten Menschen wegnehmen würde? Gewaltsam zwang Lena ihre Gedanken in eine andere Richtung.
Gemeinsam fuhren sie zur WaldseeKlinik. Während Lena schweren Herzens ihren Dienst antrat, nahm Horst in der Eingangshalle Platz. Lena hatte es sich natürlich nicht nehmen lassen, ihren Mann persönlich beim Chefarzt anzumelden. Das tat sie dann auch unmittelbar nach der Dienstübergabe.
»Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm, weil mein Mann nun ganz ohne Termin kommt«, fügte sie am Ende hinzu.
»Das meinen Sie ja wohl nicht ernst, Oberschwester Lena«, entgegnete Dr. Scheibler. »Sie sollten mich mittlerweile gut genug kennen, um zu wissen, daß ich nicht auf Termine beharre. Manchmal geht es zwar nicht anders, aber wenn jemand zu mir kommt und mich um eine Untersuchung bittet, dann schicke ich ihn nicht weg, nur weil er vielleicht keinen Termin hat.« Aufmunternd lächelte er Lena an. »Bringen Sie Ihren Mann zu mir. Ich werde mich gleich um ihn kümmern.«
Spontan ergriff Lena seine rechte Hand und drückte sie innig. »Vielen Dank, Herr Chefarzt.« Sie zögerte einen Moment. »Mein Mann… er geniert sich sehr wegen seiner Beschwerden.«
»Auch das werden wir in den Griff bekommen«, versicherte Dr. Scheibler beruhigend, und als Lena ihren Mann wenige Minuten darauf ins Büro begleitete, kam Ihnen der Chefarzt mit einem besonders herzlichen Lächeln entgegen. »Herr Kaufmann, ich freue mich, daß ich Sie endlich kennenlernen darf.«
Horst zwang sich zu einem Lächeln, das aber kläglich mißlang. Er warf Lena einen kurzen Blick zu und diese verstand. Mit einer sanften Geste berührte sie seinen Arm, dann küßte sie ihn flüchtig auf die Wange.
»Alles Gute, Liebling«, flüsterte sie ihm zu, ehe sie an ihre Arbeit ging.
Dr. Scheibler blickte ihr nach, dann lächelte er. »Ich wüßte gar nicht, was wir ohne unsere tüchtige Oberschwester tun würden. Sie haben eine wundervolle Frau, Herr Kaufmann.«
»Ja, ich weiß«, murmelte Horst. »Ohne sie wäre mein Leben nichts mehr wert.«
Dr. Scheibler betrachtete ihn. »Ich glaube, dasselbe würde Ihre Frau auch über Sie sagen.« Mit einer einladenden Handbewegung bot er ihm Platz an, dann setzte er sich ebenfalls und kam gleich zum Thema, damit Horst gar keine Gelegenheit mehr hatte, noch weitere Ängste aufzubauen. »Es gibt einen Grund für Ihren Besuch.«
Horst schluckte schwer, dann nickte er. »Ich… ich habe…« Er atmete tief durch und versuchte dabei, seiner Scham Herr zu werden. Der Mann, der ihm gegenübersaß, war schließlich Arzt und hatte sicher laufend mit derlei Dingen zu tun. Doch alles vernünftige Denken half nichts. Horst war einfach zu prüde erzogen worden. Alles, was unterhalb der Gürtellinie gewesen war, durfte zu Hause niemals erwähnt werden und auch wenn er seine beiden Töchter offener erzogen hatte – er selbst war genierlich geblieben. Noch einmal atmete er tief durch und nahm seinen ganzen Mut zusammen. »Ich habe Blut im Urin.«
»Das ist ein sehr ernstes Zeichen«, entgegnete Dr. Scheibler und zeigte seine Besorgnis ganz offen. »Ich bin froh, daß Sie gleich zu mir gekommen sind.«
Horst senkte den Blick. »Ich habe diese… Beschwerden schon seit ein paar Wochen, aber… ich brachte es nicht über mich…« Er schwieg bedrückt.
Dr. Scheibler stand auf. »In diesem Falle sollten wir sofort mit den Untersuchungen beginnen. »Er ging mit Horst in den Nebenraum und gab ihm einen Becher. »Als erstes brauche ich eine Urinprobe von Ihnen.« Er begleitete Horst zu den Toiletten, von denen die rechte eine direkte Verbindung zum danebenliegenden Labor aufwies.
Dr. Scheibler öffnete die Tür. »Benutzen Sie diese Kabine, und stellen Sie den Becher dann in das kleine Kästchen.«
Dankbar sah Horst ihn an, bevor er die Tür hinter sich schloß. Dr. Scheibler trat auf den Flur.
»Alexandra«, sprach er die Stationsschwester der Chirurgie an. »Wenn Herr Kaufmann herauskommt, bringen Sie ihn bitte in den Untersuchungsraum, und bereiten Sie alles für eine Ultraschalluntersuchung vor.«
»In Ordnung, Herr Chefarzt«, stimmte Schwester Alexandra sofort zu.
Dr. Scheibler wollte ins Labor gehen, doch an der Tür drehte er sich noch einmal um. »Ach ja, ich brauche auch eine Blutprobe des Patienten. Bringen Sie sie mir gleich hier herein.«
Dann trat er endgültig ein und wartete, bis er von drüben das Zuschnappen der kleinen Tür hörte, das signalisierte, daß Horst den Becher abgestellt hatte. Er öffnete jetzt seinerseits das kleine Türchen und holte die
Urinprobe heraus. Ein Test wäre in diesem Fall vielleicht gar nicht mehr nötig gewesen, denn die Rötlichfärbung war schon mit bloßem Auge deutlich zu erkennen.
Trotzdem führte Dr. Scheibler den Test gewissenhaft durch und kam zu dem Ergebnis, daß die Urinprobe nicht nur rote Blutkörperchen enthielt, sondern auch Hämoglobin, was auf einen Infektionsherd hinwies. Auch Eiweiß fand sich – ein deutliches Zeichen, daß die Nieren nicht mehr einwandfrei arbeiteten.
Nach kurzem Anklopfen trat Schwester Alexandra herein und brachte dem Chefarzt die gewünschte Blutprobe. Auch hier ergab sich kein überraschendes Ergebnis. Die Blutsenkung war deutlich beschleunigt, was den Verdacht einer Infektion erhärtete, der Kreatininwert war erhöht, was Aufschluß darüber gab, daß die Nierenfunktion eingeschränkt war.
Noch einmal nahm sich Dr. Scheibler die Urinprobe vor und untersuchte sie nun auf Bakterien.
Er notierte seine Ergebnisse gewissenhaft in der Krankenakte, dann ging er ins Untersuchungszimmer, wo Horst schon auf ihn wartete. Allein an seiner Körperhaltung waren die Angst und Anspannung deutlich zu erkennen. Mit fragendem Blick sah er dem Arzt entgegen.
»Eine endgültige Diagnose kann ich jetzt leider noch nicht stellen«, erklärte Dr. Scheibler. »Im Moment weiß ich nur, daß sich in Ihrem Körper ein Infektionsherd befindet, und zwar handelt es sich dabei um einen sogenannten Harnwegsinfekt… eine Blasenentzündung. Ich nehme an, daß Sie zur Zeit beim Wasserlassen Schmerzen haben.«
Horst nickte. »Es… es brennt ziemlich.«
Mit dieser Antwort hatte Dr. Scheibler schon gerechnet. »Diese Infektion bereitet mir eigentlich die geringeren Sorgen, denn man kann ihr mit Antibiotika gut beikommen. Weit besorgniserregender sind die Ergebnisse, die darauf hinweisen, daß mit Ihren Nieren etwas nicht in Ordnung ist.« Er schwieg kurz und deutete auf die Untersuchungsliege. »Legen Sie sich bitte dorthin. Auf den Bauch.«
Horst gehorchte und wartete nervös darauf, was der Arzt als nächstes machen würde. Unwillkürlich zuckte er zusammen, als Dr. Scheibler seine Hose ein Stückchen nach unten und das Hemd nach oben schob.
»Sie müssen keine Angst haben«, meinte der Arzt beruhigend. »Die Ultraschalluntersuchung ist nicht schmerzhaft, nur das spezielle Gel, das ich auf ihrem Rücken verteilen muß, fühlt sich im ersten Moment ein bißchen kalt an.«
Langsam ließ Dr. Scheibler den Schallkopf über den unteren Teil von Horsts Rücken gleiten. Was er sah, beunruhigte ihn zutiefst.
»Haben Sie… etwas gefunden?« fragte Horst leise.
»Ja, Herr Kaufmann, ich denke schon«, antwortete Dr. Scheibler. »Sicherheitshalber werde ich aber noch eine Röntgenaufnahme machen.«
Das Röntgenbild ergab denselben Befund.
»Es ist ernst, nicht wahr?« wollte Horst wissen, als er dem Chefarzt gegenübersaß. Plötzlich waren Angst, Anspannung und Scham wie weggeblasen. Mit einer Ruhe, die ihm selbst beinahe unheimlich war, wartete Horst auf das Urteil, das ihm von Dr. Scheibler präsentiert werden würde.
»Ja, Herr Kaufmann, es ist in der tat sehr ernst«, bestätigte der Chefarzt. »An Ihrer rechten Niere hat sich ein Tumor gebildet. Ich kann im Moment noch nicht sagen, ob er gut oder bösartig ist. Im Grunde ist das auch bedeutungslos, weil ein Tumor dieses Ausmaßes in jedem Fall operativ entfernt werden muß.«
Es dauerte einige Minuten, bis Horst wieder einen klaren Gedanken fassen konnte.
»Ich muß also operiert werden«, brachte er leise hervor. »Und danach? Ich meine, ich weiß, daß ich mit einer Niere leben kann, aber… wenn es nun Krebs ist.« Hoffnungsvoll blickte er den Arzt an. »Oder können Sie das ausschließen?«
Dr. Scheibler schüttelte bedauernd den Kopf. »Nein, Herr Kaufmann, so leid es mir tut – ausschließen kann ich diese Möglichkeit nicht.« Er schwieg kurz. »Genau aus diesem Grund würde ich Ihnen empfehlen, sich in der ThierschKlinik in München operieren zu lassen. Professor Thiersch gibt sich zwar meistens sehr ruppig und unfreundlich, aber das Wohl seiner Patienten liegt ihm ganz besonders am Herzen, und – was in meinen Augen das Wichtigste ist – er ist auf diesem Gebiet unbestritten einer der besten Ärzte, die es in Deutschland gibt.«
Horst nickte. »Ich werde tun, was Sie sagen, Herr Doktor. Sie wissen sicher, was das Beste für mich ist.«
*
Ein paar Tage hatte Hannelore mit sich gerungen, ehe sie Manfreds Rat befolgt und sich Dr. Daniel anvertraut hatte.
»Über dieses Thema hätte ich mit Ihnen ohnehin noch gesprochen«, meinte Dr. Daniel. »Wie Sie ja wissen, wurde das tote Kind hier untersucht.« Er wußte, daß das die falsche Bezeichnung war, aber er brachte es einfach nicht über sich, dieser jungen Frau gegenüber von einer »Obduktion des Fetus« zu sprechen. »Diese Untersuchung hat eindeutig ergeben, daß das Baby nicht gesund war und deshalb gestorben ist. Auch wenn Sie in regelmäßiger ärztlicher Behandlung gewesen wären, hätte das nicht verhindert werden können.«
Hannelore atmete auf. »Wenn ich schuld gewesen wäre… ich glaube, das hätte ich niemals verkraftet.« Dankbar griff sie nach Dr. Daniels Hand. »Eines schwöre ich Ihnen, Herr Doktor: Sollte ich jemals wieder schwanger werden, dann komme ich zu Ihnen. Nie wieder werde ich so leichtsinnig sein.«
Dr. Daniel beschloß, an dieser Stelle einzuhaken. »Warum waren Sie eigentlich so leichtsinnig?«
Hannelore seufzte tief auf. »Das hatte verschiedene Gründe. Ich habe früher in München gearbeitet und war dort bei einem sehr guten Gynäkologen, aber dann haben Harry und ich geheiratet, und er wollte, daß ich mit der Arbeit aufhören solle.« Sie zuckte die Schultern. »Irgendwann habe ich mich halt überreden lassen. Ich war dann einmal bei einer Ärztin in der Kreisstadt, doch die war so grob, daß ich nicht wieder hingehen wollte. Als ich dann schwanger wurde, machte mir meine Stiefmutter den Vorschlag, zu Ihnen zu gehen, aber…« Verlegen senkte sie den Kopf. »Alles, was meine Stiefmutter sagt, ist für mich wie ein rotes Tuch. Ich erwiderte, sie könne sich ihren Dr. Daniel sonstwo hinstecken.« Heiße Scham breitete sich auf ihrem Gesicht aus. »Es tut mir wirklich leid.«
»Damals kannten Sie mich ja noch nicht, also nehme ich Ihre Worte auch nicht persönlich«, beruhigte Dr. Daniel sie. »Nur eines verstehe ich immer noch nicht. Sie sagten zwar, es wäre ganz natürlich, daß Ihre Stiefmutter für Uschi mehr empfinden müßte als für Sie, aber wie konnte es auf Ihrer Seite zu einem so massiven Haß kommen?«
Es war das erste Mal, daß Hannelore diese Frage gestellt wurde. Sicher, ihr Vater hatte es ab und zu angedeutet, aber sie war ihm die Antwort immer schuldig geblieben. Er hatte es aber auch nie so deutlich ausgedrückt wie Dr. Daniel gerade eben.
»Ich… ich weiß es nicht«, murmelte Hannelore. »Anfangs… wissen Sie, ich war damals achtzehn, als meine Eltern mir die Wahrheit sagten. Ich war… betroffen… enttäuscht. Es war ein richtiger Schock, und irgendwie dachte ich plötzlich…« Sie sprach nicht weiter.
»Die mangelnde Liebe Ihrer Stiefmutter zu Ihnen war also nur Einbildung«, folgerte Dr. Daniel, und dabei keimte ein bestimmter Verdacht in ihm auf. »Wurden Sie darin bestärkt?«
Hannelore nickte erst nach einigem Zögern. »Harry sagte, es wäre ganz natürlich. Seine Stiefmutter hätte ihn auch immer geschlagen, während seine Stiefschwester über die Maßen verwöhnt worden sei.«
So ähnlich hatte Dr. Daniel sich die Sache schon vorgestellt, wenn er auch noch immer nicht begreifen konnte, wie Hannelore einen so massiven Haß hatte aufbauen können. Konnte das wirklich nur durch Beeinflussung von außen geschehen sein?
»Frau Jung, denken Sie über meine nächste Frage ganz genau nach, bevor Sie antworten«, bat Dr. Daniel. »Bevor Sie wußten, daß Lena Kaufmann nicht Ihre wirkliche Mutter ist, hatten Sie da jemals das Gefühl, von ihr schlechter behandelt worden zu sein als ihre Stiefschwester?«
Hannelore senkte den Kopf. Seit jenem Tag, an dem sie die Wahrheit erfahren hatte, war es das erste Mal, daß sie wieder über ihre Kindheit und Jugend nachdachte… daß sie Erinnerungen daran überhaupt zuließ.
»Uschi und ich waren mehr als Schwestern«, gestand sie leise. »Wir sind zusammen durch dick und dünn gegangen.«
»Sie hat Sie hier noch nicht ein einziges Mal besucht«, hakte Dr. Daniel sofort nach, obwohl Hannelores Worte keine wirkliche Antwort auf seine Frage gewesen waren.
Die junge Frau nickte. »Harry und ich haben keinen Kontakt mehr zu Uschi und Georg. Die beiden wohnen in München.«
»München ist nur eine halbe Autostunde von Steinhausen entfernt.«
Hannelore nickte. »Harry will den Kontakt zu Uschi nicht. Er hat gehört, wie sie meine Stiefmutter gegen mich aufgehetzt hat. Überhaupt… ich habe zu meinen Eltern ja auch kaum noch Kontakt. Meine Stiefmutter hat mir meinen Vater entfremdet.«
»Sagt das auch Ihr Mann?«
»Harry hat es gehört.«
»Der junge Mann scheint mir aber einiges zu hören«, entfuhr es Dr. Daniel.
Hannelores Kopf ruckte hoch. »Was wollen Sie damit sagen?«
»Diese Frage werde ich Ihnen beantworten, wenn Sie mir auch endlich eine Antwort geben. Ich hatte Sie gefragt, ob Sie sich jemals vernachlässigt gefühlt haben.«
Zögernd schüttelte Hannelore den Kopf. »Nein, das habe ich nicht. Ich… ich habe eine schöne Kindheit gehabt.«
»Trotzdem glauben Sie, daß Ihre Schwester, mit der Sie einst durch dick und dünn gegangen sind, Ihre Stiefmutter gegen Sie aufhetzen würde? Und Sie glauben auch, daß Ihre Stiefmutter Ihnen den Vater entfremden würde?«
Verwirrung zeichnete sich auf Hannelores Gesicht ab. »Harry würde mich niemals belügen!«
»Eben das sollten Sie herauszufinden versuchen.« Dr. Daniel griff nach ihrer Hand. »Ich wollte vorhin nicht andeuten, daß Ihr Mann Sie absichtlich belügt. Vielleicht hat er einfach nur etwas falsch verstanden. Oder er sucht nach einer Entschädigung für seine eigene schlimme Kindheit. Er wurde vielleicht immer vernachlässigt und will nun jemanden ganz für sich allein – Sie.«
Hannelore dachte eine Weile über diese Worte nach, dann nickte sie. »Ich werde mit ihm sprechen.«
*
Dr. Daniel wollte die Klinik an diesem Tag früher verlassen. Wie jeden Mittwochnachmittag war seine Praxis geschlossen, und er beabsichtigte nach München zu fahren und seine Tochter aus der ThierschKlinik abzuholen. Allerdings kam er nicht einmal bis zum Ausgang, denn Harald Jung stürzte ihm wutentbrannt entgegen.
»Was fällt Ihnen ein, meine Frau gegen mich aufzuhetzen!« fuhr er Dr. Daniel an.
»Ich habe Ihre Frau nicht gegen Sie aufgehetzt«, stellte der Arzt richtig. »Ich habe sie nur aufgefordert, sich mit ihrem Leben objektiv auseinanderzusetzen – und zwar mit ihrem ganzen Leben… mit ihrer Kindheit, ihrer Jugend und auch mit ihrer Ehe.«
»Ich wußte von Anfang an, daß Sie mit meiner Schwiegermutter unter einer Decke stecken!« hielt Harald ihm vor. »Sie ist es doch, die Sie zu allem angestiftet hat.«
»Warum sehen Sie denn überall Feinde, Herr Jung?« fragte Dr. Daniel ruhig. »Mich hat niemand angestiftet. Ich habe es Ihnen schon einmal gesagt: Ich versuche zu helfen, und gerade in diesem Fall habe ich so viele unglückliche Menschen gesehen – aber eben auch ein Bild aus glücklichen Tagen. Diese beiden Dinge passen nicht zusammen. Ein Leben, das glücklich war, kann durch die Wahrheit nicht so unglücklich werden.«
»Waren Sie ein Adoptivkind?« fragte Harald voller Bitterkeit.
Dr. Daniel schüttelte den Kopf. »Nein, aber ich habe ein Adoptivkind. Sie ist sechs und weiß, daß meine Frau und ich nicht ihre wirklichen Eltern sind. Trotzdem liebt sie uns, und wir lieben sie, als wäre sie unsere leibliche Tochter.« Er schwieg kurz. »Ich weiß aber auch, daß Sie mit Ihrer Stiefmutter nicht so viel Glück hatten.«
»Sie hat mich geschlagen«, brach es aus Harald heraus. »Wenn ich nicht gehorcht habe, bekam ich nichts zu essen. Dabei hätte alles so schön werden können. Mein Vater kannte doch die richtige Frau, aber dann hat sie einen anderen geheiratet… wurde seinem Kind die liebevolle Mutter, die ich mir gewünscht hatte.«
Dr. Daniel war von dieser Tragik tief betroffen. Die schlimmen Jugenderlebnisse von Harald Jung mußten dazu geführt haben, daß aus ihm ein rachsüchtiger Mann geworden war. Weil er selbst gelitten hatte, wollte er offensichtlich auch das Verhältnis zwischen Hannelore und Lena vergiften – und es war ihm über Jahre hinweg gelungen.
»Empfinden Sie das, was Sie getan haben, nicht als Unrecht?« fragte Dr. Daniel vorsichtig. »Sie haben Ihre Frau dafür büßen lassen, daß Sie eine unschöne Kindheit und Jugend hatten. Sie haben eine ganze Familie unglücklich gemacht.«
»Diese Familie war lange genug glücklich!« entgegnete Harald haßerfüllt. »Es hat mir gut getan, sie alle leiden zu sehen!«
»Herr Jung…«, begann Dr. Daniel besänftigend, doch Harald drehte sich abrupt um und rannte aus der Klinik. Erst in diesem Moment entdeckte Dr. Daniel die junge Frau, die im Morgenmantel an der undurchsichtigen Glastür stand, die zur Gynäkologie führte. Rasch ging er auf sie zu, sah in ihre vor Entsetzen geweiteten Augen und legte tröstend einen Arm um ihre Schultern.
»Auf diese Weise hätten Sie es nicht erfahren sollen, Frau Jung«, meinte er.
Hannelore war stumm vor Entsetzen. Was sie gerade unfreiwillig mitbekommen hatte, hatte ihr ganzes Leben merklich erschüttert.
Wie aus dem Nichts stand plötzlich Lena Kaufmann neben ihnen. Dr. Daniel war nicht sicher, ob auch sie etwas von Haralds Worten mitbekommen hatte, aber er war froh, daß sie gerade jetzt zur Stelle war.
»Mama«, flüsterte Hannelore mit bebender Stimme.
Sanft streichelte Lena über ihre Wange und nahm ihre Stieftochter liebevoll in den Arm. Im Moment waren zwischen ihnen keine Worte nötig. Eine ernste Aussprache mußte später erfolgen.
Dr. Daniel spürte, daß er hier nicht mehr gebraucht wurde und zog sich diskret zurück. Beide Frauen wußten, daß er zur Verfügung stehen würde, wenn sie ihn brauchten; es bestand für Dr. Daniel keine Veranlassung, ihnen das extra noch zu sagen.
Erneut machte er sich auf den Weg zum Ausgang, doch er wurde auch diesmal aufgehalten – von Chefarzt Dr. Scheibler.
»Robert, ich habe mitbekommen, daß Sie noch nach München fahren wollen.«
Dr. Daniel schmunzelte. »Eigenartig, wie rasch sich so etwas herumspricht. Aber Sie haben recht, Gerrit, ich bin tatsächlich auf dem Weg nach München. Ich möchte Karina abholen, weil ich meine Tochter ja sonst überhaupt nicht mehr zu Gesicht bekomme.«
»Das bedeutet, daß Sie zur ThierschKlinik fahren«, folgerte der Chefarzt, dann reichte er Dr. Daniel eine Krankenakte. »Wären Sie so lieb, diese Akte an Professor Thiersch weiterzugeben? Ich werde ihn in der Zwischenzeit anrufen und den Patienten gleich morgen früh nach München schicken.«
Dr. Daniel warf einen Blick auf die Akte und erstarrte förmlich.
»O mein Gott«, entfuhr es ihm, dann blickte er Dr. Scheibler entsetzt an. »Krebs?«
Der Chefarzt seufzte leise. »Ich kann es leider nicht ausschließen, aber selbst wenn – bei Thiersch hat er noch die besten Chancen.«
»Weiß Oberschwester Lena es schon?« fragte Dr. Daniel.
Der Chefarzt nickte. »Herr Kaufmann hat gerade mit ihr gesprochen.« Mit dem Handrücken fuhr er sich über die Stirn. »Ich wünschte, ich hätte ihm etwas anderes sagen können.«
Dr. Daniel blickte noch einmal auf die Akte, dann sah er Dr. Scheibler wieder an. »Ich könnte ihn mitnehmen.«
Der Chefarzt nickte nachdenklich. »Das wäre nicht das schlechteste. Ursprünglich dachte ich daran, ihn über Nacht hierzubehalten, aber… ja, Robert, es wäre wohl tatsächlich besser, ihn heute noch nach München zu bringen.«
Eine Viertelstunde später fuhr Dr. Daniel zusammen mit Horst Kaufmann los.
»Wenn es Krebs ist… dann ist es aussichtslos, nicht wahr?« fragte Horst nach einer langen Weile bedrückenden Schweigens.
»Absolut nicht, Herr Kaufmann«, entgegnete Dr. Daniel ernst. »Nierenkrebs kann durchaus heilbar sein, und Professor Thiersch hat auf diesem Gebiet die größte Erfahrung. Er wird alles tun, um Ihnen zu helfen.«
Horst nickte niedergeschlagen. »Das hat Dr. Scheibler auch gesagt, aber… ich habe Angst. Gerade jetzt ist alles so schwierig…«
»Ich weiß schon, Herr Kaufmann, in Ihrer Familie gibt es auch andere Probleme«, meinte Dr. Daniel. »Aber ich glaube, die Zeichen stehen gut, daß sich diese Probleme lösen lassen.« Er schwieg kurz. »Was Ihre Angst betrifft – die ist mehr als verständlich. Die mögliche Diagnose Krebs jagt jedem Menschen Angst ein.«
Horst wollte noch etwas erwidern, doch da bog Dr. Daniel schon in die Parkplatzeinfahrt der ThierschKlinik. Mit gemischten Gefühlen betrachtete Horst den wuchtigen Bau, der so wenig Ähnlichkeit mit der WaldseeKlinik hatte.
»Dr. Scheibler hat gesagt, der Professor wäre etwas ruppig«, murmelte Horst und konnte noch immer keinen Blick von der für ihn furchteinflößenden Fassade wenden.
»Das ist sogar noch untertrieben«, bestätigte Dr. Daniel. »Sie werden den Professor als streng und unfreundlich empfinden, aber ich kann Ihnen versichern, daß er alles tun wird, um Ihnen zu helfen.«
*
Lena Kaufmann und Hannelore Jung hatten sich nach dem ersten Überschwang der Gefühle in Hannelores Zimmer zurückgezogen. Nun saß die junge Frau in ihrem Bett, während Lena an der Bettkante Platz genommen hatte und sanft die Hand ihrer Stieftochter hielt.
»Es war schrecklich«, flüsterte Hannelore. »Ich war mir Harrys Liebe immer so sicher, doch jetzt… irgendwie habe ich das Gefühl, als würde ich im luftleeren Raum stehen. Als er sagte, er hätte es genossen, uns leiden zu sehen…« Sie schluchzte auf. »Was soll ich jetzt nur tun?«
»Vielleicht hat er es nicht so gemeint«, wandte Lena tröstend ein.
»Doch«, entgegnete Hannelore leise. »Er hat es ganz sicher so gemeint. Mama, ich glaube… ich glaube, er hat mich nie geliebt. Er wollte nur unsere Familie zerstören…«
Lena schüttelte den Kopf. »Das ergibt doch keinen Sinn, Hanni. Anfangs wußte er doch gar nicht, daß du nicht meine leibliche Tochter bist. Ihr wart doch schon fast ein Jahr zusammen, als wir dir die Wahrheit sagten.« Sie seufzte. »Ich fürchte, wir haben damals einen Fehler begangen. Wir haben dich allein gelassen, dabei hätten wir uns gerade in dieser Situation um dich kümmern müssen.«
»Ich war achtzehn«, wandte Hannelore ein. »Und ich hatte Jahre voller Liebe und Geborgenheit hinter mir. Ich war gefestigt… in meiner Familie, in meinem Beruf…« Sie lächelte schwach. »Auch wenn ich gerade erst meine Lehre abgeschlossen hatte. Aber es war das, was ich immer tun wollte.« Für einen Moment blickte sie zu Boden. »Ja, es war ein Schock. Zu erfahren, daß meine Mama, die ich liebte…« Sie brachte den Satz nicht zu Ende.
Impulsiv nahm Lena sie in die Arme. »Dich Stück für Stück zu verlieren, hat so schrecklich weh getan. Hilflos zusehen zu müssen, wie sich deine Liebe in Haß verwandelte. Dich immer seltener zu sehen… darunter hat auch dein Vater ganz schrecklich gelitten.« Ein schmerzlicher Zug flog über Lenas Gesicht. In ihrer Freude darüber, daß sie ihre verlorene Tochter wiederbekommen hatte, hatte sie Horsts schreckliche Krankheit verdrängt, doch nun kehrte der Kummer darüber mit aller Gewalt zurück. Trotzdem versuchte Lena, sich nichts anmerken zu lassen. Hannelore hatte so sehr glitten – die Fehlgeburt, die schreckliche Geschichte mit Harald… zumindest im Augenblick wollte Lena ihr die Sorge um den Vater ersparen. Wenn die Diagnose endgültig feststand, war noch immer Zeit, um mit ihr darüber zu sprechen.
»Jetzt wird alles wieder gut«, versprach Hannelore und war erneut den Tränen nahe. »Wir werden wieder eine Familie.«
Lena nickte nur und hatte dabei Mühe, nicht aufzuschluchzen. Wenn Horst wirklich Krebs hatte… Lena wagte es nicht, diesen Gedanken zu Ende zu denken.
*
Als Dr. Daniel und Horst Kaufmann die ThierschKlinik betraten, kam ihnen der Professor bereits entgegen.
»Scheibler hat mich schon informiert«, erklärte er im üblichen barschen Ton und ohne eine Begrüßung, doch das war Dr. Daniel schon gewohnt. Immerhin kannte er den Professor seit über fünfundzwanzig Jahren.
Ungeduldig winkte er seinem neuen Patienten zu. »Kommen Sie mit.«
Horst warf Dr. Daniel einen fast hilfesuchenden Blick zu. Obwohl er den Professor um Haupteslänge überragte, hatte ihn der untersetzte, kleine Mann mit der dicken Hornbrille total eingeschüchtert. Dabei war er noch nicht einmal zu seiner Höchstform aufgelaufen. Professor Thiersch konnte nämlich noch sehr viel ruppiger sein, als er sich im Moment gegeben hatte.
»Daniel!« brüllte er jetzt durch die Eingangshalle.
»Herr Professor?« entgegnete Dr. Daniel fragend, was ihm sofort einen ungnädigen Blick eintrug.
»Wer redet denn mit Ihnen?« raunzte Professor Thiersch zurück.
Im selben Moment kam Karina, die Tochter von Dr. Daniel, die hier als Assistenzärztin arbeitete, auf die drei Männer zu.
»Sie haben mich gerufen, Herr Professor?«
»War ja wohl nicht zu überhören«, grummelte Professor Thiersch, dann sah er Horst an und wedelte ungeduldig mit der Hand. »Geben Sie meiner Assistenzärztin Ihre Versicherungskarte, damit sie die Aufnahmeformalitäten gleich für Sie erledigen kann.«
Mit bebenden Fingern nestelte Horst seine Brieftasche heraus und entnahm ihr die Karte. Karina nahm sie freundlich lächelnd entgegen.
»Ich bringe Sie Ihnen gleich zurück«, versprach sie, zwinkerte ihrem Vater verstohlen zu und eilte davon.
»Wo sind die Unterlagen, Daniel?« wandte sich der Professor an Dr. Daniel, nahm die Krankenakte entgegen und studierte gewissenhaft die Eintragungen.
»Da hat Scheibler gute Arbeit geleistet«, knurrte er vor sich hin. »Na ja, kein Wunder. Er hat ja schließlich auch bei mir gelernt.«
Mit kurzen energischen Schritten steuerte er nun sein Büro an. Dabei blickte er nicht ein einziges Mal zurück. Er ging einfach davon aus, daß Dr. Daniel und Horst Kaufmann ihm folgen würden.
»Herr Doktor, dieser Mann macht mir fast noch mehr Angst als meine Krankheit«, gestand Horst leise.
Beruhigend lächelte Dr. Daniel ihn an. »Keine Sorge, Herr Kaufmann, Professor Thiersch bellt sehr laut, aber er beißt nicht – ganz im Gegenteil. Wenn er sich so verhält wie jetzt, dann ist das ein deutliches Zeichen, daß ihn der Fall sehr beschäftigt.«
»Das weiß er aber geschickt zu verbergen.«
Jetzt hatten sie das Büro des Chefarztes erreicht. Dr. Daniel zögerte ein wenig, schließlich ging ihn der Fall aus ärztlicher Sicht nichts an, doch Professor Thiersch winkte ihm unwillig zu – eine deutliche Aufforderung einzutreten.
»Also, Herr Kaufmann«, kam der Professor gleich zur Sache. »Dr. Scheibler hat die nötigen Untersuchungen bereits durchgeführt. Wir machen morgen früh noch ein großes Blutbild, EKG und die übliche Operationsvorbereitung. Wenn alles in Ordnung ist, kommen Sie am Freitagfrüh auf den Tisch.«
Horst schluckte. »So schnell?«
Professor Thierschs buschige Augenbrauen zogen sich über dem Rand der Hornbrille zusammen, so daß sich über der Nasenwurzel eine steile Falte bildete.
»Soll ich Sie vielleicht noch eine Woche warten lassen?« polterte er.
»Nein, nein«, stammelte Horst unsicher. »Ich dachte nur…«
»In dieser Klinik übernehme ausschließlich ich das Denken«, belehrte ihn der Professor. Er drückte auf einen Knopf der Gegensprechanlage.
»Herr Professor?« meldete sich eine fragende Frauenstimme.
»Schicken Sie Heller zu mir!« bellte Professor Thiersch hinein, dann ließ er den Knopf unverzüglich los und ersparte sich so eine mögliche Erwiderung seiner Vorzimmerdame.
Es dauerte keine fünf Minuten, bis der Oberarzt Dr. Rolf Heller das Büro betrat. Professor Thiersch stand auf und ging ihm ein paar Schritte entgegen. Der Oberarzt war der einzige an der ganzen Klinik, der in den Genuß einer solchen Höflichkeit kam.
Er gab Dr. Heller die Krankenakte, informierte ihn in knappen Worten über die noch durchzuführenden Untersuchungen und fügte abschließend hinzu: »Kümmern Sie sich gut um unseren neuen Patienten.«
»Selbstverständlich, Herr Professor«, versicherte Dr. Heller, dann wandte er sich Horst mit einem freundlichen Lächeln zu. »Kommen Sie, Herr Kaufmann, ich bringe Sie in Ihr Zimmer.«
»Danke«, murmelte Horst, sah den Professor an, weil er sich verabschieden wollte, doch dieser hatte ihm bereits den Rücken zugewandt.
Dr. Daniel, der diese Geste gut genug kannte, erhob sich ebenfalls.
»Auf Wiedersehen, Herr Professor«, verabschiedete er sich höflich, war aber nicht weiter erstaunt, weil von Professor
Thiersch keine Erwiderung kam.
Als sie auf dem Flur standen, atmete Horst befreit auf.
»Meine Güte«, entfuhr es ihm. »Dr. Scheibler hat tatsächlich noch untertrieben.«
Dr. Heller mußte lachen. »Ich weiß schon, Professor Thierschs Art ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber ich kann Ihnen versichern, daß ihm das Wohl seiner Patienten sehr am Herzen liegt, und gerade Ihnen scheint er äußerst wohlwollend gegenüberzustehen.«
»Mir?« Zweifelnd schüttelte Horst den Kopf. »Das sah aber ganz anders aus.«
»Sie dürfen mir trotzdem glauben. Ich kenne den Professor seit ziemlich langer Zeit.« Dr. Heller lächelte. »Wenn man ihn auch niemals wirklich ganz durchschaut.« Er sah Dr. Daniel an. »Wie geht’s Gerrit… Dr. Scheibler?«
»Sehr gut«, antwortete Dr. Daniel. »Er ist jetzt Chefarzt der WaldseeKlinik, aber das wissen Sie vermutlich schon.«
Dr. Heller nickte. »Es hat sich herumgesprochen.« Wieder lächelte er. »Dann hat er letztlich ja erreicht, was er wollte.«
»Er hat sich in den vergangenen Jahren sehr verändert«, entgegnete Dr. Daniel. »Er ist verheiratet, hat zwei leibliche und zwei Adoptivkinder. Die Karriere steht bei ihm längst nicht mehr an erster Stelle. Er hatte sogar große Schwierigkeiten, sich an den ›Chefarzt‹ zu gewöhnen.« Er schwieg kurz. »Ich glaube, Sie würden ihn nicht wiedererkennen.«
Dr. Heller lächelte erneut. »Bestellen Sie ihm schöne Grüße von mir, und sagen Sie ihm, daß er uns hier in der Klinik sehr fehlt.«
»Ich werde es ihm ausrichten«, versprach Dr. Daniel, dann wandte er sich Horst zu und reichte ihm die Hand. »Ich wünsche Ihnen alles Gute, Herr Kaufmann, und nach der Operation werde ich Sie bestimmt besuchen.«
Horst zwang sich zu einem tapferen Lächeln. »Wenn ich wieder aufwache.«
»Sie werden aufwachen«, versicherte Dr. Daniel. »Etwas anderes würde Ihnen der Professor gar nicht erlauben.«
*
Nach dem langen Gespräch mit ihrer Mutter war Hannelore völlig erschöpft eingeschlafen. Erst jetzt hatte Lena gezeigt, was in ihr wirklich vorging. Ihr Gesicht war von Kummer gezeichnet, als sie den Flur entlanghastete und das Büro des Chefarztes aufsuchte.
»Ist mein Mann schon weg?« stieß sie hervor.
Dr. Scheibler kam ihr entgegen und begleitete sie fürsorglich zu einem Stuhl.
»Ja, Oberschwester«, antwortete er. »Dr. Daniel hat ihn persönlich nach München gefahren.«
Lena vergrub das Gesicht in den Händen und schluchzte auf. »Ich hätte ihn begleiten müssen, aber… Hanni… sie brauchte mich doch auch.«
»Niemand kann sich zerreißen«, entgegnete Dr. Scheibler. »Ich bin sicher, daß Sie die richtige Entscheidung trafen, als sie sich entschlossen, ihrer Tochter beizustehen. Dr. Daniel hat mich in wenigen Worten informiert«, fügte er erklärend hinzu, dann legte er tröstend eine Hand auf ihren Arm. »Ihr Mann war bei Dr. Daniel in guten Händen… Fast möchte ich sagen, in den besten. Er kennt den Professor länger als wir alle und konnte Ihren Mann sicher beruhigen, wenn er von der ruppigen Art des Professors ein bißchen eingeschüchtert war.«
Lena nickte etwas halbherzig. »Trotzdem hätte er mich gerade jetzt gebraucht.«
Dr. Scheibler warf einen Blick auf die Uhr. »In einer halben Stunde ist Dienstübergabe, danach wird Frau Dr. Walther die Nachtschicht übernehmen. Was halten Sie davon, wenn wir beide dann nach München fahren? Ich bin sicher, daß sich für Sie ein Hotelzimmer in der Nähe der ThierschKlinik auftreiben läßt und für morgen beurlaube ich Sie. Bleiben Sie bei Ihrem Mann und machen Sie sich um Ihre Tochter keine Sorgen. Dr. Daniel und ich werden uns um sie kümmern.«
»Das kann ich doch nicht annehmen«, entgegnete Lena ergriffen.
»Doch, Oberschwester Lena, das müssen Sie sogar annehmen«, betonte Dr. Scheibler. »Also, in einer halben Stunde treffen wir uns in der Eingangshalle.
Lena schüttelte den Kopf. »Herr Chefarzt, Sie haben Familie. Ihre Frau… ihre vier Kinder… die werden Sie doch alle längst sehnsüchtig erwarten…«
»Meine Frau hat für Notfälle immer Verständnis, und das hier ist in meinen Augen ein Notfall.« Er legte beide Hände auf Lenas Schultern. »Machen Sie sich um mich keine weiteren Gedanken mehr. In einer halben Stunde fahren wir nach München.«
Aufschluchzend lehnte sich Lena für einen Moment gegen Dr. Scheibler.
»Danke, Herr Chefarzt«, flüsterte sie.
*
Als Hannelore am nächsten Morgen erwachte, saß Manfred Kern neben ihrem Bett. Erschrocken, weil sie nicht mit ihm gerechnet hatte, aber auch ein bißchen erfreut, weil er sein Versprechen doch gehalten hatte, fuhr die junge Frau hoch.
»Tut mir leid«, meinte Manfred mit seinem sympathischen Lächeln. »Erschrecken wollte ich Sie nicht.«
»Haben Sie auch nicht… fast nicht«, berichtigte sich Hannelore, dann lächelte sie ebenfalls. »Ich wäre jetzt vermutlich ebenso erschrocken, wenn meine Mutter am Bett gesessen hätte. Es ist einfach… wenn man gerade aufwacht…« Sie zuckte die Schultern. »Aber ich freue mich, daß Sie mich besuchen. Wenn ich ehrlich bin… ich hatte nicht damit gerechnet.«
»Ich pflege meine Versprechen zu halten«, entgegnete Manfred ernster werdend. Er zögerte einen Moment, dann griff er nach Hannelores Hand, doch als er ihr Zusammenzucken spürte, ließ er sie sofort wieder los. »Haben Sie mit Dr. Daniel gesprochen?«
Hannelore nickte. »Der Tod des Babys war nicht meine Schuld. Es hätte sowieso nicht überlebt. Trotzdem werde ich nie wieder so leichtsinnig sein.« Sie senkte den Kopf. »Vorausgesetzt, ich werde überhaupt jemals wieder schwanger.«
»Warum denn nicht?« hakte Manfred nach. »Sie sind doch noch jung. Vierundzwanzig oder fünfundzwanzig würde ich schätzen.«
Doch Hannelore schüttelte den Kopf. »Darum geht es gar nicht. Es ist vielmehr… mein Mann… ich glaube, wenn ich aus der Klinik entlassen werde… wir werden uns wohl trennen… besser gesagt, ich werde mich von ihm trennen, aber ich denke, daß das auch in seinem Sinne sein wird.«
Manfred war tief betroffen von der Traurigkeit, die er bei Hannelore spürte, gleichzeitig fühlte er, wie sein Herz ein wenig heftiger zu klopfen begann. Seit dieser zufälligen Begegnung am Waldsee hatte er immerzu an Hannelore denken müssen, doch er hatte sich gezwungen, sie aus seinem Kopf zu verbannen… und aus seinem Herzen. Sie war verheiratet, das hatte er nicht vergessen wollen. Aber nun sah es so aus, als könnte der Weg zu ihr eines Tages vielleicht doch offenstehen.
»Wegen… unserem zufälligen Zusammentreffen?« wollte Manfred wissen, obwohl er fast sicher war, daß er nicht der Grund für Hannelores Entschluß war. »Ich meine… es war doch ganz harmlos.«
Hannelore schüttelte den Kopf. »Damit hat es gar nichts zu tun. Es ist… viel komplizierter.« Sie lächelte ihn entschuldigend an. »Ich kann nicht darüber sprechen. Wir kennen uns kaum, und… ich verstehe die Zusammenhänge selbst noch nicht ganz.«
Manfred wollte etwas erwidern, doch ein ganz zaghaftes Klopfen an der Tür hielt ihn davon ab. Unwillkürlich zuckte Hannelore zusammen, doch als sich die Tür öffnete, entspannte sie sich.
»Uschi«, flüsterte sie und streckte sogleich impulsiv eine Hand aus.
Die junge Frau trat ein und musterte Manfred mit einem erstaunten Blick.
»Ach, du hast Besuch«, murmelte sie verstört.
Manfred stand sofort auf. »Nein, nein, ich sollte schon längst gehen.«
»Uschi, das ist Herr Kern«, stellte Hannelore ihren Besucher vor, ehe er das Zimmer verlassen konnte. »Wir haben uns vor einigen Tagen zufällig im Klinikpark getroffen, und heute hat er mich kurz besucht.« Sie sah Manfred an, während sie auf die junge Frau wies. »Meine Schwester Uschi.«
Mit einem freundlichen Lächeln reichte Manfred ihr die Hand. »Freut mich, Sie kennenzulernen.« Er nickte den beiden Frauen zu. »Nun will ich Sie aber nicht länger stören. Einen schönen Tag noch.«
»Ein sympathischer Mann«, urteilte Uschi, als er gegangen war, dann sah sie ihre Schwester an. »Ist es dir überhaupt recht, daß ich… ich meine… Mama hat mich angerufen.«
Wieder streckte Hannelore eine Hand aus, und diesmal ergriff Uschi sie.
»Die Situation ist ziemlich verfahren«, meinte Hannelore leise.
Uschi nickte. »Noch viel verfahrener, als du jetzt denkst.« Sie atmete tief durch. »Mama wollte es dir eigentlich selbst sagen, aber… sie kann Papa im Moment nicht allein lassen.«
Hannelore erschrak. »Was ist mit Papa? Hatte er einen Unfall?«
Uschi schüttelte den Kopf und setzte sich spontan auf die Bettkante. »Papa ist krank. Er liegt seit gestern abend in der
ThierschKlinik in München und morgen soll er operiert werden. Bis jetzt weiß man nur, daß er einen Tumor an der Niere hat.«
Mit vor Entsetzen geweiteten Augen schlug Hannelore beide Hände vor den Mund.
»Krebs?« brachte sie mit heiserer Stimme hervor.
»Möglicherweise«, entgegnete Uschi ernst. »Vielleicht ist der Tumor aber auch ganz harmlos.«
Hilflos schluchzte Hannelore auf. »Ich muß zu ihm. Meine Güte… wenn ich doch nur früher gewußt hätte…«
Obwohl Uschi die jüngere von ihnen war, nahm sie ihre Schwester jetzt doch tröstend in die Arme.
»Deine Liebe zu Harry hat dich blind und taub gemacht«, meinte sie. »Mach dir deswegen bitte keine Vorwürfe mehr. Wichtig ist nur, daß du dich in Zukunft anders verhältst.« Sie hielt Hannelore ein wenig von sich ab, so daß sie ihr in die Augen sehen konnte. »Hanni, du brauchst jetzt auch noch Erholung, außerdem denke ich, daß wir Papa nicht den Eindruck vermitteln sollten, er könnte diese Operation vielleicht nicht überleben.«
»Und wenn er sie nicht überlebt?« fragte Hannelore verzweifelt. »Wenn ich ihm nicht mehr sagen kann, wie lieb ich ihn habe.« Wieder vergrub sie das Gesicht in den Händen. »O Gott, warum erkenne ich das erst so spät?«
In diesem Moment trat Dr. Daniel ins Zimmer und erfaßte die Lage mit einem Blick.
»Sie wissen also, daß Ihr Vater in der ThierschKlinik ist«, vermutete er.
Hannelore nickte unter Tränen. »Meine Schwester hat es mir gerade gesagt.« Bittend sah sie den Arzt an. »Ich muß zu ihm. Ich will, daß er weiß…« Sie brachte die restlichen Worte nicht mehr über die Lippen.
Dr. Daniel spürte, wie wichtig dieses Gespräch für Hannelore war, und er ahnte, daß es auch für Horst Kaufmann von großer Bedeutung sein würde.
»Eine Entlassung kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verantworten«, erwiderte Dr. Daniel. »Allerdings könnte ich Sie für ein paar Stunden beurlauben.« Er sah Uschi an. »Ich nehme an, Sie sind mit dem Auto hier, oder?«
Die junge Frau nickte. »Ich werde Hannelore in die ThierschKlinik fahren und dann wieder zurückbringen.«
Dr. Daniel wandte sich seiner Patientin zu. »Sie müssen mir allerdings Papiere unterschreiben, daß Sie die Klinik auf eigenen Wunsch verlassen und pro forma muß ich Sie auch auf gesundheitliche Risiken hinweisen.« Er lächelte ein wenig. »Sie müssen keine Angst haben. Wenn es wirklich ein Risiko wäre, würde ich Sie nicht gehen lassen.«
Hannelore nickte. »Das weiß ich. Es geht da nur um verwaltungsrechtliche Dinge.« Dankbar drückte sie Dr. Daniels Hand. »Ich werde Ihnen nie vergessen, daß Sie mir das Gespräch mit meinem Vater überhaupt ermöglichen.«
*
Bereits eine halbe Stunde später konnten sich Uschi und Hannelore auf den Weg machen und erreichten am späten Vormittag die ThierschKlinik. Als sie dann vor dem Zimmer standen, in dem ihr Vater lag, blieb Hannelore zögernd stehen.
»Wir wird er reagieren?« fragte sie, und in ihrer Stimme schwang Angst mit. »Ich war so… ungerecht… habe entsetzlich viele Fehler gemacht…«
»Du wirst es nur herausbekommen, indem du hinein
gehst«, meinte Uschi.
Hannelore nickte, dann atmete sie tief durch, klopfte an und trat schließlich ein. Ihre Schwester folgte ihr.
Lena, die am Bett ihres Mannes gesessen hatte, drehte sich um, dabei schlug ihr Herz plötzlich heftiger. Wie lange war es her, daß ihre beiden Töchter so einträchtig zur Tür hereingekommen waren? Dabei machte es für Lena keinen Unterschied, daß Hannelore nicht ihre leibliche Tochter war.
Ein Blick in das Gesicht ihres Mannes zeigte Lena, daß Horst das gleiche empfand. Die Angst vor der anstehenden Operation schwand plötzlich aus seinem Gesicht und machte gelassener Zufriedenheit Platz.
»Hanni, Uschi«, murmelte er und streckte lächelnd beide Arme aus. Im nächsten Moment standen seine Töchter an seinem Bett, Hannelore ergriff die eine, Uschi die andere Hand.
»Papa, ich bin gekommen, um dir zu sagen… es tut mir so leid«, flüsterte Hannelore und war dabei schon wieder den Tränen nahe. Manchmal hatte sie das Gefühl, als hätte sie in ihrem ganzen Leben noch nicht so oft und so viel geweint, wie in den Tagen, seit sie ihr Baby verloren hatte.
Wortlos nahm Horst sie in die Arme und drückte sie liebevoll an sich. Danach bezog er auch Uschi in die Umarmung mit ein. Zutiefst bewegt betrachtete Lena dieses Bild, das endlich wieder von der Harmonie einer glücklichen Familie zeugte.
»Ich werde mich von Harry trennen«, erklärte Hannelore nach dem ersten Überschwang der Gefühle. »Nicht ohne ein ernstes Gespräch, aber… mein Entschluß steht fest. Ein Mann, der sich am Leid meiner ganzen Familie weiden konnte, kann mich niemals wirklich geliebt haben.«
Dabei bereitete ihr der Gedanke, nach fast acht Jahren wieder völlig allein dazustehen, große Angst. Sie war erst siebzehn gewesen, als sie Harry kennengelernt hatte, mit zwanzig hatte sie ihn geheiratet, und nun… fünf Jahre nach der Eheschließung sollte eine Scheidung ihr gemeinsames Leben beenden. Es war traurig, aber noch schlimmer wäre die Fortsetzung dieser Ehe, die wohl von Anfang an nur eine Farce gewesen war. Genau das wollte Hannelore allerdings noch herausbekommen… sie wollte wissen, ob es von seiner Seite tatsächlich nie auch nur einen Funken Liebe gegeben hatte…
*
Im Operationssaal der
ThierschKlinik war eine illustre Starbesetzung vertreten – so nannten es die Schwestern scherzhaft, wenn Professor Thiersch und Oberarzt Dr. Heller gemeinsam am OPTisch standen. Allerdings hüteten sich alle davor, das Wort »Starbesetzung« in Anwesenheit des Chefarztes zu verwenden. Hätte der Professor so etwas vernommen, wäre ein mittelstarker Tornado durch die Klinik gefegt.
Jetzt trat Professor Thiersch mit seinem OPTeam in den Raum. Umgehend herrschte beinahe andächtige Stille, die nur vom Piepsen der Apparate unterbrochen wurde. Der Professor verschaffte sich einen raschen Überblick über den Zustand des Patienten, dann streckte er die rechte Hand aus.
Die OPSchwester reagierte sofort und reichte ihm das Skalpell. Routiniert führte Professor Thiersch den Schnitt durch. Karina Daniel zögerte keine Sekunde, sondern setzte gleich die Operationshaken an. Der Professor warf ihr einen kurzen, anerkennenden Blick zu, dann konzentrierte er sich auf das Operationsfeld.
»O mein Gott«, stieß Dr. Heller in diesem Moment hervor. »An der Innenseite der linken Niere befindet sich ja auch ein Tumor.«
Professor Thiersch nickte. »Der war weder auf Ultraschall noch auf dem Röntgenbild zu sehen.« Vorsichtig entfernte er den Tumor von der linken Niere. »Schnellschnittverfahren.«
Der junge Assistenzarzt, der den Tumor in einer keimfreien Schale entgegengenommen hatte, wußte sofort, was er zu tun hatte. Eiligst brachte er den Tumor ins Labor und wartete hier auf die Auswertung.
Währenddessen ging Professor Thiersch schon daran, die rechte Niere samt Tumor vollständig zu entfernen, da hier kein anderer Weg mehr möglich war. Er war gerade damit fertig, als der Assistenzarzt zurückkehrte.
»Positiv«, meldete er.
»So ein Mist«, entfuhr es Professor Thiersch. Ein positives Ergebnis bedeutete, daß sich im Tumor bösartige Zellen gefunden hatten.
»Wenn Sie ihm die zweite Niere auch herausnehmen, ist er auf die Dialyse angewiesen«, gab Dr. Heller zu bedenken.
»Das weiß ich auch«, raunzte der Professor unwirsch zurück. »Wenn ich sie ihm drinnlasse, ist er in einem Monat wieder hier und hat womöglich Metastasen. Dialyse ist immer noch besser als ein langsamer Krebstod. Im übrigen werde ich ihn gleich auf die Liste für Organempfänger setzen.«
Trotzdem nahm der Professor die zweite Niere nur schweren Herzens heraus, und als der Eingriff beendet war, blieb er persönlich bei dem Patienten, bis dieser dann aus der Narkose erwachte.
»Herr Kaufmann, können Sie mich hören?« fragte er.
Horst blickte in die blauen Augen hinter der dicken Hornbrille und nickte schwach.
»Werde ich… wieder… gesund?« wollte er mit heiserer, unsicherer Stimme wissen, doch der Professor wurde einer Antwort enthoben, weil Horst nahezu im gleichen Augenblick unter den Nachwirkungen der Narkose wieder einschlief.
Professor Thiersch betrachtete ihn eine Weile, dann trat er auf den Flur, wo Lena Kaufmann unruhig auf und ab ging. Ihre Tochter Uschi leistete ihr dabei Gesellschaft, während Hannelore ja wieder in der WaldseeKlinik lag.
Der Professor zögerte einen Moment, dann ging er mit raschen, energischen Schritten davon. Das Gespräch mit Ehefrau und Tochter würde er seinem Oberarzt überlassen. Dr. Heller war dafür geeigneter, denn Professor Thiersch wußte wirklich gut genug, daß er selbst nicht über den nötigen einfühlsamen Ton verfügte.
Dr. Heller, der mit diesem »Auftrag« schon gerechnet hatte, hatte sich seine Worte auch bereits zurechtgelegt.
»Frau Kaufmann«, sprach er Lena behutsam an.
Sie fuhr herum und erkannte an dem ernsten Gesicht des Arztes, daß sich ihre Hoffnung nicht erfüllen würde. Horst würde nicht mehr gesund werden.
»Metastasen?« fragte sie leise und wunderte sich selbst darüber, daß sie es schaffte, ihre Fassung zu bewahren.
Dr. Heller schüttelte den Kopf. »Nein, Frau Kaufmann, Ihr Mann hat glücklicherweise keine Metastasen, aber… es war nicht nur der Tumor an der rechten Niere, sondern… Professor Thiersch war gezwungen, beide Nieren zu entfernen.«
Erschüttert preßte Lena eine Hand vor den Mund. »Das bedeutet… Dialyse… ein Leben lang…«
»Ihr Mann steht bereits auf der Liste für Organempfänger, allerdings… ich will ehrlich sein: Es wird nicht ganz leicht sein, für ihn einen Spender zu finden. Er hat einen sehr ausgefallenen Gewebetyp.«
Lena sackte förmlich zusammen. »Weiß er es schon?«
Dr. Heller schüttelte den Kopf. »Nein, im Moment steht er noch unter der Einwirkung des Narkosemittels. Diese Wahrheit kann man ihm erst zumuten, wenn er sich von der Operation ein bißchen erholt hat.«
»Kann ich meinem Vater denn eine Niere spenden?« mischte sich Uschi in diesem Moment ein. »Ich bin seine Tochter… ich meine, da müßte ich doch eigentlich denselben Gewebetyp haben.«
»Das muß nicht zwangsläufig so sein«, entgegnete Dr. Heller. »Aber wir können den Test gern durchführen.« Er schwieg kurz. »Bevor Sie sich allerdings endgültig entscheiden…«
»Ich habe mich bereits entschieden«, fiel Uschi ihm ins Wort. »Wenn mein Gewebetyp mit dem meines Vaters übereinstimmt, werde ich ihm eine Niere spenden.«
Dr. Heller erkannte, daß es sinnlos gewesen wäre, in diesem Moment mit der jungen Frau über mögliche Risiken zu sprechen. Das konnte man immer noch, wenn der Test erst durchgeführt war. Allerdings machte das Ergebnis weitere Diskussionen dann schon nicht mehr erforderlich, denn Uschis Gewebetyp stimmte mit dem ihres Vaters nicht überein. Ganz selbstverständlich ließ sich auch Lena testen, doch es ergab sich dasselbe Ergebnis.
»Ein Leben an der Dialyse übersteht Papa nicht«, erklärte Uschi verzweifelt. »Er wird daran zugrunde gehen.«
*
Hannelore wagte sich den ganzen Vormittag keinen Meter vom Telefon weg. Am liebsten wäre sie sowieso aus dem Krankenhaus geflüchtet und in die ThierschKlinik geeilt, um in der Nähe ihres Vaters zu sein.
Dann endlich klingelte das Telefon, und Hannelore riß den Hörer förmlich an ihr Ohr.
»Mama?« Sie schrie es fast hinein, und als sie das Schluchzen am anderen Ende der Leitung hörte, dachte sie gleich an das Allerschlimmste. »Nein! O Gott, nein!«
»Hanni.« Es war Uschis Stimme, die jetzt erklang. »Sie mußten Papa beide Nieren entfernen. Weißt du, was das bedeutet?«
»Ja«, flüsterte Hannelore betroffen. »Ausgerechnet Papa…«
»Der Professor hat ihn auf die Liste der Organempfänger gesetzt, aber Papas Gewebetyp ist äußerst selten… nicht einmal ich habe denselben, dabei bin ich seine Tochter…«
Hannelore reckte sich hoch. »Ich bin auch seine Tochter.« Sie legte den Hörer auf und lief aus ihrem Zimmer. Wie gehetzt blickte sie sich um, dann sah sie Dr. Daniel aus dem Schwesternzimmer kommen.
»Herr Doktor!« rief sie mit sich überschlagender Stimme. »Ich muß wissen, ob ich denselben Gewebetyp habe wie mein Vater! Können Sie mich in die ThierschKlinik bringen…«
»Langsam, Frau Jung«, bat Dr. Daniel. »Was ist denn überhaupt los?«
»Meinem Vater mußten beide Nieren entfernt werden«, erzählte Hannelore aufgeregt. »Ich kenne ihn… ein Leben lang Dialyse… damit wird er nicht fertig. Uschi sagt, er hätte einen seltenen Gewebetyp, aber ich bin doch seine Tochter. Vielleicht…«
»Dr. Scheibler wird den Test machen«, fiel Dr. Daniel ihr sanft ins Wort. »Er kann das auch. Kommen Sie, Frau Jung.«
Als das Testergebnis vorlag, rief Dr. Scheibler persönlich bei Professor Thiersch an und gab ihm die nötigen Werte durch.
»Das ist ja nahezu ideal«, stellte der Professor fest. »Ich werde sofort im Transplantationszentrum anrufen und einen Termin vereinbaren. Allerdings gehe ich davon aus, daß Sie die Patientin über die Risiken aufklären werden.«
»Selbstverständlich, Herr Professor«, sicherte Dr. Scheibler zu, doch ein einziger Blick in Hannelores Gesicht bewies ihm, daß er sich das eigentlich sparen konnte. Der Entschluß der jungen Frau stand fest – gleichgültig, was Dr. Scheibler an Argumenten vorbringen würde. Hannelore Jung würde kein Risiko scheuen, um ihrem Vater zu helfen.
*
Seit jenem unerfreulichen Gespräch mit Dr. Daniel hatte sich Harald Jung in der Klinik nicht mehr sehen lassen. Erst an Hannelores Entlassungstag tauchte er wie aus dem Boden gewachsen plötzlich wieder auf.
Sehr ernst blickte Hannelore ihn an.
»Warum?« fragte sie dann nur.
Harald erwiderte ihren Blick. »Ich wollte euch dieselben Schmerzen zufügen, die ich selbst durchleiden mußte.«
Hannelore fürchtete sich vor ihrer nächsten Frage. »Dann hast du mich… nie geliebt? Es war… immer nur Rache?«
Harald nickte ohne zu zögern. Es hatte keinen Sinn mehr zu lügen oder gar eine nie empfundene Liebe zu heucheln.
Fassungslos schüttelte Hannelore den Kopf. »Ich verstehe es einfach nicht. Warum ausgerechnet meine Familie?«
»Sie ist an allem schuld!« stieß Harald haßerfüllt hervor.
»Sie?«
»Deine Stiefmutter«, klärte Harald sie auf. »Hätte sie damals meinen Vater geheiratet…« Er stockte, doch es war schon zu spät. Hannelore begriff die Zusammenhänge bereits.
»Mama war also die Frau, die dein Vater liebte und die dann einen anderen Mann geheiratet hat«, flüsterte sie betroffen. »Wieso hat sie das nicht gewußt? Ich meine… wenn sie deinen Vater kannte, dann hätte sie bei deinem Namen doch zumindest stutzig werden müssen.«
»Ich wurde ein Leben lang nur herumgeschubst«, entgegnete Harald voller Bitterkeit. »Dabei sah anfangs alles so gut aus. Ich war sieben, als mein Vater deine Stiefmutter kennenlernte. Er hat sie geliebt, und ich habe sie vergöttert, aber dann trat dein Vater in ihr Leben. Sie hat ihn geheiratet und dir die Mutter ersetzt, die ich mir gewünscht hatte. Mein Vater heiratete die nächstbeste Frau, die ihm über den Weg lief. Ich mußte weg von meiner Heimat… meinen Freunden… und durchlebte dabei die Hölle. Als mein Vater starb, wurde alles noch viel schlimmer… bis meine Stiefmutter dann ein zweites Mal heiratete. Ich wurde von meinem neuen Vater adoptiert und bekam den Namen Jung. Ich glaube, er konnte mich ganz gut leiden.« Er schwieg eine Weile. »Ich war fast dreiundzwanzig, als ich endlich wieder nach München kam. Von hier aus war es nicht weit bis Steinhausen und so machte ich mich auf die Suche nach der Frau, die ich mir einst als Mutter gewünscht hatte. Es war nicht schwierig, sie zu finden und die Tatsache, daß sie zwei Töchter hatte, machte alles noch viel einfacher. Deine Schwester war mit ihren damals fünfzehn Jahren zu jung für mich, also fiel meine Wahl auf dich.« Er lächelte herablassend. »Es war ein Kinderspiel, dich herumzukriegen, und als du von deinen Eltern die Wahrheit erfahren hast, bedurfte es nur noch ein paar gezielter Verdächtigungen, um dich gegen deine Eltern und deine Schwester aufzuhetzen.«
»Ich war also von Anfang an nur ein Instrument deiner Rache.« Hannelore konnte es noch immer nicht glauben. Ihre Ehe war tatsächlich nichts als Lüge gewesen. »Beinahe hätten wir ein Kind gehabt.«
Ungerührt zuckte Harald die Schultern. »In diesem Spiel mußte ich eben auch ein paar schlechte Karten einstecken. Die Ehe mit dir war gelegentlich recht anstrengend. Dein ständiges Gesäusel von Liebe… während ich für euch alle nur Haß empfand.« Sein Gesicht verzerrte sich vor Zorn. »Du und dein Vater… ihr habt mein Leben zerstört.«
»Ich glaube, das reicht jetzt«, mischte sich Dr. Daniel in diesem Moment ein. Er hatte gesehen, wie Harald angekommen war, und sich sicherheitshalber in der Nähe aufgehalten, um notfalls eingreifen zu können. Dieser Notfall schien ihm nun gekommen zu sein.
Harald fuhr herum. »Was wollen Sie denn schon wieder?«
Dr. Daniel blieb bewundernswert ruhig. »Herr Jung, Ihr Haß und Ihre Rachegefühle haben in all den Jahren bedenkliche Formen angenommen. Ich rate Ihnen dringend, sich in ärztliche Behandlung zu begeben.«
»Soll ich Ihnen sagen, was Sie mit Ihrem Rat tun können?« fragte Harald herausfordernd.
»Nein, ich kann es mir auch so vorstellen«, entgegnete Dr. Daniel ruhig. »Aber wenn Sie meinen Rat nicht befolgen wollen, dann hören Sie sich wenigstens meine Bitte an. Sie haben das Glück dieser Familie beinahe zerstört. Lassen Sie es dabei bewenden, und gehen Sie weg von hier.«
Harald nickte. »Das können Sie haben.« Er sah Hannelore an. »Ich will nur noch die Scheidung.«
»Ich auch«, erwiderte Hannelore tonlos. Sie hatte das Gefühl, als wäre alles in ihr zu Eis erstarrt. Wie sollte sie nach alldem jemals wieder Liebe für einen Mann empfinden?
Sie sah Harald nach, der jetzt in sein Auto stieg und davonfuhr.
»Er hat acht Jahre meines Lebens zerstört«, murmelte sie, dann drehte sie sich zu Dr. Daniel um… wie sie zumindest dachte. Doch vor ihr stand nicht der Arzt, den sie eigentlich erwartet hatte, sondern Manfred Kern.
»Ich habe wohl mehr mitbekommen, als sich für mich schicken würde«, gestand er etwas verlegen. »Normalerweise lausche ich nicht, aber in diesem Fall… vielleicht war es ja sogar ganz gut.«
Hannelore schüttelte den Kopf. »Ich kann mich nach all dem nicht gleich auf eine neue Beziehung einlassen. Es würde bestimmt schiefgehen, Fredi.«
Manfred nickte. »Das sollst du ja auch gar nicht.« Ganz selbstverständlich duzte er sie, dann griff er nach ihrer Hand. »Nimm nur meine Freundschaft… alles andere wird sich dann von allein finden.«
Da brachte Hannelore sogar ein kaum sichtbares Lächeln zustande. »Danke, Fredi.«
*
Einen Tag vor der geplanten Nierentransplantation machte Horst plötzlich einen Rückzieher.
»Ich kann das nicht«, stieß er hervor, sah erst seine Frau, dann seine beiden Töchter an. Schließlich blieb sein Blick an Hannelore hängen. »Ich kann einfach nicht verlangen, daß du dich für mich verstümmeln läßt.«
Sehr sanft streichelte Hannelore über seine Wange. »Ich lasse mich nicht verstümmeln, Papa. Ich spende dir eine Niere, schließlich brauche ich ja keine zwei.«
Horst schüttelte den Kopf. »So darfst du es nicht sehen, Hanni. Wenn du einmal eine solche Krankheit bekommen würdest, dann… dann wärst du auch auf einen Spender angewiesen. Hanni… überleg es dir…«
»Das habe ich bereits, und mein Entschluß steht unumstößlich fest.« Sie griff nach der Hand ihres Vaters und drückte sie. »Papa, Dr. Scheibler hat mir alles haarklein erklärt, und der Arzt, der die Transplantation morgen vornehmen wird, hat auch mit uns gesprochen. Wir kennen die Risiken. Meine Niere könnte von deinem Körper abgestoßen werden… du wirst ein Leben lang Medikamente gegen diese Abstoßungsreaktion nehmen müssen. Eine harmlose Grippe kann für dich zu einem Todesurteil werden. Papa, du gehst doch ein viel größeres Risiko ein als ich. Wenn du sagen würdest, daß du vor einem solchen Leben Angst hast, dann könnte ich das akzeptieren, aber wenn du nur meinetwegen kneifen willst…« Sie schüttelte den Kopf.
Horst seufzte. »Ich habe Angst vor diesem Leben, andererseits… dem gegenüber steht nur ein Dasein mit der Dialyse, und ich glaube, alles andere ist besser als das.« Hilfesuchend sah er seine Frau an. »Was würdest du an meiner Stelle tun?«
»Wenn mein Gewebetyp mit dem deinen übereingestimmt hätte, wäre ich ebenfalls bereit gewesen, dir eine Niere zu spenden – ohne Wenn und Aber«, antwortete Lena ruhig. »Also, ich an deiner Stelle würde das Geschenk meiner Tochter annehmen. Ich würde mir Sorgen um sie machen… dieselben Gedanken, die du hattest, haben mich auch beschäftigt, aber wie Hanni schon sagte – wir alle kennen die Risiken. Wenn sie trotzdem bereit ist, dir zu helfen, solltest du diese Hilfe nicht ausschlagen.«
Horst nickte nachdenklich, dann blickte er Hannelore wieder an. »Eine letzte Frage habe ich noch, Hanni, und ich erwarte eine absolut ehrliche Antwort. Tust du es, weil du mich liebst oder weil du wegen der vergangenen Jahre ein schlechtes Gewissen hast?«
»Aus beiden Gründen«, antwortete Hannelore ehrlich. »Ja, natürlich habe ich ein schlechtes Gewissen. Ich hatte eine wundervolle Kindheit und Jugend, also hätte ich mehr Vertrauen zu euch haben müssen. Ich hätte wissen müssen, daß all das, was Harry gesagt hat, eine einzige Lüge war. Aber ich liebte ihn, und meine Liebe hat mich für die Wahrheit blind gemacht. Ja, Papa, ich habe ein furchtbar schlechtes Gewissen, aber das macht nur einen winzigen Teil meiner Entscheidung aus. Der Hauptgrund ist, daß ich dich liebe… daß ich es nicht ertragen könnte, dich leiden zu sehen.«
Die Worte trieben Horst Tränen in die Augen. Spontan nahm er seine Tochter in die Arme und drückte sie zärtlich an sich.
»Dann lassen wir uns morgen also operieren«, flüsterte er ergriffen. Er schaute Lena an und zog sie und Uschi ebenfalls in diesen engen Kreis. »Wir haben endlich wieder eine Familie.«
*
Einen Monat später stattete die gesamte Familie Kaufmann Dr. Daniel einen Besuch ab. Natürlich hatte Lena dem Arzt längst erzählt, daß die Operation ohne Komplikationen gut verlaufen war. Hannelores gespendete Niere arbeitete in Horsts Körper einwandfrei, und der Arzt, der ihn betreute, war guter Dinge, daß das auch so bleiben würde. Zu einer hyperakuten Abstoßung, die innerhalb der ersten achtundvierzig Stunden erfolgen würde, war es nicht gekommen, und aufgrund der Gewebeähnlichkeit zwischen Vater und Tochter rechnete der Arzt auch nicht mit einer akuten oder chronischen Abstoßungsreaktion, obwohl man dies zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht präzise vorhersagen konnte. Die Medikamente, die Horst nun auf Dauer einnehmen mußte, bargen zwar gewisse Risiken, aber der Arzt hatte gesagt, daß er jede Menge Patienten kennen würde, die damit gut leben. Horst war daher zuversichtlich, daß es bei ihm genauso sein würde und seine eigene Zufriedenheit färbte auch auf den Rest der Familie ab, wie Dr. Daniel nun unschwer feststellen konnte.
»Ich freue mich aufrichtig, daß für Sie letztlich doch noch alles gut ausgegangen ist«, meinte er.
»Daran waren Sie nicht unmaßgeblich beteiligt«, entgegnete Hannelore. »Sie waren es, der mir die Augen geöffnet hat.« Sie senkte einen Augenblick lang den Kopf. »Harry ist seit einer Woche übrigens in psychiatrischer Behandlung.«
Dr. Daniel war sichtlich erstaunt. »Ich hätte nicht gedacht, daß er meinen Rat befolgen würde.«
»Hat er auch nicht«, erwiderte Hannelore. »Er ist betrunken Auto gefahren und hat einen Unfall gebaut – nicht schlimm, fast nur Blechschaden, er selbst trug allerdings einige leichte Verletzungen davon. Aber in dem Krankenhaus, in das er eingeliefert wurde, hat man seine psychische Störung festgestellt. Er muß sich dort wie ein Wilder gebärdet haben. Daraufhin wurde er in eine psychiatrische Klinik überstellt. Vor dem Gesetz bin ich ja immer noch seine Ehefrau – so lange, bis die Scheidung rechtskräftig ist. Daher wurde mir mitgeteilt, daß die Behandlung seines offensichtlich schweren Kindheitstraumas dringend erforderlich wäre. Aufgrund einer akuten Selbstgefährdung kann man ihn im Moment noch zwangsweise in der Klinik behalten.«
Dr. Daniel nickte teilnahmsvoll. »Das ist eine tragische Geschichte, aber ich bin sicher, daß man ihm helfen kann, wenn er es nur zuläßt.«
»Das wird das Problem sein«, fürchtete Hannelore, dann zuckte sie die Schultern. »Er tut mir leid, aber an meinem Entschluß, mich scheiden zu lassen, wird das nichts ändern – ganz davon abgesehen, daß Harry ja selbst die Ehe gar nicht aufrechterhalten will. Schließlich hat er mich nur geheiratet, um sich an Mama rächen zu können.«
»Das trifft mich am meisten«, mischte sich Lena jetzt ein. »Es ist schrecklich für mich, daß ich diesem Jungen einst so weh getan habe.« Sie seufzte leise. »Dabei hat er die Situation damals völlig mißverstanden. Zwischen seinem Vater und mir gab es nie mehr als eine harmlose Freundschaft. Wir sind zusammen zur Schule gegangen, und als seine Frau später dann auf so tragische Weise verunglückte, habe ich nur versucht, ihn ein bißchen zu trösten… ihm über die ersten schweren Monate hinwegzuhelfen. Zu jenem Zeitpunkt kannte er auch seine spätere Frau schon, und er hat sie sehr geliebt, das hat er mir oft genug gesagt. Ich kannte sie ja auch, und niemand konnte ahnen, daß sie den armen Jungen einmal so mißhandeln würde.«
»Man kann eben doch in keinen Menschen hineinschauen«, meinte Dr. Daniel.
In diesem Moment trat noch jemand in diesen Kreis: Manfred Kern.
»Ich habe gehört, daß ihr wieder in Steinhausen seid«, meinte er, sah dabei aber nur Hannelore an. »Da hat es mich zu Hause natürlich nicht mehr gehalten.« Er lächelte geheimnisvoll. »Im übrigen ist mein Zuhause jetzt nicht mehr sehr weit weg von hier. Ich habe Würzburg nämlich mit Steinhausen vertauscht.«
»Fredi! Das ist ja wunderbar!« rief Hannelore begeistert.
Wohlwollend betrachtete Dr. Daniel die beiden jungen Menschen. Er wußte, daß es für Hannelore noch viel zu früh war, um an eine Liebesbeziehung zu denken, doch die Freundschaft zu Manfred tat ihr augenscheinlich sehr gut. Und Dr. Daniel war sicher, daß aus dieser Freundschaft eines Tages mehr werden würde… es stand in ihren Augen.
Zufrieden blickte Dr. Daniel auf das Bild, das sich ihm bot – ein Bild, das von den kommenden, glücklichen Tagen dieser Familie zeugte…