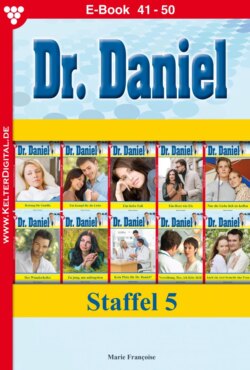Читать книгу Dr. Daniel Staffel 5 – Arztroman - Marie-Francoise - Страница 5
ОглавлениеEs war ein typischer Montagmorgen in der Praxis von Dr. Robert Daniel. Die Patientinnen gaben sich buchstäblich die Türklinke in die Hand, und die junge Empfangsdame Gabi Meindl war schier am Verzweifeln, weil die Hälfte der hereinströmenden Damen ohne Termin gekommen war, aber jede Patientin hatte angeblich etwas ganz Dringendes mit dem Herrn Doktor zu besprechen, so daß Gabi sie auch nicht einfach wieder wegschicken konnte.
Während das Wartezimmer bereits aus allen Nähten zu platzen drohte, kam dann noch ein alarmierender Anruf aus der Steinhausener Waldsee-Klinik, deren Direktor Dr. Daniel zusätzlich auch noch war.
»Bei der Geburt von Frau Heidenraths Baby gibt es Probleme«, erklärte die Stationsschwester der Gynäkologie hastig. »Bitte, Fräulein Meindl, schicken Sie sofort den Herrn Doktor hierher.«
»Wie stellen Sie sich das denn vor?« fragte Gabi verzweifelt. »In der Praxis herrscht gerade die reinste Invasion!«
»Und hier liegt möglicherweise eine Patientin im Sterben!« entgegnete Schwester Bianca heftiger, als es normalerweise ihre Art war. »Frau Dr. Reintaler ist im OP. Ich brauche Dr. Daniel im Kreißsaal, und das so schnell wie möglich!«
Gabi seufzte tief auf. »In Ordnung. Er wird in ein paar Minuten drüben sein.« Sie legte den Hörer auf, hob aber sofort wieder ab und drückte auf den Knopf, der eine direkte Verbindung zum Sprechzimmer herstellte, dann wartete sie, bis Dr. Daniel drüben abnahm. »Herr Doktor, die Waldsee-Klinik braucht Sie dringend. Bei einer Frau Heidenrath gibt es Probleme.«
»Das war zu erwarten«, meinte Dr. Daniel. »Ich fahre sofort hin-über.«
Gabi nickte ergeben. Sie wußte genau, was das für sie und ihre Kollegin, die Sprechstundenhilfe Sarina von Gehrau, bedeutete. Sie hatten jetzt nämlich die undankbare Aufgabe, alle Patientinnen auf den Nachmittag zu vertrösten oder sie warten zu lassen, bis Dr. Daniel wieder zurückkam. Das konnte in diesem Fall allerdings eine ganze Weile dauern.
»Ich weiß nicht, bis wann ich wieder hier sein kann«, erklärte Dr. Daniel auch schon, dann verließ er im Laufschritt die Praxis, stieg in sein Auto und fuhr den kurzen Weg zur Waldsee-Klinik. Hier wurde er auch schon dringend erwartet.
»Eine plötzliche Wehenschwäche«, erklärte die Hebamme Anna Lüder, die inzwischen regelmäßig in der Klinik aushalf. »Ich habe ihr zwar…«
In diesem Augenblick erklang aus dem Kreißsaal ein gellender Schrei.
»Ich schätze, die Wehen sind wieder da«, meinte Dr. Daniel und eilte in den nur schwach erleuchteten Raum. In der Waldsee-Klinik wurde die sanfte Geburt nach Fréderick Leboyer praktiziert – das bedeutete, daß die Babys hier in einen warmen, etwas abgedunkelten Raum hineingeboren wurden. Doch jetzt brauchte Dr. Daniel unbedingt Licht, und Schwester Bianca richtete sofort eine an der Decke installierte Operationslampe auf das Bett.
»Herr Doktor…«, stöhnte Gunilla Heidenrath, während ihr ganzer Körper unter dem heftigen Wehenschmerz, der urplötzlich wieder eingesetzt hatte, erbebte.
»Ganz ruhig, Frau Heidenrath«, versuchte Dr. Daniel sie zu besänftigen. »Wir schaffen das schon.«
Dabei war er sich dessen im Moment gar nicht so sicher. Ähnlich einer Sturzgeburt, wurde das Baby durch die nicht nachlassenden Wehen aus dem Geburtskanal gedrückt. Es ging so schnell, daß Dr. Daniel gar nicht mehr helfend eingreifen konnte. Und durch das nachströmende Blut war er im Moment daran gehindert zu erkennen, ob diese viel zu rasche Geburt bei der Mutter zu irgendwelchen Verletzungen geführt hatte.
Völlig erschöpft lag Gunilla auf dem breiten Bett. Die Hebamme hatte ihr das Baby auf den Bauch gelegt, wie es hier üblich war, und mit einem flauschigen Tuch zugedeckt, doch Gunilla war im Moment zu schwach, um das winzige Wesen auch nur zu berühren.
»Ist es… vorbei?« stammelte sie.
»Ich fürchte, noch nicht ganz«, entgegnete Dr. Daniel, dann ging er daran, das Baby abzunabeln. Auch das war normalerweise nicht üblich, denn man ließ Mutter und Kind etwas Zeit, miteinander zu schmusen, bevor man die Abnabelung vornahm, doch in diesem Fall galten andere Voraussetzungen.
»Schwester Bianca, nehmen Sie das Kind einen Augenblick an sich«, bat Dr. Daniel, während er darauf wartete, daß die Plazenta ausgestoßen wurde.
Währenddessen lag Gunilla noch immer völlig regungslos auf ihrem Bett.
»Ist es… endlich ein Junge?«
Die Frage kam schwach und kaum hörbar, trotzdem hatte Schwester Bianca sie verstanden und kontrollierte nun sehr vorsichtig das Geschlecht des Babys, das sie im Arm hielt.
»Nein, Frau Heidenrath, es ist ein kleines Mädchen«, antwortete sie.
Gunilla schluchzte leise auf. »O Gott… ich habe so gehofft… Helmut wird…« Der Rest des Satzes war nur noch ein unverständliches Gemurmel.
Inzwischen hatte Dr. Daniel die Plazenta auf ihre Vollständigkeit untersucht.
»Es hört nicht auf zu bluten«, flüsterte ihm Anna Lüder zu.
Dr. Daniel nickte. »Das Problem hatten wir schon bei der letzten Entbindung – allerdings nicht ganz so schlimm wie diesmal.« Er wandte sich der Schwester zu. »Bianca, ich brauche dringend eine Ampulle Ergometrin. Schnell.«
Die Hebamme nahm das Baby an sich, während Bianca das Medikament in einer Spritze aufzog und sie Dr. Daniel reichte. Er injizierte die Lösung rasch und geschickt, während Gunilla Heidenrath langsam in eine tiefe Bewußtlosigkeit hineindämmerte.
»Herr Doktor, die Frau stirbt uns weg«, erklärte Bianca mit bebender Stimme, doch Dr. Daniel schüttelte den Kopf.
»Der Blutverlust ist zwar sehr hoch, aber zumindest im Moment habe ich noch alles unter Kontrolle.« Er zögerte einen kurzen Augenblick. »Uns bleibt nichts anderes übrig, als eine Bluttransfusion vorzunehmen. Das Medikament wird zwar rasch wirken und die Blutung zum Stillstand bringen, aber ich fürchte, der Blutverlust ist zu hoch, als daß der Körper ihn allein ausgleichen könnte.«
Im Laufschritt verließ die Krankenschwester den Kreißsaal und kehrte wenig später mit einer Blutkonserve und einer Flasche Kochsalzlösung zurück. Währenddessen hatte Dr. Daniel schon den Zugang gelegt und brauchte nun bloß noch die Infusion anzuschließen.
»Ich glaube, wir haben’s geschafft«, meinte Dr. Daniel, als er sah, daß die Unterleibsblutungen zum Stillstand gekommen waren. Auch bei der Bluttransfusion schien es keine Komplikationen zu geben. »Trotzdem werden wir Frau Heidenrath auf die Intensivstation legen müssen. Im Augenblick kann ich ein nochmaliges Nachbluten nicht ausschließen, und solange die Transfusion läuft, müssen regelmäßig Puls, Blutdruck und Temperatur kontrolliert werden.« Dann wandte er sich der Hebamme zu. »Wie geht’s dem Kind?«
»Auf jeden Fall besser als der Mutter«, meinte Anna Lüder, dann warf sie der noch immer bewußtlosen Gunilla einen kurzen Blick zu. »Sie hätte nach dem vierten Kind schon sterilisiert gehört.«
Dr. Daniel seufzte. »Das ist leider ein Kapitel für sich, Frau Lüder. Ich nehme ja an, daß Sie Herrn Heidenrath kennen.«
»Und ob! Ich kann allerdings nicht sagen, daß ich darüber sehr erfreut bin. Dieser Mann ist ein rücksichtsloser Egoist, der sich den Teufel um seine arme Frau schert. Irgendwann wird er sie damit noch umbringen.«
Dr. Daniel gab der aufgebrachten Hebamme ein Zeichen, nicht mehr weiterzusprechen, weil er bemerkte, daß Gunilla langam zu sich kam. Jetzt setzte er sich zu ihr und griff nach ihrer Hand.
»Nun, Frau Heidenrath, wie fühlen Sie sich?« fragte er besorgt.
»Müde«, murmelte Gunilla schwach, dann sah sie Dr. Daniel an. »Weiß Helmut schon, daß es wieder nur ein Mädchen ist?«
»Was heißt denn ›nur‹, Frau Heidenrath?« entgegnete Dr. Daniel mit einem tadelnden Unterton in der Stimme. »Sie sollten froh sein, daß die Kleine gesund ist. Dabei fällt mir ein…« Er wandte sich Anna Lüder zu. »Rufen Sie bitte den Chefarzt. Er soll die Kleine vorab schon mal untersuchen. Ich werde mich heute gleich mit dem Kinderarzt aus der Kreisstadt in Verbindung setzen.«
Anna Lüder verzog das Gesicht. »Doch nicht dieses eingebildete Ekel.«
»Dr. Bürgel mag vielleicht nicht der sympathischste Mensch sein, aber als Kinderarzt ist er erstklassig.«
»Möglich«, brummelte Anna, obwohl sie ja selbst wußte, was für ein guter Arzt Dr. Bürgel war Aber er war eben leider auch schrecklich arrogant, was der guten Anna überhaupt nicht gefiel.
»Außerdem sollte die Waldsee-Klinik längst über einen eigenen Kinderarzt verfügen«, setzte sie noch hinzu.
»Ich weiß«, entgegnete Dr. Daniel. »Leider kann ich mir keinen aus dem Ärmel schütteln, und wirklich gute Kinderärzte gibt’s auch nicht wie Sand am Meer.« Dann sah er Gunilla wieder an. »Sie machen sich Sorgen wegen Ihres Mannes, nicht wahr?«
Gunilla nickte. »Er wird rasen vor Zorn, weil es wieder kein Junge geworden ist.«
»Ich werde mit ihm sprechen«, erklärte Dr. Daniel ohne zu zögern. Und ihm gehörig die Meinung sagen, fügte er in Gedanken hinzu.
»Danke, Herr Doktor«, flüsterte Gunilla, dann fielen ihr die Augen wieder zu.
Dr. Daniel stand auf.
»Bianca, bringen Sie Frau Heidenrath auf Intensiv«, ordnete er an. »Ich sehe heute nachmittag noch einmal nach ihr. Sollten erneut Unterleibsblutungen auftreten, dann benachrichtigen Sie mich umgehend, ja?«
»Selbstverständlich, Herr Doktor.«
*
Unruhig marschierte Helmut Heidenrath in der Eingangshalle hin und her. Warum dauerte es denn so lange? Mittlerweile sollte Gunilla im Kinderkriegen doch schließlich ein wenig Übung haben! Unwillig sah er auf die Uhr. Seit vier Stunden war er nun schon hier!
In diesem Moment trat Dr. Daniel aus der Gynäkologie in die Eingangshalle und steuerte direkt auf Helmut Heidenrath zu.
»Und? Ist es diesmal endlich ein Junge?« fragte Helmut ohne den Arzt überhaupt zu begrüßen.
»Guten Tag, Herr Heidenrath«, erklärte Dr. Daniel mit Nachdruck und zeigte dabei seine Mißbilligung über Helmuts unhöfliche Art ganz deutlich. »Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer Tochter.«
Entsetzt starrte Helmut ihn an. »Tochter?« Dann donnerte er seine rechte Faust gegen die Wand. »Meine Güte, ist diese Frau denn wirklich nicht fähig, mir endlich einen Sohn zu schenken? Vier Gören habe ich schon zu Hause sitzen, und nun…«
»Was fällt Ihnen eigentlich ein, sich hier in der Klinik dermaßen aufzuführen!« fiel Dr Daniel ihm barsch ins Wort. Normalerweise schlug er keinen so groben Ton an, doch das Verhalten, das dieser Mann nun schon seit Jahren an den Tag legte, brachte selbst ihn auf die Palme.
»Ist doch wahr«, knurrte Helmut. »Im Mittelalter wurden die Frauen hingerichtet, wenn sie ihren Männern keine Söhne schenken konnten.«
»Und Sie sind auf dem besten Weg, dasselbe zu tun«, entfuhr es Dr. Daniel. »Im übrigen unterliegen Sie schon rein biologisch einem großen Irrtum. Nicht die Frau, sondern der Mann bestimmt das Geschlecht des Kindes. Also sind Sie es, der anscheinend keine Söhne zeugen kann, wenn man in einem solchen Fall schon eine Schuldzuweisung vornehmen will.«
Sekundenlang blieb Helmut der Mund offen.
»Sagen Sie mal, wie sprechen Sie denn mit mir?« ereiferte er sich dann.
»So, wie Sie es wohl auch verdienen, und vor allen Dingen in der gebotenen Deutlichkeit, denn sanftere Hinweise verstehen Sie ja leider nicht«, entgegnete Dr. Daniel. »Ich habe Ihnen nach Kristins Geburt schon gesagt, daß Ihre Frau kein Kind mehr bekommen solle. Das ist jetzt ein gutes Jahr her, und nun liegt sie schon wieder auf der Entbindungsstation.« Er schwieg einen Moment, dann fuhr er fort: »Heute wäre uns Ihre Frau beinahe weggestorben. Ich sage es Ihnen jetzt also ausdrücklich, Herr Heidenrath: Bei einer weiteren Schwangerschaft könnte ich für das Leben Ihrer Frau nicht mehr garantieren.«
Ungerührt sah Helmut ihn an. »Das haben Sie letzten Mal auch schon angedeutet, und Gunilla hat diese Geburt trotzdem überstanden.« Er schwieg einen Moment. »Ich sage Ihnen jetzt auch etwas in aller Deutlichkeit, Herr Doktor: Ich will einen Sohn und Stammhalter haben – um jeden Preis. Das heißt, daß Gunilla mir so viele Kinder gebären wird, bis sie endlich einen Sohn zustande bringt.« Damit nickte er Dr. Daniel knapp zu, dann verließ er die Klinik.
»Meine Güte, wer war denn das?«
Dr. Daniel drehte sich um und sah sich dem Chefarzt der Waldsee-Klinik, Dr. Wolfgang Metzler, gegenüber.
»Der ist wohl als Relikt aus dem vorigen Jahrhundert übriggeblieben«, urteilte Dr. Daniel ärgerlich. »Der glaubt nämlich immer noch, die Frau sei für das Geschlecht des Kindes verantwortlich. Und mit dieser Einstellung bringt er seine Frau Stück für Stück um. Schon nach der Geburt seines letzten Kindes habe ich auf ihn eingeredet wie auf ein krankes Pferd. Ein Vierteljahr später war seine Frau wieder bei mir in der Praxis zum Schwangerschaftstest. Gerade hat sie ein Mädchen zur Welt gebracht…«
»Das übrigens kerngesund ist«, warf Dr. Metzler dazwischen. »Die Kleine hat beim Apgar-Test zehn Punkte erreicht. Mehr ist bekanntlich nicht drin.«
Dr. Daniel nickte zwar, war mit seinen Gedanken aber offensichtlich ganz woanders. Helmut Heiden-
raths halsstarrige Haltung ging ihm nämlich noch immer nicht aus dem Kopf.
»Er will einen Sohn, und dafür riskiert er sogar das Leben seiner Frau«, fuhr Dr. Daniel fort. »Ich dachte, wenn ich ihm eiskalt und brutal die Wahrheit ins Gesicht sage, dann…« Er zuckte die Schultern. »Es scheint, als wäre es ihm völlig gleichgültig. Seine Frau soll auch weiterhin Kinder zur Welt bringen, bis er seinen langersehnten Sohn hat.«
»Wie schätzt du die Chancen ein, daß das klappen kann?« wollte Dr. Metzler wissen.
Wieder zuckte Dr. Daniel die Schultern. »So etwas läßt sich leider nur schwer vorhersagen, aber Helmut Heidenrath selbst ist der einzige Junge unter elf Mädchen.«
Entsetzt starrte Dr. Metzler ihn an. »Willst du damit sagen, daß seine Mutter zwölf Kinder zur Welt gebracht hat?«
»Fünfzehn«, berichtete Dr. Daniel. »Drei sind kurz nach der Geburt gestorben. Das hat sie mir einmal erzählt, als sie in meiner Praxis war. Inzwischen ist sie leider nicht mehr am Leben. Sie war eine sehr sympathische Frau.« Er seufzte. »Der Vater von Herrn Heidenrath muß allerdings eine ähnliche Einstellung gehabt haben, wie sie jetzt auch sein Sohn an den Tag legt. Herr Heidenrath ist nämlich der Jüngste.«
»Das heißt, daß dieser armen Frau dasselbe Schicksal droht wie schon ihrer Schwiegermutter.«
Doch Dr. Daniel schüttelte den Kopf. »Gunilla Heidenrath wird die nächste Schwangerschaft aller Wahrscheinlichkeit nach nicht überleben. Sie hatte nach dem vierten Kind schon starke Nachblutungen, und diesmal waren sie so schlimm, daß ich ihr Ergometrin spritzen und zusätzlich eine Bluttransfusion geben mußte.«
Fassungslos schüttelte Dr. Metzler den Kopf. »Und das will ihr Mann nicht begreifen?«
»Nein«, antwortete Dr. Daniel und fühlte dabei wieder Wut aufsteigen, weil er einfach nicht verstand, wie ein Mensch nur so verbohrt sein konnte. Irgendwann mußte er seine Frau ja auch geliebt haben oder das noch immer tun. Wie konnte er sie da in Lebensgefahr bringen, nur weil sich sein Wunsch nach einem Sohn erfüllen sollte?
»Kann man denn mit der Frau auch nicht sprechen? Sie muß doch selbst sehen, wie jede Geburt schwieriger geworden ist.«
Dr. Daniel seufzte. »Natürlich weiß sie, daß sie mit jeder weiteren Schwangerschaft zunehmend in Lebensgefahr geraten ist, aber sie wagt es nicht, sich ihrem Mann zu widersetzen. Den Grund dafür habe ich noch nicht herausgefunden. Entweder ist er so jähzornig, daß sie einfach Angst vor ihm hat, oder aber sie wurde noch nach dem Prinzip erzogen, daß die Frau dem Manne untertan ist. Immerhin ist sie nun schon zweiundvierzig. Es könnte also durchaus sein, daß sie eine sehr strenge Erziehung genossen hat oder sogar in der eigenen Familie gesehen hat, daß alle dem Vater ohne Widerspruch gehorchten.«
»Wahnsinn«, murmelte Dr. Metzler, dann sah er seinen Freund an. »Du solltest aber trotzdem noch mal mit ihr sprechen.«
»Worauf du dich verlassen kannst«, bekräftigte Dr. Daniel. »Diesmal wird es mir gelingen, sie wenigstens zur Verhütung zu bewegen. Noch lieber wäre es mir allerdings, sie würde sich sterilisieren lassen, aber da habe ich wenig Hoffnung.« Er überlegte kurz. »Auch mit ihm werde ich noch einmal sprechen. Er kann doch nicht allen Ernstes wollen, daß fünf oder sorgar sechs Kider Halbwaisen werden, nur weil er um jeden Preis einen Sohn in die Welt setzen will.«
*
Als Dr. Daniel kurz nach zwölf Uhr mittags endlich seine Praxis erreichte, wartete dort nur noch eine Patientin auf ihn.
»Alle anderen ließen sich auf den Nachmittag vertrösten, einige sogar auf morgen früh«, erklärte Gabi Meindl. »Aber Frau Scheibler will unbedingt jetzt noch mit Ihnen sprechen.«
»Für Steffi nehme ich mir auch immer Zeit«, betonte Dr. Daniel, dann trat er ins Wartezimmer, so Stefanie Scheibler, die Schwester von Dr. Metzler und Ehefrau des Oberarztes Dr. Gerrit Scheibler, geduldig auf ihn wartete.
»Steffi, was gibt es denn so Dringendes?« wollte Dr. Daniel wissen, während er die junge Frau in sein Sprechzimmer begleitete. Dann sah er sich wie suchend um. »Hast du die kleine Daniela denn nicht dabei?«
Stefanie schüttelte den Kopf. »Meine Mutter kümmert sich um sie. Sie freut sich immer riesig, wenn ich ihr Dani für ein paar Stunden überlasse. Außerdem weiß ich ja, daß ich bei Ihnen immer eine gewisse Wartezeit mit einkalkulieren muß, und da würde Dani nur quengelig.«
Dr. Daniel seufzte. »Ich weiß schon, was ich meinen Patientinnen so Tag für Tag zumute, aber ich liebe es auch nicht gerade, ständig im Streß zu stehen.«
»Was ich über die Wartezeiten gesagt habe, war auch überhaupt nicht als Vorwurf gemeint«, verwahrte sich Stefanie. »Dazu kommt es ja nur, weil Sie eben ein Arzt sind, der sich für seine Patientinnen noch Zeit nimmt. Und dafür lohnt es sich ja auch schließlich zu warten.«
»Na, jetzt hör aber auf mit deinen Schmeicheleien, sonst werde ich noch ganz eingebildet«, meinte Dr. Daniel lächelnd, obwohl bei ihm in dieser Hinsicht überhaupt keine Gefahr bestand. Er war viel zu bescheiden, um eingebildet zu sein, und außerdem betrachtete er es als pure Selbstverständlichkeit, sich für seine Patientinnen Zeit zu nehmen. »Also, Steffi, was führt dich zu mir? Ich sehe dir doch an, daß du nicht sehr glücklich bist. Du hast doch hoffentlich keine Probleme mit Gerrit?«
Stefanie schüttelte den Kopf. »Gerrit ist der beste Mann, den ich bekommen konnte. Er ist so lieb und zärtlich, und unsere kleine Dani ist unser ganzer Sonnenschein, aber…« Sie senkte den Kopf. »Sie wissen ja noch, was während meiner zweiten Schwangerschaft passiert ist.«
Dr. Daniel nickte. Wie könnte er das auch jemals vergessen? Stefanie und Gerrit waren so glücklich gewesen, als die junge Frau zum zweiten Mal schwanger geworden war, doch dann hatte Martin Bergmann, der ehemalige Besitzer des Steinhausener Chemiewerks, Stefanie mit dem Auto angefahren. Dadurch hatte sie eine Fehlgeburt erlitten und sich ganz offensichtlich noch immer nicht davon erholt.
»Gerrit und ich möchten so gern noch ein Kind«, fuhr Stefanie fort. »Aber seit dieser Fehlgeburt will es einfach nicht mehr klappen.«
»Tja, Steffi, es kann gut sein, daß damals mehr passiert ist, als man im ersten Moment überblicken konnte«, räumte Dr. Daniel ein. »Was hältst du davon, wenn du für ein paar Tage in die Waldsee-Klinik
gehst und dich von mir dort einmal ganz gründlich untersuchen läßt?«
Stefanie nickte ohne zu zögern. »Ja, Herr Doktor, das wäre gut. Dieses ständige Probieren, und dann jeden Monat aufs neue die Enttäuschung, wenn es wieder nicht geklappt hat… lange würde ich das sicher nicht mehr durchhalten.«
»Gut, dann schlage ich vor, daß du dich um eine Unterkunft für deine kleine Daniela kümmerst. Mit mehr als drei Tagen Krankenhaus-aufenthalt mußt du aber sicher nicht rechnen.« Dr. Daniel überlegte kurz. »Vielleicht könnte Gerrit in dieser Zeit auch Urlaub nehmen. Im Augenblick ist die Waldsee-Klinik nicht voll belegt, da kann Wolfgang seinen Oberarzt sicher auch mal ein paar Tage entbehren. Wenn du alles organisiert hast, dann rufst du mich an, damit ich in der Klinik ein Zimmer für dich bereitstellen kann.«
Da brachte Stefanie sogar ein kurzes Lächeln zustande. »Gerrit hatte schon recht, als er einmal sagte, Sie wären unser guter Geist. Was täten wir alle nur ohne Sie?«
*
»Überraschung!«
Dr. Daniel blickte auf und direkt in die schönen, dunklen Augen von Frau Dr. Manon Carisi hinein, der Allgemeinmedizinerin Steinhausens, die er im Moment allerdings noch in der Thiersch-Klinik in München vermutet hatte.
Jetzt sprang er auf, nahm die attraktive Frau liebevoll in die Arme.
»Manon! Wie kommst du denn hier herein? Meine beiden Damen sind doch schon längst weg.«
Mit einem zärtlichen Lächeln sah sie ihn an. »Und du arbeitest wieder mal bis zum Umfallen. Robert, Robert, ich glaube, auf dich muß ich wirklich schwer aufpassen.«
»Gerade wollte ich Schluß machen und nach München fahren, um dich zu besuchen«, beteuerte Dr. Daniel.
»Ich glaube dir kein Wort«, entgegnete Manon. »Als ich hereingekommen bin, hast du nicht unbedingt so ausgesehen, als würdest du die Arbeit gerade niederlegen. Außerdem kannst du dir ab sofort die Fahrten nach München sparen. Professor Thiersch hat mich endlich aus seinen Fängen entlassen.«
Mit einer Hand streichelte Dr. Daniel durch Manons kurzes, leicht gewelltes Haar. Dabei mußte er unwillkürlich daran denken, welche Qualen sie beide durchlitten hatten, als Manon ganz plötzlich an akuter Leukämie erkrankt war. Dieser Umstand hatte Dr. Daniel gezeigt, wieviel Manon ihm eigentlich bedeutete, daß es sehr viel mehr als nur Freundschaft war. Doch eine ganze Weile hatte es so ausgesehen, als würde ihre Liebe keine Zukunft haben. Erst eine Knochenmarktransplantation hatte Manons Leben gerettet, und nun war sie also endlich aus der Thiersch-Klinik entlassen worden.
»Ich bin froh, daß ich dich endlich wiederhabe«, gestand Dr. Daniel leise, dann küßte er sie. »Ich liebe dich.«
»Alles Lüge«, entgegnete Manon, doch sie lächelte dabei. »Würdest du mich wirklich lieben, dann hättest du längst gesehen, welch eine flotte Frisur ich jetzt trage.«
Dr. Daniel schmunzelte. »Natürlich habe ich das gesehen, Manon, und wenn es mir nicht gefallen würde, dann hätte ich es dir schon gesagt.«
»Um Ausreden bist du ja wohl nie verlegen«, lachte Manon, dann drehte sie sich kokett vor ihm. »Und? Wie steht mir die neue Frisur?«
»Du bist schön wie immer«, erwiderte Dr. Daniel ernst. »Sogar als du keine Haare hattest, hast du mir gefallen.«
»Daran will ich gar nicht mehr denken«, meinte Manon, während ein Hauch von Melancholie über ihr fraulich-schönes Gesicht huschte.
»Das heißt also, daß du gleich an deinem Entlassungstag noch beim Friseur warst«, erklärte Dr. Daniel in dem Versuch, sie von diesen trüben Gedanken abzulenken.
Manon nickte lächelnd. »Selbstverständlich. Ich will schließlich ein wenig schön sein, wenn ich zu dir komme.« Wieder drehte sie sich vor ihm. »Ein neues Kleid habe ich mir auch gegönnt. Meine gesamte Garderobe ist mir nämlich noch ein bißchen zu weit, und schließlich wollte ich dir nicht im Schlabberkleid gegenübertreten.«
Wieder nahm Dr. Daniel sie in die Arme. Er küßte sie erneut. »Ich bin so froh, daß du wieder zu Hause bist.«
»Ich auch, Robert.« Zärtlich streichelte sie durch sein dichtes, blondes Haar. »Du hast Sorgen, Liebling.«
»Sieht man mir das an?«
Manon nickte. »Ich habe es schon immer gemerkt, wenn es dir nicht gutging. Also, was ist los?«
»Heute war in der Tat ein stressiger Tag«, meinte Dr. Daniel, dann schüttelte er den Kopf. »Mehr werde ich dir aber nicht sagen. Du kommst gerade aus der Klinik, da sollst du dich erst mal ein wenig erholen. Professor Thiersch würde mir schwere Vorwürfe machen, und das zu Recht, wenn ich dich jetzt mit meinem Problemen belasten würde.«
»Wir gehören zusammen, Robert, vergiß das nicht«, entgegnete Manon ernst. »Das bedeutet, daß man nicht nur das Glück, sondern auch das Leid miteinander teilen muß.«
»Das werde ich ganz bestimmt nicht vergessen«, versicherte Dr. Daniel. »Was mich im Augenblick jedoch beschäftigt, sind die Sorgen einer Patientin, und damit, liebe Manon«, er stupste sie an der Nase, »sollst du dich jetzt ganz bestimmt nicht belasten. So, und nun gehen wir nach oben. Irene kocht erfahrungsgemäß immer für eine ganze Kompanie, da wird für dich also sicher auch etwas abfallen.«
»Das ist gut«, meinte Manon. »Ich habe nämlich einen Bärenhunger, und deine Schwester kocht auch ausgezeichnet.«
»Weiß ich«, grinste Dr. Daniel, während er hinter Manon die Treppe zu seiner Wohnung hinaufstieg. »Deshalb lasse ich mir ja von ihr den Haushalt führen. Außerdem liebt sie ihren kleinen Bruder so heiß und innig…«
»Robert! Eigentlich sollte ich dir dafür die Ohren langziehen!« schallte ihm in diesem Moment die Stimme seiner verwitweten Schwester entgegen. »Kannst du denn nicht ein einziges Mal pünktlich sein?«
»Sie liebt dich heiß und innig?« wiederholte Manon fragend und grinste dabei über das ganze Gesicht. »Das hört sich für mich aber doch ein bißchen anders an.«
In diesem Moment trat Irene aus der Küche, und dabei fiel Manon wieder einmal auf, wie wenig sich die Geschwister rein äußerlich glichen. Dr. Daniel war groß und schlank, mit markantem Gesicht und blondem Haar, während die Körperformen seiner Schwester eher üppig ausfielen und ihr einstmals dunkles Haar mittlerweile grau geworden war.
»Manon!« Jetzt strahlte sie über das ganze runde Gesicht und nahm die Freundin ihres Bruders spontan in die Arme. »Schön, daß Sie endlich wieder hier sind.« Dabei warf sie Dr. Daniel einen strafenden Blick zu. »Das hättest du mir auch früher sagen können, dann hätte ich ein feudaleres Abendessen auf den Tisch gebracht.«
»Ich wußte nichts davon«, verteidigte sich Dr. Daniel. »Manon hat mich ebenfalls überrascht.«
»Außerdem lege ich auch keinen Wert auf ein feudales Menü«, betonte Manon. »Bei Ihnen schmeckt mir alles gut, Irene.«
Dr. Daniels Schwester errötete. »Das haben Sie jetzt aber lieb gesagt, Manon.« Sie zögerte. »Was halten Sie eigentlich davon, wenn wir beide uns jetzt auch endlich duzen würden?«
»Sehr viel«, stimmte Manon erfreut zu.
»Schön«, meinte Irene, dann warf sie ihrem Bruder einen kurzen Seitenblick zu, ehe sie sich Manon wieder zuwandte. »Bei dieser Gelegenheit gebe ich dir auch gleich einen Tip: Erziehe dir diesen Burschen beizeiten, sonst läßt er dich eines Tages auch auf deinem Essen sitzen und kommt, wann immer es ihm beliebt.«
»Irene…«, begann Dr. Daniel, doch seine Schwester fiel ihm gleich ins Wort: »Sei du bloß ruhig.« Sie bedachte ihn mit einem strafenden Blick. »Um sechs wolltest du oben sein, und jetzt schau mal auf die Uhr. Es ist schon gleich acht. Ein paar hinter die Löffel sollte man dir geben, und deinem Sohn gleich dazu. Der macht es schon genauso wie du… kommt und geht, wann es ihm paßt. Und wenn die gnädigen Herren dann aufkreuzen, soll das Essen natürlich auf dem Tisch stehen.«
»Wenn du mich jetzt noch länger ausschimpfst, dann wird dein Essen vollends kalt«, wandte Dr. Daniel beschwichtigend ein.
»Sei nicht zu streng mit Robert und Stefan«, meinte Manon lächelnd. »Sie sind beide sehr pflichtbewußte Ärzte, die eben leider nicht immer pünktlich Feierabend machen können.«
»Na ja, dann will ich eben mal Gnade vor Recht ergehen lassen«, grummelte Irene. »Glücklicherweise habe ich Rohrnudeln gemacht. Die schmecken notfalls auch kalt.«
In diesem Moment betraten Stefan und seine jüngere Schwester Karina, die jetzt wieder in München studierte, die Wohnung. Noch einmal wurde Manon aufs herzlichste begrüßt, und als sie später alle gemütlich beisammensaßen, gelang es Dr. Daniel sogar, seine Sorgen um Gunilla Heidenrath für eine Weile zu vergessen.
*
Nach zwei Tagen konnte Gunilla von der Intensivstation auf die normale Station verlegt werden, trotzdem bat Dr. Daniel die Schwestern, noch sehr gut auf die Patientein zu achten, denn die Gefahr weiterer Nachblutungen bestand noch bis zum fünften Tag.
»Nun, Frau Heidenrath, wie fühlen Sie sich?« wollte Dr. Daniel wissen, als er seine Patientin nach der Sprechstunde besuchte.
Ein wenig hilflos zuckte Gunilla die Schultern. »Ich weiß nicht so recht, Herr Doktor, müde und wohl auch ein bißchen ängstlich.«
Dr. Daniel nickte verständnisvoll. »Wegen Ihres Mannes, nehme ich an. Hat er die kleine Helene schon gesehen?«
Gunilla schüttelte den Kopf. »Gestern war er für ein paar Minuten bei mir und sagte nur, er würde sich die Göre gar nicht erst anschauen.«
Erneut stieg der Ärger in Dr. Daniel auf, doch er versuchte, sich zu beherrschen. Trotzdem klang in seiner Stimme ein leiser Vorwurf mit, als er sagte: »Er sollte eigentlich froh sein, daß er ein gesundes Kind bekommen hat.«
Ein sanftes Lächeln huschte über Gunillas Gesicht. »Sie ist ein süßes Baby, nicht wahr?«
»Sehr süß sogar«, stimmte Dr. Daniel zu, dann wurde er ernst. »Und sie sollte Ihr letztes Kind sein, Frau Heidenrath.«
Bedauernd schüttelte Gunilla den Kopf. »Das wird Helmut niemals zulassen. Er will einen Sohn, und ich bin durch meine Heirat mit ihm verpflichtet, ihm einen zu schenken.«
»Moment mal, Frau Heidenrath. Sie unterliegen da einem gewaltigen Irrtum. Im Ehegelöbnis heißt es nur, daß Sie die Kinder, die Gott Ihnen schenken wird, annehmen und im christlichen Glauben erziehen sollen, aber nicht, daß Sie Ihrem Mann so viele Kinder gebären müssen, bis er endlich einen Sohn hat.«
»Na ja, wenn man es so genau auslegt…«, wandte Gunilla ein, dann seufzte sie. »Eigentlich würden mir fünf Kinder schon reichen. Es waren ja bei mir immer schwierige Schwangerschaften und Geburten.«
»Richtig, und es waren auch nicht nur fünf, sondern eigentlich acht, wenn man die drei Fehlgeburten, die Sie erlitten haben, mitrechnet. Frau Heidenrath, ich habe es Ihnen nach Kristins Geburt schon einmal gesagt: Sie müssen unbedingt verhüten, wenn Sie Ihren Kindern die Mutter erhalten wollen. Bei Helene ging es gerade noch mal gut, aber Sie dürfen das Schicksal nicht noch einmal herausfordern. Eine sechste Geburt würden Sie aller Wahrscheinlichkeit nach nicht überleben.«
»Ach, Herr Doktor«, seufzte sie leise. »Sie haben leicht reden. Was glauben Sie, was Helmut mit mir machen würde, wenn ich ihm sage, daß ich die Pille nehmen will?«
»Soll ich ehrlich sein, Frau Heidenrath?« Dr. Daniel wartete ihre Antwort gar nicht ab, sondern fuhr fort: »Ich habe nicht an die Pille gedacht. Ich würde Ihnen dringend empfehlen, sich sterilisieren zu lassen. Das hätte eigentlich schon nach Kristins Geburt geschehen sollen, aber jetzt ist es praktisch unumgänglich geworden. Frau Heidenrath, Sie sind zweiundvierzig. Auch ohne die Probleme, die Sie bei Schwangerschaften und Geburt haben, würden Sie damit zu einer Risikogruppe gehören. Die Gefahr von Behinderungen bei Kindern, vor allem meine ich das sogenannte
Down-Syndrom, erhöht sich bei zunehmendem Alter der Eltern ebenfalls, und damit sind nicht nur Sie, sondern auch Ihr Mann gemeint. Er ist ja immerhin auch schon sechs-undvierzig.«
»Einer Sterilisation wird Helmut niemals zustimmen«, entgegnete Gunilla niedergeschlagen. »Er würde darauf bestehen, daß ich weiterhin Kinder bekomme – und zwar so lange, bis ich endlich einem Jungen das Leben schenke.«
»Das ist doch Wahnsinn!« begehrte Dr. Daniel auf und wurde dabei lauter, als es eigentlich seine Art war. »Begreifen Sie denn nicht, daß Sie schon durch die nächste Schwangerschaft in ernste Lebensgefahr geraten werden? Wollen Sie dann sechs Kinder zu Halbwaisen machen?«
Da schluchzte Gunilla hilflos auf. »Was soll ich denn tun? Helmut bringt mich um, wenn ich mich sterilisieren lasse!«
Spätestens in diesem Moment wußte Dr. Daniel, daß er hier nichts ausrichten konnte. Er mußte Helmut Heidenrath davon überzeugen, daß eine erneute Schwangerschaft Gunillas Tod bedeuten könnte.
*
Die Untersuchungen bei Stefanie Scheibler ergaben genau den Befund, mit dem Dr. Daniel schon gerechnet hatte, deshalb bat er auch Gerrit zu diesem Gespräch hinzu.
»Also, Steffi, eines gleich vorweg«, begann Dr. Daniel, als sie gemeinsam in seinem Büro saßen. »Ich konnte nichts entdecken, was eine Schwangerschaft verhindern würde. Der Unfall, in den du damals verwickelt warst, hatte zwar die Fehlgeburt zur Folge, aber ansonsten hat er keine weiteren Schäden hinterlassen.«
Voller Verzweiflung sah Stefanie erst ihren Mann, dann Dr. Daniel an.
»Aber warum kann ich dann nicht mehr schwanger werden?«
»Weil du die schrecklichen Ereignisse noch immer nicht verarbeitet hast«, antwortete Dr. Daniel ruhig.
Gerrit nickte. »Genau das habe ich auch schon vermutet. Trotzdem bin ich froh, daß sich Steffi noch einmal untersuchen ließ.«
»Und was sollen wir jetzt tun?« wollte Stefanie wissen. »Muß ich mich denn einfach damit abfinden, daß ich keine Kinder mehr bekommen kann, weil Martin Bergmann mich damals angefahen hat und ich diesen Unfall nicht richtig verarbeiten kann?«
»Nein, Steffi, ganz im Gegenteil«, erwiderte Dr. Daniel. »Du sollst dich nicht damit abfinden, sondern versuchen, die Geschehnisse aufzuarbeiten. Wenn du das geschafft hast, dann wirst du auch schwanger werden können.«
»Das heißt, ich muß zu einem Psychiater«, erklärte Stefanie mit unüberhörbarer Bitterkeit in der Stimme.
»Nein, Steffi, absolut nicht. Ich bin sicher, daß es ausreichend ist, wenn du mit mir sprichst, und auch Gerrit kann dir helfen, mit dieser unseligen Geschichte fertigzuwerden.« Er schwieg kurz, bevor er ihr noch einen weiteren Rat gab. »Vielleicht solltest du auch versuchen, nicht mehr ganz so verbissen auf eine Schwangerschaft hinzuarbeiten. Ich weiß schon, das ist leichter gesagt als getan, aber erfahrungsgemäß klappt es am ehesten, wenn man gar nicht daran denkt.«
Stefanie seufzte. »Sie haben recht, Herr Doktor, das ist wirklich leichter gesagt als getan. Dani wird immer größer, und sie soll ihr Geschwisterchen doch möglichst bald bekommen. Wenn sie erst mal fünf oder sechs Jahre alt ist, dann wachsen die beiden doch beinahe wie Einzelkinder auf.«
»Erstens mal ist es bis dahin noch ein recht weiter Weg. Daniela ist doch erst zwei. Und zweitens bin ich beispielsweise auch fünf Jahre jünger als meine Schwester, und trotzdem hatten Irene und ich nie das Gefühl, wie zwei Einzelkinder aufgewachsen zu sein.« Er lächelte. »Meistens war es für mich sogar sehr schön, so eine große Schwester zu haben.«
Dr. Scheibler schmunzelte. »Nur meistens?«
»Gelegentlich können einem große Schwestern auch auf die Nerven fallen«, räumte Dr. Daniel bereitwillig ein. »Aber das ändert sich auch mit zunehmendem Alter nicht. Irene versucht heute noch, mich zu erziehen, wo sie nur kann, dabei sollte dieser Teil meiner Entwicklung eigentlich längst abgeschlossen sein.«
Stefanie und Gerrit mußten lachen.
»Damit erzählen Sie mir nichts Neues«, stimmte Stefanie dann zu. »Geli und Wolfgang machen es mit mir doch genauso, wobei sich Wolfgang noch einigermaßen zurückhält. Im Grunde hat er den großen Bruder nur damals herausgekehrt, als ich mich in Gerrit verliebt hatte. Aber Geli hält sich immer noch für meine zweite Mutter. Sogar in Danis Erziehung will sie mir dreinreden, dabei hätte sie eigentlich genug damit zu tun, sich um ihre Zwillinge zu kümmern. Raimo und Tommy sind ja die reinsten Landplagen.«
Dr. Daniel erinnerte sich nur mit Unbehagen an die beiden Zehnjährigen, deren Ungehorsam eigentlich kaum zu überbieten gewesen war. Dann wandte er sich dem ursprünglichen Thema wieder zu.
»Also, Steffi, ich würde vorschlagen, daß du einmal pro Woche zu mir kommst«, meinte er. »Dann werden wir ausführlich über das sprechen, was damals geschehen ist.« Er sah Dr. Scheibler an. »Wenn es Ihre Zeit erlaubt, Gerrit, dann sollten Sie bei diesen Gesprächen vielleicht auch dabei sein. Für Daniela wird sich währenddessen sicher ein Babysitter finden.«
Stefanie und Gerrit nickten.
»Ganz bestimmt, Herr Doktor«, versicherte die junge Frau, dann reichte sie Dr. Daniel voller Dankbarkeit die Hand. »Ich bin froh, daß Sie sich für mich immer wieder so viel Zeit nehmen. Und wenn ich dann wirklich schwanger werden könnte… das wäre unser größtes Glück, nicht wahr, Gerrit?«
Ihr Mann stimmte zu, dann lächelte er. »Noch vor ein paar Jahren hätte ich mir nicht einmal vorstellen können, verheiratet zu sein, und jetzt… der Gedanke an eine große Familie kann mich nicht erschrecken, ganz im Gegenteil. Ich hätte absolut nichts dagegen, wenn unsere Dani noch drei oder vier Geschwisterchen bekommen würde.«
Dr. Daniel lächelte. »Ich werde sehen, was sich da machen läßt. Erstmal müssen wir die Ursache für diese innere Blockade wegschaffen.«
*
»Herr Heidenrath, das geht aber nicht!« erklärte Schwester Bianca, als Helmut den kleinen Koffer seiner Frau packte.
»So?« Er warf der jungen Krankenschwester einen wütenden Blick zu. »Zeigen Sie mir denjenigen, der mich aufhalten wird, wenn ich meine Frau nach Hause holen will.«
»Das werde ich Ihnen zeigen, verlassen Sie sich darauf«, prophezeite Bianca, dann lief sie ins Schwesternzimmer hinüber und rief in der Praxis Dr. Daniel an.
Keine fünf Minuten später stand der Arzt im Zimmer.
»Tut mir leid, Herr Heidenrath, aber Ihre Frau kann noch nicht entlassen werden«, meinte er, und sein Ton duldete eigentlich keinen Widerspruch.
»Jetzt hören Sie mir mal zu«, entgegnete Helmut scharf. »Meine Frau wird zu Hause gebraucht. Ich habe keine Lust, vier Kinder zu versorgen und den Haushalt in Schwung zu halten, nur damit sie sich hier drinnen auf die faule Haut legen kann.«
Mit größter Mühe gelang es Dr. Daniel angesichts dieser Worte ruhig zu bleiben.
»Ihre Frau hat eine äußerst schwierige Geburt hinter sich, und ich kann noch immer nicht aus-schließen, daß es zu weiteren Komplikationen kommen wird. Aus diesem Grund…«
»Sie sind überängstlich, das ist alles«, fiel Helmut ihm grob ins Wort. »Früher haben die Frauen ihre Kinder auf dem Feld zur Welt gebracht und gleich weitergearbeitet.«
»Deshalb war damals nicht nur die Säuglingssterblichkeit besonders hoch, sondern auch die der Mütter«, konterte Dr. Daniel. »Frau Heidenrath bleibt noch zwei Tage hier, dann können Sie sie nach Hause holen. Etwas anderes kann ich nicht verantworten.«
»Müssen Sie auch nicht«, entgegnete Helmut kalt, dann sah er seine Frau an. »Los, steh auf und zieh dich an.«
Genilla fühlte sich noch sehr schwach und zittrig, trotzdem gehorchte sie.
»Herr Heidenrath…«, begann Dr. Daniel energisch, doch Helmut unterbrach ihn erneut. »Ich hole meine Frau auf eigene Verantwortung aus der Klinik. Damit sind Sie aus dem Schneider, und mehr wollen Sie ja wohl nicht.«
»Da unterliegen Sie aber einem gewaltigen Irrtum«, erklärte Dr. Daniel mit Nachdruck. »Ich will meine Patientinnen gesund entlassen und nicht…«
»Los, geben Sie mir schon so einen Wisch«, verlangte Helmut ungeduldig. »Gunilla wird unterschreiben, daß sie die Klinik auf eigenen Wunsch verläßt.«
Es machte Dr. Daniel rasend, daß er nichts tun konnte, um Gunilla vor diesem rücksichtslosen Mann zu schützen. Er ließ sich von Schwester Bianca eine entsprechende schriftliche Erklärung bringen, behielt sie aber noch einen Augenblick in der Hand.
»Frau Heidenrath, niemand zwingt Sie, dieses Stück Papier zu unterschreiben«, erklärte Dr. Daniel eindringlich. »Wenn Sie sich weigern, dann ist das Recht auf unserer Seite. Ich kann Sie hierbehalten, bis die Gefahr weiterer Nachblutungen gebannt ist. Bitte, Frau Heidenrath, gehen Sie kein unnötiges Risiko ein.«
»Hören Sie schon auf mit Ihrem unnützen Geschwafel«, brauste Helmut auf, dann wandte er sich seiner Frau zu. »Und du unterschreibst gefälligst!«
Gunillas Augen baten Dr. Daniel um Verzeihung. »Ich muß gehen, Herr Doktor. Meine Kinder brauchen mich, und… ich fühle mich wirklich schon ganz gut.«
Dr. Daniel wußte, daß sie log, doch er wußte auch, daß er machtlos war, wenn Gunilla die Erklärung unterschrieb. Genau das würde sie aber tun, weil ihr Mann es von ihr verlangte und weil sich ihr Leben im Falle einer Weigerung nur noch schwieriger gestalten würde.
Mit einem tiefen Seufzer reichte Dr. Daniel ihr das Blatt Papier.
»Tun Sie mir nur einen Gefallen, Frau Heidenrath«, meinte er, während er zusah, wie sie mit zitternden Fingern ihre Unterschrift daraufsetzte. »Schonen Sie sich, so gut es Ihnen möglich ist. Sie kennen Ihren Wochenfluß nach so vielen Geburten ja schon sehr genau. Wenn Sie also merken, daß er stärker wird, dann kommen Sie unverzüglich zu mit. Versprechen Sie mir das?«
»Ja, Herr Doktor«, flüsterte Gunilla, dann folgte sie ihrem Mann nach draußen. Dabei hielt sie ihr Baby so fest im Arm, als müsse sie es vor schlimmen Gefahren beschützen.
Besorgt sah Dr. Daniel ihnen nach und wurde dabei das Gefühl nicht los, daß er Gunilla schon bald wiedersehen würde.
*
»Herr Oberarzt! Einen Augenblick noch!«
Dr. Gerrit Scheibler war bereits an der Tür, als die Stimme der Stationsschwester Alexandra Keller ihn aufhielt. Mit einem leisen Seufzer drehte er sich um.
»Was gibt’s denn, Alexandra?«
»Es tut mir leid, daß ich Sie noch mal zurückrufen muß«, erklärte Schwester Alexandra, und Dr. Scheibler wußte sofort, daß sie das ehrlich meinte. »Frau Strehl ist so unruhig. Sie hat große Angst vor der morgigen Operation.«
Dr. Scheibler warf einen Blick auf seine Armbanduhr. Seit einer Stunde war sein Dienst offiziell beendet, und eigentlich hätte er jetzt schon auf dem Weg nach München zu einer Fortbildungsveranstaltung sein müssen, aber er kam ja doch nie pünktlich von der Klinik weg. Wieso hätte es also ausgerechnet heute anders sein sollen?
»Also schön, ich sehe noch mal nach ihr«, antwortete der junge Oberarzt ergeben, schlüpfte wieder in seinen weißen Kittel und trat auf den Flur.
Schwester Alexandra sah dem großen, schlanken und äußerst gut aussehenden Arzt nach, und dabei erstaunte es sie wieder einmal, wie sehr Dr. Scheibler sich gegenüber früher verändert hatte. Wenn man ihn heute sah, wäre man nie auf den Gedanken gekommen, welch ein Casanova er einst gewesen war. Doch damals, als er Stefanie kennengelernt hatte, hatte er sich von Grund auf geändert und war nicht nur ein zärtlicher und rücksichtsvoller Ehemann und Vater geworden, sondern auch ein äußerst pflichtbewußter Arzt, für den das Wohl seiner Patienten gleich nach der Sorge um seine Familie kam.
Und so betrat Dr. Scheibler auch jetzt mit einem freundlichen Lächeln das Zimmer von Frau Strehl. Sie richtete sich sofort ein wenig auf.
»Das ist aber lieb, Herr Dr. Scheibler, daß Sie mich heute noch besuchen«, erklärte sie, und an ihrer Stimme hörte Gerrit, daß sie wirklich Angst hatte.
Spontan setzte er sich zu ihr ans Bett und griff nach ihrer Hand.
»Schwester Alexandra sagte mir, daß Sie Kummer haben«, meinte er.
Frau Strehl nickte. »Ja, Herr Doktor, ich habe ganz schreckliche Angst vor morgen. Es ist meine erste Operation, müssen Sie wissen. Wenn ich nun nicht mehr aus der Narkose erwache? Ich bin doch schon über sechzig.«
»Aber, Frau Strehl, an so etwas sollten Sie nicht einmal denken«, entgegnete Dr. Scheibler beruhigend. »Dr. Metzler und ich haben Sie doch gründlichen Untersuchungen unterzogen. Sie haben ein kräftiges Herz, das auch nach der Operation ruhig und regelmäßig schlagen wird. Machen Sie sich nur keine Sorgen, Frau Strehl. Ich bin überzeugt, daß Sie die Operation sehr gut überstehen werden.« Er lächelte sie an. »Außerdem ist sechzig doch noch überhaupt kein Alter. Und Sie sehen sowieso mindestens zehn Jahre jünger aus.«
Die Frau errötete.
»Ach, Herr Doktor…«, murmelte sie sichtlich verlegen.
Dr. Scheibler tätschelte noch einmal ihre Hand, dann stand er auf. »Kann ich Sie jetzt allein lassen?«
Frau Strehl nickte. »Natürlich. Ihre Worte haben mir sehr geholfen, Herr Dr. Scheibler. Ich bin froh, daß Sie hier an der Klinik arbeiten. Sie sind ein so guter Mensch.«
Dr. Scheibler lächelte ihr noch einmal mit besonderer Herzlichkeit zu, bevor er das Zimmer verließ und eilig den Flur entlangging. Wenn er pünktlich in München sein wollte, dann mußte er sich jetzt aber wirklich beeilen! Trotzdem schaute er zunächst noch einmal ins Schwesternzimmer.
»Sonst noch was, Schwester Alexandra?«
Sie lächelte ihm zu. »Nein, Herr Oberarzt, im Augenblick nicht, aber an Ihrer Stelle würde ich schauen, daß ich jetzt schnell aus der Klinik komme.«
Dr. Scheibler grinste. »Worauf Sie sich verlassen können. Also dann, bis morgen früh, Alexandra.«
Der Oberarzt hatte Glück. Um diese frühe Nachmittagsstunde herrschte sowohl auf der Autobahn als auch in München nur schwacher Verkehr, so daß er trotz der Verspätung, mit der er in Steinhausen losgefahren war, pünktlich zu der Fortbildungsveranstaltung erschien. Es handelte sich dabei um einen sehr interessanten und anschaulichen Vortrag, der völlig neue Aspekte
der Chirurgie eröffnete. Die an-schließende Fachdiskussion zog sich dann ebenfalls noch hin, und so war es schon beinahe neun Uhr abends, als sich Dr. Scheibler wieder auf den Nachhauseweg machen konnte.
Durch den anstrengenden Dienst, den er am Vormittag noch gehabt hatte, und diesen doch sehr langen Abend fühlte er sich müde und fuhr deshalb wesentlich langsamer als gewohnt. Wahrscheinlich sah er nur aus diesem Grund das Kind, das am unbeleuchteten Straßenrand stand und offensichtlich versuchte, per Anhalter weiterzukommen. Dr. Scheibler hielt an, beugte sich auf die Beifahrertür hinüber und öffnete die Tür.
Ein hübscher blonder Junge streckte den Kopf herein, und Gerrit erkannte auf Anhieb, daß er kaum älter als acht oder höchstens zehn Jahre sein konnte.
»Nehmen Sie mich ein Stück mit?« fragte er, und seine Stimme zitterte dabei ein wenig.
»Wo möchtest du denn hin?« wollte Dr. Scheibler wissen.
»Zu meiner Schwester nach Innsbruck«, antwortete der Junge nach kurzem Zögern.
»Das ist aber ein ziemlich weiter Weg«, meinte Gerrit. »Und so ganz ohne Gepäck…«
»Sie müssen mich ja nicht mitnehmen, wenn Sie nicht wollen«, gab der Junge ein wenig patzig zurück, doch Dr. Scheibler vermutete, daß er dahinter nur seine Angst verbarg.
»Na, komm schon, steig ein«, erklärte Gerrig. Er würde den Jungen zur Polizei bringen, denn daß er von zu Hause ausgerissen war, stand für ihn außer Frage. Und bei den Gestalten, die sich hier überall herumtrieben, war es Dr. Scheibler lieber, dieses Kind in seinem Auto in Sicherheit zu wissen.
»Nach hinten«, befahl er, als der Junge auf dem Beifahrersitz Platz nehmen wollte.
»Meine Güte, sind Sie aber penibel«, meinte er, gehorchte jedoch.
»Ohne passenden Kindersitz dürfte ich dich eigentlich überhaupt nicht mitnehmen«, belehrte Dr. Scheibler ihn, »aber es ja nur ein kurzes Stück.«
Der Junge wurde stutzig. »Was soll das heißen?«
»Nichts von Bedeutung«, wehrte Gerrit ab, dann warf er einen raschen Blick in den Rückspiegel, doch bei der herrschenden Dunkelheit konnte er das Gesicht des Jungen nicht erkennen. »Wie heißt du denn?«
»Geht Sie gar nichts an«, grummelte der Junge.
Dr. Scheibler zuckte die Schultern. »Na gut, dann nicht.«
Er wendete und fuhr den Weg zurück, den er gerade gekommen war. Wenn er sich recht erinnerte, dann war hier irgendwo eine Polizeidienststelle. In diesem Moment begriff allerdings auch der Junge, was Gerrit beabsichtigte.
»Sie sind gemein!« rief er, als Dr. Scheibler an einer roten Ampel anhielt, dann wollte er aus dem Auto flüchten, doch die Türen waren von innen nicht zu öffnen. Seit die kleine Daniela von ihrem Kindersitz aus die Türgriffe erreichen konnte, hatte Dr. Scheibler grundsätzlich die Kindersicherung drin.
»Lassen Sie mich hinaus!« verlangte der Junge, und seiner Stimme war anzumerken, daß er den Tränen nahe war.
»Kommt nicht in Frage«, entgegnete Dr. Scheibler. »Im Augenblick kannst du es zwar noch nicht verstehen, aber irgendwann wirst du einsehen, daß es besser für dich wäre, wieder nach Hause gebracht zu werden.«
Jetzt hielt Dr. Scheibler vor der Polizeistation an. Er stellte den Motor ab, stieg aus und öffnete dann von außen die hintere Autotür. Der Junge sprang blitzschnell heraus und wollte sofort davonlaufen, doch damit hatte Gerrit schon gerechnet und hielt ihn am Arm fest. Der Kleine wehrte sich verbissen, hatte gegen den Arzt aber nicht die geringste Chance.
»Komm schon, Junge, es hilft doch nichts«, versuchte er ihn zu besänftigen. »Niemand wird dich kleinen Zwerg bis nach Innsbruck mitnehmen, und die Gefahr, daß du an jemanden gerätst, der ganz andere Dinge mit dir anstellt, ist viel zu groß, als daß ich dich einfach weglaufen lassen könnte.«
Er brachte den sich heftig sträubenden Jungen in die Polizeidienststelle.
»Na, Rudi, auch mal wieder hier«, begrüßte der Wachhabende den Jungen, dann sah er Dr. Scheibler an. »Der kleine Mann ist bei uns bereits wohlbekannt, müssen Sie wissen.« Er stand auf und kam um seinen Schreibtisch herum, dann half er Gerrit, den Jungen zu bändigen. »Komm, Rudi, Widerstand ist zwecklos. Du kennst doch das Spielchen inzwischen.«
Mit einem heftigen Aufschluchzen ergab sich der Junge in sein Schicksal und ließ sich schwer auf einen an der Wand stehenden Stuhl fallen. Tränen liefen über das schmale Gesichtchen, und plötzlich fühlte Gerrit grenzenloses Mitleid mit ihm.
»Sie müssen mir nur Ihre Personalien hierlassen«, erklärte der Beamte und riß Dr. Scheibler damit aus seinen Gedanken. »Alles weitere regle ich dann schon.« Er lächelte ein wenig. »Den Kleinen wieder nach Hause zu verfrachten, gehört für uns bereits zur alltäglichen Routine.«
Dr. Scheibler nickte, dann gab er Namen und Adresse an, während immer wieder sein Blick zu dem Jungen wanderte, der wie ein Häufchen Elend auf seinem Stuhl saß. Der Beamte bemerkte es.
»Rudi Gerlach heißt er«, erläuterte er. »Acht Jahre alt und schon ein ewiger Ausreißer.« Er zuckte die Schultern. »Aber wer könnte es ihm auch verdenken? Hat’s nicht gerade gut, der Kleine. War erst sechs, als er die Eltern verloren hat. Jetzt lebt er bei Onkel und Tante, die sich über diese Erbschaft nicht gerade gefreut haben.«
Dr. Scheibler wurde bei diesen Worten das Herz schwer.
»Sie mißhandeln ihn doch nicht etwa?« gab er seinen ärgsten Befürchtungen Ausdruck.
Der Beamte schüttelte den Kopf. »Nein, das nicht, aber… lieben tun sie ihn halt auch nicht – vor allem sie… seine Tante. Ist ein Modepüppchen, das nie eigene Kinder haben wollte. Hat sie mir mal gesagt, als sie den Kleinen gerade wieder bei uns abholte.« Er seufzte. »Der arme Kerl hat ein paar hinter die Ohren bekommen und die Aussicht auf eine Woche Stubenarrest.«
Fassungslos schüttelte Dr. Scheibler den Kopf. Er, der Kinder über alles liebte, konnte ein solches Verhalten einfach nicht begreifen.
»Warum bemühen sie sich dann nicht um einen Pflegeplatz für den Jungen?« wollte er wissen. »Schließlich gibt es doch genügend kinderlose Ehepaare, die glücklich wären, den Kleinen zum Sohn zu haben.«
Der Beamte zuckte erneut die Schultern. »Schon möglich, aber anscheinend will Rudis Onkel den Jungen nicht weggeben – wenn auch nur aus schlechtem Gewissen seinem verstorbenen Bruder gegen-über.« Dann stand er auf. »Na ja, das soll Sie nicht weiter kümmern. Im Namen der Gerlachs bedanke ich mich, daß Sie ihn hergebracht haben, Herr…« Er warf einen Blick auf seine Notizen, »… Dr. Scheibler.«
Gerrit verabschiedete sich, warf dem noch immer weinenden Rudi einen kurzen Blick zu und wollte schon hinausgehen, als ihn die nächsten Worte, die der Beamte an den Jungen richtete, buchstäblich festnagelten.
»Komm, Rudi, leg dich hin und versuch ein bißchen zu schlafen. Du kennst dich hier ja schon aus.«
Dr. Scheibler fuhr herum. »Was soll denn das heißen? Wird der Kleine etwa nicht abgeholt?«
Der Beamte lachte auf. »Um diese Zeit? Da machen sich Kurt und Christa Gerlach bestimmt nicht mehr auf den Weg hierher. Und sie haben es uns nur zu deutlich gesagt, daß sie es auch nicht wünschen, wenn die Polizei bei ihnen vorfährt. Das heißt für uns, daß wir den Kleinen auch nicht heimbringen dürfen.« Er machte eine kurze Pause. »Wahrscheinlich sitzen sie jetzt gerade vor dem Fernseher und sind froh, wenn sie nicht gestört werden.« Er dämpfte seine Stimme ein wenig. »Ganz unter uns gesagt – manchmal habe ich das Gefühl, als wären sie ganz glücklich, wenn der Junge eines Tages überhaupt nicht mehr zurückgebracht würde.«
»Das ist doch…«, begann Gerrit, dann schüttelte er wieder den Kopf.
»Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Dr. Scheibler«, versuchte der Beamte ihn zu beruhigen. »Rudi hat’s gut bei uns. Wir alle mögen den kleinen Kerl.«
»Das glaube ich Ihnen aufs Wort«, meinte Gerrit. »Trotzdem widerstrebt es mir, ihn einfach hierzulassen. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich dem Jungen Gesellschaft leiste, bis er abgeholt wird?«
Dem Beamten blieb vor Überraschung der Mund offen. So etwas hatte er noch nie erlebt. Die meisten, die Rudi hier abgeliefert hatten, waren froh gewesen, den kleinen Ausreißer los zu sein.
»Na, an Ihrer Stelle könnte ich mir etwas Schöneres vorstellen, als eine Nacht auf der Polizeistation zu verbringen«, meinte er, als er seine Sprache endlich wiedergefunden hatte.
»Ich auch«, gab Gerrit unumwunden zu. »Aber wenn Rudi schon hierbleiben muß, dann soll er wenigstens nicht allein sein.«
»Also schön, wenn Sie möchten. Leider kann ich Ihnen nur die Ausnüchterungszelle als Schlafzimmer anbieten, aber da sind Sie und der Junge wenigstens ungestört.« Dann lächelte der Beamte. »Sie sind ein guter Mensch, Herr Dr. Scheibler.«
Und Gerrit wurde bewußt, daß dieser Polizist heute schon der zweite war, der diese Worte zu ihm sagte. Doch er konnte nicht länger darüber nachdenken, denn in diesem Moment schob sich eine schmale, kleine Hand in die seine. Gerrit drehte sich um und ging vor dem Jungen in die Hocke.
»Sie bleiben wirklich bei mir?« fragte der Kleine leise.
»Ja, Rudi«, antwortete Gerrit und betrachtete ihn dabei. Wie konnte man es nur fertigbringen, diesem Jungen etwas zuleide zu tun? Und was mußten das für Menschen sein, die seinem natürlichen Charme widerstehen konnten?
Das schmale ernste Gesichtchen, die großen, tiefblauen Augen, die von so viel Melancholie überschattet waren, die dichten blonden Locken und der fast schmächtige kleine Körper – unwillkürlich hatte Dr. Scheibler das Bedürfnis, diesen Jungen zu beschützen.
»Hast du Hunger, Rudi?« wollte er schließlich wissen.
Der Kleine zögerte, dann nickte er.
Dr. Scheibler stand auf. »Gut, ich werde uns etwas zu essen holen. In ein paar Minuten bin ich wieder hier.«
Im selben Moment sah er die Angst in den großen Kinderaugen aufblitzen.
»Ich komme zurück, Rudi, das verspreche ich dir«, versicherte Gerrit, streichelte flüchtig über den blonden Wuschelkopf des Jungen und verließ dann mit langen Schritten die Polizeistation.
Es dauerte länger, als Dr. Scheibler gedacht hatte. Es war nämlich nicht beim Essenholen geblieben, denn unterwegs war ihm eingefallen, daß er Steffi unbedingt Bescheid sagen mußte. Sie würde sonst vor Sorge um ihn umkommen. Als er ihr den Grund für sein nächtliches Ausbleiben allerdings geschildert hatte, drängte sie ihn sogar, dem armen Jungen Gesellschaft zu leisten.
»Wenn seine Tante und sein Onkel ihn tatsächlich nicht haben wollen, dann bring ihn ruhig mit«, fügte Stefanie noch hinzu.
»Ich werde sehen, was sich machen läßt«, meinte Dr. Scheibler, denn ihm war dieser Gedanke auch schon durch den Kopf gegangen.
Doch als er die Polizeidienststelle wieder erreichte, konnte er Rudi nirgends sehen. Auch der Beamte, der sie in Empfang genommen hatte, war anscheinend für einen Moment hinausgegangen. Vielleicht war aber auch sein Dienst jetzt beendet.
»Sind Sie nicht der Arzt, der Rudi hergebracht hat?« sprach ihn ein anderer Polizist an.
»Ja. Wurde er doch noch abgeholt?«
Der Polizist lachte. »Ach, wo denken Sie hin. Nein, der Kleine hat sich in die Zelle gelegt. Er hat ganz fürchterlich geweint, weil er dachte, Sie kämen nicht mehr zurück.«
Zusammengerollt wie ein Murmeltier lag der Junge auf der Pritsche, und an seinem bebenden Rücken erkannte Dr. Scheibler, daß er noch immer weinte.
»Rudi«, sprach er ihn leise an.
Der Kleine fuhr hoch, und als sich Gerrit zu ihm setzte, fiel er ihm um den Hals.
»Ich dachte… es hat so furchtbar lange gedauert… und… und…«
Wieder fing er an zu schluchzen.
»Hör zu, Rudi, ich habe dir versprochen zurückzukommen, und ich pflege meine Versprechen auch zu halten. So, und jetzt essen wir erst mal etwas.« Dr. Scheibler begann auszupacken. »Ich hoffe, du magst Pizza.« Er lächelte. »Meine beiden Neffen sind immer ganz wild darauf.«
Auch Rudi brachte ein scheues Lächeln zustande. »Ich mag Pizza sogar sehr gern.« Er nahm ein Stück entgegen. »Danke, Herr Dr. Scheibler.«
»Vergiß den Doktor«, entgegnete der junge Oberarzt, »und sag einfach Gerrit zu mir.« Er lächelte den Jungen an. »So, Rudi, laß es dir gut schmecken.«
Der Kleine nickte. »Danke, Gerrit.
Mit großem Appetit verzehrte er ein Stück Pizza nach dem anderen, und Dr. Scheibler konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, daß der Junge vermutlich schon seit einer Ewigkeit nichts mehr zu essen bekommen hatte. Als er diese Vermutung äußerte, senkte Rudi den Kopf.
»Ich habe heute schlechte Noten aus der Schule mit nach Hause gebracht«, erklärte er leise. »Immer wenn ich schlechte Noten bekomme, dann werde ich in mein Zimmer gesperrt und bekomme nichts zu essen.« Es schwieg kurz. »Als es dunkel wurde, bin ich einfach aus dem Fenster geklettert.« Dann sah er Dr. Scheibler bittend an. »Kann ich denn nicht bei dir bleiben, Gerrit?«
»Ich will ganz ehrlich sein, Rudi, daran habe ich auch schon gedacht. Aber dazu muß ich zuerst mit deiner Tante und deinem Onkel sprechen. Und nur wenn sie einverstanden sind, könnte ich etwas unternehmen.«
Wie schutzsuchend kuschelte sich Rudi an ihn.
»Ich will nicht zurück«, flüsterte er. »Tante Christa mag mich nicht.«
Wieder wurde Dr. Scheibler das Herz schwer. Unwillkürlich dachte er daran, wie sehr Steffi und er sich ein zweites Kind wünschten. Und jetzt war da ein kleiner Junge, der sich verzweifelt nach Liebe sehnte…
»Ich werde es versuchen, Rudi«, versprach er spontan, dann schränkte er jedoch ein: »Aber mach dir mal besser nicht zu große Hoffnungen. Ich kann nur etwas ausrichten, wenn deine Tante und dein Onkel mitmachen.«
*
Der Anruf der Polizei erreichte Kurt und Christa Gerlach gegen zehn Uhr abends.
»Er ist wiederaufgetaucht«, erklärte Kurt, als er das Gespräch beendet hatte und zu seiner Frau ins Wohnzimmer zurückkehrte.
»Schön«, entgegnete sie beiläufig, während sie sich weiterhin auf die Nachrichten im Fernsehen konzentrierte.
»Sag mal, Christa, ist dir Rudi denn vollkommen gleichgültig?«
Jetzt endlich wandte seine Frau ihm das Gesicht zu. Sogar um diese Zeit war sie noch makellos geschminkt und trug ein auf Figur gearbeitetes Kleid von Lagerfeld. Dabei saß sie auf dem Sofa, als wäre sie nur auf einen Sprung zu Besuch gekommen.
»Willst du etwa behaupten, daß dir so besonders viel an dem Jungen liegt?« konterte sie mit bissiger Stimme.
Kurt seufzte. »Er ist immerhin das Kind meines verstorbenen Bruders.«
»Das uns aufgehalst wurde«, fügte Christa hinzu. »Warum konnte man ihn nicht in ein Heim geben? Tausende Kinder leben dort. Immerhin waren wir beide uns darin einig, daß wir keine Kinder wollen.«
Kurt seufzte noch einmal. »Ich weiß, aber…« Er zuckte die Schultern. »Gerhard würde es mir niemals verzeihen, wenn ich Rudi in ein Heim gebe.«
»Gerhard ist tot«, entgegnete Christa kalt. Sie hatte ihren Schwager ja nie besonders gut leiden können. »Was kümmert es dich also, ob er dir verzeihen würde oder nicht? Und Rudi will anscheinend ohnehin nicht bei uns bleiben. Warum würde er wohl sonst ständig davonlaufen?«
»Du verwöhnst ihn schließlich nicht gerade mit Liebe«, hielt Kurt ihr vor.
»Du auch nicht!« konterte Christa. »Erst vorige Woche hast du ihm ein paar hinter die Löffel gegeben, weil er ein Glas Limonade umgeschüttet hat.«
»Ja, auf den nagelneuen Perser«, verteidigte sich Kurt, dann zuckte er die Schultern. »Natürlich könnten wir ihn in ein Heim abschieben. Vielleicht würde ihn dort sogar jemand adoptieren, aber das Geld, das wir monatlich für ihn bekommen, ginge damit auch verloren. Du kennst Gerhards Testament. Die Zinsen aus seinem nicht unerheblichen Vermögen bekommt nur der, der den Jungen bis zu seiner Volljährigkeit versorgt. Und gerade du würdest dich ganz schön umschauen, wenn wir dieses satte Nebeneinkommen nicht mehr hätten.«
Christa schwieg. Natürlich gefiel es ihr ungemein, jeden Monat zusätzlich über einen stattlichen Betrag zu verfügen, der natürlich nur ihren eigenen Bedürfnissen zugute kam und nicht – wie es eigentlich gedacht war – für Rudi verwendet wurde.
»Na ja, vielleicht hast du recht«, gab sie widerwillig zu. »Für das Geld kann man die kleine Nervensäge schon eine Weile in Kauf nehmen.« Dann lächelte sie. »Und zumindest heute haben wir ja unsere Ruhe vor ihm.«
Auch Kurt machte es sich jetzt bequem. Er teilte im Grunde Christas Meinung. Sie mußten es genießen, daß Rudi weg war. Morgen würden sie ihn sowieso schon wieder auf dem Hals haben.
*
Dr. Scheibler blieb auf der Polizeiinspektion, bis Rudi von seiner Tante am nächsten Morgen abgeholt wurde.
»Frau Gerlach, das ist Dr. Scheibler«, stellte der Beamte vor, der Gerrit und Rudi am vorherigen Abend in Empfang genommen hatte. »Er war so freundlich, Rudi herzubringen, und ist die ganze Nacht über bei ihm geblieben.«
Völlig fassungslos starrte Christa den jungen Oberarzt an. Es war ihr unvorstellbar, daß ein Mensch freiwillig die Nacht in einer Polizeidienststelle verbrachte, nur um einen kleinen ungezogenen Jungen nicht allein zu lassen. Dann bedachte sie Rudi mit einem strafenden Blick, bevor sie sich bei Dr. Scheibler für seine Mühe bedankte.
»Du kannst dich zu Hause auf etwas gefaßt machen«, drohte sie dem Jungen, als sie ihn zum Ausgang drängte. »Diesmal wird dir dein Onkel den Hosenboden aber ordentlich strammziehen, verlaß dich darauf.«
»Ich glaube nicht, daß es nötig ist, ihn zu bestrafen«, mischte sich Dr. Scheibler in ruhigem Ton ein.
Christa fuhr herum. »Und ich glaube nicht, daß Sie das irgend etwas angeht.« Dann nahm sie Rudi mit hartem Griff bei der Hand und wollte ihn hinter sich her nach draußen ziehen.
»Einen Augenblick noch«, hielt Dr. Scheibler sie erneut zurück. »Ich will mich ganz bestimmt nicht in Ihre Angelegenheiten einmischen, Frau Gerlach, aber ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, daß Sie an Rudi kein allzu großes Interesse haben.«
»Was erlauben Sie sich…«, brauste Christa auf, doch Dr. Scheibler fiel ihr ins Wort.
»Ich will damit nur zum Ausdruck bringen, daß… meine Frau und ich würden den Jungen zu uns nehmen. Wir würden ihn sogar adoptieren, wenn Sie und Ihr Mann damit einverstanden wären.«
Christa reckte den Kopf hoch. »Nein, das sind wir nicht! Rudi gehört zur Familie, und wir werden ihn ganz bestimmt nicht hergeben.«
Damit zog sie den widerstrebenden Jungen hinter sich her. Rudi sah hilfesuchend zu Gerrit zurück, bis die Tür hinter ihm und Christa ins Schloß gefallen war. Unwillkürlich ballte Dr. Scheibler die Hände zu Fäusten.
»Warum kann man gegen solche Leute nichts unternehmen?« stieß er hervor.
Der Beamte, der jetzt seinen Dienst beendete, zuckte die Schultern. »Weil sie nichts Verbotenes tun. Rudi wird für sein Ausreißen bestraft, aber keiner von den beiden mißhandelt das Kind. Und daß er nicht geliebt wird…« Er zuckte die Schultern. »Dagegen gibt es nun mal kein Gesetz.«
»Ich weiß«, erklärte Dr. Scheibler resignierend. »Aber… er ist so ein liebenswerter Junge.« Und er dachte daran, wie selig der Kleine in seinen Armen geschlafen hatte – in der Gewißheit, beschützt und geliebt zu werden.
»Wem sagen Sie das?« Der Beamte seufzte. »Ich habe ja selbst schon mal angeklingelt, ob ich den Kleinen nicht zu mir nehmen könnte. Meine Frau und ich wünschten uns immer Kinder, aber es wollte leider nicht damit klappen.« Er winkte ab. »Ich habe dieselbe Antwort bekommen wie Sie. Die Gerlachs geben das Kind nicht her, und damit sind sie leider juristisch im Recht. Immerhin haben sie das Sorgerecht für den Jungen, und das kann man ihnen wohl nicht so einfach streitig machen.«
Zusammen verließen die beiden Männer die Polizeistation, verabschiedeten sich voneinander und stiegen in ihre Autos. Der Beamte machte sich auf den Weg nach Hause, während Dr. Scheibler zur Klinik fuhr. Doch den ganzen Tag über schaffte er es nicht, den kleinen Rudi aus seinen Gedanken zu verbannen.
Schließlich hielt er es nicht mehr aus und suchte Dr. Daniel auf, um ihm die ganze Geschichte zu erzählen.
»Und das Schlimmste ist, daß ich überhaupt nichts für ihn tun kann«, schloß er. »Ich habe versucht, seine Tante auf eine Adoption anzusprechen, doch sie hat sofort abgeblockt und behauptet, der Junge würde zur Familie gehören.« Er seufzte tief auf. »Dabei sieht man nur zu deutlich, daß er ihr bloß im Weg ist und sie nicht interessiert.«
»Trotzdem ist das Recht auf ihrer Seite«, wandte Dr. Daniel ein. »Solange diese beiden den Jungen nicht mißhandeln oder ihn sonstwie grob vernachlässigen, können Sie nichts dagegen unternehmen, Gerrit.« Impulsiv legte er dem jungen Mann eine Hand auf den Arm. »Ich weiß schon, es ist hart, so etwas mitansehen zu müssen, und wahrscheinlich wird Ihnen der Junge noch lange im Kopf herumgeistern, aber letzten Endes werden Sie einsehen müssen, daß Sie in diesem Falle machtlos sind.«
Dr. Scheibler seufzte wieder. »Ich weiß.«
»Sie müssen versuchen, den Jungen zu vergessen«, riet ihm Dr. Daniel. »Das wird Ihnen sicher nicht leichtfallen, aber es nützt niemandem, wenn Sie sich in der Sorge um den Kleinen nur selbst aufreiben. Trösten Sie sich mit dem Gedanken, daß es eine Menge Kinder gibt, die unter noch viel ärgeren Umständen als Rudi aufwachsen müssen.«
»Ein schwacher Trost«, entgegnete Dr. Scheibler deprimiert. »Und was diese vielen lieblosen Jahre bei einem Kind bewirken können…«
Dr. Daniel seufzte nun ebenfalls. »Es gibt viele Möglichkeiten, was aus dem Jungen werden könnte. Vielleicht wird er nach diesen schlechten Erfahrungen seinen eigenen Kindern einmal ein besonders liebevoller Vater sein. Ebensogut könnte er irgendwann unter die Räder kommen – im wörtlichen oder auch im übertragenen Sinn. Aber daran dürfen Sie nicht denken, Gerrit. Sie haben nur Ihre Pflicht getan, als sie den Jungen zur Polizei brachten.«
Dr. Scheibler wußte, daß Dr. Daniel im Grunde recht hatte. Er hatte seine Pflicht getan, und nun mußte er Rudi vergessen, doch im Augenblick wußte er noch nicht, wie er das machen sollte. Das schmale Gesichtchen und die traurigen Augen verfolgten ihn praktisch auf Schritt und Tritt.
*
»Gunilla? Bist du es wirklich?«
Sie sah den attraktiven Mann vor sich an, zögerte einen Moment und nickte dann schließlich.
»Ja, Franz, ich bin es«, flüsterte sie.
Um Franz Baumgartens Mund zuckte es ein wenig, denn er erinnerte sich nur zu gut an das hübsche junge Mädchen, in das er sich vor beinahe zwanzig Jahren so sehr verliebt hatte, und jetzt stand vor ihm eine Frau mit verhärmtem Gesicht und glanzlosen Augen. Ihr einst sanft gewelltes, langes Haar hatte sie streng nach hinten gekämmt und mit einer breiten Spange zusammengefaßt, was sie älter aussehen ließ, als sie es in Wirklichkeit war.
»Mami, ich habe Hunger«, begann das etwa fünfjährige Mädchen an ihrer Hand in diesem Moment zu quengeln.
»Ja, Barby, wir gehen gleich nach Hause«, versuchte Gunilla das Kind zu besänftigen, dann sah sie Franz wieder an. »Ich muß weiter. Mein Mann kommt um fünf Uhr nach Hause, dann will er etwas zu essen bekommen.«
Unwillkürlich ballte Franz die Fäuste. Wie gut er sich noch an den blendend aussehenden Helmut Heidenrath erinnerte! Mit seinem Charme und seinen verlogenen Komplimenten hatte er die hübsche Gunilla damals für sich gewonnen.
Daran dachte auch Gunilla in diesem Moment. Welch einen Fehler sie doch begangen hatte! In einem Rausch der Verzauberung hatte sie ein stilles, wärmendes Feuer gegen die heiße Glut der Leidenschaft getauscht, und nun mußte sie ihren damaligen Fehler gleich tausenfach büßen.
»War nett, dich zu sehen, Franz«, murmelte sie, dann wollte sie rasch weiter, doch das heftige Schwindelgefühl, das sie schon den ganzen Tag immer wieder heimgesucht hatte, ließ sie plötzlich taumeln, und noch ehe Franz mit einer Hand helfend zugreifen konnte, war Gunilla schon zu Boden gestürzt.
»Mami!«
Das kleine Mädchen war den Tränen nahe, während die etwa Einjährige, die in einem speziellen Sitz auf dem Kinderwagen saß, kein Interesse an dem zeigte, was da um sie herum vorging. Sie beschäftigte sich angelegentlich mit den knallroten Knöpfen an ihrer Latzhose.
»Gunilla, um Himmels willen…«, begann Franz, doch im selben Moment sah er den roten Fleck, der sich auf ihrem Kleid ausbreitete.
»Schnell!« rief er verzweifelt. »Einen Arzt!«
Amelie Hauser, die Besitzerin des Gemischtwarenladens, die ja schon von Berufs wegen recht neugierig war, erschien als erste auf der Straße, dann lief sie rasch in ihr Geschäft zurück und rief sofort in der Waldsee-Klinik an. Kaum zwei Minuten später war der Krankenwagen da und transportierte Gunilla samt ihrer Kinder in die Klinik. Fast gleichzeitig mit ihr trafen Dr. Daniel und auch Franz Baumgartner ein.
»Wer sind Sie?« wollte Dr. Daniel wissen, während er bereits hinter der fahrbaren Trage herging, auf der Gunilla in die Gynäkologie hinübergefahren wurde.
»Ein… ein Freund«, stammelte Franz, doch Dr. Daniel spürte instinktiv, daß hinter seiner Besorgnis weit mehr als nur flüchtige Freundschaft steckte.
»Helfen Sie ihr!« rief Franz dem Arzt noch nach, dann blieb er wie betäubt in der Eingangshalle stehen. Er wußte, daß er hier nichts zu suchen hatte. Was zwischen ihm und Gunilla einmal gewesen war, war längst Vergangenheit, und doch – er hatte innerlich nie aufgehört, sie zu lieben.
*
»Ich wußte es«, knurrte Dr. Daniel, als er sah, daß Gunilla Heidenrath erneut an Unterleibsblutungen litt, und diesmal hatte er weit mehr Mühe, die Blutung zum Stillstand zu bringen.
»Wenn Herr Heidenrath seine Frau wieder vorzeitig aus der Klinik holen will, dann werfen Sie ihn umgehend hinaus!« erklärte Dr. Daniel wütend, als es ihm endlich gelungen war, die Blutung zum Stillstand zu bringen.
»Sie wissen genau, daß ich das nicht so einfach darf, Herr Doktor«, entgegnete Schwester Bianca beinahe schüchtern. So wie im Augenblick hatte sie den sanftmütigen Dr. Daniel noch nie erlebt.
Jetzt seufzte er. »Ich weiß. Es war auch nur…« Ärgerlich winkte er ab. »Daß Frau Heidenrath wieder hier liegt, ist allein seine Schuld. Hätte er sie noch zwei Tage länger in der Klinik bleiben lassen, wäre es sicher nicht passiert, aber ich fürchte, es würde nicht einmal etwas nützen, ihm das jetzt zu sagen. Er ist und bleibt ein extrem rücksichtsloser Mensch.«
»Frau Heidenrath hatte übrigens nur Barbara, Kristin und Helene dabei«, erklärte Bianca in der Hoffnung, Dr. Daniel von seinem Unmut auf Helmut Heidenrath ein wenig abzulenken.
Er runzelte auch tatsächlich die Stirn. »Das heißt, daß Gitti und Nina allein zu Hause sind.« Dr. Daniel fuhr sich mit einer Hand durch das dichte blonde Haar. »Darum werde ich mich wohl kümmern müssen. Die Mädels sind zwar schon vierzehn und zwölf Jahre alt, trotzdem kann man sie nicht einfach sich selbst überlassen.« Er schwieg einen Moment. »Frau Heidenrath kommt wieder auf Intensiv, und diesmal wird sie dort so lange bleiben, bis sie wirklich außer Gefahr ist. Und von der Intensivstation wird Herr Heidenrath sie mir nicht wegholen, dafür sorge ich.«
Dann verließ er mit langen Schritten den Raum und steuerte auf die Eingangshalle zu.
»Wie geht’s Gunilla?«
Dr. Daniel sah sich um und erkannte, daß der Mann, der gleichzeitig mit ihm in der Klinik eingetroffen war, noch hier wartete.
»Den Umständen entsprechend«, antwortete er ausweichend. »Mehr darf ich Ihnen leider nicht sagen – es sei denn, Sie wären mit Frau Heidenrath verwandt.«
Betrübt schüttelte Franz den Kopf. »Nein, das bin ich leider nicht.« Er blickte zu Boden. »Ich wollte sie einmal heiraten, aber…« Hilflos zuckte er die Schultern, dann sah er Dr. Daniel wieder an. »Sie ist nicht glücklich mit Helmut geworden, oder?«
Dr. Daniel konnte unschwer erkennen, wie groß Franz’ Liebe zu Gunilla noch immer war, und es war ihm klar, daß sie es mit diesem Mann sicher weit besser getroffen hätte.
»Auch darüber darf ich nichts sagen«, wich Dr. Daniel aus.
Franz nickte. »Ich verstehe, Herr Doktor.« Er zögerte. »Nur eines noch: Sie wird doch wieder… gesund?«
Dr. Daniel nickte. »Ja, das wird sie bestimmt. Machen Sie sich dar-über keine Sorgen.«
»Danke, Herr Doktor«, murmelte Franz, dann verließ er die Klinik und machte sich mit langsamen Schritten auf den Heimweg. Die Begegnung mit Gunilla hatte ihn zutiefst erschüttert, und wieder einmal wünschte er, er hätte damals, als er sie verloren hatte, etwas dagegen tun können. Aber sie war von ihrer Liebe zu Helmut ja so hingerissen und verblendet gewesen…
*
»Wo ist eure Mutter?« herrschte Helmut Heidenrath seine beiden älteren Töchter an.
Ängstlich wich die zwölfjährige Nina vor ihm zurück.
»Antwortet gefälligst, ihr dämlichen Gören!« fuhr Helmut auf.
Wie beschützend stellte sich Gitti vor ihre Schwester, dabei zitterte sie selbst vor lauter Angst.
»Mami ist einkaufen gegangen«, erklärte sie mit bebender Stimme. »Vor über zwei Stunden schon und…«
Die Türklingel unterbrach sie.
»Wenn sie das ist, dann soll sie was erleben«, knurrte Helmut wütend, während er die Tür aufriß, doch davor stand nicht Gunilla, sondern Dr. Daniel.
»Was wollen Sie denn hier?« fuhr Helmut den Arzt an.
»Ihre Frau liegt seit einer Stunde stationär in der Waldsee-Klinik«, antwortete Dr. Daniel, und niemand hätte erkennen können, welcher Sturm in ihm tobte. »Wie ich es Ihnen gestern schon prophezeit habe, hat sie wieder Unterleibsblutungen bekommen, und daß sie daran nicht gestorben ist, kommt beinahe einem Wunder gleich.«
»Sie ist eben ein wehleidiges Luder«, polterte Helmut los. »Wenn ich da an ihre Mutter denke – das war eine Frau! Zehn Kinder hat sie zur Welt gebracht, und kein Wort der Klage kam über ihre Lippen. Das hat mein Schwiegervater mir mal erzählt. Nur deshalb habe ich Gunilla überhaupt geheiratet. Ich dachte, sie würde nach ihrer Mutter kommen.« Ärgerlich winkte er ab. »Weit gefehlt!«
Dr. Daniel hatte nun wirklich Mühe, sich länger zu beherrschen.
»Ihre Frau, Herr Heidenrath, ist alles andere als wehleidig«, entgegnete er so ruhig, wie es ihm angesichts der Haltung dieses Mannes überhaupt noch möglich war. »Wäre sie das, dann hätte sie Ihnen bestimmt keine fünf Kinder zur Welt gebracht.«
Ungerührt zuckte Helmut die Schultern. »Na und? Was ist da schon dabei? Es waren ja sowieso bloß lauter Mädchen.«
»Glauben Sie denn, es würde einen Unterschied machen, ob eine Frau ein Mädchen oder einen Jungen austrägt?« Dr. Daniel schüttelte den Kopf. »Manchmal frage ich mich wirklich, was Sie früher während des Biologieunterrichts in der Schule getrieben haben. Die Wehen sind bei jedem Kind dieselben, und gerade Ihre Frau hatte außerordentlich schwere Geburten. Bei Gitti lag sie fast vierzehn Stunden in den Wehen, und bei Nina waren es immerhin noch zehn.«
Ein spöttisches Grinsen huschte über Helmuts Gesicht. »Sie nehmen am Schicksal meiner Frau ja regen Anteil.«
»Ja, Herr Heidenrath, die Sorgen meiner Patientinnen sind für gewöhnlich auch meine Sorgen«, entgegnete Dr. Daniel ernst.
»Bei Gunilla können Sie sich das sparen«, meinte Helmut. »Wir werden mit unserem Leben auch ohne Sie fertig.«
»Das scheint mir aber nicht so zu sein. Immerhin soll Ihre Frau weitere Kinder zur Welt bringen, und damit bin auch ich betroffen. Ich soll schließlich dafür sorgen, daß Mutter und Kind die Geburt wohlbehalten überstehen.«
Helmut stöhnte betont theatralisch auf. »Fangen Sie jetzt bloß nicht wieder mit dem Unsinn an, daß Gunilla beim nächsten Kind sterben könnte. Meine Güte, Herr Doktor, in welchem Jahrhundert leben Sie eigentlich. Heutzutage stirbt man nicht mehr bei der Geburt.«
»Himmel noch mal, wollen Sie es nicht begreifen, oder können Sie es nicht?« brauste Dr. Daniel ganz entgegen seiner sonstigen besonnenen Art auf. »Daß Ihre Frau Helenes Geburt überlebt hat, verdanken Sie doch auch nur der Tatsache, daß ich sie mittlerweile schon so gut kenne. Ich wußte also genau, daß es zu dieser Nachblutung kommen würde.«
»Na sehen Sie, und nächstes Mal wissen Sie es auch«, erklärte Helmut in einem Tonfall, als müsse er sich einem kleinen Kind verständlich machen.
Dr. Daniel war nun wirklich verärgert. Warum schaffte er es nicht, sich diesem Mann verständlich zu machen?
»Mit einer weiteren Schwangerschaft verurteilen Sie Ihre Frau zum sicheren Tod«, meinte Dr. Daniel. »Sie wird mir unter den Händen verbluten. Wollen Sie das wirklich riskieren, Herr Heidenrath? Ist Ihre Manie, unbedingt einen Sohn zu bekommen, schon so ausgeprägt, daß Sie dafür Ihre Frau opfern wol-
len?«
»So etwas muß ich mir nicht anhören!« fuhr Helmut ihn an. »Verschwinden Sie! Und lassen Sie sich eines gesagt sein: Ich will einen Sohn, und ich bin bereit, jeden Preis dafür zu zahlen.«
Dr. Daniel fröstelte unwillkürlich. Er konnte einfach nicht begreifen, wie ein Mensch nur so kaltblütig sein konnte.
»Und was tun Sie, wenn das nächste Kind wieder ein Mädchen ist und Ihre Frau bei der Geburt stirbt?« wollte Dr. Daniel wissen, doch Helmut blieb ihm die Antwort auf diese Frage schuldig.
»Gehen Sie endlich!« verlangte er nur.
Erst in diesem Moment fiel Dr. Daniels Blick auf die beiden Mädchen, die sich völlig verängstigt in die Ecke gedrückt hatten.
»Ich werde Gitti und Nina mitnehmen«, erklärte er. »Sie müssen schließlich morgen früh wieder zur Arbeit und…«
»Die zwei können sich selbst versorgen«, fiel Helmut ihm ins Wort. »Wo sind die anderen Gören?«
»Unsere Krankenpflegehelferin Darinka kümmert sich um Barby, Kristin und Helene«, antwortete Dr. Daniel. »Ich bin sicher, daß es ihr nichts ausmachen würde, auch Gitti und Nina…«
»Die zwei bleiben bei mir«, entgegnete Helmut barsch, dann drängte er den Arzt fast gewaltsam hinaus und schlug ihm die Tür vor der Nase zu.
Dr. Daniel seufzte tief auf. Nur selten hatte er sich so hilflos gefühlt wie in diesem Augenblick. Was konnte er jetzt noch für Gunilla tun?
*
Als Gunilla erwachte, saß Dr. Daniel bei ihr am Bett. Erschrocken fuhr sie hoch.
»Wo sind die Mädchen?« fragte sie mit bebender Stimme.
Vorsichtig drückte Dr. Daniel sie wieder in die Kissen zurück.
»Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Heidenrath«, erklärte er dabei besänftigend. »Barby, Kristin und Helene werden von unserer Krankenpflegehelferin versorgt, und die beiden Großen sind bei Ihrem Mann.«
Gunillas Unterlippe begann zu zittern. Es war ganz deutlich, daß sie um Gitti und Nina fürchtete.
»Ich muß sofort nach Hause, Herr Doktor.«
Doch Dr. Daniel schüttelte bedauernd den Kopf. »Das kann ich nicht verantworten, Frau Heidenrath. Sie haben eine Menge Blut verloren.« Er schwieg kurz. »Ich weiß genau, was in Ihnen vorgeht, aber wenn ich Sie jetzt aus der Klinik entlasse, dann sind Sie in ein paar Stunden wieder hier, das kann ich Ihnen versichern. Und dann gelingt es mir womöglich nicht mehr, Sie zu retten. Es war diesmal schon schwierig genug.«
Dieses Argument schien Gunilla zu überzeugen. Lieber ließ sie Gitti und Nina für ein paar Tage in der Obhut ihres rücksichtslosen und oftmals brutalen Mannes als womöglich alle fünf Kinder für immer…
»Machen Sie mich bitte schnell gesund, Herr Doktor«, bat sie leise. »Meine Kinder brauchen mich.«
Dr. Daniel nickte. »Genau dar-über muß ich mit Ihnen sprechen, Frau Heidenrath. Sie dürfen keine weitere Schwangerschaft mehr riskieren. Ein sechstes Kind würde Sie unweigerlich umbringen.«
Hilflos schluchzte Gunilla auf. »Was soll ich denn tun, Herr Doktor? Helmut will unbedingt einen Sohn.«
»Das ist sein Problem«, urteilte Dr. Daniel ungewöhnlich hart, dann wurde seine Stimme wieder sanft und eindringlich. »Frau Heidenrath, Sie sollten jetzt nicht an Ihren Mann und seine verschrobenen Vorstellungen denken, sondern einzig und allein an sich und Ihre Kinder. Wie Sie vorhin ganz richtig sagten – die Mädchen brauchen Sie.«
Gunilla zögerte. »Helmut wünscht sich diesen Jungen so sehr…«
»Frau Heidenrath, Ihr Mann stammt aus einer Familie mit elf Mädchen… eigentlich waren es sogar vierzehn, wenn man die drei Babys mitrechnet, die kurz nach der Geburt gestorben sind. Damit liegt die Wahrscheinlichkeit, daß Ihr nächstes Baby ein Junge wird, meiner Meinung nach nicht einmal bei fünfzig Prozent. Es wäre der pure Wahnsinn, wenn Sie dafür Ihr Leben aufs Spiel setzen würden.«
Mit einer fahrigen Handbewegung strich sich Gunilla über die Stirn, dann schluchzte sie auf.
»Was soll ich denn bloß tun, Herr Doktor? Ich bin doch erst zweiundvierzig. Ich will noch nicht sterben. Und meine Kinder… Helmut ist mit ihnen immer so… so streng…«
Dr. Daniel ahnte, daß das eine dezente Umschreibung war für das, was Helmut Heidenrath hinter verschlossenen Türen wohl tatsächlich tat. Für einen Augenblick fragte er sich, ob man dem Mann vielleicht auf diese Weise beikommen könnte, doch er verwarf diesen Gedanken rasch wieder. Bisher hatte Dr. Daniel nicht feststellen können, daß Helmut seine Kinder vielleicht sogar mißhandeln würde, und er sah die Familie Heidenrath ja ziemlich häufig.
»Sie sollten sich sterilisieren lassen«, antwortete Dr. Daniel jetzt auf Gunillas Frage.
Heftig schüttelte Gunilla den Kopf. »Nein, Herr Doktor, das kann ich nicht! Helmut würde mich umbringen…«
»Frau Heidenrath, Sie dürfen kein Baby mehr bekommen, und die einzige wirklich sichere Methode, um das zu verhindern, ist nun mal eine Sterilisation.« Impulsiv ergriff er ihre Hand. »Ich würde so etwas einer Frau niemals leichtfertig empfehlen, das können Sie mir glauben. Eine Sterilisation ist ein ziemlich endgültiger Schritt und will daher gut überlegt sein. Aber in Ihrem Fall, Frau Heidenrath, kann er lebensrettend sein.«
Doch Gunilla schüttelte wiederum den Kopf. »Nein, Herr Doktor, ich kann einfach nicht. Meine Ehe ist schwierig genug, ich darf sie mit so etwas nicht noch zusätzlich belasten.« Sie wich Dr. Daniels Blick aus. »Sie müssen mich verstehen, Herr Doktor. Mein Mann… er… er hat mich schon wegen weniger wichtigen Dingen geschlagen…«
Unwillkürlich ballte Dr. Daniel die Fäuste. Noch nie im Leben hatte er einen Menschen so sehr verabscheut wie diesen groben Helmut Heidenrath, und es machte ihm arg zu schaffen, daß er gerade in diesem Fall nicht so leicht Hilfe bringen konnte.
*
Es verging kaum ein Tag, an dem Dr. Scheibler nicht an den kleinen Rudi Gerlach dachte. Während dieser Zeit suchte er einen befreundeten Rechtsanwalt auf, ging zum Jugendamt und sogar zum Gericht, doch gleichgültig wo er seine Geschichte vorbrachte – es wurde ihm klipp und klar gesagt, daß er keine Chance hatte, den Jungen auch nur in Pflege zu bekommen, solange die Gerlachs damit nicht einverstanden waren – es sei denn, sie würden das Kind extrem vernachlässigen oder gar mißhandeln, doch beides war offensichtlich nicht der Fall. Rudi wurde zwar allem Anschein nach sehr streng erzogen, doch das rechtfertigte noch kein Einschreiten von Amts wegen. Schließlich gab Dr. Scheibler auf und versuchte, Dr. Daniels Rat zu folgen.
Er stürzte sich in seine Arbeit, beschäftigte sich noch intensiver als zuvor mit seiner kleinen Tochter und tat alles, um den kleinen Rudi zu vergessen. Doch die großen, traurigen Augen schienen ihn zu verfolgen. So sehr er sich auch bemühte, es gelang ihm nicht, den Jungen aus seinem Gedächtnis zu verbannen. Und ganz offensichtlich beruhte das auf Gegenseitigkeit, denn eines Abends gab es ein Wiedersehen zwischen den beiden.
Als Dr. Scheibler nach dem Dienst seine Wohnung betrat, kam ihm seine Frau Stefanie lächelnd entgegen.
»Rate mal, wer zu Besuch gekommen ist?« fragte sie mit geheimnisvollem Blick.
Dr. Scheibler zuckte die Schultern. »Keine Ahnung. Geli vielleicht?«
Stefanie schüttelte den Kopf, dann öffnete sie die Wohnzimmertür. Dr. Scheibler glaubte seinen Augen nicht zu trauen: Da saßen Daniela und Rudi einträchtig auf dem Teppich und spielten hingebungsvoll miteinander. Jetzt sah der Junge auf.
»Gerrit!« rief er, und dabei glitt ein glückliches Strahlen über sein Gesicht, dann sprang er auf und fiel Dr. Scheibler um den Hals.
»Rudi, Junge, wo kommst du denn her?« fragte Gerrit, als er sich von der ersten Überraschung erholt hatte. »Und woher wußtest du, wo ich wohne?«
Mit leuchtenden Augen sah Rudi zu ihm auf. »Du hast damals bei der Polizei deine Adresse angegeben, und die habe ich mir eben gemerkt.«
Spontan nahm Dr. Scheibler den Kleinen in die Arme.
»Ich habe oft an dich gedacht, Rudi«, gestand er, dann sah er ihn prüfend an. »Hat deine Tante dich damals bestraft?«
Der Junge nickte. »Das tut sie immer, wenn ich davonlaufe. Onkel Kurt hat mir auch noch ein paar hinten drauf gegeben.« Er lächelte wieder. »Aber jetzt werde ich bei dir und Steffi bleiben – für immer.«
Mit einem tiefen Seufzer stand Dr. Scheibler auf.
»Ich fürchte, so einfach wird das nicht sein, Rudi.«
»Ich gehe aber nicht zu Tante Christa und Onkel Kurt zurück«, widersprach Rudi heftig, dann schlang er seine Arme um Dr. Scheiblers Taille und drückte sich fest an ihn. »Bitte, Gerrit, laß mich hierbleiben. Ich verspreche dir auch…«
Da löste sich Dr. Scheibler aus seiner Umarmung, ergriff seine beiden Hände und ging erneut vor ihm in die Hocke.
»Hör zu, Rudi, es ist nicht so, daß ich in den vergangenen beiden Wochen untätig gewesen wäre«, erklärte er so ruhig, wie es ihm bei dem Aufruhr, der in seinem Inneren herrschte, möglich war. »Ich habe mich erkundigt, ob ich dich von deiner Tante und deinem Onkel wegholen darf, aber es geht nicht. Gegen ihren Willen kann ich nicht das geringste für dich tun, und du hast ja gehört, was deine Tante gesagt hat, als ich sie gefragt habe, ob sie dich zu Steffi und mir in Pflege geben würde.«
Rudi schluchzte auf. »Dabei wollen sie mich doch gar nicht haben!«
Die Tränen des Jungen schnitten nicht nur Dr. Scheibler, sondern auch Stefanie ins Herz.
»Gerrit, wir können ihn nicht einfach zurückschicken und so tun, als existierte sein Kummer gar nicht«, erklärte sie eindringlich.
»Das will ich doch gar nicht«, begehrte Dr. Scheibler auf. »Meine Güte, du tust ja, als wäre ich ein Scheusal! Nichts wäre mir lieber, als Rudi einfach zu behalten, aber das geht leider nicht. Wir würden uns strafbar machen, wenn wir ihn nicht zurückbringen!«
Besänftigend legte Stefanie eine Hand auf seine Schulter. »Das weiß ich doch auch, Gerrit. Und so, wie es sich angehört hat, habe ich es ja gar nicht gemeint.« Sie zögerte. »Wenn wir beide mit den Gerlachs sprechen würden… glaubst du, das könnte etwas nützen?«
Dr. Scheibler zuckte die Schultern. »Keine Ahnung. Aber wir können es ja zumindest mal versuchen.« Er stand auf. »Ich werde bei ihnen anrufen.« Er sah Rudi an. »Du weißt die Nummer, oder?«
Rudi nickte, dann wagte er noch einen Versuch. »Gerrit, ich verspreche dir auch, daß ich dir und Steffi niemals davonlaufen werde. Ich werde brav sein, und ihr… ihr werdet gar nicht merken, daß ich überhaupt da bin. Bitte, Gerrit, kannst du mich nicht behalten?«
Dr. Scheibler ließ den Hörer wieder sinken und seufzte. »Du machst es mir verdammt schwer, mein Junge. Rudi, wir können dich nicht einfach hierbehalten. Das käme einer Kindesentführung gleich, und damit würden wir uns strafbar machen.«
»Ich verstecke mich einfach bei euch«, erklärte Rudi verzweifelt. »Niemand wird jemals erfahren, daß ich bei euch bin. Gerrit, bitte…«
»Es geht nicht, Rudi, und ich glaube, du bist auch alt genug, um das zu begreifen.« Er schwieg kurz. »Ich kann dir nur versprechen, daß ich alles versuchen werde, um deinen Onkel und deine Tante umzustimmen, denn nur wenn sie einverstanden sind, kann ich dich zu mir holen.«
Tränen glitzerten in Rudis großen Augen. »Und wenn Sie… nicht einverstanden sind?«
»Ich fürchte, dann mußt du leider bei ihnen bleiben.«
Diese Worte brachen Dr. Scheibler fast das Herz, und es kostete ihn große Mühe, den Telefonhörer ein zweites Mal abzuheben, doch er wußte ja, daß er keine andere Wahl hatte.
»Also, Rudi, was ist jetzt?« fragte er, doch seine Stimme klang dabei nicht so sicher wie sonst. »Sagst du mir die Nummer, oder muß ich im Telefonbuch nachsehen?«
Der Junge resignierte. Niedergeschlagen nannte er die Telefonnummer seiner Verwandten.
»Herr Gerlach? Hier ist Gerrit Scheibler«, gab sich der Arzt zu erkennen. »Rudi ist bei mir. Als ich vom Dienst nach Hause kam, wartete er schon auf mich.«
»Dieser Lausebengel!« tobte Kurt Gerlach. »Aber diesmal versohle ich ihm den Hintern so sehr, daß er eine Woche lange nicht mehr sitzen kann, das versichere ich Ihnen. Rudi wird Sie bestimmt nicht mehr belästigen.«
»Er hat mich ganz und gar nicht belästigt«, entgegnete Dr. Scheibler so ruhig wie möglich. »Und ich möchte auch nicht, daß Sie ihn bestrafen.«
Einen Augenblick herrschte Schweigen am anderen Ende der Leitung.
»Soll ich ihn… abholen?« erkundigte sich Kurt dann zögernd, und Dr. Scheibler hörte an seiner Stimme, daß er eigentlich ein Nein erhoffte.
»Nicht nötig, Herr Gerlach. Es macht mir nichts aus, Rudi nach Hause zu bringen.«
»Ja, das wäre mir sehr recht.« Und wie zu seiner Rechtfertigung fügte er hinzu: »Wissen Sie, ich fahre abends nicht mehr sehr gern mit dem Auto – noch dazu in eine Gegend, die ich nicht kenne.«
»In Ordnung, Herr Gerlach. Ich bin in einer halben Stunde bei Ihnen.«
Dr. Scheibler legte auf, und als er sich umdrehte, sah er direkt in Rudis ängstliche Augen.
»Ich muß wirklich zurück?«
Impusliv nahm Dr. Scheibler ihn in den Arm. »Glaub ja nicht, daß mir das leichtfällt.« Dann sah er Stefanie an. »Ich glaube, es ist besser, wenn ich noch mal versuche, allein mit den Gerlachs zu sprechen. Ich weiß nämlich nicht, wie sie es auffassen, wenn wir beide mit Daniel dort anrücken.«
Stefanie zögerte, dann nickte sie. »Vielleicht hast du recht.« Liebevoll streichelte sie über Rudis blonde Locken. »Wenn es einen Weg gibt, dich von deinen Verwandten wegzuholen, dann wird Gerrit ihn finden, das verspreche ich dir.«
Rudi nickte tapfer, aber als Dr. Scheibler eine halbe Stunde später vor dem Haus der Gerlachs seinen Wagen anhielt, flossen doch noch ein paar Tränen.
Dr. Scheibler drückte ihn tröstend an sich. »Vielleicht habe ich bei deinem Onkel mehr Erfolg als bei deiner Tante.«
»Und wenn nicht?« schluchzte Rudi leise.
»Dann werde ich zumindest versuchen einen Weg zu finden, damit du Steffi und mich ab und zu besuchen kannst.«
Ganz fest schmiegte sich Rudi an ihn. »Gerrit, ich habe dich sehr lieb.«
»Ich habe dich auch sehr lieb, mein Junge.« Dr. Scheibler nahm seine Hand. »Komm jetzt, Rudi.«
Auf sein Klingeln öffnete Kurt Gerlach die Haustür und kam dann ans Gartentor, um Rudi in Empfang zu nehmen.
»Darf ich noch einen Augenblick mit hineinkommen?« fragte Dr. Scheibler höflich.
Kurt zögerte kurz, dann ließ er Gerrit eintreten. Als sie gemeinsam im Wohnzimmer saßen und auch Christa sich bequemte, den Fernsehapparat auszuschalten, beschloß Dr. Scheibler spontan, nicht lange um den heißen Brei herumzureden.
»Rudi fühlt sich bei Ihnen nicht sehr wohl«, erklärte er rundheraus.
»Das geht Sie gar nichts an!« entgegnete Christa scharf.
»Ich weiß nicht. Sind wir nicht alle betroffen, wenn ein Kind unglücklich ist?«
»Rudi hat keinen Grund, unglücklich zu sein«, entgegnete Kurt energisch, und Christa fügte hinzu: »Er hat hier alles, was er braucht.«
Dr. Scheiblers Blick wurde eisig, als er die mondän gekleidete Frau betrachtete.
»Braucht er auch Ohrfeigen, wenn er vor Ihrer Lieblosigkeit flüchtet? Und braucht er Stubenarrest und Nahrungsentzug, wenn er schlechte Noten mit nach Hause bringt?«
Unter Gerrits scharfem Blick und seinen schweren Vorwürfen wurde es Christa und Kurt tatsächlich ein wenig unbehaglich – wenn auch nur deswegen, weil sie befürchten mußten, ihr einträgliches Nebeneinkommen zu verlieren.
»Leider sind das alles Dinge, mit denen man Sie vor Gericht nicht belangen könnte«, fuhr Dr. Scheibler fort und bemerkte dabei, wie sich die Gerlachs wieder sichtlich entspannten. »Ich habe also keine Möglichkeit, Ihnen das Sorgerecht für den Jungen entziehen zu lassen, und im Grunde will ich das auch gar nicht. Ich selbst befand mich als Kind in einer ähnlichen Lage wie Rudi heute, deshalb würde ich ihn nur ungern von den einzigen Verwandten, die er noch hat, entfernen. Andererseits will ich aber auch nicht tatenlos zusehen, wie Rudi immer unglücklicher wird. Deshalb bitte ich Sie ausdrücklich, mir den Jungen wenigstens in Pflege zu geben, wenn Sie einer Adoption durch meine Frau und mich schon nicht zustimmen wollen.«
Christa und Kurt wechselten einen langen Blick. Sie dachten beide dasselbe – nämlich, wie schön es doch wäre, das lästige Anhängsel Rudi endlich loszuwerden. Aber der Gedanke an das Geld, das ihnen monatlich überwiesen wurde, ließ sie zögern.
»Tut mir leid, Herr Dr. Scheibler, aber wir geben den Jungen nicht her«, antwortete Kurt schließlich.
»Warum denn nicht?« fragte Gerrit heftiger, als er es eigentlich gewollt hatte. »Ihnen liegt an Rudi doch überhaupt nichts!«
»Woher wollen Sie das wissen?« konterte Kurt in ebenso heftigem Ton. »Rudi ist der Sohn meines verstorbenen Bruders! Wir lieben ihn, als wäre er unser eigenes Kind!«
Dr. Scheibler glaubte ihm kein Wort. Das Verhalten, das sowohl Christa als auch Kurt Rudi gegen-über an den Tag legten, sprach für sich. Warum weigerten sie sich aber dennoch so strikt, das Kind in gute Hände zu geben? War es wirklich – wie der Polizeibeamte vermutet hatte – das Pflichtbewußtsein dem verstorbenen Bruder gegenüber?
»Herr Gerlach…«, setzte Dr. Scheibler noch einmal an, doch Christa fiel ihm sofort ins Wort.
»Haben Sie nicht gehört, was mein Mann gesagt hat? Wir geben Rudi nicht her.« Sie zögerte kurz, dann fügte sie wenig glaubhaft hinzu: »Wir lieben ihn.«
»Ja, vor allem Sie«, entfuhr es Dr. Scheibler, doch im selben Moment wußte er, daß er damit einen Fehler begangen hatte. Spätestens jetzt hatte er überhaupt keine Chance mehr, die Gerlachs für seinen Vorschlag zu gewinnen.
»Sie sollten jetzt besser gehen«, erklärte Kurt da auch schon. »Und ich möchte nicht, daß Sie und Rudi sich noch einmal begegnen. Ihre Gesellschaft kann meines Erachtens nur einen schlechten Einfluß auf Rudi haben.«
Dr. Scheibler wußte, daß er einlenken mußte, wenn er überhaupt noch etwas für Rudi tun wollte.
»Was ich gesagt habe, tut mir leid«, erklärte er. »Ich wollte Ihnen keinesfalls zu nahe treten, aber es schmerzt mich einfach zu wissen, daß Rudi unglücklich ist, und ich denke, wir sollten miteinander und nicht gegeneinander arbeiten, damit sich das ändert.« Er schwieg einen Moment. »Bitte, versuchen Sie wenigstens, dem Jungen ein bißchen Liebe und Verständnis entgegenzubringen. Als Gegenleistung soll Rudi Ihnen versprechen, nicht mehr davonzulaufen. Und vielleicht sind Sie ja damit einverstanden, wenn ich den Jungen gelegentlich zu mir hole – an einem dienstfreien Wochenende beispielsweise.«
Wieder wechselten Kurt und Christa einen Blick. Dieser Vorschlag war nun wirklich verlockend, denn auf diese Weise wären sie Rudi wenigstens ab und zu mal los und bräuchten trotzdem nicht auf ihr monatliches Nebeneinkommen zu verzichten.
»Also schön«, meinte Kurt. »Sie können Rudi ab und zu sehen. Über den anderen Punkt muß nicht weiter diskutiert werden, weil wir dem Jungen ohnehin nur Liebe entgegenbringen.«
Dr. Scheibler konnte nur mit Mühe eine heftige Erwiderung unterdrücken, denn er wollte das, was er erreicht hatte, ja nicht wieder zunichte machen.
»Danke«, erklärte er, dann stand er auf, doch bevor er ging, wandte er sich Rudi noch einmal zu. »Du versprichst mir, daß du nicht mehr davonläufst, ja?«
Rudi senkte einen Augenblick den Kopf, dann sah er Dr. Scheibler mit seinen großen, blauen Augen an.
»Nein, Gerrit, versprechen kann ich dir das nicht«, antwortete er ehrlich. »Aber ich werde mich bemühen.«
Dr. Scheibler nickte ihm lächelnd zu, dann streichelte er zärtlich durch seinen blonden Wuschelkopf.
»Wir sehen uns bald wieder, mein Junge.«
*
Als Gunilla Heidenrath in Dr. Daniels Praxis kam, ahnte er sofort Schreckliches.
»Herr Doktor, ich bin schwanger.«
Ihre Worte kamen leise, so, als würde sich sich darüber schämen. Und dann brach sie auch schon in Tränen aus.
»Ich wollte es nicht«, schluchzte sie verzweifelt. »Ich spürte, daß es meine fruchtbaren Tage waren, aber Helmut…« Vor lauter Weinen konnte sie nicht weitersprechen.
Dr. Daniel stand auf, kam um seinen Schreibtisch herum und legte einen Arm tröstend um die Schultern der hilflos schluchzenden Frau.
»Ich weiß schon, Frau Heidenrath, gegen Ihren Mann ist wirk-
lich nur schwer anzukommen.« Er überlegte, was nun zu tun sei. »Weiß er schon von der Schwangerschaft?«
Gunilla schüttelte nur den Kopf.
»Dann sollten wir vielleicht an eine Abtreibung denken«, meinte Dr. Daniel. »Obwohl das gerade in Ihrem Fall sicher auch nicht ganz ungefährlich ist.«
»Nein, Herr Doktor!« wehrte Gunilla entschieden ab. »Sie dürfen das Baby nicht töten.« Wie beschützend legte sie beide Hände auf ihren Bauch. »Es ist doch jetzt schon mein Kind.«
»Das weiß ich«, entgegnete Dr. Daniel sehr ernst. »Und normalerweise bin ich mit einem Schwangerschaftsabbruch auch nicht so schnell bei der Hand, ganz im Gegenteil, aber in diesem Fall… Frau Heidenrath, denken Sie an Ihre fünf Mädchen. Wenn Sie darauf bestehen, dieses Baby zu bekommen, verurteilen Sie sich damit selbst zum Tod. Und was soll denn aus Ihren anderen Kindern werden?«
Gunilla vergrub ihr Gesicht in den Händen, dann schüttelte sie den Kopf. »Ich kann es nicht abtreiben lassen. Das würde allem widersprechen, wonach ich bisher gelebt habe.«
*
»Robert, was ist denn los mit dir?« fragte Manon Carisi besorgt, als Dr. Daniel wie beinahe jeden Abend zu ihr kam.
Er seufzte tief auf. »Ach, Manon, ich weiß nicht mehr weiter. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich völlig ratlos, dabei wäre es gerade jetzt so dringend…« Er winkte ab. »Damit sollst du dich nicht belasten, Liebes. Du brauchst noch Erholung und…«
»Damit ist es ab morgen vorbei«, fiel Manon ihm ins Wort. »Ich bin der Meinung, daß Stefan mich jetzt lange genug vertreten hat – sehr gut sogar übrigens«, fügte sie lächelnd hinzu. »Dein Sohn wird mal ein erstklassiger Arzt.« Sie streichelte durch Dr. Daniels dichtes Haar. »Genau wie sein Vater.«
»Danke für die Blumen. Im Moment fühle ich mich allerdings eher wie ein Versager.« Erst jetzt wurde ihm bewußt, was Manon gerade gesagt hatte. »Augenblick mal… soll das etwa heißen, du willst morgen wieder anfangen zu arbeiten?«
Manon nickte strahlend. »Es wird langsam Zeit, daß ich mich bei meinen Patienten wieder sehen lasse. Außerdem halte ich es einfach nicht mehr länger aus. Zuviel Erholung ist nämlich auch nicht gut. Ich sehne mich richtig nach meiner Arbeit.«
Zärtlich nahm Dr. Daniel sie in den Arm. »Ich will ganz ehrlich sein – ich freue mich, dich wieder in meiner Nähe zu haben.« Er wurde ernst. »Hast du mit Professor
Thiersch darüber gesprochen?«
»Selbstverständlich, und er hält es auch für unbedenklich.« Sie grinste. »So hat er das natürlich nicht gesagt, wie du dir denken kannst.«
Dr. Daniel schmunzelte. »Ich nehme an, er wird sich etwa in dieser Art geäußert haben.« Er räusperte sich und versuchte dann die Stimme des Professors zu imitieren: »Ich habe Ihnen gesagt, daß Sie gesund sind, also wird es auch allmählich Zeit für Sie, wieder mit der Arbeit zu beginnen.«
Manon lachte. »Das klingt fast, als hättest du eine Abhöranlage in mein Telefon installiert. Du wirst es nicht glauben, Robert, aber das waren genau seine Worte.« Sie wurde wieder ernst und streichelte erneut durch Dr. Daniels Haar. »Was ist jetzt, Robert? Willst du mir nicht doch endlich erzählen, was dich schon seit Wochen so bedrückt?«
Dr. Daniel nickte. »Ja, Manon, vielleicht hast du recht. Ich sollte wirklich darüber sprechen.« Er atmete tief durch. »Es geht um eine Patientin von mir, zweiundvierzig Jahre alt und Mutter von fünf Kindern… Mädchen. Ihr Mann ist ein rücksichtsloser Klotz, der…«
»Der sich einen Sohn wünscht«, vollendete Manon voller Bitterkeit. »Du sprichst von Gunilla Heidenrath, nicht wahr?«
Dr. Daniel war sichtlich erstaunt. »Ja. Woher weißt du das?«
»Weil ich die Familie ebenfalls kenne. Und deine Bezeichnung ›rücksichtsloser Klotz‹ ist noch eine starke Untertreibung. In meinen Augen ist dieser Mann kriminell. Es ist schon eine Weile her, da war Frau Heidenrath bei mir in der Praxis. Angeblich ist sie die Treppe hinuntergefallen, aber ich wette mir dir, daß ihr Mann sie in Wirklichkeit verprügelt hatte.«
Dr. Daniel seufzte. Manons Worte waren eigentlich nur noch eine Bestätigung dessen, was er schon seit einer ganzen Weile befürchtet hatte.
»Sie ist wieder schwanger«, erklärte er. »Und sie will das Kind austragen, obwohl sie weiß, daß eine weitere Geburt sie das Leben kosten kann.« Er seufzte wieder. »Ich schaffe es einfach nicht, sie zu einer Abtreibung zu bewegen. Ursprünglich wollte ich ja, daß sie sich sterilisieren läßt, aber das wagt sie natürlich nicht, und mit ihren Mann ist in dieser Hinsicht überhaupt nicht zu reden.« Mit einer fahrigen Handbewegung strich sich Dr. Daniel über die Stirn. »Ich weiß nicht, was ich tun soll, um dieser Frau das Leben zu retten.«
*
Fast vier Wochen lang verlief im Hause Gerlach alles glatt. Während dieser Zeit hatte Rudi zweimal nach Steinhausen fahren dürfen, um die Scheiblers zu besuchen. Darüber hinaus bemühten sich Kurt und Christa, sich mit Schimpfen und Strafen ein wenig zurückzuhalten – wenn auch nur, um zu vermeiden, daß Dr. Scheibler vielleicht doch noch gerichtliche Schritte gegen sie einleiten würde. Immerhin hätte man ihnen das, was sie gelegentlich mit Rudi angestellt hatten, als grobe Kindesvernachlässigung auslegen können.
Allerdings hatte zumindest Christa nach diesen vier Wochen immer größere Schwierigkeiten, sich Rudi gegenüber zusammenzunehmen. Allein durch seine Anwesenheit brachte er sie schon gegen sich auf, und wäre das Geld nicht gewesen, das sie Monat für Monat kassierten, dann hätte sie den Jungen liebend gern von Dr. Scheibler und seiner Frau adoptieren lassen.
Inzwischen hielt der launische April in München Einzug, und an einem außergewöhnlich kalten, regnerischen Tag geriet Rudi mit einem Klassenkameraden in Streit. Es war im Grunde nur eine ganz normale Keilerei, wie sie gelegentlich zwischen zwei Jungen vorkommt, und Rudi war maßlos stolz darüber, daß er als Sieger aus dem Streit hervorgegangen war. Daß seine neuen
Jeans einen langen Riß abbekommen hatten, überdies völlig durchnäßt waren und vor Schmutz starrten, kümmerte ihn nicht weiter. Auch seine Jacke war arg in Mitleidenschaft gezogen worden, und das war dann auch das erste, was Christa sah, als Rudi das Haus betrat.
»Himmel noch mal, wie siehst du denn aus?!«
Ihre Stimme überschlug sich fast. Sie war vollkommen außer sich vor Zorn. Und in dieser Stimmung ging sie auf den armen Rudi los. Eine wahre Schimpfkanonade ergoß sich über den armen Jungen, begleitet von schmerzhaften Knüffen. Aber noch bevor sich Christa vollends abreagieren konnte, ergriff Rudi die Flucht. Er rannte aus dem Haus und lief dann einfach los – hinaus aus München und die Landstraße entlang in Richtung Steinhausen.
Als er den kleinen Vorgebirgsort endlich erreichte, war bereits die Dunkelheit hereingebrochen, und schon vor Stunden hatte es zu regnen begonnen. Rudi war naß bis auf die Haut, und der kalte Wind ließ ihn entsetzlich frieren. Schon längst konnte er nicht mehr laufen, sondern schleppte sich nur noch mühsam Schritt für Schritt weiter. Dann sah er vor sich am Horizont das Haus, in dem Gerrit und Steffi wohnten. Mit klammen Fingern drückte er auf den Klingelknopf neben dem Namen Scheibler, doch nichts rührte sich.
Rudi hatte keine Uhr bei sich, aber er rechnete damit, daß Gerrit jeden Augenblick aus der Klinik kommen müßte, und auch Steffi und Daniela würden sicher bald heimkommen. Es war bestimmt schon gegen acht Uhr. Zitternd vor Kälte ließ sich Rudi neben der Haustür nieder, schlang beide Arme um die Beine und versuchte sich auf diese Weise ein wenig warmzuhalten.
Minuten und Stunden verrannen, doch weder Gerrit noch Steffi kamen nach Hause. Der Wind war inzwischen so schneidend kalt, daß er Rudi Tränen in die Augen trieb. Er versuchte aufzustehen und sich durch Bewegung warmzuhalten, doch die Kälte saß so schmerzhaft in seinen Gliedern, daß er sich kaum noch rühren konnte.
»Gerrit«, murmelte er verzweifelt. »Bitte, Gerrit, komm doch endlich nach Hause.«
*
Es war eine ruhige Nacht, die Dr. Scheibler mit Schwester Irmgard in der Klinik verbrachte. Sie hatten Nachtschicht und wunderten sich ein wenig darüber, daß trotz des unfreundlichen Wetters nicht viel los war. Normalerweise häuften sich gerade bei solch ungünstigen Straßenverhältnissen die Zahl der Unfälle.
»Anscheinend traut sich heute niemand mehr auf die Straße«, meinte Schwester Irmgard lächelnd.
»Sieht so aus«, stimmte Dr. Scheibler zu. »Aber uns soll’s nur recht sein. Ich habe nichts gegen einen ruhigen Nachtdienst, und Sie sicher auch nicht.«
Noch bevor Schwester Irmgard antworten konnte, ertönte die Klingel.
»Schon vorbei mit der Ruhe«, meinte sie seufzend. »Das wird Frau Westphal sein. Die hält mich jetzt mindestens eine halbe Stunde lang in Trab.« Die Nachtschwester erhob sich kopfschüttelnd. »Ständig braucht sie irgend etwas anderes.« Dann lächelte sie dem Oberarzt entschuldigend zu. »Ich weiß, ich dürfte das eigentlich nicht sagen, aber – ich bin heilfroh, wenn sie endlich entlassen wird.«
Dr. Scheibler lächelte. »Von mir wird bestimmt niemand etwas erfahren.«
»Danke, Herr Oberarzt«, meinte Schwester Irmgard, bevor sie sich auf den Weg zu der Patientin machte, die gerade geklingelt hatte. Und dabei dachte sie wieder einmal, wie angenehm es doch war, in der Waldsee-Klinik zu arbeiten. Hier gab es keine arroganten Ärzte, die sich selbst als Halbgötter in Weiß sahen und Krankenschwestern wie Menschen zweiter Klasse behandelten. An ihrer früheren Arbeitsstelle hatte sie da anderes erlebt.
Dr. Scheibler blieb im Schwesternzimmer, bis Irmgard zurückkehrte.
»Alles ruhig«, erklärte er, dann sah er auf die Uhr. »Ich schätze, das wird eine lange Nacht werden. Wenn man vor lauter Arbeit nicht mehr aus den Augen sehen kann, ist es nicht gerade angenehm, aber wenn sich überhaupt nichts rührt…« Er winkte lächelnd ab. »Ich fürchte, uns Ärzten kann man es einfach nicht recht machen, was?«
Schwester Irmgard lächelte, dann meinte sie: »Legen Sie sich doch im Ärztezimmer ein bißchen hin. Ich sage Ihnen schon Bescheid, wenn Sie gebraucht werden.«
»So etwas sollten Sie den Chefarzt aber nicht hören lassen«, grinste Dr. Scheibler. »Schließlich habe ich keinen Schlafdienst.«
Schwester Irmgard zuckte die Schultern. »Dr. Metzler hört es ja auch nicht. Außerdem weiß er ganz genau, was er an Ihnen hat. Sie sind neben ihm der beste Arzt hier an der Klinik. Dr. Daniel einmal ausgenommen. Im übrigen ist es unsinnig, wenn wir alle beide nur untätig herumsitzen. Ruhen Sie sich aus, Herr Oberarzt. Schließlich wollen Sie doch morgen mit Rudi etwas unternehmen.«
Das Schicksal des kleinen Jungen, der bei seinen Verwandten so unglücklich war, hatte sich bereits herumgesprochen, und als Dr. Scheibler ihn einmal kurz mit in die Klinik genommen hatte, waren Rudi gleich sämtliche Herzen entgegengeflogen.
»Ja, ich freue mich schon sehr darauf«, erklärte Dr. Scheibler jetzt, und ein liebevolles Lächeln erschien auf seinen markanten Zügen. »Sein Onkel und seine Tante sind wahrscheinlich ganz froh darüber, daß er das Wochenende bei Steffi und mir verbringen wird. Allerdings scheint es in letzter Zeit bei den Gerlachs etwas besser zu gehen. Immerhin ist Rudi seit vier Wochen nicht mehr davongelaufen.«
»Vielleicht wendet sich ja doch noch alles zum Guten für den Kleinen.«
Dr. Scheibler nickte. »Zu wünschen wäre es ihm.«
*
Der Morgen graute, als Dr. Scheibler von seinem Nachtdienst nach Hause kam. Er hatte Schwester Irmgards Rat beherzigt und sich ein wenig hingelegt, so daß er jetzt wieder verhältnismäßig ausgeruht war. Er würde noch eine Kleinigkeit essen, zwei oder drei Stunden schlafen und sich dann erst mal auf den Weg zu seiner Schwiegermutter machen, um Stefanie und Daniela abzuholen, die den gestrigen Abend und die darauffolgende Nacht dort verbracht hatten. Anschließend würden sie gemeinsam zu den Gerlachs fahren und Rudi für das Wochenende zu sich holen.
Beschwingt stieg Dr. Scheibler aus dem Auto, schloß ab und suchte dann nach dem Hausschlüssel. Im selben Augenblick sah er die kleine zusammengekauerte Gestalt an der Haustür lehnen.
»Rudi!« stieß er erschrocken hervor und war im nächsten Moment bei ihm.
Langsam hob der Junge den Kopf.
»Gerrit.«
Seine Stimme war kaum mehr als ein heiseres Flüstern.
Kurzerhand nahm Dr. Scheibler den Jungen auf die Arme, trug ihn zu seinem Auto und legte ihn auf die Rückbank, um ihn sofort in die Klinik zu bringen. Rudi ließ es widerstandslos geschehen. Anscheinend war er zu keiner Bewegung mehr fähig. Er mußte bereits völlig durchgefroren sein.
Kaum fünf Minuten später erreichte Dr. Scheibler die Waldsee-Klinik und brachte Rudi sofort auf die Station und in ein freies Zimmer. Hier zog er ihm vorsichtig die nasse Kleidung aus und wickelte ihn in eine warme Decke. Erst in diesem Moment fielen Dr. Scheibler die Schrammen im Gesicht und das leicht geschwollene, bläulich verfärbte linke Auge des Jungen auf. Unwillig runzelte er die Stirn. Was war da passiert? Es war offensichtlich, daß Rudi geschlagen worden war, und ebenso klar war für Dr. Scheibler, daß er die ganze Nacht im Freien zugebracht haben mußte.
Ohne lange zu überlegen ging er ins Ärztezimmer, trat ans Telefon und rief bei den Gerlachs an.
Nach mehrmaligem Klingeln meldete sich Kurt mit verschlafener Stimme.
»Scheibler«, gab sich Gerrit knapp zu erkennen. »Rudi ist bei mir.«
»Das haben wir uns schon gedacht«, entgegnete Kurt lakonisch. »Er ist uns am frühen Nachmittag weggelaufen.«
»Nachdem er offensichtlich geschlagen worden war.«
»Aber nicht von uns«, verwahrte sich Kurt. »Rudi hatte eine Prügelei mit einem Klassenkameraden. Er kam völlig verdreckt nach Hause, und Christa muß ein wenig heftig reagiert haben. Jedenfalls stürmte der Junge dann wie ein Wilder davon, und wir gingen davon aus, daß er sich zu Ihnen geflüchtet hat. Da Sie ja sowieso das Wochenende mit ihm verbringen wollten, ließen wir es gleich dabei bewenden.«
»Das sollten Sie beim nächsten Mal lieber nicht tun«, erklärte Dr. Scheibler und hatte Mühe, seinen Zorn zu unterdrücken. Wie verantwortungslos würden die Gerlachs eigentlich noch handeln? »Zum einen ist die Strecke von München nach Steinhausen nicht gerade ein Katzensprung, wenn ein Kind sie zu Fuß bewältigen will. Außerdem wissen Sie ganz genau, daß ich Arzt bin und gelegentlich Nachtdienst habe. Ich bin vor einer Viertelstunde aus der Klinik gekommen und habe Rudi vor der Haustür gefunden – naß bis auf die Haut und entsprechend unterkühlt. In Zukunft, Herr Gerlach, versichern Sie sich bitte, ob meine Frau oder ich zu Hause sind, wenn Rudi wieder einmal vor einer Überreaktion Ihrer Gattin davonläuft. Ansonsten könnte es nämlich passieren, daß ich Sie doch noch wegen Unterlassung der Aufsichtspflicht anzeige.«
»Was erlauben Sie sich!« brauste Kurt auf. »Ich werde…«
Dr. Scheibler hörte gar nicht mehr hin, sondern legte einfach auf, dann kehrte er zu Rudi zurück. Der Junge war inzwischen eingeschlafen, und seine Wangen hatten sich unnatürlich rot verfärbt. Liebevoll streichelte Gerrit über die dichten Locken des Jungen, dann drehte er ihn behutsam auf die Seite, befreite seinen Unterkörper von der Decke und kontrollierte vorsichtig seine Temperatur. Das Ergebnis beunruhigte ihn sehr. Rudi hatte beängstigend hohes Fieber, und Dr. Scheibler ahnte bereits, woran das lag.
Als er Herz und Lunge des Jungen abhörte, bestätigte sich sein Verdacht. Die Lungengeräusche ließen auf eine beginnende Entzündung schließen. In diesem Moment öffnete Rudi langsam die Augen.
»Gerrit«, murmelte er schwach. »Wo warst du denn so lange?«
Dr. Scheibler setzte sich zu ihm ans Bett und streichelte sein heißes Gesichtchen.
»Ich hatte Nachtdienst«, erklärte er. »Rudi, so etwas darfst du nie wieder tun. Wenn du zu mir kommen willst, dann mußt du vorher anrufen und dich vergewissern, daß Steffi oder ich zu Hause sind. Allein auf dem Weg von München bis hierher hätte dir schon allerhand passieren können, und dann auch noch bei diesem Wetter – Rudi, du hättest dir da draußen den Tod holen können.«
»Nicht schimpfen, Gerrit, bitte nicht schimpfen«, flüsterte Rudi, und dabei füllten sich seine Augen mit Tränen.
»Ich schimpfe ja nicht.« Liebevoll streichelte Dr. Scheibler über Rudis Haare. »Ich mache mir doch nur Sorgen um dich.«
»Bin ich denn so krank?«
Dr. Scheibler nickte. »Ja, mein Junge, ich fürchte schon.«
Rudi schob die Decke zurück und legte eine Hand auf seine Brust. »Hier tut’s furchtbar weh, Gerrit.«
»Ich weiß, mein Kleiner.« Er deckte den Jungen wieder zu. »Du mußt für ein paar Tage Penicillin-Spritzen bekommen. Das ist nicht sehr angenehm, aber es muß sein, Rudi. Ich werde auch…«
»Na endlich!«
Kurt Gerlachs Stimme unterbrach Dr. Scheibler.
»Sie hätten mir am Telefon wenigstens mitteilen können, wo Sie den Jungen hingebracht haben«, fuhr er mit vorwurfsvoller Stimme fort. »In mühsamer Kleinarbeit mußte ich das erst noch herausfinden. Ich fürchte, Herr Dr. Scheibler, damit haben Sie Ihre Kompetenzen bei weitem überschritten. Immerhin haben meine Frau und ich noch immer das Sorgerecht für Rudi.«
Dr. Scheibler wußte, daß dieser harte Ton mit seinem nicht gerade diplomatisch geführten Telefongespräch von vorhin zusammenhing. Aber er hatte allen Grund gehabt, entsprechend ungehalten zu reagieren.
»Wie soll ich das verstehen, Herr Gerlach?« fragte er jetzt und schaffte es dabei noch immer nicht, den etwas aggressiven Unterton aus seiner Stimme zu verbannen. »Wollen Sie Rudi vielleicht in diesem Zustand nach Hause holen? Das kann ich als Arzt nicht verantworten.«
»Im Grunde ist es mir völlig gleichgültig, was Sie verantworten können und was nicht«, entgegnete Kurt äußerst arrogant. »Aber soweit ich es sehe, scheint Rudi wohl wirklich ein wenig krank zu sein.« Er bedachte Dr. Scheibler mit einem eisigen Blick. »Eine Behandlung durch Sie lehne ich allerdings entschieden ab. Ich verlange einen Kinderarzt. Über so etwas wird diese Klinik ja wohl verfügen.«
»Was ist hier los?«
Dr. Scheibler atmete unmerklich auf, als hinter ihm so unerwartet Dr. Daniels Stimme erklang. Jetzt wandte er sich um und bedachte Dr. Daniel mit einem eindringlichen Blick.
»Herr Direktor, gut daß Sie hier sind«, erklärte er, und seine Förmlichkeit machte Dr. Daniel sofort stutzig. Normalerweise sprachen sie sich ja beim Vornamen an. »Das ist Herr Gerlach.«
Noch immer begriff Dr. Daniel nicht so ganz, worum es hier eigentlich ging. Sicher war ihm der Name Gerlach ein Begriff; er kannte ja auch den kleinen Rudi. Aber ihm war nicht klar, was Gerrit mit seiner förmlichen Ansprache bezwecken wollte. Trotzdem ging Dr. Daniel vorsichtshalber darauf ein. Er begrüßte Kurt, dann sah er Gerrit an.
»Gibt es irgendwelche Probleme, Herr Dr. Scheibler?« erkundigte er sich.
»Und ob es die gibt«, mischte sich Kurt ein. »Mein Neffe ist krank, und ich verlange einen Kinderarzt.«
Dr. Daniel wandte sich ihm zu. »Ich kann Ihnen versichern, daß Ihr Neffe bei Dr. Scheibler medizinisch in den allerbesten Händen ist.«
»Das ist mir egal«, entgegnete Kurt mit schroffer Stimme. »Ich will den Kontakt zwischen meinem Neffen und diesem Herrn ein für allemal unterbinden, weil ich der Ansicht bin, daß sein Einfluß auf Rudi nur negativ sein kann.« Mit beinahe drohendem Blick sah er Dr. Daniel an. »Wenn Sie nicht umgehend einen Kinderarzt hinzuziehen können, dann lasse ich Rudi in eine andere Klinik bringen.«
»Das wäre unverantwortlich!« brauste Dr. Scheibler auf. »Rudi hat hohes Fieber und…«
Mit einem kurzen, eindringlichen Blick bedeutete Dr. Daniel ihm zu schweigen, dann sah er Kurt wieder an. »Ich werde Dr. Bürgel anrufen. Er arbeitet als niedergelassener Kinderarzt in der Kreisstadt, kümmert sich aber auch um entsprechende Fälle hier in der Waldsee-Klinik.«
Kurt nickte knapp, dann drehte er Dr. Daniel und Dr. Scheibler demonstrativ den Rücken zu.
»Keine Sorge, mein Junge«, erklärte er und bemühte sich wegen der anwesenden Ärzte um einen besonders sanften Ton. »Gleich wird der Doktor hier sein.«
»Ich möchte, daß Gerrit…«, begann Rudi bittend.
»Sei ruhig!« zischte Kurt wütend, wodurch er seine wahren Gefühle wider Willen verriet. Gleichzeitig gab er dem Jungen einen schmerzhaften Klaps auf den Mund.
Aufgebracht wollte Dr. Scheibler dazwischengehen, doch Dr. Daniel hielt ihn zurück, drängte ihn aus dem Zimmer und schloß die Tür.
»Ich lasse nicht zu, daß er Rudi schlägt«, brauste Dr. Scheibler auf.
»Gerrit, beruhigen Sie sich«, bat Dr. Daniel in besänftigendem Ton.
»Ich kann nicht! Wenn ich sehe, wie…«
»Gerrit! Es hat doch keinen Sinn, wenn Sie hier einen Aufstand machen! Damit nützen Sie Rudi nicht – ganz im Gegenteil. Wenn Sie Herrn Gerlach noch mehr zusetzen, macht er seine Drohung womöglich wahr und läßt den Jungen in eine andere Klinik bringen. Wollen Sie das?«
Dr. Scheibler senkte den Kopf. »Nein, natürlich nicht.«
»Na also.« Dr. Daniel legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Ich weiß genau, was Ihnen so weh tut, und ich bin ebenfalls ein strikter Gegner von jeglichen Prügelstrafen für Kinder. Ein Klaps auf den Mund ist nicht schön, aber wenn Herr Gerlach so etwas als Erziehungsmittel einsetzt, reicht das leider noch nicht aus, um etwas dagegen zu tun.« Er schwieg einen Moment. »Wie kam es überhaupt zu einer solchen Situation? Immerhin waren Sie und die Gerlachs sich doch darin einig, daß Rudi zu Ihnen kommen kann. Warum will er plötzlich jeglichen Kontakt verbieten?«
Dr. Scheibler seufzte, dann schilderte er Dr. Daniel in groben Zügen, was geschehen war.
»Ich war so wütend, deshalb habe ich am Telefon wohl nicht ganz den richtigen Ton angeschlagen«, schloß er zerknirscht.
»Na ja, daran kann man nun nichts mehr ändern«, meinte Dr. Daniel. »Vielleicht entschärft sich die Lage ja wieder, wenn Rudi erst gesund ist. Ich werde jetzt jedenfalls Dr. Bürgel anrufen.«
»Kann man Rudi diesen Grobian denn nicht ersparen?« fragte Dr. Scheibler verzweifelt. »Wolfgang könnte sich doch als Kinderarzt ausgeben…«
»Darauf erwarten Sie hoffentlich keine Antwort von mir«, fiel Dr. Daniel ihm ins Wort. »Sie wissen ganz genau, daß so etwas nicht möglich ist. Im übrigen mag Dr. Bürgel zwar nicht gerade der sympathischte Mensch in der Umgebung sein, als Kinderarzt aber ist er erstklassig.«
»Er ist grob und unsensibel«, hielt Dr. Scheibler dagegen. »Die meisten Kinder weinen doch schon, wenn sie nur in seinem Wartezimmer sitzen.«
»Daran können wir nichts ändern«, meinte Dr. Daniel. »Dr. Bürgel ist nun mal der einzige Kinderarzt hier in der Nähe.«
»Nicht mehr lange«, mischte sich da Dr. Metzler ein, der die letzten Worte noch gehört hatte. »Ich habe nämlich erfahren, daß sich in Steinhausen demnächst ein Kinderarzt niederlassen wird. Und dabei haben wir auch noch großes Glück.« Er sah Dr. Daniel an. »Dr. Markus Leitner. Sagt dir der Name etwas?«
»Und ob!« bekräftigte Dr. Daniel sofort. »Seine Doktorarbeit wurde im letzten Jahr veröffentlicht. Sämtliche Kinderkliniken haben sich förmlich um ihn gerissen.«
Dr. Metzler nickte eifrig. »Richtig, aber er will in seine Heimat zurückkehren. Markus kam am gleichen Tag zur Welt wie ich – nur zwei Stunden später. Wir waren zusammen im Kindergarten und auch in der Schule. Erst als seine Eltern sich scheiden ließen und er mit seiner Mutter nach Hannover gezogen ist, haben wir uns aus den Augen verloren. Aber ich freue mich riesig, daß er bald wieder hier sein wird.«
»Das nützt uns im Augenblick nur leider auch nicht viel weiter«, wandte Dr. Scheibler bedrückt ein. »Diesen guten Kinderarzt bräuchten wir jetzt sofort und nicht erst in ein paar Wochen.«
»Irrtum, Gerrit«, entgegnete Dr. Metzler. »Markus wird schon ab Montag in Steinhausen praktizieren.«
»Wenigstens etwas«, murmelte Dr. Scheibler.
Dr. Daniel nickte. »Aber trotzdem müssen wir jetzt zunächst noch auf Dr. Bürgel zurückgreifen. Rudi hat schließlich eine möglicherweise massive Lungenentzündung. Da können wir mit der Behandlung nicht bis Montag warten.«
Der Kinderarzt sagte dann auch zu, sofort in die Klinik zu kommen, denn schließlich wußte er ebenfalls, daß man bei Lungenentzündung nicht lange zögern durfte. Eine knappe Viertelstunde später betrat er Rudis Zimmer. Die stattliche Größe des Arztes und sein herrisches Auftreten erschreckten den Jungen, und nur die Tatsache, daß Dr. Scheibler wartend in der halboffenen Tür stand, vermochte Rudi ein wenig zu beruhigen.
Bittend streckte er eine Hand aus. »Gerrit.«
»Hör jetzt endlich auf damit«, fuhr Kurt ihn an. »Oder willst du noch eins auf den Mund haben?«
»So, dann wollen wir mal«, erklärte Dr. Bürgel. »Mach deinen Mund auf und streck’ die Zunge heraus.«
Anstandslos ließ sich Rudi in den Mund schauen, und auch das Abhören von Herz und Lunge ging reibungslos über die Bühne. Erst beim Fiebermessen zuckte Rudi erschrocken zusammen.
»Na, na, hab’ dich nicht so«, knurrte Dr. Bürgel. »Wird ja wohl nicht das erste Mal sein, daß jemand deine Temperatur kontrolliert.«
»Halten Sie es denn nicht für nötig, Ihrem Patienten wenigstens zu sagen, was Sie als nächstes tun werden?« mischte sich Dr. Scheibler ein, den es äußerste Beherrschung kostete, hier nicht einzugreifen. »Ein kaltes Thermometer in dieser unsensiblen Art und Weise eingeführt zu bekommen, hätte sogar einen Erwachsenen erschreckt.«
»Meine Güte!« brauste Dr. Bürgel auf. »Da müßte ich mir ja Tag für Tag in meiner Praxis den Mund fusselig reden! Wenn der Junge das Thermometer spürt, dann weiß er, daß Fieber gemessen wird. Wozu also noch groß drumherum reden?«
Jetzt kontrollierte er die Temperatur, dann wandte er sich Kurt zu. »Ich werde sofort eine Behandlung mit Penicillin einleiten. Der Junge bekommt jetzt eine Spritze und abends vor dem Einschlafen noch einmal. Ab morgen dann zehn Tage lang jeweils eine Injektion.«
»Werden Sie die Behandlung persönlich durchführen?« wollte Kurt mit einem Seitenblick auf Dr. Scheibler wissen.
Dr. Bürgel schüttelte den Kopf. »Tut mir leid, ich habe auch noch eine Praxis, und es steht für mich in keinem Verhältnis, wegen einer Penicillinspritze extra von der Kreisstadt bis hierher zu fahren. Das Klinikpersonal kann die Behandlung ebensogut durchführen.« Er nahm von der Stationsschwester die vorbereitete Spritze entgegen und zog die Schutzhülle von der Nadel, dann desinfizierte er die Einstichstelle, aber auch diesmal hielt er es nicht für nötig, Rudi in irgendeiner Weise darauf vorzubereiten.
»Au«, wimmerte der Junge, weil die ölige Konsistenz des Medikaments in seinem Muskel ein krampfartiges Gefühl verursachte. »Gerrit! Au, das tut weh!«
»Sei nicht so wehleidig«, fuhr Kurt ihn an und verpaßte ihm erneut einen Klaps auf den Mund.
Dr. Scheibler ballte die Fäuste, dann verließ er rasch den Raum. Er wußte, wenn er nur noch eine Minute länger bleiben würde, würde er die Beherrschung verlieren. Doch damit könnte er Rudi und sich selbst nur schaden.
Er hörte, wie Dr. Bürgel den Chefarzt über die Behandlung bei Rudi informierte, dann sah er Kurt Gerlach mit dem Kinderarzt weggehen. Rasch kehrte er zum Krankenzimmer zurück, setzte sich auf die Bettkante und streichelte liebevoll über Rudis blonden Wuschelkopf.
Langsam hob der Junge sein tränenüberströmtes Gesichtchen.
»Gerrit«, schluchzte er. »Dieser Doktor… er hat mir weh getan. Warum hast du mir nicht geholfen?«
Das Herz tat Dr. Scheibler weh bei diesen Worten.
»Weil ich es nicht durfte, Rudi«, antwortete er leise. »Du hast selbst gehört, was dein Onkel gesagt hat. Eigentlich dürfte ich nicht einmal jetzt mit dir sprechen.« Wieder streichelte er über die Haare des Jungen. »Keine Angst, Rudi, dieser Doktor wird nicht mehr zu dir kommen. Das Penicillin bleibt dir damit zwar nicht erspart, aber unser Chefarzt wird sehr viel vorsichtiger damit umgehen.«
»Warum kannst du mir diese Spritze nicht selbst geben, Gerrit? Bei dir hätte ich keine Angst.«
Dr. Scheibler seufzte. »Weil dein Onkel mir verboten hat, dich zu behandeln, und auch wenn es uns beiden nicht gefällt – er ist derjenige, der über dich bestimmen darf.«
»Ich werde davonlaufen«, beschloß Rudi kurzerhand.
»Nein, mein Junge, das wirst du nicht!« entgegnete Dr. Scheibler, und dabei wurde seine Stimme plötzlich sehr streng. »Ich verlasse mich darauf, daß du mir gehorchst. Du bist sehr krank, Rudi…«
»Ich habe gehört, was passiert ist.«
Mit diesen Worten eilte Stefanie Scheibler in diesem Augenblick ins Zimmer und an Rudis Bett, dann ergriff sie seine heiße Hand.
»Wie fühlst du dich, mein Kleiner?«
Tränen kullerten über Rudis Wangen. »Der Doktor hat mir weh getan, und Gerrit… er hat gerade geschimpft…«
»Nein, das habe ich nicht«, widersprach Dr. Scheibler. »Ich habe dir lediglich verboten, noch einmal davonzulaufen, und das aus gutem Grund.« Seine Stimme wurde eindringlich. »Rudi, versteh doch, Steffi und ich wollen dich adoptieren – jetzt mehr denn je. Aber mit deinem ständigen Ausreißen machst du alles nur noch viel schwieriger.«
»Ich halte es aber nicht mehr länger aus«, schluchzte Rudi verzweifelt.
Dr. Scheibler seufzte. »Ich weiß schon, mein Junge. Dabei ist die Situation so verfahren wie nie zuvor, aber das liegt hauptsächlich an mir.« Er sah seine Frau an und schilderte ihr, was alles vorgefallen war.
»Vielleicht sollte ich einmal versuchen, mit den Gerlachs zu sprechen«, schlug sie vor, doch Dr. Scheibler schüttelte nur den Kopf.
»Im Augenblick halte ich das für aussichtslos, Steffi«, meinte er. »Wir können wohl nichts anderes tun, als vorerst abzuwarten. Robert hat vielleicht recht. Wenn Rudi erst gesund ist, könnte sich die Situation wieder entschärfen.«
*
Gunilla Heidenrath bereitete gerade das Mittagessen zu, als sie plötzlich von einem entsetzlichen Schmerz überfallen wurde.
»Helmut«, stieß sie hervor, dabei wußte sie genau, daß ihr Mann nicht zu Hause war. Vor einer Stunde war er weggefahren – und sie hatte keine Ahnung, wohin.
»Mami, was ist denn?« fragte die vierzehnjährige Gitti erschrocken, dann entdeckte sie das Blut, das auf den Boden tropfte. »Du blutest ja! Mami! Du blutest!«
Im selben Moment konnte Gunilla den Schmerz deuten. So war es auch damals gewesen, als sie bei drei Schwangerschaften die Babys verloren hatte. Nur heute schienen ihr die Schmerzen noch unerträglicher zu sein. Trotzdem zwang sie sich dazu, Ruhe in ihre Gedanken zu bringen. Sie durfte jetzt nicht durchdrehen – damit wäre niemandem geholfen.
»Das ist nicht so schlimm, Gitti«, versuchte sie ihre Tochter zu beruhigen. »Du mußt jetzt nur Dr. Daniel anrufen. Die Nummer steht im Telefonregister.«
»Aber, Mami, heute ist doch Samstag«, wandte Gitti ein. »Da ist Dr. Daniel bestimmt nicht in seiner Praxis.«
Wieder arbeitete Gunillas Gehirn fieberhaft, aber noch bevor sie einen Entschluß fassen konnte, klingelte es. Nina, die inzwischen auch schon mitbekommen hatte, daß mit ihrer Mutter etwas nicht in Ordnung war, lief zur Tür, um zu öffnen.
»Hallo! Wer bist du denn?« erklang gleich darauf eine sympathische männliche Stimme.
»Ich heiße Nina Heidenrath«, antwortete das Mädchen sofort.
»Nina«, wiederholte der Mann, und im selben Moment erkannte Gunilla seine Stimme.
»Franz!« rief sie. »Franz! Gott sei Dank!«
Franz Baumgartner lief an Nina vorbei in die Küche, dann erfaßte er die Lage mit einem Blick. Ohne zu zögern nahm er Gunilla auf die Arme, trug sie zu seinem Auto und legte sie vorsichtig auf die Rückbank, dann sah er zu Gitti und Nina, die ihm gefolgt waren, zurück.
»Ich bringe eure Mutter jetzt ins Krankenhaus«, erklärte er hastig. »Danach komme ich wieder her und hole auch euch.«
So schnell es die gewundenen Straßen Steinhausens erlaubten, fuhr Franz zur Waldsee-Klinik, dann sprang er aus dem Auto und betrat im Laufschritt die Eingangshalle. Der erste, der ihm begegnete, war Chefarzt Dr. Metzler.
»Ich brauche Dr. Daniel!« stieß Franz hervor. »Schnell! Die Frau in meinem Auto hat Unterleibsblutungen!«
Dr. Metzler rief zwei Pfleger herbei und ordnete an, daß die Patientin in die Gynäkologie gebracht werden solle, dann rief er persönlich bei Dr. Daniel an, und der Arzt war knapp fünf Minuten später zur Stelle. Als er Franz sah, wußte er sofort Bescheid.
»Mir scheint, Sie haben die seltene Begabung, immer dann bei Frau Heidenrath zu sein, wenn sie in Lebensgefahr gerät und Ihrer Hilfe dringend bedarf«, meinte er, während er in die Gynäkologie eilte.
Franz folgte ihm ein paar Schritte. »Ich muß die Kinder noch holen. Sie sind allein zu Hause.«
Dr. Daniel nickte knapp, dann verschwand er in dem Raum, wo sich Gunilla inzwischen auf der Untersuchungsliege befand. Sie hatte die Beine angezogen und weinte vor Schmerzen.
»Ganz ruhig, Frau Heidenrath«, erklärte Dr. Daniel in der ihm eigenen Art, die bei den Patienten so großes Vertrauen weckte.
»Eine Fehlgeburt«, schluchzte Gunilla. »Herr Doktor, ich verliere mein Baby.«
Dr. Daniel nickte nur, dann begann er sehr vorsichtig mit der Untersuchung. Es war bereits zu spät, um die Fehlgeburt noch aufzuhalten, doch darüber war Dr. Daniel in diesem Fall sogar fast froh. Im Grunde rettete diese Fehlgeburt Gunilla das Leben. Der Blutverlust war allerdings schon wieder bedenklich hoch.
»Brauchst du mich?« fragte Dr. Metzler und sah zur Tür herein.
»Ja, Wolfgang«, antwortete Dr. Daniel rasch. »Wie gut bist du als Anästhesist?«
»Vergiß es«, entgegnete Dr. Metzler nur. »Ich bin kein Allroundtalent. Aber Jeff ist im Haus. Ich hole ihn sofort her.«
Bis Dr. Jeffrey Parker im kleinen Operationssaal der Gynäkologie erschien, hatte Dr. Daniel Gunilla persönlich hinübergebracht.
»Leiten Sie die Narkose ein, Jeff«, ordnete er an. »Ich muß eine Ausschabung vornehmen.«
Es war ein schwieriges Stück Arbeit, denn nicht einmal die Kürettage konnte Gunillas Blutung stoppen. Dr. Daniel mußte der Patientin erneut Ergometrin spritzen und auf Bluttransfusionen zurückgreifen.
»Mein lieber Mann, da haben Sie aber was geleistet«, meinte Dr. Parker anerkennend, als es Dr. Daniel endlich gelungen war, die Blutung zum Stillstand zu bringen. Völlig erschöpft lehnte er an der Wand im Waschraum.
»Das war knapp«, meinte Dr. Daniel, dann stieg Wut in ihm auf. »Und das alles nur, weil ihr Mann um jeden Preis einen Sohn haben will. Er riskiert absichtlich das Leben seiner Frau, nur um sich seinen Wunsch zu erfüllen.«
Fassungslos schüttelte Dr. Parker den Kopf. »Das ist doch regelrecht abartig.«
Dr. Daniel nickte. »Fünf Kinder hat diese Frau schon zur Welt gebracht, und das war eben ihre vierte Fehlgeburt.«
Entsetzt starrte Dr. Parker ihn an. »Neun Schwangerschaften bei einer Risikopatientin? Ja, Himmel, ist dieser Mann denn noch zu retten?«
»Ich fürchte, nein.« Er blickte vor sich hin. »Diesmal muß sie einer Sterilisation zustimmen. Ich will nicht dabei sein, wenn diese Frau stirbt – das wird sie bei der nächsten Schwangerschaft zwangsläufig. Eine zehnte Schwangerschaft wäre ihr Todesurteil.«
*
Nervös ging Franz Baumgartner auf dem Flur hin und her. Er hielt die kleine Helene im Arm, während Kristin auf wackligen Beinchen hinter ihm herlief und Barby sich zwischen Gitti und Nina auf die Bank gedrängt hatte.
»Bisher hatte ich noch nicht die Gelegenheit zu fragen, aber – wer sind Sie eigentlich?« wollte Dr. Daniel jetzt wissen.
Franz fuhr herum. »Geht es Gunilla besser?«
»Den Umständen entsprechend«, antwortete Dr. Daniel. »Sie hat zwar viel Blut verloren, aber ihr Zustand ist nicht lebensbedrohlich.« Er schwieg einen Moment. »Beantworten Sie meine Frage jetzt auch?«
»Selbstverständlich«, entgegnete Franz. »Baumgartner ist mein Name. Gunilla und ich… nun… wir waren einst verlobt. Doch dann tauchte dieser Helmut auf, und sein betörender Charme war natürlich weit interessanter als mein solider Lebenswandel.«
Dr. Daniel deutete den bitteren Unterton in Franz Baumgartners Stimme richtig: Er liebte Gunilla noch immer.
»Normalerweise dürfte ich mit Ihnen nicht darüber sprechen, aber um Frau Heidenraths Leben zu retten, ist mir mittlerweile beinahe jedes Mittel recht«, meinte Dr. Daniel. »Herr Baumgartner, wie groß schätzen Sie Ihren Einfluß auf Frau Heidenrath ein?«
Verständnislos sah Franz ihn an. »Ich weiß es nicht. Wir haben uns vor knapp drei Monaten zum ersten Mal seit Jahren wiedergesehen. Warum fragen Sie mich so etwas?«
Dr. Daniel atmete tief durch. Er war im Begriff seine Schweigepflicht zu verletzen, doch Gunillas Leben stand auf dem Spiel, und das rechtfertigte in seinen Augen diesen Verstoß durchaus.
»Frau Heidenrath hatte gerade eine Fehlgeburt, und es ist mir nur mit Mühe gelungen, ihr Leben zu retten«, erklärte Dr. Daniel. »Eine weitere Schwangerschaft würde ihren sicheren Tod bedeuten…«
»Ich verstehe nicht ganz, weshalb Sie da mit mir sprechen«, fiel Franz ihm ins Wort. »Nicht ich bin mit Gunilla verheiratet, sondern Helmut Heidenrath.«
»Das weiß ich sehr wohl, doch leider ist mit Herrn Heidenrath in diesem Punkt nicht zu reden. Er weiß, welcher Gefahr er seine Frau aussetzt, tortzdem ist er nicht bereit, auf weitere Kinder zu verzichten, weil er um jeden Preis einen Sohn haben will. Bitte, Herr Baumgartner, tun Sie mir den Gefallen, und versuchen Sie Frau Heidenrath davon zu überzeugen, daß sie sich sterilisieren lassen muß.«
Franz schwieg betroffen. Natürlich war ihm klar, daß Dr. Daniel ihm das alles nicht hätte sagen dürfen, doch er sah auch die außergewöhnlich schwierige Situation, in der der Arzt steckte. Und für das Leben seiner Patientin war ihm jetzt offenbar fast jedes Mittel recht.
»Ich werde es versuchen, Herr Doktor«, erklärte Franz. »Aber versprechen kann ich Ihnen nichts.«
*
Schon am ersten Tag war die neueröffnete Praxis des Kinderarztes Dr. Markus Leitner brechend voll, trotzdem nahm er sich eine Stunde Zeit, um seinen ehemaligen Schulfreund Wolfgang Metzler zu besuchen.
»Du wirst übrigens schon ganz dringend erwartet«, erklärte Dr. Metzler, nachdem sie sich eine Weile über private Dinge unterhalten hatten.
»So?« Lächelnd zog Markus die Augenbrauen hoch. »Willst du mich hier in der Klinik etwa auch noch einspannen?«
»Ausgezeichnet kombiniert«, meinte Dr. Metzler. »Wir brauchen dringend einen guten Kinderarzt, der sich unsere Neugeborenen anschaut und etwas umgänglicher ist als der werte Kollege aus der Kreisstadt. Aber das nur ganz nebenbei. Auf der Station liegt ein Achtjähriger mit Lungenentzündung. Penicillin-Behandlung wurde bereits eingeleitet, aber ich wäre dir trotzdem dankbar, wenn du dir den Jungen einmal anschauen würdest.« Er schilderte Rudis schwierige familiäre Situation und fügte dann hinzu: »Sei also bitte ein bißchen nett zu ihm.«
»Ich bin zu meinen kleinen Patienten immer nett«, verwahrte sich Dr. Leitner. »Gerade bei Kindern kann ein barscher, unsensibler Arzt sehr viel zerstören.«
Zusammen mit Dr. Metzler ging er auf die Station, betrat das Krankenzimmer aber allein.
»Hallo, Rudi«, begrüßte er den Jungen lächelnd. »Ich bin der neue Doc. Markus ist mein Name.«
Mißtrauisch sah Rudi ihn an. »Tun Sie mir auch so weh wie der andere Doktor?«
Spontan setzte sich Dr. Leitner zu ihm aufs Bett. »Ich will ganz ehrlich sein, Rudi. Ein bißchen pieksen muß ich dich wohl, und Penicillin-Spritzen sind nun mal leider unangenehm. Aber ich verspreche dir, daß ich dabei so vorsichtig wie möglich sein werde.«
Rudi nickte, doch seine Gedanken waren schon wieder ganz woanders. »Wann darf Gerrit mich besuchen?«
»Ist das dein Freund?«
»Ja, das ist er. Gerrit und Steffi wollen mich adoptieren, aber mein Onkel will mich nicht hergeben, dabei hat er mich gar nicht lieb. Und er hat auch verboten, daß Gerrit zu mir kommt.«
Impulsiv streichelte Dr. Leitner über Rudis blondes Haar. »Aber du hast große Sehnsucht nach Gerrit, nicht wahr?«
Rudi nickte, und dabei füllten sich seine großen blauen Augen mit Tränen.
»Weißt du was, mein Junge? Das nehme ich jetzt einfach auf meine Kappe. Ich werde Gerrit suchen und hierherbringen. Und erst wenn er da ist und deine Hand halten kann, werden wir das mit der Spritze in Angriff nehmen. Dann ist das Penicillin sicher nur noch halb so schlimm für dich.«
Da schlich sich ein Lächeln auf Rudis schmales Gesichtchen. »Du bist nett, Markus.«
»Danke für das Kompliment«, meinte Dr. Leitner und stupste Rudi an der Nase, dann stand er auf und verließ das Zimmer. Während er sich auf dem Flur noch umsah, fiel ihm ein Ehepaar auf, das in eine heftige Diskussion vertieft war.
»Das Geld ist mir mittlerweile schon egal!« zischte die Frau aufgebracht. »Du verdienst genügend, damit wir sorgenfrei leben können! Warum sollen wir uns also weiter mit dem Bengel belasten!«
»Ich habe aber keine Lust, auf das Erbe zu verzichten«, entgegnete der Mann nicht weniger aufgebracht. »Was glaubst du eigentlich, was wir für einen Reibach machen, wenn Rudi erst mal achtzehn
ist.«
»Wenn er achtzehn ist«, spottete die Frau, dann tippte sie sich an die Stirn. »Dann gehört ihm das Vermögen seines Vaters, und wir… wir haben die schönsten Jahre unseres Lebens verpaßt.«
»Wenn ich es geschickt genug anstelle, wird Rudi nie auch nur einen Pfennig von dem Vermögen sehen. Er…«
Dr. Leitner hörte nicht mehr zu. Rasch setzte er seinen Weg fort und betrat das Arztzimmer.
»Entschuldigen Sie«, sprach er den Mann im weißen Kittel an. »Sind Sie Gerrit?«
Erstaunt sah Dr. Scheibler ihn an. »Ja, warum?«
Lächelnd streckte Markus die Hand aus. »Freut mich, Sie kennenzulernen, Herr Kollege. Ich bin Dr. Leitner, der neue Kinderarzt von Steinhausen, und ich komme gerade von Rudi. Er will Sie sehen.«
Dr. Scheibler seufzte. »Das wird nicht möglich sein. Ich darf das Zimmer nicht betreten, und daran halte ich mich nur, weil ich Rudi nicht schaden will.«
»Ich übernehme die Verantwortung«, entgegnete Dr. Leitner. »Außerdem glaube ich, daß ich Ihnen und Rudi helfen kann. Kommen Sie mal mit.« Er wies den Flur entlang. »Sind das da vielleicht Rudis Verwandte, von denen Wolfang mir erzählt hat?«
Dr. Scheibler blickte in die angegebene Richtung, dann nickte er. »Ja, das sind Kurt und Christa Gerlach. Sie sind wohl auf dem Weg zu Rudi. Angeblich lieben sie ihn ja über alles, aber wenn man sieht, wie sie sich ihm gegenüber benehmen…«
»Wenn diese beiden etwas lieben, dann nur das Vermögen, das hinter Rudi steht. Wußten Sie davon etwas?«
Dr. Scheiblers fragendes Gesicht war Antwort genug.
»Ich habe zufällig ein paar Gesprächsfetzen gehört«, meinte Dr. Leitner, dann lächelte er. »Nun ja, ganz zufällig wohl auch nicht. Die beiden glaubten sich allein, und sie sprachen auch so leise, daß ich Mühe hatte, etwas zu verstehen. Aber einiges habe ich eben doch verstanden, und ich bin bereit, dar-über auszusagen.« Er schwieg kurz. »Damit dürfte der Adoption wohl nichts mehr im Wege stehen, denn mit mir als objektivem Zeugen wird es Ihnen sicher nicht allzu schwerfallen, das Vormundschaftsgericht davon zu überzeugen, daß Rudi bei seinen Verwandten vielleicht nicht ganz so gut aufgehoben sein dürfte, wie sie es selbst behaupten.«
*
Gunilla Heidenrath war erstaunt, aber auch sichtlich erfreut, als sie aus der Narkose erwachte und in Franz Baumgartners Gesicht blickte.
»Franz«, murmelte sie müde, doch ein Lächeln schlich sich dabei auf ihre verhärmten Züge.
»Nicht sprechen, Gunilla«, entgegnete er sanft. »Dazu bist du noch viel zu schwach. Du hast viel Blut verloren.«
Gunilla nickte, doch unter den Nachwirkungen der Narkose schlief sie gleich wieder ein. Als sie das nächste Mal erwachte, war Franz noch immer bei ihr und hielt ihre Hand.
»Hast du denn so viel Zeit für mich?« fragte sie mit leiser Stimme.
Franz nickte. »Und wenn ich sie nicht hätte, dann würde ich sie mir eben nehmen.« Zärtlich streichelte er ihr Gesicht. »Du bist verheiratet und hast fünf Kinder, deshalb solltest du für mich eigentlich tabu sein, aber da es sich bei deinem Mann um Helmut handelt, bestehen zumindest in meinen Augen andere Voraussetzungen. Er ist ein Schuft. Und nur aus diesem Grund will ich dir sagen, daß…« Er senkte einen Moment den Kopf, dann sah er Gunilla wieder an. »Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben.«
Mit einem gequälten Seufzen drehte Gunilla den Kopf zur anderen Seite. »Bitte, Franz, mach mir das Herz nicht so schwer. Ich bin gebunden…«
»Helmut verdient eine Frau wie dich überhaupt nicht«, fiel Franz ihr ins Wort. »Er ist bereit, dein Leben zu opfern, nur weil er einen Sohn haben will.« Seine Stimme wurde jetzt eindringlich. »Gunilla, ich flehe dich an – laß das nicht geschehen! Laß nicht zu, daß er dir noch eine Schwangerschaft aufzwingt.« Er schwieg einen Moment. »Heute sitze ich an deinem Krankenbett, aber ich will nicht in ein paar Wochen oder Monaten an deinem Grab stehen.«
»Woher weißt du das alles?«
Franz wich ihrem Blick aus. »Dr. Daniel macht sich große Sorgen um dich, deshalb hat er mich eingeweiht.«
Gunilla schwieg betroffen. Sie kannte Dr. Daniel nun schon seit vielen Jahren und wußte, wie genau er es mit der Schweigepflicht hielt. Daß er Franz gegenüber so offen gewesen war, zeigte ihr mehr als alles andere, in welcher Gefahr sie tatsächlich schwebte.
»Du wärst an dieser Fehlgeburt schon beinahe gestorben«, fuhr Franz fort. »Bitte, Gunilla, tue, was Dr. Daniel dir sagt. Laß dich sterilisieren.«
»Helmut bringt mich um…«
»Er bringt dich auf jeden Fall mit einem weiteren Kind um«, unterbrach Franz sie verzweifelt. »Meine Güte, Gunilla, verstehst du denn nicht? Helmut ist es völlig egal, ob du stirbst oder nicht. Er will einen Sohn, und dafür ist er bereit, jeden Preis zu zahlen.«
Gunilla sah in sein markantes Gesicht und fragte sich nun schon zum wiederholten Male, warum sie sich damals, als sie die Wahl gehabt hatte, für Helmut und nicht für Franz entschieden hatte. Vorhin hatte er gesagt, er würde sie noch immer lieben, und wenn sie ganz ehrlich zu sich selbst war, dann mußte sie sich eingestehen, daß sie für ihn dasselbe fühlte wie er für sie.
»Ich werde mich sterilisieren lassen«, versprach sie, dann griff sie wie hilfesuchend nach seiner Hand. »Aber ich fürchte, danach wirst du mir beistehen müssen. Helmut wird toben… er wird vor lauter Wut so außer sich sein…« Sie stockte, weil sie nicht aussprechen wollte, wozu sie ihren Mann tatsächlich für fähig hielt.
»An mir wird er sich die Zähne ausbeißen«, versicherte ihr Franz.
*
Obwohl Helmut Heidenrath von Dr. Daniel informiert worden war, daß seine Frau wieder einmal im Krankenhaus lag und seine fünf Kinder hier von der Krankenpflegehelferin Darinka versorgt wurden, hielt er es erst nach drei Tagen für nötig, Gunilla zu besuchen.
»Mit dir habe ich mir ja eine schöne Niete eingehandelt«, waren seine ersten Worte, als er Gunillas Zimmer betrat. »Meine Güte, wenn sich andere Frauen auch wegen jeder Kleinigkeit tagelang ins Krankenhaus legen würden…«
»Helmut, ich wäre beinahe gestorben«, brachte Gunilla mühsam hervor, weil sie einfach nicht begreifen konnte, wie kalt ihr Mann in den vergangenen Jahren geworden war. Angefangen hatte es bereits nach Gittis Geburt. Schon damals hatte er ihr nicht verziehen, daß ihr erstes Kind nur ein Mädchen gewesen war, und mit jedem weiteren Mädchen, das sie zur Welt gebracht hatte, war Helmuts Verhalten ihr gegenüber nur noch schlimmer geworden.
»Ich weiß genau, was dieser Dr. Daniel dir wieder eingeimpft hat«, erklärte Helmut mit drohender Stimme. »Aber ich warne dich, Gunilla – wenn du auch nur versuchen solltest, irgend etwas einzunehmen, was eine Schwangerschaft verhindern könnte, dann wirst du mich von einer anderen Seite kennenlernen.«
»Eine weitere Schwangerschaft würde mein Tod sein«, entgegnete Gunilla mit bebender Stimme. »Gleichgültig, ob ich eine Fehlgeburt habe oder ob ich ein gesundes Kind zur Welt bringe – ich würde daran sterben. Willst du dann fünf oder womöglich sechs Kinder allein großziehen?«
In Helmuts Blick lag nichts als eisige Kälte. »Hör zu, Gunilla, wenn du über den Jordan gehst, dann glaubst du doch wohl nicht, daß ich mich mit deinen fünf Gören belasten werde. Wenn du mir einen Jungen schenkst, dann verspreche ich dir, daß ich ihn voller Liebe aufziehen werde – die Mädchen aber wandern in ein Heim. Sollte das sechste Kind wieder ein Mädchen sein…« Er zuckte die Schultern. »Tja, dann werde ich mir wohl eine andere Frau suchen müssen, die mir gibt, was ich will: einen Sohn.«
Gunilla war so entsetzt über diese schrecklichen Worte, daß sie minutenlang kein Wort hervorbrachte.
»Du bist verrückt«, brachte sie endlich hervor.
Helmuts Züge verfinsterten sich. »Wenn wir jetzt zu Hause wären, dann würdest du für diese Bemerkung bestraft werden.« Er beugte sich zu ihr hinunter und sah sie mit seinen kalten, unbarmherzigen Augen an. »Morgen hole ich dich nach Hause, und dann, meine liebe Gunilla, werden wir uns um einen Sohn bemühen, nicht wahr?«
Er nickte ihr mit einem gefühllosen, ja fast grausamen Lächeln zu, bevor er das Zimmer verließ, wo Gunilla entsetzt und verstört zurückblieb. So fand Dr. Daniel sie, als er unmittelbar nach der Sprechstunde in die Klinik kam.
»Frau Heidenrath, um Himmels willen, was ist denn passiert?« fragte er erschrocken.
Da sah Gunilla ihn mit einem Blick an, der einem Hilferuf gleichkam.
»Herr Doktor, ich will, daß Sie mich auf der Stelle sterilisieren«, verlangte sie.
Dr. Daniel ahnte, daß etwas Schreckliches vorgefallen sein mußte, und als er es durch behutsames Nachfragen auch herausbrachte, war er schockiert. Wie konnte ein Mensch nur so kalblütig sein wie Helmut Heidenrath?
»Sie müssen keine Angst haben, Frau Heidenrath«, meinte Dr. Daniel. »Wir werden Sie nach dieser Operation selbstverständlich nicht nach Hause entlassen. Es gibt in der Kreisstadt ein gutes Mütterheim, und ich werde mich sofort darum bemühen, daß Sie dort einen Platz bekommen. Es wäre unverantwortlich, Sie und die Kinder wieder zu Ihrem Mann zu schicken.«
Doch Gunillas Blick blieb trotz dieser deutlichen Worte hoffnungslos. »Er würde es niemals zulassen, daß ich mich scheiden lasse.«
Tröstend ergriff Dr. Daniel ihre Hand. »So weit müssen Sie jetzt noch nicht denken, Frau Heidenrath. Ich will lediglich erreichen, daß Sie vorerst in Sicherheit sind. Vielleicht beruhigt sich Ihr Mann ja wieder und sieht ein, daß wir mit einer Sterilisation das einzig Richtige tun. Immerhin hat er Sie einmal geliebt, ich denke nicht, daß ihm seine Kinder gleichgültig sind. Er hat sich einfach in diesen Gedanken verrannt, aber ich bin sicher, daß er wieder zur Besinnung kommen wird, wenn wir ihn dazu zwingen, ein bißchen Abstand zu gewinnen.«
Gunilla nickte zwar, aber überzeugt war sie offensichtlich nicht.
»Fürs erste sollten wir uns jetzt mal um die Sterilisation kümmern«, fuhr Dr. Daniel fort. »Ich würde sagen, daß wir den Eingriff auf morgen früh ansetzen.«
Wieder nickte Gunilla, dann legte sie voller Dankbarkeit eine Hand auf Dr. Daniels Arm. »Ich bin froh, daß es Sie gibt, Herr Doktor. Ohne Sie… ich fürchte, da wäre ich längst nicht mehr am Leben.«
*
Es war kurz vor neun Uhr morgens, als Helmut Heidenrath die Waldsee-Klinik betrat und sofort das Zimmer seiner Frau aufsuchte. Als er eintrat, stellte er zu seinem Erstaunen fest, daß Gunilla mitsamt ihrem Bett verschwunden war. Unwillig runzelte er die Stirn, dann ging er hinaus und sah sich suchend um, bevor er auf eine Schwester zusteuerte, die gerade den Flur entlangkam. Unglücklicherweise handelte es sich dabei um die OP-Schwester Petra Dölling, und sie war vermutlich die einzige im ganzen Haus, die noch nicht mitbekommen hatte, welche Spannungen zwischen den Heidenraths herrschten. Ihr war der Name nur deshalb ein Begriff, weil heute die Sterilisation durchgeführt werden sollte.
»Ich bin auf der Suche nach meiner Frau«, erklärte Helmut Heidenrath. »Sie sollte eigentlich heute entlassen werden, aber ihr Zimmer ist schon leer.«
»Wie ist der Name Ihrer Frau?« wollte Petra wissen.
»Gunilla Heidenrath.«
Erstaunt sah Petra ihn an. »Ich kann mir nicht vorstellen, daß Dr. Daniel Frau Heidenrath heute entlassen wollte. Sie wurde bereits für den Eingriff vorbereitet.«
»Für den…« Helmut stockte, weil er im selben Augenblick Bescheid wußte. Sein Blick verfinsterte sich so sehr, daß Petra unwillkürlich einen Schritt vor ihm zurückwich.
»Das lasse ich nicht zu!« stieß Helmut wütend hervor, dann verließ er im Laufschritt die Station und wenig später auch die Klinik. Petra atmete auf und unterschätzte die Gefahr, die von ihm ausging, bis er wieder zurückkam – mit einer abgesägten Schrotflinte in der Hand.
Die Sekretärin Martha Bergmeier, die wie immer in ihrem Glas-häuschen mit der Aufschrift Information saß, erschrak zutiefst, als sie den wild entschlossenen Mann in die Gynäkologie hinüberlaufen sah, doch dann reagierte sie sofort und rief im Büro des Chefarztes an.
»Herr Heidenrath ist gerade mit einem Gewehr in die Gynäkologie gegangen«, stieß sie aufgeregt hervor. »Da ist doch heute die Operation bei Frau Heidenrath.«
»Oh, verdammt«, entfuhr es Dr. Metzler. »Woher weiß er das bloß?« Er überlegte kurz. »Rufen Sie die Polizei an. Ich denke zwar, daß man ihn auch anders aufhalten kann, aber wir wollen kein Risiko eingehen.« Dann legte er auf, verließ sein Büro und lief in die Gynäkologie hinüber.
Etwa zur gleichen Zeit drang Helmut Heidenrath gerade mit dem Gewehr im Anschlag in den kleinen Operationssaal ein.
»Aufhören!« schrie er, kaum daß er die Tür aufgerissen hatte. Seine Stimme überschlug sich dabei fast. »Hören Sie sofort auf!«
Erschrocken blickte Dr. Daniel hoch und direkt in die abgesägten Läufe der Schrotflinte hinein.
»Hören Sie sofort auf«, befahl Helmut noch einmal, »sonst jage ich Ihnen diese Ladung ins Gesicht.«
»Herr Heidenrath, machen Sie doch keinen Unsinn«, entgegnete Dr. Daniel und versuchte, trotz dieser extremen Ausnahmesituation ruhig zu bleiben, was ihm aber nicht ganz gelang. Immerhin kannte er Helmut Heidenrath gut genug, um zu wissen, daß seine Drohung ernst gemeint war.
»Ich lasse nicht zu, daß Sie meine Frau verstümmeln«, erklärte Helmut und drückte Dr. Daniel die Läufe der Schrotflinte gegen die Stirn. »Sie soll mir einen Sohn gebären, und wenn es das Letzte ist, was sie jemals tun wird.«
Dr. Daniel fühlte, wie ihm der Schweiß ausbrach. Dieser Mann war weit gefährlicher, als er bisher angenommen hatte. Seine Kaltblütigkeit machte ihn zu einer tödlichen Bedrohung.
»Die Möglichkeit, daß Ihr sechstes Kind ein Junge wäre, ist eher unwahrscheinlich«, erwiderte Dr. Daniel.
»Erzählen Sie mir nichts!« fuhr Helmut ihn an. »Irgendwann muß sie einen Jungen bekommen. Und nun bewegen Sie sich! Machen Sie Gunilla wieder zu oder…« Argwöhnisch schaute er den Arzt an. »Haben Sie da drin womöglich schon herumgefummelt?«
In diesem Moment stürzte Dr. Metzler in den Operationssaal. Helmut fuhr herum und richtete seine Waffe auf ihn.
»Raus!« befahl er. »Und dann schließen Sie die Tür ab. Den nächsten, der hier hereinkommt, schieße ich nieder!«
»Tu, was er sagt, Wolfgang«, meinte Dr. Daniel, als der Chefarzt zögernd stehenblieb.
Kaum war Dr. Metzler wieder draußen, da richtete Helmut sein Gewehr wieder auf Dr. Daniels Gesicht.
»Und jetzt antworten Sie!«
herrschte er ihn an.
Dr. Daniel hielt seinem Blick stand, und dabei war ihm nicht anzumerken, daß er fieberhaft überlegte, wie er sowohl Gunilla als auch den Anästhesisten Dr. Parker, die OP-Schwester und sich selbst befreien könnte.
»Ich habe die Eileiter bereits durchtrennt und verschweißt«, erklärte er dann.
Aus zornfunkelnden Augen starrte Helmut ihn an, und Dr. Daniel bemerkte, wie sein Finger, den er am Abzug hatte, zu zittern be-
gann.
Wenn er jetzt abdrückt, ist alles vorbei, durchfuhr es Dr. Daniel. Auf diese kurze Entfernung ist eine Schrotflinte ebenso gefährlich wie jedes andere Gewehr.
Allerdings wußte Helmut auch, daß er den Arzt noch brauchte.
»Machen Sie es rückgängig«, verlangte er. »Auf der Stelle!«
»Das ist nicht so einfach«, entgegnete Dr. Daniel, um Zeit zu gewinnen.
Wieder drückte Helmut ihm die Läufe der Schrotflinte schmerzhaft gegen die Stirn, dann nahm er sie plötzlich weg, ergriff mit einer Hand den Kittel der OP-Schwester Petra und zog sie zu sich heran, bevor er ihr den abgesägten Lauf ins Genick drückte.
»Machen Sie es rückgängig, oder die Kleine hier muß dran glauben«, erklärte er, und sein Tonfall ließ keinen Zweifel aufkommen, daß er seine Worte ernst meinte.
»In Ordnung, Herr Heidenrath«, meinte Dr. Daniel, um den Mann zumindest vorübergehend ruhigzustellen, dann tat er so, als würde er die Sterilisation rückgängig machen. In Wahrheit überlegte er fieberhaft, wie er zuerst Petra aus der unmittelbaren Gefahr befreien und anschließend Helmut Heidenrath überwältigen könnte, doch das
schien unmöglich zu sein. Im Grunde hatte er nur eine Chance, sie alle heil hier herauszubringen: Er mußte behaupten, daß Gunilla wieder ein Kind zur Welt bringen könnte.
»Der Blutdruck der Patientin fällt«, erklärte der Anästhesist Dr. Jeffrey Parker.
Erstaunt sah Dr. Daniel ihn an. Normalerweise gebrauchte Dr. Parker während einer Operation keine vollständigen Sätze. Da fielen höchstens Bemerkungen wie »Blutdruck fällt«. Dr. Daniels nächster Blick galt dem Monitor, der deutlich anzeigte, daß Gunillas Zustand vollkommen stabil war.
»Wir haben Herzflimmern«, fuhr Dr. Parker fort.
Aufmerksam beobachtete Helmut die beiden Ärzte und versuchte herauszufinden, ob man ihm hier eine Falle stellen wollte.
»Was ist los? Haben Sie einen Fehler gemacht?« herrschte er Dr. Daniel an.
Der Arzt hatte im Augenblick keine Ahnung, worauf Dr. Parker hinauswollte, tat aber instinktiv das Richtige.
»Wir brauchen Schwester Petra«, erklärte er. »Sie muß eine Injektion vorbereiten, damit wir den Zustand Ihrer Frau wieder stabilisieren können.«
Helmut schüttelte den Kopf. »Das kann er auch.« Damit meinte er Dr. Parker.
»Nein, eben nicht«, widersprach Dr. Daniel. »Dr. Parker hat im Augenblick alle Hände voll zu tun, um einen Herzstillstand zu verhindern. Lassen Sie Schwester Petra bitte das Medikament holen, sonst wird Ihre Frau sterben.«
Helmut zögerte. Für seine Begriffe sah alles genauso aus wie zu dem Zeitpunkt, als er den Operationssaal betreten hatte. Der Monitor piepste gleichmäßig.
»Wenn Sie hier irgendeine miese Tour versuchen wollen, dann wird Ihnen das noch leid tun«, prophezeite er, bevor er Petra von sich stieß.
Genau diesen Moment hatte Dr. Parker abgewartet. Noch ehe Helmut seine Waffe wieder auf Dr. Daniels Gesicht richten konnte, war er aufgesprungen. Jetzt machte er eine blitzschnelle Drehung, streckte das rechte Bein und schlug Helmut mit dem Fuß die Waffe aus der Hand. Dabei stieß er einen so markerschütternden Schrei aus, daß Helmut vor Schreck buchstäblich wie gelähmt war. Mit einer erneuten raschen Bewegungsfolge machte Dr. Parker ihn vollständig kampfunfähig und hielt ihn am Boden fest. Natürlich waren die vor der Tür wartenden Polizisten auf den Tumult aufmerksam geworden und stürmten jetzt in den Operationssaal, doch dort gab es für sie kaum noch etwas zu tun. Sie mußten Helmut lediglich Handschellen anlegen und ihn abführen.
»Das war ganze Arbeit«, meinte einer der Beamten anerkennend. »Wir wären Ihnen gern früher zu Hilfe gekommen, aber Dr. Metzler hat uns zurückgehalten. Wir durften nicht riskieren, daß der Kerl hier wie wild herumschießt.«
»Das ist schon in Ordnung«, meinte Dr. Daniel. »Aber würden Sie den Raum jetzt bitte verlassen. Wir haben hier einen Eingriff zu beenden.«
Dr. Parker ließ sich von der OP-Schwester keimfreie Handschuhe überstreifen, dann ging er wieder an seine Arbeit, als hätte er nicht eben gerade eine Meisterleistung in Karate vorgeführt. Auch Dr. Daniel merkte man die ausgestandene Angst kaum an. Nur seine Hände zitterten ein wenig, während er die Wunde schloß.
»Herr Doktor, es war meine Schuld«, flüsterte Schwester Petra plötzlich. Leise und immer wieder stockend erzählte sie, wie Helmut Heidenrath sie auf dem Flur der Station angesprochen hatte. Und dann ließen ihre Nerven sie plötzlich im Stich. Sie begann am ganzen Körper zu zittern und brach in unkontrolliertes, heftiges Schluchzen aus.
»Jeff, bringen Sie Frau Heidenrath in den Aufwachraum«, ordnete Dr. Daniel an, dann legte er fürsorglich einen Arm um Petras Schultern und führte sie hinaus. »Niemanden trifft an dem, was gerade geschehen ist, irgendeine Schuld. Sie kannten Herrn Heidenrath nicht und konnten daher auch nicht vorhersehen, wie schlimm er reagieren würde. Ich will ganz ehrlich sein: Auch ich hätte mit einem so massiven Vorgehen seinerseits nicht gerechnet. Dafür wird er sich allerdings nun verantworten müssen.«
»Es wäre nie passiert, wenn ich…«, schluchzte Petra. Die ausgestandene Angst und ihre eigene Überzeugung, an allem, was passiert ist, die Schuld zu tragen, waren eindeutig zuviel für sie.
Dr. Daniel sorgte dafür, daß sich die OP-Schwester nebenan im Untersuchungsraum hinlegte, dann spritzte er ihr ein starkes Beruhigungsmittel, das sie fast augenblicklich einschlafen ließ.
»Eine solche Situation erlebt man auch nur selten«, meinte Dr. Parker, der jetzt ebenfalls in den Untersuchungsraum trat.
»Glücklicherweise«, ergänzte Dr. Daniel. »Ich muß gestehen, daß ich auch ziemlich fertig bin. Mit dem Lauf einer Schrotflinte an der Stirn operiert es sich nicht ganz so leicht.« Er sah Dr. Parker an, der völlig ruhig wirkte. »Ihnen scheint das alles ja gar nichts ausgemacht zu haben.«
»Täuschen Sie sich nicht. Innerlich bin ich im Moment das reinste Nervenbündel«, gestand der junge Arzt. »Wissen Sie, wenn mein erster Schlag danebengegangen wäre, dann hätte der Kerl einen von uns niedergeschossen.« Er brachte ein schiefes Lächeln zustande. »Ich schätze, ich werde mich jetzt auch zu einem Beruhigungsmittel überreden lassen.«
Da legte Dr. Daniel ihm eine Hand auf die Schulter. »Was Sie da drinnen geleistet haben, Jeff, das war sagenhaft. Meine Tochter hat mir ja schon einmal erzählt, wie gut Sie als Karatekämpfer auftreten, aber das mitzuerleben… ich muß gestehen, Ihr Schrei ist sogar mir durch Mark und Bein gegangen.«
Dr. Parker lächelte. »Das ist bei dieser Art des Kampfsports auch der Sinn der Sache. Allerdings ist es ein gewaltiger Unterschied, ob man einen Wettkampf im Verein durchsteht oder ob der Gegner eine geladene Waffe in der Hand hält.« Er schwieg einen Moment, und Dr. Daniel sah, wie es in seinem Gesicht zu zucken begann. »Sie entschuldigen mich jetzt, Robert, ich muß gehen, denn ich möchte hier vor Ihnen nicht gern die Fassung verlieren.«
»Machen Sie sich darum keine Sorgen, Jeff«, entgegnete Dr. Daniel. »Legen Sie sich im Ärztezimmer hin, dann gebe ich Ihnen auch eine Spritze.«
»Und Sie?« wollte Dr. Parker wissen.
»Ich werde mich ebenfalls zurückziehen«, gab Dr. Daniel zu. »Einen derartigen Überfall habe ich noch nicht erlebt. Was Herr Heidenrath gemacht hat, geht auch an mir nicht spurlos vorüber.«
*
Unmittelbar nach dem Gespräch mit dem neuen Steinhausener Kinderarzt hatte Dr. Scheibler Nachforschungen angestellt, und das Ergebnis bewog ihn, noch am selben Tag nach München zu fahren, um Kurt und Christa Gerlach aufzusuchen.
»Was wollen Sie denn hier?« fragte Kurt unfreundlich.
»Mit Ihnen über Rudis Adoption sprechen«, antwortete Dr. Scheibler ohne Umschweife.
»Ich habe Ihnen schon gesagt…«, begann Kurt, doch Dr. Scheibler fiel ihm sofort ins Wort. »Ich kann Ihnen das, was ich über Sie herausgefunden habe, auch hier vor dem Gartentor sagen, aber an Ihrer Stelle würde ich mir das lieber ganz genau überlegen.«
Kurt zögerte noch einen Moment, dann ließ er Dr. Scheibler eintreten.
»Sie haben jeden Monat einen stattlichen Betrag kassiert, der eigentlich Rudi zugute kommen sollte«, erklärte Dr. Scheibler, kaum daß er im Wohnzimmer Platz genommen hatte. In seinen Augen war es unsinnig, noch lange um den heißen Brei herumzureden. »Daß das nicht geschehen ist, wissen Sie wohl besser als ich.«
Christa und Kurt erröteten zutiefst – eine deutlichere Antwort hätten sie gar nicht geben können.
»Ich könnte mit dem, was ich weiß, auch vor Gericht gehen«, fuhr Dr. Scheibler fort, »aber ich denke, wir können uns auch so einigen. Rudi soll endlich ein Zuhause bekommen, das diesen Namen verdient, und ich gehe davon aus, daß Sie meiner Frau und mir keine Schwierigkeiten mehr machen werden, wenn wir die Adoption beantragen.«
Kurt und Christa wechselten einen kurzen Blick.
»Nein, Herr Dr. Scheibler, ich denke nicht«, murmelte Kurt. »Im Grunde wollten wir ja nie ein Kind.«
Dr. Scheibler nickte. »Rudi kann in ein paar Tagen aus der Klinik entlassen werden. Ich werde ihn dann gleich zu mir nehmen.«
»Und das Geld?« entfuhr es Christa.
»Darauf verzichte ich«, antwortete Dr. Scheibler, aber noch bevor sich auf Christas Zügen ein erfreutes Lächeln ausbreiten konnte, fügte er hinzu: »Ich werde dieses Geld für Rudi anlegen. Wenn er achtzehn ist…«
»Dann ist er doch sowieso steinreich!« fiel Christa ihm mit schriller Stimme ins Wort. »Was wir bekommen haben, waren doch nur die Zinsen seines Vermögens!«
»Spielt das vielleicht eine Rolle?« fragte Dr. Scheibler zurück, dann stand er auf. »Mir ist es vollkommen egal, wie reich Rudi einmal sein wird. Wichtig ist für mich allein, daß er ab jetzt eine glückliche Kindheit haben wird, denn das zählt sehr viel mehr als alles Geld der Welt.«
Damit verließ er das Haus der Gerlachs und kehrte nach Steinhausen zurück. Als er Rudis Krankenzimmer in der Waldsee-Klinik betrat, huschte ein seliges Strahlen über das schmale Kindergesicht.
»Gerrit!«
Liebevoll nahm Dr. Scheibler den Jungen in die Arme.
»Jetzt wird alles gut, Rudi«, versprach er leise. »Bald bist du gesund, und dann darfst du nach Hause kommen.«
»Nach Hause?« wiederholte Rudi gedehnt und sah dabei gar nicht so glücklich aus.
Dr. Scheibler nickte lächelnd. »Ja, Rudi, zu Steffi und mir. Mit Hilfe von Dr. Leitner habe ich es endlich durchgesetzt, daß wir dich adoptieren dürfen.«
Da ging in Rudis Gesicht die Sonne auf. »Dann habe ich ja endlich wieder Eltern! Und Dani ist meine kleine Schwester. Ich habe mir immer eine kleine Schwester gewünscht.«
Erneut nahm Dr. Scheibler den Jungen in den Arm. »Wir vier werden jetzt eine glückliche kleine Familie sein. Und wer weiß? Vielleicht bekommst du irgendwann sogar noch ein paar Geschwisterchen mehr.«
»Wir sind bereits dabei, uns zu vergrößern«, erklärte Stefanie, die von Gerrit und Rudi unbemerkt das Zimmer betreten und die letzten Worte gehört hatte. »Ich komme gerade von Dr. Daniel.« Dabei strahlte ihr Gesicht vor lauter Glück. »Die Gespräche, vor allem aber die große Aufregung um Rudi haben anscheinend bewirkt, daß ich mich nicht mehr so verbissen wie zuvor um ein Baby bemüht habe. Und jetzt hat es geklappt. Ich bin tatsächlich schwanger.«
Freudestrahlend wirbelte Dr. Scheibler seine junge Frau herum, dann lächelte er sie und Rudi an. »Ich glaube, ich muß meine Worte von vorhin korrigieren. Wir werden keine kleine, sondern eine große, glückliche Familie sein.«
*
Als Gunilla Heidenrath erfuhr, was ihr Mann sich im OP gleistet hatte, blieb sie erstaunlich ruhig.
»Dafür muß er doch ins Gefängnis, nicht wahr?« fragte sie leise.
Dr. Daniel nickte. »Ich nehme es an, und vermutlich wird das noch nicht alles sein. Ich gehe davon aus, daß er sich auch in psychiatrische Behandlung begeben muß.«
Traurig senkte Gunilla den Kopf. »Vor der Operation war ich fest entschlossen, ihn zu verlassen, aber jetzt… er wird meinen Beistand brauchen, oder?«
Dr. Daniel atmete tief durch. »Ich bin nicht ganz sicher, ob für Sie nach allem, was geschehen ist, noch eine Verpflichtung besteht, Ihrem Mann beizustehen. Allerdings kann das nicht ich entscheiden.« Er schwieg kurz. »Lassen Sie sich Zeit, Frau Heidenrath, und denken Sie gründlich über alles nach. Sie müssen sich darüber klarwerden, wieviel von Ihren Gefühlen er durch sein kaltblütiges Handeln zerstört hat.«
»Alles«, antwortete Gunilla ohne zu zögern. »Es ist nicht allein das, was er im Operationssaal getan hat, sondern auch das, was er vorher zu mir gesagt hat. Er hätte meinen Tod billigend in Kauf genommen. Ich selbst und meine Töchter sind ihm völlig gleichgültig gewesen.«
»Sie werden also die Scheidung einreichen«, vermutete Dr. Daniel.
Gunilla nickte. »Irgendwie werde ich die Kinder und mich schon durchbringen. Von Helmut will ich jedenfalls kein Geld. Er hat die Mädchen niemals geliebt.«
Impulsiv streichelte Dr. Daniel über ihren Arm. »Ich glaube, über Ihre Zukunft müssen Sie sich keine allzu großen Sorgen machen, Frau Heidenrath.« Er lächelte. »Ich nehme an, Sie werden eine starke Hilfe an Ihrer Seite haben.«
Verständnislos sah Gunilla ihn an, doch Dr. Daniel war nicht bereit, sein Geheimnis mit Worten zu lüften. Statt dessen öffnete er die Tür des Krankenzimmers und ließ jemanden eintreten, der dort draußen offenbar schon sehnsüchtig gewartet hatte.
»Franz«, flüsterte Gunilla gerührt. »Du bist hier?«
Er nickte lächelnd. »Aber nicht nur ich.«
Im nächsten Moment stürzten Gitti, Nina und Barby ins Zimmer, umarmten und küßten ihre Mutter, während die Krankenpflegehelferin mit der kleinen Helene auf dem Arm und der einjährigen Kristin an der Hand hereinkam.
Mit geübtem Griff nahm Franz das Baby an sich und hob mit am anderen Arm Kristin auf das Bett ihrer Mutter.
»Stell dir vor, Mami, wir haben in der vergangenen Woche bei Onkel Franz gewohnt«, sprudelte es aus Gitti heraus. »Du, der hat ein ganz tolles Haus und einen riesigen Garten.«
»Ja, und einen Hund!« fügte Nina voller Begeisterung hinzu. »Bello heißt er, und er ist sooo süß. Mich mag er am liebsten.«
»Gar nicht wahr!« widersprach Gitti heftig, und während die Mädchen heiß darüber diskutierten, wen Bello wohl am liebsten mochte, lächelten sich Gunilla und Franz über ihre Köpfe hinweg an.
»Für dich ist auch noch ein Zimmer frei«, meinte er.
Gunilla nickte. »Das Angebot nehme ich gern an, Franz.« Sie streckte eine Hand aus, und Franz ergriff sie. Dabei fielen ihr Dr. Daniels Worte wieder ein. »Ich nehme an, Sie werden eine starke Hilfe an Ihrer Seite haben.«
Gunilla sah in Franz’ sanfte graue Augen und wußte, daß Dr. Daniel recht hatte – sogar viel mehr als das. Franz würde ihr nicht nur eine starke Hilfe sein, er würde ab jetzt der Fels in der Brandung sein, auf den sie sich blind verlassen konnte…
– E N D E –