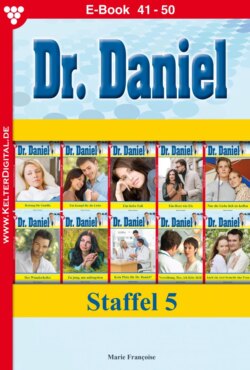Читать книгу Dr. Daniel Staffel 5 – Arztroman - Marie-Francoise - Страница 7
Оглавление»Du willst was?« fragte Manfred Klein und starrte seine Freundin dabei völlig entgeistert an.
Ines Holbe blieb kühl.
»Ich gehe für ein halbes Jahr nach Japan«, wiederholte sie gelassen. »Oder glaubst du vielleicht, ich hätte in den vergangenen Jahren diese Sprache nur zum Spaß gebüffelt?«
Fassungslos schüttelte Manfred den Kopf. »Damit setzt du alles aufs Spiel, was zwischen uns war und noch immer ist.«
Ines seufzte. Genau mit diesem Argument hatte sie schon gerechnet, dabei war ihre Beziehung zu Manfred in den vergangenen Wochen ziemlich abgekühlt, und diese Tatsache hatte für sie schließlich den Ausschlag gegeben, das Angebot aus Japan anzunehmen.
»Hör mal, Manfred, ich will ja deswegen nicht gleich auswandern«, entgegnete sie in besänftigendem Ton. »Es ist nur ein halbes Jahr, und diese Zeit könnte doch uns beiden guttun. Vielleicht würde uns ein bißchen Abstand helfen, wieder zu dem zu finden, was wir einmal gehabt haben.«
Manfred betrachtete seine außerordentlich attraktive Freundin und hatte plötzlich den unbändigen Wunsch, durch ihr dichtes, dunkles Haar zu streicheln und ihren sanft geschwungenen, sinnlichen Mund zu küssen. In letzter Sekunde beherrschte er sich aber, weil er genau wußte, daß jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für solche Zärtlichkeiten war. Ines hätte das vermutlich gar nicht gewollt – ganz im Gegenteil. Sie war ja gerade im Begriff, eine ziemlich große Entfernung zwischen sich und Manfred zu legen.
»Du glaubst also, daß wir Abstand voneinander brauchen«, murmelte Manfred niedergeschlagen. »Warum machst du dann eigentlich nicht gleich Schluß? Im Endeffekt zielt es doch sowieso darauf hinaus.«
»Nein, Manfred, absolut nicht«, entgegnete Ines in etwas aggressiverem Ton. Diese Diskussion begann allmählich, ihr auf die Nerven zu gehen. »Ich arbeite an meiner Karriere als Dolmetscherin, das mußt du akzeptieren, wenn du behauptest, mich zu lieben. Schließlich habe ich dir auch keine Steine in den Weg gelegt, als du dich entschlossen hast, die Fortbildungsseminare zu besuchen.«
»Das ist ja wohl ein kleiner Unterschied«, begehrte Manfred auf. »Immerhin fahre ich für meine Seminare nur nach München. Du aber willst gleich bis nach Japan. Und nicht nur für ein paar Wochen, sondern ein halbes Jahr lang.«
Ines wurde jetzt wirklich wütend. »Du redest Unsinn! Wie soll ich denn in ein paar Wochen meine Sprachkenntnisse verbessern. Ein halbes Jahr ist doch das mindeste!« Sie zwang sich zu einem ruhigeren Ton. »Bitte, Manfred, stell dich doch nicht so an. Hast du noch nie gehört, daß eine Trennung auch ein neuer Anfang sein kann?«
Mißmutig winkte Manfred ab. »Ein neuer Anfang! Daß ich nicht lache! Für dich vielleicht. Schließlich wirst du ja neue Eindrücke gewinnen und andere Menschen kennenlernen. Vielleicht sogar die große Liebe.« Die letzten Worte hatten ziemlich sarkastisch geklungen.
Ines reckte sich hoch. »Du redest jetzt wirklich Unsinn, Manfred. Ich gehe nicht nach Japan, um mich zu verlieben. Ich will meine Sprachkenntnisse verbessern – sonst nichts.« Wieder zwang sie sich zu einem sanfteren Ton, denn sie wollte Manfred ja nicht ganz verlieren – wenn er ihr im Moment auch ziemlich auf die Nerven ging. Aber sie hatten eben auch eine schöne Zeit gehabt. »Wenn ich zurückkomme, dann können wir vielleicht ganz von vorn beginnen.«
»Ja, vielleicht«, stimmte Manfred zu, doch seiner Stimme war anzuhören, daß er nicht mehr daran glaubte.
*
Es war für Ines nicht ganz einfach, sich an die Lebensverhältnisse und die Mentalität ihrer japanischen Gastfamilie zu gewöhnen. Alles war hier so anders als zu Hause, und
Ines gestand sich ein, daß sie niemals so hätte leben wollen wie Fujiko Nakashida. Sie lebte nur für ihren Haushalt und ihre Kinder, pflegte ihre kranke Schwiegermutter und sorgte für die Uroma, deren Alter sich in astronomischen Höhen bewegen mußte. Noch nie im Leben hatte Ines eine so alte Frau gesehen, und sie erstarrte beinahe vor Ehrfurcht, wenn sie von der Greisin angesprochen wurde.
Den Herrn des Hauses, Hiraga Nakashida, hatte Ines in den Wochen, seit sie hier lebte, nur ein- oder zweimal gesehen. Für ihn
schien es hauptsächlich die Firma in Kyoto zu geben, in der er seit vielen Jahren arbeitete.
»Morgen hast du deinen freien Tag«, erklärte Katsumata, der älteste Sohn der Nakashidas, und bemühte sich dabei, langsam und deutlich zu sprechen. »Ich würde dir gern ein bißchen was von Kyoto zeigen.«
Ines lächelte. »Das Angebot nehme ich natürlich an. Kyoto ist eine faszinierende Stadt.«
Davon war sie nach dem Tag, den sie mit Katsumata verbrachte, wirklich überzeugt. Er zeigte ihr den kaiserlichen Palast, führte sie zum Kamo, wo sich das Nachtleben abspielte, und fuhr mit ihr schließlich in den Nordwesten Kyotos nach Kitayama, wo sich die schönsten Zen-Tempelbauten der Stadt befanden.
Besonders beeindruckt war Ines vom Ryoanji mit seinem Steingarten und dem Goldenen Pavillon.
»Im 14. Jahrhundert war das die Sommerresidenz eines Ashikaga-Shoguns«, erklärte Katsumata. »Allerdings ist das jetzige Gebäude nur eine exakte Nachbildung des Originals, das durch den Brand von 1955 zerstört worden ist.«
Bewundernd sah Ines ihn an. »Was du alles weißt.«
Katsumata lächelte. »Du bist gut. Das hier ist schließlich meine Heimat.«
»Weißt du auch, weshalb ganz Kyoto nach diesem eigenartigen Gittermuster aufgebaut ist?«
Diese Frage hatte Ines auch Fujiko einmal gestellt, ihre Antwort jedoch nicht richtig verstanden, weil die Hausherrin in einem Dialekt sprach, mit dem Ines selbst jetzt noch nicht richtig zurechtkam.
»Du kennst die Tatami-Matten, die in unserem Haus am Boden liegen«, erklärte Katsumata. »Eine solche Matte ist etwa ein mal zwei Meter groß, und mit dieser Größe ist der Grundriß Kyotos eng verknüpft.«
»Wie bitte?« Ines schüttelte den Kopf. »Das verstehe ich nicht.«
»Die Maße eines jeden Hauses werden nach der Zahl der Tatami-Matten, die darin liegen, genommen. Dadurch wird die Länge und Breite jedes Raumes und somit schließlich der gesamten Wohnung festgelegt. Unser Haus beispielsweise ist acht Meter breit und vierzig Meter lang. Fünf dieser Häuser bilden ein goningumi, und zu einem cho gehören vierzig Häuser. Auf diese Weise können die Maße eines ganzen Bezirks, sogar der gesamten Stadt bis zur Größe einer einzigen Tatami-Matte zurückverfolgt werden.«
»Meine Güte«, stöhnte Ines, dann schüttelte sie wieder den Kopf. »Tut mir leid, Katsumata, aber das ist mir denn doch zu hoch.«
Der junge Mann lachte. »Du solltest dein bezauberndes Köpfchen auch gar nicht so anstrengen.«
Mit kokettem Augenaufschlag sah Ines zu ihm auf. Sie hatte schon ein paarmal gemerkt, daß Katsumata ihr sehr zugetan war, und sie hatte gegen einen kleinen Flirt auch nichts einzuwenden. Katsumata war ein äußerst gutaussehender junger Mann, und der Umstand, daß er Asiate war, reizte Ines ganz besonders. Es dauerte nicht lange, bis sich zwischen Ines und Katsumata eine heimliche Beziehung anbahnte. Heimlich deswegen, weil die Naka-shidas natürlich nichts davon erfahren sollten.
Gerade das wurde mit der Zeit aber immer schwieriger, vor allem weil sich Katsumatas Verhältnis zu Ines allmählich änderte. Die Blicke, die er ihr zuwarf, waren nun zu begehrlich, als daß sie seiner Mutter hätten entgehen können. Und schließlich bat Hiraga Ines zu einem Gespräch unter vier Augen.
»Ines, ich möchte, daß du dir eine andere Unterkunft suchst«, erklärte er ohne Umschweife.
Die junge Frau war völlig perplex. »Ich verstehe nicht…«
»Doch, ich glaube, du verstehst sehr gut«, fiel Hiraga ihr ins Wort. Unter normalen Umständen hätte er einen Gast niemals unterbrochen, denn dazu war er viel zu höf-ich.
»Es ist… weil Katsumata und ich…«, begann Ines, dann stand sie auf. »Ich werde Ihr Haus verlassen, Herr Nakashida, aber ich weiß nicht, ob sich Katsumata davon abhalten lassen wird, sich weiterhin mit mir zu treffen.«
Auch Hiraga erhob sich. »Er wird seinem Vater gehorchen, verlaß dich darauf.« Mit kurzen, energischen Schritten ging er zu der strenggegliederten Papierschiebetür, doch bevor er sie öffnete, drehte er sich noch einmal zu Ines um. »Du hast eine Woche Zeit, um dir eine andere Unterkunft zu suchen.«
Ines nickte. »Danke, Herr Naka-shida.«
Er bedachte sie mit einem letzten Blick, dann verließ er den Raum und kurz darauf auch das Haus. Wie betäubt blieb Ines zurück. Sie hatte zwar schon gehört, daß eine Beziehung, wie sie sie mit Katsumata eingegangen war, in diesem Land einem groben Mißbrauch der Gastfreundschaft gleichkam, allerdings hatte sie gedacht, daß japanische Familien inzwischen etwas moderner eingestellt wären. Doch das war zumindest bei den Nakashidas offensichtlich nicht der Fall.
»Mein Vater hat mir verboten, dich zu sehen.«
Ines fuhr erschrocken herum, als hinter ihr so unerwartet Katsumatas Stimme erklang.
»Ist das, was wir getan haben, denn so schlimm?« wollte sie wissen. »Meine Güte, Katsumata, wir sind doch jung. Was ist dabei, wenn man ein bißchen Spaß zusammen hat?«
Katsumata schüttelte den Kopf. »Die Liebe ist niemals nur ein Spaß, Ines – für uns jedenfalls nicht. Wenn ich dich nach unserem ersten gemeinsamen Ausflug damals nach Kyoto meinem Vater offiziell als meine Braut vorgestellt hätte, dann wäre alles in Ordnung gewesen.«
Völlig fassungslos starrte Ines den jungen Mann vor sich an. »Als deine Braut?«
Katsumata nickte. »Mein Vater ist noch sehr konservativ eingestellt. Eine Beziehung zwischen Mann und Frau ohne die Absicht zu heiraten, das ist für ihn das Verwerflichste, was es gibt. Du mußt aus diesem Grund das Haus verlassen, und ich…« Er senkte den Kopf. »Ich wurde schwer bestraft.«
Ines hatte das Gefühl, in der Zeit um Jahrzehnte zurückversetzt worden zu sein. Konnte es eine solche Einstellung denn heute überhaupt noch geben?
»Heißt das, ich war dein erstes Mädchen?« wollte Ines wissen.
»Nein, natürlich nicht. Ich war ziemlich oft im Pontocho. Das ist eines der Haupt-Geisha-Viertel Kyotos«, fügte er erklärend hinzu.
»Du hattest nie eine Freundin?« fragte Ines beinahe entsetzt. Wie konnte es so etwas im zwanzigsten Jahrhundert noch geben?
»Meine erste Freundin muß ich heiraten«, antwortete Katsumata ernst. »Tue ich das nicht, so werde ich aus der Familie verbannt.«
Ines erschrak. »Hat dein Vater das jetzt etwa getan? Ist das die schwere Strafe, von der du vorhin gesprochen hast?«
»Nein«, entgegnete Katsumata. »Mein Vater hat noch einmal Gnade vor Recht ergehen lassen, allerdings nur, weil du kein japanisches Mädchen bist.«
Ines schüttelte den Kopf. »Wie kannst du nur so leben, Katsumata?«
»Ich wurde so erzogen«, erklärte er schlicht. »Sollte ich aber jemals eigene Kinder haben, dann werde ich offener… freier denken. Eine Liebe muß langsam wachsen. Man kann nicht nach einem Beisammensein wissen, ob man die Frau fürs Leben gefunden hat.« Für einen Augenblick berührte er ihren Arm. »Du wärst es vielleicht gewesen,
Ines.«
»Nein, Katsumata. Ich werde nach Deutschland zurückkehren.« Sie sah sich in dem karg eingerichteten Raum um. »Hier könnte ich auf Dauer nicht leben. Für ein paar Monate war es sehr interessant, aber für ein ganzes Leben…« Sie schüttelte den Kopf. »Ich will nicht heiraten, Kinder bekommen und den Haushalt führen – zumindest jetzt noch nicht. Ich habe Japanisch gelernt, um als Dolmetscherin zu arbeiten… ich will auf der Karriereleiter nach oben steigen, so weit es geht. Für ein Hausfrauendasein, wie deine Mutter es führt, ist in meinem Leben kein Platz.«
Katsumata nickte. »Du wirst dir also keine neue Unterkunft suchen, sondern gleich abreisen?«
»Ja, wahrscheinlich. In den vier Monaten, die ich jetzt hier war, habe ich viel gelernt.«
Wieder nickte Katsumata, dann drehte er sich um. Im selben Moment begann er zu taumeln und griff wie haltsuchend um sich. Rasch eilte Ines zu ihm, um ihn zu stützen.
»Was ist los, Katsumata?« fragte sie besorgt.
»Nichts von Bedeutung«, wehrte er ab. »Ein leichter Schwindelanfall. Sicher vom Streß in der Universität. Das haben im Moment mehrere von meinen Freunden. Es wird schon wieder vergehen.«
»Vielleicht solltest du zum Arzt gehen«, riet Ines, während sie ihn noch immer festhielt.
Im nächsten Moment riß Katsumata sie in seine Arme, beugte sich über sie und küßte sie voller Leidenschaft.
»Katsumata, nein«, murmelte
Ines, doch ihr Widerstand war nicht sehr stark. Zu groß war die Versuchung, sich noch ein letztes Mal von Katsumatas Glut mitreißen zu lassen, und der Nervenkitzel war um so größer, weil es diesmal im Haus seiner Eltern geschah. Doch auf einmal ging in Katsumata eine Veränderung vor. Er wich zurück, und
Ines sah, wie er wieder taumelte, dann begann er plötzlich zu keuchen, und der Schweiß brach ihm aus. Von einer Minute auf die andere begann sein ganzer Körper wie im Fieber zu glühen.
»O mein Gott!« stieß Ines erschrocken hervor. »Was ist mit dir?«
»Geh!« stieß er zwischen den Zähnen hervor. »Es ist nichts! In einer halben Stunde ist alles vorbei.«
Ines zögerte. Sie hatte das Gefühl, etwas unternehmen zu müssen.
»Soll ich nicht lieber einen Arzt holen, Katsumata?«
Heftig schüttelte er den Kopf. »Nicht nötig. Geh jetzt.«
Ines wandte sich zu der Papierschiebetür und öffnete sie, doch bevor sie den Raum verließ, blickte sie noch einmal zurück. Katsumata hatte sich auf einer der Tatami-Matten, mit denen das ganze Haus ausgelegt war, zusammengerollt. Sein ganzer Körper bebte wie im Schüttelfrost, und Ines fragte sich, ob es wirklich richtig sei, den jungen Mann in diesem Zustand allein zu lassen. Aber er hatte es ja ausdrücklich so gewollt.
Leise ging sie hinaus und schob die Tür hinter sich zu. Das ganze Haus wirkte leer – wie ausgestorben, und Ines hegte den Verdacht, daß man abwarten wollte, bis sie das Haus verlassen hatte.
»Na schön, das können sie haben«, murmelte sie und begann ihre Koffer zu packen. Sie war gerade damit fertig, als Katsumata zu ihr trat. Er lächelte sie an, und dabei hätte niemand vermuten können, daß er noch eine halbe Stunde zuvor von einem heftigen Fieberanfall geschüttelt worden war.
»Was war das, Katsumata?« wollte Ines beklommen wissen.
Er zuckte die Schultern. »Nichts von Bedeutung. Die Anforderungen an der Universität sind sehr hoch. Zur Zeit leiden viele von uns an solchen Fieberattacken, aber es geht immer schnell vorbei.«
»Es ist beängstigend«, meinte
Ines, dann berührte sie sein Gesicht, das noch immer ein wenig heiß war. »Versprich mir, daß du zu einem Arzt gehst.«
Katsumata lächelte wieder. »Es ist sicher unnötig, aber wenn es dich beruhig, gebe ich dir dieses Versprechen. Gleich morgen früh lasse ich mich untersuchen.«
Ines ergriff ihre Koffer. »Leb wohl, Katsumata.«
Er beugte sich zu ihr und küßte sie sanft. »Sayonara.«
Mit langsamen Schritten verließ sie das Haus, dann blickte sie noch einmal zurück. Katsumata stand an der Tür und sah ihr nach. Sie wußten beide, daß sie sich nie wieder begegnen würden, und diese Gewißheit ließ eine leise Wehmut in Ines’ Herz ziehen. Auf eine bestimmte Weise hatte sie Katsumata eben doch geliebt – wenn diese Liebe auch nicht für ein ganzes Leben gereicht hätte.
*
Die Heimreise wurde für Ines zu einer wahren Tortur. Der lange Flug, die schier endlosen Wartezeiten an den Flughäfen und die Zeitumstellung machten ihr arg zu schaffen. Dazu kamen die Kopfschmerzen, die sie jetzt plötzlich plagten und die immer unerträglicher wurden.
Völlig erschöpft kam sie schließlich zu Hause an und ließ sich auf ihr Bett fallen. Minuten später war sie fest eingeschlafen. Als sie erwachte, war es draußen dunkel. Sie wollte aufstehen, weil sie so entsetzlich durstig war, doch der hämmernde Schmerz in ihrem Kopf hinderte sie daran, sich auch nur zu bewegen. Wieder schloß sie die Augen, doch an Schlaf war nicht mehr zu denken. Das Pochen in ihrem Kopf und das Brennen in ihrer Kehle hielt sie wach.
Als der Morgen graute, ließen die Schmerzen endlich nach und verschwanden schließlich ganz. Ein wenig mühsam erhob sie sich, ging langsam in die Küche hinüber und ließ Wasser in ein Glas laufen, dann trank sie durstig drei Gläser hintereinander leer.
»Ines.«
Die überrascht klingende Stimme ließ sie herumfahren. Dann lächelte sie den jungen Mann vor sich an.
»Hallo, Manfred. Überraschung gelungen?« fragte sie.
Manfred Klein nickte. »Das kann man wohl sagen. Ich wollte hier in der Wohnung eigentlich nur nach dem Rechten sehen.« Jetzt lächelte auch er und nahm seine Freundin zärtlich in die Arme. »Schön, daß du wieder da bist.«
Ines lehnte sich an ihn. »Ich bin auch froh, wieder zu Hause zu sein, obwohl Japan ein sehr interessantes Land ist.«
»Dann hat dich also die Sehnsucht nach Steinhausen wieder heimgetrieben«, vermutete Manfred, und sie hörte die leise Enttäuschung aus seiner Stimme heraus. Er hatte nämlich gehofft, Ines wäre seinetwegen schon nach vier Monaten zurückgekehrt.
»Nicht ganz«, entgegnete sie. »Es hat eine kleine Meinungsverschiedenheit zwischen meinem Gastgeber und mir gegeben.« Sie zögerte einen Moment und überlegte, ob sie Manfred die Wahrheit gestehen solle, entschied sich dann aber dagegen. Sie wollte ihn mit der Affäre, die sie mit Katsumata gehabt hatte, nicht verletzen. Daß es weit mehr als nur eine kleine Affäre gewesen war, wollte sie noch nicht wahrhaben.
»Und nach mir hattest du gar keine Sehnsucht?« fragte Manfred, und Ines hörte die Hoffnung aus seiner Stimme heraus.
»Doch«, antwortete sie, obwohl es eigentlich nicht der Wahrheit entsprach. Die vier Monate in Japan hatten ihr gezeigt, daß ihre Liebe zu Manfred tatsächlich abgekühlt war. Während der ganzen Zeit hatte sie nur sehr selten an ihn gedacht, und wenn, dann waren ihre Gedanken nicht von Sehnsucht geprägt gewesen.
Manfred spürte, daß Ines nicht die Wahrheit gesagt hatte und daß seine Beziehung zu ihr nun wirklich kurz vor dem Ende stand, doch er war nicht bereit, dies zu akzeptieren.
»Ich liebe dich«, raunte er der jungen Frau ins Ohr, dann küßte er sie.
Ines spürte seine Leidenschaft, doch sie wich vor ihm zurück.
»Nein, Manfred, nicht jetzt«, bat sie. »Ich bin schrecklich müde von der Reise.«
Liebevoll sah er sie an. »Dann schlaf dich aus, Ines. Ich komme heute abend wieder. Wir könnten essen gehen und anschließend…« Er lächelte. »Na, uns wird schon was einfallen, nicht wahr?«
Ines nickte nur. Sie hätte am liebsten jetzt gleich Schluß gemacht, doch das konnte sie Manfred nicht antun. Er hatte sich während ihrer Abwesenheit um die Wohnung gekümmert, und sie spürte, wie sehr er hoffte, daß sich ihre Beziehung wieder bessern würde.
Auf ein paar Monate mehr oder weniger kommt es nicht an, dachte Ines. Er wird bald merken, daß auch von ihm aus keine Liebe mehr da ist, sondern nur noch ein Festklammern an gewissen Gewohnheiten.
*
In der Praxis von Dr. Daniel war mal wieder die Hölle los. Die Patientinnen gaben sich buchstäblich die Türklinke in die Hand, und die junge Empfangsdame Gabi Meindl war einem Nervenzusammenbruch nahe.
»In einer halben Stunde will der Chef seine Briefe und Rechnungen unterschreiben, und ich habe noch keine einzige Rechnung fertig, weil ich nur damit beschäftigt bin, die diversen angemeldeten und unangemeldeten Damen hereinzulassen, Karteikarten herzurichten und endlose Telefongespräche zu führen«, beklagte sie sich bei der Sprechstundenhilfe Sarina von Gehrau.
Sarina seufzte. »Heute ist es wirklich schlimm. Aber daß Dr. Daniel in einer halben Stunde irgend etwas unterschreiben wird, glaube ich nicht. Er steht nämlich genauso im Streß wie wir.«
»Na, ich weiß nicht«, entgegnete Gabi zweifelnd. »Dr. Daniel will seine Briefe doch immer vor dem Mittagessen vorgelegt bekommen.«
»Vor eins kommt er heute sicher nicht aus der Praxis«, vermutete Sarina. »Im Wartezimmer herrscht noch die reinste Invasion.«
Gabi runzelte die Stirn. »Sind da eigentlich auch noch Patientinnen von der Carisi mit dabei?«
Sarina schüttelte den Kopf. »Sie wissen doch ganz genau, daß Frau Dr. Carisi ihr eigenes Wartezimmer hat. Und ihre Sprechstundenhilfe achtet sehr darauf, daß sich keiner der Patienten zu Dr. Daniel verirrt.«
Gabi seufzte abgrundtief. »Also besonders glücklich bin ich über diese seltsame Gemeinschaftspraxis nicht. Ein Frauenarzt und eine Allgemeinmedizinerin – das paßt doch gar nicht zusammen.«
Sarina schmunzelte. »Ist es nicht eher Ihre Eifersucht auf Frau Dr. Carisi, die da nicht dazupaßt?«
Brennende Röte überzog Gabis hübsches Gesicht. »Sie sind ja wohl verrückt, Sarina! Der Chef ist doppelt so alt wie ich.«
»Aber Sie verehren ihn trotzdem grenzenlos.« Sarina grinste. »Ich übrigens auch. Trotzdem finde ich, daß er und Frau Dr. Carisi wunderbar zusammenpassen würden.«
»Dann spielen Sie doch Amor«, knurrte Gabi.
»Ach, ich glaube, das ist gar nicht nötig«, meinte Sarina scherzend. »Über kurz oder lang wird es zwischen den beiden ohnehin funken.« Davon war sie selbst gar nicht mal überzeugt, aber es machte ihr einfach Spaß, Gabi ab und zu ein bißchen zu ärgern. Die junge Empfangsdame schwärmte ja schon eine ganze Weile für ihren attraktiven Chef und sah daher nur ungern ein anderes weibliches Wesen in seiner Nähe – es sei denn, es handelte sich um eine etwas ältere Dame oder um ein unscheinbares Mauerblümchen. Frau Dr. Carisi war aber weder das eine noch das andere, und das führte bei Gabi zu rechten Eifersuchtswallungen, was Sarina wiederum köstlich amüsierte.
Das Klingeln an der Praxistür unterbrach die Diskussion der beiden jungen Frauen.
»Wenn die auch nicht angemeldet ist, werde ich noch langsam unfreundlich«, prophezeite Gabi, dann drückte sie auf den elektrischen Türöffner.
»Guten Tag«, grüßte die hereintretende Frau mit einem freundlichen Lächeln.
»Grüß Gott, Frau Doschek«, erwiderte Gabi etwas milder gestimmt. Die Patientin war nämlich nicht nur angemeldet, sondern auch schwanger, und da war Rücksichtnahme geboten. »Nehmen Sie bitte noch einen Augenblick im Wartezimmer Platz, und erschrecken Sie nicht vor der Patientenflut da drinnen. Sie kommen jedenfalls pünktlich dran.«
Valerie Doschek winkte ab. »Ach, mir macht es nichts aus, wenn ich ein bißchen warten muß. Ich habe Zeit.«
Diese Worte nahmen Gabi noch mehr für die junge Frau ein.
»So etwas höre ich leider viel zu selten«, seufzte sie. »Die meisten Patientinnen wollen schon wieder fertig sein, ehe sie überhaupt hereinkommen.«
Valerie mußte lachen. »Wissen Sie, Frau Meindl, bevor ich schwanger wurde, habe ich mich um die Besuche beim Frauenarzt auch nicht gerade gerissen, aber jetzt… das Abhören der Herztöne, die Ultraschallaufnahmen – das ist alles so ungeheuer spannend.«
Gabi lächelte. »Das kann ich mir vorstellen.« Sie warf einen Blick auf die Karteikarte der Patientin. »Jetzt ist es ja bald soweit.«
Valerie nickte eifrig. »In sieben Wochen.« Sie seufzte. »Ich kann es schon fast nicht mehr erwarten.« Dann erblickte sie die Akten, die sich neben Gabis Schreibmaschine bereits stapelten. »Meine Güte, ich erzähle und erzähle, dabei haben Sie sicher eine Menge Arbeit. Jetzt halte ich Sie aber wirklich nicht länger auf.« Sie nickte Gabi lächelnd zu, dann verschwand sie im Wartezimmer.
»Eine nette Frau«, urteilte Gabi, dann konzentrierte sie sich auf ihre Arbeit und wurde tatsächlich keine Minute zu früh damit fertig, denn Dr. Daniel kam zwischen zwei Terminen rasch heraus, um die anfallende Post zu unterschreiben, dann warf er einen Blick auf die vielen Karteikarten, die noch bereitlagen.
»Heute gönnt man mir anscheinend mein Mittagessen nicht«, meinte er, bevor er sich Sarina zuwandte. »Wer ist die nächste Patientin?«
»Frau Doschek.«
Dr. Daniel nickte. »Sagen Sie ihr bitte, sie möge sich noch einen Augenblick gedulden. Ich muß eine Kleinigkeit essen, sonst breche ich zusammen, und mein Mittagessen kann ich mir heute anscheinend sowieso schenken.«
»Wir auch«, murmelte Gabi, als Dr. Daniel die Praxis verlassen hatte. »Leider haben wir unsere Wohnungen aber nicht in so greifbarer Nähe wie der Chef.«
»Heute sind Sie aber wirklich am Nörgeln, Gabi«, hielt Sarina ihr vor. »Es passiert sowieso nur selten…« Sie stockte, weil Dr. Daniel in diesem Moment zurückkehrte und ein Tablett hereinbalancierte.
»Sie sollen mir natürlich auch nicht verhungern«, meinte er lächelnd, stellte das Tablett auf Gabis Schreibtisch ab, nahm einen der drei reichlich gefüllten Teller und kehrte in sein Sprechzimmer zurück, während sich Sarina und Gabi eifrig über diese unerwartete Zwischenmahlzeit hermachten.
»Er ist wirklich einzigartig«, schwärmte Gabi. »Welcher andere Chef würde wohl an uns armes Fußvolk denken?«
»Seine Schwester ist aber auch eine hervorragende Köchin«, urteilte Sarina.
Gabi nickte. »Es ist schon gut, daß sie ihm den Haushalt führt.«
Ein neckisches Grinsen erschien auf Sarinas Gesicht. »Ansonsten würden Sie sich eben um unseren lieben Chef kümmern, nicht wahr?«
»Manchmal sind Sie ein richtiges Biest«, meinte Gabi, doch sie lächelte dabei. Mit vollem Magen konnte man derartige Scherze eben gelassener hinnehmen.
*
Währenddessen hatte auch Dr. Daniel ein wenig hastiger als sonst gegessen. Er liebte diese Hektik nicht besonders, aber manchmal ging es nicht anders. Dann ließ er von Sarina die nächste Patientin hereinbringen. Mit einem freundlichen Lächeln kam er der schwangeren jungen Frau entgegen.
»Grüß Gott, Frau Doschek. Wie geht’s Ihnen?« wollte er wissen.
»Blendend!« erklärte Valerie nachdrücklich. »Nur die Wartezeit auf mein Baby wird mir allmählich ganz schön lang.«
Dr. Daniel schmunzelte. »Das höre ich von vielen werdenden Müttern. Aber bei Ihnen wird es ja nun wirklich nicht mehr lange dauern.« Er warf einen Blick auf seine Notizen in der Karteikarte. »Sind Sie noch immer entschlossen, zu Hause zu entbinden?«
Valerie nickte. »Ja, ich möchte auf alle Fälle eine Hausgeburt. Mit Frau Lüder habe ich schon alles deswegen vereinbart.«
Nachdenklich strich sich Dr. Daniel über das Kinn. »Eigentlich hatte ich gehofft, Sie würden es sich doch noch anders überlegen und zur Entbindung in die Waldsee-Klinik gehen. Verstehen Sie mich nicht falsch, Frau Doschek, Frau Lüder ist eine erstklassige Hebamme, aber auf die bräuchten Sie auch in der Klinik nicht zu verzichten. Sie war schon öfter bei Entbindungen in der Waldsee-Klinik dabei. Mir persönlich wäre allerdings wirklich wohler, wenn ich Sie in der Klinik wüßte.«
»Warum denn?« wandte Valerie ein. »Meine Schwangerschaft ist bisher völlig normal verlaufen, und ich denke nicht, daß das bei der Geburt anders sein wird.«
»Damit haben Sie wahrscheinlich sogar recht«, räumte Dr. Daniel ein. »Aber ich habe oft genug erlebt, daß bei einer Geburt, bei der eigentlich keine Komplikationen zu erwarten waren, plötzlich doch welche aufgetreten sind und dann ganz schnell ein Kaiserschnitt gemacht werden mußte. Ich will Ihnen keine Angst machen, Frau Doschek, aber ich muß Sie nun mal darauf hinweisen, daß so etwas grundsätzlich passieren kann.«
Dr. Daniels Worte stimmten Valerie nun doch ein wenig nachdenklich, aber letztendlich siegte ihr Wunsch nach der häuslichen Geborgenheit.
»Ich möchte es meinem Kind und mir so richtig gemütlich machen«, meinte sie. »Ohne Hektik und Krankenhausroutine, und ich bin sicher, daß ich keinen Kaiserschnitt benötigen werde.«
»In der Waldsee-Klinik gibt es bei Geburten weder Hektik noch Routine, und unsere Kreißsäle sind schon fast gemütlich«, entgegnete Dr. Daniel, obwohl er spürte, daß sich Valerie von ihrem einmal gefaßten Entschluß nicht mehr würde abbringen lassen. »Vielleicht schauen Sie sich unsere Entbindungsstation bei Gelegenheit einmal an.«
Valerie nickte. »Bei der nächsten Geburtsvorbereitungsstunde will Frau Lüder uns ohnehin einen Kreißsaal zeigen, und ich nehme an, es wird der von der Waldsee-Klinik sein.«
»Ganz sicher sogar«, stimmte Dr. Daniel zu, zögerte einen Moment und fügte dann hinzu: »Wie gesagt, für Ihre eigene Sicherheit und die Ihres Kindes würde ich Ihnen eine Entbindung in der Klinik empfehlen.«
»Ich werde es mir überlegen«, versprach Valerie, war insgeheim aber schon fest entschlossen, sich nicht von ihrem Vorhaben abbringen zu lassen. Ihre eigene Mutter hatte viermal zu Hause entbunden, und nichts war dabei schiefgegangen. Warum sollte es bei ihr anders sein?
*
Der erste schwere Fieberschub traf Ines Holbe ganz unvorbereitet. Sie war gerade dabei, ein ganz besonderes Abendessen zuzubereiten, denn Manfred hatte Geburtstag, und den wollten sie heute gemeinsam feiern. Es würde ihre letzte Feier sein – das war zumindest für Ines klar. Nach diesem Geburtstag wollte sie die Beziehung zu Manfred, die für sie in letzter Zeit mehr und mehr eine Belastung geworden war, beenden.
Gerade gab Ines noch einen Schuß Sahne zu ihrer Soße, als sich plötzlich alles vor ihren Augen zu drehen begann. Haltsuchend griff sie um sich, doch es war nichts in der Nähe, woran sie sich hätte festhalten können. Sie stürzte zu Boden, während sie noch immer das Gefühl hatte, in einem wahnsinnig schnellen Karussell zu sitzen. Dann war der Schwindelanfall mit einem Schlag wieder vorbei, dafür stieg brennende Hitze in Ines auf. Ihr ganzer Körper glühte, der Schweiß brach ihr aus, und sie war unfähig, sich zu bewegen. Es schien, als wäre sie von Kopf bis Fuß gelähmt, dabei zitterte sie wie im Schüttelfrost. Nach einer halben Stunde war dann alles wieder vorbei.
Langsam rappelte sich Ines wieder auf, zog ihren schweißnassen Jogging-Anzug aus, stellte sich unter die Dusche und schlüpfte danach in das Kleid, das sie sich für die Geburtstagsfeier zurechtgelegt hatte.
Als sie in die Küche zurückkehrte, erschrak sie. Der Herd sah aus wie nach einer Explosion, und der stechende Geruch von verbranntem Essen erfüllte den ganzen Raum. Die Soße war übergekocht und der Braten schon leicht angekohlt.
Dunkle Rauchschwaden drangen aus dem Backofen.
Rasch schaltete Ines den Herd aus, dann riß sie beide Fensterflügel weit auf.
»Meine Güte, was ist denn hier passiert?« fragte Manfred entsetzt.
Mit einem verlegenen Lächeln wandte sich Ines ihm zu. »Ich fürchte, wir müssen deine Geburtstagsfeier ins Restaurant verlegen. Mein Essen dürfte nicht mehr genießbar sein.«
Manfred runzelte die Stirn. Noch nie war Ines etwas Ähnliches passiert. Sie war eine gute Köchin, der noch nicht mal ein Schnitzel angebrannt war.
»Ich war am Telefon«, behauptete Ines. »Eine Freundin, von der ich lange nichts mehr gehört hatte, hat angerufen und…« Sie zuckte die Schultern. »Über den vielen Neuigkeiten, die sie zu erzählen hatte, habe ich total vergessen, daß ich was auf dem Herd stehen hatte.«
Manfred spürte, daß das nicht die Wahrheit war, doch er ging kommentarlos darüber hinweg.
»Macht ja nichts«, meinte er. »Gehen wir halt zum Italiener.«
Ines nickte. »Gute Idee.« Dabei war ihr nach dem eben Erlebten der Appetit gründlich vergangen. Und während sie neben Manfred im Auto saß, beschäftigte sie sich in Gedanken zum ersten Mal ganz ausgiebig mit dem, was in ihrer Wohnung vorgefallen war.
Es war genau so ein Anfall gewesen, wie Katsumata ihn an jenem Tag gehabt hatte, als sie Japan verließ. Der Streß an der Universität sei die Ursache dafür, hatte er behauptet.
In letzter Zeit hatte ich ja auch ziemlichen Streß, dachte Ines und versuchte sich damit zu beruhigen, was ihr allerdings nicht gelang. Instinktiv spürte sie, daß dieser Anfall etwas anderes bedeutete, und eigentlich hätte sie nun genau das tun sollen, was sie Katsumata empfohlen hatte: zu einem Arzt gehen! Doch jetzt, da es sie selbst betraf, scheute sie davor zurück.
Es war sicher nur der Streß, redete sie sich ein. Wenn es ein zweites Mal passiert, werde ich zum Arzt gehen.
*
Der nächste Anfall kam fast auf die Stunde genau einen Tag später und lief genauso ab wie beim ersten Mal. Zuerst der Schwindel, dann Schweißausbruch und Fieber. Und nach einer halben Stunde war alles wieder vorbei. Als Manfred gegen sieben Uhr abends zu ihr kam, wies nichts mehr darauf hin, daß sie sich noch eine Stunde zuvor hilflos am Boden gewälzt hatte.
Doch selbst wenn man ihr noch etwas angesehen hätte, hätte Manfred es wohl nicht bemerkt. Er war in einer zärtlichen Stimmung, und obwohl Ines nichts mehr fühlte, wenn er sie streichelte oder küßte, ließ sie sich von seiner Leidenschaft mitreißen.
Stunden später lag sie neben Manfred und lauschte auf seine gleichmäßigen Atemzüge. In ihrem Kopf pochte ein leiser Schmerz, und plötzlich begann sich alles um Ines zu drehen.
»Nein, nicht schon wieder«, flüsterte sie verzweifelt und wußte doch, daß nichts diesen erneuten Anfall aufhalten konnte. Mit letzter Kraft kroch sie aus dem Bett, und obwohl sie durch den heftigen Schwindelanfall vollkommen die Orientierung verloren hatte, schaffte sie es irgendwie, ins Badezimmer zu gelangen. Sie schloß die Tür hinter sich ab, dann stürzte sie zu Boden. Die unerträgliche Hitze ergriff wieder Besitz von ihr und vermittelte ihr das Gefühl, innerlich zu verbrennen. Dann war der Anfall vorbei, doch diesmal war Ines völlig erschöpft davon. Sie schaffte es kaum, sich aufzurichten. Mit Mühe kroch sie zur Duschkabine, setzte sich hinein und schaltete dann das Wasser ein. Angenehm warm prasselte es auf ihren schweißnassen Körper.
»Ines? Bist du da?« hörte sie Manfred fragen. »Was ist los? Ist dir nicht gut?«
»Doch, alles in Ordnung«, behauptete Ines. »Ich hatte einen Alptraum und bin schweißgebadet aufgewacht. Jetzt will ich nur rasch duschen.«
»Ach so.« Manfred schwieg einen Moment. »Und sonst ist wirklich alles okay?«
»Ja, Manfred, ich komme gleich wieder«, erklärte sie und dachte dabei, daß es höchste Zeit sei, diese Beziehung zu beenden. Manfred durfte einen solchen Anfall nicht miterleben. Und sie selbst würde ab jetzt zu Hause bleiben und abwarten, bis diese seltsame Krankheit wieder vergehen würde. Schließlich wollte sie nicht riskieren, mitten auf der Straße einen dieser gräßlichen Anfälle zu bekommen.
*
»Valerie, das ist aber eine nette Überraschung«, erklärte Sigrid Neumeister erfreut, als sie die Wohnungstür öffnete und sich so unverhofft ihrer Freundin gegenübersah.
Valerie Doschek lächelte. »Mir war es zu Hause so langweilig, da dachte ich, ich könnte dich mal besuchen.«
»Du hast goldrichtig gedacht, Valerie«, meinte Sigrid. »Aber daß du dich das überhaupt noch traust. Immerhin könnte es ja jetzt jeden Tag soweit sein.«
Zärtlich streichelte Valerie über ihren Bauch. »Ach was, ich habe noch fast zwei Wochen bis zum Termin. Außerdem ist es von München nach Steinhausen ja nur ein Katzensprung.«
»Na ja, allerdings ein ziemlich großer Katzensprung«, wandte Sig-rid ein, dann lächelte sie. »Aber falls es wirklich losgehen sollte, kann ich dich rasch in die Klinik fahren.«
Doch Valerie schüttelte den Kopf. »Ich werde in keiner Klinik entbinden, sondern zu Hause.«
»Wirklich? Ist das nicht zu riskant?«
»Überhaupt nicht. Ich habe eine erstklassige Hebamme, und der Gynäkologe wohnt praktisch um die Ecke. Dr. Daniel – der beste Arzt, den du in Steinhausen und Umgebung finden kannst.«
Sigrid seufzte. »So einen könnte ich hier auch gut brauchen. Mein Gynäkologe ist zwar gut, aber unglücklicherweise hat er seine Praxis fast am anderen Ende von München, und hier in der Gegend gibt es keinen, der mir zusagen würde.« Sie lächelte. »Und bis nach Steinhausen möchte ich wegen dieser kleinen Routineuntersuchungen auch nicht fahren.«
»Das kann ich mir vorstellen. Es ist ja doch…« Valerie stockte, als der Schmerz sie mit voller Wucht überfiel. Mit beiden Händen griff sie an ihren jetzt brettharten Bauch und schrie auf.
Erschrocken fuhr Sigrid hoch. »Geht’s los?«
Doch Valerie brachte kein Wort hervor, weil der Schmerz noch immer in ihrem Bauch tobte, und plötzlich bekam sie Angst. Die Hebamme hatte bei der Geburtsvorbereitung gesagt, der Schmerz würde langsam kommen, anschwellen und dann wieder verklingen. Das, was sie hier erlebte, war aber völlig anders. Der Wehenschmerz nagelte sie buchstäblich fest, und sie war nicht imstande, auch nur einen Finger zu rühren.
»Meine Güte, Valerie, so sag doch etwas«, bat Sigrid inständig. »Was ist los?«
»Ich glaube, mein Baby…«, begann Valerie, dann blickte sie entsetzt nach unten, weil sie die Nässe fühlte, die an ihren Beinen hinablief.
»O mein Gott«, stieß Valerie hervor. »Ich kann es nicht halten… es läuft einfach weg…« Ganz dunkel erinnerte sie sich an die Worte der Hebamme. Bei einem vorzeitigen Blasensprung sollte sie sich umgehend in die Klinik bringen lassen – liegend.
»Bis nach Hause schaffe ich es nicht mehr«, erklärte Valerie mit bebender Stimme. »Bring mich in die nächste Klinik.«
Sigrid nickte ein wenig halbherzig. Sie wußte, daß das Krankenhaus hier in der Umgebung keinen besonders guten Ruf genoß, andererseits schien in diesem Fall wirklich Eile geboten zu sein. Wenn sie um diese Uhrzeit eine der großen Kliniken ansteuern würde, dann konnte es passieren, daß sie irgendwo im Stau steckenbleiben würden. Das durfte sie keinesfalls riskieren.
Auf Sigrid gestützt ging Valerie die Treppe hinunter und stieg schließlich ins Auto. Sie versuchte sich auf die Rückbank zu legen, doch das war in Sigrids Kleinwagen äußerst schwierig.
»Es ist nicht weit«, erklärte Sigrid beruhigend, als sie losfuhr, und tatsächlich waren sie schon knappe zehn Minuten später am Ziel.
Rasch stieg Sigrid aus und betrat die Klinik.
»Meine Freundin hat Wehen, und sie hat Wasser verloren«, erklärte sie hastig.
Der Pförtner nickte gelangweilt, hob den Telefonhörer ab und wählte eine Nummer. Erst nach einer halben Ewigkeit begann er zu sprechen, und Sigrid wurde allmählich nervös. Für ihre Begriffe dauerte das alles viel zu lange, und fast bereute sie schon, daß sie nicht zur Sommer-Klinik gefahren war, die einen sehr guten Ruf hatte.
»Es kommt gleich jemand«, erklärte der Pförtner jetzt.
Sigrid eilte zu ihrem Auto zurück. »Einen Augenblick noch, Valerie.« Besorgt sah sie ihre Freundin an. »Wie geht’s dir?«
Tränen rollten über Valeries Wangen. »Ich habe Angst, Sigrid, und es tut schrecklich weh.« Sie schluchzte auf. »Wenn doch nur Dr. Daniel hier wäre.«
»Soll ich Heinz anrufen?« fragte Sigrid. »Ich meine… sicher möchte er doch bei der Geburt seines ersten Kindes dabeisein.«
Valerie nickte. »Eigentlich schon, aber… ausgerechnet heute ist er geschäftlich in Würzburg und kommt erst am späten Abend zurück.« Erneut schluchzte sie auf. »Wir dachten doch, daß wir genügend Zeit hätten. Ich hätte ja noch fast zwei Wochen bis zum Termin.«
»Wo ist denn nun die schwangere Frau?« erklang in diesem Moment eine weibliche Stimme von der Tür her.
»Hier!« rief Sigrid, dann wiederholte sie, was sie schon zum Pförtner gesagt hatte.
»Ein vorzeitiger Blasensprung ist kein Grund zur Besorgnis«, erklärte die Schwester. »So etwas passiert öfter.«
Die Worte sollten Valerie beruhigen, doch der leicht genervte Ton der Schwester bewirkte das Gegenteil. Valerie fühlte sich, als wäre sie ein lästiges Insekt, und sehnte sich nach Dr. Daniels ruhiger, verständnisvoller Art.
»Den Wagen können Sie hier aber nicht stehenlassen«, erklärte die Schwester nun an Sigrid gewandt.
»Ich fahre ihn gleich weg«, versprach die junge Frau, zögerte und erkundigte sich dann: »Darf ich meiner Freundin ein bißchen beistehen? Es ist ihr erstes Kind, und ihr Mann ist nicht erreichbar.«
Die Schwester seufzte. »Wenn es sein muß.«
Sigrid ärgerte sich über die unfreundliche Schwester, sagte aber nichts, weil sie jetzt nicht Zeit verlieren wollte. Sie hatte nämlich nach wie vor den Eindruck, es würde bei Valerie nun wirklich eilen.
Als Sigrid nach ein paar Minuten den Kreißsaal betrat, lag Valerie bereits auf dem schmalen Bett, das ein wenig an den Gynäkologischen Stuhl beim Frauenarzt erinnerte. Ihre Beine lagen in speziell dafür angebrachten Stützen. Als Sigrid zu ihr trat, wandte Valerie ihr tränenüberströmtes Gesicht der Freundin zu.
»Genau das war es, was ich vermeiden wollte«, flüsterte sie kläglich. »Mein erstes Kind sollte in einer heimeligen Atmosphäre geboren werden, nicht in der Sterilität eines solchen Kreißsaales.
»So, wen haben wir denn da?« fragte in diesem Moment eine männliche Stimme.
Valerie wandte den Kopf und sah den Arzt an, der jetzt zu ihr trat.
»Na, na, wer wird denn gleich so weinen?« meinte er, dann wandte er sich der Schwester zu. »Wir machen gleich eine Periduralanästhesie.«
Valerie erschrak. »Nein! Das will ich nicht!«
»Aber warum denn nicht?« erkundigte sich der Arzt in besonders väterlichem Ton, der allerdings nicht sehr überzeugend klang. »Danach haben Sie keine Schmerzen mehr und können die Geburt Ihres Kindes ganz entspannt genießen.«
Wieder schüttelte Valerie den Kopf. »Ich will eine natürliche Geburt.«
Der Arzt zuckte die Schultern. »Wenn Sie meinen. Aber ich sage es Ihnen gleich. Ein paar Stunden wird das sicher noch dauern.«
»Kann ich in der Zwischenzeit ein bißchen spazierengehen?« wollte Valerie wissen. »Im Geburtsvorbereitungskurs…«
»Das ist bei uns nicht üblich«, fiel der Arzt ihr ins Wort. »Sie haben Wehen, und da gehören Sie in einen Kreißsaal.«
Und bevor Valerie auch nur einen Ton sagen konnte, hatte er den Raum wieder verlassen.
»Hier werden keine Extrawürste gebraten«, fügte die Schwester brummelnd hinzu, dann verschwand sie ebenfalls.
»Wäre ich doch bloß zu Hause geblieben«, brachte Valerie unter Tränen hervor, dann schrie sie auf, weil der Schmerz sie schon wieder überfiel.
Impulsiv griff Sigrid nach ihrer Hand und drückte sie sanft. Sie hätte ihrer Freundin so gern geholfen. Plötzlich kam ihr eine Idee.
»Weißt du die Nummer von diesem Dr. Daniel auswendig?« fragte sie.
Erstaunt sah Valerie sie an. »Ja, warum?«
»Ich rufe ihn an. Vielleicht kann er etwas unternehmen, damit du nicht hier liegen mußt.«
Hoffnung keimte in Valerie auf. »Ja, Sigrid, versuch es.« Sie nannte ihrer Freundin die Telefonnummer, dann lief Sigrid rasch den Flur entlang bis zur Eingangshalle, wo sie bei ihrer Ankunft schon eine Telefonzelle entdeckt hatte. Und dabei hoffte sie inständig, daß Dr. Daniel etwas für ihre Freundin würde tun können.
*
Die Sprechstunde war schon fast zu Ende, als Gabi Meindl noch ein Gespräch zu Dr. Daniel durchstellte.
»Guten Tag, Herr Doktor, mein Name ist Sigrid Neumeister«, stellte sich die Frau am anderen Ende der Leitung vor. »Ich bin eine Freundin von Valerie Doschek.« Und dann schilderte sie die Ereignisse vom Nachmittag. »Jetzt liegt sie auf diesem schmalen Kreißbett, und ich weiß nicht, wie ich ihr helfen könnte.«
Dr. Daniel seufzte. »Ich kenne diese Klinik, Frau Neumeister. Die Ärzte und Schwestern dort haben sich mit der natürlichen Geburt nach Leboyer noch nicht anfreunden können.«
»Und Sie können gar nichts für Valerie tun?« fragte Sigrid verzweifelt.
»Leider nicht«, entgegnete Dr. Daniel. »Ich bin niedergelassener Gynäkologe und darf mich in die Methoden einer Klinik nicht einmischen, abgesehen davon, daß das in diesem Fall nicht viel nützen würde. In dieser Klinik gibt es keine Kreißsäle mit gedämpftem Licht und breiten, bequemen Betten. Und nach Ihrer Schilderung dürfte es für eine Verlegung in ein anderes Krankenhaus bereits zu spät sein. Frau Doschek wird wohl nichts anderes übrigbleiben, als ihr Baby dort zur Welt zu bringen.« Er überlegte kurz. »Danach soll sie aber darauf bestehen, wieder nach Hause zu fahren. Ambulante Geburten sind heutzutage nichts Ungewöhnliches mehr, und man wird ihrem Wunsch auch in dieser Klinik ohne weiteres entsprechen. Morgen nach der Vormittagssprechstunde komme ich dann zu ihr wegen der ersten Nachuntersuchung.«
»Danke, Herr Doktor«, murmelte Sigrid niedergeschlagen.
»Es tut mir wirklich leid, Frau Neumeister, aber mehr kann ich nicht tun«, erklärte Dr. Daniel bedauernd. »Wenn ich in dieser Klinik Belegbetten hätte, wäre es etwas anderes, aber so… mir sind in diesem Fall die Hände gebunden.«
»Das verstehe ich natürlich«, meinte Sigrid. »Es ist nur… Valerie tut mir so leid. Sie weint ganz schrecklich, und sie muß fürchterliche Schmerzen haben.«
»Das kann ich mir vorstellen«, entgegnete Dr. Daniel. »Diese Art der Geburtshilfe wirkt sich auf die Gebärende nicht gerade günstig aus. Die liegende Position, zu der sie gezwungen wird, ist häufig nicht sehr glücklich, um ein Kind zur Welt zu bringen, aber, wie gesagt – ich kann da leider nichts tun.«
Sigrid bedankte sich noch einmal, verabschiedete sich und legte dann auf, während Dr. Daniel noch eine Weile mit dem Hörer in der Hand sitzen blieb. Nun war Valerie Doschek also doch noch in einer Klinik gelandet, allerdings in der schlechtesten, die er sich für sie vorstellen konnte. Vom medizinischen Standpunkt aus gab es für Dr. Daniel eigentlich keine Bedenken, aber gerade bei Valeries ausgeprägtem Wunsch nach Geborgenheit und einer gemütlichen Atmo-sphäre war der Ablauf in dieser Klinik die denkbar schlechteste Lösung.
Dr. Daniel seufzte, dann verließ er sein Ordinationszimmer.
»Setzen Sie Frau Doschek bitte auf die Liste der Hausbesucher für morgen«, bat er seine Sprechenstundenhilfe.
Erstaunt sah Sarina ihn an. »Ist es denn schon soweit?«
Dr. Daniel nickte. »Ja, und unglücklicherweise hat sie sich gerade in München aufgehalten und ist nun in einer kleinen Frauenklinik gelandet, deren Ruf nicht der beste ist.«
»Ach, du liebe Zeit«, entfuhr es Sarina. »Frau Doschek wollte doch so gern zu Hause entbinden.«
»Ja, und nun ist ausgerechnet sie in eine der wenigen Kliniken gekommen, wo die sanfte Geburt noch nicht praktiziert wird.« Er seufzte leise. »Ich fürchte, da wird morgen ein sehr langes, einfühlsames Gespräch nötig sein, um sie diese Eindrücke vergessen zu lassen.
*
»Er kann nichts tun?«
Beinahe hysterisch stieß Valerie Doschek diese Worte hervor. Die Wehenschmerzen, die in immer kürzeren Abständen kamen, und die steife Haltung, die sie hier einnehmen mußte, hatten sie buchstäblich zermürbt. Nun war Dr. Daniel ihre letzte Hoffnung gewesen, und als
Sigrid ihr sagte, daß ihr der Arzt in diesem Fall nicht helfen könne, war Valerie einem Zusammenbruch nahe.
»So, Frau Doschek, nun wird’s langsam ernst«, erklärte der hereintretende Arzt mit betonter Munterkeit. »Jetzt heißt es noch mal kräftig mitarbeiten.«
»Ich kann nicht mehr!« rief Valerie mit tränenerstickter Stimme. »Ich wollte zu Hause entbinden und nicht in dieser gräßlichen Krankenhaussterilität!«
»Tja, das hätten Sie sich früher überlegen müssen«, entgegnete der Arzt. »Jetzt können Sie nicht mehr nach Hause. Der Muttermund ist zehn Zentimeter offen, und Ihr Baby will heraus. Also, Frau Doschek, Sie werden bei der nächsten Wehe kräftig pressen.« Er warf Sigrid einen kurzen Blick zu. »Und Sie gehen bitte hinaus.«
»Nein! Ich will wenigstens meine Freundin bei mir haben, wenn ich…«
»Das ist bei uns nicht üblich«, fiel der Arzt ihr ins Wort, dann sah er
Sigrid an. »Gehen Sie jetzt. Sie können wieder hereinkommen, wenn alles vorbei ist.«
Sigrid drückte noch einmal Valeries Hand. »Mach’s gut. Ich versuche inzwischen Heinz zu erreichen.«
Valerie konnte nur nicken, weil die nächste Wehe sie mit voller Wucht überfiel.
»Pressen!« kommandierte der Arzt. »Frau Doschek, Sie müssen schon ein bißchen mitarbeiten!«
Valerie bemühte sich, der Anweisung zu folgen, doch es schien, als wäre sie mit ihrer Kraft am Ende. Sie versuchte zu pressen, doch die Geburt ging nicht voran.
»Hilft nichts«, meinte der Arzt. »Ich muß das Baby mit der Saugglocke holen.«
»Nein«, schluchzte Valerie leise. Sie fühlte, wie sie von der Krankenhausroutine überrollt wurde, und konnte nichts mehr dagegen tun, weil sie zu erschöpft war.
Im Rhythmus der Wehen zog der Arzt das Baby vorsichtig heraus, dann wurde die Nabelschnur durchtrennt, und Valerie hörte ihr Kind kläglich weinen, während die herbeigerufene Kinderärztin es gründlich untersuchte.
»Mein Baby«, stammelte Valerie. »Ich möchte mein Baby sehen.«
»Immer mit der Ruhe«, entgegnete der Arzt. »Ihr Kleiner wird untersucht, gebadet und angezogen. Währenddessen werde ich den kleinen Dammriß hier nähen. An-schließend können Sie Ihr Kind sehen.«
Wieder rollten Tränen über Valeries Wangen. Sie spürte den feinen Stich, als der Arzt die Lokalanästhesie vornahm. Valerie fühlte ein leichtes Taubheitsgefühl im Intimbereich.
»Es werden nur etwa zehn Stiche nötig sein«, erklärte der Arzt, während er begann, den Riß zu schließen. »In einer Viertelstunde ist alles vorbei, dann können Sie für ein paar Minuten Ihr Kind haben, bevor es ins Säuglingszimmer gebracht wird.«
»Ich möchte nach Hause«, verlangte Valerie mit schwacher Stimme.
Der Arzt sah sie an. »Bei uns ist ein Krankenhausaufenthalt von einer Woche, nach einem Kaiserschnitt sogar von vierzehn Tagen üblich. Eine ambulante Geburt sehen wir nicht gern.«
»Das ist mir egal«, erwiderte Valerie so fest, wie es ihr angesichts dieser Situation möglich war. »Ich will jedenfalls nach Hause.«
»Von mir aus«, erklärte der Arzt nun weit weniger freundlich. »Aber Sie müssen mir eine Erklärung unterschreiben, daß Sie auf eigenes Risiko nach Hause gehen.«
»Ich unterschreibe Ihnen alles, wenn ich nur schnell von hier wegkomme.«
»Undankbarkeit ist der Welt Lohn«, entfuhr es dem Arzt, während er seine Arbeit beendete, dann stand er auf. »Sie bleiben noch zwei Stunden zur Beobachtung hier. Währenddessen werde ich für Ihren Gynäkologen einen Bericht schreiben.«
Valerie nickte nur. Mittlerweile war ihr alles egal. Sie wollte lediglich ihr Baby und dann nichts wie weg aus diesem Krankenhaus.
Kaum war der Arzt draußen, da kam auch schon Sigrid herein.
»Wie war’s?« fragte sie teilnahmsvoll.
»Grauenhaft«, antwortete Valerie. »Er hat das Baby mit der Saugglocke geholt, und dann wurde es sofort abgenabelt und weggebracht. Ich habe es noch nicht mal gesehen.«
»So, hier ist Ihr kleiner Prinz«, erklärte die Schwester und zeigte Valerie das Baby, das sie zur Welt gebracht hatte. Es trug einen blauen Strampelanzug, und die Ärmel des weißen Jäckchens waren über die Hände gezogen. Die Schwester bemerkte Valeries erschrockenen Blick.
»Die Kleinen haben oft so scharfe Fingernägelchen, und damit zerkratzen sie sich gern das Gesicht«, erklärte sie, dann lächelte sie. »Wollen Sie ihn ein wenig halten, oder soll ich ihn gleich ins Säuglingszimmer bringen?«
»Geben Sie mir mein Kind«, verlangte Valerie mit sich überschlagender Stimme. »Ich fahre jetzt sofort nach Hause.«
Das Gesicht der Schwester wurde abweisend. »Davon weiß ich nichts.« Sie überlegte, ob sie das Baby seiner Mutter überlassen sollte, und legte es nach einigem Zögern schließlich in Valeries Arme. »Aber Sie bleiben hier, bis ich bei Dr. Hellmann rückgefragt habe.«
Das hörte Valerie schon gar nicht mehr. Mit zärtlichem Blick sah sie auf ihren kleinen Sohn hinunter.
»Mein Liebling«, murmelte sie, und als das Baby ein wenig unruhig wurde, schob sie das Klinikhemd zur Seite und unternahm einen ersten Stillversuch, was hier auf diesem schmalen Bett nicht ganz einfach war.
»Was machen Sie denn da?« wollte die Schwester wissen, die in diesem Augenblick zurückkam.
»Ich lege mein Kind an«, erklärte Valerie.
»Das hat ja nun wirklich keinen Sinn«, entgegnete die Schwester spöttisch. »Der Milcheinschuß kommt frühestens in drei Tagen.«
»Jetzt hören Sie mir mal ganz genau zu«, brauste Valerie auf. »Ich mußte mich bei der Geburt Ihrer Methode beugen, aber was ich mit meinem Kind mache, müssen Sie schon mir selbst überlassen.«
Erstaunt sah Sigrid ihre Freundin an. Von der Schwäche, die sie noch vor ein paar Minuten gezeigt hatte, war nichts mehr zu spüren. Es
schien, als hätte ihr das Kind alle Kraft zurückgegeben, die sie zuvor verloren hatte.
Die Schwester war über Valeries Ton so empört, daß ihr sekundenlang die Worte fehlten.
»Das ist doch wirklich die Höhe«, schnappte sie schließlich, dann rauschte sie hinaus.
»Wann kannst du gehen?« wollte Sigrid wissen.
»Der Arzt hat irgend etwas von zwei Stunden gesagt«, antwortete Valerie. »Angeblich muß ich so lange zur Beobachtung hierbleiben.«
Allerdings ging es dann doch etwas schneller. Der Arzt kam zurück, untersuchte Valerie und händigte ihr einen verschlossenen Umschlag und ihren Mutterpaß aus.
»Der Brief ist für Dr. Daniel bestimmt«, erklärte er. »Wie aus dem Mutterpaß hervorgeht, hat er sie während der Schwangerschaft betreut, und ich nehme an, daß Sie ihn auch jetzt nach der Geburt wieder aufsuchen werden.«
»Worauf Sie sich verlassen können«, meinte Valerie. »Einen besseren Arzt als Dr. Daniel könnte ich bestimmt nicht finden.«
Dr. Hellmann ging kommentarlos über diese Bemerkung hinweg und gab ihr ein beschriebenes Blatt Papier.
»Unterschreiben Sie das, dann können Sie nach Hause fahren.«
Valerie nahm sich nicht die Mühe, das Geschriebene zu lesen. Hastig setzte sie ihre Unterschrift auf das Papier, dann kletterte sie mühsam von dem schmalen Bett herunter, während Sigrid ihren kleinen Sohn hielt.
»Trag du ihn hinaus«, bat Valerie ihre Freundin. »Ich bin noch ein wenig wacklig auf den Beinen.« Sie sah Dr. Hellmann an. »Die Sachen, die mein kleiner Tobias trägt, werde ich Ihnen gleich morgen früh per Post zurückschicken.«
Der Arzt nickte. »Darum möchte ich gebeten haben.« Er reichte Valerie die Hand. »Trotz der kleinen Mißstimmungen wünsche ich Ihnen alles Gute.«
Valerie sah ihn an. »Danke, Herr Doktor. Sie haben vermutlich getan, was Sie konnten, aber ich hatte mir die Geburt meines ersten Kindes eben ganz anders vorgestellt – mit mehr Gefühl und weniger Technik. Vielleicht statten Sie der Waldsee-Klinik in Steinhausen einmal einen Besuch ab, dann werden Sie verstehen, was ich meine.«
*
Manfred Klein war am Boden zerstört. Er konnte einfach nicht begreifen, weshalb Ines so plötzlich mit ihm Schluß gemacht hatte. Sicher, in letzter Zeit hatte es zwischen ihnen des öfteren gekriselt, und das war ja auch der Grund gewesen, weshalb Ines für mehrere Monate nach Japan gegangen war. Doch nach ihrer Rückkehr hatte zumindest für Manfred wieder alles ganz anders ausgesehen. Er liebte Ines und hatte gedacht, sie würde ebenso empfinden. Und gerade die letzte Nacht war für ihn das schönste gewesen, was er seit langem erlebt hatte. Er war sich Ines’ Liebe wieder so sicher gewesen, und nun… Schluß. Einfach so. Ohne Erklärung… besser gesagt, fast ohne Erklärung.
»Wir haben uns auseinandergelebt.«
Das war die einzige Begründung, die Ines hatte vorbringen können, und die Tatsache, daß sie ihn angeblich nicht mehr lieben würde, doch gerade das konnte Manfred nicht glauben. Sie war an jenem Abend so zärtlich gewesen.
»Manfred! Schläfst du?«
Die Stimme seiner Arbeitskollegin Michaela Weller riß ihn aus seinen Gedanken. Mit einem tiefen Seufzer blickte er auf und direkt in ihre sanften grauen Augen.
»Nein, Michaela, ich schlafe nicht, ich träume nur«, erklärte er.
Aufmerksam sah sie in sein ernstes, trauriges Gesicht.
»Scheint mir aber eher ein Alptraum zu sein«, stellte sie fest, dann setzte sie sich neben ihn. »Möchtest du darüber sprechen?«
»Jetzt?« Manfred betrachtete den Stapel Akten, der nahezu anklagend vor ihm lag.
»Nein«, entgegnete Michaela, »aber heute abend vielleicht.«
Manfred betrachtete die hübsche junge Frau. Er wußte, daß die Hälfte der hier arbeitenden Männer in Michaela verliebt war. So mancher vergaß in ihrer Anwesenheit sogar seine Ehefrau, doch die schöne Michaela hatte bisher noch an keinem ihrer Verehrer Interesse gezeigt. Sie war nett und freundlich, für jeden Spaß zu haben und dazu eine Kollegin, auf die man sich verlassen konnte. Darüber hinaus half sie, wann immer sie konnte. Manfred war daher nicht sicher, ob ihr Angebot einfach nur aus dem Bedürfnis kam, einem anderen zu helfen, oder ob hinter dieser Hilfsbereitschaft vielleicht mehr stecken könnte.
»Du hast recht«, stimmte Manfred schließlich zu. »Vielleicht wäre es wirklich nicht schlecht, einmal über alles zu sprechen.«
Michaela nickte. »Gut, dann erwarte ich dich heute abend bei mir, einverstanden?«
Manfred stimmte zu, doch als er sich ein paar Stunden später auf dem Weg zu Michaela befand, bemerkte er zu seinem eigenen Erstaunen, wie nervös er war. Einen Augenblick spielte er sogar mit dem Gedanken, einfach wieder nach Hause zu gehen und diese Verabredung abzusagen. Aber schließlich stand er doch vor ihrer Wohnungstür und klingelte.
Michaela öffnete, dann glitt ein herzliches Lächeln über ihr Gesicht.
»Ich dachte schon, du hättest es dir anders überlegt«, meinte sie.
Manfred errötete ein wenig.
»Hätte ich auch beinahe«, gestand er. »Irgendwie ist es eine komische Situation. Wir treffen uns wie ein Liebespaar in deiner Wohnung, um über meine Probleme zu sprechen.«
»Über deine Probleme mit Ines«, ergänzte Michaela.
Wieder errötete Manfred. »Woher weißt du das?«
»Ich bin nicht dumm, Manfred, und schon gar nicht blind«, entgegnete Michaela ernst. »Glaubst du denn, ich hätte nicht bemerkt, daß es zwischen euch kriselt?«
Manfred seufzte. »Ich verstehe sie nicht.«
Ich auch nicht, dachte Michaela. Wenn ich einen Freund wie dich hätte, würde ich keinen anderen Mann mehr ansehen.
Doch das sprach sie natürlich nicht aus. Manfred mußte schon selbst merken, wie tief ihre Gefühle für ihn waren. Und vor allen Dingen mußte er sich erst mal von Ines lösen.
»Sie wollte für ein halbes Jahr nach Japan«, begann Manfred zu erzählen. »Um ihre Sprachkenntnisse zu verbessern und um Abstand zu gewinnen – von mir.« Er schwieg kurz. »Das hat mich am meisten getroffen… daß sie meine Gesellschaft als bedrückend empfand.« Dann seufzte er. »Ich habe auf sie eingeredet wie auf ein krankes Pferd, doch es nützte nichts. Sie reiste ab, kam aber schon nach vier Monaten zurück. Ich hatte gehofft, die Sehnsucht nach mir hätte sie getrieben, aber das war es nicht. Sie behauptete zwar, sie hätte sich nach mir gesehnt, doch ich habe gespürt, daß das nicht der Wahrheit entsprach. Aber wie auch immer – wir hatten eine schöne Zeit… bis gestern. Wir haben einen traumhaften Abend verbracht, und am nächsten Morgen sagte sie mir, es wäre Schluß.«
»Einfach so?« hakte Michaela nach.
Manfred zuckte die Schultern. »Angeblich hätten wir uns auseinandergelebt, aber die Wahrheit ist wohl, daß sie mich nicht mehr liebt.«
»So plötzlich?« Michaela schüttelte den Kopf. »Das ist schon sehr eigenartig.« Sie schwieg einen Moment. »Könnte sie in Japan jemanden kennengelernt haben?«
»Möglich«, meinte Manfred, »aber eher unwahrscheinlich. Wäre das der Fall gewesen, dann wäre sie doch nicht früher zurückgekommen als geplant.« Er seufzte wieder. »Ich verstehe sie nicht, aber wahrscheinlich sind Frauen dazu da, daß man sie nicht versteht.«
Michaela mußte schmunzeln. »Das ist aber nicht gerade ein Kompliment.«
Da sah er ihr direkt ins Gesicht. »Du bist anders, Michaela. Bei dir weiß man immer, woran man ist.« Er zögerte. »Darf ich dich etwas fragen?«
»Natürlich.«
»Warum hast du keinen Freund?« Er errötete ein wenig. »Das ist schrecklich indiskret, ich weiß, aber… ich habe mich das schon oft gefragt. Du bist wunderschön, besitzt viel Charme und bist dabei so offen und ehrlich… so fröhlich und unbeschwert – genau das Mädchen, das sich jeder Mann an seiner Seite wünscht.«
Forschend sah sie ihn an. »Du auch?«
Er zögerte, dann nickte er. »Ja, Michaela, ich würde mir ein solches Mädchen wünschen.«
»Dann nimm es dir, Manfred.« Sie atmete tief durch, weil sie dieses Eingeständnis ihrer Liebe viel Mut kostete. »Du bist der Grund, weshalb ich noch immer keinen Freund habe. Vor zwei Jahren habe ich in der Firma angefangen, und seit diesem Tag liebe ich dich, aber gegen Ines hatte ich nie eine Chance. Ich kenne sie… vielmehr, ich habe sie einige Male gesehen. Sie ist wirklich sehr hübsch.«
Fassungslos hatte Manfred ihr zugehört. Auf seine Frage hatte er beinahe mit jeder Antwort gerechnet, aber damit nicht. Es war für ihn vollkommen unverständlich, daß dieses Traummädchen ihn liebte. Was war er denn schon? Ein kleiner Angestellter mit durchschnittlichem Aussehen und eher unterdurchschnittlichem Verdienst.
»Warum ich?« konnte er nach einer Weile des Schweigens fragen. »Meine Güte, dir liegen die bestaussehenden Männer zu Füßen.«
»Liebe fragt nicht nach dem Aussehen«, entgegnete Michaela, dann zuckte sie die Schultern. »Ich kann dir keine Antwort geben, Manfred. Ich liebe dich eben, das ist das Einzige, was ich weiß.«
Manfred schluckte. »Wenn du jetzt von mir erwartest, daß ich dich küsse und dir ebenfalls meine Liebe erkläre, dann muß ich dich leider enttäuschen, Michaela. Ich habe dir vorhin gesagt, daß ich mir ein Mädchen wie dich an meiner Seite wünschen würde, und das ist auch die Wahrheit, aber bis jetzt habe ich dieses Mädchen immer in Ines gesehen. Ich kann nicht eine Freundin als Ersatz für eine andere nehmen. Dafür wärst du auch viel zu schade.«
Da lächelte Michaela. »Genauso habe ich dich eingeschätzt, Manfred, und ich bin froh, daß du so bist.« Sie legte eine Hand auf seine Schulter. »Du mußt dich gefühlsmäßig erst von Ines lösen, dann wirst du bereit für eine neue Liebe sein, und ich kann nur hoffen, daß ich das Ziel dieser Liebe sein werde.«
*
Valerie Doschek war die erste Patientin, die Dr. Daniel an diesem Nachmittag aufsuchte. Sie selbst öffnete ihm die Tür, doch ihr Lächeln kam diesmal nicht von Herzen.
»Es ist sehr nett, daß Sie mich zu Hause besuchen, Herr Doktor«, erklärte sie. »Aber ich wäre auch zu Ihnen in die Praxis gekommen. Ich fühle mich eigentlich recht gut.«
»Körperlich vielleicht«, räumte Dr. Daniel ein, »aber ich sehe Ihnen an, daß Sie die Vorfälle noch längst nicht verarbeitet haben.« Er seufzte. »Es war eine unglückliche Situation, daß Sie ausgerechnet in dieser Klinik gelandet sind.«
»Es gab keine andere Möglichkeit«, meinte Valerie. »Sigrid und ich mußten schnell handeln. Der Wehenschmerz hat mich buchstäblich überfallen, und dann ging das Fruchtwasser ab. Ich hatte Angst, und zudem herrschte in München gerade Stoßzeit.« Sie zuckte die Schultern. »Sicher, im Endeffekt hatte ich noch fast fünf Stunden Zeit, aber das wußte ich ja vorher nicht. Hätte ich es geahnt, dann wäre ich in die Waldsee-Klinik gefahren.« Sie schluchzte auf. »Es war so schrecklich, Herr Doktor. Der Arzt mußte meinen Tobias mit der Saugglocke holen. Er hat jetzt eine fürchterliche Geschwulst am Kopf. Und dann wurde er mir gleich weggenommen, gebadet und angezogen. Nichts lief so, wie Frau Lüder es gesagt hatte… daß mir das Baby auf den Bauch gelegt werden würde und…« Vor lauter Schluchzen konnte sie nicht mehr weitersprechen.
Fürsorglich begleitete Dr. Daniel die junge Frau in ihr Wohnzimmer zu einem der bequemen Sessel, dann setzte er sich ihr gegenüber.
»Zu allererst kann ich Sie beruhigen, Frau Doschek. Diese Geschwulst, die sich bei Ihrem kleinen Sohn durch die Saugglocke gebildet hat, wird in ein paar Tagen wieder verschwinden«, erklärte er. »Dar-über müssen Sie sich keine Sorgen machen. Viel beunruhigender ist Ihr psychischer Zustand. Ich fürchte, wir müssen aufpassen, daß sich diese Geburt nicht zu einem traumatischen Erlebnis entwickelt. Ich weiß, daß in München beinahe alles anders gelaufen ist, als es bei Ihnen zu Hause oder in der Waldsee-Klinik der Fall gewesen wäre, aber Sie dürfen das, was Sie erlebt haben, nicht als typisches Beispiel einer Geburt sehen. Früher standen solche Entbindungen an der Tagesordnung, das heißt, man kannte gar nichts anderes. Wenn Frauen Wehen bekamen, mußten sie sich ins Bett legen. Heute weiß man, daß das grundverkehrt ist. Doch das ist nicht das einzige: Der französische Arzt Frédérick Leboyer hat erkannt, daß man ein Baby durchaus sanft ins Leben bringen kann, ohne ihm dabei zu schaden. Seine Ideen haben sich mittlerweile schon an den meisten Kliniken durchgesetzt, aber einige Ärzte plädieren noch immer für diese veraltete Form des Kinderkriegens, die weder auf die Bedürfnisse der werdenden Mutter noch auf die des Babys ausgerichtet ist. Glücklicherweise sind es nur noch wenige Ärzte, die diese Art der Geburtshilfe verfechten.«
»Und ich mußte ausgerechnet in eine solche Klinik geraten«, murmelte Valerie, dann sah sie Dr. Daniel an. »Ich fürchte, das werde ich niemals vergessen. Ich lag da oben mit gespreizten Beinen und fühlte nur noch die Schmerzen. Das Glück, das andere Frauen bei einer Geburt erleben, ging mir völlig verloren.«
»Ich weiß, Frau Doschek, aber ich kann es leider nicht mehr rückgängig machen, genauso wie ich es nicht verhindern konnte.«
Valerie senkte den Kopf. »Gestern war ich wütend und enttäuscht deswegen. Ich fühlte mich von Ihnen im Stich gelassen, aber heute weiß ich, daß Sie keine andere Wahl hatten. Sie können schließlich nicht in eine fremde Klinik gehen und Forderungen stellen.«
»Gestern hätte ich es gern getan«, gestand Dr. Daniel, dann erhob er sich und ging zu Valerie, um ihr tröstend eine Hand auf die Schulter zu legen. »Was passiert ist, kann ich nicht ungeschehen machen, aber ich werde Ihnen helfen, diese schlimmen Eindrücke zu verarbeiten. Kommen Sie zu mir, wann immer Sie wollen – auch außerhalb meiner Sprechzeiten. Ich werde mir für Sie Zeit nehmen.« Er lächelte. »Und jetzt würde ich gern Ihren kleinen Sohn kennenlernen.«
Da glitt ein glückliches Strahlen über Valeries Gesicht. »Er ist ein ganz herziges Kerlchen.« Sie wurde wieder ernst. »Nur diese Beule macht mir Sorgen.«
»Die sind sicher unbegründet. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, daß die Beule in ein paar Tagen weg sein wird«, erklärte Dr. Daniel, dann folgte er ihr ins Kinderzimmer, wo der kleine Tobias selig schlief.
»Sie müssen übrigens auch an die Vorsorgeuntersuchungen denken«, meinte Dr. Daniel. »Morgen steht schon die U 2 an. Sie wissen sicher, daß in der Kreisstadt ein Kinderarzt ist, aber wenn Sie möchten, können Sie mit Tobias auch zu Frau Dr. Carisi gehen. Sie ist zwar Allgemeinmedizinerin, hat aber in letzter Zeit an vielen Kursen über Kinderheilkunde teilgenommen, weil von einer Landärztin noch mehr erwartet wird als von einem Allgemeinmediziner, der in der Stadt praktiziert.«
»Da bin ich aber froh«, urteilte Valerie. »Frau Dr. Carisi ist eine so nette, freundliche Ärztin. Mein Mann und ich sind ja auch bei ihr in Behandlung.«
»Dann wissen Sie sicher, daß sie ihre Praxisräume jetzt bei mir oben hat.«
Valerie nickte. »Bei meiner letzten Vorsorgeuntersuchung habe ich das neue Schild gesehen, und ich muß gestehen, daß ich ein wenig überrascht war.«
»Diese Gemeinschaftspraxis hat sich direkt angeboten«, meinte Dr. Daniel. »Immerhin sind die Kollegin Carisi und ich die einzigen niedergelassenen Ärzte hier am Ort, und eine Gemeinschaftspraxis erleichtert da einiges. Schließlich ist es gelegentlich vorgekommen, daß Patientinnen an mich überwiesen werden mußten. Jetzt können wir Hand in Hand arbeiten.«
Valerie lächelte. »Stimmt. Auf diese Weise kann ich meine Nachuntersuchungen mit Tobias’ Vorsorgeuntersuchungen verbinden, ohne daß ich von einer Praxis in die andere hetzen muß.«
»Das heißt, wir beide sehen uns dann ebenfalls morgen.«
Valerie nickte. »Allerdings wohl eher zu einem Gespräch.« Sie wurde ernst. »Sie haben vollkommen recht, Herr Doktor. Es wird noch eine Weile dauern, bis ich diese unangenehmen Erlebnisse verarbeitet habe.«
*
Manfred Klein hatte über Mi-
chaelas Worte lange nachgedacht und war schließlich zu dem Schluß gekommen, daß er noch einmal mit Ines reden müsse, um sich über seine Gefühle für sie endgültig klar zu werden. Bisher hatte er geglaubt, sie zu lieben – so sehr, daß ihn keine andere Frau interessieren könnte. Doch jetzt war er sich dessen nicht mehr so sicher.
Ines erschrak, als sie sich Manfred so unverhofft gegenübersah. Gerade hatte sie wieder eine Fieber-attacke überstanden und fühlte sich noch ein wenig geschwächt.
Besorgt sah Manfred sie an. »Fühlst du dich nicht gut, Ines? Du bist ziemlich blaß.«
Abwehrend schüttelte sie den Kopf.
»Alles in Ordnung«, behauptete sie. »Was willst du von mir? Zwischen uns ist alles gesagt.«
»Findest du?« Manfred schwieg einen Moment und fuhr dann fort: »Je länger ich über alles, was du gesagt hast, nachdenke, um so mehr komme ich zur Ansicht, daß das nur Ausreden waren. Das einzige, was vielleicht stimmt, ist, daß du mich nicht mehr liebst. Aber selbst das muß einen Grund haben.«
Ines zögerte, dann nickte sie. »Es hat auch einen Grund. Ich habe mich in Japan verliebt.«
Völlig fassungslos starrte Manfred sie an. »Das glaube ich nicht. Wenn es die Wahrheit wäre, dann wärst du nicht früher als geplant nach Hause gekommen.«
Mit einem tiefen Seufzer ließ sich Ines auf das Sofa fallen.
»Es ist die Wahrheit, Manfred«, erklärte sie. »Ich wollte es mir selbst nicht eingestehen, aber… ich kann Katsumata nicht vergessen. Und meine Beziehung zu ihm war der Grund, weshalb ich so früh aus Japan zurückgekehrt bin. Sein Vater hat mich praktisch hinausgeworfen.« Mit einer fahrigen Handbewegung strich sie ihr dunkles Haar zurück. »Als alles anfing, war es nur ein Flirt. Katsumata gefiel mir, und ich dachte… nein, wahrscheinlich habe ich überhaupt nichts gedacht. Ich ließ mich auf diese Affäre ein, nur… es war auf einmal mehr als eine Affäre. Das habe ich allerdings erst begriffen, als ich wieder zu Hause war.« Offen sah sie Manfred an. »Wenn ich mit dir zusammen war, habe ich an ihn gedacht, und das hast du nicht verdient.«
Schweigend stand Manfred da und wartete darauf, daß Ines’ Worte schmerzen würden, doch das war nicht der Fall. Wirklich weh getan hatte ihre Abreise nach Japan, doch jetzt… im Grunde hatte sie den Schlußstrich, den sie schon gezogen hatte, nur noch einmal wiederholt. Ihre Behauptung, sie müsse Abstand gewinnen, war lediglich ein Hinauszögern des unvermeidlichen Endes gewesen. Das bewies allein schon der Umstand, daß sie fähig gewesen war, sich in Japan zu verlieben.
»Wirst du… zurückgehen?« wollte er wissen.
Ines zuckte die Schultern. »Ich weiß es nicht. Sein Vater wäre sicher nicht sehr erfreut, wenn ich wiederkommen würde. Und ich habe keine Ahnung, wie Katsumata zu unserer Beziehung steht. Er hat zwar einmal erwähnt, daß ich vielleicht die Frau wäre, die er heiraten möchte, aber…« Wieder zuckte sie die Schultern. »Ich weiß nur, daß es für mich keinen anderen Mann mehr geben wird als ihn.«
*
Die Anfälle kamen immer häufiger und wurden von Mal zu Mal stärker. Auch die Erholungsphase dauerte nach jedem Anfall ein bißchen länger, und allmählich bekam Ines tatsächlich Angst. Konnten diese Anfälle noch harmlos sein?
Dabei mußte sie wieder einmal Katsumata denken. Ob er wohl sein Versprechen gehalten hatte und zum Arzt gegangen war? Das hatte sie ihm damals dringend geraten, und jetzt… jetzt war sie in der gleichen Situation und verschwieg ihre Krankheit genauso, wie Katsumata es getan hatte.
»Es ist sicher nur der Streß«, redete sie sich ein. »Die Szenen mit Manfred…«
An jenem Tag, als sie ihm ihre Liebe zu Katsumata gestanden hatte, war er gegangen – traurig und einsam. Ines hatte Mitleid verspürt, aber Mitleid war eben nicht Liebe. Und ihre Liebe zu Manfred gab es nicht mehr – vielleicht hatte es sie nie wirklich gegeben. Doch das mit Katsumata saß tiefer, als sie es sich zuerst hatte eingestehen wollen. Seit sie wieder zu Hause war, dachte sie immer öfter an ihn, und die Sehnsucht nach seinen zärtlichen Händen, seinen sanften, dunklen Augen und seiner tiefen, warmen Stimme schnitt ihr ins Herz. Sie wollte zu ihm zurück – mit allen Konsequenzen. Sogar ein Leben, wie Fujiko es führte, würde sie in Kauf nehmen, um bei ihm zu sein, und das war etwas, was sie sich vor ein paar Wochen noch nicht einmal hätte vorstellen können.
»Katsumata«, murmelte sie flehend, während sie schon wieder von diesem fürchterlichen Schwindel erfaßt wurde. Ihm folgten wieder Schweißausbruch und Fieber, doch diesmal stellten sich auch noch heftige Unterleibsschmerzen ein. Der Fieberanfall war nach einer halben Stunde vorbei, doch die Schmerzen im Unterbauch wurden von Stunde zu Stunde schlimmer. Nach zwei Tagen hielt Ines es nicht mehr aus. Die Schmerzen waren so stark geworden, daß sie sich gezwungen sah, Dr. Daniel aufzusuchen.
»Frau Holbe, wir haben uns ja lange nicht gesehen«, meinte der Arzt mit einem freundlichen Lächeln. »Wie ich hörte, waren Sie eine Weile im Ausland.«
Ines mußte lächeln. »In gewisser Hinsicht ist Steinhausen eben immer noch ein Dorf.« Dann nickte sie. »Aber Sie haben recht, Herr Doktor. Ich war für vier Monate in Japan.«
»Ein ausgesprochen interessantes Land«, urteilte Dr. Daniel. »Der Chefarzt der Waldsee-Klinik, Dr. Metzler, hat sich ein paar Jahre dort aufgehalten und mir eine Menge darüber erzählt.«
»Es ist wirklich faszinierend dort«, stimmte Ines zu, und man konnte ihr die Angst dabei nicht anmerken. »Allerdings ist es nicht ganz einfach, die Mentalität dieser Menschen zu begreifen. Wenn ich nur an Fujiko Nakashida denke… Sie lebt für ihre Kinder und ihren Haushalt. Etwas anderes zählt für sie nicht. Das einzige Interesse ihres Mannes gilt dagegen der Firma, in der er arbeitet. Er ist dort lediglich angestellt, trotzdem könnte man den Eindruck gewinnen, die Firma würde ihm gehören, so sehr engagiert er sich dafür. In den vier Monaten, die ich bei der Familie gelebt habe, habe ich ihn höchstens fünfmal gesehen.«
Dr. Daniel nickte. »So etwas in der Art hat Dr. Metzler auch schon erzählt. Die Standesunterschiede zwischen Männern und Frauen sind dort nach wie vor sehr ausgeprägt.« Dann wechselte er das Thema. »Was führt Sie heute zu mir, Frau Holbe? Die normale Routineuntersuchung oder ein spezielles Problem?«
»Ich habe seit ein paar Tagen ganz schreckliche Unterleibsschmerzen«, bekannte Ines. »Dazu einen unangenehmen Ausfluß, und wenn ich auf die Toilette gehe, brennt es richtig.«
Dr. Daniel nickte, dann stand er auf. »Das muß ich mir ansehen, Frau Holbe.« Er ging ihr voran ins Nebenzimmer und wies auf den dezent gemusterten Wandschirm. »Wenn Sie sich bitte freimachen und dann auf dem Untersuchungsstuhl Platz nehmen.«
Rasch kam Ines dieser Aufforderung nach. Sie wollte das alles jetzt möglichst schnell hinter sich haben, schließlich mußte sie jeden Augenblick mit einem dieser heftigen Anfälle rechnen.
Abgesehen von dem Ausfluß konnte Dr. Daniel auf den ersten Blick keine krankhaften Veränderungen feststellen, also nahm er einen Abstrich und untersuchte ihn unter dem Mikroskop, doch auch hier ergab sich kein Hinweis auf eine Pilzinfektion oder eine Geschlechtskrankheit.
»Haben Sie etwas gefunden?« wollte Ines wissen. »Es ist doch hoffentlich nichts Schlimmes.«
»Tja, Frau Holbe, gefunden habe ich nichts«, entgegnete Dr. Daniel, »aber ich glaube, ich weiß dennoch, was Ihre Beschwerden hervorruft. Es könnte sich um eine Chlamydien-Infektion handeln. Allerdings kann ich das hier in der Praxis nicht so einfach feststellen. Zur genauen Diagnose ist eine Pelviskopie nötig. Das ist eine Untersuchung des tiefen Beckens mit einem Spezialgerät. Dabei kann ich gleichzeitig Abstriche von den Eileitern nehmen.«
»Tut das nicht schrecklich weh?« fragte Ines ängstlich.
»Keine Angst, Frau Holbe, die Untersuchung wird in Vollnarkose durchgeführt«, erklärte er beruhigend, dann griff er nach seinem Terminkalender. »Ich würde vorschlagen, daß wir sie gleich für morgen früh ansetzen. Und bitte ab zehn Uhr abends nichts mehr essen, wegen der Narkose.«
Ines nickte ein wenig halbherzig. Dieser weitere Termin bedeutete für sie, daß sie morgen erneut Gefahr lief, in Dr. Daniels Anwesenheit einen dieser schrecklichen Anfälle zu bekommen. Aber die zweite Untersuchung ließ sich wohl nicht mehr vermeiden.
»Ich werde pünktlich in der Klinik sein«, versprach Ines, dann verabschiedete sie sich und ging nach Hause. Sie erreichte ihre Wohnung keine Sekunde zu früh. Kaum hatte sie die Tür hinter sich geschlossen, als sie auch schon von dem inzwischen altbekannten Schwindel erfaßt wurde.
In der folgenden Nacht und auch am frühen Morgen erlitt sie weitere Anfälle, und ihre Angst, daß diese seltsame Krankheit entdeckt werden könnte, wuchs noch. Mit sehr gemischten Gefühlen ging sie zur Waldsee-Klinik und hoffte inständig, in den nächsten Stunden von diesen gräßlichen Anfällen verschont zu bleiben.
»Sie sind ja überpünktlich«, stellte Dr. Daniel fest, als er der jungen Frau in der Eingangshalle begegnete. »Dann können wir gleich anfangen.«
Der neue Anästhesist, Dr. Jeffrey Parker, stand ebenfalls schon bereit und leitete die Narkose ein, dann nahm Dr. Daniel die Untersuchung vor, die genau den Befund ergab, mit dem er schon gerechnet hatte.
»Es handelt sich tatsächlich um eine Chlamydien-Infektion«, erklärte er, als Ines sich von der Narkose ein wenig erholt hatte. »Ich werde Ihnen ein Antibiotikum verschreiben. Davon nehmen Sie täglich vier Kapseln, und in einer Woche kommen Sie zur Nachuntersuchung. Bis dahin müßten die Beschwerden eigentlich abgeklungen sein.«
Ines nickte. »Danke, Herr Doktor.« Und obwohl ihr die Angst vor einem Anfall im Nacken saß, raffte sie sich zu einer Frage auf. »Wo kann ich mir das geholt haben?«
»Chlamydien werden ausschließlich durch Geschlechtsverkehr übertragen«, antwortete Dr. Daniel. »Falls Sie in letzter Zeit mit jemandem intim waren, sollten Sie ihn über Ihre Erkrankung unterrichten. Möglicherweise ist Ihr Partner sogar die Ansteckungsquelle. Es wäre also für ihn erforderlich, sich ebenfalls untersuchen zu lassen.«
Ines nickte. »Ich werde es ihm sagen.«
Doch dazu kam sie nicht mehr, denn kaum zu Hause angekommen, wurde sie von einem so heftigen Anfall überrascht, daß es ihr unmöglich war, die Wohnung wieder zu verlassen. Mit letzter Kraft konnte sie sich in ihr Bett schleppen, dann schlief sie erschöpft ein. Halb besinnungslos dämmerte sie dahin…
*
Die langen und sehr einfühlsamen Gespräche mit Dr. Daniel taten Valerie Doschek gut. Sie spürte, wie sie allmählich begann, die unangenehmen Erlebnisse der Geburt zu verarbeiten. Natürlich war sie noch meilenweit davon entfernt, das alles wirklich bewältigt zu haben, doch sie fühlte sich wenigstens nicht mehr so elend wie in den ersten Tagen nach der Geburt.
Dazu kamen auch die positiven Erfahrungen mit ihrem kleinen Sohn, denn trotz der widrigen Umstände bei der Geburt hatte sie keine Schwierigkeiten beim Stillen, was ihr Selbstvertrauen ungemein stärkte.
Um so schlimmer war es für sie, als sie plötzlich Schmerzen im Intimbereich bekam. Der Gang zur Toilette wurde die reinste Tortur, und dazu kam das unangenehme Gefühl, als würde sich da unten etwas öffnen. Rasch packte sie Tobias in den Kinderwagen und machte sich auf den Weg zu Dr. Daniel. Dabei wurden ihre Schmerzen schier unerträglich. Valerie hatte das Gefühl, keinen Schritt mehr gehen zu können, doch immer wieder zwang sie einen Fuß vor den anderen, und sie atmete auf, als sie endlich vor Dr. Daniels Praxis stand.
Mit schmerzverzerrtem Gesicht trat sie in den Vorraum, was die Empfangsdame Gabi Meindl erschrocken aufspringen ließ.
»Um Himmels willen, Frau Doschek, was ist denn los?« fragte sie besorgt.
»Ich habe schreckliche Schmerzen«, brachte Valerie mit Mühe hervor.
Fürsorglich nahm Gabi die junge Frau am Arm und führte sie sofort ins Untersuchungszimmer.
»Der Herr Doktor wird sich gleich für Sie Zeit nehmen«, versprach sie, während sie Valerie half, sich auf die Untersuchungsliege zu legen. »Und auf Ihren kleinen Sohn passe ich in der Zwischenzeit schon auf.«
»Danke, Frau Meindl«, erwiderte Valerie mit leiser, schwacher Stimme. »Das ist sehr lieb von Ihnen.«
Impulsiv tätschelte Gabi Valeries Arm. »Ist doch selbstverständlich, Frau Doschek.«
Dann verließ sie das Untersuchungszimmer, doch Valerie blieb nicht lange allein, denn schon wenig später kam Dr. Daniel durch die Zwischentür herein. Sein Blick war besorgt.
»Frau Meindl sagte mir, daß Sie Schmerzen haben.«
Valerie nickte. »Seit heute früh. Jeder Schritt ist eine Qual, und wenn ich auf die Toilette gehe, brennt es ganz fürchterlich. Außerdem habe ich irgendwie das Gefühl, als wäre da unten etwas offen.« Sie zuckte die Schultern. »Das ist komisch ausgedrückt, aber ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll.«
Dr. Daniel nickte. »Ich sehe mir das gleich an, Frau Doschek. Für diese Untersuchung können Sie auch ruhig hier liegenbleiben.«
Er streifte sich Plastikhandschuhe über, während Valerie versuchte, sich freizumachen, was ihr mehr schlecht als recht gelang. Dr. Daniel mußte ihr helfen, doch was er gleich darauf entdeckte, verschlug ihm für einen Moment tatsächlich die Sprache.
»Das ist doch nicht die Möglichkeit«, murmelte er, dann sah er Valerie an. »Ihre Beschreibung war gar nicht schlecht, Frau Doschek. Die Dammnaht, die im Krankenhaus gemacht wurde, ist wieder aufgegangen.«
Valerie erschrak. »Ist das schlimm?«
»Nein, ich werde das gleich in Ordnung bringen«, versicherte Dr. Daniel. »Dazu müssen Sie aber leider in die Waldsee-Klinik, weil Sie eine Narkose benötigen. Haben Sie heute schon etwas gegessen?«
Valerie schüttelte den Kopf. »Durch die Schmerzen war mir der Appetit gründlich vergangen.«
»Gut, dann alarmiere ich jetzt einen Krankenwagen, der Sie in die Klinik bringen wird, und unmittelbar nach Ende meiner Vormittags-Sprechstunde werde ich die Naht noch einmal machen.«
Auf Valeries Gesicht zeigte sich Erleichterung, aber auch eine Spur Ratlosigkeit.
»Wie kann so etwas überhaupt passieren?« fragte sie.
»Dafür gibt es verschiedene Gründe. Vielleicht haben Sie Ihre Rückbildungsgymnastik ein wenig zu intensiv gemacht, oder aber der Dammriß wurde nicht gründlich genug vernäht.«
»Also an der Gymnastik kann es nicht liegen«, meinte Valerie überzeugt. »Damit habe ich nämlich noch gar nicht angefangen. Irgendwie habe ich bisher einfach keine Zeit dafür gefunden.«
Valeries Worte bestätigten Dr. Daniels Verdacht, daß die Naht nur mangelhaft ausgeführt worden war.
»Wie auch immer. Wir werden das jedenfalls innerhalb der nächsten zwei Stunden in Ordnung bringen«, erklärte Dr. Daniel. »Bleiben Sie erst mal hier liegen. Die Sanitäter werden Sie dann abholen, und Ihren kleinen Sohn nehmen sie auch gleich mit. Er kann bei Ihnen bleiben, bis Sie in den Operationssaal gebracht werden. Sie werden nur eine ganz leichte Narkose bekommen, von der Sie sich bestimmt schnell erholen werden.«
Da konnte Valerie endlich wieder lächeln. »Vielen Dank, Herr Doktor. Ich bin ja so froh, daß es Sie gibt.«
*
Als Manfred Klein neben Mi-
chaela Weller erwachte, ergriff ihn etwas wie schlechtes Gewissen. Gestern abend hatte er behauptet, seine Gefühle für Ines seien erloschen, doch das stimmte nicht so ganz. Sie spukte nach wie vor in seinem Kopf herum, und wenn ihm die Trennung von ihr auch keine nennenswerten Schmerzen bereitet hatte, so war er doch noch nicht restlos frei von ihr.
»Guten Morgen, Liebling.«
Michaelas sanfte Stimme riß ihn aus seinen Gedanken. Mit einem zärtlichen Lächeln wandte er sich ihr zu. Ihr langes, dunkles Haar war wie ein Fächer über ihr Kissen gebreitet, und ihre schönen grauen Augen strahlten vor Glück. Spontan beugte sich Manfred über sie und küßte sie. Im selben Moment jagte ein stechender Schmerz in seinen Kopf.
Mit einem leisen Stöhnen griff er sich an den Hinterkopf. »Ich glaube, ich hätte gestern abend dieses dritte Glas Wein nicht mehr trinken sollen.«
Michaela runzelte die Stirn. »Es war aber ein ausgesprochen guter Wein, von dem man eigentlich keine Kopfschmerzen bekommen sollte.« Sanft drückte sie ihn in die Kissen zurück, dann küßte sie ihn. »Du bleibst jetzt schön im Bett, bis ich das Frühstück zubereitet habe. Danach geht es dir sicher besser.«
Das blieb allerdings nur ein Wunsch. Manfreds Kopfschmerzen verstärkten sich noch, es hämmerte und pochte, und nicht einmal die Schmerztablette, die Michaela ihm gab, brachte Erleichterung. Eher das Gegenteil war der Fall. Es schien Manfred, als würden die Schmerzen immer schlimmer werden. Stundenlang lag er regungslos im Bett und hatte das Gefühl, als müsse sein Kopf jeden Moment zerspringen.
Gegen Abend waren die Schmerzen dann von einer Minute zur anderen gewichen. Erschöpft schlief Manfred ein, und als er am nächsten Morgen erwachte, lag ein Zettel auf dem Nachttischchen.
Ich bin in die Firma gefahren und werde Dich für heute krankmelden. Schlaf Dich aus. Ich liebe Dich, Michaela.
Lächelnd blickte Manfred auf die Zeilen, die ihre ganze Liebe widerspiegelten, doch auf einmal begannen sich die Buchstaben vor seinen Augen zu drehen – immer schneller und schneller. Manfred ließ den Zettel fallen und schloß die Augen in der Hoffnung, dieses fürchterliche Schwindelgefühl würde aufhören, doch es wurde nur noch stärker. Und dann brach ihm der Schweiß aus. Sein ganzer Körper wurde glühend heiß, und Manfred hatte das Gefühl, gelähmt zu sein. Er war zu keiner Bewegung fähig und bekam nur noch mit, daß er wie im Schüttelfrost zitterte. Nach einer halben Stunde war der Anfall vorbei.
»Meine Güte, was war das denn?«
Seine eigene Stimme klang fremd und unheimlich in seinen Ohren. Rasch stand er auf, duschte und zog sich an, dann verließ er das Haus. Zögernd blieb er neben seinem Auto stehen und fragte sich, ob es ein Risiko sei, wenn er sich hinter das Steuer setzen würde. Der Anfall, den er gerade durchlitten hatte, gab ihm eine eindeutige Antwort, so daß er sich kurzerhand entschloß, zu Fuß zur Praxis der Allgemeinmedizinerin Dr. Manon Carisi zu gehen. Da es bereits kurz vor Mittag war, befanden sich keine Patienten mehr im Wartezimmer, so daß Manfred gleich ins Sprechzimmer gerufen wurde.
»Guten Tag, Herr Klein«, grüßte Manon freundlich, dann wies sie auf die beiden Sessel, die vor ihrem Schreibtisch standen. »Bitte, nehmen Sie Platz. Was führt Sie zu mir?«
Manfred atmete tief durch. »Wenn ich das so genau wüßte, Frau Doktor. Ich hatte gerade etwas ganz Seltsames.« In wenigen Worten schilderte er seinen Anfall. »Nach einer halben Stunde war alles vorbei, und jetzt fühle ich mich wieder pudelwohl. Hätte mir dieses Erlebnis keine solche Angst eingejagt, wäre ich vermutlich gar nicht zu Ihnen gekommen.« Er senkte den Kopf. »Ich muß gestehen, daß ich mir im Moment ein bißchen dumm vorkomme… nein, nicht dumm, eher wehleidig…«
»Das sind Sie ganz sicher nicht«, entgegnete Manon ernst. »Was Sie mir geschildert haben, klingt tatsächlich besorgniserregend.« Sie überlegte einen Moment. »Und abgesehen von diesem Vorfall haben Sie wirklich keine Beschwerden? Erkältungssymptome oder Kopfschmerzen?«
Manfred schüttelte den Kopf, hielt aber mitten in der Bewegung inne. »Gestern hatte ich ganz schreckliche Kopfschmerzen – beinahe den ganzen Tag. Nicht einmal eine Schmerztablette hat gewirkt. Und am Abend waren sie dann plötzlich weg.«
Manon nickte, dann stand sie auf und kam um ihren Schreibtisch herum.
»Ich werde Sie jetzt untersuchen«, meinte sie. »Vielleicht gibt es eine ganz harmlose Erklärung für das alles. Im Augenblick leiden viele Menschen an den seltsamsten Erkältungsformen – Halsschmerzen, Fieber und Kopfschmerzen, Husten, Schnupfen.«
»Ich weiß nicht. Wie eine Erkältung kam mir das nicht vor.«
Die Untersuchung ergab keinen krankhaften Befund, und normalerweise hätte Manon den Patienten jetzt nach Hause geschickt, doch die Schilderung seines eigenartigen Fieberanfalls gab ihr zu denken.
»Ich mache Ihnen einen Vorschlag, Herr Klein«, erklärte sie. »Anhand meiner Untersuchungsergebnisse würde ich sagen, daß Sie kerngesund sind, aber was Sie heute erlebt haben, kann nicht normal sein, und ich will nicht riskieren, daß sich dahinter irgendeine Krankheit verbirgt, die unerkannt bleiben würde. Ich möchte Sie in die Waldsee-Klinik überweisen. Die Ärzte dort haben ganz andere Untersuchungsmöglichkeiten als ich.«
»Ins Krankenhaus«, murmelte Manfred gedehnt. »Ich weiß nicht so recht. Im Moment fühle ich mich blendend. Vielleicht war es ja nur ein Schwächeanfall. Ich hatte in letzter Zeit ein bißchen viel um die Ohren – sowohl beruflich als auch privat.«
»Ich kann Sie nicht zwingen, in die Waldsee-Klinik zu gehen«, meinte Manon. »Aber ich würde es Ihnen dringend raten. Sie verlieren dadurch vielleicht einen Tag, aber danach wissen Sie, ob Sie gesund sind oder ob Ihnen vielleicht doch etwas fehlt.«
Manfred seufzte. »Also schön. Ich lasse mich untersuchen. Schaden kann es ja in keinem Fall.«
»Das denke ich auch«, meinte Manon, dann griff sie nach dem Telefonhörer, wählte die Nummer der Waldsee-Klinik und ließ sich mit dem Chefarzt verbinden.
»Guten Tag, Herr Kollege, hier ist Manon Carisi«, gab sie sich zu erkennen. »Ich habe Arbeit für Sie. Es handelt sich um einen jungen Mann mit recht eigenartigen Symptomen, die ich nicht einordnen kann. Darf ich ihn zur Klinik hinüberschicken?«
»Selbstverständlich, Frau Kollegin«, antwortete Dr. Metzler ohne Zögern. »Um was für Symptome handelt es sich denn?«
»Ein Schwindel- und Fieberanfall. Im Moment ist der Patient aber beschwerdefrei.«
»Schicken Sie ihn gleich herüber. Ich kümmere mich um ihn.«
Manon bedankte sich, dann legte sie auf. »Sie können sofort in die Klinik gehen. Dr. Metzler erwartet Sie.«
Manfred verabschiedete sich und machte sich auf den Weg zur Waldsee-Klinik. Dabei bereute er schon fast, daß er sich von seiner Angst hatte treiben lassen. Sicher war dieser Anfall nur eine Raktion seines Körpers auf die Querelen mit Ines und seine überstürzte Liebe zu Michaela. Es war doch Unsinn, deshalb einen solchen Aufwand zu machen, aber jetzt war er in der Klinik angemeldet und mußte auch hingehen.
»Na ja, die werden bald feststellen, daß mit mir alles in Ordnung ist«, sagte er zu sich selbst.
Nach einer knappen Viertelstunde erreichte er die Klinik und trat ein. In der Eingangshalle wurde er bereits von einem jungen Arzt erwartet, der sich als Dr. Stefan Daniel vorstellte.
»Dr. Metzler wird sich sofort um Sie kümmern«, versprach er. »Wir können inzwischen schon mal ins Untersuchungszimmer gehen, und dann schildern Sie mir am besten Ihre Beschwerden.«
Manfred unterdrückte nur mit Mühe einen Seufzer, dann erzählte er noch einmal von den eigenartigen Kopfschmerzen, die ihn am Tag zuvor buchstäblich überfallen hatten und ebenso plötzlich wieder weggewesen waren. Er beschrieb den heftigen Schwindel, das Fieber und den Schweißausbruch.
»Dabei hatte ich das Gefühl, als wäre ich vollständig gelähmt«, fügte er hinzu. »Ich konnte während der ganzen Zeit nicht einmal einen Finger rühren, zitterte aber wie im Schüttelfrost.«
»Das klingt ziemlich eigenartig«, meinte Stefan und nahm den Telefonhörer zur Hand. »Ich werde mal sehen, ob Dr. Metzler schon abkömmlich ist.« Er wählte eine Nummer. »Darinka, hier ist Stefan. Ist der Chefarzt noch bei euch oben?« Als die Frage bejaht worden war, setzte Stefan hinzu: »Gib ihn mir mal.« Und dann erzählte er in knappen Worte, was er von Manfred erfahren hatte. Daraufhin erhielt er von Dr. Metzler eine Anordnung, und er wandte sich Manfred wieder zu.
»Waren Sie kürzlich im Ausland? In Asien vielleicht?«
Manfred schüttelte den Kopf.
Stefan gab dies an Dr. Metzler weiter, dann legte er auf.
»Der Chefarzt wird in ein paar Minuten hier sein«, meinte er.
Das war auch tatsächlich der Fall, doch Manfred erschrak sichtlich, als Dr. Metzler mit Mundschutz und Handschuhen hereintrat.
»Meine Güte«, entfuhr es ihm. »Habe ich denn so eine schlimme Krankheit?«
»Ich fürchte, ja«, antwortete Dr. Metzler. »Mit solchen Symptomen bin ich vor ein paar Jahren schon einmal konfrontiert worden. Es tut mir sehr leid, Herr Klein, aber ich muß Sie sicherheitshalber isolieren.«
Aus weitaufgerissenen Augen starrte Manfred ihn an. »Wie bitte? Aber… ich fühle mich doch vollkommen gesund!«
Entsetzt sah er zu, wie sich Stefan Daniel auf Dr. Metzlers Anweisung hin gründlichst die Hände desinfizierte und sich dann ebenfalls einen Mundschutz anlegte. Auch Manfred bekam einen solchen Mundschutz gereicht.
»Ich muß Sie bitten, das vor Mund und Nase zu binden«, erklärte der Chefarzt. »Wir müssen zu einem anderen Zimmer gehen, und ich möchte vermeiden, daß Sie mit irgendwelchen Patienten in Kontakt kommen.«
Wie betäubt kam Manfred dieser Aufforderung nach, dann verließ er gemeinsam mit Dr. Metzler und Stefan das Untersuchungszimmer. Er war so geschockt, daß er gar nicht registrierte, wie Dr. Metzler die Tür hinter sich abschloß.
Auf dem Weg zur Station begegneten sie einer hübschen jungen Krankenschwester.
»Alexandra«, sprach der Chefarzt sie an. »Der Untersuchungsraum im Erdgeschoß muß gründlichst desinfiziert werden. Nehmen Sie sich einen Mundschutz, und ziehen Sie Handschuhe an.«
Die Schwester nickte. Dann warf sie Manfred einen kurzen, fast ängstlichen Blick zu, bevor sie Dr. Metzlers Aufforderung nachkam. Danach wandte sich der Chefarzt Stefan zu.
»Du gehst zu Zimmer einunddreißig und wartest dort, bis ich komme.«
Es war Stefan deutlich anzusehen, daß ihm tausend Fragen auf den Lippen brannten, doch er gehorchte wortlos, weil er spürte, daß er im Moment keine befriedigenden Antworten bekommen würde.
Dr. Metzler und sein Patient setzten ihren Weg fort und erreichten schließlich ein Zimmer, das ein wenig abseits lag.
»Wie lange muß ich hierbleiben?« wollte Manfred wissen.
»Mit zwei oder drei Wochen müssen Sie schon rechnen«, meinte Dr. Metzler.
»Aber ich muß doch in meiner Firma Bescheid sagen und… und…« In seinem Kopf ging jetzt alles durcheinander.
»Dafür haben Sie noch eine Menge Zeit«, fiel Dr. Metzler ihm ins Wort. »Erst mal müssen wir sehen, ob mein Verdacht richtig ist.« Er holte ein Klinikhemd und reichte es Manfred. »Kleiden Sie sich aus, und ziehen Sie das hier an.«
Entsetzt starrte Manfred das weiße, etwa knielange Hemd an. »Das ist ja hinten offen!«
»Richtig. Dadurch werden mir Untersuchung und Behandlung erleichtert. Bitte, Herr Klein, machen Sie mir keine Schwierigkeiten. Sie liegen in nächster Zeit nur im Bett, und da ist es doch völlig gleichgültig, was Sie tragen.«
Manfred nickte ein wenig halbherzig, dann zog er sich aus und schlüpfte in das Klinikhemd.
»Legen Sie sich ins Bett, Herr Klein«, bat Dr. Metzler. »Den Mundschutz können Sie jetzt abnehmen. Außer der Oberschwester und mir wird niemand dieses Zimmer betreten.«
»Ist diese Krankheit denn so ansteckend?«
»Ja, leider. Vorausgesetzt, es handelt sich um den Virus, den ich in Ihrem Körper vermute. Aber das werde ich innerhalb der nächsten halben Stunde herausfinden.«
Dr. Metzler kontrollierte Manfreds Temperatur, doch die war normal. Damit hatte er allerdings schon gerechnet. Der gefährliche Temperaturanstieg würde erst am zehnten Tag nach Krankheitsausbruch erfolgen.
»Ich muß Ihnen jetzt noch Blut abnehmen«, erklärte Dr. Metzler. »Dann sind Sie für den Augenblick erlöst. Dieses Zimmer hier dürfen Sie allerdings unter keinen Umständen verlassen. Wenn Sie etwas brauchen sollten, dann klingeln Sie nach der Schwester.«
Rasch und geschickt erfolgte die Blutabnahme, dann verließ Dr. Metzler das Zimmer, ging in den Nebenraum, um sich zu desinfizieren, und eilte schließlich den Flur entlang. Unterwegs traf er die Oberschwester Lena Kaufmann.
»Auf Zimmer fünfundzwanzig liegt ein Mann mit einer äußerst gefährlichen und ansteckenden Krankheit«, erklärte er. »Lassen Sie niemanden zu ihm, und wenn Sie den Raum betreten, dann nur mit Mundschutz und Handschuhen. Nach Verlassen des Zimmers müssen Sie sich gründlichst desinfizieren. Informieren Sie das gesammte Personal, daß ausschließlich Sie und ich dieses Zimmer betreten dürfen, und hängen Sie ein entsprechendes Schild an die Tür.«
»Wird sofort erledigt«, versprach die Oberschwester, dann beeilte sie sich, Dr. Metzlers Anordnungen auszuführen.
Währenddessen war er selbst ins Ärztezimmer gegangen und hob den Telefonhörer ab. Hastig wählte er die Nummer von Dr. Manon Carisi.
»Frau Kollegin, hier Metzler«, gab er sich zu erkennen. »Kommen Sie sofort zu mir in die Klinik – desinfiziert und mit Mundschutz. Das gleiche gilt für Ihre Sprechstundenhilfe, falls sie mit Herrn Klein in Kontakt gekommen ist. Außerdem will ich jeden Patienten hierhaben, der mit Herrn Klein im Wartezimmer gesessen hat.«
»Meine Güte, das klingt ja gefährlich«, stieß Manon erschrocken hervor.
»Das ist es auch«, bestätigte Dr. Metzler. »Haben Sie seit Herrn Kleins Weggehen mit irgend jemandem Kontakt gehabt?«
Manon verneinte.
»Gut. Dann schließen Sie Ihre Praxis ab, und kommen Sie umgehend hierher. Sie müssen für die nächsten Tage in Quarantäne.«
Dr. Metzler verabschiedete sich knapp, legte auf, hob aber sofort wieder ab, um Dr. Daniel anzurufen.
»Robert, wir haben hier möglicherweise Alarmstufe Rot«, erklärte er ohne Begrüßung. »Wenn ich mich nicht irre, dann kursiert in Steinhausen ein Virus der gefährlichsten Sorte. Den ersten Patienten habe ich gerade bekommen, aber er kann kaum der einzige sein. Er muß sich angesteckt haben, und solange wir die Ansteckungsquelle nicht kennen, ist der ganze Ort gefährdet.«
»Um Himmels willen, Wolfgang, wovon sprichst du da?« fragte Dr. Daniel erschrocken.
»Komm in die Klinik, dann erkläre ich dir alles. Bis dahin habe ich auch die Blutanalyse durchgeführt und endgültige Gewißheit, allerdings besteht für mich nicht der geringste Zweifel, daß der Mann an dieser Krankheit leidet.«
»An welcher Krankheit?«
»Der Name ist sehr schwer auszusprechen, und er würde dir auch nichts sagen. Aber die Krankheit ist lebensgefährlich, und die Heilungschancen sind ab einem gewissen Zeitpunkt äußerst gering.«
*
Nach diesem alarmierenden Anruf hatte Dr. Daniel natürlich nichts Eiligeres zu tun, als zur Waldsee-Klinik hinauszufahren. Dr. Metzler erwartete ihn bereits mit Mundschutz und Handschuhen.
»Es tut mir leid, Robert«, meinte er, »aber solange ich die Ansteckungsquelle nicht kenne, muß ich jeden Kontakt mit anderen vermeiden – sogar mit dir.«
Dr. Daniel war sichtlich entsetzt. »Meine Güte, Wolfgang, was ist das für eine schreckliche Krankheit, und wie kann man sich davor schützen?«
Dr. Metzler seufzte. »Das ist nun gleich die schlechte Nachricht. Es gibt keine Impfung. Jeder, der auch nur entfernt mit dieser Krankheit in Berührung gekommen ist, muß sofort in Quarantäne. Die Kollegin Carisi und ihre Sprechenstundenhilfe sind bereits hier in der Klinik.«
»Manon?!« rief Dr. Daniel erschrocken aus. »Wie um Himmels willen ist sie mit dieser Krankheit in Berührung gekommen?«
»Sie hat den Kranken hierher überwiesen – glücklicherweise.« Dr. Metzler schwieg kurz. »Leider wurde er hier von Stefan in Empfang genommen, so daß ich auch deinen Sohn in Quarantäne schicken mußte.«
Dr. Daniel wurde kalkweiß im Gesicht. »O mein Gott.«
»Es muß nicht sein, daß er sich angesteckt hat«, versuchte Dr. Metzler seinen Freund zu beruhigen. »Aber ich darf hier in der Klinik kein Risiko eingehen. Dieser Virus ist nämlich sehr heimtückisch. Er führt anfangs lediglich zu kurzen Anfällen mit Schwindel, Fieber und Schweißausbrüchen. Vor und nach diesen Anfällen fühlt sich der Betroffene kerngesund, und nicht einmal eine körperliche Untersuchung ergibt einen krankhaften Befund. Nur ein ganz bestimmter Bluttest kann diese Krankheit, die unbehandelt unweigerlich zum Tod führt, nachweisen.«
»Das ist ja schrecklich«, flüsterte Dr. Daniel betroffen, dann sah er Dr. Metzler an. »Wie kommt es überhaupt, daß du so gut darüber Bescheid weißt? Und wie heißt diese Krankheit eigentlich?«
»Ich bin während meiner Zeit in Japan einmal damit in Berührung gekommen. Und wie sie heißt…« Er winkte ab. »In unseren Lehrbüchern wird sie nicht erwähnt, vermutlich kennt man sie in Europa gar nicht. Selbst in Japan hat sie nur einen ellenlangen lateinischen Namen, aber ich denke, wir sollten sie unter uns einfach mal als Asien-Syndrom bezeichnen.«
Unwillkürlich begann Dr. Daniel zu frösteln. Das alles klang wirklich beängstigend.
»Und es ist ganz sicher, daß der Patient an diesem Asien-Syndrom leidet?«
Dr. Metzler nickte. »Daran besteht nicht der geringste Zweifel. Ich habe gerade den Bluttest gemacht, und wenn ich aus der internationalen Apotheke das richtige Medikament bekomme, dann hat er eine Überlebenschance. Während der ersten drei Tage nach Ausbruch der Krankheit können bis zu siebzig Prozent der Betroffenen geheilt werden, zwischen dem vierten und zehnten Tag sind es immerhin noch dreißig Prozent. Aber nach dem zehnten Tag sinkt die Heilungschance auf maximal vier Prozent.«
Dr. Daniel fühlte Übelkeit aufsteigen, wenn er nur daran dachte, daß diese schreckliche Krankheit auch seinen Sohn betreffen und daß sie womöglich in ganz Steinhausen ausbrechen könnte.
»Und… dieser Patient?« fragte er.
»Herr Klein leidet seit gestern an dem Asien-Syndrom«, antwortete Dr. Metzler. »Wenn ich das Medikament bekomme, hat er gute Chancen. Gerrit ist bereits unterwegs nach München, und ich kann nur hoffen, daß er die Infusionslösung auftreibt.«
»Und wenn nicht?«
»Dann muß ich sie direkt aus Japan kommen lassen, aber das kostet Zeit, und ich fürchte…«
»Herr Doktor, schnell, der Patient hat einen Anfall!« rief Oberschwester Lena zur Tür herein. Auch sie trug Mundschutz und Handschuhe.
Im Laufschritt hetzte Dr. Metzler zur Station hinauf, und auch Dr. Daniel folgte ihm. Ohne Aufforderung reichte Oberschwester Lena ihm einen Mundschutz und keimfreie Handschuhe. Hastig streifte Dr. Daniel beides über, dann be-trat er hinter Dr. Metzler das Zimmer.
Manfred Klein lag in seinem Bett, bebte wie im Schüttelfrost, während ihm der Schweiß in Strömen über Gesicht und Körper lief. Mit dem speziellen Fieberthermometer, das auch auf der Intensivstation benutzt wurde, konnte Dr. Metzler den rapiden Temperaturanstieg verfolgen. Auch Dr. Daniel blickte auf die Anzeige, während sich Entsetzen in ihm ausbreitete. Innerhalb weniger Minuten war die Körpertemperatur des Patienten auf 41,5 Grad gestiegen. Der Puls raste, und die Herzfrequenz war so hoch, daß Dr. Daniel jeden Augenblick mit einem Herzversagen rechnete. Doch dann sank das Fieber so rasch, wie es gestiegen war, und nach einer halben Stunde schien der Mann wieder völlig gesund zu sein.
»Das ist ja wie ein übler Spuk«, meinte Dr. Daniel, als er sich zusammen mit Dr. Metzler im Nebenraum desinfizierte. »Ich nehme an, die Patienten sterben am Ende an Herzversagen.«
»Manche schon, vor allem ältere Menschen, deren Herz diesem rapiden Temperaturanstieg nicht mehr standhält«, antwortete Dr. Metzler. »Allerdings ist das, was du jetzt gesehen hast, nur der Anfang. Später kommen die Anfälle immer häufiger, und die Patienten können sich von diesen Strapazen nicht mehr so schnell erholen. Die Erschöpfungszustände nehmen zu, und schließlich beginnt ein kontinuierlich anhaltendes Fieber, das immer mehr ansteigt. Bei etwa vierzig Grad kommt es zum Stillstand, doch während andere Viren bei dieser Temperatur absterben, läuft dieser Virus nun erst zur Höchstform auf und verursacht Lähmungen, die sich allmählich im ganzen Körper ausbreiten. Wenn diese Lähmungen auf das Gehirn übergreifen, kommt es zum Tod, und das ist meistens zwischen dem vierzehnten und sechzehnten Tag der Fall.«
»Das ist ja schrecklich«, meinte Dr. Daniel entsetzt.
Dr. Metzler seufzte. »Mehr als das, Robert, viel mehr als das – vor allem, weil wir nicht wissen, wer diese Krankheit eingeschleppt hat. Ich werde mich jetzt mit dem Gesundheitsamt in Verbindung setzen, und ich fürchte, daß über ganz Steinhausen eine strenge Quarantäne verhängt wird. Dann können wir nur noch hoffen, daß die Krankheit nicht von außerhalb kommt, denn sonst könnte bereits die ganze Region in Gefahr sein.«
*
Obwohl Dr. Daniel von all dem, was Dr. Metzler ihm erzählt hatte, ziemlich geschockt war, vergaß er nicht, daß er noch andere Pflichten hatte. Valerie Doschek wartete drüben in der Gynäkologie darauf, daß ihre Dammnaht wieder geschlossen werden würde.
Als Dr. Daniel die Eingangshalle erreichte, erfuhr er von der Stationsschwester der Gynäkologie, Bianca Behrens, daß der dortige Operationssaal bereits belegt war.
»Frau Dr. Reintaler mußte bei einer Patientin eine Ausschabung vornehmen«, erklärte sie. »Frau Dr. Teirich hat die Anästhesie übernommen.«
Dr. Daniel nickte. »Dann bringen Sie Frau Doschek in die Chirurgie hinüber, und informieren Sie Dr. Parker.«
»Bin schon hier«, meldete sich der sympathische junge Änasthesist, dann wandte er sich mit besorgtem Gesicht Dr. Daniel zu. »Haben Sie von diesem seltsamen Virus gehört, das hier umgehen soll?«
Dr. Daniel nickte seufzend. »Der Chefarzt hat mich gerade informiert. Eine schreckliche Geschichte.«
»Das kann man wohl sagen. Bloß gut, daß sich Wolfgang anscheinend bestens mit dieser Krankheit auskennt.«
»Ja, er hat im Ausland viel Erfahrung sammeln können, die uns hier schon mehrmals zugute gekommen ist«, meinte Dr. Daniel, dann wandte er sich dem Operationssaal zu. »Wir sollten uns allmählich bereit machen.«
Gemeinsam betraten die Ärzte den Operationssaal.
»So, Frau Doschek, in einer halben Stunde ist alles vorbei«, meinte Dr. Daniel lächelnd, während Dr. Parker schon die Narkose einleitete.
»Okay, Robert, Sie können anfangen«, erklärte er.
Von diesem Augenblick an gestattete sich Dr. Daniel keinen Gedanken mehr an die gefährliche Krankheit, die möglicherweise in Steinhausen kursierte, sondern verrichtete gewissenhaft seine Arbeit.
»So«, meinte er dann. »Diese Naht wird mit Sicherheit nicht mehr aufgehen.«
Dr. Parker grinste, was nur an den Fältchen, die sich um seine blauen Augen bildeten, zu erkennen war, weil er hier im Operationssaal ja einen Mundschutz tragen mußte.
»Die in der anderen Klinik hatten wohl keine gute Nähmaschine«, scherzte er.
»Sieht so aus«, stimmte Dr. Daniel zu, dann wandte er sich der OP-Schwester zu. »Petra, bringen Sie die Patientin in den Aufwachraum hinüber. Ich kümmere mich persönlich um sie.«
»Ist in Ordnung, Herr Direktor.«
Dr. Daniel sah ihr nach, dann seufzte er. »Also, diesen Direktor kann ich wirklich nicht mehr hören.«
Dr. Parker nahm seinen Mundschutz ab und lächelte. »Sie sind zu bescheiden, Robert.«
Dr. Daniel mußte lachen. »Ist das nun ein Kompliment, Jeff, oder eher eine Beleidigung?«
»Weder – noch, nur eine Feststellung«, meinte Dr. Parker, dann wurde er ernst. »Ich finde es erstaunlich, aber auch sehr lobenswert, daß ein Mann in Ihrer Position und mit Ihrem Können noch immer so viel Bescheidenheit bewahrt.«
»Jetzt hören Sie aber auf.« Dr. Daniel warf einen Blick auf die Uhr. »Frau Doschek müßte jeden Moment aufwachen.«
Die beiden Ärzte verabschiedeten sich, dann betrat Dr. Daniel den Aufwachraum, holte sich einen Stuhl heran und setzte sich neben Valeries Bett. Es dauerte nur ein paar Minuten, bis sie die Augen aufschlug.
»Wie fühlen Sie sich, Frau Doschek?« wollte Dr. Daniel wissen.
»Na ja… es geht«, brachte Valerie ein wenig mühsam hervor. »Kalt ist mir.«
Fürsorglich breitete Dr. Daniel eine weitere Decke über sie, dann gab er Anweisung, die Patientin wieder auf die Station zu bringen.
»Ich würde vorschlagen, Sie erholen sich noch bis morgen hier bei uns, dann können Sie wieder nach Hause gehen«, meinte er.
Valerie nickte nur. Die Nachwirkungen der Narkose machten sie müde, und so dauerte es nicht lange, bis ihr die Augen zufielen.
»Ich sehe nach der Sprechstunde noch einmal nach ihr«, erklärte Dr. Daniel an die Stationsschwester gewandt, dann verließ er die Klinik und kehrte in seine Praxis zurück.
*
Michaela Weller war erstaunt, als sie von der Arbeit kam und ihre Wohnung verlassen vorfand. Allerdings hatte sie kaum Gelegenheit, sich weiter darüber zu wundern, denn die Kopfschmerzen, die sie schon den ganzen Tag verspürte, wurden jetzt immer schlimmer. Mit Mühe schleppte sie sich ins Schlafzimmer und legte sich ins Bett, doch auch hier ließen die Schmerzen nicht nach.
Irgendwo in der Ferne hörte sie das Telefon klingeln. Sie dachte noch, daß das Manfred sein könnte, doch sie war nicht fähig aufzustehen und den Hörer abzunehmen. In ihrem Kopf hämmerte und pochte es. Sie schloß die Augen, doch der schier unerträgliche Schmerz peinigte sie weiter.
Einmal glaubte sie, die Türglocke gehört zu haben, und dann drangen plötzlich Stimmen an ihr Ohr. Stimmen, die ihren Namen riefen, doch Michaela konnte nicht antworten. Sie schaffte es nicht einmal, die Augen zu öffnen, und so fühlte sie nur, wie sie hochgehoben und weggetragen wurde, während der Schmerz in ihrem Kopf unvermindert weitertobte.
Michaela hörte das Martinshorn des Krankenwagens, fühlte, wie ihre Temperatur gemessen wurde, und spürte dann einen feinen Stich in der rechten Armbeuge, während um sie herum lauter verzerrte, unheimlich klingende Stimmen waren.
Nach einer Zeit, die Michaela wie eine halbe Ewigkeit vorkam, hörten die Kopfschmerzen plötzlich auf. Die junge Frau öffnete die Augen und erkannte, daß sie in einem fremden Zimmer lag. Erstaunt sah sie sich um.
»Sie sind in der Waldsee-Klinik«, erklang neben ihr eine männliche Stimme.
Erschrocken fuhr Michaela herum und betrachtete den Arzt, von dessen Gesicht sie nur die sanften, rehbraunen Augen sehen konnte, weil er einen breiten Mundschutz trug.
»Ich bin Dr. Metzler, der Chefarzt dieser Klinik«, stellte er sich jetzt vor, dann fragte er: »Wie fühlen Sie sich?«
»Gut«, antwortete sie. »Bis vor kurzem hatte ich schreckliche Kopfschmerzen, aber jetzt ist alles wieder in Ordnung. Wahrscheinlich habe ich zu lange vor dem Computer gesessen.«
»Nein, Frau Weller, so harmlos ist die Ursache Ihrer Kopfschmerzen leider nicht«, entgegnete Dr. Metzler. »Sie haben sich mit einer sehr gefährlichen Krankheit angesteckt.«
Michaela fuhr hoch. »Wie bitte? Dann schüttelte sie den Kopf. »Sie müssen sich irren, Herr Doktor. Ich fühle mich ganz hervorragend.«
»Das ist eben die Heimtücke dieser Krankheit«, entgegnete Dr. Metzler. Er wies zu dem Infusionsständer, den man neben Michaelas Bett gestellt hatte. »Über diese Infusion bekommen Sie ein Medikament, das Ihnen helfen wird, aber ich fürchte, Sie werden trotzdem noch einige schlimme Anfälle bekommen. Sie beginnen mit Schwindelgefühl, danach kommen Schweißausbrüche und hohes Fieber. Der ganze Anfall dauert vielleicht eine halbe Stunde. Ich sage Ihnen das alles, damit Sie nicht erschrecken, wenn es soweit ist. Durch das Medikament werden die Anfälle ein bißchen gemildert, und in ein paar Tagen haben Sie es vielleicht schon überstanden.«
Mit vor Schreck geweiteten Augen hatte Michaela dem Chefarzt zugehört.
»O mein Gott«, stammelte sie jetzt. »Was ist denn das für eine Krankheit?«
»Bei uns in Europa kommt sie normalerweise nicht vor, daher hat sie hier auch keinen Namen. Wir nennen sie der Einfachheit halber Asien-Syndrom. Ich selbst bin damit in Japan zum ersten Mal in Berührung gekommen.«
»Japan«, murmelte Michaela. »Heißt das, daß Ines auch krank ist?«
Dr. Metzler runzelte die Stirn. »Ines? Von welcher Ines sprechen Sie?«
»Ines Holbe – die Ex-Freundin meines Freundes«, antwortete Michaela, dann erschrak sie. »Ist Manfred auch krank?«
Dr. Metzler nickte. »Er ist ebenfalls hier in der Klinik, von ihm haben wir Ihren Namen erfahren. Eigentlich wollten wir Sie nur abholen, um Sie in der Klinik unter Quarantäne zu stellen, aber dann ergab eine Blutanalyse, daß Sie ebenfalls schon an der Krankheit leiden.« Er schwieg kurz. »Zurück zu dieser
Ines: Wenn sie die Ex-Freundin von Herrn Klein ist, wie kommen Sie dann darauf, daß sie auch erkrankt sein könnte? Ich denke nicht, daß Herr Klein zu ihr noch immer Kontakt hat.«
»Ines war doch vier Monate lang in Japan«, entgegnete Michaela. »Nach ihrer Rückkehr war sie noch eine Weile mit Manfred zusammen – nicht sehr lange, aber…«
»Danke, Frau Weller«, unterbrach Dr. Metzler sie hastig. »Ich glaube, Sie haben uns sehr geholfen.«
Eiligst verließ er das Zimmer, desinfizierte sich im Nebenraum und wäre beim Hinausgehen beinahe mit Dr. Daniel zusammengestoßen.
»Wir haben höchstwahrscheinlich die Ansteckungsquelle gefunden«, erklärte Dr. Metzler. »Eine gewisse Ines Holbe hat sich vier Monate lang in Japan aufgehalten und womöglich dort angesteckt. Anscheinend grassiert diese Krankheit auch dort gerade wieder.«
»Ines Holbe«, brachte Dr. Daniel mühsam hervor. »Meine Güte…«
»Robert, was ist los?« fragte Dr. Metzler besorgt. »Du bist ja plötzlich ganz blaß.«
»Ines Holbe war vor ein paar Tagen bei mir in der Sprechstunde, und sie war auch hier in der Klinik«, erzählte Dr. Daniel mit fast tonloser Stimme.
»O mein Gott«, stöhnte Dr. Metzler auf. »Das bedeutet, daß der Virus schon überall sein kann. Halb Steinhausen kann bereits damit infiziert sein. Allein in deiner Praxis können sich während dieser Zeit fünfzig Frauen oder mehr angesteckt haben. Und wenn ich mir vorstelle, wie viele Einwohner Steinhausens in der Kreisstadt oder gar in München arbeiten…« Mit einer fahrigen Handbewegung wischte sich Dr. Metzler über die Stirn. »Nicht auszudenken, wenn wir hier eine Epidemie bekommen würden.«
»Ich fürchte, in diesem Fall bleibt uns nichts anderes übrig, als an die Öffentlichkeit zu gehen«, meinte Dr. Daniel. »Wir müssen Hörfunk und Fernsehen alarmieren, ebenso sämtliche Tageszeitungen.«
Dr. Metzler nickte. »Das übernehme ich. Du mußt vorerst in Quarantäne, Robert, ebenso deine Sprechstundenhilfe und deine Empfangsdame. Deine Schwester und Stefan natürlich auch. War Karina während der fraglichen Zeit in Steinhausen?«
Dr. Daniel schüttelte den Kopf. »Glücklicherweise nicht. Es reicht, wenn wir alle betroffen sein könnten. Dabei fällt mir ein, Jeff hat bei Ines Holbe die Anästhesie gemacht. Er ist also auch gefährdet.« Und dann fiel ihm etwas viel Beunruhigenderes ein. »Meine Güte, ich habe heute mittag noch eine Frau behandelt. Valerie Doschek. Ihre Dammnaht ist aufgegangen und ich habe sie unter Narkose wieder geschlossen.«
»Das heißt, daß sie auch in Quarantäne muß«, erklärte Dr. Metzler. »Ich veranlasse sofort, daß sie von der Gynäkologie herübergeholt wird.«
»Die Frau hat ein fünf Tage altes Baby«, wandte Dr. Daniel besorgt ein.
Für einen Moment schloß Dr. Metzler die Augen. »Verdammt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie Kinder oder gar Säuglinge behandelt werden müssen. In Japan wurden alle erkrankten Kinder in eine spezielle Klinik gebracht.«
»Es muß doch nicht sein, daß Frau Doschek und ihr kleiner Sohn sich angesteckt haben«, meinte Dr. Daniel und gab damit seiner letzten Hoffnung Ausdruck.
»Nein, aber wenn die Krankheit bei Ihnen ausbricht, dann fürchte ich, daß zumindest das Baby keine Chance hat.« Dr. Metzler bemerkte die Betroffenheit seines Freundes und legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Ich versuche über die japanische Klinik, an der ich damals gearbeitet habe, etwas über die Behandlung von Kindern herauszubekommen.« Dann brachte er Dr. Daniel in eines der Zimmer, die speziell für diese Fälle geräumt worden waren. »Bei der Menge an Krankheitsfällen, die uns bevorstehen können, wird es wohl besser sein, die gesamte Chirurgie zur Verfügung zu halten. Die Patienten, die hier liegen, können ebensogut in der Gynäkologie untergebracht werden.« Dann wandte er sich Dr. Daniel zu. »Wenn du Kopfschmerzen bekommen solltest, dann mußt du mich unverzüglich benachrichtigen, Robert.«
*
In Steinhausen herrschte Aufruhr. Natürlich hatte man mit Verwunderung bemerkt, daß sämtliche Zufahrtsstraßen hermetisch abgeriegelt worden waren, aber als in den Nachrichten stündlich von einer ansteckenden Krankheit die Rede war, wurden alle nervös.
»Bei den geringsten Anzeichen von Kopfschmerzen begeben Sie sich bitte unverzüglich ins nächste Krankenhaus.«
Sowohl im Fernsehen als auch im Radio wurde dieser Satz in regelmäßigen Abständen wiederholt. Natürlich fand auf die Waldsee-Klinik der reinste Ansturm statt, denn plötzlich glaubte jeder, an der lebensgefährlichen Krankheit zu leiden, doch in über neunzig Prozent der Fälle stellten sich die angeblichen oder wirklichen Kopfschmerzen als harmlos heraus. Allerdings füllten sich die Patientenzimmer der Chirurgie dennoch allmählich mit wirklichen Erkrankten.
Auch aus dem Kreiskrankenhaus und aus etlichen Münchner Kliniken kamen Meldungen über Krankheitsfälle. Dr. Metzler war beinahe mehr am Telefon als bei seinen Patienten, denn schließlich war er der einzige Arzt, der sich mit diesem Asien-Syndrom, wie es nun allgemein genannt wurde, auskannte. Trotzdem schaffte er es, persönlich zu Ines Holbe zu fahren, um auch sie endlich in die Klinik zu holen. Dabei hatte er kaum noch Hoffnung, etwas für sie tun zu können. Diese Befürchtung verstärkte sich noch, als er gewaltsam die verschlossene Tür aufbrechen ließ und die junge Frau wie leblos im Bett liegen sah.
Ines wurde schnellstens in die Waldsee-Klinik transportiert, und hier nahm Dr. Metzler gleich eine erste Untersuchung vor, die zeigte, daß die Erkrankung bei Ines vor ziemlich genau zehn Tagen ausgebrochen sein mußte.
»Sie hat bereits Lähmungserscheinungen an Händen und Füßen«, erzählte er Dr. Daniel. »Jetzt bekommt sie zwar Infusionen, aber sehr viel Hoffnung habe ich nicht.«
Fassungslos schüttelte Dr. Daniel den Kopf. »Meine Güte, warum hat sie die schrecklichen Anfälle nur verschwiegen? Sie mußte doch gespürt haben, daß da etwas nicht in Ordnung war.«
»Für mich ist das auch unbegreiflich«, stimmte Dr. Metzler zu. »Aber es läßt sich nun nicht mehr ändern.« Er schwieg kurz. »Vorhin kam ein Anruf aus Würzburg. Dort sind ebenfalls schon Krankheitsfälle aufgetreten, aber zumindest bis jetzt wurden alle im Frühstadium entdeckt.«
»Dank deines raschen Handelns«, fügte Dr. Daniel hinzu, »und deiner ausgezeichneten Kenntnisse.«
Bescheiden winkte Dr. Metzler ab. »Zufall. Wäre ich nicht etliche Jahre in Japan gewesen, hätte ich von dieser Krankheit ebenfalls keine Ahnung.«
Dr. Daniel mußte trotz der ernsten Lage lächeln. »Ich wußte ja schon immer, daß die Waldsee-Klinik den besten Chefarzt hat, den sie sich wünschen kann.«
»Jetzt hör aber auf«, meinte Dr. Metzler, dann seufzte er. »Ich muß wieder an die Arbeit gehen.«
Doch Dr. Daniel hielt ihn noch einen Augenblick zurück. »Wie lange ist die Inkubationszeit bei dieser Krankheit?«
»Fünf Tage«, antwortete Dr. Metzler. »Wenn bis nächsten Sonntag außerhalb der Kliniken keine Krankheitsfälle mehr auftreten, dann ist die Gefahr gebannt.«
»Hoffen wir das Beste«, murmelte Dr. Daniel, dann setzte er sich auf sein Bett. Die Untätigkeit, zu der er durch die Quarantäne verurteilt war, setzte ihm mehr zu als alles andere. Sein Sohn Stefan, mit dem er das Zimmer teilte, bemerkte es.
»Mir geht’s genauso, Papa«, meinte er. »Ich würde da draußen so gern etwas helfen.« Er seufzte. »Der arme Wolfgang muß sich beinahe zerreißen, und wir können nur hier sitzen und abwarten.«
Dr. Daniel nickte, dann sah er seinen Sohn prüfend an. »Hast du Angst, Stefan? Ich meine, vor dieser seltsamen Krankheit?«
»Ich müßte lügen, wenn ich nein sagen würde«, gab Stefan zu. »Bis jetzt hat es zwar noch keinen Todesfall gegeben, aber die Internationale Apotheke kann gar nicht so viel von dieser speziellen Infusionslösung heranschaffen, wie wir und all die anderen Klinik benötigen. Wolfgang hat sich jetzt schon mit der Klinik in Japan in Verbindung gesetzt, in der er damals gearbeitet hat.«
»Ich weiß«, seufzte Dr. Daniel. »Die Prognosen sind nicht erfreulich. Nach allem, was Wolfgang erfahren hat, muß die Krankheit drüben auch ausgebrochen sein, und da hat es sogar etliche Tote gegeben.«
»Ich fürchte, darauf werden wir hier auch nicht mehr lange warten müssen. Um diese Ines Holbe muß es ja ziemlich schlecht stehen. Wolfgang hält es selbst für äußerst unwahrscheinlich, daß er ihr zum gegenwärtigen Zeitpunkt überhaupt noch helfen kann.«
*
Manfred Klein wurde trotz des Medikaments, das er über die Infusion bekam, noch immer von heftigen Anfällen geschüttelt, und nach einem dieser Fieberschübe konnte er die linke Hand nicht mehr bewegen.
»Seien Sie ehrlich, Herr Doktor, werde ich sterben?« fragte er, und aus seiner Stimme klang tiefe Verzweiflung.
Dr. Metzler zögerte. Welche Antwort sollte er dem Patienten geben? So wie es im Moment bei Manfred aussah, war die Wahrscheinlichkeit, daß er noch geheilt werden würde, denkbar gering. Normalerweise hörten die Anfälle zwei bis drei Tage nach der ersten Infusion auf. Bei Manfred dagegen hatten sie sich eher verstärkt, und nun kam es auch noch zu Lähmungserscheinungen.
»Ich weiß es nicht«, antwortete Dr. Metzler endlich, und das entsprach der Wahrheit. »Aber ich werde alles tun, damit Sie diese Krankheit überleben.«
Manfred nickte zwar, doch sein Gesicht drückte Hoffnungslosigkeit aus.
»Wie geht es Michaela? Michaela Weller? Und Ines Holbe?« wollte er nur noch wissen.
»Frau Weller befindet sich auf dem Wege der Besserung«, antwortete Dr. Metzler, »aber um Frau Holbe steht es sehr ernst. Ich fürchte, bei ihr müssen wir mit dem Schlimmsten rechnen.«
»Sie ist noch nicht mal vierundzwanzig«, murmelte Manfred, dann sah er Dr. Metzler flehend an. »Bitte, Herr Doktor, helfen Sie ihr. Sie darf nicht sterben.«
*
Valerie Doschek wußte kaum, wie ihr geschah, als sie und ihr Baby plötzlich von der Gynäkologie auf die Chirurgie verlegt wurden. Und die Pfleger, die sie in ihrem Bett hinüberfuhren, trugen allesamt Handschuhe und Mundschutz. Auch Valerie hatte man einen Mundschutz angelegt.
»Ich will sofort mit Dr. Daniel sprechen!« verlangte sie, und dabei klangen Angst und Sorge aus ihrer Stimme.
»Es tut mir leid, Frau Doschek, aber das wird nicht möglich sein«, erklärte ein Arzt, von dem Valerie wegen des Mundschutzes nur die Augen sehen konnte. »Ich bin Dr. Metzler, der Chefarzt dieser Klinik.«
»Ich verstehe das alles nicht, Herr Doktor«, erklärte Valerie mit bebender Stimme. »Warum mußte ich plötzlich diesen Mundschutz tragen. Und…«
»Verzeihen Sie, Frau Doschek, es war nicht in meinem Sinn, daß Sie so überrumpelt wurden«, fiel Dr. Metzler ihr mit einfühlsamer Stimme ins Wort. »Aber im Augenblick herrscht hier in der Klinik eine ziemliche Hektik. In Steinhausen sind etliche besorgniserregende Krankheitsfälle aufgetreten, und es ist möglich, daß auch Sie und Ihr Baby mit dem gefährlichen Virus infiziert worden sind. Deshalb muß ich Sie unter Quarantäne stellen. Normalerweise bringen wir mehrere Patienten in einem Zimmer unter, aber mit Rücksicht auf Ihr Baby werde ich veranlassen, daß Sie hier allein bleiben. Es ist durchaus möglich, daß Sie nicht infiziert sind, und dann wollen wir kein unnötiges Risiko eingehen.«
Atemlos hatte Valerie zugehört. In ihrem Kopf drehte sich alles im Kreis.
»Diese Krankheit… gibt es da kein Medikament?« fragte sie ängstlich. »Man hört doch so viel von Antibiotika.«
»Antibiotika greifen nur Bakterien an«, entgegnete Dr. Metzler. »Gegen Virusinfektionen sind sie vollkommen wirkungslos. Aber es gibt ein Medikament, und wenn die Krankheit im Frühstadium erkannt und behandelt wird, stehen die Heilungschancen gar nicht so schlecht.« Daß er noch immer keine Ahnung hatte, wie er Valeries kleinen Sohn im Erkrankungsfall würde behandeln müssen, verschwieg er lieber. »Sollten Sie Kopfschmerzen bekommen, klingeln Sie bitte sofort nach der Schwester.« Dr. Metzler warf dem schlafenden Baby einen Blick zu. »Er kann leider noch nicht sagen, wenn ihm etwas weh tut. Ich werde sicherheitshalber täglich einen Bluttest machen, und Sie melden sich sofort, wenn er unruhig ist oder mehr als gewöhnlich schreit.«
Valerie nickte. Das alles bereitete ihr Angst, vor allem weil sie spürte, daß Dr. Metzler ihr etwas verschwieg.
»Kann ich mit Dr. Daniel sprechen?« wollte sie wissen.
Bedauernd schüttelte Dr. Metzler den Kopf. »Er mußte leider auch in Quarantäne, weil er mit einer der erkrankten Personen in Kontakt gekommen ist. Aber Sie könnten ihn anrufen.« Er schrieb drei Zahlen auf ein Blatt Papier. »Das ist die Nummer seines Apparats. Möglicherweise meldet sich auch sein Sohn.«
Dankbar nahm Valerie den Zettel entgegen. »Vielen Dank, Herr Doktor.« Sie wurde ein wenig verlegen. »Bitte, fassen Sie es nicht als mangelndes Vertrauen auf, aber…« Sie stockte, wußte nicht, wie sie das, was sie fühlte, erklären sollte.
»Ich weiß schon, Frau Doschek«, meinte Dr. Metzler. »Ich bin ein Unbekannter für Sie, außerdem befinden Sie sich durch die gerade überstandene Schwangerschaft in einer gewissen Ausnahmesituation. Machen Sie sich also keine weiteren Gedanken.« Er lächelte, was nur an den kleinen Fältchen zu erkennen war, die sich um seine Augen bildeten. »Sprechen Sie mit Dr. Daniel, wenn Ihnen danach ist. Ich bin sicher, daß er sich um Sie schon große Sorgen machen wird.«
Damit hatte Dr. Metzler recht. Gerade um Valerie war Dr. Daniel sehr besorgt, und so war er direkt erleichtert, als sie ihn anrief.
»Frau Doschek, es tut mir furchtbar leid«, meinte er. »Aber bis vor ein paar Stunden hatte ich noch keine Ahnung, daß ich mit einer der infizierten Personen in Kontakt gekommen bin. Ungücklicherweise hat die Frau ihr Leiden bis zuletzt verschwiegen. Nur durch zwei weitere Krankheitsfälle wurden wir darauf aufmerksam.«
»Sie haben keinen Grund, sich zu entschuldigen«, entgegnete Valerie. »Es ist nur… ich habe Angst, Herr Doktor. Diese Krankheit, von der ich nichts weiß… und Tobias… er ist noch so klein…«
»Ich kann mir gut vorstellen, daß Sie da Angst haben«, meinte Dr. Daniel. »Aber es mußte ja nicht sein, daß Sie sich infiziert haben, und wenn doch, dann können Sie versichert sein, daß Sie in Dr. Metzler den besten Arzt haben, den Sie sich wünschen können. Er ist mit dieser Krankheit gut vertraut.«
»Danke, Herr Doktor«, erklärte Valerie, und ihrer Stimme war die Erleichterung deutlich anzuhören. »Ihre Worte haben mich sehr beruhigt.«
*
»Es ist schon seltsam«, meinte Dr. Daniel. »Da habe ich fast den ganzen Tag nichts anderes getan, als hier herumzusitzen, und trotzdem bin ich müde.«
Stefan nickte. »Mir geht’s ähnlich. Allerdings hatte ich heute vormittag ja noch Dienst, und du hast ebenfalls den halben Tag in der Praxis gearbeitet.«
Dr. Daniel seufzte. »Ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Vielleicht bin ich jetzt auch noch für ein paar weitere Krankheitsfälle verantwortlich.«
»Unsinn, Papa«, entgegnete Stefan energisch. »Wenn überhaupt jemand dafür verantwortlich ist, dann diese junge Frau, die ihre Krankheit verschwiegen hat.« Stefan zuckte die Schultern. »Vielleicht hielt sie diese Anfälle zuerst für harmlos, und später war sie dann zu sehr geschwächt, um etwas zu unternehmen.«
Bedächtig wiegte Dr. Daniel den Kopf hin und her. »Immerhin hielt Herr Klein seinen ersten Anfall für ernst genug, um sich von Manon untersuchen zu lassen. Und Frau Holbe muß ja etliche dieser Anfälle gehabt haben.« Er seufzte. »Jetzt kann man ohnehin nichts mehr ändern.«
Stefan legte sich im Bett zurück. »Vielleicht sollten wir schlafen, dann hat man wenigstens das Gefühl, die Zeit würde ein bißchen schneller vergehen. Meine Güte, bis Sonntag will uns Wolfgang hier einsperren. Mir kam dieser halbe Tag schon wie eine Ewigkeit vor.«
»Mir auch«, stimmte Dr. Daniel zu. »Aber die Quarantäne ist nun mal notwendig, damit sich diese schreckliche Krankheit nicht noch weiter ausbreitet.«
»Ich weiß schon. Also, gute Nacht, Papa.«
»Gute Nacht, mein Junge.«
Doch Dr. Daniel lag noch lange wach und starrte in die Dunkelheit. Es war bestimmt schon nach Mitternacht, als er endlich einschlafen konnte. Dann aber schlief er so tief, daß er den leise pochenden Schmerz in seinem Kopf nicht fühlte. Und als er davon doch endlich erwachte, war der Schmerz bereits so schlimm, daß er zu keiner Bewegung mehr fähig war. Er wollte nach der Nachtschwester klingeln, doch er konnte nicht einmal einen Finger rühren. Der Schmerz lähmte ihn förmlich.
O mein Gott, dachte er verzweifelt. Jetzt geht es bei mir auch los.
Er wußte, daß ein einziges Wort seinen Sohn, der im Nebenbett schlief, geweckt hätte, doch nicht einmal ein Stöhnen kam über seine Lippen. Er war dem schier unerträglichen Schmerz in seinem Kopf hilflos ausgeliefert. Fast wie von selbst schlossen sich seine Augen, und er hoffte inständig, daß der Morgen bald kommen würde.
*
Als Stefan Daniel erwachte, sah er seinen Vater seltsam starr im Bett liegen. Erschrocken fuhr er hoch.
»Papa, was ist los?« fragte er und sprang gleichzeitig aus dem Bett.
Sein Vater gab keine Antwort. Er lag mit geschlossenen Augen da und bewegte sich nicht einmal. Nur das ständige Zucken auf seinem Gesicht verriet, daß er entsetzliche Schmerzen haben mußte.
Stefan wußte, wie groß die Ansteckungsgefahr war, trotzdem beugte er sich jetzt über seinen Vater, streichelte dessen dichtes blondes Haar und flehte leise: »Bitte, Papa, sag doch etwas.«
Aber Dr. Daniel konnte nichts sagen. Er hörte die Stimme seines Sohnes, wollte ihn vor der Ansteckungsgefahr warnen und bitten, Wolfgang zu verständigen, doch er schaffte es nicht einmal, die Augen zu öffnen.
Allerdings begann auch Stefan jetzt wieder klar zu denken und wußte, was er zu tun hatte. Lang und anhaltend drückte er den Klingelknopf, der die Oberschwester alarmierte. Lena Kaufmann hielt sich gar nicht damit auf, in das Zimmer von Dr. Daniel und Stefan zu gehen, sondern informierte sofort den Chefarzt. Dieser nahm sich gerade noch Zeit, den Mundschutz anzulegen und Handschuhe überzustreifen, dann betrat er eilig den Raum. Ein Blick auf Dr. Daniel genügte ihm, um Bescheid zu wissen.
»So ein Mist!« entfuhr es ihm. »Seit wann hat er die Schmerzen schon?«
Stefan zuckte die Schultern. Er war den Tränen nahe. »Ich weiß es nicht, Wolfgang. Gestern abend haben wir uns noch unterhalten, und heute früh… als ich aufwachte, lag er reglos im Bett.« Mit nahezu flehendem Blick sah er den Chefarzt an. »Du mußt ihm helfen, Wolfgang! Mein Vater darf an dieser Krankheit nicht sterben!«
»Keine Panik, Stefan«, entgegnete Dr. Metzler beruhigend. »Das Medikament hat bis jetzt noch bei jedem Patienten gewirkt.« Und dabei verschwieg er, daß Ines Holbe an der Schwelle zwischen Leben und Tod stand und daß auch bei Manfred Klein die Chancen auf Heilung immer geringer wurden.
»Für dich lasse ich gleich ein anderes Zimmer herrichten«, fuhr Dr. Metzler fort, und dabei bereute er schon fast, daß er mehrere Personen zusammen in einem Raum untergebracht hatte. Allerdings hatte er bei den doch recht begrenzten Möglichkeiten der Waldsee-Klinik gar keine andere Wahl gehabt.
»Kommt nicht in Frage«, wehrte Stefan sofort ab. »Ich bleibe hier!«
»Nein, mein Freund, du tust, was ich sage«, erklärte Dr. Metzler streng. »Es wäre Wahnsinn, dich hierzulassen. Jede Sekunde, die du ungeschützt bei deinem Vater verbringst, erhöht die Gefahr der Ansteckung.«
»Ich kann doch…«
»Nein!« fiel Dr. Metzler ihm ins Wort. »Dein Vater würde mich vierteilen, wenn ich dir das durchgehen ließe. Du kommst umgehend in ein anderes Zimmer, und dann können wir nur hoffen, daß die Krankheit bei dir nicht auch noch ausbricht.«
Stefan sah ein, daß er sich fügen mußte, dabei fiel es ihm unsagbar schwer, seinen Vater gerade jetzt allein zu lassen. Doch Dr. Metzler gab ihm keine Gelegenheit mehr, die Diskussion fortzusetzen, sondern brachte den jungen Assistenzarzt persönlich ins Nebenzimmer.
»Du hast hier ein Telefon, Stefan, also kannst du deinen Vater jederzeit anrufen«, erklärte Dr. Metzler. »Es kann sich höchstens noch um ein paar Stunden handeln, bis die Kopfschmerzen weg sind, dann kann er dir bestätigen, daß das, was wir getan haben, richtig war. Wir dürfen die Ansteckung nicht auch noch provozieren.«
Mit einer fahrigen Handbewegung strich sich Stefan über die Stirn. »Ich weiß schon, Wolfgang, aber… es geht um meinen Vater. Ich habe Angst… ich… ich will ihn nicht verlieren.«
»Ich werde für ihn tun, was ich kann«, versprach Dr. Metzler, klopfte Stefan aufmunternd auf die Schulter und verließ dann den Raum, um bei Dr. Daniel die Behandlung einzuleiten.
»Ich weiß, daß du mich hören kannst, Robert«, erklärte er, während er die Infusionsflasche auf den Ständer hängte und das Infusionsbesteck bereitlegte. »Die Schmerzen werden bald vergehen. Rein gefühlsmäßig würde ich sagen, daß sie nicht mehr länger als zwei Stunden andauern werden. Ich weiß, daß das für dich im Moment ganz furchtbar klingen muß, aber einen anderen Trost kann ich dir nicht bieten.« Er legte einen Gurt um Dr. Daniels Oberarm. »Ich muß dir jetzt ein bißchen Blut abnehmen.« Rasch und geschickt führte Dr. Metzler die Blutabnahme durch und legte dann das gefüllte Röhrchen zur Seite. »So, Robert, nun muß ich dir zusätzlich zu deinen Kopfschmerzen auch noch ein bißchen weh tun. Das Einführen der Infusionskanüle wird wohl etwas schmerzhaft sein.«
Sehr gewissenhaft betrachete Dr. Metzler den Unterarm seines Patienten, wählte eine Vene aus und setzte dann die Nadel an.
»Nicht erschrecken, Robert, jetzt tut’s ein bißchen weh«, erklärte er und stach gleichzeitig in die Vene ein, dann zog er die Nadel vorsichtig zurück, während er die Kanüle weiter in die Vene vorschob. Er fixierte sie mit Heftpflaster, schloß die Infusion an und regelte die Tropfgeschwindigkeit.
»Das war’s fürs erste«, meinte er. »Mehr kann ich im Augenblick nicht für dich tun. Ich muß jetzt noch nach den anderen Patienten sehen, dann komme ich wieder zu dir.«
Er warf Dr. Daniel einen letzten Blick zu, bevor er das Zimmer verließ. Einen Moment blieb er auf dem Flur stehen. Er fühlte sich müde und erschöpft. Seit Tagen arbeitete er praktisch nur noch in Doppelschichten, schlief ein paar Stunden auf der Untersuchungsliege im Ärztezimmer und arbeitete dann weiter.
Mit einem tiefen Seufzer stieß er sich schließlich von der Wand ab und setzte seinen Weg fort. Seine Patienten brauchten ihn.
*
Bei der Allgemeinmedizinerin Dr. Manon Carisi und ihrer Sprechstundenhilfe konnte die Quarantäne aufgehoben werden. Doch Manon erschrak zutiefst, als sie erfuhr, daß Dr. Daniel an dem Asien-Syndrom erkrankt war.
»Sie können ihm doch helfen, oder?« stieß sie besorgt hervor.
Dr. Metzler zögerte. »Ich hoffe es.« Er seufzte tief auf. »Das Medikament, das in Japan entwickelt wurde, ist erstklassig, und in den meisten Fällen hilft es, vor allem, wenn die Krankheit im Frühstadium entdeckt wird. Aber manchmal…« Er zuckte die Schultern. »Ich weiß nicht, woran es liegt, daß das Medikament gelegentlich total versagt. Zum Beispiel bei Herrn Klein, den Sie ja an mich überwiesen haben. Obwohl er vom ersten Tag an Infusionen bekommen hat, verschlechtert sich sein Zustand ganz rapide.« Niedergeschlagen fuhr er sich durch die dichten dunklen Locken. »Ich weiß bald nicht mehr weiter.«
Mitleid stieg in Manon hoch. In der Sorge um Dr. Daniel war ihr nicht gleich aufgefallen, wie abgekämpft Dr. Metzler aussah. Impulsiv legte sie ihm eine Hand auf die Schulter.
»Herr Kollege, wenn ich Ihnen helfen kann…«
»Wolfgang«, berichtigte er. »Sagen Sie nur Wolfgang zu mir, das ist einfacher. Und für Ihr Angebot, mir zu helfen, danke ich Ihnen, aber… ich weiß nicht, was Sie tun können.«
»Hören Sie zu, Wolfgang, Sie sind völlig übermüdet«, stellte Manon fest. »Sie werden sich jetzt ein bißchen hinlegen und schlafen.«
»Aber wenn ein Krankheitsfall auftritt…«, entgegnete Dr. Metzler ohne rechte Überzeugung.
»Was nützt es Ihren Patienten, wenn Sie zusammenbrechen?« entgegnete Manon ernst. »Sollte es zu einem weiteren Krankheitsfall kommen, bin ich bestimmt in der Lage, Sie zu wecken. Im übrigen könnten Sie mir auch zeigen, was in einem solchen Fall zu tun ist. Immerhin bin ich ja Ärztin und durchaus in der Lage, eine Infusion zu legen.«
»Damit würden Sie sich erneut in Gefahr begeben«, wandte Dr. Metzler ein, doch Manon zuckte die Schultern. »Mit Mundschutz und Handschuhen ist die Gefahr nicht sehr groß.«
»Also schön«, stimmte Dr. Metzler zu. »Wahrscheinlich haben Sie recht. Ein bißchen Schlaf könnte mir wirklich nicht schaden, und im Grunde können wir für die Erkrankten ohnehin nicht viel tun. Es kommt eigentlich nur darauf an, ob das Medikament wirkt oder nicht.«
Weiter kam Dr. Metzler nicht mehr, denn die Oberschwester lief in heller Aufregung auf ihn zu.
»Herr Doktor, Frau Doschek und ihr Baby!« stieß sie hervor.
»Nein! Um Himmels willen, nein!«
Im Laufschritt folgte Dr. Metzler der Oberschwester und legte sich nebenbei den Mundschutz an. Manon tat es ihm gleich und betrat unmittelbar nach ihm das Patientenzimmer.
»Die Kopfschmerzen werden immer schlimmer«, brachte Valerie Doschek mühsam hervor, während der kleine Tobias in seinem Bettchen aus Leibeskräften schrie.
Dr. Metzler half der jungen Patientin, sich ins Bett zu legen. In der Zwischenzeit holte Manon das Baby und wiegte es zärtlich in den Armen, doch sein Schreien ließ nicht nach. Es war offensichtlich, daß der Kleine Schmerzen hatte.
»Tobi«, flüsterte Valerie und streckte beide Arme nach ihrem Kind aus, doch dann sackten sie langsam nach unten.
Erschüttert sah Manon zuerst die junge Frau, dann Dr. Metzler an.
»Was ist mit ihr?« wollte sie wissen.
»Die Schmerzen lähmen den gesamten Körper«, erklärte Dr. Metzler. »Die Patienten sind nicht mehr fähig, sich zu bewegen oder auch nur zu sprechen.«
Wie zur Bestätigung für seine Worte verwandelte sich das Schreien des Babys allmählich in ein klägliches Wimmern und verstummte schließlich ganz. Manon hielt das wie leblos wirkende Baby in den Armen und hätte weinen mögen vor Mitleid und innerer Qual.
Währenddessen sprach Dr. Metzler beruhigend auf Valerie Doschek ein und erklärte ihr jeden Handgriff, den er vornahm. Dann war die Infusion angeschlossen, und Manon legte das Baby ins Bett zurück, weil sie davon ausging, daß sich Dr. Metzler auch um den kleinen Jungen kümmern würde. Um so erstaunter war sie, als er ihr bedeutete, das Zimmer zu verlassen.
»Was geschieht mit dem Kind?« wollte Manon wissen.
Dr. Metzler zuckte die Schultern. »Wenn ich das richtig dosierte Medikament nicht rechtzeitig bekomme, dann wird es sterben.« Verzweifelt schlug er die Hände vors Gesicht. »Ich habe hier alles, was ich für Erwachsene und Kinder brauche, aber ein sieben Tage alter Säugling… Vor drei Tagen, als die Frau und ihr Baby in Quarantäne gekommen sind, habe ich in Japan das passende Medikament angefordert… für alle Fälle. Und jetzt… ich kann nur warten und hoffen.«
Doch Manon schüttelte den Kopf. »Ich fürchte, das ist nicht genug, Wolfgang. Wir müssen etwas tun – für dieses Baby, für Herrn Klein und für die junge Frau, die der Auslöser dieser ganzen Krankheitswelle gewesen ist.«
»Ines Holbe«, murmelte Dr. Metzler, dann schüttelte der den Kopf. »Ich glaube nicht, daß es für sie noch eine Rettung gibt.«
»Wir werden kämpfen, Wolfgang – bis zuletzt«, erklärte Manon nachdrücklich, dann legte sie beide Hände auf Dr. Metzlers Schultern. »Sie sind erschöpft und mit Ihrer Kraft am Ende. Das ist nach allem, was Sie in letzter Zeit getan haben, ganz natürlich. Aber ich bin sicher – wenn Sie dieser Schwäche jetzt nachgeben und jegliche Hoffnung fahren lassen, dann werden Sie es irgendwann bereuen. Wolfgang, es kann sich doch nur noch um ein paar Tage handeln, bis diese ganze schreckliche Geschichte ausgestanden ist – so oder so. Aber in diesen Tagen sollten wir kämpfen… mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen.«
Es war, als hätten diese Worte Dr. Metzler wachgerüttelt. Plötzlich fühlte er, wie ein Teil seiner ursprünglichen Kraft zurückkehrte, und damit erwachte auch seine Entschlossenheit wieder.
»Sie haben recht, Manon, wir werden kämpfen«, erklärte er, dann steuerte er das Labor an. »Kommen Sie mit, wir kümmern uns zuerst um das Baby.«
Gemeinsam werteten sie die Blutproben aus, verglichen die der Erwachsenen mit denen des Babys und stellten fest, daß doch gewisse Unterschiede vorhanden waren.
»Wenn wir den Wirkstoff mit Kochsalzlösung strecken, dann könnte er noch stark genug sein, um die Krankheit zu bekämpfen, ohne dem Baby einen Schaden zuzufügen«, meinte Dr. Metzler, dann sah er Manon an. »Was sagen Sie? Sollen wir es versuchen?«
Manon erwiderte seinen Blick. »Haben wir denn eine andere Wahl? Wenn wir abwarten, bis das Medikament aus Japan kommt, dann könnte es für den Jungen schon zu spät sein, oder wissen Sie, wie die Krankheit bei einem so kleinen Kind verläuft?«
Dr. Metzler schüttelte den Kopf. »Keine Ahnung. Aber wenn ich mir den Krankheitsverlauf vor Augen halte, dann kann ich mir durchaus vorstellen, daß ein Säugling sehr viel schneller in einen lebensbedrohlichen Zustand gerät als ein Erwachsener.« Entschlossen stand er auf. »Wir versuchen es.«
Als sie das Zimmer betraten, lagen Valerie Doschek und ihr Baby noch immer regungslos in ihren Betten.
»Das sieht irgendwie gespenstisch aus«, flüsterte Manon.
Dr. Metzler nickte. »Es ist eine grauenhafte Krankheit. Allein die Kopfschmerzen müssen den Patienten schon halb wahnsinnig machen. Sie hören und fühlen alles, können aber weder sprechen noch sich bewegen. Und dabei tobt ein Schmerz in ihrem Kopf, der sich nicht beschreiben läßt. Allerdings sind die nachfolgenden Fieberschübe nicht viel angenehmer, und sie stellen darüber hinaus auch eine extreme Belastung für den Kreislauf dar.«
Während er gesprochen hatte, hatte er schon alles für die Infusion bei dem kleinen Tobias vorbereitet.
»Armes Würmchen«, murmelte er. »Nun hast du schon schreckliche Kopfschmerzen, und das Legen der Infusion wird dir sicher auch noch weh tun.«
Da nahm Manon den Kleinen liebevoll in die Arme. »In dieser Geborgenheit wird es für ihn vielleicht ein bißchen leichter sein.«
Dr. Metzler sah sie an, dann lächelte er. »Robert hat recht. Sie sind nicht nur eine erstklassige Ärztin, sondern auch eine äußerst warmherzige Frau.«
Ein wenig verlegen zuckte Manon die Schultern. »Ich liebe Kinder, aber leider war es mir nicht vergönnt, selbst welche zu haben.«
»Robert hat erwähnt, daß Sie sehr früh Witwe geworden sind.«
Manon nickte nur, und Dr. Metzler spürte, daß es für sie schmerzlich war, über dieses Thema zu sprechen.
»Na, dann wollen wir mal«, lenkte er daher ab und streichelte noch einmal zärtlich über das kleine Köpfchen von Tobias, ehe er die Infusion legte.
»Jetzt heißt es abwarten und hoffen«, meinte er schließlich, dann sah er Manon an. »Danke.«
»Wofür?«
»Dafür, daß Sie mir den Mut wiedergegeben haben.«
*
Völlig erschöpft lag Dr. Daniel in seinem Bett. Gerade hatte er wieder einen dieser fürchterlichen Fieber-anfälle gehabt. Den dritten innerhalb von zwei Stunden. Mühsam drehte sich Dr. Daniel zur Seite, um an den fahrbaren Nachttisch zu gelangen. Er fühlte sich durstig, doch als er nach dem Wasserglas greifen wollte, bemerkte er mit Entsetzen, daß ihm seine rechte Hand nicht mehr gehorchte. Er konnte zwar den Arm heben, doch die Finger blieben bewegungslos.
Mit der anderen Hand begann Dr. Daniel nun, seine Finger zu massieren, doch ohne Erfolg. Die rechte Hand blieb gefühllos.
»Nein, bitte nicht«, flehte Dr. Daniel verzweifelt. Er wußte genau, was diese erste Lähmungserscheinung bedeutete. Es war der Anfang vom Ende – einem grauenhaften Ende!
Gerade als er mit der linken Hand die Klingel betätigen wollte, öffnete sich die Tür, und sein Sohn kam herein.Obwohl er Mundschutz und Handschuhe trug, erschrak Dr. Daniel.
»Stefan, du darfst doch gar nicht…«
»Egal«, fiel sein Sohn ihm ins Wort. »Ich mußte dich einfach sehen. Wie geht’s dir, Papa?«
Dr. Daniel streifte seine gelähmte rechte Hand mit einem kurzen Blick. »Nicht sehr gut, mein Junge.« Er zögerte, entschloß sich dann aber zur Wahrheit. Schließlich würde es noch einiges zu regeln geben, wenn er wirklich unaufhaltsam auf den Tod zusteuern sollte. »Anscheinend gehöre ich zu den Menschen, bei denen das Medikament nicht wirkt.«
Aus weitaufgerissenen, erschrockenen Augen starrte Stefan ihn an. Er war nicht fähig, auch nur ein Wort zu sagen.
»Hör zu, mein Junge, du mußt jetzt sehr stark sein«, fuhr Dr. Daniel fort. » Ich weiß von Wolfgang, daß die erste Lähmungserscheinung nur der Anfang ist. Aber jetzt wird es wohl ziemlich schnell gehen. Die Fieberanfälle werden sich häufen, und mit jedem Mal wird die Lähmung wachsen. Es wird sich wohl nicht vermeiden lassen, daß du…«
»Nein!« begehrte Stefan auf. Es hatte eine Weile gedauert, bis er begriffen hatte, was sein Vater ihm beibringen wollte. »Du darfst nicht sterben! Wolfgang muß dir helfen! Ich lasse nicht zu, daß du…«
»Himmel noch mal, was tust du denn hier?«
Dr. Metzlers tiefe Stimme ließ Stefan herumfahren, aber noch bevor er ein Wort sagen konnte, setzte der Chefarzt mit unüberhörbarer Strenge hinzu: »Mach sofort, daß du in dein Zimmer hinüberkommst! Oder willst du den Virus in der ganzen Klinik verteilen?«
»Mein Vater stirbt!« stieß Stefan mit tränenerstickter Stimme hervor. »Er stirbt, und du tust nichts dagegen!«
Diese Worte schockten Dr. Metzler so sehr, daß er sekundenlang sprachlos war. Doch gerade als er zu einer heftigen Erwiderung ansetzte, erlitt Dr. Daniel wieder einen Anfall.
»Wolfgang«, brachte er mühsam hervor. »Das ist schon… der vierte… innerhalb…« Er konnte nicht mehr weitersprechen.
»Tu doch etwas!« fuhr Stefan den Chefarzt an.
Dieser wandte sich ihm zu. »Ja, Stefan, ich werde etwas tun.«
Er verließ eilig das Zimmer und kam kurz darauf mit einer vorbereiteten Spritze zurück, und ehe sich Stefan versah, hatte Dr. Metzler seinen Oberarm freigemacht, desinfiziert und mit einem kurzen Ruck die Nadel in den Muskel gestochen.
»Was tust du da?« fragte Stefan verwirrt.
»Ich bin dabei, dich ruhigzustellen«, erklärte Dr. Metzler, dann brachte er Stefan in sein Zimmer zurück. »Nun, junger Mann, fühlst du dich wieder besser?«
Das Beruhigungsmittel wirkte schnell und ermüdete Stefan.
»Papa stirbt«, brachte er mit Mühe hervor. »Er stirbt, und du…« Mit letzter Kraft bäumte er sich auf, ergriff Dr. Metzler am Kragen seines Arztkittels und schüttelte ihn. »Ich werde dir niemals verzeihen, wenn du ihn einfach sterben läßt.« Fast unmittelbar danach sank er zurück und schlief ein.
Traurig blickte Dr. Metzler auf ihn hinunter. Er wußte, daß dieses Beruhigungsmittel, das er Stefan gespritzt hatte, nur einen Aufschub bedeutete. Irgendwann würde er dem jungen Assistenzarzt Rede und Antwort stehen müssen. Und gerade an Antworten hatte er herzlich wenig anzubieten.
*
»Herr Doktor, sagen Sie mir endlich, was mit meinem Freund ist!« verlangte Michaela Weller mit Nachdruck. Seit zwei Tagen war sie von dieser mysteriösen Krankheit geheilt, und seitdem versuchte sie herauszubekommen, wie es Manfred Klein ging, doch bisher hatte sie nur ausweichende Antworten bekommen.
Dr. Metzler seufzte tief auf. »Ihrem Freund geht es sehr schlecht, Frau Weller.«
»Ich will zu ihm.«
Doch Dr. Metzler schüttelte den Kopf. »Das kann ich nicht verantworten. Die Ansteckungsgefahr wäre zu groß.«
»Das sagst du zu mir auch jeden Tag«, mischte sich Stefan Daniel ein. Seine Quarantäne hatte am Vortage aufgehoben werden können, und seitdem setzte er Dr. Metzler noch mehr zu als vorher. »Wie geht’s meinem Vater?«
Dr. Metzler sah von Stefan zu Michaela. »Damit verletze ich meine Schweigepflicht.« Resigniert winkte er ab. »Aber ich fürchte, das ist in diesem Fall langsam egal. Ihr werdet eure Antworten bekommen.« Er wandte sich Stefan zu. »Dein Vater hat Lähmungserscheinungen an Händen und Füßen.« Dann sah er Michaela an. »Bei Herrn Klein ist es noch ein bißchen schlimmer, weil er schon zwei Tage länger an dieser Krankheit leidet. Seine Arme und sein rechtes Bein sind vollständig gelähmt, das linke Bein bis zum Knie.«
Entsetzt starrten Stefan und Michaela ihn an.
»Und was tun Sie dagegen?« brachte Michaela endlich hervor.
»Nichts!« rief Stefan aufgebracht. »Er tut überhaupt nichts!«
»Das ist nicht wahr, Stefan, und das weißt du!« entgegnete Dr. Metzler ärgerlich. »Ich würde niemals einen Patienten im Stich lassen, aber… ich weiß zu wenig über diese Krankheit… besser gesagt, darüber, wie man sie wirkungsvoll behandelt.«
»Aber ich bin doch auch gesund geworden«, wandte Michaela ein. »Warum geben Sie Manfred nicht einfach dasselbe Medikament, das ich bekommen habe?«
»Er bekommt es«, erwiderte Dr. Metzler. »Aber aus irgendeinem Grund schlägt es bei ihm nicht an. Ebenso bei deinem Vater, Stefan. Und ich habe keine Ahnung, woran das liegt.«
Entsetzt starrte Michaela ihn an. »Heißt das… Manfred wird sterben?«
Dr. Metzler zögerte, dann nickte er. »Wenn nicht noch ein Wunder geschieht…«
»Gilt das auch für meinen Vater?« fragte Stefan mit fast tonloser Stimme.
Dr. Metzler wandte sich ihm zu. »Ja, Stefan.« Impulsiv ergriff er die Hand des jungen Mannes. »Dein Vater ist für mich mehr als nur ein Freund, und ich würde mein Leben geben, wenn ich seines damit retten könnte.«
Beschämt senkte Stefan den Kopf. »Es tut mir leid, Wolfgang. Ich war ungerecht zu dir, dabei hätte ich am allerbesten wissen müssen, daß gerade du einen Patienten niemals leichtfertig aufgeben würdest. Bitte verzeih mir.«
»Ist schon gut, Stefan.« Er seufzte. »Es tut mir im Herzen weh, deinen Vater sterben zu sehen.«
»Ich will bei ihm sein«, verlangte Stefan. »Und sag jetzt nicht, daß das nicht geht. Ich lasse nicht zu, daß mein Vater in seinen letzten Tagen und Stunden allein ist.«
Dr. Metzler zögerte, dann nickte er. »Einverstanden, aber nur, wenn du dich ausreichend schützt. Das bedeutet, daß du nur mit Mundschutz und Handschuhen zu deinem Vater darfst.«
»Ich nehme an, das gilt auch für mich«, mischte sich Michaela ein. »Ich werde Manfred nämlich auch nicht allein lassen.«
»Das habe ich mir schon gedacht«, meinte Dr. Metzler. »Kommen Sie mit, Frau Weller, Sie bekommen von mir, was Sie brauchen. Und wenn Sie das Zimmer Ihres Freundes verlassen, dann müssen Sie sich im Nebenraum gründlich desinfizieren, denn im ungünstigsten Fall könnte sogar die Kleidung diese Krankheit übertragen.«
»Es ist ein fürchterlicher Virus«, flüsterte Michaela betroffen, dann sah sie Dr. Metzler an. »Wie steht es eigentlich um Ines Holbe? Soviel ich weiß, ist sie doch auch betroffen.«
Dr. Metzler nickte. »Frau Holbe liegt seit gestern im Koma. Ich fürchte, für sie gibt es ebenfalls keine Hoffnung mehr.«
*
Valerie Doschek sprach auf das Medikament sehr gut an. Ihre Anfälle wurden mit jedem Mal leichter, so daß sie sich schon nach wenigen Tagen auf dem Wege der Besserung befand. Doch der kleine Tobias machte Dr. Metzler große Sorgen. Das Baby kämpfte mit dem Tod, und als bei ihm ebenfalls erste Lähmungserscheinungen auftraten, war der Chefarzt einem Zusammenbruch nahe.
»Ich kann nicht mehr«, schluchzte er verzweifelt, als er völlig zusammengesunken im Ärztezimmer an seinem Schreibtisch saß. »Zwei junge, lebenslustige Menschen, Robert und nun auch noch das Baby… ich kann nicht mehr…«
So fand ihn der Oberarzt der Klinik, Dr. Gerrit Scheibler, der bis vor kurzem mit Manon Carisi im Labor gearbeitet hatte. Noch immer versuchten sie das Rätsel um die Wirksamkeit des japanischen Medikaments zu lösen, doch bis jetzt waren sie keinen Schritt weitergekommen. Jede Spur, die sie verfolgt hatten, war im Sande verlaufen.
»Wolfgang, du mußt schlafen«, meinte Dr. Scheibler mit sanfter, beruhigender Stimme. »Seit zwei Tagen und Nächten bist du jetzt schon wieder ununterbrochen auf den Beinen. Es nützt niemandem, wenn du dich hier aufreibst.«
Mit gequältem Blick sah Dr. Metzler auf. »Wie soll ich schlafen können, wenn Robert im Sterben liegt? Und das Baby hat auch schon Lähmungserscheinungen. Gerrit, ich bin am Ende. Noch nie habe ich mich als Arzt so hilflos gefühlt.«
Dr. Scheibler widersprach dem Kollegen ernst. »Durch dein Wissen und Können hast du bereits vielen Menschen das Leben gerettet, und du hast verhindert, daß sich die Krankheit weiter ausbreiten konnte. Seit fast zehn Tagen sind in ganz Bayern keine Krankheitsfälle mehr aufgetreten. Das ist dein Verdienst, Wolfgang.«
»Ja, aber Robert wird sterben«, erklärte Dr. Metzler niedergeschlagen, »und ohne ihn werden weder Steinhausen noch die Waldsee-Klinik jemals wieder so sein wie vorher.«
*
Dr. Daniels Arme waren mittlerweile vollständig gelähmt. Stefan und Karina, die nach dem alarmierenden Anruf ihres Bruders unverzüglich aus Freiburg hergekommen war, wechselten sich am Krankenbett ihres Vaters ab.
»Ich habe nicht damit gerechnet, daß ich so früh würde gehen müssen«, erklärte Dr. Daniel, als seine beiden Kinder einmal gemeinsam bei ihm waren. »Aber es läßt sich eben nicht mehr ändern.« Unwillkürlich mußte er daran denken, daß er nun die Hochzeiten seiner Kinder nicht mehr erleben würde, daß er nicht mehr Großvater werden würde und daß seine Praxis leerstehen würde, bis Karina ihren Facharzt in der Tasche hatte – sofern es überhaupt jemals soweit kommen und sie nicht vorher ihren Verlobten
Jean Veltli heiraten würde.
»Mach dir keine Sorgen, Papa, ich werde deine Praxis übernehmen«, versprach Stefan, als hätte er die Gedanken seines Vaters erraten.
»Das wolltest du doch nicht, Stefan«, wandte Dr. Daniel ein, obwohl er über das Angebot seines Sohnes gerührt war. »Deine ganze Laufbahn… du wolltest doch immer Mikrochirurg werden.«
Doch Stefan schüttelte den Kopf. »Nein, Papa. Ich werde die Praxis in deinem Sinn weiterführen.«
Tränen der Rührung stiegen Dr. Daniel in die Augen, zu gern hätte er seinen Sohn jetzt berührt, doch das war unmöglich. Seine Arme und Hände gehorchten den Befehlen seines Gehirns nicht mehr. Und dann wurde er ganz unvermittelt wieder von einem dieser schrecklichen Anfälle überfallen. Es war der schlimmste seiner Art, und er dauerte fast eine Stunde.
Unwillkürlich ergriffen sich Stefan und Karina bei den Händen, dann lehnte sich Karina plötzlich an ihren Bruder und brach in Tränen aus.
»Er darf nicht sterben«, stieß sie schluchzend hervor. »Er darf es nicht!«
Auch Stefan fühlte Tränen aufsteigen. »Wenn es nur in meiner Macht liegen würde, das zu verhindern.«
Auch Stefan fühlte Tränen aufsteigen. »Wenn es nur in meiner Macht liegen würde, das zu verhindern.«
Dann war der Anfall endlich vorbei, doch diesmal erholte sich Dr. Daniel nicht mehr davon. Halb besinnungslos dämmerte er vor sich hin, und seine Körpertemperatur blieb konstant bei vierzig Grad stehen. Das Ende war nur noch eine Frage der Zeit…
*
»Ich hab’s!« stieß die Allgemeinmedizinerin Dr. Manon Carisi hervor.
Mit einem Ruck drehten sich Dr. Metzler und Dr. Scheibler zu ihr um. Schon seit Stunden arbeiteten sie wieder im Labor, weil sie einfach nicht gewillt waren, Dr. Daniel, Ines Holbe, Manfred Klein und den kleinen Tobias Doschek aufzugeben, obwohl es um alle vier denkbar schlecht stand. Manfred Klein lag inzwischen ebenfalls im Koma, und bei Dr. Daniel und dem kleinen Tobias würde dieser Zustand auch nicht mehr lange auf sich warten lassen.
»Antikörper!« fügte Manon jetzt hinzu, als wäre das die Lösung aller Rätsel.
»Antikörper?« wiederholte Dr. Metzler gedehnt. »Was soll das heißen?«
»In den Körpern unserer vier Sorgenkinder werden gegen das Medikament Antikörper gebildet«, erklärte Manon. »Das heißt, daß die körpereigenen Abwehrkräfte nicht die tödlichen Viren, sondern die Wirkstoffe des Medikaments als körperfremd empfinden und angreifen.
Dr. Scheibler schlug sich mit einer Hand an die Stirn. »Meine Güte, daß wir da nicht früher draufgekommen sind.«
Doch Dr. Metzler blieb zurückhaltend. »Ich glaube, wir sollten nicht zu euphorisch sein. Ich habe noch nie gehört, daß ein Patient Antikörper gegen ein Medikament entwickelt hat.«
Manon zuckte die Schultern. »Ich habe auch noch nie eine Krankheit wie diese kennengelernt. Wolfgang, wir haben keine Zeit mehr. Ines Holbe kann jeden Tag sterben, Manfred Klein liegt im Koma, und Robert und der kleine Tobias stehen kurz davor. Lassen Sie es uns versuchen.«
Aufmerksam blickte Dr. Metzler sie an. »Sie denken an Immunglobuline. Das ist riskant, Manon. Wenn die körpereigenen Abwehrkräfte ausgeschaltet werden, können die Viren innerhalb weniger Stunden den Tod herbeiführen.«
»Unsere Patienten liegen im Sterben, Wolfgang«, mischte sich Dr. Scheibler ein. »Wir haben also nichts mehr zu verlieren.«
Dr. Metzler atmete tief durch. »Also schön, ich bin einverstanden.«
Wie auf Kommando standen die drei Ärzte auf. Jetzt waren keine Worte mehr nötig. Nur Schnelligkeit zählte noch. Dr. Metzler kümmerte sich zuerst um Ines Holbe, dann ging er zu Manfred Klein, während Manon bei Dr. Daniel war und Dr. Scheibler dem kleinen Tobias die vielleicht lebensrettenden Immunglobuline spritzte.
»Wenn es nun doch nicht hilft?« fragte Manon in banger Erwartung.
»Dann werden sie heute abend alle tot sein«, antwortete Dr. Metzler, und seine Stimme bebte dabei ein wenig.
»Sie würden so oder so sterben«, entgegnete Dr. Scheibler. »Vielleicht nicht heute, aber innerhalb der nächsten Tage.«
»Ein schwacher Trost«, murmelte Manon, dann sah sie ihre beiden Kollegen an. »Wann ist die nächste Spritze fällig?«
»Morgen früh«, antwortete Dr. Metzler. »Wenn sie dann noch am Leben sind.«
*
Die Besserung trat nur sehr zögernd ein. Der kleine Tobias Doschek war der erste, der nach der Behandlung mit Immunglobulinen plötzlich auf das japanische Medikament ansprach. Langsam, aber stetig sank sein Fieber, und nach vier Tagen konnte Dr. Metzler endlich Valerie Doschek mitteilen, daß das Gröbste überstanden war. Die Blutanalyse hatte ergeben, daß das Baby gesund war. Natürlich war es nach der ausgestandenen schweren Krankheit entsetzlich geschwächt, doch diesen Zustand würden die Zeit und eine zärtliche Betreuung durch die Mutter heilen.
Bei den erwachsenen Patienten dauerte es länger, doch auch hier war eine deutliche Besserung bald nicht mehr zu leugnen. Ganz allmählich sank das Fieber, doch die Lähmungen bildeten sich nicht zurück, was Dr. Metzler große Sorgen bereitete. Täglich nahm er Blutuntersuchungen vor, die schließlich zeigten, daß Dr. Daniel, Manfred Klein und sogar die am schwersten betroffene Ines Holbe auf dem Weg der Besserung waren. Doch obwohl die Viren nicht mehr in ihren Körpern wüteten, blieben die Lähmungen bestehen.
Bei Ines waren sie am schlimmsten. Ihre beiden Arme waren gelähmt, und von der Hüfte an abwärts hatte sie ebenfalls kein Gefühl.
»Was soll ich noch mit diesem Leben«, schluchzte sie verzweifelt, als Dr. Metzler wieder einmal ihre Reflexe testete. »Ich kann nicht selbst essen und mich nicht waschen. Nicht einmal auf die Toilette kann ich gehen!« Und dann kam plötzlich die Erinnerung an den jungen Japaner, in den sie sich verliebt hatte. »Was ist mit Katsumata? Er hatte doch die gleiche Krankheit wie ich. Liegt er auch so jämmerlich da?«
»Ich weiß es nicht«, antwortete Dr. Metzler. »Aber ich kann mich erkundigen, wenn Sie mir Namen und Adresse des jungen Mannes geben können.«
Noch am selben Tag nahm Dr. Metzler mit der japanischen Klinik, an der er einst gearbeitet hatte, Kontakt auf und versuchte etwas über das Schicksal von Katumata Nakashida herauszubekommen. Bereits am Nachmittag hatte er für
Ines gute Nachrichten.
»Der junge Mann lebt, und ich glaube, er ist schon auf dem Weg nach Deutschland«, erklärte er.
Doch Ines brach in Tränen aus. »Er soll mich nicht so sehen!«
»Da beugte sich Dr. Metzler zu ihr hinunter und berührte ihr Gesicht. »Frau Holbe, Ihr Katsumata lag noch vor einer Woche genauso da wie Sie – gelähmt und hilflos. Meine Erfahrungen mit dieser Krankheit waren bisher noch lückenhaft, jetzt aber weiß ich, daß sich die Lähmungen auch bei Ihnen zurückbilden werden. Es braucht nur alles seine Zeit.«
Da huschte ein glückliches Leuchten über Ines’ Gesicht, was um so rührender wirkte, weil in ihren Augen noch immer Tränen glitzerten.
»Ich möchte Sie umarmen, Herr Doktor«, gestand sie leise.
Dr. Metzler lächelte. »Das holen Sie nach, wenn es Ihnen bessergeht.«
*
Als Dr. Daniel zum ersten Mal wieder selbst essen konnte, hätte er vor lauter Glück am liebsten gleich die ganze Welt umarmt. Noch nie zuvor in seinem Leben hatte er so nah an der Schwelle zum Tod gestanden. Eine Weile hatte er mit dem Schicksal gehadert, weil es im Begriff war, ihn viel zu früh aus diesem Leben zu nehmen, doch dann hatte er sich intensiv damit auseinandergesetzt, was ihn da drüben wohl erwartete. Gedanken an seine verstorbene Frau waren aufgekommen, und er hatte sich gefragt, ob er ihr im Jenseits wiederbegegnen würde. Von klinisch Toten hatte er schon solche Dinge gehört. Doch jetzt rückten diese Gedanken wieder in weite Ferne. Dem unermüdlichen Einsatz von Dr. Metzler, Dr. Scheibler und nicht zuletzt Manon Carisi war es zu verdanken, daß er am Leben war – und nicht nur er. Natürlich hatte, Dr. Daniel inzwischen erfahren, daß der kleine Tobias ebenfalls in höchster Lebensgefahr geschwebt hatte. Und es freute ihn von Herzen, daß Ines Holbe und Manfred Klein diese schwere Krankheit ebenso überstanden hatten wie Tobias.
»Hallo, Papa!« Die fröhliche Stimme seiner Tochter Karina riß ihn aus seinen Gedanken.
Im nächsten Moment war sie schon an seinem Bett und umarmte ihn. Stefan, der ihr gefolgt war, hielt sich in dieser Hinsicht ein wenig zurück, doch auch ihm war deutlich anzusehen, wie glücklich er war, weil sein Vater wieder ganz gesund werden würde.
Da ergriff Dr. Daniel auch schon seine Hand.
»Stefan, ich wollte es dir schon längst sagen«, begann er. »Daß du alle deine Pläne umgeworfen hättest, um mir den nötigen Frieden zum Sterben zu geben…«
»Bitte, Papa, hör auf«, fiel Stefan ihm ins Wort. »Ich weiß, wie sehr dein Herz an der Praxis hängt, und es wäre für mich ganz natürlich gewesen, dein Erbe anzutreten.« Er lächelte. »Aber ich bin froh, daß ich es nicht tun muß – nicht wegen der Praxis, sondern wegen dir.«
Liebevoll drückte Dr. Daniel seine Hand. »Ich habe dich schon richtig verstanden, mein Junge.«
In diesem Moment trat Manon Carisi herein. Ein glückliches Strahlen glitt über Dr. Daniels Gesicht, dann umarmte er die Ärztin spontan.
»Manon, endlich kann ich mich bei dir bedanken«, meinte er. »Ich glaube, ich bin dir eine ganze Menge schuldig. Du hast mein Leben gerettet.«
»Ach, Unsinn«, wehrte Manon bescheiden ab. »Wolfgang, Gerrit und ich haben Hand in Hand gearbeitet. Daß gerade ich auf die Antikörper gestoßen bin, war Zufall.«
Da schüttelte Dr. Daniel den Kopf. »Nein, Manon, Tatsache ist, daß du eine erstklassige Ärztin bist.« Er warf einen Blick auf die Runde, sah seinen Sohn, seine Tochter und seine Schwester Irene, die sozusagen aus der Ferne hatte leiden müssen, weil Dr. Metzler nur Stefan und Karina gestattet hatte, bei dem todkranken Dr. Daniel zu bleiben.
»Es war eine schreckliche Krankheit, die ich durchleiden mußte«, erklärte er. »Aber sie hat mir auch gezeigt, welch wundervolle Menschen ich um mich herum habe.«
*
Zur selben Zeit saßen in einem der Patientenzimmer vier junge Menschen zusammen, die das Schicksal auf eigenartige Weise miteinander verknüpft hatte.
»Im Grunde war alles meine Schuld«, bekannte Katsumata Nakashida. Er hatte den weiten Weg von Japan bis hierher nicht gescheut, um seine große Liebe zu sich zu holen. Was als Affäre begonnen hatte, würde nun ein Leben lang halten.
»Es ist Unsinn, hier von Schuld zu sprechen«, entgegnete Manfred Klein. »Du wußtest ebensowenig wie wir alle, welch schreckliche Krankheit du in dir hattest. Und daß das Medikament bei Ines und mir nicht angeschlagen hat…« Er zuckte die Schultern, dann umfing er Michaela mit einer zarte Geste. »Wichtig ist doch nur, daß wir alle am Leben sind, und das verdanken wir diesen erstklassigen Ärzten hier.«
»Und daß wir zueinander gefunden haben«, fügte Katsumata hinzu, während er Ines liebevoll anschaute.
Manfred lächelte. »Vielleicht sollten wir eine Doppelhochzeit planen.«
Bedauernd schüttelte Katsumata den Kopf. »Das würde meinem Vater das Herz brechen. Wenn ich schon keine Japanerin zur Frau nehme, muß ich wenigstens in Japan heiraten. Aber in Gedanken werden wir bei euch sein.«
»Und wir bei euch«, versprach Manfred.
So kam es, daß fast auf den Tag genau drei Monate später sowohl in Steinhausen als auch im fernen Kyoto die Hochzeitsglocken läuteten und zwei verliebte Paare einem glücklichen Leben entgegengingen…
– E N D E –