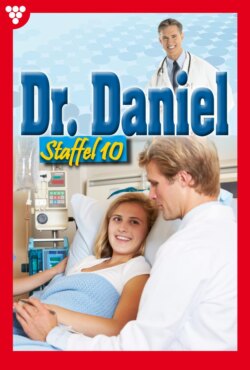Читать книгу Dr. Daniel Staffel 10 – Arztroman - Marie-Francoise - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеMona Lombardi, Managerin
Mit berechtigtem Stolz betrachtete Mona das nagelneue Schild, das neben der Tür ihres ebenso nagelneuen Büros hing. Sie hatte es geschafft! Seit heute war sie Managerin des Kaufhauses, in dem sie einst als kleine Verkäuferin angefangen hatte.
Dreizehn Jahre war das nun her, doch Mona wertete die Zahl 13 als ihre absolute Glückszahl. Welche andere Frau in ihrem noch jungen Alter konnte schon auf eine solche Karriere zurückblicken? Lediglich mit einem Hauptschulabschluß hatte sie die Stelle als Verkäuferin angetreten, doch sie hatte unermüdlich an sich gearbeitet, und nun war die Zeit gekommen, die Früchte dafür einzustreichen.
Mona öffnete die Tür und betrat das Büro, das ihr ab heute gehören würde. Große Fenster gaben den Blick auf die Neuhauser Straße frei, wo wie immer große Geschäftigkeit herrschte. Frauen mit vollgepackten Taschen erledigten Einkäufe, Männer in Anzügen und wichtig aussehenden Aktenkoffern eilten ihren Terminen entgegen, Straßenmusikanten zeigten ihre Künste und verdienten sich dabei ein paar Mark.
Mona wandte sich vom Fenster ab und strich mit einer Hand über den glänzenden Acrylglas-Schreibtisch. Der helle Ledersessel, der dahinter stand, wirkte sehr feminin, ebenso wie der champagnerfarbene Teppichboden und der breite Aubusson-Läufer. An den Wänden hingen gerahmte Drucke von Claude Monet, Monas Lieblingsmaler. Alles in allem erkannte der Besucher auf Anhieb, daß hier eine Frau regierte.
Mona warf einen Blick auf ihre elegante Armbanduhr. Bis zu ihrer ersten Sitzung hatte sie noch genau eine Stunde Zeit. Das bedeutete, daß sie jetzt die letzten Vorbereitungen treffen mußte. Das Konzept, das sie vorlegen würde, hatte sie schon vor Wochen ausgearbeitet. Immerhin hatte sie gewußt, daß sie für den Posten der Managerin an erster Stelle stand. Nun mußte sie aber auch bald Resultate liefern, sonst würde der Traum von ihrer Karriere nur allzu kurz sein.
Das Kaufhaus stand im Moment nämlich denkbar schlecht da, aber Mona hatte sich fest vorgenommen, das zu ändern und zwar schnellstens. Sie hatte auch schon einige gute Ideen, die sie heute ebenfalls preisgeben würde.
Es klopfte.
»Ja, bitte!« rief Mona.
Ihre Sekretärin Doris Sebald trat herein und lächelte verbindlich, obwohl Mona wußte, daß sie weibliche Chefs verabscheute – vor allem, wenn sie sehr viel jünger und dazu wesentlich attraktiver waren als sie selbst. »Ich habe sie alle kommen, aber viel lieber wieder gehen sehen«, war eine der Lieblingsweisheiten von Doris.
»Soll ich Ihnen einen Kaffee bringen, Frau Lombardi?« fragte die Sekretärin und ließ sich dabei nicht anmerken, wie wenig sie von Frauen in der Chefetage hielt. Sehr viel lieber hätte sie für den smarten Thilo Jürgens gearbeitet, der als Manager jedoch niemals zur Debatte gestanden hatte.
»Danke, Doris, im Moment nicht«, entgegnete Mona. »Ich muß in einer knappen Stunde zur Vorstandssitzung.« Sie reichte der Sekretärin etliche beschriebene Blätter. »Würden Sie meine Entwürfe bis dahin bitte ins Reine schreiben?«
»Selbstverständlich, Frau Lombardi«, antwortete Doris dienstbeflissen, dabei hegte sie für ihre Chefin im Moment alles andere als freundliche Gedanken, weil diese sie zu rascher Arbeit zwang.
Als Doris gegangen war, holte Mona ihre Aktentasche hervor, entnahm ihr alle wichtigen Unterlagen und studierte sie noch einmal gewissenhaft durch. Hier und da machte sie sich Notizen, ergänzte den einen oder anderen Punkt, der ihr spontan noch einfiel, dann stand sie auf. Ein erneuter Blick zur Uhr zeigte ihr, daß sie genau rechtzeitig zur Sitzung kommen würde. Es war in ihrer Position außerordentlich wichtig, nicht zu früh und schon gar nicht zu spät zu kommen.
Mona packte ihre Unterlagen zusammen, dann trat sie vor den Spiegel, der eher unaufdringlich an der Seitenwand des hellen Aktenschrankes angebracht war, und überprüfte kurz ihr Aussehen, doch es gab nichts daran auszusetzen. Die Kombination aus grün-kariertem, nicht ganz knielangem Rock, mintfarbener Bluse und flaschengrünem Blazer saß perfekt. Die lange, grobgliedrige Kette wirkte elegant und nicht aufdringlich. Das dunkle Haar hatte Mona zu einem lockeren Knoten geschlungen, was sie reifer, aber keineswegs altjüngferlich wirken ließ. Alles in allem war sie eine äußerst ansprechende junge Frau, die gutes Aussehen, Charme und Selbstbewußtsein in einer Person vereinte… eine Frau, der man ansehen konnte, daß sie genau wußte, was sie wollte.
*
Die Sitzung wurde ein voller Erfolg. Die Vorstandsmitglieder lagen Mona Lombardi buchstäblich zu Füßen. Wenn sie sprach, hingen sie an ihren Lippen und waren mit allem einverstanden, was sie vorbrachte, doch damit hatte Mona schon gerechnet – nicht, weil sie eine attraktive, junge Frau war, sondern weil ihre Pläne und Ideen wirklich gut waren.
»Ich glaube, zu einer solchen Managerin können wir uns nur beglückwünschen«, meinte einer der Herren, als sich Mona nach einem kleinen, abschließenden Sektumtrunk verabschiedete. Seine Kollegen nickten zustimmend und konnten kaum einen Blick von Mona wenden. Welch einen Glücksgriff hatten sie doch mit ihr getan! Wenn Mona Lombardi es nicht schaffte, das Kaufhaus aus den roten Zahlen zu manövrieren, wem sollte es dann gelingen?
*
Beschwingt kehrte Mona in ihr Büro zurück. Nach dem beachtlichen Erfolg bei der Vorstandssitzung ging ihr auch die übrige Arbeit flott von der Hand. Sie sah auf die Uhr und freute sich, weil sie heute ausnahmsweise einmal ganz pünktlich würde nach Hause gehen können. In letzter Zeit war das kaum einmal vorgekommen, weil sie sich ganz gewaltig reingehängt hatte, um diesen Posten als Managerin zu bekommen.
Ich werde Sekt besorgen, dachte sie. Nein, Champagner. Heute ist schließlich ein ganz besonderer Tag.
Ja, sie würde in das Delikatessengeschäft in der Nähe gehen, würde Champagner und ein paar erlesene Köstlichkeiten einkaufen. Sie hatte den Telefonhörer schon in der Hand, um ihren Verlobten Dirk Neumann anzurufen, dann überlegte sie es sich anders. Sie würde Dirk ganz einfach überraschen! Wie würde er sich über ihren Erfolg freuen! Immerhin hatte er in den vergangenen Wochen mit ihr gefiebert, hatte sie unterstützt, soweit es in seiner Macht gestanden hatte. Nun würden sie den Höhepunkt ihres beruflichen Lebens gebührend feiern.
Eine halbe Stunde später war Mona dann auch schon unterwegs. Sie kaufte ein, als müßte sie eine Party für mindestens zehn Personen ausrichten. Mit vollen Taschen stieg sie in die nächste U-Bahn, doch heute konnte ihr nicht einmal das allabendliche Gedränge etwas anhaben. Sie war rundherum glücklich und malte sich schon in den leuchtendsten Farben aus, wie sie Dirk von ihren Erfolgen erzählen würde… wie sie mit ihm auf die Zukunft anstoßen würde… eine Zukunft, in der es vielleicht auch bald eine Hochzeit geben könnte.
Die U-Bahn leerte sich allmählich, und endlich war auch Mona am Ziel. Es ging bereits auf sieben Uhr abends, aber für ihre Verhältnisse würde sie heute sogar früh heimkommen. Sie blickte an der Fassade des Hauses empor, in dessen geräumigem Dachgeschoß sie und Dirk eine gemeinsame Wohnung hatten. Vor einem Jahr hatten sie sich verlobt und waren dann hier zusammengezogen. »Unser kleines Nest«, nannten sie die Wohnung, die früher einem Maler gehört hatte. Das, was einmal sein Atelier gewesen war, war jetzt das Schlafzimmer von Mona und Dirk… ein ganz außergewöhnlicher Raum, dessen Dachschräge fast vollständig von einem großen Fenster ausgefüllt war. Hier hatten Mona und Dirk die romantischsten Stunden verbracht, denn in sternklaren Nächten hatte man in diesem Zimmer das Gefühl, als würde man direkt im Himmel sein.
So schnell es die schweren Taschen erlaubten, stieg Mona die Treppe hinauf, dann drehte sie den Schlüssel im Schloß herum und betrat die gemütliche Wohnung. Während sie die Taschen abstellte, hatte sie das Gefühl, als würde aus dem Schlafzimmer gedämpfte Musik ertönen.
Erstaunt runzelte Mona die Stirn und ging auf die Tür zu. Ein Zweifel war ausgeschlossen. Der CD-Player lief, was an sich nicht außergewöhnlich gewesen wäre, wenn es nicht ausgerechnet die CD mit ihren gemeinsamen Lieblingsliedern gewesen wäre. Diese »Kuschel-CD«, wie sie sie nannten, hörte sich Dirk normalerweise nicht allein an.
Jetzt stand Mona vor der Tür und hörte die eigenartigen Geräusche, die aus dem Schlafzimmer drangen. Ein unangenehmes Gefühl ergriff sie, als sie die Klinke herunterdrückte und die Tür öffnete. Im nächsten Moment blickten ihr zwei Augenpaare erschrocken entgegen, doch auch Mona brauchte ein paar Sekunden, um zu begreifen, daß Dirk mit ihrer Freundin Vera im Bett lag.
»Du bist schon… hier?« brachte Dirk mühsam hervor und wollte sich erheben, überlegte es sich dann aber anders. Unbekleidet wie er war, wollte er sich nicht vor Mona hinstellen… nicht unter diesen für ihn doch äußerst ungünstigen Umständen.
Währenddessen machte Vera den Eindruck, als wolle sie sich unter den Bettlaken verkriechen. Man merkte ihr an, wie peinlich ihr diese Situation war.
»Ich komme wohl ungelegen«, meinte Mona und wunderte sich, wie sie angesichts dieses Betrugs, den ihr Verlobter und ihre beste Freundin an ihr begangen hatten, überhaupt so ruhig bleiben konnte.
Dirk begann hilflos zu stottern: »Es ist nicht das, wonach es aussieht… das heißt… es ist schon, wonach es aussieht, aber ich kann’s erklären… besser gesagt, erklären kann ich es eigentlich auch nicht… es tut mir leid, Mona…«
»Dreckskerl!« zischte Mona, dann machte sie auf dem Absatz kehrt und verließ die Wohnung.
Mit einem Handtuch, das er sich eiligst um die Hüften geschlungen hatte, lief Dirk ihr hinterher. »Mona! Komm zurück! Bitte! Laß uns darüber reden! Bitte, Mona…«
Sie drehte sich um, ging auf ihn zu und verpaßte ihm eine gesalzene Ohrfeige.
»Es tut mir wirklich leid, Mona«, stammelte er. »Es war auch nur dieses eine Mal, und… es war ganz bedeutungslos…«
»Du Schuft!« erklang hinter ihm Veras aufgebrachte Stimme. »Zu mir hast du gesagt…«
Dirk fuhr herum. »Sei ruhig!«
Doch Mona hatte schon begriffen. Angewidert schaute sie ihn an. »Dafür hättest du eigentlich eine zweite Ohrfeige verdient, aber du bist es ja gar nicht wert, daß man sich an dir die Hände schmutzig macht.«
Damit ging sie endgültig. Sie hörte noch, wie Dirk und Vera zu streiten begannen und fragte sich, warum sie Dirks Seitensprünge nicht früher bereits bemerkt hatte. Offensichtlich ging das mit ihm und Vera ja schon länger.
Unschlüssig blieb Mona stehen. Wohin sollte sie sich jetzt wenden? In ihre Wohnung wollte sie nicht zurück. Das Allerletzte, worauf sie im Augenblick nämlich Lust hätte, wäre eine Diskussion mit Dirk, die ohnehin nichts fruchten würde. Schließlich konnte er seine Affäre mit Vera nicht ungeschehen machen und vielleicht wollte er das ja auch gar nicht.
»In solchen Situationen vertraut man sich eigentlich seiner besten Freundin an«, murmelte Mona niedergeschlagen. »Aber wenn diese Freundin gleichzeitig zur ärgsten Rivalin wird… was tut man dann?«
Langsam ging sie weiter… ohne Ziel, einfach nur geradeaus. Noch immer trug sie die elegante Kombination, mit der sie ihre neue Stellung als Managerin angetreten hatte. Auch ihre Handtasche hatte sie dabei, nur die feinen Köstlichkeiten und den Champagner hatte sie in der Wohnung zurückgelassen, aber was hätte sie damit jetzt auch anfangen sollen? Sollten Dirk und Vera das Zeug doch essen. Ihr – Mona – hätte es nach dem eben Erlebten ohnehin nicht mehr geschmeckt.
»Hoffentlich wird ihnen schlecht darauf«, stieß Mona bitter hervor.
Sie ging wieder zur U-Bahn hinunter. Eigentlich hätte sie das Auto mitnehmen sollen, aber so weit hatte sie im Moment gar nicht gedacht. Sie war es auch nicht gewohnt, weil sie viel lieber auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgriff. Wenn sie zur Arbeit fuhr, war sie mit der U-Bahn ohnehin besser dran.
Mona stieg in die nächste einfahrende Bahn und ließ sich auf einen freien Sitz fallen. Was sollte sie jetzt tun? Sie konnte ja schlecht die ganze Nacht durch München gehen und fahren. Vielleicht sollte sie in ihr Büro zurückkehren und die Nacht dort verbringen. Unwillkürlich schüttelte sich Mona. Sie liebte ihre Arbeit sehr und freute sich unsagbar über den neuen Posten, aber deshalb wollte sie nicht unbedingt auch gleich die Nacht im Büro verbringen.
Die U-Bahn hielt am Marienplatz. Mona stieg aus und fuhr mit der Rolltreppe nach oben. Ohne genau zu wissen, weshalb, schlug sie den Weg zur S-Bahn ein. Sie fuhr weiter Richtung Hauptbahnhof, und dann wußte sie plötzlich, welches Ziel sie ansteuern würde: Steinhausen!
Bis vor einigen Jahren hatte sie dort gelebt – zusammen mit ihren Eltern. Doch diese waren kurz nacheinander verstorben, und dann hatte Mona es in der Wohnung, wo alles an Mama und Papa erinnert hatte, nicht mehr ausgehalten und war nach München gezogen. Hier hatte sie Dirk kennengelernt, und nach der Verlobung…
Mona schüttelte die Gedanken ab. Sie wollte sich nicht mehr an Dirk erinnern! Unwillkürlich schluchzte sie auf. Es tat weh! Sie hatte ihn so sehr geliebt… und liebte ihn immer noch. Auch wenn dieser Mistkerl es nicht verdiente.
Der Zug nach Steinhausen fuhr langsam in den Hauptbahnhof ein. Mona löste eine Fahrkarte und stieg ein, aber als sich der Zug in Bewegung setzte, bereute sie ihren Entschluß schon fast wieder. Was sollte sie denn mitten in der Nacht in Steinhausen? Ihre Eltern waren tot, sie hatte keinerlei Verwandtschaft, und die wenigen Freundschaften, die sie in dem kleinen Ort gehabt hatte, waren mit den Jahren zerbrochen. Kein Wunder. Mona hatte sich damals mit aller Kraft auf ihre angehende Karriere gestürzt – zum einen, um den Tod ihrer Eltern zu verdrängen, zum anderen, weil sie nicht als Verkäuferin hatte enden wollte. Sie wollte nach oben… ganz an die Spitze, und nun hatte sie es geschafft – beinahe jedenfalls. Erst wenn ihre Maßnahmen Erfolg haben würde, würde ihr der Platz als Managerin wirklich sicher sein. Vorerst war sie nur ein weiterer Versuch, das Kaufhaus aus den roten Zahlen zu bringen. Würde ihr das nicht gelingen, dann würde schon bald ein anderer ihren Platz einnehmen.
Der Zug hielt mit einem Ruck an. Erschrocken blickte Mona auf und erkannte, daß sie schon in Steinhausen angelangt war. Rasch griff sie nach ihrer Handtasche und verließ den Zug, dann stand sie ein wenig verloren am Bahnsteig. In der Dunkelheit konnte man von dem idyllischen Vorgebirgsort nicht viel sehen, trotzdem atmete Mona jetzt tief durch. Das war der Duft der Heimat, und plötzlich merkte sie, wie sehr sie das ruhige Steinhausen vermißt hatte.
Allerdings merkte Mona rasch, daß Steinhausen nicht mehr so klein und beschaulich war wie noch vor einigen Jahren. Überhaupt hatte sich hier vieles verändert – das bemerkte sie trotz einfallender Dunkelheit. Sicher, die schmucken Vorgebirgshäuschen waren noch da, aber es waren etliche hinzugekommen, die Mona nicht kannte.
»Dr. Markus Leitner, Kinderarzt«, las sie auf einem Praxisschild und zog überrascht die Augenbrauen hoch. Steinhausen hatte jetzt sogar einen Kinderarzt.
Unwillkürlich lenkte sie ihre Schritte zum Ortsausgang und wandte sich dann nach links. Der Kreuzbergweg war noch immer so steil wie früher und an seinem Ende tauchte nun die stattliche weiße Villa auf, zu der es Mona gezogen hatte.
Allerdings hatte es auch hier eine Veränderung gegeben, wie die junge Frau gleich feststellen konnte.
Dr. Robert Daniel, Arzt für Gynäkologie, stand auf dem einen Praxisschild und darunter: Dr. Manon Daniel, Ärztin für Allgemeinmedizin.
»Er ist also wieder verheiratet«, murmelte Mona. Sie erinnerte sich noch sehr genau daran, wie Dr. Daniels erste Frau ganz unerwartet verstorben war und er Steinhausen den Rücken gekehrt hatte. Nun war er also wieder hier, und er war verheiratet. Mona lächelte ein wenig. Sie gönnte dem sympathischen Arzt dieses zweite Glück von ganzem Herzen.
Langsam setzte sie ihren Weg fort. Eigentlich war es schon viel zu dunkel, um jetzt noch zum Waldsee zu gehen, doch trotz der Gefahren, die der schmale Waldweg nachts barg, schlug Mona diese Richtung ein. Sie ging besonders vorsichtig, um nicht über Wurzeln oder herabgefallene Äste zu stolpern.
Dann konnte sie ihn auch schon sehen. Im fahlen Mondlicht glitzerte das Wasser wie mit Silberplättchen bestreut. Es drängte Mona, die Finger in das eisige kalte Wasser zu tauchen, doch als sie das Ufer erreicht hatte, entdeckte sie in der Ferne etwas, was ihre Neugier weckte. Da schimmerte doch Licht durch die Bäume, oder?
Mona trat aus dem Wald heraus und staunte. Da stand ein großer, hufeisenförmiger Bau, hinter dessen Fenstern noch vereinzelt Licht brannte. Mona ging auf das Gebäude zu und erkannte beim Näherkommen, daß es sich um eine Klinik handeln mußte.
Nach einigem Zögern trat sie durch die Doppeltür in die geflieste Eingangshalle und blickte sich überrascht um. Tatsächlich, Steinhausen verfügte über eine eigene Klinik.
»Kann ich Ihnen helfen?« fragte eine junge Frau in hellblauer Schwesterntracht. Ein an ihrem Kittel befestigtes Schildchen wies sie als Schwester Irmgard aus.
»Nein, ich… äh, eigentlich nicht«, stammelte Mona unsicher. Es war ihr ein bißchen peinlich, weil sie völlig grundlos hier hereingekommen war… nur aus Neugier.
Schwester Irmgard wies auf Monas Beine. »Das sollten Sie aber versorgen lassen.«
Mona blickte nach unten, und erst in diesem Moment registrierte sie ihre schmerzenden Füße. Ihre Strümpfe waren bis über die Fersen herauf voller Blut.
Fürsorglich griff die Nachtschwester an ihren Arm. »Kommen Sie, ich bringe Sie zur Notaufnahme. Frau Dr. Reintaler wird sich gleich um Sie kümmern.«
»Danke«, murmelte Mona verlegen, zögerte und sprach dann weiter: »Was müssen Sie nur von mir denken?«
Schwester Irmgard lächelte auf eine zurückhaltende, aber herzliche Art. »Ich denke, daß Sie großen Kummer haben. Vermutlich war ihr Herz so schwer, daß sie körperliche Schmerzen gar nicht bemerkt haben.«
Mona nickte. »Damit haben Sie wohl gar nicht so unrecht.«
Sie hatten jetzt die Notaufnahme erreicht und die Krankenschwester half Mona, sich auf die Untersuchungsliege zu setzen.
»Frau Dr. Reintaler wird gleich hier sein«, versprach Irmgard, dann zog sie sich zurück.
Es dauerte tatsächlich nicht lange, bis eine hübsche junge Ärztin hereinkam. Ihre wilde blonde Löwenmähne hatte sie nur mühsam mit einer Spange im Nacken gebändigt, und Mona erkannte zu ihrer Verwunderung, daß sie smaragdgrüne Augen hatte, die aber nicht katzenhaft wirkten, sondern sehr viel Herzenswärme ausstrahlten.
»Ich bin Dr. Alena Reintaler«, stellte sie sich vor und reichte Mona die Hand.
»Mona Lombardi«, entgegnete sie.
»Was für ein klangvoller Name«, meinte Alena bewundernd.
Mona lächelte wehmütig. »Mein Vater war italienischer Abstammung, lebte aber schon in der vierten Generation hier in Deutschland.«
Alena deutete ihr Lächeln und den Klang ihrer Stimme richtig. »Sie vermissen ihn sehr, nicht wahr?«
Mona nickte. »Es ist schon etliche Jahre her, aber…« Sie stockte, dann blickte sie mit einer Mischung aus Staunen und Bewunderung auf. »Wie konnten sie das wissen? Sind Sie Psychologin oder so etwas?«
Lächelnd schüttelte Alena den Kopf. »Ich bin Gynäkologin, aber hier in der Waldsee-Klinik muß sich jeder Arzt auf jedem Gebiet ein bißchen auskennen – vor allem auch in der Psyche des Menschen. Wirklich heilen kann man nämlich nur, wenn man den Menschen selbst und nicht nur seine Krankheit sieht. Das habe ich allerdings erst hier gelernt.«
»Waldsee-Klinik«, wiederholte Mona leise. »Das klingt so… beruhigend… heimelig.« Sie blickte sich um. »Für einen Arzt muß es schön sein, hier zu arbeiten.«
Alena nickte ohne zu zögern. »Ja, hier wird der Beruf zur Berufung.« Vorsichtig zog sie Mona die Schuhe aus. »Nun will ich mir aber Ihre Füße anschauen.«
Mona streifte die Seidenstrumpfhose ab, nun konnte man die wundgelaufenen Fersen erst wirklich erkennen.
»Ich fürchte, da werden Sie für eine Weile auf solche Schuhe verzichten müssen«, meinte Alena und wies auf die eleganten flaschengrünen Lackpumps.
»Das kann ich nicht«, erwiderte Mona. »In meinem Beruf…«
Sehr ernst sah Alena sie an. »Ihre Gesundheit sollte Ihnen wichtiger sein. Sehen Sie, Frau Lombardi, ich kann diese Wunden jetzt zwar versorgen, aber wenn Sie sich morgen wieder in solche Schuhe zwängen, dann kann aus den verhältnismäßig harmlosen Verletzungen eine Infektion entstehen, und damit ist wirklich nicht zu scherzen. Sie könnten im ungünstigsten Falle ein Leben lang, zumindest aber über viele Jahre hinweg mit Ihren Füßen Beschwerden haben.«
Mit einer fahrigen Handbewegung strich sich Mona über die Stirn.
»Warum läuft bei mir plötzlich alles schief?« fragte sie verzweifelt. »Noch heute früh war alles in bester Ordnung… nein, mehr als das. Mein Leben war auf dem absoluten Höhepunkt – beruflich und privat… dachte ich wenigstens. Und jetzt… innerhalb weniger Stunden…« Sie stockte und schüttelte nur den Kopf.
Mitfühlend sah Alena die junge Frau an. »Ich mache Ihnen einen Vorschlag, Frau Lombardi. Als erstes werde ich Ihre Füße versorgen, dann muß ich auf den beiden Stationen noch einmal nach dem Rechten sehen. Anschließend werden wir uns bei einer Tasse Kaffee zusammensetzen, und Sie schütten mir Ihr Herz aus, einverstanden?«
Mona nickte dankbar. Diese Ärztin erinnerte sie ein wenig an ihre Mutter, auch wenn sie sicher wesentlich jünger war. Mona schätzte sie auf Mitte bis Ende Dreißig. Ihre Mutter war schon fast fünfzig gewesen, als sie gestorben war. Allerdings hatte sie wesentlich jünger ausgesehen, deshalb hatte auch niemand bemerkt, daß sie erst relativ spät schwanger geworden war – ganz im Gegenteil. Man hatte sie sogar immer für eine ausgesprochen junge Mutti gehalten.
»So, Frau Lombardi, das war’s schon«, meinte Alena und riß Mona damit aus ihren Gedanken. »Ich begleite Sie jetzt noch zum Ärztezimmer, wo Sie dann bitte auf mich warten.«
»Ich weiß gar nicht, wie ich das gutmachen soll«, murmelte Mona verlegen.
Da lächelte Alena. »Sie sind im Moment Patientin hier, und ich bin als Ärztin für die Patienten dieser Klinik da.«
*
Mona mußte auf die junge Ärztin nicht lange warten. Als Alena das Zimmer betrat, hatte sie zwei Tassen dampfenden Kaffee dabei, von denen sie eine vor Mona abstellte. Dankbar nippte die junge Frau an dem heißen Getränk. Obwohl die Temperaturen für März schon recht angenehm waren, hatte Mona nach der langen Wanderung durch die Nacht doch ziemlich gefroren.
»Ich wußte nicht, wohin«, gestand Mona leise, als sie ihre Tasse wieder abstellte. »Ich war seit Jahren nicht mehr in Steinhausen, dabei bin ich hier geboren und aufgewachsen.« Sie seufzte und lehnte sich auf dem Stuhl zurück. »Wer weiß, ob ich jemals wieder hergekommen wäre, wenn nicht…« Sie unterbrach sich mitten im Satz und senkte den Kopf, dann blickte sie auf – direkt in Alenas smaragdgrüne Augen. »Wurden Sie schon einmal betrogen? Ich meine… haben Sie einen Mann so sehr geliebt, so…« Wieder brachte sie den Satz nicht zu Ende.
Unwillkürlich mußte Alena an ihre erste große Liebe denken. Dr. Hartwig Simon. Sie waren schon verlobt gewesen, da hatte Alena herausfinden müssen, daß Hartwig sie nie geliebt hatte. Er hatte nur Karriere machen wollen und seine zukünftige Frau nach Kriterien ausgewählt, die mit Liebe überhaupt nichts zu tun hatten.
»Ja, Frau Lombardi, ich wurde auch schon einmal betrogen, und das hat damals sehr weh getan«, gestand sie. »Ich glaubte damals an die ehrliche, tiefe Liebe und mußte erkennen, daß ich nur Mittel zum Zweck gewesen wäre, wenn ich den Mann an meiner Seite geheiratet hätte.« Sie schwieg eine Weile. »Damals zog ich die Konsequenzen und verließ ihn. Der Zufall oder das Schicksal führten mich hierher. Ich wurde Ärztin an dieser Kinik und…« Ein zärtliches Lächeln schlich sich auf ihre fraulich-schönen Züge. »Hier traf ich einen ehemaligen Studienfreund wieder und seit ein paar Jahren sind wir glücklich verheiratet. Er hat eine gynäkologische Praxis in München, aber unsere Wohnung haben wir hier in Steinhausen – zum einen, weil es hier ruhiger ist, zum anderen, weil ich unbedingt in der Nähe der Klinik sein muß, falls es einen Notfall gibt.«
Mona lauschte diesen Worten nach. Das alles klang nach Harmonie und Zufriedenheit… genau das, was ihr im Moment so schrecklich fehlte, dabei war es doch erst ein paar Stunden her, daß sie Dirk und Vera in eindeutiger Situation angetroffen hatte.
»Ich bin auch verlobt«, murmelte Mona. »Das heißt, ich war verlobt. Seit heute bin ich es nicht mehr.« Sie seufzte tief auf. »Als ich heute vom Büro nach Hause gekommen bin, traf ich meinen Verlobten mit meiner besten Freundin im Bett an. Er wollte mir weismachen, daß es ein einmaliger Seitensprung gewesen wäre, der keinerlei Bedeutung für ihn hätte, doch Veras Reaktion…« Wieder seufzte sie. »Die beiden müssen schon lange ein Verhältnis haben.«
Alena nickte. »So etwas ist sehr schmerzlich.«
»Vor allem, wenn man eigentlich nach Hause gekommen ist, um etwas zu feiern.« Mona strich ein paar imaginäre Haarsträhnchen zurück. »Wissen Sie, ich bin seit heute Managerin eines stattlichen Kaufhauses. Dieser Posten bedeutet mir sehr viel. Ich habe in diesem Kaufhaus vor dreizehn Jahren als kleine Verkäuferin angefangen und nun bin ich Managerin.« Traurig senkte sie den Kopf. »Die Dreizehn war wohl doch nicht meine Glückszahl.«
»Vielleicht sollten Sie im Moment nicht zu schwarz sehen«, riet Alena ihr. »Sicher, die Sache mit Ihrem Verlobten… an Ihrer Stelle würde ich wohl auch die Konsequenzen aus seinem Verhalten ziehen. Aber das bedeutet noch lange nicht, daß es jetzt immer so weitergehen wird. Ich bin sicher, daß man Sie für diesen verantwortungsvollen Posten nicht zufällig ausgewählt hat, und wenn Sie die Geschichte mit Ihrem Verlobten erst verarbeitet haben, dann wird Ihnen sicher auch in der Liebe das Glück wieder lachen.« Aufmunternd lächelte sie Mona an. »Damals, als ich Hartwigs Betrug erkannte, dachte ich auch, die Welt würde zusammenbrechen, doch jetzt ist sie schöner als je zuvor.«
Zu ihrem eigenen Erstaunen bemerkte Mona, wie ihr Optimismus durch die Worte der jungen Ärztin zurückkehrte. Dirk war ihre große Liebe, aber trotzdem war er immer nur ein bestimmter Teil ihres Lebens gewesen… ein großer Teil zwar, aber dennoch einer, der sich irgendwie ersetzen ließ. Nicht heute oder morgen, vielleicht sogar erst in ein paar Jahren. Sie würde sich jetzt auf ihre Karriere konzentrieren. Alles andere war Nebensache.
»Sie haben recht«, meinte Mona an Alena gewandt. »Mein Leben läuft im Augenblick in privater Hinsicht nicht gerade optimal, aber trotz allem ist es bestimmt nicht so, daß für mich jetzt eine nicht endende Pechsträhne begonnen hat.«
Mona ahnte nicht, wie gründlich sie sich in diesem Punkt irrte.
*
Dr. Robert Daniel staunte nicht schlecht, als die elegante junge Dame in sein Sprechzimmer trat.
»Mona Lombardi?« vergewisserte er sich, dann erhob er sich hinter seinem Schreibtisch und kam lächelnd auf die junge Frau zu. »Das nenne ich eine wirkliche Überraschung. Was führt Sie nach all den Jahren hierher?«
Mona lächelte. »Ich bin vor zwei Wochen mehr durch Zufall wieder in Steinhausen und dann auch in der Waldsee-Klinik gelandet.«
Besorgt runzelte Dr. Daniel die Stirn. »Hatten Sie einen Unfall?«
Mona schmunzelte. »Wie man’s nimmt.« Seufzend winkte sie ab. »Ach, wissen Sie, Herr Doktor, das war eine ziemlich unerfreuliche Geschichte, aber sie ist rasch erzählt. Mein Ex-Verlobter hatte eine Affäre mit meiner besten Freundin, und ich habe die beiden im Bett überrascht. Daraufhin hat es mich irgendwie hierhergetrieben.« Sie zeigte ein fast verlegen wirkendes Lächeln. »Unglücklicherweise mit Schuhen, die für längere Wanderungen nicht unbedingt geeignet sind. Ich habe mir Blutblasen gelaufen, die eigentlich ins Guinness-Buch der Rekorde gehören.«
Dr. Daniel mußte lachen. »Nun, ganz so schlimm wird’s hoffentlich nicht gewesen sein.«
»Täuschen Sie sich nicht«, entgegnete Mona. Inzwischen konnte sie darüber schmunzeln, aber bis vor zwei Tagen hatte sie unter ihren schmerzenden Füßen arg gelitten. »Ich konnte praktisch nur noch in Pantoffeln herumlaufen.« Sie schwieg kurz. »Dabei will ich offen gestehen, daß ich Frau Dr. Reintalers Rat wohl nicht beherzigt hätte, aber es war mir einfach unmöglich, in irgendeinem geschlossenen Schuh zu kommen.«
»Alena Reintaler hat Sie also versorgt«, meinte Dr. Daniel erfreut.
Mona nickte. »Nicht nur körperlich. Wir hatten ein richtig schönes Gespräch… so von Frau zu Frau.« Sie atmete tief durch. »Gerade nach der großen Enttäuschung mit Dirk hat mir das sehr geholfen.« Sie brachte ein gezwungenes Lächeln zustande. »Sein Verrat schmerzt noch immer, und ich habe auch irgendwie Sehnsucht nach ihm, obwohl er das wohl nicht verdient.« Sie seufzte. »Zwischen uns war einfach zu viel, als daß ich es innerhalb von zwei Wochen vergessen könnte.« Dann schüttelte sie den Kopf. »Aber deswegen bin ich gar nicht hier, und ich will Sie mit dieser für Sie langweiligen Geschichte auch nicht länger aufhalten.«
»Das tun Sie nicht, Mona«, verwahrte sich Dr. Daniel. »Die Sorgen meiner Patientinnen sind grundsätzlich auch meine Sorgen.«
»So tragisch ist das nicht«, versicherte Mona. »Wie gesagt, es ist nur noch so ein kleiner Schmerz im Herzen, aber der wird mit der Zeit vergehen. Allerdings…« Nun kam ihr Lächeln von Herzen. »Meine beinahe ungewollte Rückkehr nach Steinhausen vor zwei Wochen hat die Sehnsucht nach der Heimat in mir geweckt. Ich werde mir hier eine Wohnung suchen, besser gesagt, ich habe schon eine gefunden, aber sie wird erst nächsten Monat frei. Das bedeutet für mich zwar einen längeren Weg zur Arbeit, aber das ist mir die Ruhe, die ich hier in meiner knapp bemessenen Freizeit finden werde, allemal wert.«
Unauffällig betrachtete Dr. Daniel die elegante Kleidung seiner Patientin, die davon zeugte, daß ihm eine richtige Karrierefrau gegenübersaß.
»Darf ich so neugierig sein zu fragen, was Sie jetzt beruflich machen?« wollte er wissen.
»Natürlich dürfen Sie«, bekräftigte Mona und man sah ihrem Gesicht an, wie stolz sie auf sich war, ohne deswegen arrogant zu sein. »Ich bin seit zwei Wochen Managerin des Kaufhauses, in dem ich einst als kleine Verkäuferin angefangen habe.«
Anerkennend zog Dr. Daniel die Augenbrauen hoch. »Das ist wirklich ein ganz beachtlicher Aufstieg, Mona. Da kann man Ihnen nur gratulieren.«
Mona strahlte. Ja, sie war unheimlich stolz auf ihre Leistung.
»Was führt Sie heute zu mir?« fragte Dr. Daniel nun.
»Meine jährliche Routineuntersuchung steht an«, antwortete Mona, dann lächelte sie erneut. »Da ich in Kürze wieder hier wohnen werde, wollte ich deswegen gleich zu Ihnen kommen.« Sie seufzte leise. »In den vergangenen Jahren habe ich meine Gynäkologen mehrmals gewechselt und doch feststellen müssen, daß keiner so war wie Sie.«
Dieses Lob machte Dr. Daniel tatsächlich ein wenig verlegen. »Nun übertreiben Sie aber gewaltig.«
Mona wurde ernst. »Ganz und gar nicht, Herr Doktor. Sie sind ein überaus rücksichtsvoller Arzt, und so etwas findet man nicht so leicht. Ich habe auch einige Male mit dem Gedanken gespielt, hierherzukommen, aber dann… ich wußte ja nicht, ob Sie wieder hier praktizieren würden. Immerhin sind Sie damals sehr überstürzt aus Steinhausen weggezogen.«
Dr. Daniel nickte. »Nach dem Tod meiner Frau durchlebte ich eine schreckliche Zeit. Es dauerte fünf Jahre, bis ich nach Steinhausen und in diese Villa zurückkehren konnte. Meine Schwester hat mir damals sehr geholfen. Sie ist ja auch schon lange Zeit Witwe und führte mir ganz selbstlos den Haushalt.« Er lächelte ein wenig. »Das macht sie immer noch, obwohl ich mittlerweile wieder verheiratet bin. Allerdings… ich wüßte auch gar nicht, was wir ohne Irene machen würden. Meine Frau arbeitet ja halbtags hier in der Praxis als Allgemeinmedizinerin, und darüber hinaus haben wir ein kleines, äußerst lebhaftes Adoptivtöchterchen.«
Mona lächelte. »Sie sind also rundherum glücklich.« Spontan legte sie ihre schmale, sehr gepflegte Hand auf die von Dr. Daniel. »Das freut mich für Sie.« Sie wurde wieder ernst. »Ich stelle es mir ganz schrecklich vor, wenn man schon in so jungen Jahren verwitwet ist.«
Dr. Daniel nickte. »Das ist es auch.« Dann lenkte er ganz bewußt von diesem Thema ab. »Nun sollten wir uns aber um Sie kümmern.« Er warf einen Blick in die Karte, die seine junge Empfangsdame Gabi Meindl herausgesucht hatte. »Meine Eintragungen sind nach all den Jahren natürlich nicht mehr auf dem neuesten Stand.«
Mona schmunzelte. »Das glaube ich Ihnen gern. Allzu viel hat sich jedoch nicht verändert – abgesehen davon, daß ich seit drei Jahren keine Pille mehr nehme. Irgendwie hat sie mir nicht mehr gut getan. Ich habe damals auf Anraten einer jungen Ärztin, die ich während eines Urlaubs kennengelernt habe, mit der sogenannten natürlichen Familienplanung begonnen und bin bis jetzt ganz zufrieden damit.«
»Das kann ich mir bei Ihnen gut vorstellen. Sie sind eine überaus korrekte Frau, bei der es keine Nachlässigkeiten gibt. Im übrigen kamen Ihre Tage auch vor Einnahme der Pille immer ganz regelmäßig, und wenn man als Frau den eigenen Körper erst mal sehr gut kennt, dann ist die natürliche Familienplanung eine sichere Verhütungsmethode.«
Ein Hauch von Melancholie huschte über Monas Gesicht.
»Im Moment brauche ich mir um Verhütung ja keine Sorgen mehr zu machen.« Sie seufzte. »Durch die unselige Geschichte mit Dirk ist ohnehin mein ganzer Zyklus durcheinandergeraten. Meine Tage sind seit einer Woche überfällig.«
»So etwas kommt vor«, meinte Dr. Daniel. »Der Zyklus einer Frau ist äußerst störungsanfällig. Jegliche Streßsituation kann ihn durcheinanderbringen.« Er stand auf. »Gehen wir mal nach nebenan.«
Mona folgte ihm durch die Zwischentür in den Untersuchungsraum. Hier war alles noch so, wie sie es von ihren früheren Besuchen in der Praxis in Erinnerung hatte. Sie trat hinter den dezent gemusterten Wandschirm und machte sich frei, dann setzte sie sich auf den gynäkologischen Stuhl.
»Ich werde jetzt als erstes einen Abstrich nehmen«, erklärte Dr. Daniel, während er mit seinem fahrbaren Stuhl näherrückte.
Mit dem Spekulum spreizte er vorsichtig die Scheidenwände, doch was er sah, ließ ihn überrascht die Stirn runzeln.
»Seit einer Woche sind Ihre Tage überfällig?« vergewisserte er sich.
Mona erschrak. »Ja, warum? Ist etwas nicht in Ordnung?«
Dr. Daniel zögerte mit der Antwort und betrachtete noch einmal eingehend den Gebärmutterhals, der das typische purpursamtene Aussehen hatte. Vorsichtig nahm Dr. Daniel den Abstrich, dann stand er auf.
»Ich muß die Gebärmutter abtasten«, meinte er. Spätestens nach dieser Untersuchung war für ihn jeglicher Zweifel ausgeschlossen.
»Sie können sich wieder ankleiden, Mona«, erklärte Dr. Daniel. »Wir werden gleich darüber sprechen.«
Angst zeichnete sich auf dem Gesicht der jungen Frau ab, als sie jetzt von dem Untersuchungsstuhl kletterte und sich hastig anzog.
»Ist es etwas Schlimmes?« fragte sie bang, während sie Dr. Daniel gegenüber Platz nahm.
Der Arzt schüttelte den Kopf. »Nein, Mona, etwas Schlimmes ist es eigentlich nicht… höchstens in Ihrer momentanen Situation…« Er atmete tief durch. »Das Ausbleiben Ihrer Regelblutung liegt nicht an dem Streß, der Ihnen durch die Trennung von Dirk entstanden ist, sondern…« Er schwieg kurz, dann bekannte er: »Sie sind schwanger.«
Einen Augenblick lang herrschte in Monas Kopf absolute Leere, dann starrte sie Dr. Daniel verzweifelt an.
»Aber… das ist doch… unmöglich! Als wir zuletzt… es waren nicht meine fruchtbaren Tage…«
»Anscheinend doch«, entgegnete Dr. Daniel und seufzte. »Ich weiß schon, daß diese Schwangerschaft für Sie jetzt denkbar ungünstig kommt. Ihre Beziehung zu Dirk ist zerbrochen, Sie stehen mitten im Berufsleben, aber – so leid es mir tut – ein Irrtum ist völlig ausgeschlossen.«
Heftig schüttelte Mona den Kopf. »Das glaube ich nicht! Sie haben doch nicht mal einen Schwangerschaftstest gemacht!«
»Das ist auch nicht mehr nötig«, entgegnete Dr. Daniel ruhig. »Wir können den Test zwar noch nachholen, wenn sie diese Sicherheit haben möchte, aber am Ergebnis wird das nichts ändern. Sehen Sie, Mona, ich bin Gynäkologe und kann bei der körperlichen Untersuchung derartige Veränderung sehr leicht feststellen. Allein die Tastuntersuchung hätte schon ausgereicht. Ihre Gebärmutter hat sich nämlich bereits vergrößert, und das ist ein sehr deutliches Zeichen für eine Schwangerschaft.«
Mona sackte förmlich in sich zusammen. »Was soll ich denn jetzt nur tun?«
»In diesem Fall wäre es vielleicht nicht verkehrt, wenn sie mit Dirk doch noch einmal sprechen würden«, schlug Dr. Daniel vor, doch Mona hob sofort abwehrend beide Hände.
»Das werde ich ganz bestimmt nicht tun!« entgegnete sie entschieden. »Ich werde nur wegen eines Babys keine sogenannte Vernunftsehe eingehen. Damit täte ich weder dem Kind noch mir selbst einen Gefallen.«
»Ihren Worten entnehme ich, daß Sie das Kind bekommen wollen«, meinte Dr. Daniel.
Monas Kopf ruckte hoch. »Denken Sie vielleicht an Abtreibung?«
»Nein, ganz bestimmt nicht«, erwiderte Dr. Daniel ohne Zögern. »Allerdings wäre dieser Gedanke wohl den meisten Frauen in Ihrer Situation gekommen.«
Mona schluckte. »Ich will gestehen, daß er mich auch eine Sekunde lang gestreift hat, aber…« Sie schüttelte den Kopf. »Abtreibung kommt für mich nicht in Frage.« Entschlossen stand sie auf. »Ich muß erst darüber nachdenken, Herr Doktor. Im Moment herrscht in meinem Hirn ein totales Chaos. Da muß ich erst Ordnung hineinbringen, dann sehen wir weiter.«
Auch Dr. Daniel erhob sich jetzt.
»Meine Sprechstundenhilfe wird Ihnen noch Blut abnehmen. In vier Wochen sollten Sie zur nächsten Vorsorgeuntersuchung kommen, dann erhalten Sie auch Ihren Mutterpaß.«
Mona blickte zu Boden. »Darüber werden sich die meisten schwangeren Frauen sehr freuen, nicht wahr?«
Sie wartete Dr. Daniels Antwort gar nicht ab, sondern fügte leise hinzu: »Das kann ich im Moment nicht.«
»Dafür habe ich auch vollstes Verständnis«, räumte Dr. Daniel ein. »Eine junge Frau ohne Partner, die gerade dabei ist, die Spitze der Karriereleiter zu erreichen, kann über eine unverhoffte Schwangerschaft wohl nicht rückhaltlos glücklich sein.« Er nahm ihre Hand. »Aber in einem können Sie jedenfalls absolut sicher sein: Ich werde für Sie dasein, wann immer es nötig ist und gemeinsam werden wir auch eine Lösung finden, die Ihnen und dem Baby gerecht wird.«
Da brachte Mona sogar ein ansatzweises Lächeln zustande. »Danke, Herr Doktor.« Sie schwieg kurz. »Ich bin so froh, daß ich zu Ihnen gekommen bin. Wissen Sie, in Ihren Augen mag ich vielleicht herzlos wirken, weil ich mich über die Schwangerschaft nicht freuen kann. Es ist auch gar nicht so, daß mir die berufliche Karriere über alles geht. Ich wollte ja immer eine Familie, aber eben nicht jetzt schon und nicht…« Hilflos zuckte sie die Schultern. »Ich meine… wenn das mit Dirk nicht passiert wäre, aber so.« Sie dachte an den Posten, für den sie so hart gearbeitet hatte. »In zwei oder drei Jahren hätte alles anders ausgesehen…«
»Sie müssen sich gewiß nicht verteidigen«, fiel Dr. Daniel ihr sanft ins Wort. »Ich halte Sie auch nicht für herzlos. Wenn Sie das wären, würden Sie sich um Ihr Baby bestimmt keine Gedanken machen, sondern nur versuchen, es auf irgendeine Weise loszuwerden.«
»Das würde ich nicht übers Herz bringen«, erwiderte Mona spontan. »Es ist ja schließlich nicht irgendein Kind, sondern immerhin ein Teil von mir.« Sie reckte sich ein wenig hoch. »Ich werde eine Lösung finden.«
*
Monas unverhoffte Schwangerschaft ging Dr. Daniel den ganzen Tag über nicht aus dem Kopf. Sogar am Abend beschäftigten sich seine Gedanken noch immer mit seiner jungen Patientin.
»Manon, du bist eine Frau«, meinte er, als das Ehepaar noch im Wohnzimmer gemütlich zusammensaß. Die kleine Tessa war im Bett, und Irene werkelte in der Küche.
»Es geht um eine Patientin von mir, die ich schon lange kenne, wenn ich sie in den vergangenen Jahren auch nicht mehr gesehen habe. Sie wurde einst in Steinhausen geboren und ist hier auch aufgewachsen.«
Manon schmunzelte. »Ich nehme an, du hast sie auf die Welt geholt.«
Doch Dr. Daniel schüttelte den Kopf. »Als sie geboren wurde, war ich gerade Assistenzarzt bei Professor Thiersch, aber ich war zu jener Zeit schon mit Christine verheiratet und wir lebten hier in Steinhausen, das damals noch ein richtiges Dorf gewesen ist, wo jeder jeden kannte.« Er lehnte sich auf dem Sofa zurück. »Mona wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf, und als sie die Hauptschule verlassen hatte, begann sie eine Lehre als Verkäuferin. Inzwischen ist sie achtundzwanzig und seit kurzem Managerin des Kaufhauses, in dem sie einst ihre Lehre gemacht hat.«
»Das ist wirklich beachtlich«, urteilte Manon anerkennend. »Es gehört eine Menge dazu, sich so hochzuarbeiten. Allerdings verstehe ich noch nicht ganz, warum du mir das alles erzählst und was es vor allen Dingen damit zu tun hat, daß ich erwiesenermaßen eine Frau bin.«
Dr. Daniel lächelte und zog sie liebevoll in seine Arme. »Das wirst du gleich verstehen.« Er wurde wieder ernst. »Stell dir vor, du wärst an ihrer Stelle und würdest nun an der Spitze der Karriereleiter stehen. An einer im Moment noch etwas wackligen Spitze, an der du dich erst wirklich etablieren müßtest. Was würdest du tun, wenn du gerade in dieser Zeit schwanger werden würdest… von einem Mann, mit dem du eben Schluß gemacht hast, weil er dich nach Strich und Faden betrogen hat.«
»Das ist eine schwierige Frage«, meinte Manon. »Letztlich würde ich mich wohl für mein Kind entscheiden und die Karriere sausen lassen, allerdings will ich doch sagen, daß dieser Vergleich zwischen ihr und mir gewaltig hinkt. Erstens bin ich keine achtundzwanzig mehr, und zweitens… ich hätte so ziemlich alles dafür gegeben, ein eigenes Kind zu haben.«
Überrascht blickte Dr. Daniel sie an. »Davon hast du mir nie etwas gesagt.«
Manon lächelte, doch ihr Mann kannte sie gut genug um zu bemerken, daß dieses Lächeln nicht ganz echt war.
»Wozu auch?« erwiderte sie. »Für mich ist der Zug längst abgefahren. Wenn man einmal vierzig ist…«
»Das ist doch Unsinn, Manon«, fiel Dr. Daniel ihr energisch ins Wort. »Ich hatte schon eine Menge Patientinnen, die weit über vierzig waren, als sie schwanger wurden.«
»Es ist ein großer Unterschied, ob man mit vierzig sein erstes oder ein weiteres Kind bekommt«, wandte Manon ein. »Im übrigen haben wir jetzt Tessa, die mir wie ein leibliches Kind ans Herz gewachsen ist. Das ist weit mehr, als ich noch vor ein paar Jahren erwarten konnte.«
Doch Dr. Daniel spürte, daß sie nicht restlos glücklich war. Sicher, sie liebte Tessa von ganzem Herzen, aber das Gefühl einer eigenen Schwangerschaft würde sie immer vermissen.
Mit einer sanften Geste streichelte Dr. Daniel durch ihr halblanges, kastanienbraunes Haar. »Was spricht eigentlich dagegen, daß wir Eltern werden?«
»Du bist ja verrückt, Robert!« urteilte Manon sofort. »Wie ich vorhin schon sagte: Für mich ist dieser Zug abgefahren. Außerdem bin ich nicht sicher, wie unsere kleine Prinzessin reagieren würde, wenn sie plötzlich Konkurrenz bekäme.«
»Es wäre keine Konkurrenz für sie«, widersprach Dr. Daniel.
»Ich glaube, Tessa würde das anders sehen«, meinte Manon. »Und ihr möchte ich auf gar keinen Fall wehtun.« Sie beugte sich zu ihrem Mann und küßte ihn. »Ich liebe dich, Robert, und diese Liebe braucht keine Bestätigung durch ein Kind. Im übrigen haben wir Tessa und wenn dann erst mal Enkelkinder eintrudeln…«
Dr. Daniel seufzte. »Ich fürchte, darauf werden wir noch lange warten müssen. Ob Karina jemals ein Baby bekommen kann, steht in den Sternen. Bei ihrer letzten Fehlgeburt wurde eine Menge zerstört, und ich glaube, sie selbst hat mit diesem Thema sogar schon abgeschlossen. Sie konzentriert sich jetzt voll und ganz auf ihre Karriere als Ärztin. Und Stefan… er ist mit Darinka zwar schon eine ganze Weile zusammen und es scheint beiden sehr ernst zu sein, aber sie schmieden ja noch nicht mal Heiratspläne.« Er grinste. »Wenn wir also ein Baby wollen, müssen wir uns wohl selbst darum kümmern.«
Lächelnd stupste Manon ihn an der Nase. »Du bist ja wirklich verrückt.« Dann wechselte sie das Thema. »Was wirst du nun deiner Patientin raten?«
Dr. Daniel seufzte. »Ich weiß es nicht. Vermutlich kann ich ihr überhaupt keinen Rat geben. Sie muß selbst entscheiden, was für sie wichtiger ist.«
*
Als Mona Lambardi zur nächsten Vorsorgeuntersuchung in die Praxis von Dr. Daniel kam, wirkte sie wesentlich gelöster als beim ersten Mal.
»Sie sehen aus, als gäbe es in Ihrem Leben jetzt wieder etwas Erfreuliches«, meinte Dr. Daniel und vermutete, daß sich Mona mit ihrem Verlobten vielleicht doch ausgesöhnt hatte.
»Das ist richtig«, stimmte Mona zu. »Ich habe mich entschlossen, mein Baby zu behalten.«
Dr. Daniel nickte. »Das freut mich. Ich nehme an, zwischen Ihnen und Dirk hat inzwischen eine Aussprache stattgefunden.«
Doch Mona schüttelte den Kopf. »Nein, jedenfalls nicht in dem Sinne, wie Sie es jetzt denken. Dirk hat mich zwar tatsächlich noch einmal im Büro aufgesucht und wollte von vorn beginnen. Ich wäre auch beinahe schwach geworden, aber bereits am nächsten Tag sah ich ihn wieder in innigster Umarmung mit Vera. Das Kapitel Dirk ist damit für mich abgeschlossen – und zwar endgültig.« Ein selbstbewußtes Lächeln trat auf ihr Gesicht. »Ich habe es geschafft, mich von der Verkäuferin zur Managerin hochzuarbeiten, da werde ich auch Kind und Beruf unter einen Hut bringen. Bis ich in Mutterschutz gehe, werde ich dem Vorstand schon erste Ergebnisse vorweisen können. Die Herren werden also nichts dagegen haben, wenn ich die Geschicke des Kaufhauses dann für ein paar Wochen von zu Hause aus leiten werde. Nach dem Mutterschutz beginne ich wieder zu arbeiten. Ich habe mein eigenes Büro, da wird mein Baby niemanden stören.« Sie lächelte zärtlich. »Mich schon gar nicht.«
»Hoffentlich muten Sie sich da nur nicht zuviel zu«, wandte Dr. Daniel besorgt ein. »Sie dürfen nicht vergessen, daß die Versorgung eines Babys allein schon ein Vollzeitjob sein kann.«
Gelassen winkte Mona ab. »In den ersten Wochen schlafen Babys die meiste Zeit und später… ich werde das schaffen, Herr Doktor, ich weiß es.«
Davon war Dr. Daniel allerdings nicht restlos überzeugt. Er glaubte vielmehr, daß sich Mona alles viel zu einfach vorstellte.
»Vielleicht sollten Sie sich mal mit ein paar jungen Müttern unterhalten«, schlug er vor. »Verstehen sie mich nicht falsch, Mona, es ist durchaus möglich, daß Sie Beruf und Kind unter einen Hut bringen, vielleicht schaffen Sie es sogar völlig unbeschadet. Sehr viel wahrscheinlicher ist es aber, daß Sie sich dabei aufreiben. Eine Geburt ist keine Kleinigkeit, und für die meisten Mütter reichen die sechs Wochen danach nicht aus, um sich vollständig zu erholen, vor allem, weil nicht alle Babys so pflegeleicht sind und in den ersten Lebenswochen viel schlafen. Wesentlich häufiger kommt es nämlich vor, daß ein Neugeborenes mindestens einmal, in ungünstigen Fällen sogar mehrmals in der Nacht schreit. Darüber hinaus…«
»Wollen Sie mich etwa entmutigen?« fragte Mona in teils gespielter, teils echter Verzweiflung.
»Ganz und gar nicht«, verwahrte sich Dr. Daniel. »Ich will vielmehr, daß Sie die ganze Sache realistisch sehen. Ihre leitende Position verlangt Ihnen eine Menge ab, und ich weiß aus Erfahrung, daß die meisten jungen Mütter ihr erstes Baby nicht einfach nebenher versorgen können. Es ist eine gewaltige Umstellung im Leben einer Frau oder auch eines Ehepaares. Ich habe schon miterlebt, wie glückliche Ehe wegen eines Babys in schwere Krisen geraten sind, und es verlangte von beiden Partnern Verständnis und Mithilfe, um das Leben als kleine Familie zu bewältigen. Verglichen damit, sind Sie in einer noch schwierigeren Situation. Sie werden niemanden haben, der mal eine Nacht das Baby versorgt, damit Sie ungestört schlafen können. Sie müssen vielmehr Tag und Nacht für Ihr Kind dasein und werden darüber hinaus zusätzlich noch im Beruf gefordert werden, denn auch die Geschicke eines Kaufhauses lassen sich bestimmt nicht so nebenher leiten.«
Mona wurde nachdenklich. Von dieser Warte hatte sie das Ganze noch nicht betrachtet. Vielmehr hatte sie sich einen Film als Vorbild genommen, wo eine junge alleinerziehende Mutter spielend Beruf und Kindererziehung bewältigt hatte. Nun war sie natürlich bei weitem nicht so naiv, Filme für bare Münze zu nehmen, doch gerade in diesem Fall hatte das Thema genau auf ihre eigene Situation gepaßt, und sie hatte sich unwillkürlich gesagt, daß Kind und Beruf auf diese Weise zu schaffen sein müßten. Mit Problemen, wie Dr. Daniel sie nun angeschnitten hatte, hatte sie sich dabei jedoch noch nicht beschäftigt.
»Sie raten mir also, das Baby zur Adoption freizugeben«, murmelte sie niedergeschlagen.
»Nein, Mona, absolut nicht«, entgegnete Dr. Daniel. »Ich finde es sogar ausgesprochen mutig und selbstlos von Ihnen, daß Sie Ihr Kind trotz der recht ungünstigen Voraussetzungen behalten möchten, aber gerade in diesem Fall müssen Sie Beruf und Kindererziehung schon jetzt gründlich planen. Sie werden eine Tagesmutter benötigen, und selbst dann wird es noch einige Male vorkommen, daß Sie Ihr Baby tatsächlich mit ins Büro nehmen müssen. Je nach Lebhaftigkeit Ihres Kindes werden sie vermutlich auch versuchen müssen, jemanden zu finden, der ab und zu die mehr oder weniger unruhige Nachtschicht übernehmen wird.«
Mona seufzte. »Das wird wohl der schwierigste Punkt für mich sein. Ich habe weder Eltern noch Geschwister und alle meine Freundinnen sind berufstätig und brauchen ihre Nachtruhe eben auch – abgesehen davon, daß ich nicht sicher bin, ob ich ruhig schlafen könnte, wenn eine von ihnen bei meinem Baby wäre.«
Dr. Daniel staunte ein wenig darüber, daß Mona schon nach so kurzer Zeit eine so enge Verbundenheit zu ihrem ungeborenen Kind hergestellt hatte. So etwas war bei Karrierefrauen eher selten.
»Da Sie hier in Steinhausen wohnen, wird sich dieses Problem sicher lösen lassen«, meinte Dr. Daniel. »Die Freundin meines Sohnes arbeitet bis zu ihrer Ausbildung als Säuglingsschwester noch als Krankenpflegerin in der Waldsee-Klinik und hat im Umgang mit Kindern eine besonders glückliche Hand. Ich kenne Darinka mittlerweile lange genug, um behaupten zu können, daß sie die Nachtwache bei Ihrem Baby ab und zu übernehmen würde.«
Mona wurde bei diesen Worten ganz warm ums Herz. Welcher andere Arzt würde sich wohl so intensiv ihrer Probleme annehmen?
»Mein Beruf bedeutet mir sehr viel«, erklärte sie leise. »Als alleinerziehende Mutter müßte ich sowieso arbeiten, aber da ließe sich bestimmt etwas finden, womit ich Beruf und Kind unter einen Hut bringen würde, doch… das kann ich nicht… nicht jetzt. Ich habe so hart für diesen Manager-Posten gearbeitet. Ihn aufzugeben, hieße, mich selbst aufzugeben, und das kann ich nicht einmal meinem Kind zuliebe tun.«
Dr. Daniel nickte. »Das kann ich verstehen, Mona.« Dann lächelte er sie aufmunternd an. »Jetzt, da Sie wissen, was auf Sie zukommen wird, können Sie alles in Ruhe arrangieren. Bis zur Geburt des Babys haben Sie noch gute sieben Monate Zeit, um eine Tagesmutter zu finden und auch in Ihrem Beruf alles so weit zu regeln, daß Sie einen Teil der Arbeit dann vielleicht zu Hause erledigen können. Wenn Sie alles nur gut genug durchorganisieren, dann werden sie Beruf und Kind unter einen Hut bringen, da bin ich ganz sicher.«
*
In der zwölften Schwangerschaftswoche stand die erste Ultraschalluntersuchung bei Mona bevor, und sie war schon unheimlich gespannt darauf. In den vergangenen Wochen hatte sie alles über Schwangerschaft und Geburt gelesen, was sie hatte finden können. Auf Anraten von Dr. Daniel hatte sie sich auch mit jungen Müttern unterhalten und dabei festgestellt, daß Dr. Daniel mit seiner Darstellung nicht übertrieben hatte. Ein Baby bedeutete einen gewaltigen Einschnitt in das gewohnte Leben, allerdings freute sich Mona mittlerweile schon sehr auf diese Herausforderung. Es war ein neues Ziel und Mona glaubte, den Adrenalinstoß förmlich zu spüren, den diese Aufgabe in ihr auslöste.
Als sie heute in der Praxis von Dr. Daniel erschien, trug sie zum ersten Mal ein Umstandskleid. Dabei strahlte sie über das ganze Gesicht.
»Man kann die Rundung schon deutlich sehen«, platzte sie heraus, kaum daß sie Dr. Daniel gegenübersaß.
Der Arzt runzelte verwundert die Stirn. Normalerweise war in der zwölften Schwangerschaftswoche vom Bauch noch nichts zu erkennen, allerdings hatte er ja bereits vor vier Wochen bei der gynäkologischen Untersuchung bemerkt, wie enorm sich die Gebärmutter vergrößert hatte. Das war schon ein bißchen ungewöhnlich gewesen, allerdings nicht unbedingt besorgniserregend. Monas heutige Auskunft dagegen, weckte in Dr. Daniel ein ungutes Gefühl.
Er betrachtete die Aufzeichnungen über Monas Gewichtszunahme und stellte auch hier fest, daß die junge Frau während der vergangenen vier Wochen über die Maßen zugenommen hatte.
»Haben Sie in letzter Zeit sehr viel mehr gegessen, als es sonst Ihrer Gewohnheit entspricht?« wollte Dr. Daniel wissen.
Mona schüttelte den Kopf. »Nein, eigentlich nicht.« Etwas verlegen räumte sie ein: »Nun ja, vor zwei Tagen war ich auf einem Empfang, und da hatte ich plötzlich solchen Heißhunger auf Sahnetorten. Ich glaube, ich hätte mühelos eine ganze Torte verdrücken können, habe mich dann aber nach dem dritten Stück zusammengenommen.«
Wieder betrachtete Dr. Daniel die Gewichtskurve, die von seiner Sprechstundenhilfe eingetragen worden war. Selbst drei Stück Sahnetorte konnten nicht zu einem so rapiden Anstieg des Körpergewichts führen.
»Ich will Sie nicht erschrecken, Mona, aber…« Er zögerte kurz. »Wissen Sie zufällig, ob es in Ihrer oder in Dirks Familie Zwillinge gab?«
»Also bei mir sicher nicht«, antwortete Mona. »Bei Dirk weiß ich es nicht, aber… er ist ja auch Einzelkind. Wie es bei seinen Eltern und Großeltern aussah…« Sie zuckte die Schultern. »Keine Ahnung.« Dann begriff sie erst, was Dr. Daniel da anzudeuten versuchte. Sie erschrak. »Glauben Sie etwa, daß ich… Zwillinge bekomme?«
»Im Moment glaube ich noch gar nichts«, erwiderte Dr. Daniel ernst. »Die erhebliche Vergrößerung Ihrer Gebärmutter, die ich letztes Mal schon feststellte und die jetzige übermäßige Gewichtszunahme könnten allerdings tatsächlich für eine Zwillingsschwangerschaft sprechen.« Er lächelte ein wenig. »Es könnte natürlich auch sein, daß Sie mir ein paar gewichtige Kalorienbomben verschwiegen haben.«
Doch Mona war zu aufgeregt, um diesen kleinen Scherz wirklich mitzubekommen.
»Zwillinge sind unmöglich«, stammelte sie. »Ein Kind… ja, aber zwei… das würde niemals gehen.« Verzweifelt sah sie Dr. Daniel an. »Sie müssen etwas tun, Herr Doktor!«
»Langsam, Mona«, beruhigte der Arzt sie. »Im Moment ist das ja noch gar nicht sicher.« Er stand auf. »Ich werde Sie jetzt zunächst untersuchen, und dann sehen wir uns das Kleine mal auf Ultraschall an. Vielleicht erwarten sie ja ein ungewöhnlich großes Kind, das schon jetzt mehr Platz braucht als andere Babys.«
Mona nickte zwar, doch ihre Angst blieb. Und sie war auch alles andere als unbegründet, wie Dr. Daniel schon bei der gynäkologischen Untersuchung feststellte. Die Gebärmutter hatte sich wiederum vergrößert, was in Dr. Daniel den Verdacht erhärtete, daß Mona nicht nur ein Kind erwartete. Die Ultraschallaufnahme bestätigte seine Erwartungen nicht nur, sie übertraf sie sogar noch.
Dr. Daniel schloß sekundenlang die Augen, als er erkannte, was sich da in Monas Bauch abspielte. Wie, um Himmels willen, sollte er das dieser jungen Frau beibringen?
»Was ist denn nun?« fragte Mona mit ein wenig schriller Stimme, weil Dr. Daniel nichts sagte und sie selbst die hellen und dunklen Schatten auf dem Bildschirm nicht zu deuten vermochte.
»Mona, ich fürchte, jetzt wird Ihnen ein ziemlicher Schock bevorstehen«, begann Dr. Daniel so behutsam wie möglich, obwohl er wußte, daß sich seine Mitteilung für Mona auch bei noch so sorgfältiger Wortwahl nicht beschönigen lassen würde.
»Es sind also doch Zwillinge«, befürchtete Mona tonlos.
Dr. Daniel schüttelte den Kopf. »Es kommt noch schlimmer. Es sind… Drillinge.«
Nun war Mona wirklich einer Ohnmacht nahe, und fast war sie froh, hier auf dem gynäkologischen Stuhl zu sitzen. Sie schloß die Augen und preßte beide Hände vor den Mund.
»Drei…«, stieß sie hervor. »O Gott, nein…«
Fürsorglich half Dr. Daniel ihr, von dem Stuhl herunterzusteigen, und begleitete sie auch noch hinter den Wandschirm, wo sie sich wieder ankleiden konnte. Dr. Daniel wußte natürlich, daß er eigentlich Abmessungen der Ungeborenen hätte vornehmen müssen, doch das ließ sich auch bei der nächsten Ultraschalluntersuchung noch nachholen.
Mit langsamen, beinahe schleppenden Schritten kam Mona hinter dem Wandschirm hervor und ließ sich dann kraftlos auf den Stuhl fallen, der Dr. Daniels Schreibtisch gegenüberstand.
»Was soll ich tun?« fragte sie verzweifelt. »Drillinge… das… das kann ich keiner Tagesmutter antun. Das… es geht einfach nicht.« Hilfesuchend sah sie Dr. Daniel an. »Was soll ich denn jetzt bloß tun?«
Dr. Daniel zögerte, obwohl er wußte, wie seine Antwort ausfallen würde.
»Sie haben jetzt nicht mehr viele Möglichkeiten«, entgegnete er endlich. »In dieser Situation können Sie sich nur noch für eines entscheiden – entweder für Ihren Beruf oder für Ihre Kinder. Beides zusammen geht nicht.«
Mutlos sank Monas Kopf nach vorn. Sie wußte, daß Dr. Daniel recht hatte.
»Abtreibung kommt für mich nicht in Frage«, erwiderte sie.
»Daran habe ich auch keine Sekunde lang gedacht«, verwahrte sich Dr. Daniel. »Wenn Sie sich für Ihren Beruf entscheiden, dann werden Sie die Kinder zur Adoption freigeben müssen.«
Mona nickte, dann ruckte ihr Kopf hoch. »Sie dürfen nicht getrennt werden! Wenn jemand diese Kinder adoptieren möchte, dann muß er entweder alle drei nehmen oder gar keines.«
Prüfend sah Dr. Daniel sie an. »Sie haben sich also bereits entschieden.«
Mona zögerte, bevor sie verzweifelt hervorstieß: »Ich kann nicht anders! Herr Doktor, es tut mir im Herzen weh, aber… ich will auf meine Karriere nicht verzichten… nicht jetzt, da ich endlich mein großes Ziel erreicht habe. Als Hausfrau und Mutter… ich wäre todunglücklich… und ich würde meine Kinder unglücklich machen. Ich kann ja nicht mal richtig kochen. Wenn es darauf ankommt, lasse ich sogar Wasser anbrennen!« Sie begann haltlos zu schluchzen. »Mit einem Kind hätte ich es vielleicht geschafft, aber drei…«
Impulsiv stand Dr. Daniel auf, ging um den Schreibtisch herum und legte einen Arm tröstend um ihre Schultern.
»Denken Sie in Ruhe darüber nach, Mona«, riet er ihr. »Lassen Sie sich für die endgültige Entscheidung sehr viel Zeit und machen sie sich nicht von Dingen wie kochen abhängig. So etwas kann man lernen, und mit drei Kindern ist man dazu sogar gezwungen. Viel wichtiger wird es im Moment für Sie sein, sich darüber klarzuwerden, ob Sie auf Ihre Kinder auch wirklich verzichten können. Wenn Sie Ihre Babys zur Adoption freigeben, werden Sie sie niemals wiedersehen. Sie werden nicht wissen, wie es ihnen geht, wie sie sich entwickeln. Geburtstage, Weihnachten, der erste Schultag, Berufsausbildung, Hochzeit… auf all das werden Sie verzichten müssen.«
Bei diesen Worten begannen Monas Tränen erneut zu fließen.
»Bis wann muß ich mich entscheiden?« fragte sie kläglich.
»Sie haben so viel Zeit, wie Sie sich nehmen wollen«, antwortete Dr. Daniel. »Sie können sich vor der Geburt entscheiden oder auch danach. Bedenken Sie nur, daß es mit jedem Tag, den Sie mit Ihren Babys verbringen werden, schwieriger sein wird, sie wegzugeben.« Er schwieg kurz. »Drillinge können nicht auf natürlichem Weg geboren werden. Es ist bei Zwillingen schon schwierig, bei drei Babys ist es völlig unmöglich. Das bedeutet einen geplanten Kaiserschnitt. Wenn Sie sich für die Freigabe zur Adoption entschließen, dann können wir es so einrichten, daß Sie Ihre Kinder gar nicht erst sehen. Das klingt grausam, macht den Abschied aber wesentlich leichter für Sie.«
Aus naßgeweinten Augen sah Mona zu dem Arzt auf. »Und für die Babys?«
»Welche Antwort erwarten Sie denn jetzt von mir?« meinte Dr. Daniel behutsam. »Eine ehrliche oder eine, die Sie… besser gesagt, die Ihr Gewissen beruhigt?«
Mona sackte förmlich in sich zusammen. »Diesen Unterschied gibt es also.« Langsam hob sie den Kopf wieder. »Eine ehrliche Antwort, Herr Doktor.«
Dr. Daniel setzte sich zu ihr, während er noch ihre Hand hielt.
»Wir wissen, daß Babys im Mutterleib eine Menge mitbekommen. Sie hören Stimmen, fühlen, wenn sie durch den Bauch gestreichelt werden. Ein weinendes Baby beruhigt sich am schnellsten auf dem Bauch der Mutter, weil ihm der Herzschlag vertraut ist. Babys können allerdings nicht sprechen, daher wissen wir nicht, ob und wieviel es ihnen ausmacht, wenn sie all das nicht bekommen… wenn sie nicht von der leiblichen Mutter getragen, getröstet und gefüttert werden.«
»Es macht ihnen bestimmt etwas aus«, flüsterte Mona betroffen.
Sehr sanft drückte Dr. Daniel ihre Hand. »Hören Sie, Mona, wir werden Ihre Babys nicht auf die Welt holen und sie dann ablegen, bis sie adoptiert werden – im Gegenteil! In der Waldsee-Klinik werden die Kleinen liebevoll versorgt, und ein Ehepaar, das Drillinge adoptiert…«
»Wenn ich mich für meinen Beruf und gegen meine Kinder entscheide, werde ich mir ein Leben lang Vorwürfe machen«, fiel Mona ihm ins Wort. »Wenn ich die Kinder behalte und dafür meinen Beruf opfere, dann… dann fürchte ich, daß ich eines Tages die Kinder dafür verantwortlich machen werde, daß sie mir meine Karriere zerstört haben.« Ratlos blickte sie auf. »Was immer ich tue… eine wirklich richtige Entscheidung wird es in diesem Fall nicht geben.«
*
Mit gemischten Gefühlen blickte Dr. Daniel seiner jungen Patientin hinterher, als sie mit dem Auto den Parkplatz verließ. Er hätte sie in den nächsten Tagen lieber in der Waldsee-Klinik gehabt, doch sie hatte einen Krankenhausaufenthalt abgelehnt.
»Ich bin nicht krank«, hatte sie gemeint. »Ich habe lediglich eine schwierige Entscheidung zu treffen, die mir in der Waldsee-Klinik nicht leichter gemacht wird. Darüber hinaus habe ich aber auch noch einen Beruf, und obgleich das Kaufhaus in den vergangenen Wochen schon erste Gewinne verzeichnen konnte, kann ich meinem Büro nicht einfach ein paar Tage fernbleiben und mich ins Krankenhaus legen.«
Das hatte Dr. Daniel natürlich eingesehen, trotzdem machte er sich Sorgen um die junge Frau. Mona Lombardi war keine Karrierefrau, die für ihren Beruf sozusagen über Leichen ging. Sie hatte sich hochgearbeitet und wollte sich diesen Posten erhalten, aber sie besaß eben auch sehr viel Herz, was sie äußerst sympathisch machte, was für ihre eigene Psyche in diesem besonderen Fall aber wohl nicht besonders gut war. Bis sie eine endgültige Entscheidung getroffen hatte, würde sie alles andere nur mit halber Konzentration machen, und das konnte bei Dingen wie Autofahren unter Umständen lebensgefährlich sein.
Seufzend wandte sich Dr. Daniel vom Fenster ab. In solchen Situationen war selbst er machtlos. Er konnte Ratschläge geben, konnte versuchen zu helfen, aber letztlich mußten seine Patientinnen ihre Entscheidungen treffen.
»Robert, willst du heute hier übernachten?«
Die sanfte Stimme seiner Frau riß ihn aus seinen Gedanken. Mit einem etwas gezwungenen Lächeln ging er auf sie zu und zog sie in seine Arme.
»Manchmal ist es wirklich nicht leicht«, meinte er etwas rätselhaft.
Teilnahmsvoll blickte Manon in sein Gesicht. »Was macht dir denn solchen Kummer, Robert?«
»Die junge Frau, von der ich dir erzählt habe«, begann er. »Sie hätte ihr Leben in den Griff bekommen… sie hätte Kind und Beruf unter einen Hut gebracht, da bin ich ganz sicher.« Wieder seufzte er leise. »Heute hat sich herausgestellt, daß sie Drillinge bekommt.«
»Meine Güte«, entfuhr es Manon. »Was wird sie jetzt tun?«
Dr. Daniel zuckte die Schultern. »Ich weiß es nicht. Allerdings… gleichgültig, wie sie sich entscheidet – sie wird nie restlos glücklich sein. Etwas wird ihrem Leben immer fehlen.«
»Sie ist also nicht das Kaliber Karrierefrau, wie es die Mutter von Schorschs und Margits Adoptivkind war«, stellte Manon fest.
Dr. Daniel dachte an die engagierte Tänzerin Sonja Berndt, deren Baby sein bester Freund Dr. Georg Sommer einst adoptiert hatte, dann schüttelte er den Kopf.
»Nein, so ist sie auf gar keinen Fall«, bekräftigte er.»Mona hätte ihr ganzes Leben umgekrempelt, um Kind und Beruf irgendwie zu vereinbaren, doch bei Drillingen ist das unmöglich. Schon als alleinerziehende Mutter ohne Beruf hätte sie es mit drei Babys vermutlich sehr schwer.« Er fuhr sich mit einer Hand durch das dichte blonde Haar – für Manon ein deutliches Zeichen, wie sehr ihn dieser Fall mitnahm. »So allein, wie sie jetzt dasteht, hat sie wohl gar keine andere Möglichkeit, als die Kinder zur Adoption freizugeben. Sicher wird sie Ersparnisse haben, aber die wären mit drei Säuglingen rasch aufgebraucht. Sie hat keine Eltern mehr, die sie notfalls unterstützen könnten, und keine Geschwister, die ihr ein bißchen helfen würden. Sie hat nur ihren Beruf, den sie ausüben müßte, um sich und die Kinder über Wasser zu halten. Eben das wäre ihr mit Drillingen nicht möglich.«
Manon blickte auf. Es war für sie nicht schwierig, Dr. Daniels Gedankengänge nachzuvollziehen.
»Robert, ich weiß genau, was in deinem Kopf vorgeht, aber das ist unmöglich«, meinte sie. »Wir können keine Drillinge in Pflege nehmen.«
Dr. Daniel seufzte wiederum. »Das weiß ich ja auch. Ich hasse es nur einfach, so hilflos zu sein.«
Liebevoll streichelte Manon sein Gesicht. »Die junge Frau steht erst am Anfang ihrer Schwangerschaft. Vielleicht ergibt sich im Laufe der nächsten Monate noch etwas, was ihre ganze Situation zum Guten wenden könnte.«
Dr. Daniel nickte zwar, doch wirklich daran glauben konnte er nicht, weil er im Moment keine Ahnung hatte, wie dieses Etwas überhaupt aussehen sollte.
*
Die Party war in vollem Gange. Über dreißig Gäste aller Altersgruppen tummelten sich in der winzigen Zwei-Zimmer-Wohnung, die bereits als allen Nähten zu platzen schien. Es wurde gelacht, getrunken und vor allen Dingen gegessen, denn der Hausherr, Bernd Köster, war ein begnadeter Koch – auch wenn er von Beruf Sportlehrer war.
Im Moment hätte er sich am liebsten in einer ruhigen Ecke verkrochen und selbst bemitleidet. Bernd wurde heute dreißig, aber das war für ihn kein Grund zum Feiern. Der einzige Grund, weshalb diese Party heute dennoch stattfand, war, daß er seine Verwandten und Freunde nicht hatte enttäuschen wollen. Außerdem war er eigentlich kein Trauerkloß – ganz im Gegenteil. Er war ein fröhlicher junger Mann, aber er haßte Geburtstage – insbesondere seine eigenen. Dabei wurde ihm nämlich jedesmal ganz deutlich klar, daß er wieder ein Jahr älter war und sich in seinem Leben nichts geändert hatte. Er war immer noch allein… einsam… so schrecklich einsam.
»Onkel Bernd, dein Essen ist ’ne Wucht!« rief sein zehnjähriger Neffe Klaus. »Da könnte sich Mama ’ne Scheibe von abschneiden.«
Bernd lächelte. Er kannte seine ältere Schwester, Klaus’ Mutter, gut genug, um zu wissen, daß man vor dem ersten Genuß ihres Essens besser eine Lebensversicherung abschließen sollte. Meistens übernahm ja sein Schwager das Kochen und ließ seine Frau nur in Notfällen in die Küche.
»Ach, Bernd, es ist wirklich jammerschade, daß ein Mann wie du noch immer allein lebt«, schlug nun Senta Rössler in eine ähnliche Kerbe. Bernd war eine Weile mit ihrer Tochter Sandra liiert gewesen – so lange, bis sein Bruder sie ihm ausgespannt hatte. Vor einem Jahr hatten die beiden geheiratet und nun war das erste Baby unterwegs. »Dich hätte Sandra nehmen sollen.«
Bernd zwang sich zu einem komischen Grinsen. »Ich weiß schon, ich bin der Traum jeder Schwiegermutter. Leider klappt es mit den dazugehörigen Töchtern nicht so gut.«
Senta seufzte abgrundtief. »Ich kann Sandra einfach nicht verstehen. Mit dir wäre sie doch viel besser dran gewesen…«
»Bitte, Senta, nicht diese Tour«, fiel Bernd ihr nun ernster werdend ins Wort. »Auf meinen Bruder lasse ich nichts kommen. Markus und Sandra lieben sich. Das ist doch das Wichtigste.« Wie sehr es ihn damals geschmerzt hatte, Sandra zu verlieren, verschwieg er wohlweislich. Auch über den anschließenden massiven Streit mit seinem älteren Bruder verlor er kein Wort. Das ging Senta nichts an. Außerdem hatte er sich inzwischen mit Markus ausgesöhnt – auch wenn es Bernd noch immer schmerzte, das Glück zwischen Sandra und seinem Bruder zu sehen.
Bernds Blick ging durch den Raum, wo seine Verwandten und Freunde dicht gedrängt zusammenstanden. Dabei fühlte er sich wie ein Außenseiter. Abgesehen von den Kindern, war er wirklich der einzige, der solo war. Er gehörte einfach nicht dazu.
»Hey, kleiner Bruder, was ist denn los?«
Wie aus dem Boden gewachsen, stand Markus plötzlich vor ihm, dann legte er einen Arm um Bernds Schultern.
»Ich glaube, es wird langsam Zeit, die ganze Bande nach Hause zu schicken«, meinte er, doch Bernd schüttelte den Kopf.
»Nichts, Markus«, bat er leise. »Alle fühlen sich wohl, sie amüsieren sich…«
»Und du leidest«, vollendete Markus seinen angefangenen Satz, dann seufzte er. »Du solltest das nicht so tragisch nehmen, Bernd. Schau mal, ich war auch schon einunddreißig, als ich Sandra kennenlernte.«
»Als du sie mir ausgespannt hast«, berichtigte Bernd mit unüberhörbarer Bitterkeit.
»Hör auf damit!« wies Markus ihn streng zurecht. »Das Thema ist längst vom Tisch. Ich denke, wir haben uns deswegen lange genug gestritten.«
Bernd ließ den Kopf sinken. »Tut mir leid, Markus. Es ist ja nur… ich fühle mich manchmal so verdammt einsam.«
»Du tust auch nichts dagegen«, hielt sein Bruder ihm vor. »Meine Güte, du bist doch noch jung…«
»Ich bin dreißig«, korrigierte Bernd mit Grabesstimme.
»Ach ja, tut mir leid, ich habe vergessen, daß man mit dreißig längst ein Tattergreis ist«, entgegnete Markus in beißendem Sarkasmus, dann nahm er seinen Bruder bei den Schultern und schüttelte ihn ein wenig. »Wach auf, Junge, du bist noch nicht alt.« Er wies in eine unbestimmte Richtung. »Irgendwo da draußen wartet deine Traumfrau. Du mußt sie nur suchen, aber das kannst du nicht, wenn die Schule und die Küche dein ganzer Lebensinhalt sind.«
Hilflos zuckte der junge Mann die Schultern. »Wenn ich allein ausgehe… ach, ich komme mir dann immer so blöd vor.«
»Du mußt ja nicht unbedingt in Bars herumhängen«, wandte Markus ein. »Geh joggen oder schwimmen. Leg dir meinetwegen einen Hund zu, wenn du nicht allein herumlaufen willst. Aber bitte, Bernd, tu etwas, bevor du hier völlig versauerst.«
Bernd nickte mechanisch. Er wußte genau, daß er die Ratschläge seines Bruders nicht befolgen würde. Er hatte keine Lust zum Joggen, und zum Schwimmen ging er nur im Sommer an den nahegelegenen See, weil er auf das Chlorwasser in Hallenbädern allergisch reagierte. Einen Hund… ja, den hätte er ganz gern, aber was könnte er einem Tier schon bieten? Eine Zwei-Zimmer-Wohnung ohne Garten, dazu einen Lehrer als Herrchen, der vormittags in der Schule war und nachmittags Hefte korrigierte. Der arme Hund hätte im wahrsten Sinne ein Hundeleben.
»Er nickt, sagt vielleicht ›ja, Markus‹, und dann bleibt trotzdem alles beim alten«, seufzte Markus, als er eine halbe Stunde später mit seiner Frau auf dem Heimweg war. »Ich verstehe es einfach nicht. Bernd ist so ein lieber Kerl. Warum nur findet er keine Frau?«
»Das fragst du ausgerechnet mich?« gab Sandra brüskiert zurück. »Immerhin habe ich deinetwegen mit ihm Schluß gemacht.« Sie schwieg kurz. »Im übrigen ist Bernd manchmal wirklich nur schwer zu verkraften. Er ist so… perfekt.«
Markus warf seiner Frau einen Seitenblick zu. »Ist das vielleicht ein Fehler?«
»Nein, nicht direkt«, entgegnete Sandra gedehnt. »Weißt du, ich glaube, ich hätte ihn auch dann nicht geheiratet, wenn ich dich nicht kennengelernt hätte. Bernd ist so ordentlich, daß ich jedesmal ein schlechtes Gewissen hatte, wenn ich nur einen benutzten Teller auf dem Tisch hatte stehenlassen. Er kocht so gut, daß sich jede Frau wie eine Stümperin fühlen muß. Er ist handwerklich begabt, er ist sportlich…« Sie zuckte die Schultern. »Er ist einfach perfekt, und ich glaube, genau deshalb läuft ihm jede Frau davon. So viel Perfektion hält niemand auf Dauer aus.«
»Armer Bernd«, murmelte Markus. »Er kann halt auch nicht aus seiner Haut heraus.«
*
Mona Lombardi hatte Überstunden gemacht. Die Zeit, die sie in der Praxis von Dr. Daniel verbracht hatte, hatte ihr wieder mal hinten und vorne gefehlt. Dazu kam die Tatsache, daß es ihr nur schwer gelungen war, sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Die Eröffnung, die Dr. Daniel ihr heute gemacht hatte, lag ihr noch immer schwer im Magen. Drillinge! Was sollte sie damit nur anfangen?
Mit einer fahrigen Handbewegung strich Mona ein paar Haarsträhnen zurück, die sich gerade aus der Spange gelöst hatten. Dr. Daniel hatte zwar gesagt, sie könne sich mit der Entscheidung noch Zeit lassen, trotzdem konnte sie kaum an etwas anderes denken.
Mona war bereits auf dem Weg zur U-Bahn, als ihr einfiel, daß sie heute ja mit dem Auto hier war, weil zu der Zeit, wo sie aus Dr. Daniels Praxis gekommen war, kein Zug nach München gefahren war. Mit einem tiefen Seufzer machte Mona kehrt und ging zur Tiefgarage. Sie fühlte sich müde und ausgelaugt. Als sie in ihrem Auto saß, lehnte sie für ein paar Minuten die Stirn gegen das Lenkrad und schloß die Augen.
Hinlegen und schlafen, dachte sie. Alles vergessen.
Doch unwillkürlich wanderten ihre Hände zu ihrem Bauch. Sie spürte die leichte Wölbung und mußte daran denken, daß da drinnen drei kleine Babys heranwuchsen.
»Was soll ich denn mit euch nur tun?« fragte sie verzweifelt. Der Gedanke, die Babys wegzugeben, tat ihr nahezu körperlich weh, allerdings war die Vorstellung, ihre Karriere zugunsten der Drillinge zu opfern, nicht unbedingt verlockender.
Noch einmal seufzte Mona, dann ließ sie den Motor an und fuhr langsam aus der Tiefgarage. Sie war froh, daß zu dieser späten Stunde nicht mehr allzuviel Verkehr herrschte, denn noch immer hatte sie Mühe, sich auf die Fahrbahn zu konzentrieren. Ihre Gedanken glitten ständig ab. Sie wußte auch ganz genau, wie gefährlich es war, in diesem Zustand Auto zu fahren. Ganz bewußt nahm sie das Tempo noch ein wenig zurück – auch auf die Gefahr hin, von anderen Autofahrern angehupt zu werden, was natürlich nicht ausblieb. Doch Mona steckte das Hupkonzert locker weg. Ihr war es wichtiger, nur heil nach Hause zu kommen.
Endlich hatte sie die Autobahn erreicht und beschleunigte nun ein wenig. Trotzdem blieb sie auf der rechten Spur und vermied jegliche Überholmanöver. Dadurch zog sich die Strecke schier endlos hin, aber schließlich kam die Ausfahrt doch in Sicht. Mona setzte den rechten Blinker, verließ die Autobahn und fuhr auf der Landstraße Richtung Steinhausen.
Sie warf einen Blick auf die Uhr am Armaturenbrett. In einer Viertelstunde würde sie zu Hause sein, doch seltsamerweise freute sie sich gar nicht mehr darauf. Zu Hause… das bedeutete Einsamkeit… endloses Grübeln über ihre Zukunft und die der Drillinge, die sie erwartete. Sekundenlang spielte sie mit dem Gedanken, Dr. Daniel noch einmal aufzusuchen, verwarf ihn aber wieder. Die Sprechstunde war längst zu Ende, und sie konnte den vielbeschäftigten Arzt nicht auch noch zu Hause mit ihren Problemen belästigen.
Die Scheinwerfer eines von hinten herannahenden Autos blendeten Mona im Rückspiegel. Sie nahm das Tempo zurück und registrierte gerade noch, daß das andere Auto mit ungeheurer Geschwindigkeit auf sie zuraste.
Mona hielt sich so weit rechts wie möglich. Der Fahrer hinter ihr würde sicher gleich zum Überholen ansetzen – auch wenn da auf dieser gewundenen Landstraße äußerst gefährlich war. Um diese Uhrzeit war sie allerdings nur wenig befahren. Mona warf einen erneuten Blick in den Rückspiegel. Das andere Auto war schon bedenklich nah, aber noch immer machte der Fahrer keine Anstalten, auf die linke Spur auszuweichen, um zu überholen.
Mona fühlte, wie sich ihr Magen zusammenkrampfte. Der konnte ihr doch nicht einfach hinten draufbrummen! Automatisch beschleunigte die junge Frau, um einen größeren Abstand zwischen sich und das andere Auto zu bringen. Doch es war schon zu spät. Mit ohrenbetäubendem Knall verkeilten sich die beiden Autos ineinander. Von der Wucht des Aufpralls wurde Mona nach vorn geschleudert und schlug trotz angelegten Sicherheitsgurts mit der Stirn auf dem Lenkrad auf. Spontan schoß ihr durch den Kopf, daß sie sich schon längst ein Auto mit Airbag hätte kaufen sollen. Sie fühlte Blut über ihr Gesicht laufen und registrierte dann entsetzt heftige Bauchkrämpfe.
»Meine Babys!« stieß sie angstvoll hervor.
Sie krümmte sich vor Schmerzen, dann fiel ihr plötzlich das neue Handy ein, das sie sich erst vor kurzem zugelegt hatte. Mit zitternden Händen tastete sie nach ihrer Aktenmappe und erreichte dann auch das Handy. Es dauerte eine Weile, bis Angst und Schmerzen ein konzentriertes Wählen zuließen.
Bereits nach dem zweiten Klingeln meldete sich Dr. Daniel mit seiner warmen, tiefen Stimme – ein deutliches Zeichen, daß er sogar zu dieser späten Stunde noch in der Praxis war.
»Ein Unfall!« schrie Mona verzweifelt in den Hörer. »Helfen Sie mir!«
»Langsam, bitte«, bat Dr. Daniel, und seine beruhigende Stimme zeigte sogar durchs Telefon ihre Wirkung. »Wie heißen Sie, und von wo rufen Sie an?«
»Lombardi«, antwortete Mona gehetzt. »Ich bin in meinem Auto… auf der Landstraße… ein anderer Wagen ist mir hinten aufgefahren. Herr Doktor, ich habe Bauchschmerzen! Helfen Sie mir!«
»Keine Sorge, Mona, ich komme gleich mit dem Krankenwagen zu Ihnen«, versicherte Dr. Daniel rasch. »Was ist mit dem anderen Fahrer?«
»Ich weiß es nicht.« Urplötzlich begann Mona zu schluchzen. »Beeilen Sie sich! Bitte kommen Sie, Herrr Doktor!«
*
Dr. Daniel hatte nach diesem ungewöhnlichen Notruf noch nicht einmal richtig aufgelegt, als er den Hörer schon wieder an sein Ohr riß und in der Waldsee-Klinik anrief. Die Nachtschwester war sofort am Telefon.
»Ein Unfall vor Steinhausen«, meldete Dr. Daniel, als er seinen Namen genannt hatte. »Wer hat heute Bereitschaft?«
»Der Chefarzt«, antwortete Schwester Irmgard ohne zu überlegen.
»Rufen Sie ihn an. Er soll direkt zur Unfallstelle kommen. Den Krankenwagen schicken Sie erst mal zu mir.«
Es dauerte keine Minute, bis Dr. Daniel das Martinshorn hören konnte.
Im Laufschritt verließ er die Praxis und sprang in den Krankenwagen, bevor er noch richtig zum Stehen gekommen war.
Der junge Sanitäter Ricky Schermann gab auch gleich wieder Gas.
Wenige Minuten später hatten sie die Unfallstelle auch schon erreicht und nur Sekunden später hielt Dr. Gerrit Scheibler mit seinem Privatwagen neben den verunglückten Autos an.
»Ein Auffahrunfall auf freier Strecke«, meinte er kopfschüttelnd und setzte nach einem Blick auf den zweiten Wagen hinzu: »Der Kerl muß ja wie ein Irrer gerast sein.«
Währenddessen hatte Dr. Daniel bereits die Fahrertür von Monas Auto geöffnet.
»Ganz ruhig, Mona, wir bringen Sie sofort in die Klinik«, versprach Dr. Daniel sanft.
Die beiden Sanitäter kamen mit einer fahrbaren Trage und klappten die Räder so weit nach unten, daß sie Mona bequem aus dem Auto heben und darauflegen konnten.
»Wie sieht’s bei Ihnen aus, Gerrit?« rief Dr. Daniel inzwischen nach hinten.
»Bitterböse!« kam die Antwort des Chefarztes. »Ich brauche die Feuerwehr und zwar schnell!«
Der zweite Sanitäter, Mario Bertoni, hatte Dr. Scheiblers Worte gehört und hängte sich sofort ans Autotelefon.
»Mario!« rief der Chefarzt in diesem Moment. »Alarmieren Sie Dr. Parker! Kann sein, daß ich hier einen Anästhesisten brauche!«
Währenddessen hatten Ricky Schermann und Dr. Daniel die Trage mit Mona in den Krankenwagen gehoben.
»Bringen Sie uns zur Klinik«, befahl Dr. Daniel. »Anschließend kommen Sie dann umgehend hierher zurück.«
Mit Blaulicht und Martinshorn brauste der Krankenwagen los. Inzwischen versuchte Dr. Scheibler, sich einen ersten Überblick über die Verletzungen des anderen Autofahrers zu verschaffen, was gar nicht so einfach war, weil der junge Mann hinter dem Steuer hilflos eingeklemmt war.
Durch die Heckklappe des Wagens kroch Dr. Scheibler nach vorn, schob eine Hand vorsichtig zwischen Fahrersitz und den Rücken des jungen Mannes und tastete auf diese Weise die Wirbelsäule ab.
In diesem Augenblick kam der Autofahrer zu sich.
»Nicht bewegen«, mahnte Dr. Scheibler. »Haben Sie gehört? Bewegen Sie sich auf keinen Fall!«
»Das Auto«, stammelte der verletzte junge Mann. »Es war plötzlich vor mir. Ich…« Er versuchte, nach hinten zu sehen.
»Nicht bewegen!« wiederholte Dr. Scheibler streng, dann fügte er ruhiger hinzu: »Wie heißen Sie?«
»Bernd«, brachte der junge Mann leise hervor. »Bernd Köster. Ich… ich habe heute… Geburtstag.«
»Dann haben Sie sich aber kein schönes Geschenk gemacht«, entgegnete Dr. Scheibler. Er versuchte, zum Beifahrersitz zu gelangen, was gar nicht so einfach war.
»Ich bin bestimmt kein gewissenloser Raser«, flüsterte Bernd. »Es war… ich war so… einsam… nach der Feier, die ich nicht gewollt habe… ich wollte nur weg… allein sein.« Er schluckte, was ihm sichtliche Schmerzen bereitete. »Nie zuvor habe ich das Tempolimit überschritten… und dann… das Auto vor mir… ich habe es zu spät gesehen… war wie gelähmt… konnte nicht bremsen…« Seine Stimme wurde noch leiser. »Es tut so weh. Beim… Atmen und… Sprechen…«
»Dann seien Sie jetzt ruhig«, riet Dr. Scheibler ihm. »Und versuchen Sie, möglichst flach zu atmen.« Vorsichtig ließ er seine Hand über Bernds Brust gleiten und ertastete die vielen Rippenbrüche. Die Bauchdecke war hart und angespannt, was auf innere Blutungen schließen ließ.
»Haben Sie keine Angst, Bernd, wir kriegen das schon wieder hin.« Dr. Scheibler versuchte, seinem jungen Patienten mit diesen Worten Mut zu machen, was ihm einen dankbaren Blick von Bernd eintrug.
Mit blinkendem Blaulicht hielt nun die Feuerwehr neben den beiden Unfallautos an. Wenig später kehrte auch der Krankenwagen zurück. Dr. Parker kam zum Fenster der Beifahrertür.
»Wie sieht’s aus?« wollte er atemlos wissen.
»Halte dich bereit zum Intubieren«, erwiderte Dr. Scheibler, dann griff er an Bernds Oberschenkel. »Spüren Sie etwas?«
»Ja«, flüsterte Bernd mit erstickter Stimme.
»Gut.« Er lächelte dem jungen Mann aufmunternd zu. »Wir holen Sie bald hier heraus. Sie dürfen sich nur nicht bewegen. Wie geht’s mit der Atmung?«
»Schlecht«, keuchte Bernd. »Es tut… so weh, und… ich habe das Gefühl…«
»Ich kann mir vorstellen, was für ein Gefühl Sie haben«, fiel Dr. Scheibler ihm ins Wort, dann blickte er Dr. Parker an. »Du mußt intubieren, aber er darf sich dabei keinen Millimeter bewegen.«
»Wie stellst du dir das vor, Gerrit?« fragte Dr. Parker entsetzt. »Was glaubst du, wie der sich wehrt, wenn ich ihm bei vollem Bewußtsein einen Schlauch in die Luftröhre schiebe? Ganz davon abgesehen, daß ich damit bei einem nicht relaxierenden Patienten Gefahr laufe, die Stimmritze zu verletzen.«
»Wie du das machst, ist deine Sache«, entgegnete Dr. Scheibler. »Die Rippenbrüche lassen jeden Atemzug zu einer Tortur für ihn werden. Außerdem fürchte ich, daß er bald nicht mehr in der Lage sein wird, eigenständig zu atmen.«
Inzwischen hatten die Feuerwehrmänner die Fahrertür aufgeschweißt und wollten den Verletzten auf die bereitgestellte Trage heben.
»Rühren Sie ihn nur nicht an!« befahl Dr. Scheibler scharf, dann nahm er die Spritze entgegen, die Dr. Parker ihm durchs Fenster hereinreichte. Ohne zu zögern, schnitt der Chefarzt Bernds rechtes Hosenbein auf und desinfizierte die Einstichstelle am Oberschenkel. Dabei bemerkte er die Muskelanspannung des Patienten.
»Hören Sie zu, Bernd, ich muß Ihnen jetzt ein starkes Beruhigungsmittel spritzen, damit die Intubation für Sie erträglich wird«, erklärte er. »Sie sind jetzt ziemlich verkrampft, da wird der Einstich weh tun. Trotzdem dürfen Sie sich nicht bewegen, nicht einmal zusammenzucken. Schreien Sie oder weinen Sie, aber bewegen Sie sich keinen Millimeter.« Er sah die Angst in den Augen seines Patienten und fügte hinzu: »Ich werde so vorsichtig sein wie ich kann, und es dauert auch nur einen Augenblick.«
Er ließ Bernd gar keine Gelegenheit, darüber nachzudenken, sondern stieß die Nadel mit einem kurzen Ruck tief in den Muskel hinein.
»Au«, jammerte Bernd leise, weil nicht nur der Einstich, sondern auch das Einspritzen in den verkrampften Muskel schmerzte. Allerdings zeigte das Medikament rasch seine Wirkung. Bernd glitt in einen Dämmerzustand. Er fühlte, wie sein Kopf ein wenig nach hinten gebogen wurde, dann bekam er einen glatten, kühlen Gegenstand in den Mund, der seine Zunge nach unten drückte. Bernd mußte würgen und wollte sich wehren, doch sein ganzer Körper war wie gelähmt. Er fühlte den Schlauch, der tiefer und tiefer glitt, und hatte sekundenlang das Gefühl, daran zu ersticken, ehe er in eine barmherzige Bewußtlosigkeit sank.
*
Zur selben Zeit nahm Dr. Daniel in der Waldsee-Klinik an Mona Lombardi eine gründliche Untersuchung vor, während der junge Assistenzarzt Dr. Rainer Köhler schon die Platzwunde an der Stirn nähte. Mona wimmerte leise vor sich hin – nicht nur wegen der Schmerzen, die sie noch immer hatte, sondern vor allem, weil die Nervenanspannung jetzt nachließ und ihr auf einmal bewußt wurde, wie schlimm dieser Unfall hätte ausgehen können.
»Meine Babys«, stammelte sie angstvoll.
»Alles in Ordnung, Mona«, beruhigte Dr. Daniel sie, obwohl das eigentlich nicht den Tatsachen entsprach. Immerhin bestand eine leichte Schmierblutung, und die Gebärmutter wies Kontraktionen auf – kaum merklich, aber schlimm genug, daß eine Fehlgeburt drohte, wenn Arzt und Patientin jetzt nicht ganz vorsichtig waren.
»Mein Bauch tut noch immer weh«, wandte Mona ein.
Dr. Daniel nickte ernst. »Ich weiß, und damit ist auch nicht zu scherzen.« Er sah Dr. Köhler an. »Wenn Sie hier fertig sind, Rainer, dann besorgen Sie mir bitte ein Infusionsbesteck.«
Die Stationsschwester der Gynäkologie, Carola Stenzl, hatte seine Worte gehört und brachte ihm schon wenige Augenblicke später das Gewünschte.
»Ich werde Ihnen eine Infusion legen, damit die Kontraktionen der Gebärmutter aufhören«, erklärte Dr. Daniel, während er die Nadel bereits an der Vene unmittelbar hinter Monas Handgelenk ansetzte. »Nicht erschrecken, der Einstich tut ein bißchen weh.«
Mona zuckte zusammen.
»Schon vorbei«, meinte Dr. Daniel beruhigend, während er die Nadel vorsichtig zurückzog und gleichzeitig die Infusionskanüle weiter in die Vene vorschob. »Diese Infusion ist nötig, damit es zu keiner Fehlgeburt kommt.«
Mona erschrak. »Ich will die Babys nicht verlieren!«
»Ich werde alles tun, damit das nicht geschieht«, versprach Dr. Daniel. »Keine Sorge, Mona, die Infusion wird bald ihre Wirkung zeigen. Darüber hinaus ist der Muttermund noch fest geschlossen. Es wird sicher zu keiner Fehlgeburt kommen. Allerdings müssen Sie da auch ein bißchen mithelfen. In den nächsten Tagen, vermutlich sogar für ein paar Wochen, dürfen Sie das Bett nicht verlassen. Von Schwester Carola bekommen Sie einen Katheter gelegt, weil Sie nicht einmal auf die Toilette gehen dürfen.«
»Aber… meine Arbeit«, entgegnete Mona entsetzt. »Ich kann jetzt nicht einfach…«
»Sie müssen sich entscheiden, was Ihnen wichtiger ist«, fiel Dr. Daniel ihr sanft, aber bestimmt ins Wort. »Wenn Sie aufstehen, wird die Fehlgeburt nicht aufzuhalten sein.«
Mona war hin- und hergerissen zwischen ihren jetzt schon sehr mütterlichen Gefühlen und der Gewißheit, daß sie ihre leitende Position verlieren würde, wenn sie diesem Krankenhausaufenthalt zustimmte.
»Was soll ich bloß tun?« fragte sie verzweifelt.
Dr. Daniel griff nach ihrer Hand und hielt sie fest. »Sie hatten bei diesem Unfall sehr viel Glück, Mona. Die Geschichte hätte ganz dumm ausgehen können.« Er schwieg kurz. »Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, daß man Ihnen kündigen wird, weil Sie aufgrund eines Unfalls im Krankenhaus liegen.«
Mona nickte etwas halbherzig. »Ich habe diesen Posten noch nicht lange, und… es gibt einige, die ebenfalls sehr scharf darauf wären.«
»Aber Sie haben nach dieser kurzen Zeit doch schon große Erfolge vorzuweisen«, hielt Dr. Daniel dagegen.
Wieder nickte Mona, dann berührte sie mit den Fingerspitzen den Verband, den Dr. Köhler ihr angelegt hatte.
»Mein Kopf tut weh«, murmelte sie.
Dr. Daniel nickte. »Das glaube ich gern.« Er schob Monas fahrbares Bett eigenhändig aus dem Untersuchungsraum und zum Lift, der sie ins erste Stockwerk brachte.
»Schwester Carola wird in den nächsten Minuten kommen und Ihnen einen Katheter legen«, erklärte Dr. Daniel, als er Monas Bett in ein freies Patientenzimmer geschoben und verankert hatte. »Anschließend sollten Sie versuchen, ein bißchen zu schlafen. Bis morgen früh sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.«
Mona biß sich auf die Unterlippe. Sie wußte genau, daß sich bis morgen nur sehr wenig ändern würde.
»Ich möchte beides haben«, gestand sie offen ein. »Meine Kinder und meine Stellung.«
Spontan setzte sich Dr. Daniel zu ihr auf die Bettkante. »Ich fürchte, das wird schwer zu verwirklichen sein. Eine leitende Position, in der Überstunden an der Tagesordnung stehen, wäre schon mit einem Kind problematisch, mit Drillingen stelle ich mir das undurchführbar vor. Sie werden kaum eine Tagesmutter finden, die sich über Monate hinweg täglich mehr als acht Stunden um Drillinge kümmert. Aber selbst wenn… es ist nicht damit abgetan, diese drei Babys einfach zu versorgen. Sie bleiben nicht klein, sondern erweitern ihren Horizont, wollen Aufmerksamkeit, jemanden, der mit ihnen spielt. Irgendwann würde die Tagesmutter für sie zur direkten Bezugsperson, und ich bin sicher, daß das nicht in Ihrem Sinne wäre.« Er schwieg kurz. »Wenn Sie sich für Ihre Kinder entscheiden, sollten Sie das mit allen erforderlichen Konsequenzen tun. Dazu gehört, daß Sie nicht nur nach außen hin und auf dem Papier ihre Mutter sind. Allerdings müssen Sie sich in diesem Fall auch darüber klar sein, was es bedeutet, alleinerziehende Mutter von Drillingen zu sein. Sie müssen sich und die Kinder ja ernähren, aber gleichgültig, welche Arbeit Sie annehmen werden – es wird immer schwierig sein, Beruf und Kinder so unter einen Hut zu bringen, daß vor allem die Kinder nicht darunter leiden.«
Mona betrachtete ihn nachdenklich. »Ich kann mir nicht helfen, aber Ihre Worte klingen, als würden Sie aus Erfahrung sprechen.«
»Nun ja, nicht ganz. Als ich alleinerziehender Vater wurde, waren meine beiden Kinder schon fast erwachsen. Allerdings – ich bin Arzt aus Leidenschaft und zumindest in einem ist Ihre Vermutung richtig: Ich denke manchmal, meine Kinder hätten mich öfter und länger gebraucht, als ich ihnen zur Verfügung gestanden habe. Bei meinem kleinen Adoptivtöchterchen versuche ich diese Fehler zu vermeiden, doch schon jetzt bekomme ich von Tessa gelegentlich zu hören, daß ich nie Zeit für sie hätte, und damit hat sie oftmals nicht ganz unrecht. Dabei habe ich aber noch eine Frau, die ihre Arzttätigkeit Tessa zuliebe auf einen Halbtagsjob beschränkt hat. Sie sehen, Mona, wir sind zu zweit mit einem Kind, das trotz allem das Gefühl hat, seine Eltern noch öfter zu brauchen. Sie dagegen wären allein mit drei Kindern und einem Beruf.«
Mona seufzte tief auf. »Das heißt, mir bleibt gar keine andere Wahl, als die Kinder wegzugeben.«
»Eine Wahl bleibt Ihnen schon«, entgegnete Dr. Daniel. »Sie müssen nur abwägen, ob es für Sie und die Kinder eine gute Wahl ist. Diese letzte Entscheidung kann Ihnen niemand abnehmen, denn nur Sie allein wissen, inwieweit Sie in der Lage sind, Ihr Leben so zu organisieren, daß dabei nichts zu kurz kommt – vor allem auch Sie selbst nicht. Denn wenn das Leben nur noch aus Streß besteht, ist der Weg zum Zusammenbruch nicht weit, und damit wäre am Ende niemandem gedient.« Er lächelte Mona an. »Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich Ihnen ein Beruhigungsmittel geben muß, damit Sie einschlafen können.«
»Wird das meinen Babys auch nicht schaden?« fragte Mona sofort ängstlich.
Dr. Daniel schüttelte den Kopf. »Ganz bestimmt nicht. So viel Vertrauen dürfen Sie zu mir schon haben, daß ich Ihnen nie ein Medikament geben würde, das Ihre Schwangerschaft ungünstig beeinflussen könnte. Seien Sie ganz unbesorgt, Mona, ich möchte nur, daß Sie wirklich zur Ruhe kommen.«
Während Dr. Daniel die Spritze vorbereitete, kam Schwester Carola und legte der jungen Patientin rasch und geschickt einen Katheter.
»Jetzt habe ich erst recht das Gefühl, auf die Toilette zu müssen«, meinte Mona kläglich.
»Ich weiß schon«, entgegnete Carola teilnahmsvoll. »Der Reiz, den der Katheter verursacht, ist sehr unangenehm, aber das wird mit dem Medikament, das Sie von Dr. Daniel bekommen, auch ein wenig besser.«
Es zeigte sich, daß Carola recht hatte. Dr. Daniel hatte den Inhalt der Spritze gerade in die Infusionskanüle injiziert, als die Wirkung auch schon eintrat. Mona sank endlich in einen erholsamen Schlaf.
*
Währenddessen waren Dr. Scheibler und Dr. Parker noch immer an der Unfallstelle beschäftigt. Die Feuerwehrmänner hatten fast die ganze linke Seite des Unfallfahrzeugs aufgeschweißt und den Fahrersitz abmontiert. Jetzt hoben sie Bernd samt Sitz aus dem Auto.
»So, jetzt kommt der schwierigste Teil«, meinte Dr. Scheibler. »Wir müssen ihn auf die Trage bringen, ohne daß sich die Bruchenden verschieben«
Während er den Überzug des Sitzes aufschnitt, stellten Dr. Parker und Mario Bertoni schon die fahrbare Trage bereit.
»Dieser elende Raser verdient es gar nicht, daß man sich so um ihn bemüht«, knurrte einer der Feuerwehrmänner unwillig.
Dr. Scheibler fuhr aufgebracht herum. »Das will ich überhört haben!« Dabei gestand er sich nicht ein, daß er trotz der verteidigenden Worte, die Bernd nach dem Unfall gestammelt hatte, in gewisser Weise sogar ähnlich dachte wie dieser Feuerwehrmann. Vergeblich versuchte er zu vergessen, daß dieser verletzte junge Mann den Unfall durch seinen eigenen Leichtsinn verursacht hatte, doch es wollte ihm nicht so recht gelingen. »Jeder Verletzte verdient die bestmögliche Behandlung!«
»Beruhige dich, Gerrit«, versuchte Dr. Parker den Chefarzt zu besänftigen. »Bist du sicher mit dem Wirbelbruch?«
Dr. Scheibler nickte zerstreut. »Die geringste Verschiebung der Bruchenden kann eine Querschnittlähmung zur Folge haben.« er stand auf. »Los, Jeff, faß mit an. Mario, Ricky, Sie beide auch. Auf drei. Eins, zwei und… drei.« Gleichzeitig hoben die vier Männer an und legten den Verletzten auf die Trage, die mit einer speziellen Schale so abgesichert war, daß Bernd völlig bewegungslos lag.
»Okay«, meinte Dr. Scheibler. »Jetzt ab in die Klinik, aber fix.«
Ricky setzte sich ans Steuer und brauste los. In der Zwischenzeit legte Dr. Parker schon die ersten Infusionen und Dr. Scheibler nahm eine Punktion des Bauches vor.
»Verdammt, positiv«, knurrte er. »Wenn es jetzt nicht ganz schnell geht, verblutet er uns.«
Im Operationssaal der Waldsee-Klinik stellte sich dann auch gleich heraus, daß der Transport hierher wirklich keine Minute länger hätte dauern dürfen.
»Meine Güte, das ist ja das reinste Schlachtfeld«, entfuhr es der Oberärztin Dr. Lisa Walther, als Dr. Scheibler den Bauchschnitt gesetzt hatte und sie einen ersten Blick auf das Operationsfeld werfen konnte. »Der Mann hätte viel schneller in die Klinik transportiert werden müssen.«
»In Ordnung«, knurrte Dr. Scheibler. »Nächstes Mal werde ich keine Rücksicht auf Wirbelsäulenverletzungen mehr nehmen.«
Erschrocken sah Lisa ihn an. Einen solchen Ton war sie von Dr. Scheibler sonst nicht gewohnt.
»Entschuldigen Sie, Gerrit, das wußte ich nicht«, murmelte sie verlegen.
»Dann halten Sie sich beim nächsten Mal mit Kommentaren irgendwelcher Art zurück, bis Sie über alle Einzelheiten informiert sind«, erwiderte Dr. Scheibler ungewöhnlich barsch.
»Gerrit«, mischte sich nun Dr. Parker in mahnendem Ton ein.
Der Chefarzt atmete tief durch. »Tut mir leid, Lisa. Ich wollte Sie nicht verletzen. Es ist nur die Sorge um ihn…« Er nickte zu dem Patienten hin, während er schon begonnen hatte, die gerissene Milz, die zu den erheblichen Blutungen geführt hatte, zu entfernen.
»Schon gut, Gerrit«, meinte sie, die ihm gleich hilfreich assistierte. »Wir wollen ja alle nur, daß er überlebt… und daß er wieder gesund wird.«
»Kann ich helfen?« fragte in diesem Moment Dr. Daniel, der den Operationssaal unbemerkt betreten hatte.
Dr. Scheibler nickte. »Ja, Robert, übernehmen Sie bitte meinen Platz.« Er sah die Oberärztin an. »Lisa, Sie bringen das zu Ende, was ich begonnen habe. Robert wird Ihnen assistieren. Ich muß mich um die Rippen des Jungen kümmern.«
Dr. Daniel bemerkte die unterschwellige Gereiztheit des Chefarztes.
Während Dr. Daniel die erste Assistenz übernahm, warf er Dr. Scheibler einen kurzen prüfenden Blick zu.
»Was ist los, Gerrit? Derartige Operationen sind für Sie doch kein Neuland.«
»Rippenserienfrakturen rechts und links. Wir brauchen eine Röntgenaufnahme des Thorax«, erklärte Dr. Scheibler, als hätte er Dr. Daniels Frage gar nicht gehört, dann blickte er kurz zu ihm hinüber. »Wenn die unmittelbare Gefahr gebannt ist, habe ich an dem Burschen noch ein paar Wirbelbrüche zu versorgen, und dann kann ich nur hoffen, daß die Mühe, die ich mir am Unfallort gegeben habe, nicht umsonst war. Er steht am Rande einer Querschnittslähmung.«
Währenddessen hatte der junge Assistenzarzt Dr. Rainer Köhler die geforderte Röntgenaufnahme gemacht, und das Ergebnis war so, wie Dr. Scheibler schon befürchtet hatte.
»Pneumothorax«, urteilte er. »Ich lege eine Pleuradrainage. Intubation und künstliche Beatmung müssen auch nach der Operation bis auf weiteres aufrechterhalten werden.«
Die Ärzte arbeiteten schweigend und voller Konzentration, dann waren die Blutungen gestillt und auch Dr. Scheibler war mit seiner Arbeit fertig, doch auf ihn wartete jetzt noch ein letzter Akt von Feinmechanik.
»O verdammt«, stieß er hervor, als er einen ersten Blick auf die Wirbelbrüche werfen konnte. »Ich habe so gehofft…«
Unwillkürlich hielt Dr. Daniel den Atem an. »Wird er doch gelähmt sein?«
»Nein«, brachte der Chefarzt gepreßt hervor. »Im Moment kann ich es wohl abwenden, aber der Bruch ist instabil.«
Obwohl Dr. Daniel auf die Gynäkologie spezialisiert war, wußte er, was das bedeutete: Bernd Köster würde aller Wahrscheinlichkeit nach nie wieder völlig gesund werden.
*
Mona Lombardi erwachte vom Klingeln des Telefons. Obgleich ihr der Infusionsschlauch ziemlich im Weg war, erreichte sie doch mit einer Hand das fahrbare Nachttischchen und zog es näher heran, damit sie den Telefonhörer abnehmen konnte.
»Lombardi«, meldete sie sich mit ihrer angenehm sanften Stimme.
»Frau Lombardi, Gott sei Dank, Sie sind einigermaßen wohlauf«, drang die Stimme des Vorstandsvorsitzenden Heinrich Gellner an ihr Ohr. »Ein Dr. Daniel hat uns heute früh benachrichtigt, daß Sie einen Unfall hatten.«
»Das ist richtig«, stimmte Mona zu und wertete die offensichtliche Besorgnis von Heinrich Gellner als sehr positiv für ihre momentane Situation. »Ein anderer Autofahrer ist mir mit hoher Geschwindigkeit hinten aufgefahren.« Für einen Moment dachte sie daran, daß sie sich bei Dr. Daniel gar nicht nach dem Zustand des Unfallfahrers erkundigt hatte, dann schob sie diesen Gedanken wieder beiseite. Wer so rücksichtslos dahinraste, verdiente doch eigentlich gar kein Mitgefühl.
»Das bedeutet, daß Sie für eine Weile ausfallen werden«, meinte Heinrich Gellner.
Unwillkürlich hielt Mona den Atem an. Wie sollte sie jetzt reagieren? Was sollte sie sagen?
»Mein behandelnder Arzt möchte mich eine Weile hier in der Klinik behalten«, begann sie, berührte für einen Moment ihren Bauch und wußte im selben Moment, daß sie auf ihre berufliche Karriere nicht verzichten konnte. »Ich werde morgen wieder im Büro erscheinen und…«
»Das kommt überhaupt nicht in Frage, Frau Lombardi!« fiel Heinrich Gellner ihr heftig ins Wort. »Sie hatten einen Unfall, und wenn Ihr Arzt eine Entlassung aus dem Krankenhaus für bedenklich hält, dann hat er dafür sicher zwingende Gründe.« Er schwieg kurz. »Wenn wichtige Entscheidungen zu treffen sind, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen. Ansonsten wird das Kaufhaus für ein paar Tage auch ohne Ihre Anwesenheit existieren können.«
Mona fiel ein Stein vom Herzen. »Heißt das… ich werde meine Stellung nicht verlieren?«
»Aber ich bitte Sie, Frau Lombardi!« erwiderte Heinrich Gellner energisch. »Wenn Sie einfach blaumachen würden, aber so… immerhin liegen Sie aufgrund eines Unfalls im Krankenhaus. Machen Sie sich keine Sorgen. Man wird Sie nicht einfach als Managerin absetzen. Dazu haben wir alle viel zu großes Vertrauen zu Ihnen und Ihren Fähigkeiten. Ihre ersten Maßnahmen haben ja bereits beachtliche Erfolge gezeigt. Sehen Sie nur zu, daß Sie wieder gesund werden. Alles andere wird sich dann schon finden.«
Mona hätte am liebsten vor Freude einen Luftsprung gemacht. Mit so viel Entgegenkommen hatte sie niemals gerechnet.
»Vielen Dank, Herr Gellner«, meinte sie und versprach: »Ich werde sicher bald wieder im Büro sein.«
Der Vorstandsvorsitzende betonte noch einmal, daß Mona nur ja auf ihre Gesundheit schauen solle, dann verabschiedete er sich. Zufrieden legte Mona auf. Wieder berührte sie einen Moment lang ihren Bauch, doch sie wußte, daß sie sich ganz richtig entschieden hatte. Als Hausfrau und Mutter würde sie niemals diese Erfüllung finden wie in ihrem Beruf – ganz davon abgesehen, daß sie es sich nicht würde leisten können, nur Hausfrau und Mutter zu sein. Mehr aber als das bloße Geldverdienen, brauchte sie die Bestätigung, die sie gerade von Heinrich Gellner bekommen hatte. Sie war eine erfolgreiche Managerin, und mit den Jahren würde sie noch viel erfolgreicher werden. Das wollte sie nicht missen.
Ihe Kinder hatten es aber auch nicht verdient, eine Mutter zu haben, die nur für ihre Karriere lebte.
Sie waren mit Adoptiveltern sicher tausendmal besser dran als mit einer ewig gestreßten Mutter, die weder für ihre Kinder noch für ihre Karriere genügend Zeit haben würde und mit den Jahren wohl immer gefrusteter werden würde.
Als Dr. Daniel am späten Vormittag ihr Zimmer betrat, bemerkte er sofort die Veränderung, die in ihr vorgegangen war. Er deutete sie gleich ganz richtig.
»Sie haben sich entschieden, nicht wahr?«
Mona nickte. »Ich werde meine Kinder zur Adoption freigeben, aber nur unter der Voraussetzung, daß sie zusammenbleiben können.«
»Das läßt sich bestimmt einrichten«, stimmte Dr. Daniel ihr zu, dann setzte er sich auf die Bettkante. »Wie sind Sie nun zu diesem raschen Entschluß gekommen, wenn ich fragen darf? Noch gestern abend waren Sie ja ziemlich unschlüssig.«
»Ich habe heute die Bestätigung bekommen, die ich brauche, um wirklich glücklich zu sein«, antwortete Mona und erzählte in wenigen Worten vom Anruf des Vorstandsvorsitzenden. »Auf dieses Hochgefühl, wirklich jemand zu sein, könnte ich auf Dauer nicht verzichten. Es mag herzlos klingen, aber… ich brauche meine Karriere mehr als die Kinder, die ich trage.«
»Für mich klingt es nicht herzlos, weil ich genau weiß, wie schwer Sie sich zu diesem Entschluß durchgerungen haben«, entgegnete Dr. Daniel. »Ich vermute auch, daß Sie noch manche Zweifel durchzustehen haben werden, wenn sie die ersten Kindsbewegungen spüren. Allerdings will ich Ihnen jetzt schon sagen, daß ich Ihre Entscheidung in diesem Fall absolut richtig finde. Sie sind eine Frau, die mit ganzem Herzen bei der Sache sein will. Nur deshalb haben Sie in Ihrem Beruf so großen Erfolg, und nur deshalb sind Sie überhaupt so weit gekommen. Wären Sie verheiratet und könnten den Beruf für ein paar Jahre unbesorgt zurückstellen, dann wären Sie auch als Mutter mit ganzem Herzen bei der Sache gewesen. So wie Ihre Situation im Moment aber aussieht, hätten Sie zwangsläufig immer das Gefühl gehabt, alles nur halb tun zu können, und das hätten Sie auf Dauer nicht verkraftet.«
Mona war eine ganze Weile sprachlos. Wie hatte Dr. Daniel es nur geschafft, sie in der kurzen Zeit, die er mit ihr verbracht hatte, so gründlich zu durchschauen?
»Wie konnten Sie mich so gut einschätzen?« fragte sie schließlich fassungslos.
Dr. Daniel lächelte. »Wissen Sie, Mona, in meinem Beruf erarbeitet man sich mit den Jahren auch ein bißchen Menschenkenntnis und gerade bei Ihnen war das nicht ganz so schwierig. Sie sind ein sehr offener Mensch, sprechen aus, was Sie denken und fühlen… es war also wirklich kein allzu großes Problem, Sie richtig einzuschätzen.«
Auch Mona lächelte jetzt. »Ich bin froh, daß Sie meinen Entschluß billigen.« Wieder streichelte sie liebevoll über ihren Bauch. »Er ist mir wahrlich nicht leichtgefallen und vermutlich haben Sie recht: Ich werde sicher noch mit Zweifeln zu kämpfen haben, aber dann werde ich immer an das denken, was Sie mir gerade gesagt haben: Man kann nicht zwei verschiedene Dinge mit ganzem Herzen tun. Etwas käme dabei zu kurz, und das will ich nicht.«
*
Als Bernd Köster erwachte, registrierte er als erstes den Schlauch in seinem Mund. Mit der Zunge wollte er danach tasten, doch sein Körper gehorchte den Befehlen des Gehirns noch nicht.
Die Erinnerung an das, was er im Dämmerzustand erlebt hatte, wurde wieder wach. Irgend jemand hatte ihm einen Schlauch in den Hals geschoben, und offensichtlich steckte er noch immer dort. Überhaupt fühlte sich sein Hals rauh und trocken an. Er mußte husten und würgen, was den Druck verstärkte und zu unerträglichen Schmerzen im Brustkorb führte.
»Ganz ruhig, Herr Köster, es ist alles in Ordnung«, hörte er eine sanfte Frauenstimme. Gleich darauf rückte das Gesicht einer Krankenschwester in sein Blickfeld. Wieder mußte er husten und würgen. Er wollte den Schlauch herausziehen, doch er konnte sich nicht bewegen. Nicht einmal den Arm konnte er heben, was bei ihm zu plötzlicher Panik führte.
»Herr Köster, können Sie mich hören?«
Es war offensichtlich ein Arzt, der diese deutlichen Worte sprach. Bernd konnte blaue Augen, dunkelblonde Haare und einen kurzgeschnittenen Vollbart erkennen und erinnerte sich vage daran, daß er diesen Mann auch an der Unfallstelle gesehen hatte.
Er wollte auf die Frage des Arztes antworten, doch sprechen war wegen des Schlauches nicht möglich und als er zu nicken versuchte, bemerkte er, daß er nicht einmal seinen Kopf bewegen konnte.
Gelähmt! schoß es ihm durch den Kopf. Am ganzen Körper gelähmt!
Seine Panik verstärkte sich. Der würgende Husten wurde immer schlimmer. Röchelnd holte Bernd tief Luft, was die Schmerzen in seinem Brustkorb ins Unerträgliche steigerte.
»Bernd, beruhigen Sie sich.«
Mit diesen Worten tauchte das Gesicht des Arztes, der ihn an der Unfallstelle versorgt hatte, in seinem Blickfeld auf. Allein die Anwesenheit Dr. Scheiblers und sein ruhiger, bestimmter Ton vermochten Bernd ein wenig zu beruhigen. Doch in seinen weit aufgerissenen Augen stand immer noch nackte Angst.
»Ganz ruhig, mein Junge«, fuhr Dr. Scheibler fort und legte besänftigend eine Hand auf Bernds Kopf. Die Tatsache, daß er diese Berührung fühlen konnte, entspannte ihn ein wenig. Der Hustenreiz ließ nach.
»So ist es gut, Bernd«, meinte der Chefarzt behutsam. »Ich weiß, daß Sie mich hören können, und vermutlich erkennen Sie mich auch wieder. Ich bin Dr. Scheibler, der Chefarzt hier. Sie hatten einen schweren Unfall. Dabei haben Sie sich etliche Rippen gebrochen, und deshalb müssen wir Sie künstlich beatmen. Sie hätten sonst ganz fürchterliche Schmerzen und das wollen Sie doch nicht.«
Erneut versuchte Bernd die Hand zu heben und als es nicht ging, geriet er wieder in Panik. Er hustete und würgte, was sich noch verstärkte, je mehr er sich seiner absoluten Bewegungslosigkeit bewußt wurde. Plötzlich begriff Dr. Scheibler, was mit ihm los war. Er gab Dr. Parker, der dem Patienten schon ein starkes Beruhigungsmittel in die Infusionskanüle spritzen wollte, ein Zeichen zu warten.
»Bernd, hören Sie mir zu!« verlangte Dr. Scheibler jetzt mit unüberhörbarer Strenge. Sein bestimmter Ton bewirkte auch diesmal, daß der junge Mann ein wenig ruhiger wurde. »Sie sind nicht gelähmt. Haben Sie gehört? Sie können sich im Moment nicht bewegen, weil Sie in einem Gipskorsett liegen, aber Sie sind nicht gelähmt.«
Tränen der Erleichterung rollten über Bernds Wangen.
»Ist schon gut, mein Junge.« Noch einmal legte er seine Hand auf Bernds Kopf. »Ich weiß, es ist schlimm für Sie, so dazuliegen, aber im Moment haben wir leider keine andere Wahl, als Sie zu absoluter Bewegungslosigkeit zu verdammen. Wir werden Sie jetzt wieder einschlafen lassen, dann ist es erträglicher für Sie.«
Dr. Parker drückte die Spritze auf die Infusionskanüle und preßte so den Inhalt direkt in die Vene. Augenblicklich begannen Bernds Lider zu flattern, dann war er eingeschlafen.
»Ich hätte nicht gedacht, daß es dir noch gelingen würde, ihn zu beruhigen«, meinte Dr. Parker. »Wenn die Patienten versuchen, den Tubus auszuhusten, dann herrscht meistens Alarmstufe rot, und man hat in der Regel nur noch zwei Möglichkeiten: Entweder sofort extubieren oder schnellstens schlafen schicken.«
»Er hatte lediglich Angst, und das ist verständlich«, erwiderte Dr. Scheibler. »Stell dir vor, du würdest nach einem Unfall im Krankenhaus erwachen und könntest dich nicht bewegen, nicht sprechen… Ich bin sicher, daß du da auch in Panik geraten würdest.«
Dr. Parker nickte aus eigener Erfahrung.
Er konnte das sogar sehr gut nachempfinden, denn immerhin hatte er nach seinem schweren Autounfall auch so ähnlich dagelegen.
»Ich wäre ganz sicher in Panik geraten, wenn nach dem Aufwachen nicht Karina bei mir gewesen wäre«, gestand er.
»Na siehst du«, meinte Dr. Scheibler, dann sah er Schwester Alexandra an. »Spritzen Sie vor Beendigung Ihrer Schicht noch einmal nach. Er sollte in den nächsten Tagen möglichst selten zu sich kommen.« Er warf einen Blick auf die Uhr. »Seine Eltern werden schon auf mich warten.«
»Dann heißt es für dich also Farbe bekennen«, folgerte Dr. Parker.
Der Chefarzt gab ihm recht. »So ähnlich, ja.« Er sah zu Bernd zurück. »Ihm kann man die Wahrheit noch nicht zumuten.« Dann seufzte er tief auf und machte sich auf den Weg zu seinem Büro.
Es stellte sich heraus, daß nicht nur Bernds Eltern gekommen waren, sondern auch seine beiden älteren Geschwister.
»Was ist mit unserem Sohn!« platzte Hermine Köster sofort heraus.
Dr. Scheibler bat die Angehörigen seines Patienten in sein Büro und bot ihnen Platz an.
»Vorweg gleich eines«, begann er. »Herr Köster ist außer Lebensgefahr.«
Bernds Mutter brach in Tränen der Erleichterung aus.
»Und wo ist der Haken an der Sache?« wollte sein Bruder Markus wissen.
Dr. Scheibler atmete tief durch. »Herr Köster hat sich bei dem Unfall einen Wirbelbruch zugezogen.« Er schaltete den Bildschirm ein, vor dem ein Röntgenbild hing, das offensichtlich Bernds Wirbelsäule zeigte. Der Chefarzt deutete auf eine Stelle an dem Bild. »Die Verletzung liegt genau hier, und sie ist unglücklicherweise instabil, das heißt, daß die Wirbel im Bereich der Verletzung nicht mehr befestigt sind. Es ist zwar möglich, daß die Verletzung ausheilt, wenn Herr Köster lange genug im Gipskorsett liegt, aber die Wahrscheinlichkeit, daß ein gewisses Restrisiko bestehen bleibt, liegt sehr nahe.«
»Was ist das für ein Risiko?« wollte Markus wissen, während seine Eltern und seine Schwester wie erstarrt zuhörten.
Dr. Scheibler zögerte – nicht, weil er etwa die Wahrheit verschweigen wollte, sondern weil er das, was im Körper seines Patienten ablaufen könnte, jetzt so anschaulich wie möglich erklären mußte.
»Es könnte sein, daß sich die Wirbel einmal verschieben… sei es durch eine unbedachte, ruckartige Bewegung, durch einen erneuten Unfall oder ähnliches. Wenn das passieren würde, dann könnte im ungünstigsten Fall das Rückenmark in Mitleidenschaft gezogen werden, und das würde eine Querschnittslähmung zur Folge haben.«
Hermine Köster schlug mit einem leisen Aufschrei die Hände vor den Mund, aber auch ihr Mann und ihre beiden erwachsenen Kinder waren sichtlich betroffen.
»Bernd ist Sportlehrer«, brachte Markus nach einer Weile des Schweigens hervor.
Bedauernd schüttelte Dr. Scheibler den Kopf. »Diesen Beruf wird er auf alle Fälle aufgeben müssen. Damit würde er eine erneute Verletzung ja förmlich herausfordern.«
»Das wird ein schrecklicher Schock für ihn sein«, vermutete sein Vater, dann blickte er Dr. Scheibler an. »Weiß er es schon?«
»Nein«, antwortete Dr. Scheibler. »Eine solche Mitteilung kann man ihm im Moment noch nicht zumuten. Man kann ihn frühestens dann damit konfrontieren, wenn er wieder in der Lage ist zu sprechen.«
Die Eltern und Geschwister des Patienten erschraken erneut, doch der Chefarzt beruhigte sie sogleich.
»Ich habe mich da mißverständlich ausgedrückt. Herr Köster kann im Moment nicht sprechen, weil er noch künstlich beatmet wird.« Er stand auf. »Sie dürfen ihn auch gern sehen, allerdings nur kurz, weil er noch auf der Intensivstation liegt. Erschrecken Sie auch bitte nicht. Die künstliche Beatmung und die vielen anderen Geräte, die zur Intensivüberwachung nötig sind, wirken auf einen medizinischen Laien oftmals sehr bedrohlich. Zudem halten wir Herrn Köster absichtlich noch ohne Bewußtsein. Er wird also nicht ansprechbar sein, aber Sie müssen dennoch keine Angst haben. Er liegt nicht im Koma, sondern schläft nur unter der Einwirkung von Medikamenten.«
Trotz dieser beruhigenden Worte erschraken die Kösters ganz schrecklich, als sie Bernd zwischen all den Schläuchen und Apparaten liegen sahen.
»Es ist alles meine Schuld«, murmelte Markus betroffen.
Dr. Scheibler sah ihn an, dann schüttelte er den Kopf. »Nein, Herr Köster, es ist ganz allein seine Schuld. Er fuhr wie ein Irrer. Das Auto vor sich hat er angeblich nicht… besser gesagt, zu spät gesehen. Trotzdem hat er nicht mal versucht zu bremsen, sondern ist diesem Wagen mit knapp zweihundert hinten draufgebrummt. Er kann von Glück sagen, daß er überhaupt noch lebt.«
Markus schluckte schwer, dann nahm er den Chefarzt ein Stück beiseite, um allein mit ihm sprechen zu können.
»Im Gegensatz zu mir wissen Sie aber nicht, warum er es getan hat«, meinte Markus leise.
»Er kam an der Unfallstelle zu sich und sagte zu mir, er wäre kein Raser. Er wäre lediglich einsam gewesen, aber das ist in meinen Augen noch lange kein Grund für ein derart rücksichtsloses Verhalten.«
Einen Augenblick kämpfte Markus mit sich, dann entschloß er sich für die Wahrheit: »Vor zwei Jahren habe ich die Frau geheiratet, die er liebte. Ich glaube, inzwischen ist er drüber weg, aber… als er jetzt dreißig wurde… er wollte gar keine Feier, doch wir alle haben ihn dazu gedrängt, und als wir gegessen und getrunken hatten, da… da ließen wir ihn allein – ich auch, obwohl ich wußte, wie sehr er unter seiner Einsamkeit leidet. Bernd ist äußerst sensibel. Ich bin sicher, er wollte gar nicht so schnell fahren. Vermutlich war es ihm nicht einmal bewußt. Er war einfach auf der Flucht… auf der Flucht vor sich selbst… vor dieser entsetzlichen Einsamkeit, die er so sehr haßte.« Er schwieg kurz, dann bat er leise: »Herr Doktor, bitte, verurteilen Sie ihn nicht deswegen.«
»Ich verurteile ihn ja gar nicht«, entgegnete Dr. Scheibler. »Was Sie gerade erzählt haben, erklärt auch tatsächlich einiges, aber es entschuldigt dennoch nichts, und Sie können sicher sein, daß ich beizeiten ein ernstes Wort mit Ihrem Bruder sprechen werde.«
*
Nach fast vier Wochen gab Dr. Daniel für Mona Lombardi endlich grünes Licht – allerdings nicht ganz so, wie sie sich das erhofft hatte.
»Sie dürfen sich keinesfalls überanstrengen«, mahnte er. »Das bedeutet, keine Überstunden, keine stundenlangen Sitzungen und mindestens zweimal am Tag eine halbe Stunde absolute Ruhe – hinlegen, Augen schließen, gar nichts tun«, zählte er im Telegrammstil auf.
Mona seufzte. »Wie stellen Sie sich das vor, Herr Doktor? Ich bin Managerin eines Kaufhauses und wenn ich…«
»Sie sind werdende Mutter, und ich denke, Sie wollen das Leben Ihrer Kinder nicht gefährden, auch wenn Sie vorhaben, die Drillinge zur Adoption freizugeben.«
»Natürlich will ich die Kinder nicht gefährden«, räumte Mona sofort ein. »Allerdings wird es nicht ganz einfach sein, Ihre Anordnungen immer einzuhalten.«
»Das weiß ich, aber Sie werden es schon schaffen«, meinte Dr. Daniel und lächelte dabei. »Es kommt übrigens noch eine Anordnung hinzu: Ich möchte Sie jeden zweiten Tag in meiner Praxis sehen.«
Mona ließ sich in die Kissen zurückfallen. »Es gibt zwar Sicherheit, daß Sie absolut kein Risiko eingehen, aber… soll ich ehrlich sein? Es wäre fast einfacher für mich, meine Arbeit von der Klinik aus zu erledigen.«
Dr. Daniel schmunzelte. »Damit wäre ich durchaus einverstanden, denn auf diese Weise hätte ich Sie wenigstens unter meiner Kontrolle.« Er wurde ernst. »Es besteht kein zwingender Grund, Sie noch länger in der Klinik zu behalten. Die Infusionen konnten ja schon nach zwei Tagen abgesetzt werden und seit einer Woche müssen Sie auch keine strikte Bettruhe mehr einhalten. Sie und Ihre Babys hatten bei diesem Unfall sehr viel Glück, trotzdem dürfen Sie jetzt keinesfalls leichtsinnig sein.«
»Ganz bestimmt nicht«, versprach Mona ernsthaft. »Ich werde nichts tun, was die Babys irgendwie gefährden würde, und Sie können sich auch darauf verlassen, daß ich mich an alle Ihre Anordnungen halten werde.« Sie zögerte. Dr. Daniel hatte mit seinen Worten die Erinnerung an den Unfall heraufbeschworen und obwohl Mona gedacht hatte, das Schicksal des Unfallverursachers wäre ihr gleichgültig, weil er so rücksichtslos gefahren war, ließ ihr die Ungewißheit, was aus ihm geworden war, nun doch keine Ruhe.
»Der Mann, der mir hinten aufgefahren ist… das heißt… ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ein Mann war…«, begann sie.
Dr. Daniel nickte. »Ja, Mona, es war ein Mann. Er ist nur wenig älter als Sie.«
Mit einer Hand strich Mona ihr Haar zurück.
»Seltsam«, murmelte sie. »Irgendwie dachte ich, er wäre wesentlich jünger… achtzehn, zwanzig vielleicht.« Sie schüttelte den Kopf. »Wie kann ein Mensch um die Dreißig noch so kopflos durch die Gegend rasen? In diesem Alter sollte er doch schon vernünftiger sein.«
Dr. Daniel wußte vom Chefarzt zwar schon einiges über Bernd Köster, doch das konnte er Mona gegenüber nicht einfach so erzählen.
»Er war wohl ein wenig durcheinander, als er ins Auto stieg und losfuhr«, wich er daher aus.
Nachdenklich blickte Mona vor sich hin, dann sah sie Dr. Daniel an. »Wissen Sie, im ersten Moment… nein, sogar noch während der ganzen Zeit, wo ich hier liegen mußte… ich habe einige Male an ihn gedacht… wollte mich auch schon nach ihm erkundigen, aber…« Sie atmete tief durch. »Ich habe mir eingeredet, daß ein so rücksichtsloser Autofahrer kein Mitgefühl verdient.« Verlegen blickte sie nach unten. »Das klingt hartherzig, nicht wahr?«
»Ja«, gab Dr. Daniel ohne Umschweife zu. »In Ihrer Situation ist das aber auch ganz verständlich. Durch seine Schuld hätten Sie Ihre Babys verlieren können, und unter diesem Aspekt kann man ein bißchen Hartherzigkeit durchaus verzeihen.«
Langsam hob Mona den Kopf. »Wie geht es ihm?«
»Nicht sehr gut«, antwortete Dr. Daniel ehrlich. »Er mußte seinen Leichtsinn teuer bezahlen.«
Monas Gedanken gingen bei diesen Worten gleich in eine bestimmte Richtung. »Ist er… gelähmt?«
»Nein, aber das verdankt er nur der Umsichtigkeit unseres Chefarztes. Im übrigen sind seine Verletzungen auch ohne eine Lähmung noch immer schwer genug.«
»Hat er… nach mir gefragt?« wollte sie wissen und fügte hinzu, bevor Dr. Daniel etwas antworten konnte: »Ich meine… wenn er nicht völlig gewissenlos ist, dann muß er sich um den Menschen, den er mit seiner Fahrweise gefährdet hat, doch eigentlich Gedanken machen.«
»Da haben Sie sicher recht, aber selbst wenn er nach Ihnen hätte fragen wollen – es wäre ihm noch nicht möglich gewesen, weil er nach wie vor künstlich beatmet werden muß und daher nicht sprechen kann.«
Nun war Mona wirklich betroffen.
»Ich würde ihn gern einmal besuchen«, bat sie spontan. »Wissen Sie, vielleicht macht er sich ja wirkich Gedanken und… ich würde ihm gern sagen, daß ich soweit in Ordnung bin.«
»Das ist nett gemeint von Ihnen«, entgegnete Dr. Daniel. »Trotzdem sollten Sie mit einem Besuch lieber noch warten. Im Augenblick würde der junge Mann vermutlich nur wenig mitbekommen. Der Chefarzt hält ihn meistens ohne Bewußtsein, denn obwohl Herr Köster mittlerweile weiß, daß sowohl seine momentane Bewegungslosigkeit als auch die künstliche Beatmung nur vorübergehend sind, gerät er deswegen immer wieder mal in Panik. Dabei kann er sich natürlich verletzen und obgleich die ständigen Beruhigungsmittel keine Ideallösung sind, sind sie im Verhältnis immer noch der beste Weg. Allerdings ist er dadurch auch in den wenigen wachen Minuten kaum ansprechbar.«
Obwohl Mona den jungen Mann nicht kannte und in den vergangenen Wochen beim Gedanken an den rücksichtslosen Autofahrer, für den sie ihn gehalten hatte und wohl auch noch immer hielt, nur Wut empfunden hatte, zog sich ihr Herz bei Dr. Daniels Schilderung doch irgendwie vor Mitleid zusammen. Sicher, er hatte einen Unfall verursacht, der bei gemäßigterer Fahrweise nicht passiert wäre. Die ganze Geschichte hätte ja auch für Mona wesentlich weniger glimpflich ausgehen können – trotzdem… eine solche Strafe hatte er vielleicht auch nicht verdient.
»Sobald es ihm bessergeht, werde ich Sie benachrichtigen«, versprach Dr. Daniel. »Wie gesagt, ich kenne den jungen Mann nicht, aber nach allem, was ich von Dr. Scheibler erfahren habe, denke ich, daß ihm das, was er da angerichtet hat, sehr leid tut, und daß er sich um Sie tatsächlich Sorgen macht. Es ist also sicher nicht verkehrt, wenn Sie ihn dann besuchen und ihn zumindest in dieser Hinsicht beruhigen können.«
*
»Allmählich sollte er aber aufwachen«, meinte Dr. Scheibler mit einem Blick zur Uhr.
Als wäre das sein Stichwort, öffnete Bernd in diesem Moment die Augen. Sofort beugte sich der Chefarzt über ihn und suchte seinen Blick.
»Keine Panik, Bernd, es ist alles in Ordnung«, versuchte er ihn schon im Vorfeld zu beruhigen, denn wenn der junge Mann erst wieder anfing zu husten und zu würgen, würde das die geplante Extubierung nicht gerade erleichtern. »Wenn Sie schön tun, was wir sagen, dann kann Dr. Parker Sie vielleicht von diesem gräßlichen Schlauch befreien.«
Dr. Scheibler sah seinem jungen Patienten an, daß sich bei ihm allein aufgrund dieser Worte schon wieder Hustenreiz einstellte.
»Sie sollen weder husten noch würgen, sondern allein das tun, was Dr. Parker Ihnen sagt«, befahl Dr. Scheibler und fand dabei erneut den richtigen Ton, um Bernds Gehorsam zu erzwingen.
»Sie müssen keine Angst haben«, meinte Dr. Parker, der jetzt in Bernds Blickfeld trat. »Es wird gar nicht so schlimm. Sie werden jetzt ganz tief einatmen.«
Bernd gehorchte, wobei Dr. Parker das Atemzugvolumen kontrollierte. Es lag zwar gerade mal bei 400 ml, was seinen Grund aber wohl darin hatte, daß Bernd wegen der noch immer schmerzenden Rippenbrüche nicht wirklich tief einzuatmen wagte.
»In Ordnung«, murmelte Dr. Parker, dann blickte er Bernd an. »Noch einmal tief einatmen und durch den Mund aus – so, als würden Sie eine ganze Batterie von Kerzen ausblasen.«
Wieder tat Bernd nur halbwegs das, was Dr. Parker gefordert hatte, doch der junge Anästhesist war erfahren genug, um trotzdem Komplikationen zu vermeiden. Die Prozedur wurde lediglich für den Patienten wesentlich unangenehmer. Bernd hustete und würgte noch, als der Tubus längst draußen war.
»Ist ja gut«, versuchte Dr. Scheibler ihn zu beruhigen, während Dr. Parker dem jungen Mann einen durchsichtigen Schlauch, aus dem kühler Sauerstoff strömte, vor die Nase legte, um ihm das Atmen zu erleichtern.
Bernd wollte sprechen, brachte aber nur ein heiseres Krächzen hervor.
»Damit werden Sie sich noch ein bißchen gedulden müssen«, meinte Dr. Parker. »Nach dieser langen künstlichen Beatmung wird es eine Weile dauern, bis Ihre Stimme wieder richtig mit macht. Aber keine Sorge, es wird alles in Ordnung kommen.«
Dr. Scheibler sah allein schon an Bernds Augen, wie viele Fragen ihm förmlich auf der Zunge brannten, und er konnte sich auch vorstellen, in welche Richtung diese Fragen gehen würden, trotzdem brachte er die Worte, die Bernds Gewissen beruhigt hätten, nicht über die Lippen. Dr. Scheibler war ein sehr mitfühlender Mensch, doch gerade bei Bernd gelang es ihm einfach nicht, wirkliches Mitleid zu haben und das machte ihm arg zu schaffen. Gleichgültig, wie es zu diesem Unfall gekommen war – er wollte diesen jungen Mann gegenüber nicht mehr hartherzig sein.
»Ruhen Sie sich ein bißchen aus«, meinte Dr. Scheibler. »Ich komme später noch einmal zu Ihnen.«
Bernds Augen bettelten. Er versuchte, den Chefarzt mit Blicken festzuhalten, doch Dr. Scheibler wandte sich ab und ging hinaus.
»Was ist los, Gerrit?« wollte Dr. Parker wissen.
»Nichts«, behauptete Dr. Scheibler wenig glaubwürdig.
»Erzähl’ mir bitte keine Märchen«, entgegnete der junge Anästhesist energisch. »Noch bei keinem Intensivpatienten hast du einen derart strengen Ton angeschlagen. Und auch jetzt… du hast doch genau gemerkt, welche Angst der Junge hat, allein zu sein.«
»Laß mich in Ruhe«, grummelte Dr. Scheibler und wollte gehen, doch als er sich umdrehte, sah er sich ganz unvermittelt Dr. Daniel gegenüber.
»Jeff hat vollkommen recht«, meinte nun auch er. »Sehen Sie, Gerrit, durch meine Arbeit in der Praxis und Klinik bekomme ich hier zwangsläufig nicht alles mit, aber sogar ich habe gemerkt, wie distanziert Sie sich Bernd Köster gegenüber verhalten.«
Dr. Scheibler seufzte tief auf, dann gestand er: »Ich habe ein verdammt schlechtes Gewissen. Ich möchte mich diesem armen Kerl gegenüber gar nicht so streng und kalt zeigen, aber… ich kann mit ihm einfach kein wirkliches Mitleid haben. Jedesmal, wenn ich neben ihm stehe, packt mich die Wut, weil er sich selbst in eine solche Lage manövriert hat. Ich muß mich dermaßen beherrschen, ihn nicht laut anzubrüllen… ihm nicht meine ehrliche Meinung über sein rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr zu sagen.«
Dr. Daniel betrachtete ihn und erkannte, daß ihm seine Gefühle wirklich zu schaffen machten.
»Tun Sie es«, riet er dem Chefarzt schließlich. »Wenn er einigermaßen beschwerdefrei sprechen kann, sollten Sie ihn mit Ihrer Meinung konfrontieren, dann werden Sie sehen, was er dazu zu sagen hat.«
*
Dr. Scheibler hatte einige Bedenken, Dr. Daniels Rat zu befolgen, doch dann sagte er sich, daß zwischen Arzt und Patient ein gewisses Vertrauensverhältnis einfach bestehen mußte. Das war aber nur möglich, wenn man gegenseitig ehrlich zueinander war, und gerade auf Ehrlichkeit dem Patienten gegenüber hatte Dr. Scheibler immer viel Wert gelegt. So würde er es auch diesmal halten.
»Ich glaube, es ist dringend nötig, daß wir uns mal ausführlich miteinander unterhalten«, meinte Dr. Scheibler, als er an diesem Morgen an Bernds Bett trat.
Der junge Mann lag noch immer auf der Intensivstation, aber sein Zustand hatte sich mittlerweile gebessert, wenn ihm auch beim Atmen und Sprechen noch immer Brust und Rachen ziemlich weh taten.
»Sie sind unheimlich sauer auf mich«, vermutete Bernd leise.
»Sauer ist der falsche Ausdruck«, entgegnete Dr. Scheibler, zögerte einen Moment und setzte sich dann auf die Bettkante, damit Bernd, der noch immer im Gipskorsett lag, ihn gut sehen konnte. »Normalerweise lebe und leide ich mit meinen Patienten, aber bei Ihnen kann ich kein Mitgefühl aufbringen und dafür schäme ich mich, weil es Sie nämlich wirklich böse erwischt hat.«
Bernd schluckte schwer. »Es ist ganz allein meine Schuld, daß ich hier liege.«
Dr. Scheibler nickte. »Daran besteht nicht der geringste Zweifel.«
Der Chefarzt sah, wie Bernds Augen feucht wurden, und wandte den Blick ab.
»Was ist?« fragte der junge Mann leise. »Können Sie nicht hart bleiben, wenn ich weine?«
»Es würde mir jedenfalls schwerfallen«, gestand Dr. Scheibler, dann seufzte er. »Im Grunde möchte ich ja gar nicht hart bleiben. Sonst wäre ich jetzt bestimmt nicht hier.« Er stützte sich mit einer Hand über Bernds Körper hinweg auf der anderen Bettseite ab. »Ich wüßte gern, was an jenem Abend in Ihrem Kopf vorgegangen ist.«
»Gar nichts«, flüsterte Bernd, dann atmete er tief durch, doch dabei zeichneten sich Schmerzen auf seinem Gesicht ab. »Werden mir die Rippen noch lange weh tun?«
Dr. Scheibler nickte. »Es wird sicher seine Zeit dauern.«
Bernd zögerte, dann schüttelte er den Kopf. »Nein, vermutlich nicht.« Er schwieg kurz. »Zu meiner Entschuldigung kann ich nur vorbringen, daß ich so etwas nie zuvor getan habe. Ich bin nämlich kein verantwortungsloser Raser – ganz im Gegenteil. In den zwölf Jahren, seit ich meinen Führerschein habe, bin ich immer unfallfrei gefahren.« Wieder machte er eine Pause. »Es war mein Geburtstag. Ich hasse Geburtstage – vor allem meine eigenen, aber dieser dreißigste war mit Abstand der schlimmste. Alle waren da – meine Eltern, Geschwister, Freunde, Verwandte. Ich habe für sie gekocht, alle außer mir waren in Bombenstimmung. Es war schon ziemlich spät, als sie aufbrachen. Dann war ich auf einmal allein. Ich fühlte mich so schrecklich einsam, und dieser Einsamkeit wollte ich entfliehen, also fuhr ich los – einfach so, ohne Ziel. Ich landete auf der Autobahn und da merkte ich plötzlich, wie gut es mir tat, schnell zu fahren. Es verlangte meine ganze Konzentration. Ich hatte keine Zeit mehr, an meinen Geburtstag zu denken… an die dreißig Jahre, die ich jetzt alt war… an meine Einsamkeit. Ein Stau bremste mich, aber ich wollte jetzt nicht im Schrittempo dahinkriechen. Zum ersten Mal in meinem Leben sehnte ich mich nach Geschwindigkeit, nach Gefahr – ausgerechnet ich, der immer auf Nummer Sicher gegangen war. Bei der nächsten Ausfahrt verließ ich die Autobahn und trat wieder aufs Gas. Es war spät, die Landstraße wirkte wie ausgestorben. Ich erkannte mich selbst nicht mehr… war wie im Rausch. Ich nahm die Kurven zu schnell, und… o Gott, ich hätte auf dieser Strecke mindestens zehn Unfälle bauen können. Dann war vor mir plötzlich dieses Auto. Ich sah es ziemlich spät, aber noch hätte ich bremsen können, doch ich war wie gelähmt. Ich brachte den Fuß nicht vom Gas… ich…« Jetzt begann er wirklich zu schluchzen. »Das war das Schrecklichste an allem… die Gewißheit, daß ich andere mit in mein ganz persönliches Elend hineinreißen würde. Ich wollte das nicht… ich schwöre Ihnen, daß ich das nicht gewollt habe…« Vor Weinen konnte er nicht mehr weitersprechen, und dabei wurde ihm besonders deutlich bewußt, daß er sich nicht bewegen konnte… daß er nicht einmal in der Lage war, sich die Tränen wegzuwischen.
Dr. Scheibler stand auf, und als er seinem jungen Patienten jetzt über den Kopf streichelte, bemerkte er plötzlich eine Veränderung in sich. Jetzt konnte er Mitgefühl für ihm empfinden. Bernd Köster war eben doch nicht der gewissenlose Raser, für den er ihn trotz der Worte seines Bruders insgeheim gehalten hatte. Er war nur einfach todunglücklich gewesen – und war es immer noch. Vielleicht hatte er da auf dieser Landstraße sogar ein kleines bißchen gehofft, nach diesem Unfall nicht mehr aufzuwachen. Sicher hatte er es nicht bewußt gedacht, aber tief in seinem Innern hatte er wohl gehofft, der Unfall könnte seiner Einsamkeit ein Ende setzen.
Bernds hilfloses Schluchzen verebbte langsam. Als seine Augen wieder einigermaßen klar sahen, bemerkte auch er, daß sich Dr. Scheiblers Einstellung geändert hatte.
»Bisher habe ich es Ihnen nicht gesagt«, meinte der Chefarzt, »aber das will ich nun schnellstens nachholen. Der jungen Frau, die in dem anderen Auto saß, ist nicht viel passiert. Sie konnte vor zwei Wochen wieder entlassen werden.«
Bernd atmete auf. »Das hat mich die ganze Zeit am meisten belastet. Diese Ungewißheit… und ich konnte nichts fragen…« Er wich Dr. Scheiblers Blick aus. »Irgendwann habe ich mich auch nicht mehr getraut zu fragen.« Jetzt sah er ihn wieder an. »Sie haben mich ganz schön leiden lassen.«
Dr. Scheibler seufzte leise, dann setzte er sich wieder auf die Bettkante. »Ich fürchte, Ihnen steht noch mehr Leid bevor… Leid, für das ich nicht verantwortlich bin, aber das ich Ihnen auch nicht ersparen kann.« Er schwieg kurz. »Es geht um Ihre Verletzung. Sie haben sich bei dem Unfall einen Wirbelbruch zugezogen.«
Bernd erschrak zutiefst. »Ich bin also doch gelähmt?«
»Nein, ich habe Sie damals nicht belogen. Die Querschnittslähmung konnte ich abwenden, aber… der Bruch ist instabil.« Wie schon seinen Eltern und Geschwistern erklärte Dr. Scheibler nun auch ihm, was das für seine Zukunft bedeuten konnte. Seine Worte trafen Bernd wie ein Schlag.
»Das heißt… ich werde künftig mit einem Bein im Rollstuhl stehen«, brachte er nach Sekunden des entsetzten Schweigens stockend hervor.
Dr. Scheibler nickte. »Das ist die eine Möglichkeit. Die andere besteht darin, daß ich Sie noch einmal operiere und die Wirbel versteife. Damit wäre die Gefahr einer Rückenmarksverletzung zwar gebannt, aber ich will ganz ehrlich sein, Bernd: Die Erfahrung hat gezeigt, daß die meisten Patienten nach einem solchen Eingriff ein Leben lang unter Rückenschmerzen leiden.«
»Ich habe also die Wahl zwischen möglicher Querschnittslähmung und lebenslangen Rückenschmerzen«, faßte Bernd bitter zusammen. Um seine Mundwinkel zuckte es verdächtig, doch das rührte nicht nur von der schrecklichen Wahrheit her, die Dr. Scheibler ihm soeben offenbart hatte. Das lange Sprechen hatte ihn sehr angestrengt. Er hatte das Gefühl, als stünde sein ganzer Rachen in Flammen.
Der Chefarzt legte eine Hand auf seinen Arm. »Sie müssen sich nicht sofort entscheiden, Bernd. Lassen Sie sich Zeit. Sie können auch jederzeit noch einmal mit mir sprechen, wenn es Ihnen ein bißchen bessergeht und Sie schmerzfrei reden können. Der Eingriff hat Zeit. Im Moment liegen Sie ja noch im Gipsbett, da kann also nichts passieren.«
Bernd nickte, doch in seinem Gesicht begann es wieder verdächtig zu zucken.
»Gleichgültig, wie ich mich entscheide«, meinte er mit gepreßter Stimme. »Ich werde nie mehr so leben können wie zuvor.«
*
Dr. Daniel hielt Wort und gab Mona Lombardi Bescheid, als Bernd Köster endlich von der Intensivstation auf die Chirurgie verlegt werden konnte. Noch immer lag er im Gipsbett, aber wenigstens konnte er jetzt Kopf und Arme frei bewegen.
Mona, die sich ja fest vorgenommen hatte, den jungen Mann zu besuchen, wurde wieder wankend, als sie die Eingangshalle der Waldsee-Klinik betrat. Was veranlaßte sie eigentlich zu diesem Besuch? Im Grunde wollte sie den Mann gar nicht sehen, der an ihrem Krankenhausaufenthalt schuld gewesen war… der durch sein rücksichtsloses Verhalten bei ihr eine Fehlgeburt hätte auslösen können.
»Was er getan hat, tut ihm leid.«
Erschrocken fuhr Mona herum, als hinter ihr so unverhofft Dr. Daniels Stimme erklang.
»Können Sie jetzt sogar Gedanken lesen?« fragte Mona verblüfft.
Lächelnd schüttelte Dr. Daniel den Kopf. »Nein, Mona, das nun nicht gerade, aber Ihre Gedanken waren wirklich nicht schwer zu erraten.« Er wurde ernst. »Der junge Mann blickt einer sehr ungewissen Zukunft entgegen. Er ist selbst daran schuld, aber das macht es für ihn nicht leichter. Dazu kommt, daß er sich lange Zeit große Sorgen um Sie gemacht hat… nun ja, nicht um Sie persönlich, sondern um die Insassen des Autos, auf das er aufgefahren ist.« Dr. Daniel zögerte kurz, dann gab er das weiter, was er vor wenigen Tagen von Dr. Scheibler erfahren hatte: »Er war an jenem Tag sehr unglücklich und einsam. Das ist vielleicht keine Entschuldigung, aber…«
»Doch, ich glaube schon«, murmelte Mona. Dr. Daniel wartete, weil er fühlte, daß die junge Frau ihm gleich Einblick in ihre eigene Seele geben würde. »Seit ich mit Dirk endgültig Schluß gemacht habe, weiß ich sehr gut, was es heißt, einsam und unglücklich zu sein. Ich habe es die ganze Zeit verdrängt… habe mich hinter meiner Arbeit und der Schwangerschaft versteckt.« Sie blickte zu Boden. »Tief im Innern wußte ich längst, daß ich die Drillinge zur Adoption freigeben würde. Mein eigenes Gerangel um eine Entscheidung entsprang ganz anderen Gefühlen. Damit wollte ich doch in erster Linie vermeiden, daß ich zuviel über Dirks Untreue und meine eigene Einsamkeit nachgrübeln konnte.«
»Es wäre besser gewesen, Sie hätten sich mir anvertraut«, meinte Dr. Daniel. »Sie machten in dieser Hinsicht einen so sicheren Eindruck, daß ich gar nicht auf den Gedanken gekommen wäre, die Trennung von Dirk könnte Sie so sehr belasten.«
»Es ist vorbei«, behauptete Mona betont munter, dann blickte sie zu den Doppeltüren hinüber, die zur Chirurgie führten. »Nun werde ich meinen geplanten Besuch endlich hinter mich bringen.«
Dr. Daniel begleitete sie zu Bernds Zimmer, doch hineingehen ließ er sie allein. Sehr zögernd trat Mona an das Bett.
»Guten Tag, Herr Köster«, grüßte sie und fühlte dabei eine eigenartige Unsicherheit, die sie im Umgang mit Menschen normalerweise überhaupt nicht an sich kannte.
Bernd wandte den Kopf. Er war ein wenig eingenickt gewesen und hatte daher gar nicht gehört, wie sich die Tür geöffnet und wieder geschlossen hatte. Jetzt hatte er das Gefühl, einer Fata Morgana zu begegnen. Diese wunderschöne Frau an seinem Bett konnte doch nicht Wirklichkeit sein!
»Ich bin Mona Lombardi«, stellte sie sich vor… durch sein Schweigen noch mehr verunsichert.
Unwillkürlich schloß Bernd für einen Moment die Augen und ließ diese weiche, sanfte Stimme in sich nachklingen… eine Stimme wie Musik und ein Name wie ein Traum. Mona Lombardi…
Doch als er die Augen wieder öffnete, bemerkte er die deutliche Wölbung unter ihrem Kleid. Sein Traum zerplatzte jäh wie eine Seifenblase.
»Was wollen Sie von mir?« fragte er, und seine Stimme klang dabei ein wenig heiser, doch das kam nicht mehr von der langen Zeit der künstlichen Beatmung, sondern hatte seinen Grund einzig darin, daß diese bezaubernde Frau hier bei ihm war.
»Wenn ich das so genau wüßte«, murmelte Mona. Noch immer fühlte sie sich schrecklich unsicher, und als der junge Mann sie jetzt so traurig anschaute, da kam noch etwas anderes hinzu… etwas, das sie nicht deuten konnte.
»Ich… ich wollte Ihnen sagen, daß ich… nun ja, daß ich es ganz gut überstanden habe«, stammelte Mona und begriff ihre eigene Verlegenheit nicht. Was hatte dieser Mann denn nur an sich, daß sie in seiner Gegenwart nicht so selbstbewußt auftreten konnte wie sonst? Lag es vielleicht daran, daß er so schwer verletzt war? Aber sie konnte ja gar nichts dafür!
Bernd begriff plötzlich, wen er da vor sich hatte.
»Sie?« fragte er leise. »Sie waren in dem anderen Auto?« Sein Blick glitt über ihren gerundeten Bauch. »O mein Gott.«
»Es ist ja nichts passiert«, beeilte sich Mona zu versichern. »Ich mußte eine Weile liegen, aber sonst…«
»Ich habe so etwas noch nie getan«, beteuerte Bernd. »Nie zuvor habe ich das Tempolimit überschritten… na ja, vielleicht mal um zehn oder zwanzig Stundenkilometer, aber nicht so wie… wie in jener Nacht.«
Spontan setzte sich Mona auf die Bettkante. »Der einzige, dem Sie damit wirklich geschadet haben, sind doch Sie selbst.«
Bernds Augen füllten sich mit Tränen. Rasch wandte er den Kopf zur Seite, denn Mona sollte es nicht bemerken.
»Ich bin… ich war… Sportlehrer«, brachte er mit erstickter Stimme hervor. »Ich unterrichte auch Deutsch, aber der Sport… diesem Fach gehörte mein ganzes Herz.« Jetzt sah er Mona an. »Ich muß eine Entscheidung treffen, und die Auswahl ist nicht sehr verlockend. Ich kann mich für das Risiko oder für die Schmerzen entscheiden. Eine dritte Möglichkeit gibt es leider nicht.«
Mona begriff nicht, was er damit meinte.
Leise und stockend erzählte Bernd nun, was Dr. Scheibler ihm vor fast drei Wochen über seine Wirbelverletzung gesagt hatte. Dabei erstaunte es ihn, daß er zu einer Fremden mehr Vertrauen hatte als zu seinen Eltern und Geschwistern.
Sie alle wußten noch nichts von der Entscheidung, die er zu treffen hatte, obwohl sie in dieser Zeit mehrmals zu Besuch gewesen waren.
Mona war zutiefst erschüttert, Spontan streckte sie die Hand aus und berührte Bernds Gesicht.
Er zuckte nun zusammen, als hätte sie ihn geschlagen, dabei war er über dieses unverhoffte Streicheln ja nur so erschrocken, weil er niemals damit gerechnet hätte.
»Lassen Sie sich doch operieren«, riet Mona ihm spontan. »Alles ist besser, als mit der ewigen Angst einer Querschnittlähmung zu leben.«
Bernd war so benommen, daß er ihre Worte gar nicht richtig mitbekam.
Monas Anwesenheit, ihre Augen, die so voller Zärtlichkeit auf seinem Gesicht ruhten, ihre Hand, die ihn noch immer streichelte…
»Sie… Sie sind schwanger«, brachte er mühsam hervor. »Ich meine… was Sie hier tun… Ihr Mann…«
Mona verstand. Ein trauriges Lächeln huschte über ihr Gesicht. »Schwangerschaft ist nicht immer gleichbedeutend mit Ehe.« Sie senkte den Kopf. »Ich war verlobt, aber… er hat es vorgezogen, mit meiner Freundin ins Bett zu steigen.« Mit einer Hand berührte sie ihren Bauch, dann blickte sie wieder auf. »Ich werde die Babys zur Adoption freigeben.«
»Die Babys?« wiederholte Bernd fragend.
Mona nickte. »Es sind Drillinge.«
»Tun Sie es nicht!« rief Bernd ihr nun ebenso spontan, wie sie es vorhin getan hatte. »Geben Sie die Kinder nicht weg!«
»Ich habe doch gar keine andere Wahl«, entgegnete Mona beinahe verzweifelt. »Ich bin allein und… mein Beruf. Mühsam habe ich mich hochgearbeitet und jetzt, da ich endlich am Ziel bin…« Sie verstummte, weil es ihr plötzlich peinlich war, gerade mit ihm über ihren Beruf zu sprechen. Bernd würde seinen Beruf schließlich aus gesundheitlichen Gründen aufgeben müssen.
Gerade deshalb verstand er sie aber auch so gut. »Es tut weh, ein solches Opfer zu bringen. Ich kann mir ein Leben ohne Sport auch noch nicht vorstellen, aber es wird irgendwie gehen müssen.« Er sah Mona wieder an. »Gib deine Kinder nicht her.« Ganz zwanglos hatte er sie bei diesen Worten geduzt. »Ich weiß, wovon ich spreche. Nicht aus eigener Erfahrung natürlich, aber… meine Mutter. Sie war gerade neunzehn, als sie ungewollt schwanger wurde, und sie hat denn dieses Kind weggegeben. Obwohl sie später, als sie dann verheiratet war, noch meine beiden Geschwister und mich hatte, ist sie nie wirklich darüber hinweggekommen. Und noch heute… vierzig Jahre danach, weint sie jedes Jahr am 3. Mai, weil da ihr Kind Geburtstag hätte… ihr Kind, von dem sie nichts weiß… nicht einmal, ob es ein Mädchen oder ein Junge war. Sie mußte damals mit Kaiserschnitt entbunden werden und als sie aus der Narkose aufwachte, war das Baby bereits weg.«
Mona schluckte schwer. Genauso würde es bei ihr auch laufen… nun ja, nicht ganz genauso. Dr. Daniel würde ihr wohl noch die Möglichkeit geben, ihre Kinder zu sehen, wenn sie es wollte, doch er hatte auch gesagt, daß es umso schwerer für sie werden würde, je länger sie nach der Geburt mit den Babys zusammen war.
»Bernd, was soll ich denn nur tun?« fragte Mona betroffen. Dabei wurde ihr auf einmal klar, welch seltsames Verhältnis sich in der vergangenen Stunde zwischen ihnen entwickelt hatte. Sie kannten sich im Grunde gar nicht und wußten doch schon so viel voneinander… Dinge, die man eigentlich nur einem besonders nahestehenden Menschen anvertraute.
Mona stand auf. »Ich glaube, ich sollte jetzt gehen.« Im selben Moment wußte sie, daß sie ihn überhaupt nicht verlassen wollte… jetzt nicht… nie mehr. So etwas hatte sie noch nie erlebt. So tiefe Gefühle für einen Menschen, den sie vor einer Stunde noch nicht einmal gekannt hatte.
Wortlos streckte sie die Hand aus, und Bernd ergriff sie.
»Ich glaube nicht, daß du gehen solltest«, meinte er und ehe Mona sich versah, hatte Bernd sie näher zu sich gezogen, dann spürte sie seine Lippen auf ihrem Mund und wußte, daß sie genau das ersehnt hatte. Sie hatte es ersehnt, seit sie dieses Zimmer betreten und einen ersten Blick mit ihm gewechselt hatte.
»Wir sind völlig verrückt«, urteilte Mona, als sie sich von Bernd ein wenig löste, doch sie lachte dabei. Zum ersten Mal, seit sie die Beziehung zu Dirk gelöst hatte, konnte sie wieder befreit lachen, und es tat ihr unheimlich gut.
»Liebe muß manchmal ein bißchen verrückt sein«, entgegnete Bernd. »Ich habe sie immer zu ernst genommen, aber das war verkehrt.« Er erinnerte sich an Sandras Worte, als sie wegen seines Bruders Markus mit ihm Schluß gemacht hatte. »Zu mir hat mal jemand gesagt, ich sei zu perfekt für eine Beziehung. Damals hat das schrecklich weh getan, vor allem weil mein Bruder offenbar nicht zu perfekt für diese Beziehung war.« Er schwieg eine Weile. »Es hat weh getan, bis du durch diese Tür gekommen bist. Ich glaubte zu träumen…«
Prüfend blickte Mona ihn an. »Heißt das… ich bin nur Lückenbüßer für die andere, die dich nicht gewollt hat?«
Heftig schüttelte Bernd den Kopf. »Nein, Mona, so habe ich das nicht gemeint. Es ist vielmehr… oh, wie soll ich das nur erklären? Du hast dagestanden, und ich wußte, du bist die Frau, nach der ich immer gesucht habe. Der ganze Schmerz, den ich jahrelang mit mir herumgeschleppt habe, der Kummer, die Einsamkeit… alles war plötzlich weg. Es gab nur noch dich.« Wieder schwieg er kurz. »Doch dann kam der Schock. Ich bemerkte deine Schwangerschaft und nahm an…« Er beendete den Satz nicht, sondern zog Mona wieder an sich und küßte sie erneut. »Willst du es denn mit einem Invaliden versuchen?«
»Sprich nicht so!« wies Mona ihn zurecht. »Du wirst dich operieren lassen und…«
»Und du wirst die Kinder behalten«, ergänzte Bernd.
Mona lachte. »In Ordnung, aber wie stellst du dir das vor? Drillinge und… o Gott, ahnst du überhaupt, was ich für eine Hausfrau bin? Ich habe das Kochen nicht gerade erfunden.«
Bernd schmunzelte. »Da mach dir mal keine Sorgen. Solange es mich gibt, werden wir sicher nicht verhungern.« Dann wurde er ernst. »Es ist vermutlich viel zu früh, um Zukunftspläne zu schmieden, aber… zumindest ich für meinen Teil weiß, daß ich dich nie wieder loslassen werde.« Er lächelte erneut. »Ich habe mir immer eine Familie gewünscht… eine große Familie mit vielen Kindern. Mein Leben wird nie wieder so sein, wie es einmal war, aber um einen großen Teil meines alten Lebens ist es bestimmt nicht schade. Die leere Wohnung, die Einsamkeit… wie habe ich das alles gehaßt.«
Mona streichelte ihren Bauch. »Mit der Einsamkeit wird es in ein paar Monaten endgültig vorbei sein.« Sie wurde ein bißchen melancholisch. »Mit meiner Karriere allerdings auch.«
Da schüttelte Bernd den Kopf. »Nein, Mona, damit muß es gewiß nicht vorbei sein. Wenn wir beide zusammenhalten, dann wird für dich beides möglich sein: Kinder und Karriere.« Er machte eine Pause, als müsse er für seine nächsten Worte Mut sammeln, und vermutlich war es auch so. »Es fällt mir schwer, mich an diesen Gedanken zu gewöhnen, aber Tatsache ist nun mal, daß ich umlernen muß. Ob ich die Operation machen lasse oder nicht – als Sportlehrer kann ich in keinem Fall arbeiten. Ich werde in nächster Zeit also viel zu Hause sein, abgesehen von den Vormittagsstunden, wo ich in der Schule noch etwas Deutschunterricht geben werde.«
»Du wirst viel lernen müssen, da kannst du nicht auch noch nebenbei Drillinge versorgen«, wandte Mona ein. »Darüber hinaus habe ich als Kaufhaus-Managerin nicht gerade einen Teilzeitjob.«
Bernds lange verborgener Optimismus kam plötzlich wieder zum Vorschein. »Hör mal, Mona, wir leben im Zeitalter des Computers. Mit einem Internet-Anschluß läßt sich ein Großteil deiner Arbeit von zu Hause aus erledigen.«
Daran hatte Mona tatsächlich noch nicht gedacht, aber Bernd hatte ganz recht. Auf diese Weise würde sie alles unter einen Hut bringen können: Ehe, Kinder und Beruf.
Sie würde nicht nur das Kaufhaus, sondern ihr ganzes Leben managen!
Sie beugte sich über Bernd und küßte ihn zärtlich, dann raunte sie ihm zu: »Weißt du, daß du das Beste bist, was mir passieren konnte?«
Bernd lachte leise. »Das Kompliment kann ich in vollem Umfang zurückgeben.« Mit den Fingern zärtelte er durch ihr langes Haar. »Gemeinsam sind wir stark.«
Doch Mona schüttelte den Kopf. »Viel mehr als das, Bernd. Gemeinsam werden wir die glücklichste Familie auf der ganzen Welt sein…«