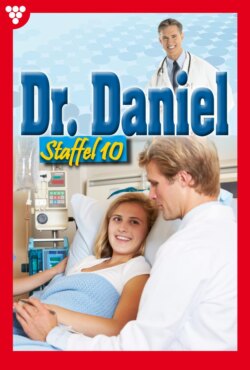Читать книгу Dr. Daniel Staffel 10 – Arztroman - Marie-Francoise - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEs war wieder einer dieser typisch stressigen Vormittage in der Praxis von Dr. Robert Daniel. Die Patientinnen gaben sich buchstäblich die Türklinke in die Hand, und das Wartezimmer platzte schon fast aus allen Nähten, doch noch immer war ein Ende der Patientenflut nicht in Sicht.
Gabi Meindl, die junge Empfangsdame von Dr. Daniel, war, wie meistens an solchen Tagen, mit ihren Nerven am Ende.
»Wenn jetzt noch eine einzige Patientin unangemeldet hier aufkreuzt, dann kriege ich einen Schreikrampf«, kündigte sie ihrer Kollegin Sarina von Gehrau an.
Die junge Sprechstundenhilfe schmunzelte nur. Sie kannte Gabis diesbezügliche Prophezeiung zur Genüge, daher wußte sie, daß man sie nicht allzu ernstzunehmen brauchte.
Das Telefon klingelte und gleichzeitig schellte es auch an der Tür.
»Ich werde wahnsinnig!« stieß Gabi hervor, drückte auf den Türöffner und hob gleichzeitig den Telefonhörer ab.
»Praxis Dr. Daniel«, schnurrte sie herunter und dabei war die Gereiztheit schon an ihrer Stimme zu hören. Als sich am anderen Ende der Leitung Oberschwester Lena Kaufmann zu erkennen gab, hob das ihre Laune nicht unbedingt.
»Wir benötigen Dr. Daniel dringend in der Waldsee-Klinik«, erklärte die Oberschwester auch schon, was Gabi einen Stoßseufzer entlockte.
»Ahnen Sie, was hier in der Praxis los ist?« entfuhr es ihr in nicht gerade höflichem Ton.
»Ja«, antwortete Lena lakonisch. »Immerhin habe ich etliche Jahre für Dr. Daniel als Sprechstundenhilfe gearbeitet und erinnere mich noch ausgesprochen gut an den Praxisbetrieb. Allerdings sind die Belange der Patientin, die ich hier habe, noch dringender. Sie erwartet Drillinge, hat Wehen und noch über einen Monat bis zum errechneten Geburtstermin.«
Sekundenlang schloß Gabi die Augen. Sie wußte, was die Worte der Oberschwester im Klartext bedeuteten.
»Ich schicke Dr. Daniel sofort in die Klinik«, versprach sie ergeben und legte dann ohne viele weitere Worte auf. »Genau das, was man sich an einem solchen Tag wünscht«, grummelte sie, während sie eiligst zu Dr. Daniels Sprechzimmer lief. Sie klopfte kurz, dann streckte sie nur den Kopf hinein. »Tut mir leid, Herr Doktor, die Waldsee-Klinik braucht Sie.«
Dr. Daniel seufzte ebenfalls, dann schüttelte er den Kopf. »Ich kann hier unmöglich weg.«
»Ich fürchte, Sie müssen«, hielt Gabi dagegen. »Die Drillinge drängen auf die Welt.«
»Jetzt schon?« entfuhr es Dr. Daniel. Er brauchte keine zwei Sekunden, um sich zu entscheiden. »Rufen Sie sofort in der Waldsee-Klinik an, Fräulein Meindl. Man soll Frau Lombardi-Köster schnellstens nach München in die Sommer-Klinik bringen. Informieren Sie auch Dr. Sommer, daß er in Kürze frühgeborene Drillinge bekommt. Ich mache mich auf den Weg nach München, sobald ich hier fertig bin.«
»Sie können ruhig gleich fahren«, bot die Patientin an, die im Sprechzimmer gesessen und den Wortwechsel daher zwangsläufig mitbekommen hatte. »Ich kann ja auch ein anderes Mal wiederkommen.«
Doch Dr. Daniel schüttelte den Kopf. »Nein, Frau Burger, das Gespräch und die Untersuchung machen wir schon noch fertig.« Er sah Gabi wieder an. »Die weiteren wartenden Patientinnen müssen Sie leider vertrösten, denn ich weiß nicht, bis wann ich aus München wieder hiersein kann. Dringende Fälle übernimmt Frau Dr. Reintaler in der Waldsee-Klinik.«
»In Ordnung, Herr Doktor«, stimmte Gabi zu. Sie wußte, daß ihr und Sarina jetzt etliche unangenehme Gespräche bevorstanden, denn einige der wartenden Damen würden sicher nicht so entgegenkommend sein wie Frau Burger.
Obwohl er sich um Mona Lombardi-Köster große Sorgen machte, brachte Dr. Daniel das Gespräch mit Frau Burger und die anschließende Untersuchung mit derselben Freundlichkeit und Rücksichtnahme zu Ende, die alle seine Patientinnen von ihm gewohnt waren. Danach allerdings hatte er nichts Eiligeres zu tun, als seinen weißen Kittel auszuziehen, in seine Strickjacke zu schlüpfen und schließlich im Laufschritt die Praxis zu verlassen.
Eine halbe Stunde später erreichte er die Klinik von Dr. Georg Sommer, mit dem er schon seit der gemeinsamen Studienzeit eng befreundet war. Die beiden Ärzte begegneten sich bereits in der Eingangshalle.
»Ich liebe deine Überraschungen«, behauptete Dr. Sommer in einem Ton, der darauf schließen ließ, daß seine Worte eher das Gegenteil ausdrücken sollten.
»Weiß ich doch«, entgegnete Dr. Daniel lächelnd. »Allerdings bin ich für derartige Überraschungen nur selten selbst verantwortlich. Ist die Patientin schon im OP?«
Dr. Sommer schüttelte den Kopf. »Du warst schneller als der Krankenwagen.«
Besorgt runzelte Dr. Daniel die Stirn. »Hoffentlich ist nichts passiert.«
Sie hatten jetzt die Notaufnahme erreicht und in diesem Augenblick hielt draußen auch schon der Krankenwagen der Waldsee-Klinik. Die fahrbare Trage wurde herausgehoben und mit einem stählernen Rasseln klappten die Räder nach unten.
Durch die Doppeltüren trat Dr. Daniel nach draußen. Im selben Moment stieg Bernd Köster aus dem Krankenwagen und eilte, so rasch es seine Rückenschmerzen erlaubten, zu seiner jungen Frau, die leise stöhnend auf der Trage lag.
»Ist das meine Schuld?« wollte Bernd ängstlich wissen, noch ehe Dr. Daniel auch nur ein Wort sagen konnte.
Der Arzt begriff sofort, was Bernd meinte. Vor ein paar Monaten war er mit seinem Auto hinten auf Monas Wagen aufgefahren. Das Resultat waren damals leichte vorzeitige Wehen gewesen, während es Bernd bei diesem Unfall sehr viel schlimmer erwischt hatte. Er war nur knapp an einer Querschnittslähmung vorbeigegangen und hatte aufgrund eines instabilen Wirbelbruchs vor einigen Wochen noch eine operative Wirbelversteifung über sich ergehen lassen müssen. Seitdem litt er unter Rückenschmerzen, und Dr. Scheibler, der Chefarzt der Waldsee-Klinik, hatte ihm prophezeit, daß das unter Umständen sein ganzes Leben so bleiben würde. Im Moment war das allerdings noch Bernds geringste Sorge.
»Nein, Herr Köster«, beruhigte Dr. Daniel ihn. »Der damalige Unfall hat mit den jetzigen Wehen ganz bestimmt nichts zu tun.«
Inzwischen hatten sie den Untersuchungsraum erreicht. Dr. Daniel verschaffte sich einen ersten Überblick über die Lage.
»Versuchen Sie sich zu entspannen, Mona«, bat er.
»Es tut so schrecklich weh, Herr Doktor«, flüsterte Mona Lombardi-Köster mit gepreßter Stimme.
»Ich weiß«, meinte Dr. Daniel teilnahmsvoll. »Sie müssen das auch sicher nicht mehr lange
aushalten. Ich werde sehen, ob man die Geburt noch aufhalten kann.«
Erstaunt sah Bernd ihn an. »Aber… warum haben Sie das nicht gleich versucht?«
»Weil ich Ihre Frau zunächst hier in der Sommer-Klinik wissen wollte«, erklärte Dr. Daniel. »Erfahrungsgemäß müssen Mehrlinge in einer solchen Situation geholt werden, und dafür ist Dr. Sommer wesentlich besser eingerichtet, als die Waldsee-Klinik. Er verfügt über eine ausgezeichnete Frühgeborenen-Intensivstation, auf der Ihre Babys die größten Chancen haben.«
Noch während er sprach, kam ihm zu Bewußtsein, daß Bernd ja gar nicht der leibliche Vater dieser drei Babys war. Er und die damals bereits schwangere Mona hatten sich ja erst durch den Unfall kennengelernt und vor zwei Wochen, als sich Bernd von der zweiten Operation ein wenig erholt hatte, hatten für das junge Paar die Hochzeitsglocken geläutet.
Dr. Daniel tastete nur sehr vorsichtig, aber dennoch äußerst gründlich den Muttermund ab und stellte dabei schon fest, daß die Geburt nicht mehr aufzuhalten sein würde. Der Muttermund hatte sich bereits vier Zentimeter geöffnet. Somit war Eile angesagt, denn Drillinge konnten keinesfalls auf natürlichem Weg geboren werden, und diese hier waren überdies auch noch mehr als einen Monat zu früh dran.
»Ich lege Ihnen jetzt eine Infusion, Mona«, meinte Dr. Daniel, während er sich die Handschuhe abstreifte. »Sie bekommen ein wehenhemmendes Medikament. Anschließend bringe ich Sie in den Operationssaal, und dort werde ich zusammen mit Dr. Sommer einen Kaiserschnitt vornehmen.« Er lächelte sie an. »In spätestens einer Stunde werden Sie Mami sein.« Beruhigend drückte er Monas Hand. »Machen Sie sich keine Sorgen, ihre Babys werden hier bestens versorgt.« Über die drohende Gefahr, daß zumindest eines der zu früh geborenen Babys sterben könnte, verlor er kein Wort, um Mona jetzt nicht zu verunsichern. Die Empfindungen und Ängste der Mutter übertrugen sich nämlich auch auf die ungeborenen Kinder, und gerade um sie mußten die Ärzte jetzt kämpfen. Dazu gehörte, der Mutter Mut zu machen, denn wenn sie die Hoffnung verlor, dann würden damit womöglich auch die Babys geschwächt.
Inzwischen war eine Krankenschwester mit dem Infusionsbesteck zurückgekehrt. Rasch und geschickt legte Dr. Daniel den Zugang. Er fühlte sich hier in der Klinik seines Freundes ebenso zu Hause wie in der Waldsee-Klinik. Dr. Sommer hatte noch nie etwas einzuwenden gehabt, wenn sein Freund hier in der Klinik seine eigenen Patientinnen versorgte – im Gegenteil. Der Chefarzt wußte, wie beliebt Dr. Daniel war und das rückhaltlose Vertrauen der Patienten war für die Genesung noch immer am wichtigsten. Dr. Daniel schloß nun die Infusion an und regelte die Tropfgeschwindigkeit, dann beugte er sich noch einmal zu Mona hinunter.
»Haben Sie keine Angst, Mona«, bat er. »Für Sie und Ihre Babys wird hier alles getan.« Er richtete sich auf und sah Bernd an. »Bleiben Sie bei Ihrer Frau, bis sie abgeholt wird. Ich muß jetzt zusehen, daß ich in den Operationssaal komme.«
Bernd nickte, dann nahm er den Arzt beiseite. »Wird wirklich alles gutgehen?«
»Ich hoffe es«, antwortete Dr. Daniel. »Mehrlingsgeburten sind immer ein Risiko, auch wenn sie nicht zu früh kommen. Aber eines kann ich Ihnen mit absoluter Sicherheit sagen: Bessere Chancen als hier in dieser Klinik hätten Ihre Babys sonst nirgends.«
»Danke, Herr Doktor«, murmelte Bernd halbwegs erleichtert, dann wandte er sich Mona zu und sprach liebevoll mit ihr.
Dr. Daniel warf einen letzten Blick auf das junge Paar, dann eilte er zum OP. Dr. Sommer wartete dort schon auf ihn.
»Ich hoffe, du bist dir des Risikos bewußt«, meinte er sofort, während Dr. Daniel begann, sich die Hände abzuschrubben. »Die Chancen, frühgeborene Drillinge durchzukriegen, sind nicht gerade groß.«
Dr. Daniel nickte. »Ich weiß, aber dein Dr. Senge ist der beste Frühgeborenen-Spezialist, den es in München und Umgebung gibt. Abgesehen davon sind die Drillinge keine wirklichen Frühgeborenen. Sie sind das, was man allgemein als Acht-Monats-Kinder bezeichnet. In vier Wochen hätten wir sie sowieso mit Kaiserschnitt geholt.«
»Robert, du bist Gynäkologe«, stellte Dr. Sommer fest. »Du weißt genau, was vier Wochen bei Mehrlingen ausmachen können. Senge ist erstklassig, aber gib dich trotzdem keinen Illusionen hin. Es ist äußerst unwahrscheinlich, daß wir alle drei Kinder durchbekommen.«
Sekundenlang schloß Dr. Daniel die Augen. Er haßte solche Prognosen, aber er wußte auch, daß es nötig war, realistisch zu bleiben.
Gemeinsam betraten die beiden Ärzte den Operationssaal. Durch die andere Tür wurde in diesem Moment Mona Lombardi-Köster hereingebracht. Der Anästhesist tauschte einen kurzen Blick mit Dr. Sommer, dann leitete er die Narkose ein.
Als Dr. Sommer und Dr. Daniel an den OP-Tisch traten, stieß der Frühgeborenen-Spezialist Dr. Bruno Senge zum Team hinzu.
Ohne viele Worte zu verlieren, waren die Freunde übereingekommen, daß Dr. Daniel den Eingriff durchführen und Dr. Sommer assistieren würde – nicht nur, weil es sich bei Mona um eine Patientin von Dr. Daniel handelte, sondern weil Dr. Sommers Spezialität die Mikrochirurgie war und er demzufolge bei Kaiserschnitten nicht mehr über so viel Routine verfügte wie er selbst für nötig erachtete.
Die OP-Schwester reichte Dr. Daniel das Skalpell. Mit einer raschen, sicheren Bewegung führte er den Bauchschnitt durch, wartete, bis Dr. Sommer die Haken angesetzt hatte und öffnete dann vorsichtig den Uterus. Was er sah, ließ ihm sekundenlang den Atem stocken. Die Plazenta hatte schon begonnen, sich abzulösen, was nach der Untersuchung von vorhin überhaupt nicht zu erwarten gewesen war.
»So ein Mist!« entfuhr es Dr. Daniel, während er das erste noch winzig kleine Baby aus dem Uteros hob und es Dr. Senge übergab. Unmittelbar danach entband er das nächste Baby, doch dann kam ein erneuter Schock, denn das dritte Kind befand sich in einem denkbar schlechten Zustand.
»Meine Güte, es ist ja schon ganz blau!« stieß Dr. Daniel entsetzt hervor. »Sofort den Schleim absaugen und beatmen.«
Dr. Senge nahm das wie tot aussehende Baby entgegen.
»Sie atmet nicht!« stellte er erschrocken fest, doch Dr. Daniel bekam es nur am Rande mit, denn auch der Zustand von Mona verschlechterte sich nun ganz rapide.
»Die Patientin blutet stark«, ließ sich Dr. Sommer vernehmen und leitete sofort eine Bluttransfusion ein, während Dr. Daniel versuchte, die Blutung zum Stillstand zu bringen.
»Sie kollabiert!« rief der Anästhesist in diesem Moment.
Dr. Daniel entschied sich in Sekundenschnelle. »Ich lege einen arteriellen Zugang.« Er blickte zu Dr. Sommer hinüber. »Gib mir das Blut…«, im Druckbeutel, hatte er sagen wollen, unterbrach sich aber, als er sah, daß Dr. Sommer schon dabei war. Trotzdem blieb Monas Zustand bedenklich.
»Ich gebe der Patientin einen Milliliter Atropin«, meldete Dr. Sommer. Dr. Daniel nickte, ohne von seiner Arbeit aufzusehen, dann warf er der OP-Schwester einen kurzen Blick zu. »Bereiten Sie eine Dopamin-Infusion vor.«
»Multifokale Extrasystolen!« rief der Anästhesist hektisch.
»Nein, verdammt«, knurrte Dr. Daniel und sah wie beschwörend zum Monitor hin, der anzeigte, daß Monas Herz den Belastungen nicht mehr lange standzuhalten vermochte.
»Der Blutverlust ist noch immer enorm hoch«, meinte Dr. Sommer besorgt.
»Kümmere dich bitte darum«, entgegnete Dr. Daniel, dann wandte er sich dem Anästhesisten zu. »Spritzen Sie der Patientin hundert Milligramm Lidocain intravenös.«
Der schrille Piepton, der im nächsten Augenblick vom Monitor ertönte, fuhr allen Ärzten buchstäblich in die Knochen. Herzstillstand!
»Den Defibrillator!« rief Dr. Daniel, doch die OP-Schwester stand schon bereit und reichte ihm die beiden Defibrillatorpaddel.
»Auf 260 laden«, kommandierte Dr. Daniel, dann drückte er die Defibrillatorpaddel auf Monas Brust. »Zurücktreten!« Er drückte auf den Knopf, der einen kurzen Stromstoß durch den Körper der Patientin jagte. Der schrille Pfeifton verstummte und machte dem regelmäßigen Piepen Platz, das anzeigte, daß das Herz seine Arbeit wieder aufgenommen hatte.
»Gott sei Dank«, stieß Dr. Daniel hervor, und die Erleichterung war ihm deutlich anzuhören.
»Die Blutung kommt allmählich zum Stillstand«, meldete sich jetzt Dr. Sommer zu Wort.
Dr. Daniel nickte, dann kontrollierte auch er noch einmal den Uterus der Patientin, doch Dr. Sommer hatte die zurückgebliebenen Reste der Plazenta bereits entfernt.
Dr. Daniel ging ihm zur Hand, und zusammen begannen sie, die Wunde zu schließen, nachdem er sich nochmals davon überzeugt hatte, daß die Blutung tatsächlich zum Stillstand gekommen war.
»Blutdruck stabilisiert sich«, erklärte der Anästhesist, der seinen Platz ebenfalls wieder eingenommen hatte.
Dr. Daniel atmete auf. »Ich glaube, wir haben’s geschafft. Die Mutter wird überleben. Fragt sich nur, wie es inzwischen den Babys geht.«
*
Dr. Senge war mit dem winzig kleinen, völlig leblos wirkenden Kind in den Nebenraum geeilt. Hier hatte er alles, was er brauchte. Mit einem sterilen Absaugschlauch saugte er vorsichtig, aber in der gebotenen Eile dickflüssigen Schleim aus Mund, Nase und Rachenhöhle des Babys. Eine Säuglingsschwester ging ihm dabei unaufdringlich und hilfreich zur Hand.
»Ich muß dringend intubieren«, erklärte Dr. Senge, und die Schwester reichte ihm die Instrumente, während das kleine Mädchen noch immer blau und jämmerlich vor ihnen auf dem Behandlungstisch lag.
»Kriegen Sie die Kleine durch?« fragte die Schwester mit bebender Stimme.
»Keine Ahnung«, antwortete Dr. Senge wahrheitsgemäß. »Ich hoffe es.«
Jetzt hatte er dem Baby den Tubus eingeführt, durch den es künstlich beatmet werden konnte. Ohne viele Worte übernahm die Schwester die Beatmung, während Dr. Senge eine Spritze mit einem Atemstimulans aufzog und dem kleinen Mädchen injizierte.
»So, mein Spatz, jetzt bist du dran«, erklärte der Frühgeborenen-Spezialist. »Ein bißchen was mußt du schon auch dazu tun.«
»Mir scheint, Ihre Aufforderung hat etwas genützt«, meinte die Schwester mit der Spur eines Lächelns, und wies auf den schon beinahe lilafarbenen Körper des Kindes, der sich ganz allmählich rosig zu färben begann.
Doch Dr. Senge war mit der Entwicklung der Dinge noch nicht zufrieden.
»Holen Sie mir eine Glukoselösung«, ordnete er an, während er die Beatmung des Kindes übernahm.
Die Schwester war in Windeseile wieder zurück und gab dem Arzt das Gewünschte. Rasch und geschickt legte Dr. Senge nun bei dem Baby eine Infusion.
»Sie hat sich bewegt!« stieß die Schwester impulsiv hervor.
Trotzdem ließ Dr. Senge die künstliche Beatmung vorerst aufrechterhalten. Erst als die Bewegungen des Babys intensiver wurden und er sicher sein konnte, daß die Kleine fähig war, selbständig zu atmen, entfernte er vorsichtig den Tubus. Nahezu im gleichen Moment stieß das Baby einen tiefen Seufzer aus, doch dann erlag die Atmung wieder.
»Na komm, das kann doch noch nicht alles gewesen sein«, meinte Dr. Senge und war bereits drauf und dran, ein zweites Mal zu intubieren.
Noch einmal schnappte die Kleine nach Luft, dann begann sie ganz jämmerlich zu weinen.
Dr. Senge atmete auf. Einen Augenblick hatte er befürchtet, daß ihm ein Fehler unterlaufen war, als er den Tubus entfernt hatte.
»Wie sieht’s aus?«
Mit dieser bangen Frage stürzte Dr. Daniel in den Raum, und sein blutverschmierter grüner Kittel wies nur zu deutlich Spuren auf, wie verbissen er um das Leben seiner Patientin gekämpft hatte.
»Gar nicht so schlecht«, urteilte Dr. Senge. »Die beiden Jungs sind recht kräftig, nur das kleine Mädchen macht mir noch Sorgen.« Er lächelte. »Bei dieser Kraft geballter Männlichkeit ist sie offenbar ein bißchen zu kurz gekommen. Dazu die überraschende vorzeitige Plazentaablösung… Aber ich denke, wir werden sie irgendwie durchkriegen.«
Mit dieser Auskunft war Dr. Daniel noch nicht zufrieden.
»Und wie wird ihr Leben aussehen?« wollte er wissen.
Dr. Senge wurde ernst. »Das ist im Augenblick schwer zu beurteilen. Der Fünf-Minuten-Apgar war mehr als zufriedenstellend, und da es den beiden Jungs gut geht, gehe ich davon aus, daß auch die Kleine nicht ohne Sauerstoffversorgung war.«
Dr. Daniel lehnte sich gegen die Wand. Jetzt endlich bemerkte er seine eigene Erschöpfung.
»Die Plazenta hatte sich nur an einer kleinen Stelle abgelöst«, erklärte er. »Darüber hinaus waren die Herztöne aller drei Kinder bis unmittelbar vor dem Kaiserschnitt vollkommen in Ordnung. Nach diesem Befund konnte man eigentlich weder mit der vorzeitigen Ablösung noch mit dem schlechten Zustand des kleinen Mädchens rechnen.«
»Wenn die Sauerstoffversorgung bis zum Beginn des Kaiserschnitts gut war, schließe ich eine geistige Behinderung eigentlich aus«, meinte Dr. Senge.
Erleichtert atmete Dr. Daniel auf, dann trat er zu der jungen Säuglingsschwester, die das weinende Baby zärtlich in den Armen wiegte. Mit einem Finger streichelte er über das runde Bäckchen der Kleinen.
»Deine Mama braucht noch ein bißchen Erholung«, flüsterte er. »Aber du darfst dafür gleich zu deinem Papi.«
Diese Aussicht erschien dem Baby offenbar wenig reizvoll, denn es schrie noch jämmerlicher als zuvor. Erst als Dr. Daniel es in den Arm nahm, verstummte das klägliche Weinen.
»Sie wirken anscheinend nicht nur auf Ihre erwachsenen Patienten beruhigend«, meinte Dr. Senge schmunzelnd. »Auch Babys spüren diese Ausstrahlung schon.«
»Ich weiß genau, was Sie damit sagen wollen«, entgegnete Dr. Daniel lächelnd. »Ich bin so langweilig, daß man bei mir nur einschlafen kann.«
Dr. Senge mußte lachen. »So waren meine Worte ganz bestimmt nicht aufzufassen!«
»Das weiß ich, Herr Kollege.« Er legte das jetzt schlafende Baby in den vorbereiteten Brutkasten, dann betrachtete er die Drillinge noch einen Moment, die im Gegensatz zu einem normalen Neugeborenen wie kleine Püppchen aussahen. Aber schließlich eilte er auf den Flur, wo Bernd unruhig hin und her marschierte. Als er Dr. Daniel sah, blieb er so abrupt stehen, als wäre er gegen eine Mauer gerannt.
»Gute Nachrichten«, eröffnete ihm der Arzt sofort. »Ihre Frau hat den Eingriff nach anfänglichen Komplikationen gut überstanden.« Dabei verschwieg er, wie schlimm es für Mona schon ausgesehen hatte. Es wäre unsinnig gewesen, Bernd nachträglich noch Angst einzujagen. »Ihre Babys sind ebenfalls gesund.« Er nahm Bernd am Arm und begleitete ihn zur Frühgeborenen-Intensivstation. »Ihre Frau wird zur Sicherheit noch für ein paar Stunden auf die Intensivstation gebracht. Bis sie zum ersten Mal aufwacht, können Sie schon Ihre Kinder begrüßen.«
Bernd brachte vor Erleichterung kein Wort hervor, doch als er vor den Brutkästen stand, erschrak er.
»Meine Güte, die sind ja so winzig«, brachte er hervor, dann sah er Dr. Daniel angstvoll an. »Geht es ihnen auch wirklich gut?«
Dr. Daniel nickte beruhigend. »Sie sind noch sehr klein, aber ansonsten gut entwickelt. Sie können ohne Hilfe atmen, und in ein paar Wochen werden sie sich kaum noch von anderen Babys ihres Alters unterscheiden. Sicherheitshalber werden wir sie in den nächsten Tagen noch im Brutkasten behalten. Das kleine Mädchen braucht vielleicht sogar ein paar Wochen, weil es nach der Geburt gewisse Probleme hatte. Deshalb sollte auch gerade sie viele Streicheleinheiten bekommen, um das aufzuholen, was sie im Mutterleib anscheinend versäumt hat.« Er lächelte Bernd an. »Nun sollten wir aber auch die frischgebackene Mami nicht mehr länger warten lassen.«
Zusammen schoben sie die drei Brutkästen zur Intensivstation, wo Mona eben im Begriff war, aus der Narkose zu erwachen. Als sie die Augen aufschlug, fiel ihr erster Blick auf die drei Babys. Mit großer Mühe gelang es ihr, eine Hand auszustrecken.
»Sie sind… so klein«, flüsterte sie mit heiserer Stimme.
»Das ist bei Drillingen nun mal nicht ungewöhnlich«, meinte Dr. Daniel mit einem beruhigenden Lächeln. »Sie haben drei gesunde Kinder zur Welt gebracht, Mona. Die beiden Jungs sind ein bißchen kräftiger als das Mädchen, aber um die Kleine werden wir uns ganz intensiv kümmern, damit sie gegen ihre Brüder bestehen kann.«
Ein glückliches Lächeln huschte über Monas Gesicht, dann schlief sie unter den Nachwirkungen der Narkose wieder ein.
»Darf ich noch ein bißchen hierbleiben?« fragte Bernd etwas zaghaft.
»Ich bin sicher, daß Dr. Sommer nichts dagegen haben wird«, meinte Dr. Daniel.
»Natürlich nicht«, bekräftigte der Chefarzt, der seine Worte gehört hatte. »Eine frischgebackene Familie muß zusammen sein. Die Babys dürfen Sie auch noch ein Weilchen bei sich behalten.«
Dr. Daniel und Dr. Sommer gingen hinaus, während sich Dr. Senge unauffällig im Hintergrund hielt, um im Notfall gleich zur Stelle zu sein, obgleich jetzt keine Komplikationen mehr zu erwarten waren. Aber in der Sommer-Klinik ging man grundsätzlich kein Risiko ein.
»Was wirst du jetzt tun?« wollte Dr. Sommer wissen.
Mit einem tiefen Seufzer lehnte sich Dr. Daniel gegen die Wand. »Heimfahren und mich unter Manons Fürsorge von der anstrengenden Operation erholen.«
Dr. Sommer grinste. »Du hast ja unverschämtes Glück, daß du eine so treusorgende Ehefrau daheim hast.«
»Weiß ich«, stimmte Dr. Daniel zu, verabschiedete sich sehr herzlich von seinem Freund und sah dann noch einmal nach Mona und Bernd.
Die junge Frau schlief, aber Bernd blickte mit einem glücklichen Lächeln zurück.
»Bestellen Sie Mona schöne Grüße von mir. Ich werde sie in den nächsten Tagen noch einmal aufsuchen«, meinte Dr. Daniel, dann verließ er die Sommer-Klinik endgültig.
Die halbstündige Fahrt nach Hause war für ihn heute anstrengender als er es sonst empfand. Die Operation, die Angst um Mona und die Drillinge… all das hatte an seinen Kräften gezehrt. Im Moment konnte ihn wirklich nur der Gedanke an seine warmherzige Frau aufmuntern, doch als er seinen Wagen in die Garage fuhr, sah er, daß in der Praxis noch Licht brannte.
Mit langsamen Bewegungen schloß er die schwere, eichene Haustür auf und betrat die Praxis, wo nicht nur er als Gynäkologe tätig war, sondern auch seine Frau Manon als Allgemeinmedizinerin arbeitete. Normalerweise tat sie das vormittags, während der Nachmittag ihrem sechsjährigen Adoptivtöchterchen Tessa gehörte, doch seit gestern war die Kleine mit Dr. Daniels Sohn Stefan und dessen Freundin Darinka auf Sardinien, um Monsignore Antonelli zu besuchen, bei dem Tessa die ersten fünf Lebensjahre verbracht hatte.
Nach kurzem Anklopfen betrat Dr. Daniel das Sprechzimmer seiner Frau. Manon blickte hastig von ihrer Schreibarbeit auf.
»Du bist schon hier?« fragte sie überrascht.
Dr. Daniel nickte, dann ließ er sich mit einem tiefen Seufzer auf einen der beiden Sessel fallen, die Manons Schreibtisch gegenüberstanden.
»Ich habe einen anstrengenden Tag hinter mir«, gestand Dr. Daniel. »Dazu eine schwierige Operation und…« Bittend sah er Manon an. »Ich sehne mich nach ein paar Streicheleinheiten.«
Bedauernd schüttelte Manon den Kopf. »Tut mir leid, Robert, ich kann hier im Moment noch nicht Schluß machen. Ich habe in der Zeit, in der Tessa weg ist, eine Menge aufzuarbeiten. Das wirst du sicher verstehen.«
Dr. Daniel nickte zwar, aber in Wirklichkeit verstand er es nicht. Es kam nicht oft vor, daß er so direkt um ein bißchen Fürsorge bat, und gerade heute hätte er Manons Nähe ganz dringend gebraucht.
»Du siehst erschöpft aus, Robert«, stellte Manon fest und legte für einen Moment ihre Hand auf seinen Arm. »Geh nach oben und leg dich hin. Ich komme, sobald ich hier fertig bin.«
Dr. Daniel erhob sich ungewöhnlich schwerfällig.
»Arbeite nur nicht mehr zu lange«, bat er leise, dann verließ er Manons Sprechzimmer. Auf dem Flur blieb er sekundenlang stehen. Warum war Manon heute so distanziert gewesen? Lag es an der Arbeit und steuerten sie auf eine Krise zu? Aber weshalb? Es hatte keinen Streit zwischen ihnen gegeben… nicht einmal eine kleine Meinungsverschiedenheit. Noch heute früh war alles wie immer gewesen.
»Wahrscheinlich vermißt sie Tessa«, murmelte sich Dr. Daniel zu. Er hatte ja auch schon nach diesem einen Tag Sehnsucht nach seinem quirligen Adoptivtöchterchen, das ihm längst wie ein eigenes Kind ans Herz gewachsen war. Ohne Tessa wirkte die ganze Villa wie ausgestorben.
Müde ließ sich Dr. Daniel auf das Sofa fallen und sah blicklos vor sich hin. Seine ältere, verwitwete Schwester Irene, die ihnen hier den Haushalt führte, hatte die Gelegenheit, daß es durch Tessas Abreise für eine Weile ruhiger war, beim Schopf gepackt und war für ein paar Tage in ihre Heimatstadt Kiel gefahren. Im Gegensatz zu Dr. Daniel, der ursprünglich ja auch aus Schleswig-Holstein stammte, sich mittlerweile hier in Bayern aber ganz zu Hause fühlte, ergriff Irene immer wieder mal das Heimweh.
Dr. Daniel war somit völlig allein. Er ging in die Küche und schenkte sich ein Bier ein, doch es vermochte ihn nicht zu entspannen. Schließlich ließ er das halbgeleerte Glas stehen und legte sich ins Bett. Es konnte nicht mehr lange dauern, bis Manon heraufkommen würde, doch irgendwann schlief er erschöpft ein. Als er am nächsten Morgen erwachte, lag er allein im Bett. Manon war anscheinend schon wieder in der Praxis unten.
Mit einem tiefen Seufzer stand Dr. Daniel auf und ging unter die Dusche. Zum ersten Mal während seiner zweiten Ehe fühlte er sich einsam und unglücklich.
*
Die Luft im Auto war heiß und stickig.
»Mama, wie lange müssen wir noch fahren?« wollte die vierzehnjährige Pamela genervt wissen.
»Bis wir am Ziel sind«, antwortete Rebecca Horn im üblichen lieblosen Ton.
Pamela tauschte einen Blick mit ihrem zwei Jahre älteren Bruder, doch sie wußte, daß Perry schweigen würde. Er hatte vor seiner übermäßig strengen Mutter noch sehr viel mehr Angst als Pamela.
Rebecca bog in einen staubigen Weg ein, der die Luft im Auto nicht unbedingt verbesserte, dann hielt sie den Wagen an und stieg aus. Umgeben von der traumhaften Landschaft des Napa Valley lag dort unten – eingebettet in sanfte Hügel – das Weingut, das Rebecca ihren Kindern unbedingt zeigen wollte.
Ungeduldig winkte sie zum Auto hin. Perry und Pamela kannten dieses Zeichen und stiegen aus, blieben aber in respektvollem Abstand zu ihrer Mutter stehen.
»Seht«, meinte Rebecca und wies mit ausgestreckter Hand auf das große Haupt- und die beiden nur unwesentlich kleineren Nebengebäude, die gerade mal fünfhundert Meter Luftlinie von ihnen entfernt waren. »Das wird bald euch gehören… zumindest das meiste davon.«
»Mama, hör auf damit«, bat Perry leise. Er war ein hübscher, schlanker Junge mit dunkelblondem Haar und herrlich blauen Augen. Ungehalten trat Rebecca mit wenigen Schritten zu ihm und bestrafte ihn für seine Worte mit einem harten Schlag auf den Mund.
»Perry hat recht…«, begann Pamela, doch auch sie wurde mit einem ebenso schmerzhaften Klaps zum Schweigen gebracht.
»Steigt ein!« befahl Rebecca scharf.
Pamela und Perry gehorchten widerspruchslos.
»Ich hasse sie«, zischte Pamela ihrem Bruder zu.
Perry schwieg. Er litt unter der Lieblosigkeit seiner Mutter mehr als seine Schwester. Pamela hatte eine große Portion von Rebeccas Kaltblütigkeit geerbt, was ihr den Umgang mit der hartherzigen Mutter erleichterte. Perry dagegen war sanft und sensibel. Jede Strafe und jedes harte Wort zerstörten ein bißchen mehr in ihm.
Auch Rebecca stieg jetzt wieder ins Auto, ließ den Motor an und fuhr den holprigen Weg zurück, dann bog sie auf die Straße, die nach San Francisco führte. Pamela und Perry registrierten erleichtert, daß sie nicht ins heimatliche Los Angeles zurückfahren würde. Anscheinend hatte Rebecca wieder einmal vor zu verreisen. Früher hatten Pamela und Perry während der Abwesenheit ihrer Mutter bei ihrem Großvater bleiben müssen, was für die Kinder immer zu einer Tortour geworden war. Allem Anschein nach hatte Rebecca ihr herzloses Wesen von ihrem Vater geerbt. Jonathan Horn war die Hartherzigkeit in Person gewesen, und die beiden Kinder hatten in seinem Haus zuweilen die Hölle durchlebt. Seit dem Tod des Großvaters wurden sie immer bei Rebeccas Bruder untergebracht, wenn ihre Mutter verreisen wollte. Dr. Alec Horn war ein arbeitsloser Arzt, aber die Kinder liebten ihn von Herzen. Er stand ihnen weit näher als ihre eigene Mutter.
Jetzt hielt Rebecca ihren Wagen vor der stattlichen, im viktorianischen Stil erbauten Villa an. Nahezu im selben Moment kam Alec zur Tür heraus und ging ihnen mit einem strahlenden Lächeln entgegen. Sein glattes, dunkles Haar hatte er wie immer nach hinten gekämmt, doch ein paar vorwitzige Strähnen fielen ihm widerspenstig ins Gesicht, was ihm etwas Lausbubenhaftes gab. In krassem Gegensatz dazu standen seine sanften, blaugrauen Augen, die wohl schon zuviel Elend gesehen hatten, als daß in ihnen jemals wirkliche Fröhlichkeit liegen könnte. Sogar wenn er – wie jetzt – so herzlich lächelte, blieben seine Augen ernst.
»Becky, wie schön, dich zu sehen«, meinte Alec, und Perry dachte wieder einmal, daß der Kosename ›Becky‹ zu seiner Mutter eigentlich überhaupt nicht paßte.
»Ich heiße Rebecca«, korrigierte sie denn auch schon nachdrücklich, ließ es widerwillig geschehen, von ihrem älteren Bruder auf die Wange geküßt zu werden, und drängte ihn ins Haus zurück, ehe er seine Nichte und seinen Neffen begrüßen konnte.
»Ihr geht zu Bett!« befahl Rebecca, kaum daß sie die Villa betreten hatten.
»Aber Mama, es ist doch erst…«, wagte Pamela einzuwenden, doch Rebecca brachte sie mit einer heftigen Handbewegung zum Schweigen. Dann sah sie ihren Bruder an. »Gib ihnen etwas, damit sie schlafen. Am besten eine Spritze, und die kann ruhig weh tun. Sie sollen lernen, daß Widerspruch bestraft wird.«
Alecs Lächeln erlosch. Wortlos nahm er Pamela und Perry mit nach oben und brachte sie ins Gästezimmer. Perry wich ängstlich an die Wand zurück.
»Onkel Alec, bitte…«, flüsterte er flehend.
»Pam, Perry, ihr wißt doch ganz genau, daß ihr vor mir keine Angst zu haben braucht«, erklärte Alec mit sanfter Stimme. »Ich bin nicht wie euer Großvater. Im Gegensatz zu ihm bin ich Arzt geworden, um Menschen zu heilen, und nicht, um sie mit Medikamenten zu bestrafen. Und euch beiden könnte ich schon gar nicht weh tun. Bleibt hier in diesem Zimmer. In dem Schrank dort sind Bücher, und irgendwo stecken sicher auch noch ein paar Gesellschaftsspiele. Eure Mutter wird mich wohl nicht lange mit ihrer Anwesenheit beglücken, und danach werden wir drei es uns gemütlich machen.« Er lächelte die beiden an, streichelte erst Pamela, dann Perry über den Kopf und bemerkte dabei, wie der Junge angstvoll zusammenzuckte. Es schmerzte Alec, und er wünschte, er könnte mehr für die beiden tun, als ihnen nur während Rebeccas Abwesenheit ein etwas schöneres Leben zu verschaffen.
»Schlafen sie?« wollte Rebecca wissen, als Alec wieder im Salon erschien.
Er nickte. »Ja.« Dabei hatte er nicht die Spur eines schlechten Gewissens, weil er seine Schwester mit einer Lüge abspeiste.
»Sehr gut«, urteilte Rebecca, dann schlug sie graziös die Beine übereinander und zündete sich eine Zigarette an. »Wir kommen von der Parker-Winery… das heißt, wir haben sie uns von weitem angesehen.«
Es gelang Alec nicht, einen Seufzer zu unterdrücken. »Meine Güte, Becky… Rebecca, warum kannst du nicht endlich Ruhe mit diesem Thema geben? Die Parkers sind längst tot, ihr einziger Sohn arbeitet irgendwo in Deutschland als Arzt und das Weingut ist verpachtet. Warum willst du da unbedingt Unfrieden stiften?«
»Perry ist Parkers Sohn«, hielt Rebecca dagegen.
Zweifelnd sah Alec sie an. »So viele Väter kann kein Kind haben. Wie vielen Männern hast du Perry und Pam schon als Kinder untergejubelt?«
»Diesmal ist es wahr«, behauptete Rebecca ungerührt. »Parker war der Vater von Perry. Damit ist Perry erbberechtigt, und da Parker tot ist, wird es mir ein leichtes sein, ihm auch Pam als Tochter unterzujubeln. Parkers ehelicher Sohn wird die Erbschaft auszahlen müssen, dafür werde ich sorgen.«
»Du weißt ja gar nicht, wo er jetzt lebt«, entgegnete Alec, obwohl er wußte, daß das wohl nicht schwierig herauszubekommen sein dürfte.
»Natürlich weiß ich es«, bekräftigte Rebecca triumphierend. »Und morgen werde ich nach Deutschland reisen.«
Verständnislos sah Alec seine Schwester an. »Wieso das? Wenn du ihm nur das Erbe streitig machen willst, dann kannst du das von hier aus genausogut.«
Rebecca zeigte ein raffiniertes Lächeln, das Alec an die Abbildung einer bösen Fee aus dem Märchenbuch erinnerte, das er als kleiner Junge so sehr geliebt hatte. In diesem Buch hatte am Ende immer die gute Fee über die böse gesiegt, doch wenn er das nun mit seiner Schwester verglich, mußte er feststellen, daß es im wirklichen Leben doch eher andersherum ging.
»Ich will mir den Burschen mal ansehen«, erklärte sie jetzt. »Wenn er nach seinem Vater kommt, dann würde sich eine kleine Affäre mit ihm allemal lohnen – auch finanziell. Auf diese Weise könnte ich sogar zweimal bei ihm abkassieren.«
*
»Seit Tessa weg ist, hast du für mich überhaupt keine Zeit mehr«, hielt Dr. Daniel seiner Frau enttäuscht vor. »In den vergangenen Tagen warst du ja Tag und Nacht in der Praxis.«
»Du übertreibst«, entgegnete Manon, dabei fühlte sie sich nach den anstrengenden Tagen völlig ausgelaugt. Ein paar ruhige Stunden mit Robert würden ihr bestimmt guttun, andererseits war in den letzten Monaten so viel liegengeblieben und wann würde sie schon wieder die Chance haben, wirklich ungestört arbeiten zu können? Manon liebte ihr Töchterchen, doch es ließ sich nicht bestreiten, daß Tessa gelegentlich ziemlich anstrengend sein konnte. Trotzdem litt Manon schon jetzt unter ihrer Sehnsucht nach der quirligen Kleinen, was zu der kräftezehrenden Arbeit noch erschwerend hinzukam.
»Ich übertreibe nicht«, stellte Dr. Daniel nachdrücklich klar. »Seit Stefan und Darinka mit Tessa abgefahren sind, haben wir beide kaum noch ein privates Wort gewechselt. Allmählich fühle ich mich wie ein Gegenstand, den du zur Seite gestellt hast, weil du ihn gerade nicht brauchst.«
»Da siehst du mal, wie es mir meistens geht«, konterte Manon. »In der Regel bist nämlich du derjenige, der nie aus der Praxis oder aus der Klinik findet. Vielleicht tut es dir mal ganz gut zu spüren, wie es ist, wenn man sich vernachlässigt fühlt.«
Dr. Daniel war von diesen Worten wie vor den Kopf gestoßen. Noch nie hatte Manon in dieser Weise mit ihm gesprochen.
»Heißt das… du willst mir eine Lektion erteilen?« fragte Dr. Daniel zurück.
Manon schüttelte den Kopf. »Nein, Robert, eigentlich wollte ich das nicht. Ich versuche lediglich, meine liegengebliebene Arbeit zu erledigen, und das kostet eben Zeit… Zeit, die ich sonst nie habe, und Tatsache ist nun mal, daß du daran nicht ganz unschuldig bist. In meiner Praxis wäre längst nicht soviel liegengeblieben, wenn du mir mit Tessa nur ab und zu mal behilflich wärst. Aber meistens bist du ja so sehr eingespannt, daß du erst spät abends nach Hause findest. Was ich während dieser Zeit alles getan habe, interessiert dich gar nicht.«
»Das ist nicht wahr!« widersprach Dr. Daniel energisch. Er spürte, daß die Diskussion nahe daran war, in einen Streit zu münden. »Machst du es mir denn zum Vorwurf, daß ich meine Arbeit ernst nehme? Daß ich sie gründlich erledigen will?«
»Nein, Robert, aber du tust genau das bei mir«, erwiderte Manon. »Du willst nicht einsehen, daß ich auch einen Beruf habe, den ich liebe und den ich gründlich erledigen will. Wenn es nach dir ginge, müßte ich einfach nur immer parat stehen, falls du einmal Zeit hast oder dich gerade nach ein paar Streicheleinheiten sehnst. Was ich tue oder wie ich es schaffe, ist dir egal. Du verläßt dich darauf, daß ich alles irgendwie erledige – meine Arbeit in der Praxis, hier oben mit Tessa…«
»Ich wußte nicht, daß dir das so zuwider ist«, fiel Dr. Daniel ihr bitter ins Wort.
»Es ist mir doch gar nicht zuwider«, korrigierte Manon. »Ich habe es nur einfach satt, mein Leben nach deinem Zeitplan auszurichten. Ich habe nicht nur Pflichten, sondern auch Rechte, und die wirst du nun zum ersten Mal zu spüren bekommen.«
Ihre harten Worte trafen ihn mitten ins Herz. Dr. Daniel verstand auf einmal die Welt nicht mehr. Diese herben Vorwürfe, mit denen Manon ihn bombardierte… Vorwürfe, die zumindest zum Teil ungerechtfertigt waren, taten ihm schrecklich weh. Sicher, er arbeitete viel und kam oft spät nach Hause. Gelegentlich brachte er auch die Probleme seiner Patientinnen mit, kümmerte sich oft mehr um sie, als es seiner Ehe wohl zuträglich war, aber nie zuvor hatte Manon auch nur eine Andeutung gemacht, daß sie sich vernachlässigt fühlte… daß er sich wie ein Pascha benehmen würde…
Abrupt stand er auf und verließ die Wohnung. Wie gehetzt rannte er die Treppe hinunter und zur Haustür hinaus. Dort wäre er beinahe mit seiner Tochter Karina zusammengestoßen.
»Papa, um Himmels willen, was ist denn los?« fragte sie erschrocken, als sie einen Blick in sein verstörtes Gesicht warf.
Hastig schüttelte er den Kopf. »Nichts.«
Doch so leicht ließ sich Karina nicht abwimmeln. Sie hielt ihren Vater am Arm fest und fragte teilnahmsvoll: »Hattest du Krach mit Manon?«
Mit einer fahrigen Handbewegung strich sich Dr. Daniel über die Stirn. »Ich kann nicht darüber reden, Karina. Nicht mit dir… mit niemandem. Laß mich bitte einfach in Ruhe.«
Besorgt sah Karina ihm nach, als er mit langen Schritten den Weg zum mächtigen Kreuzberg hinauf einschlug. Sie wußte, daß er den steilen Anstieg immer dann bevorzugte, wenn er mit einem Problem fertigzuwerden hatte oder einfach nur Ruhe suchte. Doch diesmal machte sie sich ernstlich Sorgen um ihren Vater.
Sie betrat das Haus und ging die Treppe hinauf. Bereits an der Wohnungstür begegnete ihr Manon, die sich gerade auf den Weg zur Praxis machte, obwohl heute ja Sonntag war.
»Papa ist mir begegnet«, begann Karina ohne Umschweife. »Er war völlig durcheinander. Was ist passiert, Manon?«
»Dein Vater lernt gerade, wie es ist, wenn man sich vernachlässigt fühlt«, antwortete Manon achselzuckend.
Karina betrachtete ihre attraktive Stiefmutter, mit der sie sich normalerweise gut verstand, dann schüttelte sie den Kopf. »Ist das wirklich nötig?«
Seufzend lehnte sich Manon an den Türrahmen. »Nein, Karina. Ich wollte es ja auch gar nicht.« Mit gespreizten Fingern fuhr sie sich durch ihr halblanges, kastanienbraunes Haar. »Irgendwie kommt im Moment eben alles zusammen. In letzter Zeit war Robert besonders eingespannt, so daß ich ihn kaum zu Gesicht bekommen habe…«
»Und das willst du ihn jetzt spüren lassen«, fiel Karina ihr etwas vorwurfsvoll ins Wort.
Manon schüttelte den Kopf. »Nein, eigentlich nicht… allerdings… vielleicht tut es ihm wirklich mal ganz gut.« Sie seufzte wieder. »Karina, dein Vater ist ein herzensguter Mensch, und ich liebe ihn über alles, aber manchmal ist es wirklich nicht einfach mit ihm. Er kümmert sich um alles und jeden, versucht immer zu helfen und… manchmal habe ich den Eindruck, als würde ich dabei auf der Strecke bleiben. Jetzt ist es plötzlich mal umgekehrt…« Sie stockte, dann senkte sie den Kopf und rückte mit der Wahrheit heraus. »Tessa fehlt mir, und darüber hinaus… ach, Karina, ich… ich bin eifersüchtig.«
Damit hatte Karina nicht gerechnet. »Eifersüchtig? Auf wen denn?«
»Auf die Praxis, auf die Klinik… das alles scheint Robert mehr zu bedeuten als ich. Und Tessa… sie ist so voller Freude mit Stefan und Darinka mitgefahren. Bei ihren Anrufen erzählt sie ganz begeistert, was sie mit Stefan und Darinka alles unternimmt, wie schön es bei Monsignore Antonelli ist und sie fragt, wie es ihrem Papa geht. Allmählich habe ich das Gefühl, als würde ich für niemanden mehr existieren.«
Spontan nahm Karina ihre Stiefmutter in den Arm. »Manon, meine Güte… du solltest mit Papa sprechen, anstatt ihn noch zusätzlich zu vergraulen.«
Manon nickte etwas fahrig, doch sie wußte schon jetzt, daß sie dieses Gespräch nicht führen würde. Im Grunde war ihre Eifersucht ja auch lächerlich. Robert liebte sie, Tessa liebte sie… sie brauchte nur ein wenig Zeit, um mit sich wieder ins reine zu kommen.
*
Es war für Rebecca Horn ein Leichtes gewesen, die Adresse von Dr. Jeffrey Parker herauszubekommen, und als sie jetzt in Steinhausen ankam, hatte sie kein Auge für den idyllischen Vorgebirgsort. Vor sich hatte sie nur ein einziges Ziel: Geld.
Rebecca quartierte sich in dem einzigen Gasthof im Ort ein und bemerkte mit Genugtuung die begehrlichen Blicke, die sie bei sämtlichen anwesenden Männern auslöste. Es war eigentlich immer das gleiche. Männer waren doch wirklich einfältig. Die Schönheit einer Frau genügte ganz allein, um sie völlig aus dem Gleichgewicht zu bringen. War das erst mal geschehen, hatte man leichtes Spiel mit ihnen.
Rebecca packte ihre Koffer aus, dann beschloß sie, ihr Ziel gleich auf direktem Weg anzusteuern. Sie ging zur Waldsee-Klinik und erkundigte sich bei Martha Bergmeier, die wie immer in ihrem Glashäuschen mit der Aufschrift ›Information‹ saß, nach Dr. Parker.
»Tut mir leid, Herr Dr. Parker hat heute dienstfrei«, antwortete Martha bedauernd.
»Dann werde ich es wohl bei ihm zu Hause versuchen müssen«, meinte Rebecca, blieb aber absichtlich noch einen Moment abwartend stehen. Sie schätzte Martha ganz richtig als sehr gesprächig ein.
»Ach so«, meinte Martha auch schon. »Sie wollen in einer privaten Angelegenheit mit ihm sprechen. Nun… an dienstfreien Tagen ist er meistens zu Hause, aber falls Sie ihn dort doch nicht erreichen, könnten Sie es auch bei Dr. Daniel versuchen. Dr. Parker ist mit seiner Tochter verheiratet und hält sich an dienstfreien Tagen häufig in der Villa seiner Schwiegereltern auf.«
Das Wort ›Villa‹ ließ Rebecca hellhörig werden. Sollte beim Schwiegervater des jungen Parker womöglich mehr zu holen sein als bei ihm selbst? Die Erbschaft war ihr ja allemal sicher. Es konnte also nicht schaden, sich diese Villa wenigstens mal anzusehen. Möglicherweise könnte sie sogar beides mitnehmen… Parker und seinen Schwiegervater.
»Vielen Dank«, meinte Rebecca, als sie von Martha einen Zettel mit Dr. Daniels Adresse entgegennahm. »Sie haben mir mit Ihrer Auskunft sehr geholfen.«
Die stattliche Villa am Ende des Kreuzbergweges sah dann auch wirklich verheißungsvoll aus.
Ja, nickte sich Rebecca selbst zu. Das ist ganz genau meine Kragenweite.
Sie las das Praxisschild und beschloß, gleich heute, kurz vor Ende der Sprechstunde, noch einmal herzukommen. Sie wollte unbedingt sichergehen, daß sie die letzte Patientin sein würde.
»Und dann ist der gute Daniel fällig«, murmelte sie sich mit einem zufriedenen boshaften Lächeln zu.
*
Der Montagmorgen ließ sich ungewöhnlich ruhig an.
»Ich wette, da kommt heute nachmittag das dicke Ende erst noch«, vermutete Gabi Meindl.
Doch sie irrte sich. Es kamen wirklich nur die angemeldeten Patientinnen und auch von der Waldsee-Klinik erfolgte kein Notruf. Die Sprechstunde war dann auch schon fast zu Ende, als es noch einmal an der Tür klingelte.
Gabi drückte auf den Türöffner. Wenig später stand vor ihrem Schreibtisch eine außergewöhnlich schöne Frau. Langes, dunkles Haar umrahmte das beinahe klassische Gesicht, in dem Augen, unergründlich wie ein tiefer See, dominierten.
»Sie wünschen?« fragte Gabi und spürte eine seltsame Unsicherheit, die sie an sich sonst gar nicht kannte. War es die Anwesenheit dieser außergewöhnlichen Frau? Gabi erkannte, daß sie nicht einfach nur schön war, sie besaß darüber hinaus auch noch Ausstrahlung.
»Rebecca Horn ist mein Name«, antwortete die Dame mit unüberhörbarem, amerikanischem Akzent. »Ich habe hier in Steinhausen geschäftlich zu tun und leide nun seit zwei Tagen unter Bauchschmerzen… Unterleibschmerzen, um genau zu sein.«
»Nehmen Sie doch einen Moment im Wartezimmer Platz«, bat Gabi. »Der Herr Doktor wird sich gleich Zeit für Sie nehmen.«
Rebecca bedankte sich und ließ sich von der Sprechstundenhilfe Sarina von Gehrau zum Wartezimmer begleiten.
»Mensch«, stieß Gabi bewundernd hervor. »Da könnte man direkt neidisch werden. Hast du schon mal eine solche Schönheit gesehen?«
»Sie ist wirklich eine ganz außergewöhnliche Frau«, stimmte Sarina zu.
»Hoffentlich wird der Chef da nicht schwach«, meinte Gabi. »Mir scheint, er hat im Moment sowieso reichlich Zoff mit seiner Angetrauten.«
»Gabi, du spinnst«, urteilte Sarina hart. »Dr. Daniel liebt seine Frau. Für ihn gibt es keine andere und wenn sie noch so schön ist.«
»Dein Wort in Gottes Ohr«, entgegnete Gabi. Sie wies zum Wartezimmer hin. »Meines Erachtens kann der da drinnen kein Mann widerstehen.«
»Dr. Daniel schon«, beharrte Sarina, dann machte sie auf dem Absatz kehrt. »Ich werde sie jetzt anmelden.«
Angesichts des Unfriedens, der zwischen ihm und Manon schwelte, war Dr. Daniel über diese unverhoffte Patientin nicht sehr glücklich. Eigentlich hatte er gehofft, er könnte heute ganz pünktlich Feierabend machen, ein paar Blumen besorgen und sich dann mit seiner Frau gründlich aussprechen.
»Schicken Sie die Dame herein«, bat er dennoch und stand gleichzeitig auf, um seiner Patientin entgegenzugehen.
»Guten Tag, Daniel ist mein Name«, stellte er sich vor.
»Rebecca Horn«, erwiderte sie und zauberte ein verführerisches Lächeln auf ihre Lippen, was Dr. Daniel aber ebensowenig wahrnahm wie ihre außerordentliche Schönheit. Seine Gedanken waren viel zu sehr in den Problemen mit Manon gefangen, als daß ihm eine Frau wegen solcher Äußerlichkeiten aufgefallen wäre.
»Was führt Sie zu mir?« wollte Dr. Daniel wissen, als Rebecca Platz genommen hatte.
Mit dem geübten Blick der erfahrenen Frau erkannte sie auf Anhieb, daß Dr. Daniel mit den üblichen Verführungskünsten nicht zu entflammen war. Natürlich hatte sie gleich den Ehering an seiner Hand entdeckt. Die Tatsache, daß er auf ihre Schönheit nicht einmal mit einem anerkennenden Blick reagiert hatte, zeigte Rebecca nur zu deutlich, daß sie andere Wege gehen mußte, um diesen Mann herumzukriegen.
»Seit vorgestern verspüre ich so einen unangenehmen Druck im Unterleib – nicht direkt schmerzhaft, aber doch sehr hartnäckig«, antwortete sie nun und schlug graziös ihre Beine übereinander. Dabei rutschte ihr Rock ein Stückchen hoch, doch auch das registrierte Dr. Daniel nicht. Er war in seinen Gefühlen eben zu gefestigt, um beim Anblick einer schönen Frau gleich schwach zu werden. Darüber hinaus beschäftigte ihn der Unfrieden mit Manon zu sehr. Er hatte ja schon Mühe, sich auf seine Arbeit zu konzentrieren und sehnte sich im Augenblick wirklich nur nach einer gründlichen Aussprache mit seiner Frau.
Dr. Daniel machte sich eine Notiz, dann sah er Rebecca wieder an. »Haben Sie außer diesem unangenehmen Druckgefühl denn noch andere Beschwerden? Verstopfung oder vielleicht ein schmerzhaftes Brennen beim Wasserlassen?«
Rebecca schüttelte den Kopf. »Nein, Herr Doktor, nichts von alledem. Es ist lediglich ein eigenartiger Druck, der mir doch gewisse Sorgen bereitet.«
Dr. Daniel stand auf. »Wir sollten mal nach nebenan gehen, damit ich Sie untersuchen kann.«
Rebecca machte sich hinter dem Wandschirm frei, dann trat sie zu Dr. Daniel und blieb näher, als es nötig gewesen wäre, vor ihm stehen. Sie wußte, wie makellos ihr Körper war. Zwar trug sie noch ihre Bluse, doch das machte sie eigentlich nur noch verführerischer. Allerdings zeigte Dr. Daniel auch angesichts ihrer zumindest halben Nacktheit kein Anzeichen von Begehren oder wenigstens Interesse.
Das wird schwierig, dachte Rebecca verärgert, während sie sich auf den gynäkologischen Stuhl setzte. Er sieht in seinem Beruf natürlich zu viele unbekleidete Frauen. Aber eine Schwachstelle hat auch er. Ich muß sie nur finden.
Trotz gründlichster Untersuchung konnte Dr. Daniel die Ursache für Rebeccas beschriebenes Druckgefühl natürlich nicht finden, weil es ja nichts zu finden gab. Rebecca war kerngesund. Sie hatte mit diesem Besuch hier nur mal die Lage sondieren wollen.
»Tut mir leid, Frau Horn«, entgegnete Dr. Daniel bedauernd. »Ich kann keine Auffälligkeiten feststellen. Der Abstrich war ohne Befund, und auch die Tastuntersuchung hat nichts ergeben, was auf eine Krankheit hinweisen könnte.« Er schwieg kurz. »Wenn ich die kleine Narbe auf der rechten Unterbauchseite richtig deute, dann haben Sie Ihren Blinddarm bereits verloren, wobei die geschilderten Symptome für eine Blinddarmentzündung aber auch nicht sehr typisch wären.«
Rebecca stieg von dem Untersuchungsstuhl und blieb erneut vor Dr. Daniel stehen, doch auch diesmal erfolgte von ihm keine Reaktion. Ihr Lächeln war verheißungsvoll, und sie begriff nicht, wie ihre Waffen bei diesem Mann derart versagen konnten.
»Vielleicht ist es ja die ganze Umstellung«, meinte sie. »Ich komme aus Los Angeles. Die Zeitumstellung… das ungewohnte Essen… wahrscheinlich habe ich wegen dieses seltsamen Gefühls einfach überreagiert.«
Dr. Daniel nickte. »Das wäre möglich, trotzdem sollten Sie Ihren Zustand weiterhin aufmerksam beobachten.« Er schwieg kurz. »Wenn sich dieses Druckgefühl in den nächsten Tagen nicht bessert, sollten Sie wiederkommen. Da ich neben meiner Praxistätigkeit auch Direktor der Waldsee-Klinik bin, könnte ich veranlassen, daß Sie nicht nur gynäkologisch untersucht werden. Ein Druckgefühl im Unterbauch kann verschiedene Ursachen haben, die…«
»Ja, das wäre vielleicht wirklich eine Möglichkeit«, fiel Rebecca ihm ins Wort, dann lächelte sie wieder. »Ich werde das Angebot, mich gründlich untersuchen zu lassen, sicher annehmen, sobald ich meine geschäftlichen Angelegenheiten erledigt habe.« Sie trat hinter den Wandschirm und kleidete sich an, dann kam sie wieder auf Dr. Daniel zu und lächelte ihn an. »Sie scheinen ja ein sehr vielbeschäftigter Mann zu sein. Praxis und Klinik verlangen Ihnen sicher eine ganze Menge ab.«
Dr. Daniel nickte. »Das ist richtig. Manchmal wird es schon äußerst stressig, vor allem, weil man immer versucht, nichts zu kurz kommen zu lassen, obwohl es dann am Ende zwangsläufig doch passiert.«
Rebecca bemerkte sofort die leise Melancholie, die in seiner Stimme mitschwang und wußte, daß sie jetzt im Begriff war, das Geheimnis seiner Standhaftigkeit einer schönen Frau gegenüber zu ergründen.
»Ich nehme an, Sie sprechen von Ihrem Privatleben«, hakte Rebecca sofort nach.
»Ja.« Dr. Daniel seufzte leise, dann schüttelte er den Kopf. »Ich will Sie hier nicht mit meinen Sorgen belästigen…«
»Aber das tun Sie doch gar nicht«, entgegnete Rebecca nachdrücklich. »Ich weiß selbst, wie das ist, Herr Doktor. Sehen Sie, ich bin Geschäftsfrau, und meine beiden Kinder leiden oft ganz schrecklich darunter.«
»Sie sind alleinerziehend?«
Es war schon eine schauspielerische Glanzleistung, wie Rebecca jetzt Tränen in ihre Augen zauberte. »Ja, seit dem Tod meines Mannes…« Sie wandte sich ein wenig ab, betupfte sich die Augen mit einem feinen Spitzentaschentuch und wandte sich dann Dr. Daniel wieder zu. Dabei schien es, als müsse sie sich zu dem sanften Lächeln, das sie ihm schenkte, regelrecht zwingen. »Es ist schon ein paar Jahre her, aber es tut immer noch weh.«
»Das kann ich sehr gut nachempfinden«, meinte Dr. Daniel. »Ich habe meine erste Frau auch viel zu früh verloren und stand dann mit zwei Kindern allein da. Nun ja… Karina und Stefan waren damals bereits fast erwachsen, aber in Ihrem Fall…« Er betrachtete die Frau vor sich und schätzte sie auf Anfang Dreißig. »Ich nehme an, Ihre Kinder sind noch sehr klein.«
»Zehn und zwölf«, log Rebecca ungeniert, weil sie nicht eingestehen wollte, daß sie bei Perrys Geburt erst siebzehn gewesen war. »Im Augenblick sind sie bei meinem Bruder in den Staaten, aber es ist natürlich immer schwer für sie, ihre geliebte Mama nicht um sich zu haben.«
»Das kann ich mir vorstellen«, bekräftigte Dr. Daniel. Die junge Frau tat ihm von Herzen leid.
»Manchmal denke ich…« Sie unterbrach sich. »Meine Güte, nun langweile ich Sie mit meiner Geschichte.«
»Davon kann überhaupt nicht die Rede sein«, widersprach Dr. Daniel energisch. »Manchmal ist es nötig, sich auszusprechen.«
Damit spielte er Rebecca ahnungslos genau in die Hände. »Sehen Sie, Herr Doktor, das denke ich auch.« Sie warf einen Blick auf ihre elegante Armbanduhr. »Vielleicht sollten wir dieses Gespräch in angenehmerer Atmosphäre weiterführen. Sie kennen hier in Steinhausen sicher…« Wieder unterbrach sie sich. »Aber nein, wie gedankenlos von mir. Ihr Privatleben kommt ja ohnehin immer zu kurz. Ihre Frau wird sicher auf Sie warten.«
Dr. Daniel wollte gerade bejahen, als ihm der Zettel einfiel, den er mittags in der Wohnung oben von Manon vorgefunden hatte. Sie hatte in der Praxis so viel zu tun, und er solle abends nicht auf sie warten. Eigentlich hatte er diese Nachricht ja ignorieren und Blumen besorgen wollen…
Unwillkürlich wanderte sein Blick zur Tür. Hier hinaus, den Flur entlang und dann durch die Zwischentür in den anderen Teil der Praxis. Ein Weg von nicht einmal einer Minute. Trotzdem hatten weder er noch Manon ihn heute oder in den vergangenen Tagen gefunden. Ihre Ehe steckte in einer tiefen Krise, auch wenn er sich das nicht eingestehen wollte und es auch noch immer nicht ganz verstand. Bis zu Tessas Abreise war alles in bester Ordnung gewesen. Oder hatte er sich das nur eingebildet? Hatte er die ersten Anzeichen einer Krise vielleicht nicht bemerkt… gar nicht bemerken wollen?
Plötzlich wurde ihm bewußt, daß er noch immer mit Rebecca Horn zusammenstand.
»Entschuldigen Sie bitte, ich war mit meinen Gedanken woanders«, murmelte er verlegen, dann blickte er auf die Uhr. »Auf mich wartet niemand.«
Rebecca triumphierte innerlich. Das war es also, was bei Robert Daniel zog. Er wollte ein bißchen getröstet und umsorgt werden, aber Rebecca hatte auch diese Masche drauf, obgleich sie sie selten brauchte. Die meisten Männer entflammten schon aufgrund ihrer berückenden Schönheit. Allerdings war Rebecca zuversichtlich, daß es auch bei Dr. Daniel nicht nur beim Trösten bleiben würde. Spätestens in ein paar Tagen würde sie ihn in ihrem Bett haben und danach würde sie ihn sehr kräftig zur Kasse bitten…
*
Manon Daniel saß an ihrem Schreibtisch und versuchte zu arbeiten, aber der schwelende Streit mit ihrem Mann raubte ihr die Konzentration. Immer wieder glitt ihr Blick zur Sprechzimmertür. Sie würde nicht einmal eine Minute brauchen, um zu Robert hinüberzugehen und ihn um Verzeihung zu bitten. Sie liebte ihn doch schließlich! Und sie wußte, daß er für sie das gleiche fühlte… daß er sie niemals vernachlässigen wollte. Im Grunde tat er es ja auch gar nicht. Er bemühte sich immer, für sie da zu sein… besonders jetzt, doch sie gab ihm ja gar keine Gelegenheit dazu. Sie war es ja, die ihn plötzlich vernachlässigte – und zwar ganz gewaltig!
Seufzend stand Manon auf und trat ans Fenster. Es wurde bereits dunkel, doch der Patientenparkplatz lag im hellen Licht der beiden Straßenlaternen. Manon konnte sehen, daß nur noch ein Auto dort draußen stand. Robert würde also ziemlich pünktlich Feierabend machen können.
Spontan beschloß Manon, ihre restliche Arbeit liegenzulassen. Sie würde jetzt rasch nach oben gehen und etwas Feines kochen. Tortellini in Sahnesoße zum Beispiel. Das ging schnell und war eines von Roberts Lieblingsgerichten.
Manon beeilte sich, um das Essen pünktlich auf dem Tisch zu haben, dann wartete sie, doch Dr. Daniel kam nicht. Nach einer guten halben Stunde nahm Manon den Telefonhörer ab und wählte den Hausanschluß, der sie von hier oben direkt mit der Praxis verband.
Gabi Meindls gehetzte Stimme erklang. Offenbar war sie schon an der Tür gewesen und nun rasch umgekehrt.
»Fräulein Meindl, ist mein Mann noch in der Praxis?« wollte Manon wissen.
Sekundenlang herrschte am anderen Ende der Leitung verlegenes Schweigen.
»Der Herr Doktor ist vor einer halben Stunde mit einer Patientin weggefahren«, antwortete Gabi endlich gedehnt.
Die Tatsache an sich hätte Manon gar nicht verwundert, doch Gabis Zögern und die Art, wie sie gesprochen hatte… so, als wäre es ihr äußerst peinlich, diese Auskunft zu erteilen, machten die Ärztin irgendwie stutzig.
»Handelte es sich um einen Notfall?« hakte Manon nach. »Mußte die Patientin rasch in die Klinik?«
»Nein«, erwiderte Gabi gepreßt. »Ich glaube, es war… eher privat… ich meine, wahrscheinlich hatte die Frau Probleme und…«
»Danke, Fräulein Meindl«, fiel Manon ihr ins Wort, dann legte sie auf. Gabis sonderbares Gestammel ließ für Manon nur einen Schluß zu: Robert war mit dieser ominösen Patientin ausgegangen. Womöglich war es gar keine Patientin, sondern…
Manon wollte diesen Gedanken abschütteln, doch es gelang ihr nicht. Vor ihrem geistigen Auge sah sie ihren Mann Arm in Arm mit einer anderen Frau. Verzweifelt preßte sie eine Hand auf den Mund, doch sie vermochte ihr trockenes Aufschluchzen damit nicht zu ersticken. Bisher war ihre Eifersucht auf Praxis und Klinik völlig unbegründet gewesen, doch jetzt… durch ihr Verhalten hatte sie Robert ja förmlich in die Arme der anderen getrieben.
Ihr Blick fiel auf den liebevoll gedeckten Tisch. Zu spät! Sie hatte sich zu spät auf das besonnen, was in ihrer Ehe wirklich wichtig war.
Mit langsamen, fast mechanischen Bewegungen räumte sie den Tisch ab, dann warf sie die Tortellini verbittert in den Abfall. Ihr war der Appetit gründlich vergangen. Den restlichen Abend verbrachte sie am Fenster. Sie hoffte so sehr, daß Robert heimkommen würde… daß sich alles, was sie jetzt befürchtete, als ein dummes Mißverständnis herausstellen würde. Doch die Stunden vergingen, und Manon blieb allein. Es ging bereits auf elf Uhr abends, als sie sich entschloß, zu Bett zu gehen, doch an Schlaf war natürlich nicht zu denken. Sie lag im Bett und starrte blicklos in die Dunkelheit, bis sie endlich ein Auto auf den Parkplatz fahren hörte.
Mit einem Satz war Manon aus dem Bett und am Fenster. Vom Glockenturm der Pfarrkirche St. Benedikt schlug es zweimal. Zu dieser Zeit hatte in Steinhausen kein Lokal mehr geöffnet, also konnte Robert nur in der Wohnung dieser Frau gewesen sein, die ihn jetzt sogar noch in ihrem Wagen nach Hause brachte.
Mit brennenden Augen starrte Manon auf den Parkplatz hinunter, sah, wie Dr. Daniel ausstieg und auch die Frau das Auto verließ. Mit leicht wiegendem Schritt kam sie nun auf ihn zu, nahm ihn eine Spur zu vertraut beim Arm und stellte sich dann auf Zehenspitzen, um ihn auf die Wange zu küssen.
Manons Herz brannte. Sie hatte das Gefühl, keine Sekunde länger zusehen zu können, trotzdem gelang es ihr nicht, ihren Blick loszureißen. Sie sah, wie die Frau durch Dr. Daniels Haar streichelte, ehe sie ihn noch einmal küßte und sich damit wohl endgütig verabschiedete. Dr. Daniel blieb auf dem Parkplatz stehen, bis das Auto losfuhr. Er ging ein paar Schritte auf die Villa zu, dann drehte er sich um und blickte noch eine Weile in die Richtung, in die der Wagen verschwunden war.
Manon hörte, wie die Haustür ins Schloß fiel. Im ersten Moment wollte sie sich wieder ins Bett legen und schlafend stellen, doch dann verließ sie das Schlafzimmer, zog ihren Morgenmantel an und blieb wartend im Flur stehen.
Dr. Daniel bemühte sich offenbar, besonders leise die Treppe heraufzukommen. Als er die Wohnung betrat und Manon abrupt das Licht aufflammen ließ, zuckte er erschrocken zusammen.
»Warum bist du nicht gleich die ganze Nacht bei ihr geblieben?« wollte Manon mit schneidender Stimme wissen.
Dr. Daniel brauchte ein paar Sekunden, um sich von dem Schrecken, vor allem aber von Manons Frage zu erholen.
»Was soll denn der Unsinn?« gab er endlich zurück. »Rebecca und ich haben nur…«
»Rebecca!« fiel Manon ihm scharf ins Wort. »Ihr duzt euch also schon!«
»Ja, warum denn nicht?« entgegnete Dr. Daniel. Er wollte Manons Hand ergreifen, doch sie wich vor ihm zurück, als hätte er eine ansteckende Krankheit.
»Wage es nur nicht, mich jetzt anzufassen!« drohte sie.
»Manon, es ist doch alles ganz anders, als du denkst«, versuchte Dr. Daniel sie in eindringlichem Ton zu überzeugen. »Rebecca und ich haben nichts getan, dessen wir uns schämen müßten. Wir waren lediglich zusammen in der Kleinen Reblaus und haben uns unterhalten.«
»Du lügst!« hielt Manon ihm vor. »Die Kleine Reblaus schließt um Mitternacht, jetzt aber ist es zwei Uhr morgens.«
Dr. Daniel nickte. »Wir waren noch auf ihrem Zimmer im Gasthof, aber auch das war harmlos. Manon…«
»Erzähl mir nichts!« fiel sie ihm grob ins Wort, dann drehte sie sich um, betrat das Schlafzimmer und schloß die Tür hinter sich ab.
Mit einem tiefen Seufzer ließ sich Dr. Daniel gegen die Wand sinken. Er hätte Rebeccas Vorschlag, noch zu ihrem Zimmer im Gasthof zu gehen, niemals zustimmen dürfen. Andererseits… das Zusammensein mit ihr hatte ihm unheimlich gut getan. Rebecca und er hatten so viele Gemeinsamkeiten entdeckt… man konnte wirklich sehr anregend mit ihr plaudern. Vor allem aber hatte Dr. Daniel bei ihr genau das bekommen, was er bei Manon in letzter Zeit so schmerzlich vermißt hatte – Fürsorge, Verständnis, das Gefühl, nicht allein zu sein… gemocht und gebraucht zu werden.
Dr. Daniel seufzte noch einmal, dann ging er zur Schlafzimmertür und drückte die Klinke herunter, doch er hatte sich nicht verhört. Die Tür war tatsächlich abgeschlossen.
»Manon, sei doch vernünftig«, bat er. »Laß uns darüber sprechen. Es ist wirklich nichts passiert – jedenfalls nicht das, was du zu glauben scheinst. Manon, ich liebe doch nur dich.«
»Scher dich zum Teufel!« erklang Manons erstickte Stimme, an der Dr. Daniel nur zu deutlich erkannte, daß sie weinte oder den Tränen jedenfalls sehr nahe war.
»Manon, es war nur…«, begann er noch einmal, wurde aber unterbrochen.
»Laß mich endlich in Ruhe!«
Niedergeschlagen lehnte Dr. Daniel den Kopf gegen die Tür. Es war das erste Mal, daß er mit Manon einen so massiven Streit hatte, und Dr. Daniel fühlte sich daran nicht ganz unschuldig. Er hätte mit Rebecca niemals ausgehen dürfen, doch allein der Gedanke an die Stunden mit ihr, ließ wieder dieses Gefühl von Wärme in ihm aufkommen, das er bisher nur bei seiner Frau verspürt hatte.
Für einen Moment berührte er die Tür – so sanft, als hätte er Manon vor sich. Er wünschte, er hätte sich mit ihr aussprechen können, anstatt sich jetzt im Streit von ihr zu trennen. Langsam drehte er sich um. Es war ihm klar, daß Manon ihn heute nicht ins Schlafzimmer lassen würde, also blieb ihm nichts anderes übrig, als den Rest der Nacht auf dem Sofa im Wohnzimmer zu verbringen.
An Schlaf war allerdings gar nicht zu denken. Der Streit mit Manon belastete ihn viel zu sehr, als daß er Ruhe hätte finden können. Und dann geisterte auch noch Rebecca in seinen Gedanken herum. Ihre sanfte, verständnisvolle Art hatte ihn ein wenig an seine verstorbene Frau Christine erinnert, aber auch an Manon, bevor seine Ehe mit ihr in diese schreckliche Krise geraten war.
Der Morgen graute bereits, als Dr. Daniel endlich einschlafen konnte, doch lange Ruhe war ihm nicht vergönnt, denn Manon riß ihn reichlich grob aus seinen Träumen.
»Die Praxis wartet«, sagte sie nur, dann wollte sie zur Tür hinaus, doch Dr. Daniel war trotz fast durchwachter Nacht schneller, als sie gedacht hatte.
An der Wohnungstür holte er sie ein und hielt sie fest.
»Manon, bitte, hör mir zu«, verlangte er eindringlich.
»Du kannst mir mit deinen Lügen gestohlen bleiben!« schleuderte sie ihm ins Gesicht. »Ich weiß genau, was ich gesehen habe, und das war aufschlußreicher für mich, als es jedes Wort von dir sein könnte.«
»Und was hast du gesehen?« Auch Dr. Daniel wurde nun heftiger als beabsichtigt. »Sie hat mich auf die Wange geküßt, sonst nichts.«
»Das ist auch schon mehr als genug! Was würdest du sagen, wenn ich mich von einem dir fremden Mann auf die Wange küssen lassen würde?«
»Ich würde nach dem Grund fragen«, entgegnete Dr. Daniel und zwang sich dabei zur Ruhe. Es hatte keinen Sinn, wenn er jetzt auch noch überreagierte. Der Streit zwischen ihm und Manon war schrecklich genug, er mußte ihn nicht noch schlimmer machen.
Herausfordernd verschränkte sie die Arme. »Also schön, dann sag mir den Grund, Robert.«
Dr. Daniel seufzte leise. »Seit Tessa weg ist, führen wir beide doch im Grunde überhaupt keine Ehe mehr. Du lebst nur noch für die Praxis…«
»Wie du«, fiel Manon ihm ins Wort.
»Ja, du hast recht«, gab Dr. Daniel zu. »Es ist wohl auch meine Schuld. Trotzdem denke ich, daß ich es nicht verdient habe, mit einem Zettel am Kühlschrank abgefertigt zu werden, auf dem steht, daß ich abends nicht auf dich warten solle.«
Scheinbar ungerührt zuckte Manon die Schultern. »Das ist nicht besser oder schlechter als von deiner Sprechstundenhilfe oder von einer Krankenschwester der Waldsee-Klinik angerufen zu werden, wenn du wieder mal nicht pünktlich nach Hause kommen kannst.«
»Seltsamerweise stört dich das aber erst seit ein paar Tagen«, wandte Dr. Daniel ein.
Manon schüttelte den Kopf »Nein, es stört mich schon viel länger.« Sie schwieg kurz. »Im übrigen sollte ein Zettel am Kühlschrank für dich noch lange kein Grund sein, gleich mit einer anderen Frau ins Bett zu steigen.«
»Das habe ich nicht getan!« erwiderte Dr. Daniel mit unüberhörbarer Schärfe. »Rebecca hat mir nur einfach zugehört, und das hat mir sehr gut getan, denn mit dir kann ich seit einigen Tagen ja leider nicht mehr sprechen.«
»Dann geh doch zu deiner Rebecca!« fuhr Manon ihn an, riß die Tür auf und stürzte hinaus, ehe Dr. Daniel es verhindern konnte.
»Was ist mit uns denn nur los?« fragte sich Dr. Daniel verzweifelt, und dabei verspürte er schon wieder Sehnsucht nach Rebeccas verständnisvoller Art. Im Moment fühlte er sich bei ihr geborgener als bei seiner Frau. Diese Empfindung erschreckte ihn zutiefst.
*
Rebecca Horn war mit der Entwicklung der Dinge vollauf zufrieden. Sie würde jetzt noch einen oder zwei Tage warten und dann erneut Dr. Daniel wegen ihrer angeblichen Unterleibsschmerzen aufsuchen… nein, sie würde ihn zu sich rufen. Und bei der dann nötigen Untersuchung würde sie aufs Ganze gehen.
Rebecca sah auf die Uhr und rechnete nach, wie spät es jetzt in Los Angeles war, dann nickte sie sich zu. Steven mußte schon im Büro sein. Sie fuhr zum nahen Postamt, denn nur von hier war es ihr möglich, ungestört in die Staaten zu telefonieren. Hermine Gruber, die Besitzerin des Steinhausener Gasthofes war nämlich sehr neugierig, wie Rebecca schon am zweiten Tag ihres Aufenthaltes gemerkt hatte, und obgleich sie sicher war, daß Hermine Gruber kein Amerikanisch verstehen würde, wollte sie doch ohne lauschende Ohren telefonieren.
Die Verbindung mit ihrem Freund und Rechtsanwalt Steven Brady war rasch hergestellt.
»Rebecca!« rief er erfreut. »Das ist aber eine schöne Überraschung!«
Rebecca lächelte. Sie wußte genau, weshalb Steven die Freundschaft mit ihr so pflegte. Immerhin hatte er in den vergangenen Jahren bereits fürstlich an ihr verdient.
»Ich habe Arbeit für dich, Steven«, kam sie gleich zur Sache. »Es geht um eine Erbschaftsgeschichte.« In knappen Worten schilderte sie Steven die Lage, und er versprach, sofort die nötigen Schritte einzuleiten.
Rebecca rieb sich im Geiste schon die Hände. Das klappte ja alles wie am Schnürchen. Die Erbschaft von Parker war ihr so gut wie sicher, darüber hinaus würde sich Dr. Daniel ihr Schweigen sicher einiges kosten lassen, und wenn sie es dann noch geschickt anstellte… für eine Schwangerschaft war sie ja noch lange nicht zu alt. Die Männer, die sie danach für Alimentezahlungen heranziehen würde, würden sich allesamt hüten, einen Vaterschaftstest zu verlangen. Schließlich würden sie damit ihre Ehen aufs Spiel setzen, und erfahrungsgemäß war es das noch kaum einem Mann wert gewesen, mit dem sie sich bislang eingelassen hatte.
Als Rebecca das Postamt verließ, wäre sie beinahe mit Dr. Daniel zusammengestoßen.
»Robert!« rief Rebecca und zauberte ein strahlendes Lächeln auf ihr Gesicht, das sie gleich tiefer Besorgnis weichen ließ. »Du siehst erschöpft aus.«
Dr. Daniel nickte seufzend. »Ich weiß. Manon… meine Frau, hat uns gesehen, als du mich nach Hause gebracht hast, und nun zieht sie leider völlig falsche Schlüsse aus unserem Zusammensein.«
Für einen Moment preßte Rebecca die Lippen zusammen. Diese Wendung der Dinge gefiel ihr überhaupt nicht. Männer, deren Ehefrauen von dem Seitensprung wußten, waren nicht so leicht
erpreßbar. Immerhin fiel damit Rebeccas stärkstes Druckmittel weg.
»Vielleicht sollte ich einmal mit ihr sprechen«, schlug sie vor, doch Dr. Daniel schüttelte nachdrücklich den Kopf.
»Ich glaube, das wäre im Moment das schlechteste, was wir tun könnten«, meinte er. »Damit würden wir Manon vielleicht nur noch in dem Glauben bestärken, daß wir etwas getan hätten, wofür wir uns rechtfertigen müssen.« Er zwang sich zu einem Lächeln. »Ich werde ihr jetzt ein bißchen Zeit lassen und dann versuchen, noch einmal in Ruhe mit ihr zu sprechen.«
Rebecca nickte. »Ja, das wird wohl das Beste sein.« Sie schwieg einen Moment. »Unter diesen Umständen ist es vermutlich auch nicht ratsam, wenn ich zu dir in die Praxis komme.«
Besorgt sah Dr. Daniel sie an. »Hat sich der Druck in deinem Unterleib nicht gebessert?«
»Leider nicht – ganz im Gegenteil. Allmählich wird es tatsächlich schmerzhaft.«
»Dann sollten wir keine Zeit mehr verlieren«, urteilte Dr. Daniel, überlegte angestrengt und beschloß dann schließlich: »Ich komme heute unmittelbar nach der Sprechstunde zu dir.«
»Wird damit der Unfrieden zwischen dir und deiner Frau nicht noch schlimmer?« fragte Rebecca scheinbar besorgt. In Wahrheit wollte sie nur herausbekommen, wieviel Dr. Daniel tatsächlich an seiner Ehe lag.
»Ich bin fast jeden Abend nach der Sprechstunde noch kurz bei Patientinnen oder in der Waldsee-Klinik«, entgegnete Dr. Daniel. »Manon wird in dieser Hinsicht also keinen Verdacht schöpfen.« Er blickte zu Boden. »Normalerweise habe ich keinerlei Geheimnisse vor ihr. Manon weiß grundsätzlich, wo sie mich erreichen kann, aber in diesem Fall… es ist vermutlich besser, ihr nicht zu sagen, daß ich gerade bei dir abends noch einen Hausbesuch mache. Meine Ehe steckt im Moment in einer tiefen Krise. Ich will nicht riskieren, daß sie wegen eines harmlosen Hausbesuchs zu Bruch geht.«
Rebecca hatte ein triumphierendes Lächeln zu unterdrücken. Das paßte ja ausgezeichnet in ihr Konzept. Heute abend würde Robert Daniel fällig sein!
*
Dr. Daniel fühlte, daß in ihm etwas vorging, was er kaum noch steuern konnte. Rebecca besaß neben ihrer berückenden Schönheit, die ihm natürlich längst aufgefallen war, eine Ausstrahlung, die es ihm beinahe unmöglich machte, in ihrer Gegenwart so ruhig und gelassen zu bleiben, wie er es sonst war. Immerhin hatte er ja berufsmäßig ständig mit Frauen zu tun… mit halb oder auch vollständig entkleideten Frauen, von denen viele durchaus begehrenswert waren, doch Dr. Daniel war in seiner Liebe zu Manon immer so gefestigt gewesen, daß ihm die Nähe dieser vielen Frauen nichts ausgemacht hatte. Bei Rebecca war das anders. Vielleicht lag es aber auch gar nicht an ihr persönlich, sondern an seiner eigenen, unglücklichen Situation.
Er hatte Manon mittags in der Wohnung schon getroffen, doch sie hatte kein einziges Wort mit ihm gewechselt und auf seine Versuche, mit ihr zu sprechen, nur mit eisigem Schweigen reagiert. Irgendwann hatte Dr. Daniel aufgegeben und war wieder in die Praxis hinuntergegangen. Lieber war er allein, als in Manons Gegenwart so schrecklich einsam zu sein.
Damit verstärkte sich aber auch seine Sehnsucht nach Rebecca. Mit ihr konnte er sich so gut unterhalten. Sie war verständnisvoll und hilfsbereit, vor allen Dingen aber gab sie ihm das an innerem Frieden und Geborgenheit, was er bei Manon nicht mehr fand.
So kann unsere Ehe doch nicht enden, dachte er bestürzt, als er feststellte, wie sehr er sich auf den Abend mit Rebecca freute. Nach Hause wäre er jetzt eigentlich nur ungern gegangen, doch die Aussicht auf ein Zusammensein mit Rebecca wirkte sich direkt belebend auf ihn aus.
Er stieg in sein Auto und konnte den Gasthof Zum Goldenen Löwen gar nicht schnell genug erreichen. Mit langen Schritten trat er ein, wandte sich sofort zur Treppe und lief – immer zwei Stufen auf einmal nehmend – hinauf. Als er vor Rebeccas Zimmer stand, bemerkte er sein eigenes, heftiges Herzklopfen, schob es aber auf die Eile, mit der er hierhergekommen war.
Auf sein Klopfen öffnete sie – mit nichts als einem hauchdünnen Negligé bekleidet. Dr. Daniel zögerte. Eine Frau, die so etwas trug, hatte nicht nur eine Untersuchung im Sinn.
»Entschuldige, Robert«, meinte sie und brachte es tatsächlich ganz schamlos fertig zu erröten. »Ich hatte mich ein wenig hingelegt. Die Schmerzen…« Sie unterbrach sich und preßte mit einem gequälten Gesichtsausdruck eine Hand auf ihren Unterleib.
Sofort erwachte wieder der Arzt in Dr. Daniel. Wie hatte er angesichts des Negligés nur auf den Gedanken kommen können, Rebecca wolle ihn verführen? Sie war viel zu anständig für ein flüchtiges Abenteuer – noch dazu mit einem verheirateten Mann! Dr. Daniel schämte sich fast, daß er ihr einen Augenblick so etwas zugetraut hatte.
Flüchtig sah sich Dr. Daniel in ihrem Zimmer um, dann deutete er auf das Bett. »Am besten legst du dich dort hin.« Er lächelte ihr beruhigend zu. »Ich werde sehr vorsichtig sein, trotzdem kann es natürlich sein, daß dir die Untersuchung weh tut.«
Rebecca nickte. »Keine Sorge, das halte ich schon aus. Wenn du nur die Ursache für diese Schmerzen endlich herausfinden kannst.«
Sie legte sich auf den Rücken und war dabei schon die Verführung in Person, doch Dr. Daniel war jetzt wieder viel zu sehr Arzt, als daß er das wirklich registriert hätte.
»Die Beine anwinkeln und dann ganz locker auseinanderfallen lassen«, bat er, während er seitlich neben Rebecca Platz nahm.
Die ungewöhnliche Situation erregte Rebecca. Das Zusammensein mit Robert versprach ihr, ein ganz besonderer Genuß zu werden.
Dr. Daniel streifte sich Plastikhandschuhe über, dann nahm er eine vorsichtige Untersuchung vor, doch wie schon beim ersten Mal konnte er absolut nichts Ungewöhnliches ertasten.
Rebecca stöhnte leise, richtete sich auf und schlang beide Arme um Dr. Daniels Nacken.
»Deine Untersuchung wirkt Wunder«, behauptete sie mit heiserer Stimme. »Die Schmerzen sind fast weg. Ich glaube, jetzt hast du es in der Hand, mich zu heilen.«
Dr. Daniel war überrascht und verwirrt. Was hatte das zu bedeuten? Unwillkürlich wollte er von Rebecca abrücken, doch ihre Arme hielten ihn fest umschlungen wie die Tentakel einer Riesenkrake.
»Rebecca, ich verstehe nicht…«
»Ich liebe dich, Robert«, fiel sie ihm ins Wort. »Ist das denn so schwer zu verstehen? Du bist attraktiv, ein Mann, von dem man nur träumen kann…«
»Ich bin verheiratet«, hielt Dr. Daniel dagegen und versuchte erneut, aus ihren Armen freizukommen. Diesmal gelang es ihm auch. Er stand auf. »Mag sein, daß ich dir durch mein Verhalten Hoffnungen gemacht habe. Wenn es so war, dann tut es mir leid. Ich mag dich, Rebecca, und ich habe das Zusammensein mit dir genossen, aber mein Herz… meine Liebe gehört immer noch meiner Frau, und daran wird sich nichts ändern.«
Mit den geschmeidigen Bewegungen einer Raubkatze kam sie auf ihn zu. »Daran muß sich ja auch nichts ändern. Hör mal, Robert, ich will dich nicht heiraten, sondern mich ein paar Stunden mit dir vergnügen. Was ist denn daran schlecht? Wir werden eine traumhafte Nacht erleben und morgen unserer Wege gehen. Deine Frau wird nichts davon erfahren und ich werde eine wunderschöne Erinnerung an Deutschland mit nach Hause nehmen.« Und eine Menge Geld, das du mir für mein Schweigen bezahlen wirst, fügte sie in Gedanken hinzu.
Doch Dr. Daniel schüttelte entschieden den Kopf. »Dafür bin ich nicht der Richtige, Rebecca. Ich nehme Gefühle sehr ernst. Was du da gerade angedeutet hast, kommt für mich nicht in Frage.«
Er griff nach seiner Arzttasche, nahm die Jacke, die er vorhin achtlos über den neben der Tür stehenden Stuhl geworfen hatte und wandte sich dann Rebecca noch einmal zu.
»Es tut mir leid«, murmelte er, weil er sich selbst dafür verantwortlich machte, daß Rebecca mit ihm eine Liebesnacht erleben wollte. Er hatte das Zusammensein mit ihr so sehr genossen, daß er ihr dadurch unbewußt und auch ungewollt Hoffnungen gemacht hatte. Er wünschte, er könnte es wieder rückgängig machen.
In ihrem hauchdünnen Negligé kam Rebecca auf ihn zu. Sie dachte noch gar nicht daran aufzugeben.
»Du mußt nicht gehen, Robert«, meinte sie mit sinnlich tiefer Stimme. »Wir können uns auch so einen schönen Abend machen.« Dabei ließ sie ihre Fingerspitzen liebkosend von seinem Nacken über seine Brust gleiten, öffnete dabei wie zufällig ein paar Knöpfe und ehe Dr. Daniel sich versah, hatte sie etliche heiße Küsse auf seine Brust gehaucht.
Dr. Daniel wich zurück. »Bitte, Rebecca, laß das. Ich habe es dir vorhin schon gesagt – ich bin kein Mann für eine Nacht, das wäre ich auch dann nicht, wenn ich nicht verheiratet wäre.« Entschlossen drehte er sich um und ging zur Tür. »Gute Nacht, Rebecca.«
Als die Tür hinter ihm ins Schloß gefallen war, ballte Rebecca vor Wut die Fäuste. So etwas war ihr noch nie passiert! Spätestens ihr gezieltes Streicheln und ihr Küsse hatten die Männer immer weich gemacht, doch Robert war wirklich eine harte Nuß.
»Die ganze Mühe umsonst«, knurrte Rebecca wütend. Einen Augenblick dachte sie daran, die Sache mit Dr. Daniel noch immer nicht aufzugeben, doch dann entschied sie sich anders. Sie würde sich ein neues Opfer suchen. Hier in der Gegend gab es bestimmt noch weitere wohlhabende Männer, die sie becircen konnte.
*
Als Dr. Daniel nach Hause kam, fand er die Wohnung verwaist vor, doch damit hatte er schon fast gerechnet. Heute war es ihm auch ganz recht. Die Geschichte mit Rebecca beschäftigte ihn nämlich noch ganz gewaltig.
Wie so oft, wenn er ungestört nachdenken wollte, setzte er sich ins dunkle Wohnzimmer und starrte blicklos vor sich hin.
Wie hatte ihn seine Menschenkenntnis nur so im Stich lassen können? Oder liebte Rebecca ihn vielleicht wirklich? Hatte sie ihm den Vorschlag von der einen Liebesnacht womöglich nur gemacht, weil sie wußte, daß er verheiratet und somit unerreichbar für sie war? Hatte sie sich wenigstens ein kleines Stückchen Glück nehmen wollen?
Seufzend lehnte sich Dr. Daniel auf dem Sofa zurück, doch dann fuhr er erschrocken wieder hoch. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel traf ihn die Erinnerung an Viola von Lilienthal, die sich ihm seinerzeit in ihrem manisch-depressiven Zustand förmlich an den Hals geworfen hatte. Damals hatte er sich ihren Verführungskünsten, die später in Erpressungsversuche ausgeartet waren, nur mit äußerster Mühe erwehren können. Mit allen Mitteln hatte sie versucht, ihn zur Ehe mit ihr zu bewegen.
Sollte Rebeccas Angebot etwa auch mit einer Krankheit zusammenhängen? Dr. Daniel schüttelte diesen Gedanken ab. Rebecca hatte sich ja völlig anders verhalten als Viola von Lilienthal dies einst getan hatte. Die Unterleibsschmerzen fielen Dr. Daniel wieder ein. Deswegen war er heute ja eigentlich zu Rebecca gegangen. Waren diese Beschwerden nur ein Vorwand gewesen, um ihn in ihr Zimmer zu locken? Oder war ihr Verhalten womöglich ein Hilferuf?
Unwillkürlich stöhnte Dr. Daniel auf. Seine Gedanken drehten sich im Kreis. Je länger er über die Situation in Rebeccas Zimmer nachgrübelte, um so durchsichtiger wurde sie für ihn. Niedergeschlagen vergrub er das Gesicht in den Händen. Er wünschte, er hätte mit Manon über all das sprechen können, aber gerade im Moment war das so unmöglich wie nie zuvor.
Dr. Daniel fuhr erschrocken hoch, als plötzlich Licht aufflammte. Manon stand in der geöffneten Tür und sah ihn stumm an. Dr. Daniel erwiderte den Blick und versuchte zu ergründen, ob es wohl möglich sein würde, vernünftig mit ihr zu sprechen… ob er auf eine Frage überhaupt eine Antwort bekommen würde.
»Hat sie dich abblitzen lassen?«
Dr. Daniel sackte förmlich in sich zusammen. Vermutlich sollte er sich jetzt weniger Gedanken um Rebecca machen als vielmehr um seine eigene Frau. Manons Ausrasten war ja auch nicht mehr normal.
»Wie kommst du bloß auf so etwas?« fragte er beinahe tonlos. »Meine Güte, Manon, gerade du müßtest mich doch kennen… besser als jede andere. Warum, um Himmels willen…«
»Ich habe gesehen, wie du in den Goldenen Löwen gegangen… nein, förmlich gerannt bist«, fiel Manon ihm mit eisiger Stimme ins Wort. »Du hattest es so eilig, zu deiner Rebecca zu kommen, daß du mich gar nicht gesehen hast, obwohl ich keine hundert Meter von dir entfernt gestanden habe.«
Dr. Daniel wurde abwechselnd heiß und kalt. Er wußte, daß Manon recht hatte. Die Vorfreude auf den Abend mit Rebecca hatte ihn für seine Umgebung anscheinend blind und taub gemacht. Allerdings hatte diese Vorfreude ja nicht einem flüchtigen Liebesabenteuer gegolten, sondern dem Zusammensein mit einem Menschen, von dem er sich verstanden gefühlt hatte.
»Es war völlig anders, Manon«, verteidigte er sich und hatte dabei ein schlechtes Gewissen ohne sich einer wirklichen Schuld bewußt zu sein. »Rebecca rief mich wegen Unterleibsschmerzen zu sich…«
Da bog Manon den Kopf zurück und lachte, doch es war kein fröhliches Lachen. Es ließ Dr. Daniel vielmehr einen eisigen Schauer über den Rücken laufen. Als Manon ihn wieder anschaute, verstummte ihr Lachen so abrupt, wie es angefangen hatte.
»Für diese Lüge sollte ich dich eigentlich ohrfeigen«, erklärte sie kalt.
»Glaubst du, daß das unserer Ehe noch besonders zuträglich wäre?« gab Dr. Daniel zurück und wunderte sich, wie er es eigentlich schaffte, dabei so ruhig zu bleiben.
Manon schüttelte den Kopf. »Ich glaube eher, es gibt nichts, was unserer Ehe wirklich noch schaden könnte. Es gibt aber vermutlich auch nichts, was sie noch retten kann.«
Dr. Daniel stand auf und ging langsam auf seine Frau zu.
»Warum, Manon?« wollte er leise wissen. »Wie konnte das alles mit uns nur geschehen?«
Sie blieb ihm die Antwort schuldig, drehte sich um und ging. Dr. Daniel war allein. Einen Moment lang fragte er sich, ob er wohl einen Fehler gemacht hatte, als er Rebeccas Angebot, mit ihr die Nacht zu verbringen, ausgeschlagen hatte.
*
Dr. Daniel hielt sich in den folgenden Tagen vom Gasthof Zum Goldenen Löwen geflissentlich fern, obgleich ihm der Gedanke an Rebecca schlaflose Nächte bereitete. Hin- und hergerissen zwischen seinen Gefühlen für Rebecca und seiner Liebe, die er nach wie vor für Manon empfand, kostete es ihn immer mehr Mühe, sich auf seine Arbeit zu konzentrieren. Mindestens tausendmal hatte er die Szene in Rebeccas Zimmer schon durchgespielt – so, wie sie tatsächlich abgelaufen war und wie sie hätte ablaufen können. Dabei hatte er jedoch weniger den Aspekt der Liebesnacht im Auge gehabt, als vielmehr die vorangegangene Untersuchung. Vielleicht hätte er gründlicher sein müssen. Wenn er nun etwas übersehen hatte… irgendeine Kleinigkeit…
Vergeblich versuchte er, diese Gedanken von sich abzuschütteln. Die Möglichkeit, daß Rebecca die Beschwerden vorgetäuscht hatte, schob er weit von sich. So eine war sie bestimmt nicht! In Wirklichkeit war es jedoch mehr ein Selbstschutz von Dr. Daniel, weil er nicht wahrhaben wollte, daß er womöglich auf eine äußerst raffinierte Frau hereingefallen war. Und dann beschäftigten sich seine Gedanken zum ersten Mal damit, was wohl geschehen wäre, wenn er ihrem Werben… ach was, es war mehr als das gewesen, nämlich ein deutliches Angebot. Ja, was wäre geschehen, wenn er nachgegeben hätte? Wenn er dieser Liebesnacht zugestimmt hätte? Wieder sah er Rebeccas makellosen Körper vor sich – diesmal nicht als Arzt, sondern als Mann…
Dr. Daniel zuckte erschrocken zusammen, als es an seiner Sprechzimmertür klopfte. Er schämte sich für die Gedanken, die er gehabt hatte – weil er verheiratet war… weil er seine Frau trotz aller Differenzen immer noch von Herzen liebte… und weil er trotzdem für eine berückend schöne Frau entflammt war.
»Ja, bitte!« brachte er endlich hervor. Eigentlich hoffte er, daß es Manon sein würde… daß sie kommen würde, um sich endlich mit ihm auszusprechen. Sekundenlang streifte ihn der Gedanke – oder war es ein Wunsch? – es könnte Rebecca sein.
Doch als sich die Tür öffnete und sein Schwiegersohn Dr. Jeff Parker hereintrat, wußte Dr. Daniel nicht, ob er enttäuscht oder erleichtert sein sollte.
»Wen hast du denn jetzt erwartet?« wollte Dr. Parker wissen, der den Gesichtsausdruck seines Schwiegervaters unschwer deuten konnte.
Dr. Daniel seufzte. »Ich weiß es nicht, Jeff. Dich jedenfalls nicht.« Unwillkürlich sah er auf die Uhr. »Es ist schon spät, und die Sprechstunde war heute ziemlich anstrengend…«
»Robert, ich brauche dich«, fiel Dr. Parker ihm leise und ungewöhnlich beklommen ins Wort. »Deinen Rat und…« Er verstummte mit gesenktem Kopf.
Dr. Daniel seufzte. »Es tut mir leid, Jeff. Du weißt, daß ich immer für dich da bin, aber gerade jetzt… ich bin nicht sicher, ob ich dir eine wirkliche Hilfe sein würde. Im Moment habe ich selbst genügend Probleme am Hals.« Plötzlich ergriff ihn ein konkreter Verdacht. »Geht es etwa um dich und Karina?«
Jeff schüttelte den Kopf. »Mit unserer Ehe hat es nichts zu tun. Es geht um mich… um mich persönlich.« Er reichte Dr. Daniel ein mehrseitiges Schreiben. »Ich weiß nicht, wie gut dein Englisch ist…«
»Es geht schon«, meinte Dr. Daniel und nahm den Brief entgegen. Der Name Horn stach ihm förmlich ins Auge. Pamela und Perry Horn, las er halblaut, dann überflog er den Text, doch sein Englisch war in den vergangenen Jahren tatsächlich recht lückenhaft geworden.
»Der Brief stammt von einem Rechtsanwalt aus Los Angeles, der im Namen meiner minderjährigen Geschwister Erbansprüche stellt«, erläuterte Dr. Parker den Inhalt des mehrseitigen Schreibens in präzisen Worten.
Erstaunt blickte Dr. Daniel auf. »Ich wußte gar nicht, daß du Geschwister hast.«
»Bisher wußte ich das auch noch nicht«, entgegnete Jeff trocken, dann gestand er leise: »Es macht mir schwer zu schaffen, Robert. Ich dachte immer, die Ehe meiner Eltern wäre glücklich gewesen. Nun muß ich auf einmal erfahren, daß mein Vater mit einer anderen Frau zwei Kinder gehabt haben soll.«
Dr. Daniel nickte verständnisvoll. Diese Wahrheit mußte für Jeff tatsächlich ein schwerer Schock gewesen sein.
»Ist es möglich, daß diese… Geschichte vor der Ehe mit deiner Mutter passiert ist?« fragte Dr. Daniel, doch dann fiel ihm wieder ein, daß Jeff gesagt hatte, die Kinder wären minderjährig.
Er schüttelte den Kopf. »Das Mädchen ist vierzehn, der Junge sechzehn. Wenn sie wirklich die Kinder meines Vaters sind, dann muß er während seiner Ehe mit meiner Mutter fremdgegangen sein. Vorausgesetzt, das Ganze stimmt überhaupt. Es ist ja ziemlich seltsam, daß dieser Rechtsanwalt, den vermutlich die Mutter der Kinder beauftragt hat, erst jetzt Erbansprüche stellt. Offensichtlich hat die Mutter nie Alimente von meinem Vater kassiert, und das erscheint mir doch ein wenig seltsam.«
»Was macht dich eigentlich so sicher, daß er für seine außerehelichen Kinder nicht bezahlt hat?« fragte Dr. Daniel zurück. »Das Geld kann von einem separaten Konto weggegangen sein.«
Doch Dr. Parker schüttelte den Kopf. »Ich kenne das Testament meines Vaters. Darin bin nur ich bedacht, und das hätte er nie getan, wenn er von der Existenz dieser beiden Kinder gewußt hätte.«
»Als dein Vater das Testament verfaßt hat, konnte er noch nicht wissen, daß er und deine Mutter gemeinsam den Tod finden würden«, wandte Dr. Daniel ein. »Wäre dieses Testament also in Anwesenheit deiner Mutter eröffnet worden, so hätte sie verspätet von seiner Affäre erfahren.«
»Mein Vater hätte irgendeinen Weg gefunden, diese beiden Kinder in seinem Testament zu bedenken«, beharrte Dr. Parker. »Da bin ich ganz sicher.« Er nahm das Schreiben des Rechtsanwalts an sich und blickte darauf nieder. »Pamela und Perry«, murmelte er leise, dann sah er Dr. Daniel wieder an. »Weißt du, ich hätte ja gar nichts dagegen, wenn diese beiden wirklich meine Geschwister wären – ganz im Gegenteil.« Mit einen fast verlegen wirkenden Lächeln gestand er: »Ich habe mir sogar oft eine kleine Schwester oder einen kleinen Bruder gewünscht, die ich richtig hätte verwöhnen können. Ich finde nur die Art, wie mir das jetzt mitgeteilt wurde, ein bißchen… wie soll ich sagen? Kalt… unpersönlich…«
Dr. Daniel überlegte eine Weile, dann schlug er vor: »Du solltest dich mit diesem Rechtsanwalt in Verbindung setzen und ihm sagen, daß du deine Geschwister kennenlernen willst.« Er lächelte. »Sie könnten sich ja ohnehin glücklich schätzen, einen Bruder wie dich zu bekommen.«
»Danke für das Kompliment«, entgegnete Dr. Parker, dann nickte er. »Du hast recht. Ich werde versuchen, die beiden kennenzulernen. Dabei läßt sich vielleicht auch feststellen, ob sie wirklich meine Geschwister sind, oder ob ich mit dieser Erbschaftsgeschichte betrogen werden soll.« Er stand auf. »Danke, daß du dir für mich Zeit genommen hast.«
»Schon in Ordnung, Jeff«, meinte Dr. Daniel, doch erst als sein Schwiegersohn draußen war, begriff er, was wirklich in ihm vorging. Pamela und Perry Horn! Los Angeles. Konnte das wirklich noch ein Zufall sein? Immerhin hatte Rebecca auch von zwei Kindern gesprochen. Sollte sie ihn mit dem Alter dieser Kinder belogen haben? Der Junge war sechzehn. Das bedeutete, daß Rebecca bei seiner Geburt noch gar nicht volljährig gewesen wäre.
Dr. Daniel schüttelte den Kopf. Das war völlig unmöglich. Der Name Horn kam in Amerika sicher nicht selten vor. Es mußte sich also um eine zufällige Namensgleichheit handeln…
*
Rechtsanwalt Steven Brady war ziemlich erstaunt, als er einen Anruf von Dr. Parker erhielt.
»Ich habe Ihren Brief bekommen und nun würde ich meine Geschwister gern kennenlernen«, kam er ohne Umschweife zum Thema.
Brady schluckte erst mal. Er war nämlich absolut nicht sicher, ob Rebecca ein solches Treffen befürworten würde.
»Ich denke nicht, daß das besonders gut wäre«, wand er sich.
»Und ich denke das Gegenteil«, erwiderte Dr. Parker entschlossen. »Ich möchte Pamela und Perry kennenlernen, und ich bin sicher, daß die beiden ebenfalls Interesse an ihrem großen Bruder haben – sofern ich das überhaupt bin, aber das steht vorerst ja noch auf einem anderen Blatt.« Er schwieg kurz. »Normalerweise hätte ich auf diesen Anruf verzichtet und wäre gleich nach Los Angeles gekommen, aber ich bin Arzt, und es ist mir im Moment leider nicht möglich, Urlaub zu nehmen. Allerdings bin ich gern bereit, den Kindern die Reise hierher zu bezahlen, falls der Flug nach Deutschland ein finanzielles Problem darstellen würde.«
Wieder zögerte Brady. »Ich muß das erst mit der Mutter von Pam und Perry besprechen.« In diesem Augenblick fiel ihm ein, daß er Rebecca in diesem Hinterwäldler-Gasthof gar nicht erreichen konnte. »Besser gesagt… ich muß mich mit ihrem Bruder in Verbindung setzen. Frau Horn ist geschäftlich verreist, und die Kinder halten sich derzeit in der Obhut…« Er brach ab. Das alles ging diesen Dr. Parker doch gar nichts an. Wie hatte er überhaupt nur so unverblümt erzählen können? Aber dieser unverhoffte Anruf hatte ihn wirklich durcheinandergebracht.
»In Ordnung«, stimmte Dr. Parker zu. »Sichern Sie sich beim Onkel der Kinder ab. Ich rufe morgen wieder an.«
Das erübrigte sich dann jedoch, denn noch am selben Abend erhielt Dr. Parker einen Anruf von Alec Horn.
»Meine Schwester ist sicher nicht einverstanden«, gab er offen zu, »aber ich kann gut verstehen, daß Sie Ihre Geschwister kennenlernen wollen. Ein finanzielles Problem ist das nicht, und da ich im Moment arbeitslos bin, verfüge ich auch über genügend Zeit für eine solche Reise. Wir werden also am Wochenende in Steinhausen sein.«
»Ich freue mich«, meinte Dr. Parker, und diese Worte kamen auch von Herzen. Er freute sich wirklich darauf, diese beiden Kinder kennenzulernen, wenn auch der Gedanke, daß sein Vater fremdgegangen sein könnte, noch immer schmerzte.
Mit etwas gemischten Gefühlen fuhr Dr. Parker am Samstag zum Münchner Flughafen, um seine Gäste abzuholen. Karina hätte ihn gern begleitet, doch
der Wochenend-Dienst in der
Thiersch-Klinik, wo sie als Assistenzärztin arbeitete, hatte ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Dr. Parker stand daher allein da und war nicht ganz sicher, ob er Alec, Pamela und Perry Horn wirklich erkennen würde. Doch dann entdeckte er in der Menge einen Jungen mit dunkelblondem Haar und blauen Augen. Dabei hatte er das Gefühl, sich selbst zu begegnen. Genauso hatte er als Teenager auch ausgesehen.
Mit wenigen Schritten war Dr. Parker bei ihm und lächelte ihn an. »Hallo, Perry, ich freue mich, dich kennenzulernen.« Dabei fuhr er ihm mit einer Hand impulsiv durch das dichte, dunkelblonde Haar und bemerkte überrascht, wie der Junge angstvoll zurückzuckte.
»Alec Horn«, stellte sich nun der große, schlanke Mann an Perrys Seite vor.
»Jeff Parker.«
Die beiden Männer reichten sich die Hände. Sie waren sich auf Anhieb sympathisch.
»Das ist Pam. Pamela«, verbesserte sich Alec und schob das vierzehnjährige Mädchen vor.
Jeff begrüßte auch sie auf sehr herzliche Art, spürte aber im selben Moment, daß sie nicht das Kind seines Vaters war. Möglicherweise kam sie ja ganz nach ihrer Mutter, die Jeff nicht kannte. Trotzdem hatte er bei ihr nicht dieses Gefühl der Verbundenheit, wie er es bei Perry empfunden hatte.
Zusammen machten sie sich auf den Weg zum Parkplatz, wo Jeff sein Auto abgestellt hatte. Er ließ Pamela und Perry einsteigen, dann nahm er Alec ein wenig zur Seite.
»Perry ist völlig verängstigt«, stellte er fest.
Alec nickte. »Ich weiß, aber das liegt nicht an mir.« Er sah Jeff an. »Es liegt auch nicht an Ihnen. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen, aber Sie werden die Zusammenhänge sicher noch verstehen.«
Mit dieser Antwort war Dr. Parker natürlich nicht zufrieden, doch er spürte auch, daß er von Alec keine weiteren Auskünfte bekommen würde.
»Ihr seid für die Dauer eures Aufenthaltes selbstverständlich meine Gäste«, wechselte er das Thema, während er sich ans Steuer setzte.
Doch Alec schüttelte den Kopf. »Ich habe bereits Zimmer im Steinhausener Gasthof gebucht.«
»Kennt man den denn auch in Amerika?« fragte Jeff schmunzelnd.
»Nicht direkt«, entgegnete Alec und lächelte dabei ebenfalls. »Aber man kann vieles herausbekommen.« Er warf Dr. Parker einen prüfenden Blick zu. Ob er Rebecca wohl schon kennengelernt hatte? Alec überlegte, wie er eine diesbezügliche Frage formulieren könnte, ließ es letztlich aber bleiben. Er würde noch früh genug herausbekommen, ob Rebecca zu Jeff Parker Kontakt aufgenommen hatte oder nicht.
Jeff hielt seinen Wagen vor dem Gasthof Zum Goldenen Löwen an und begleitete Alec, Pamela und Perry noch nach oben.
»Meldet euch bei mir, wenn ihr ausgeschlafen habt«, meinte er und fügte grinsend hinzu: »Ich habe eine Woche gebraucht, bis ich mich damals an die Zeitverschiebung gewöhnt habe.«
Alec grinste zurück. »Ich hoffe, wir werden es etwas schneller schaffen.« Dann wurde er unvermittelt ernst. »Lassen Sie sich von meiner Schwester nicht über den Tisch ziehen, Jeff.«
Auch Dr. Parker wurde ernst. »Was soll das heißen?«
Alec hielt seinem Blick stand. »Ich kenne meine Schwester. Sie hat schon eine ganze Menge Menschen betrogen.« Er seufzte tief auf. »Sie weiß ganz genau, daß ich das, was sie tut, nicht billige, deshalb weiht sie mich auch grundsätzlich nicht ein… jedenfalls nicht so, daß ich wirklich etwas in der Hand hätte. Ich erfahre immer nur Teilstücke der Wahrheit – und oft nicht einmal das. Ich kann Ihnen nur raten, sich vor ihr in acht zu nehmen.«
»Danke, Alec«, murmelte Jeff und war nicht sicher, vor wem er sich hier wirklich in acht nehmen mußte. Diese Rebecca kannte er nicht, und Alec schien zumindest auf den ersten Blick ein anständiger Kerl zu sein – aber manchmal konnte man den wahren Charakter eines Menschen eben nicht auf Anhieb erkennen.
*
Rebecca kochte vor Wut.
»Wie konntest du auf die hirnverbrannte Idee kommen, hierher zu reisen!« fuhr sie Alec an. »Noch dazu mit Pam und Perry! Willst du meine Pläne zunichte machen?«
»Parker war also gar nicht der Vater von…«
»Natürlich war er es!« fiel Rebecca ihrem Bruder grob ins Wort.
Das Gezeter seiner Mutter hatte Perry geweckt, obwohl er durch die Zeitverschiebung eigentlich todmüde war und sich darüber hinaus auch nicht besonders wohlfühlte. Da war so ein Kratzen im Hals und ständig fröstelte er, aber er wagte es nicht einmal, sich Alec anzuvertrauen.
Trotz der ständigen Schauer, die über seinen Rücken rieselten, stand er nun barfuß und im Pyjama an der Tür und beobachtete den heftigen Streit zwischen seiner Mutter und seinem Onkel.
»Mama, ist Jeff mein Bruder?« wagte er leise einzuwerfen, als Rebecca in ihrer Schimpftirade kurz innehielt, um Atem zu holen.
Wütend fuhr sie zu ihm herum.
»Wer hat dir überhaupt erlaubt, hier hereinzukommen!« fuhr sie ihren Sohn an, fertigte ihn mit zwei heftigen Ohrfeigen ab und stieß ihn dann auf den kleinen Balkon, der zu diesem Zimmer gehörte. Als sie die Tür hinter ihm abschloß, ging Alec einen wütenden Schritt auf sie zu.
»Du kannst ihn doch nicht einfach aussperren!« begehrte er auf. »Regen und Wind machen die Nacht eisig kalt! Er kann sich eine Lungenentzündung holen!«
Ungerührt zuckte Rebecca die Schultern. »Na und? Er hat ja schließlich seinen Arzt mitgebracht.« Dabei war ihre Stimme voller Sarkasmus. Dann wies sie mit ausgestreckter Hand zur Tür. »Und nun verlaß mein Zimmer.«
»Nicht bevor du Perry hereingeholt hast«, entgegnete Alec entschieden.
»Du hast mir nichts zu befehlen!« wies Rebecca ihn zurecht. »Perry ist mein Sohn und ich behandle ihn, wie ich es für richtig halte. Sein Ungehorsam wird bestraft und wenn ich der Meinung bin, daß er genug gelitten hat, dann werde ich ihn hereinholen – vorher nicht. Und nun verschwinde!«
Doch so leicht ließ sich Alec nicht abwimmeln. »Perry war doch gar nicht ungehorsam! Er hat lediglich gefragt…«
»Hör zu, Alec«, fiel Rebecca ihm mit gefährlich leiser Stimme ins Wort. »Du verdankst es einzig mir und meinem Geld, daß du Arzt werden konntest. Du magst zwar älter sein als ich, aber mit deiner Weichherzigkeit hättest du es nach Vaters Tod nie geschafft, auch nur zu einer Spur von Wohlstand zu kommen. Ich habe dir das Studium ermöglicht und mir allein verdankst du es, daß du deinen Lebensstandard trotz deiner momentanen Arbeitslosigkeit beibehalten kannst. Als Gegenleistung verlange ich, daß du tust, was ich sage. Und nun verschwinde.«
Alec zögerte. Er wollte Perry aus der Kälte holen, aber er wußte auch, daß es ihm nicht gelingen würde, indem er versuchte, Rebecca dazu zu zwingen. Vermutlich war es für Perry das beste, wenn er jetzt lieber einlenkte. Sobald er nicht mehr im Zimmer war, würde sie den Jungen wohl eher hereinholen.
Daran dachte Rebecca jedoch gar nicht. Sie wollte Perry eine Lektion erteilen – wenn sie auch gar nicht so ganz genau wußte, weshalb.
*
Dr. Daniel hatte lange mit sich gerungen, ehe er zum Steinhausener Gasthof gefahren war. Im Grunde war es ja gleichgültig, ob er sich mit Rebecca traf oder nicht – seine Ehe war ohnehin auf dem absoluten Tiefpunkt angelangt, und Dr. Daniel wußte, daß er sie nur mit sehr viel Mühe würde retten können.
Genau deshalb drängte es ihn nun aber, noch einmal mit Rebecca zu sprechen. Er mußte herausbekommen, was für eine Frau sie tatsächlich war… ob es sich wirklich gelohnt hatte, dafür seine Ehe aufs Spiel zu setzen.
Seufzend stieg Dr. Daniel aus dem Auto, zögerte noch einen Moment und betrat dann den Gasthof. Heute hatte er es nicht so eilig, zu Rebecca zu kommen. Vielmehr war er noch immer nicht sicher, wirklich das Richtige zu tun. Vielleicht sollte er sie einfach vergessen… sie und alles, was mit ihr zusammenhing. Doch Dr. Daniel wußte, daß er das nicht konnte. Seine Gefühle für diese Frau überstiegen bloße Sympathie… wobei Sympathie wohl nicht der richtige Ausdruck war. Rebecca weckte Gefühle in ihm, die er nicht steuern konnte und so etwas war ihm eigentlich noch nie passiert.
Jetzt stand er vor ihrer Zimmertür und hörte ihre Stimme. Sie schien heftig zu schimpfen. Dazwischen gab es Geräusche, die sich anhörten, als würde jemand geschlagen. Verwundert runzelte Dr. Daniel die Stirn. Wie paßten dieses Gezeter und die anderen Geräusche zu der warmherzigen, hilfsbereiten Frau, die er kennengelernt hatte? Wo war die Sinnlichkeit, mit der sie ihm ihre Liebe gestanden hatte… mit der sie ihn für eine Nacht in ihr Bett holen wollte?
Dr. Daniel atmete tief durch. Er wußte, daß er die Antworten hinter dieser Tür finden würde, aber er war nicht sicher, ob sie ihm gefallen würden. Nach weiterem kurzem Zögern klopfte er. Augenblicklich verstummte drinnen die schimpfende Stimme, dann wurde die Tür aufgerissen.
Dr. Daniel hatte das Gefühl, eine völlig fremde Frau vor sich zu haben. Rebeccas makellos schönes Gesicht spiegelte deutlich ihre Wut wider, und sie hatte Mühe, ein Lächeln auf ihre harten, wie versteinert wirkenden Züge zu zaubern.
»Robert, was für eine Überraschung«, meinte sie, doch auch ihre Stimme klang noch eisig und hatte nicht mehr viel von der Sinnlichkeit, die ihm im Gedächtnis haftete.
Ehe Dr. Daniel etwas sagen konnte, huschte eine schlanke Gestalt auf den Flur. Erst auf den zweiten Blick erkannte Dr. Daniel, daß es sich um einen Teenager handelte, der nichts als einen völlig durchnäßten Pyjama trug.
»Perry, verdammt, komm zurück!« befahl Rebecca in scharfem Ton, doch der Junge rannte, als wäre der Teufel persönlich hinter ihm her.
»Perry«, wiederholte Dr. Daniel, dann nickte er. »Es ist also doch keine zufällige Namensgleichheit. Du bist die Mutter der Kinder, die angeblich Jeffs Geschwister sein sollen.«
Rebecca hatte sich nach der überraschenden Flucht ihres Sohnes nur halbwegs in der Gewalt. Sie ließ Dr. Daniel eintreten und schloß die Tür hinter ihm, dann bemühte sie sich, die Kälte aus ihren Augen zu verbannen, was ihr noch immer nicht vollends gelang.
»Es sind seine Geschwister«, betonte sie.
Wieder nickte Dr. Daniel. »Das bedeutet, daß du mich belogen hast. Über den Tod deines Mannes, über das Alter deiner Kinder…«
Rebecca vergrub das Gesicht in den Händen und schluchzte auf. »Was hätte ich denn tun sollen? O Gott, Robert, ich habe mich auf den ersten Blick in dich verliebt! Wie hätte ich dir sagen können, daß ich als junges Mädchen auf einen ausgekochten Mann hereingefallen bin… daß ich zwei uneheliche Kinder habe? David Parker hat mich jahrelang damit hingehalten, daß er sich scheiden lassen und mich heiraten würde, aber alles war gelogen!« Aus tränennassen Augen blickte sie Dr. Daniel an. »Ich konnte das einfach nicht erzählen.«
Dr. Daniel wurde wankend. Diese Geschichte paßte schon eher in das Bild, das er sich von Rebecca gemacht hatte. Doch ein Rest Zweifel blieb.
»Warum hast du von diesem Parker keine Alimente verlangt?« wollte er wissen.
Rebecca seufzte abgrundtief. »Er hat mir gedroht und… meine Güte, ich war noch ein unerfahrenes Ding. Ich hatte einfach Angst vor ihm. Also sah ich zu, daß ich mich und die Kinder ohne seine Hilfe durchbringen würde.« Sie zuckte die Schultern. »Ich hatte Glück. Eine überraschende Erbschaft hat mich zu einer wohlhabenden Frau gemacht und nun…« Sie wischte sich über die Augen. »Ich habe doch nur um das Recht meiner Kinder gekämpft. Sie haben Anspruch auf ihr Erbe.«
Dr. Daniel glaubte ihr. Da war jetzt nur noch ein Punkt…
»Du behandelst Perry nicht gerade liebevoll«, meinte er.
Wieder wischte sich Rebecca über die Augen. »Es ist jedesmal dasselbe. Perry, Pam und ich haben ein wundervolles Verhältnis zueinander, aber immer, wenn ich geschäftlich verreisen muß, bin ich gezwungen, die Kinder in der Obhut meines Bruders zurückzulassen. Alec tut leider alles, um die Kinder und mich zu entzweien. Er erzählt ihnen haarsträubende Geschichten über mich, und es kostet mich jedesmal eine überaus strenge Hand, um gerade Perry wieder zur Vernunft zu bringen.« Sie seufzte. »Er hat leider sehr viel von den Erbmerkmalen seines Vaters, was seine Erziehung nicht besonders leicht macht.«
Dr. Daniel bekam direkt ein schlechtes Gewissen. Was hatte die arme Rebecca alles durchzumachen, und er hatte dann auch noch an ihr gezweifelt.
»Es tut mir leid«, entschuldigte er sich. »Auch, daß wir uns beim letzten Mal so… wie soll ich sagen… so im Unfrieden getrennt haben.« Er fuhr sich mit einer Hand durch das dichte, blonde Haar. »Diese ganze Situation hat mich etliche schlaflose Nächte gekostet. Dein Geständnis, daß du mich liebst, das Angebot für die gemeinsame Nacht… ja, und nicht zuletzt auch deine Unterleibsschmerzen. Ich habe mir ziemliche Vorwürfe gemacht…«
Mit einer sanften Geste berührte Rebecca sein Gesicht und triumphierte dabei innerlich. Sollte ihr das Glück jetzt doch noch hold sein? Würde sie heute erreichen, was ihr noch vor ein paar Tagen als völlig aussichtslos erschienen war?
»Ich liebe dich wirklich, Robert«, flüsterte sie. »Und dieses Angebot… weißt du, ich würde alles dafür geben, nur ein einziges Mal mit dir vollends glücklich zu sein.« Sie blickte zu Boden. »Ich weiß, daß eine Scheidung für dich nie in Frage käme, schon wegen deiner kleinen Adoptivtochter, von der du mir erzählt hast, aber…« Sie hob den Kopf und lächelte ihn an. »Eine einzige Nacht mit dir würde mir genügen… nein, genügen würde sie mir wohl nicht, aber es wäre mehr, als ich je zu hoffen gewagt habe.«
Dr. Daniel kämpfte verzweifelt mit sich. Er war ein Mensch, der Gefühle ernst nahm, und das allerletzte, was er wollte, war, Rebecca weh zu tun. Andererseits… er konnte Manon nicht betrügen, dazu liebte er sie zu sehr.
Dr. Daniel ließ seine Stirn gegen Rebeccas Schulter sinken.
»Ich kann nicht«, sagte er leise. »Ich liebe Manon – gleichgültig, wie schwierig unsere Ehe im Moment ist. Aber das allein ist es gar nicht. Es geht auch um dich, Rebecca.« Er hob den Kopf und blickte sie wieder an. »Nach einer solchen Nacht wäre für dich alles noch viel schlimmer, oder aber du würdest dir Hoffnungen machen, die ich niemals erfüllen könnte.« Unendlich sanft streichelte er durch ihr dunkles Haar. »Es wird für uns beide das beste sein, wenn wir uns nicht mehr sehen.«
»Ja, vielleicht«, flüsterte Rebecca, dann drängte sie sich an Dr. Daniel heran, schlang ihre Arme um seinen Nacken und küßte ihn mit einer Glut, die er noch nie zuvor erlebt hatte. Er wußte, was sie damit erreichen wollte und spürte, wie nahe er daran war, schwach zu werden. Doch dann löste er sich von ihr und trat zur Tür.
»Leb wohl, Rebecca.«
Rasch ging er hinaus und fühlte dabei noch das Vibrieren in sich. Rebecca Horn war eine außergewöhnliche Frau, und die Gefühle, die sie weckte, waren für einen Mann nur unter Aufbietung aller Kräfte zu unterdrücken.
Dr. Daniel konnte nicht wissen, daß Rebecca in diesem Moment außer sich vor Zorn war. Sie war so nahe an ihrem Ziel gewesen. Wie schaffte dieser Mann es nur, ihr nach einem solchen Kuß noch zu widerstehen? Es war ihre stärkste Waffe und sie hatte bisher noch immer gewirkt – selbst bei schier aussichtslosen Fällen, wie Rebecca besonders standfeste Männer bezeichnete. Doch Dr. Robert Daniel übertraf sie alle. Einem Mann wie ihm war sie wirklich noch nie zuvor begegnet.
*
»Manchmal könnte ich ihn wirklich erwürgen«, beklagte sich Karina.
Liebevoll zog Dr. Parker seine hübsche junge Frau in die Arme. »Wen denn?«
»Professor Thiersch«, knurrte sie. »Nicht genug damit, daß ich heute Frühschicht hatte, nun hat er mich auch noch zum Nachtdienst eingeteilt.«
Dr. Parker seufzte abgrundtief. »Er ist eine Landplage!«
Karina mußte lachen. »Wenn er das gehört hätte, dann würde er dich auf der Stelle durch den Fleischwolf drehen.« Sie wurde wieder ernst und seufzte ebenfalls. »Hilft nichts, ich muß los.« Voller Zärtlichkeit küßte sie ihren Mann, dann raunte sie ihm zu: »Dafür habe ich morgen frei und da machen wir es uns ganz gemütlich. Nur wir zwei.«
Dr. Parker nickte, mußte dabei aber unwillkürlich an Alec, Pamela und Perry denken, mit denen er sich morgen eigentlich hatte treffen wollen. Allerdings würde das notfalls auch bis übermorgen Zeit haben. Er und Karina hatten so selten gemeinsam frei, daß sie diese Tage weidlich ausnutzen mußten.
»Ich begleite dich noch zum Auto«, bot Dr. Parker an, nahm Karina liebevoll bei der Hand und verließ mit ihr die gemütliche Dachwohnung. Im selben Moment flackerte das Licht und verlöschte dann.
»O nein«, stöhnte Karina. »Schon wieder Stromausfall.« Sie schüttelte den Kopf. »Kaum weht einmal ein stärkerer Wind, schon liegt ganz Steinhausen im Dunkeln.«
Allerdings kannten sie die Tücken ihres Heimatortes zur Genüge und hatten daher immer eine Taschenlampe griffbereit. In deren schwachem Schein, aber ausgelassen kichernd wie kleine Kinder gingen sie die Treppe hinunter und küßten sich noch einmal voller Innigkeit, bevor Karina die Haustür öffnete. Der Wind riß ihr fast die Türklinke aus der Hand und ein Schwall Regen schlug ihr ins Gesicht.
»So ein Sauwetter!« schimpfte sie und blickte in die rabenschwarze Nacht hinaus. Der Sturm hatte tatsächlich ganze Arbeit geleistet. Steinhausen lag in absoluter Finsternis.
»Ich fahre dich nach München«, beschloß Dr. Parker kurzerhand. »Wenn du bei diesem Wetter mit dem Auto unterwegs bist, finde ich ja keine Sekunde Ruhe. Außerdem…«
Karina erfuhr nicht mehr, was Jeff sagen wollte, denn in diesem Moment stolperte sie über die Beine einer am Boden liegenden Gestalt. In der herrschenden Dunkelheit hatten weder sie noch Dr. Parker gesehen, daß da jemand lag.
Jeff richtete den Strahl der Taschenlampe direkt auf das Gesicht der Gestalt und erschrak.
»Perry, um Himmels willen«, stieß er hervor, drückte Karina die Taschenlampe in die Hand und nahm den Jungen kurzerhand auf seine starken Arme.
Karina ging mit ihm hinauf, um ihm den Weg zu leuchten.
»Jetzt muß ich aber wirklich los«, meinte sie. Dr. Parker war hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, Karina nach München zu fahren, und der Verpflichtung, sich um den tropfnassen und völlig unterkühlten Jungen zu kümmern, der höchstwahrscheinlich sein Bruder war.
In diesem Moment ging das Licht wieder an. Karina lächelte ihrem Mann beruhigend zu.
»Mach dir keine Sorgen, Jeff, ich komme auch ohne dich heil nach München.« Sie küßte ihn. »Ich rufe dich an, wenn ich da bin.«
Dr. Parker nickte. »Fahr vorsichtig, Liebling.«
Karina verließ die Wohnung nun endgültig, während Jeff den völlig durchnäßten Perry ins Bad brachte. Hier kam der Junge zu sich und begann wie wild um sich zu schlagen.
»Ruhig, Perry«, versuchte Jeff ihn zu besänftigen.»Ganz ruhig, mein Junge, du bist bei mir.«
Perry schluchzte auf. »Sie hat mich geschlagen und… und ausgesperrt. Es war so bitterkalt…«
»Das erzählst du mir alles nachher«, meinte Dr. Parker.
Er hängte ein großes Handtuch über die Heizung und ließ warmes Wasser in die Badewanne laufen, dann zog er Perry den nassen Pyjama aus und verfrachtete ihn in die Wanne – allerdings nur für ein paar Minuten. Anschließend rubbelte er mit dem angewärmten Handtuch seinen Körper trocken und wickelte ihn schließlich in eine Decke.
»Bleib einen Augenblick hier sitzen. Ich werde dir gleich etwas zum Anziehen bringen.«
Perry gehorchte schweigend und wünschte dabei, er wäre zu seinem Onkel gelaufen anstatt hierher. Schließlich kannte er Jeff ja überhaupt nicht. Andererseits hatte er aber zuviel Angst gehabt, im Gasthof zu bleiben… in der Reichweite seiner gnadenlosen Mutter.
Jetzt kam Jeff mit einem Jogginganzug zurück, der Perry zwar um mindestens drei Nummern zu groß, dafür aber angenehm weich und kuschelig war.
»So, mein Junge, hast du Hunger, oder bist du nur müde?« wollte Dr. Parker wissen.
»Müde«, murmelte Perry kraftlos und ließ sich anstandslos ins Gästezimmer bringen. Als er im Bett lag, setzte sich Jeff auf die Bettkante und streichelte sanft über Perrys dunkelblondes Haar, das mittlerweile auch getrocknet war. Wieder zuckte der Junge angstvoll zusammen.
»Wovor fürchtest du dich denn so?« fragte Dr. Parker behutsam, doch Perry schüttelte nur den Kopf.
Plötzlich richtete er sich im Bett auf. »Ich muß nach Hause… zu Onkel Alec… er wird sich schon Sorgen machen.«
»Du bleibst schön im Bett«, befahl Dr. Parker. »Ich werde Alec anrufen und ihm Bescheid sagen.«
Perry gehorchte zwar, doch die Angst war seinen Augen noch immer deutlich anzusehen.
Jeff ging nach nebenan und wählte die Nummer des Steinhausener Gasthofes, dann ließ er Alec Horn an den Apparat holen.
»Parker«, gab er sich zu erkennen. »Perry ist bei mir.«
Alec atmete hörbar auf. »Gott sei Dank. Rebecca hatte ihn wegen einer Nichtigkeit auf den Balkon gesperrt, und als sie ihn wieder hereinholen wollte, ist er offensichtlich haltlos davongelaufen. Ich hätte das gar nicht gewußt, aber sie hat ihn natürlich bei mir gesucht. Nun bin ich froh, daß er in Sicherheit ist. Ich habe mir solche Sorgen gemacht.«
»Was ist das nur für eine Mutter, die ihren Sohn so hart bestrafen kann?« entfuhr es Dr. Parker ungehalten. »Und… entschuldigen Sie meine Direktheit, aber… was sind Sie für ein Mann, daß Sie das nicht verhindern können?«
»Diesen Vorwurf muß ich mir wohl gefallen lassen«, murmelte Alec, dann seufzte er. »Es steckt viel dahinter, wovon Sie keine Ahnung haben.«
»Ich werde Perry über Nacht hierbehalten«, beschloß Dr. Parker kurzerhand. »Vielleicht auch länger, denn ich schätze, die Zeit, in der er Wind und Regen ausgesetzt war, wird nicht spurlos an ihm vorübergehen.«
»Seien Sie vorsichtig, wenn Sie ihn untersuchen und behandeln«, bat Alec spontan. »Tun Sie ihm bitte nicht weh.«
»Ich bin Arzt und kein Menschenschinder«, entgegnete Dr. Parker, dann verabschiedete er sich und legte auf. Er verstand das alles nicht. Alecs Besorgnis und gleichzeitig die offensichtliche Hilflosigkeit seiner Schwester gegenüber, die sich jetzt anscheinend auch in Steinhausen aufhielt… was ging hier bloß vor?
Dr. Parker schüttelte diese Gedanken ab. Wichtig war im Moment nur, sich um Perry zu kümmern. Er kehrte ins Gästezimmer zurück. Erschrocken fuhr der Junge hoch.
»Du mußt vor mir keine Angst haben«, meinte Dr. Parker und setzte sich wieder auf die Bettkante, dann legte er den Handrücken an Perrys Stirn. Sie war glühend heiß. »Ich muß dich jetzt untersuchen, um festzustellen, wie schlimm es dich erwischt hat.«
Heftig schüttelte Perry den Kopf. »Nein, ich will nicht!« Seit er von seinem Großvater bei jeder ärztlichen Maßnahme mehr oder weniger mißhandelt worden war, hatte er vor anstehenden Untersuchungen panische Angst – sogar wenn sein rücksichtsvoller Onkel sie durchführte.
Dr. Parker griff nach seinen zitternden Händen und hielt sie fest. »Hör zu, Perry, ich fürchte, daß du deinen Ausflug im Pyjama mit einer kräftigen Lungenentzündung bezahlen wirst. Je früher ich das feststellen kann, um so einfacher und kürzer wird die Behandlung. Du mußt auch gar keine Angst haben. Ich werde dir nicht weh tun, sondern lediglich deine Temperatur kontrollieren, Herz und Lunge abhören und in deinen Mund schauen. Das ist alles.«
Er stand auf und holte seine Arzttasche, dann entnahm er ihr als erstes ein Gerät, das Perry bereits wohlbekannt war.
»Ich nehme an, du kennst das aus Amerika«, stellte Dr. Parker auch schon fest. »Damit kann ich deine Temperatur im Ohr messen. Das geht schnell und schmerzlos.«
Es dauerte wirklich nur ein paar Sekunden, das Ergebnis beunruhigte Dr. Parker jedoch.
»Fast vierzig Grad«, murmelte er und griff nach Perrys Handgelenk, um den Puls zu kontrollieren. Er ging rasend schnell, allerdings vermutete Dr. Parker, daß das auch an der schrecklichen Angst des Jungen lag.
»Setz dich bitte hin«, forderte er Perry auf, während er das Stethoskop zur Hand nahm.
Jeff schob das Oberteil des Jogginganzugs hoch und hörte gewissenhaft Herz und Lunge ab. Die Lungengeräusche wiesen tatsächlich bereits auf eine beginnende Entzündung hin.
»Bleib sitzen«, bat Jeff, während er einen steril verpackten Holzspatel herausholte. »Ich muß mir deinen Rachen noch ansehen.«
Angstvoll wich Perry zurück. In seiner Erinnerung tauchte wie ein Schreckgespenst sein Großvater auf, der ihm wegen angeblicher oder tatsächlicher Lügen unzählige Male zur Strafe in einer schrecklichen Prozedur den Rachen ausgepinselt oder seinen Mund mit Seife ausgewaschen hatte.
Jeff bemerkte seine Panik, konnte sie aber nicht einordnen.
»Was ist denn, Perry?« fragte er geduldig. »Ich will doch nur in deinen Mund hineinschauen. Das dauert nicht einmal eine Minute.«
Doch Perry preßte die Lippen zusammen und schüttelte hartnäckig den Kopf.
Jeff legte den Spatel beiseite und tastete vorsichtig die Lymphknoten am Hals ab. Schon diese Berührung genügte, um Perry erneut zurückweichen zu lassen, soweit das im Bett überhaupt ging.
Dr. Parker arbeitete ja normalerweise als Anästhesist und hatte daher mit körperlichen Untersuchungen nicht viel zu tun, aber er konnte sich nicht erinnern, jemals einen so verängstigten Patienten gehabt zu haben.
»Die Lymphknoten sind stark geschwollen«, stellte er fest und fügte eindringlich hinzu: »Perry, ich muß in deinen Mund schauen.«
Wieder schüttelte der Junge den Kopf.
»Ich werde dir nicht weh tun«, versprach Jeff erneut. »Hast du denn gar kein Vertrauen zu deinem großen Bruder?«
»Wer sagt denn, daß Sie mein Bruder sind?« fragte Perry zurück und Dr. Parker hatte dabei das Gefühl, als hätte er einen großen Sieg errungen.
Er lächelte Perry aufmunternd an. »Du kannst es nur nicht sehen, weil ich einen Bart trage, aber weißt du, als ich in deinem Alter war, habe ich genauso ausgesehen wie du jetzt. Wir sind ganz sicher Brüder, Perry.«
»Aber…«, begann der Junge, und als er dabei nun erneut den Mund zum Sprechen öffnete, reagierte Jeff blitzschnell. Er schob den Holzspatel in Perrys Mund und drückte die Zunge herunter. Die normale Körperreaktion darauf erfolgte augenblicklich. Perry mußte würgen und gewährte Jeff auf diese Weise für einen Augenblick ungehinderten Einblick in seinen Rachen. Dieser Moment genügte dem jungen Arzt. Er zog den Spatel zurück und nahm seinen kleinen Bruder tröstend in die Arme.
»Das war gemein«, beklagte sich Perry.
»Ich weiß«, gab Jeff offen zu. »Aber anders hättest du mich nicht hineinschauen lassen.«
»Bin ich sehr krank?« fragte Perry leise.
Dr. Parker nickte. »Ja, allerdings bin ich sicher, daß du schon krank warst, als du hierhergekommen bist. Dein nächtlicher Ausflug hat das nur noch verstärkt. Ich werde dich jetzt in die Klinik hinüberbringen und…«
»Nein!«
Diesmal konnte Jeff einen tiefen Seufzer nicht unterdrücken. »Du machst es mir aber wirklich nicht leicht, Perry. Die Klinik muß einfach sein. Du hast eine
eitrige Angina und darüber hinaus eine beginnende Lungenentzündung. Das kann ich hier nicht behandeln, zumal ich übermorgen wieder Dienst habe. Außerdem verspreche ich dir, daß man dir auch im Krankenhaus nicht weh tun wird.« Er spürte, wie der schmale Jungenkörper, den er immer noch tröstend in den Armen hielt, zu beben begann.
»Perry, schau mich an«, verlangte Dr. Parker, doch als er in die in Tränen schwimmenden blauen Augen blickte, tat ihm das Herz vor Mitleid weh. »Wovor hast du denn bloß solche Angst?«
Perry schluchzte auf und dann brach plötzlich alles aus ihm heraus. Die Lieblosigkeit seiner Mutter, die Quälereien seines Großvaters, die schmerzhaften Spritzen und Einläufe, die vielen Schläge und Mißhandlungen. Als er fertig war, wußte Dr. Parker nicht, was in seinem Innern überwog – das grenzenlose Mitgefühl mit Perry und seiner jüngeren Schwester oder die schier unbezähmbare Wut auf Rebecca Horn.
»Hör zu, Perry, ich verspreche dir etwas«, erklärte Dr. Parker, während er den leise schluchzenden Jungen noch immer in den Armen hielt. »Und ich schwöre dir, daß ich dieses Versprechen halten werde. Du bist mein Bruder, das verschafft mir gewisse Rechte. Ich werde dafür sorgen, daß du nie wieder in das Haus deiner Mutter zurückkehren mußt. Notfalls adoptiere ich Pam und dich.« Dabei wußte er genau, wie schwierig das werden würde. Er war zwar verheiratet, aber er und Karina arbeiteten als Ärzte im Schichtdienst. Welches Gericht sollte ihnen die Adoption von zwei Teenagern bewilligen, die nachweislich einer ganz besonderen Fürsorge bedurften?
*
Dr. Parker brachte seinen kleinen Bruder in die Waldsee-Klinik und übergab ihn dort der Obhut von Nachtschwester Irmgard Heider.
»Lassen Sie niemanden außer mir zu ihm«, schärfte er ihr ein, dann ließ er den Jungen Narkosegas atmen, damit er weder die vorbereitenden Maßnahmen noch den schmerzhaften Einstich spürte, der beim Legen einer Infusion nicht zu vermeiden war. Zusammen mit der Nachtschwester nahm er bei Perry eine Entleerung von Blase und Darm vor, dann setzte er die Nadel an der Vene unmittelbar hinter dem Handgelenk an und stach ein. Vorsichtig zog er die Nadel zurück und schob gleichzeitig die Kanüle weiter in die Vene vor. Er schloß die Antibiotika-Infusion an und regelte die Tropfgeschwindigkeit, dann stand er auf, warf dem schlafenden Perry einen letzten Blick zu und verließ schließlich das Zimmer.
Draußen wäre er beinahe mit Dr. Daniel zusammengestoßen.
»Ach, hier bist du«, stellte dieser fest. »Karina hat mich angerufen, weil sie dich nicht erreichen konnte.«
Dr. Parker erschrak. »Ist ihr etwas passiert?«
»Nein, sie wollte dir nur sagen, daß sie gut in der Thiersch-Klinik angekommen ist.« Prüfend sah Dr. Daniel seinen Schwiegersohn an. »Du hast heute keinen Dienst. Was tust du also mitten in der Nacht hier?«
»Hat Karina dir denn nichts erzählt?« fragte Jeff zurück.
Dr. Daniel schüttelte den Kopf. »Sie war in Eile.«
Jeff atmete tief durch, dann schilderte er in knappen Worten, wie er und Karina den völlig durchnäßten Perry vor der Tür gefunden hatten. Er erzählte von der übermäßigen Angst des Jungen und wie er herausgefunden hatte, wo diese ihren Ursprung hatte.
»Das glaube ich nicht«, entgegnete Dr. Daniel entschieden.
Jeff war sichtlich erstaunt. »Ich habe Perry zwar erst heute kennengelernt, aber seine Geschichte hörte sich absolut nicht so an, als wäre sie erfunden.«
»Jugendliche können sehr geschickt lügen – vor allem, wenn sie etwas damit erreichen wollen«, entgegnete Dr. Daniel.
Jeff verstand in diesem Augenblick die Welt nicht mehr. Normalerweise sah sein Schwiegervater doch auch rot, wenn Kinder oder Jugendliche mißhandelt wurden. Warum zog er diesmal die Möglichkeit, daß Perrys Geschichte stimmte, überhaupt nicht in Betracht?
»Was macht dich eigentlich so sicher, daß er lügt?« wollte Jeff aus diesem Grund auch schon wissen.
Dr. Daniel atmete tief durch. »Ich kenne seine Mutter. Rebecca Horn kam als Patientin zu mir und…« Er verstummte.
»Und?« hakte Jeff nach.
»Wir kamen uns näher – rein freundschaftlich«, behauptete Dr. Daniel, doch die Art, wie er das sagte, weckte in Jeff den Verdacht, daß dieses Verhältnis eben nicht nur rein freundschaftlich gewesen war.
»Sie hat dir also eine andere Version der Geschichte erzählt«, vermutete Dr. Parker.
Sein Schwiegervater nickte. »Ja, und die klingt für mich wesentlich glaubhafter. Sei doch ehrlich, Jeff, welcher Arzt würde ein Kind mit Spritzen und Einläufen quälen, noch dazu wenn dieses Kind sein Enkel ist? Zur Strafe den Rachen auspinseln, den Mund mit Seife auswaschen… das sind Dinge, die man vielleicht im Mittelalter gemacht hat.«
»Seine Angst ist jedenfalls echt«, hielt Jeff dagegen. »Perry zittert ja schon am ganzen Leib, wenn man ihm nur über die Haare streichelt.«
»Er weiß vermutlich auch, weshalb.« Dr. Daniel seufzte. »Versteh mich bitte nicht falsch, Jeff, ich will über deinen Bruder bestimmt nichts Schlechtes sagen, aber Tatsache ist nun mal, daß er sehr schwer erziehbar ist.«
Dr. Parker schüttelte den Kopf. »Nein, Robert, das ist sicher nicht wahr. Ich habe mich intensiv um den Jungen gekümmert und seine Angst gespürt, während ich ihn untersuchte. Ich mußte einen Trick anwenden, um ihm überhaupt in den Mund schauen zu können. Perry ist nicht schwer erziehbar, aber er ist völlig verängstigt.« Er schwieg kurz. »Im übrigen – gleichgültig wie es sich nun verhält. Würdest du einen Sechzehnjährigen bei Wind und Regen zur Strafe auf den Balkon sperren?«
»Wer sagt dir, daß sie das wirklich getan hat?« hielt Dr. Daniel dagegen, mußte dabei aber unwillkürlich an das Schimpfen und die schlagenden Geräusche denken, die er im Gasthof vor der Tür von Rebeccas Zimmer gehört hatte. Und Tatsache war auch, daß Perry schon völlig durchnäßt gewesen war, als er im Gasthof die Flucht ergriffen hatte.
»Ich sage es Ihnen.«
Jeff und Dr. Daniel fuhren herum und sahen sich unverhofft Alec Horn gegenüber. Dieser blickte Dr. Parker an.
»Ich habe Sie gesucht, weil mir Ihr Anruf keine Ruhe gelassen hat«, gestand er. »Ich mußte einfach wissen, was mit Perry los ist, und da ich Sie in Ihrer Wohnung nicht angetroffen habe, bin ich zur Klinik gefahren. Die Nachtschwester hat mich dann hier heraufgeschickt.«
»Perry bekommt Antibiotika-Infusionen«, antwortete Dr. Parker. »Er hat eine eitrige Angina und eine beginnende Lungenentzündung.«
»Jetzt reicht’s!« stieß Alec hervor, dann sah er Dr. Parker fast flehend an. »Helfen Sie mir! Ich muß unbedingt durchsetzen, daß man Rebecca das Sorgerecht entzieht.«
»Hoffen Sie, dadurch an das Erbe der Kinder zu kommen?« fragte Dr. Daniel herausfordernd.
Alec wandte sich ihm zu. »Rebecca hat Sie also auch um den Finger gewickelt.« Er nickte. »Das kann sie nämlich sehr gut.« Prüfend sah er Dr. Daniel an. »Haben Sie mit ihr geschlafen?«
»Was erlauben Sie sich!« brauste Dr. Daniel ungehalten auf.
Anerkennend zog Alec die Augenbrauen hoch. »Sie dürften der erste Mann sein, der es geschafft hat, ihr zu widerstehen. Vielleicht hätte Ihnen diese Erfahrung aber in anderer Hinsicht gut getan, denn dann hätten Sie Rebeccas Charakter rasch kennengelernt. Die Nacht mit ihr wäre Sie teuer zu stehen gekommen.«
Angewidert schüttelte Dr. Daniel den Kopf. »Was versuchen Sie eigentlich noch alles, um Ihre Schwester in Mißkredit zu bringen? Nicht genug damit, daß Sie Pamela und Perry gegen die eigene Mutter aufhetzen…«
»Das ist nicht nötig«, fiel Alec ihm ins Wort. »Pam und Perry haben bei ihrer Mutter die Hölle durchlebt… dieselbe Hölle, die Rebecca und ich bei unserem Vater durchlitten haben. Rebecca hat sich seine Grausamkeiten zum Beispiel genommen, mir dagegen waren sie eine Lehre. Kein Mensch verdient es, so geschunden und mißhandelt zu werden. Wahrscheinlich habe ich das schon viel zu lange untätig geschehen lassen, aber auch ich stand… und stehe noch immer unter ihrer Fuchtel. Sie hat mir mein Medizinstudium finanziert und hält mich jetzt finanziell so, daß ich auf sie angewiesen bin. Ich bin arbeitslos. Diesen Zustand hält sie gern aufrecht, denn ohne eigenes Einkommen habe ich kaum Möglichkeiten, von ihr loszukommen.«
»Sie wollen mir doch wohl nicht weismachen, Rebecca würde verhindern, daß Sie eine Stellung bekommen?« entgegnete Dr. Daniel kopfschüttelnd.
»Sie haben ja keine Ahnung, wer alles in ihrer Schuld steht«, meinte Alec, dann senkte er den Kopf. »Natürlich hätte ich meine Chance gehabt.« Er blickte wieder auf. »Die Villa in San Francisco gehört mir. Mein Vater hat sie mir vermacht, weil er der Meinung war, Haus- und Grundbesitz sollten auf den Sohn übergehen – auch wenn er von mir persönlich nichts hielt. Ich war für seine Begriffe zu lasch und weichherzig.« Er atmete tief durch. »Mehr als einmal habe ich mit dem Gedanken gespielt, die Villa zu verkaufen und Kalifornien zu verlassen, doch… da gab es eben noch Pam und Parry. Viel konnte ich für sie nicht tun, aber ich denke, das bißchen, was mir möglich war, war eben schon mehr als gar nichts. Wegen der Kinder habe ich mich Rebecca gegenüber in eine Abhängigkeit manövriert, die mir immer mehr zum Verhängnis wird.«
Dr. Parker glaubte ihm, weil er sicher war, daß Alec das alles nicht erfunden haben konnte. Jeder hatte doch das Bedürfnis, sich selbst in ein helles Licht zu rücken, doch Alecs Geschichte war eher dazu angetan, ihn für einen Versager zu halten. Auch Dr. Daniel war nachdenklich geworden, konnte aber immer noch nicht glauben, daß Rebecca ihn so belogen haben könnte… nein, mehr als das. Ihre Tränen, ihre Verzweiflung, das war doch echt gewesen – oder nicht?
»Das Bild, das Sie von Ihrer Schwester zeichnen, widerspricht so total dem, das ich von Rebecca bekommen habe, daß es mir schwerfällt, Ihnen auch nur ein einziges Wort zu glauben«, meinte Dr. Daniel.
Alec nickte. »Ich weiß, wie geschickt Rebecca lügen kann. Sonst wäre sie ja nie zu ihrem Reichtum gekommen.«
»Sie hat eine Erbschaft gemacht«, erwiderte Dr. Daniel. »Erst die ermöglichte ihr und ihren beiden Kindern ein angenehmes Leben.« Er sah Jeff an. »Dein Vater hat sich nämlich auch nicht gerade anständig benommen.«
Dr. Parker zog die Augenbrauen hoch. »Ach, meinen Vater hat sie also auch schlecht gemacht?« Er schüttelte den Kopf. »Wenn mein Vater von diesen beiden Kindern gewußt hätte…«
»Er konnte von ihnen nichts wissen«, fiel Alec ihm ins Wort. »Ihre erste Affäre habe ich sozusagen hautnah mitbekommen. Rebecca war sechzehn und ich siebzehn, als wir eine Woche auf einem echten kalifornischen Weingut verbringen durften. Die Parkers haben uns aufgenommen wie eigene Kinder.« Er sah Jeff an und wechselte dann ganz spontan zum vertrauten Du. »Du warst zu jener Zeit in Harvard. Das hat dein Vater voller Stolz erzählt.« Mit einer Hand strich er sein
dunkles Haar zurück, doch es fiel ihm gleich wieder in die Stirn. »Rebecca war mit sechzehn schon ein richtiges kleines Biest. Sie hat es geschafft, deinen Vater zu verführen. Er war für sie nur eine Art Versuchskaninchen. An ihm hat sie ausprobiert, was bei Männern so zieht.«
Man konnte Jeff ansehen, wie entsetzt er über diese Eröffnung war. Sein Vater und ein sechzehnjähriges Mädchen! Wie hatte er das nur tun können?
»In der einen Woche, die wir auf der Parker-Winery verbracht haben, begann Rebeccas Karriere, wenn man das so bezeichnen will«, fuhr Alec fort. »Mit wie vielen Männern sie bis jetzt tatsächlich zusammen war, weiß ich nicht. Ich weiß nur, daß sie von jedem eine stattliche Summe Schweigegeld kassiert hat.«
»Schweigegeld?« wiederholte Dr. Daniel kopfschüttelnd. Noch immer war er nicht sicher, ob er das alles glauben sollte. Rebecca – wie sanft und fürsorglich war sie zu ihm gewesen. Es fiel ihm schwer, in ihr eine Frau zu sehen, die gleich reihenweise Männer in ihr Bett zog und sich danach fürstlich von ihnen bezahlen ließ. Dabei verdrängte er die Erinnerung an jenen Abend, an dem sie ihm dieses eindeutige Angebot gemacht hatte.
Alec nickte. »Sie ließ sich dafür bezahlen, daß sie den jeweiligen Ehefrauen gegenüber Stillschweigen bewahrte. Die Liebesnacht mit Rebecca kostete den jeweiligen Mann zwar eine Stange Geld, dafür konnte er aber seine Ehe weiterführen. Aus diesem Grund suchte sich Rebecca auch grundsätzlich Männer, die glücklich verheiratet waren, denn sonst wäre ihr schlagkräftiges Druckmittel ja weggefallen.« Er wandte sich Jeff zu. »Damit bin ich nun auch bei dem Punkt, der dich angeht. Rebecca behauptet zwar, daß Perry der Sohn deines Vaters ist, aber sie hat über Jahre hinweg von mindestens sieben verschiedenen Männern Alimente für ihn kassiert. Ebenso für Pam. Ich bin nicht sicher, ob Rebecca überhaupt weiß, von wem ihre Kinder sind.«
»So etwas hätte man nachprüfen können«, warf Dr. Daniel dazwischen, der sich immer mehr wie in einem bösen Alptraum fühlte. Das alles konnte doch einfach nicht wahr sein!
»Rebecca hat sich nie arme Männer ausgesucht – jedenfalls soweit ich das weiß«, entgegnete Alec. »Und nun frage ich Sie – welcher reiche Mann würde seine Ehe und womöglich sein Ansehen in der Öffentlichkeit riskieren, um einen Vaterschaftstest zu machen? Die haben doch alle lieber stillschweigend gezahlt, und genau damit hat Rebecca ja auch gerechnet.« Wieder wanderte sein Blick zu Jeff. »Pam ist aller Wahrscheinlichkeit nach nicht deine Schwester. Bei Perry bin ich mir da allerdings nicht so sicher. Er könnte wirklich dein Bruder sein. Tatsache ist, daß Rebecca gerade mal siebzehn war, als sie ihn zur Welt gebracht hat. Aber sie hatte im fraglichen Zeitraum bestimmt auch noch mit einigen anderen Männern intimen Kontakt. Jedenfalls hat dein Vater niemals Alimente für ihn gezahlt. Ich denke, er hat von Rebeccas Schwangerschaft gar nichts erfahren.«
Dr. Parker nickte nachdenklich. »Dieser Meinung bin ich auch.« Er seufzte tief auf. »Es ist für mich schon schwer zu glauben, daß mein Vater intimen Kontakt mit einer Sechzehnjährigen hatte, aber gut… wenn sie es geschickt angestellt hat…« Er atmete tief durch. »Doch niemals hätte er sein Kind verleugnet. Spätestens in seinem Testament hätte er den Jungen bedacht.« Jetzt sah er Alec an. »Perry ist mein Bruder, dafür brauche ich keinen Bluttest. So wie er habe ich mit sechzehn auch ausgesehen.«
Alec atmete auf. »Ich bin froh darüber. Einen Bruder wie dich hätte Perry schon viel früher gebraucht. Er ist so ein sensibler Junge und ich glaube, wenn er dem unseligen Einfluß seiner Mutter noch lange ausgesetzt ist, geht er daran zugrunde.«
»Das werde ich verhindern«, entgegnete Dr. Parker entschlossen. »Und du wirst mir dabei helfen. Mag sein, daß es für dich schwierig wird, aber meiner Meinung nach hast du dich lange genug vor der Verantwortung gedrückt.«
Beschämt senkte Alec den Kopf und hatte dabei das Gefühl, als hätte er ebenfalls gerade einen großen Bruder bekommen, der ihm zeigte, wo’s langging.
*
Als Dr. Daniel nach Mitternacht die Waldsee-Klinik verließ, war er von dem Gespräch mit Jeff und Alec noch immer wie betäubt. Sekundenlang spielte er mit dem Gedanken, zu Rebecca zu gehen und eine Erklärung zu verlangen, doch er verwarf diesen Gedanken wieder. Für ein solches Gespräch mußte er ausgeruht sein. Im Moment hätte er sicher Schwierigkeiten gehabt, Wahrheit und Lüge zu unterscheiden.
Allerdings fühlte sich Dr. Daniel am nächsten Morgen auch nicht sehr viel ausgeruhter. Rebecca hatte ihm eine erneute schlaflose Nacht bereitet, und Dr. Daniel wußte, daß er schnellstens mit ihr sprechen mußte, wenn er jemals wieder wirklich zur Ruhe kommen wollte.
Als er den Gasthof Zum Goldenen Löwen jedoch erreichte, erlebte er eine weitere Enttäuschung, denn Rebecca war abgereist.
»Das ist doch nicht möglich!« entfuhr es Dr. Daniel, was der Gasthofbesitzerin Hermine Gruber einen überraschten Blick entlockte.
»Die Dame wollte noch zu einer Untersuchung kommen«, redete sich Dr. Daniel rasch heraus, weil er vermeiden wollte, daß er zum Tagesgespräch der geschwätzigen Frau Gruber werden würde.
Vertraulich beugte sich Hermine näher zu ihm. »Ich will ja ganz ehrlich sein, Herr Doktor. Eigentlich bin ich sogar froh, daß sie so überstürzt abgereist ist. Das Gezeter vom vergangenen Abend war äußerst störend, und in der Nacht gab es dann noch einmal Streit, bevor der junge Mann, der gestern mit den beiden Jugendlichen hier angekommen ist, wie der Blitz die Treppe heruntergerannt ist und dann das Haus verlassen hat. So eine Unruhe mag ich hier gar nicht gern.«
Dr. Daniel nickte zerstreut. Das alles interessierte ihn nur am Rande, und es war auch keine Antwort auf die vielen Fragen, die ihn beschäftigten. Hatte nun Rebecca die Wahrheit gesagt oder Alec?
»Frau Horn hat ja mitten in der Nacht noch mal den Gasthof verlassen«, fuhr Hermine Gruber fort, und Dr. Daniel fragte sich, wann diese Frau eigentlich schlafen würde. Ihr schien ja absolut nichts zu entgehen. »In den Morgenstunden kam sie dann mit einem Mann zurück, und mit ihm ist sie heute in aller Frühe abgereist.«
Die Worte trafen Dr. Daniel wie ein Schlag. Sollte Alec etwa doch die Wahrheit gesagt haben?
»Danke, Frau Gruber«, murmelte Dr. Daniel.
Wie in Trance verließ er den Gasthof. Rebecca war mit einem Mann abgereist, den sie wenige Stunden zuvor erst kennengelernt hatte, obwohl sie am vergangenen Abend noch beteuert hatte, ihn – Dr. Daniel – zu lieben.
»Sie wissen es also schon?«
Erschrocken fuhr Dr. Daniel herum und sah sich Alec Horn gegenüber.
Zögernd nickte er. »Ja, Herr Horn, ich weiß es, und ich glaube, ich muß Abbitte leisten. Ich hielt Sie für einen Lügner.« Nachdenklich runzelte er die Stirn. »Was geschieht jetzt mit Pamela und Perry?«
»Rebecca hat mir eine Nachricht hinterlassen«, antwortete Alec. »Nach getaner Arbeit wird sie sich bei mir melden.«
»Nach getaner Arbeit«, murmelte Dr. Daniel kopfschüttelnd. Wie hatte er auf diese Frau nur hereinfallen können? Dabei hatte er sogar noch Glück gehabt, daß er so glimpflich davongekommen war.
Manon fiel ihm ein. Sicher, ihre Ehe hatte schon einen kleinen Knacks gehabt, bevor Rebecca das erste Mal in seine Praxis gekommen war, aber erst danach war Manon völlig ausgerastet und das wohl auch zu Recht.
»Ich muß nach Hause«, meinte Dr. Daniel und hatte es auf einmal furchtbar eilig. Er wollte zu Manon – und das auf der Stelle. Er mußte diesen ganzen Unfrieden aus der Welt schaffen, mußte ihr sagen, daß er sie liebte – nur sie. Aber… würde Manon ihm überhaupt noch glauben?
Dr. Daniel bewältigte den Heimweg fast ausschließlich im Laufschritt. Völlig atemlos erreichte er die Villa, hetzte die Treppe hinauf und stürzte in die Wohnung.
»Manon?« rief er fragend, doch er bekam keine Antwort.
Obwohl Sonntag war, lief Dr. Daniel in die Praxis hinunter, aber auch sie war verwaist. Manon war verschwunden. Sie hatte ihn verlassen – ohne Brief, ohne Abschied… einfach so.
Aufstöhnend vergrub Dr. Daniel das Gesicht in den Händen. Wie hatte das alles nur geschehen können? Wie sollte er das der kleinen Tessa erklären? Und wie, um Himmels willen, sollte er ohne Manon weiterleben?
*
Dr. Parker hatte an diesem Sonntagmorgen keinen Dienst, trotzdem führte ihn sein erster Weg zur Waldsee-Klinik. Vor einer Stunde war Karina von der Nachtschicht heimgekommen und würde vermutlich bis mittags schlafen. Dr. Parker hatte also genügend Zeit, um nach Perry zu sehen.
Als er das Zimmer betrat, fand er seinen kleinen Bruder weinend vor.
»Perry, was ist denn los?« fragte Dr. Parker besorgt und eilte an sein Bett.
»Mir ist so schlecht«, jammerte der Junge kläglich.
Behutsam streichelte Jeff über seine Haare, bemerkte das ängstliche Zusammenzucken und wurde von erneuter Wut auf die ihm persönlich unbekannte Rebecca Horn ergriffen. Allerdings war es vermutlich besser, daß er sie nicht kennengelernt hatte.
»Das kommt von der Infusion«, erklärte Dr. Parker nun. »Antibiotika können Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auslösen, aber die Infusion ist in deinem Fall leider nicht zu umgehen.« Er half Perry, sich aufzusetzen und hörte gewissenhaft Herz und Lunge ab, dann sah er ihn aufmerksam an. »Wirst du mich heute freiwillig in deinen Mund schauen lassen?«
Perry zögerte, dann nickte er.
»Fein.« Dr. Parker lächelte ihn an. »Dann mach mal schön auf, und streck’ deine Zunge heraus.«
Perry gehorchte, und Jeff wußte, daß das schon ein großer Vertrauensbeweis des Jungen war.
»Ein paar Tage wirst du die Infusionen noch bekommen müssen«, stellte Dr. Parker fest, während er ihn wieder fürsorglich zudeckte, dann stützte er sich über Perrys Körper hinweg auf der anderen Seite des Bettes ab. »Was würdest du wohl davon halten, für immer hierzubleiben?«
Der Junge erschrak. »In der Klinik?«
Jeff mußte lachen und schüttelte den Kopf. »Nein, Perry, natürlich nicht in der Klinik, sondern hier in Steinhausen. Bei Alec und mir eben.«
Aus weitaufgerissenen Augen starrte Perry ihn an. »Aber… Mama… sie wird das niemals erlauben.«
»Das werden Alec und ich schon irgendwie hinkriegen«, versicherte Dr. Parker. »Wichtig ist mir im Moment nur, was du möchtest.«
»Ich will nicht mehr heim«, flüsterte Perry bestimmt. »Bei Onkel Alec ist es so schön.«
Dr. Parker nickte, als hätte er genau diese Antwort erwartet. »Ich nehme an, Pam denkt genauso.«
Perry nickte. »Sie haßt Mama.« Er senkte den Kopf. »Ich nicht. Ich habe nur solche Angst… wenn sie mich schlägt… und bestraft…«
»Dazu wird sie nie wieder Gelegenheit haben«, versprach Dr. Parker. »Alec und ich haben uns vergangene Nacht lange und eingehend unterhalten. Er wird die Villa in San Francisco verkaufen und hierher übersiedeln – mit dir und Pam. In dem Haus, wo meine Frau und ich wohnen, wird in Kürze die Erdgeschoßwohnung frei. Ursprünglich wollten Karina und ich dort hinunterziehen, aber genaugenommen brauchen wir eigentlich gar keine größere Wohnung.«
In Perrys Augen leuchtete für einen Moment die Sonne auf. »Heißt das, wir werden künftig alle in einem Haus wohnen?«
Jeff nickte. »Alec wird sich hier eine Stellung suchen, aber als Arzt wird auch er im Schichtdienst arbeiten müssen. Er ist nicht verheiratet, deshalb wird es nötig sein, daß wir gemeinsam nachweisen, wie wir die Aufsichtspflicht für euch regeln. Wenn wir alle im selben Haus wohnen, wird es wegen des Sorgerechts für dich und Pam keine größeren Probleme geben, denn einer von uns wird immer für euch da sein. Im übrigen werdet ihr von eurer Mutter nachweislich mißhandelt, was in einem Prozeß deutlich gegen sie sprechen wird – vorausgesetzt, es kommt überhaupt dazu.«
Da konnte Perry zum ersten Mal wieder lächeln. Er zögerte noch einen Moment, dann schlang er seine Arme um Jeffs Nacken, obwohl der Infusionsschlauch dabei ziemlich im Weg war.
»Ich habe mir immer einen großen Bruder gewünscht«, gestand er leise. »Einen, der mich beschützt… der mir hilft und… der mich lieb hat.«
Die Worte rührten an Jeffs Herz. Ganz sanft streichelte er über Perrys Kopf und Rücken. Dabei zuckte der Junge zum ersten Mal nicht mehr angstvoll zusammen.
»Ich habe dich lieb, Perry«, meinte Jeff. »Ich habe dich vom ersten Augenblick an lieb gehabt, und daran wird sich auch nie etwas ändern.«
*
Dr. Daniel konnte nicht fassen, daß Manon ihn wirklich verlassen hatte. Zuerst ging er in der Praxis von Raum zu Raum, dann durchstreifte er den Garten und kehrte schließlich erschöpft in seine Wohnung zurück. Auch hier sah er noch einmal in jedes Zimmer, doch er war allein.
Niedergeschlagen ließ er sich auf das Sofa im Wohnzimmer fallen, doch ohne Manon schien hier alles nur noch halb so gemütlich zu sein.
Die vielen schlaflosen Nächte machten sich bemerkbar. Dr. Daniels Kopf dröhnte, als wolle er gleich zerspringen. Er preßte beide Handflächen gegen die Schläfen, fühlte, wie seine Augen brannten und wünschte sich nichts sehnlicher, als die Zeit um zwei Wochen zurückdrehen zu können.
»Robert.«
Wie elektrisiert blickte er auf und direkt in ihr Gesicht. Er hatte das Gefühl, einen Traum zu erleben.
»Manon«, flüsterte er, als hätte er Angst, sie könnte sich in Luft auflösen, wenn er jetzt zu laut sprechen würde.
Langsam stand er auf und überlegte, was er sagen, wie er ihr alles erklären könnte. Doch als er dann vor Manon stand, nahm er sie einfach in die Arme.
»Ich liebe dich«, gestand er in einem Ton, der keinen Zweifel an der Wahrhaftigkeit seiner Worte aufkommen ließ.
Er spürte, wie Manons Anspannung nachließ, wie sie sich zärtlich an ihn schmiegte.
»Ich habe Fehler gemacht«, meinte sie.
Da rückte Dr. Daniel ein wenig von ihr ab – gerade so weit, daß er in ihr Gesicht sehen konnte. »Du?« Er schüttelte den Kopf. »Nein, Manon, die Fehler lagen bei mir. Ich hätte mit Rebecca niemals ausgehen dürfen, obwohl es wirklich harmlos war. Nur… was in meinem Kopf ablief… ich war auf einmal so unsicher. Nicht in meiner Liebe zu dir, aber… sie weckte Gefühle, die sich nur schwer steuern ließen. Trotzdem… ich schwöre dir, daß ich dir keine Sekunde lang untreu war.« Er blickte zu Boden. »Im übrigen war sie es nicht wert, daß ich mich auch nur mit ihr unterhalten habe, aber das wurde mir erst viel zu spät klar.«
Liebevoll streichelte Manon sein Gesicht. »Ich hätte mit dir sprechen müssen… gleich nach unserem ersten Streit, aber… ich war so schrecklich eifersüchtig – auf die Praxis, auf die Klinik, sogar auf Tessa, eigentlich auf alles. Und wie ich dich dann mit dieser anderen Frau sah… ich dachte, ich müßte verrückt werden vor Eifersucht. Dazu kam, daß ich mich auch noch schuldig fühlte. Unser Streit wegen nichts und wieder nichts… ich war es doch, die dich damit in die Arme der anderen getrieben hat. Das zu wissen, war das Schrecklichste an allem. Ich steigerte mich immer mehr hinein und gestern war ich dann überzeugt, daß es nur einen Weg geben würde, um damit fertigzuwerden. Ich wollte dich verlassen… die Scheidung einreichen, aber dann… ich war noch nicht einmal eine Stunde weg, da hatte ich solche Sehnsucht nach dir. Ich wußte, daß ich ohne dich niemals leben könnte.« Aufschluchzend drängte sie sich in seine Arme. »Verzeih mir, Robert.«
Dr. Daniel hielt sie liebevoll an sich gedrückt und wußte, daß etwas geschehen mußte. Sie waren an einem Punkt angekommen,wo sie nicht mehr so weitermachen konnten wie bisher.
»Ich glaube, es wird Zeit, daß wir auch einmal an uns denken«, meinte Dr. Daniel. »Wir werden die Praxis schließen – auf unbestimmte Zeit. Noch heute packen wir unsere Koffer, und morgen früh schon fliegen wir nach Sardinien.«
Fassungslos starrte Manon ihren Mann an. Es war das erste Mal, daß er sein Privatleben so deutlich vor seinen Beruf stellte.
»Robert…«, begann sie erstaunt, doch er ließ sie gar nicht aussprechen. Mit beiden Händen umschloß er ihr Gesicht.
»Hör zu, Manon, ich bin heute früh hierhergekommen und habe Wohnung und Praxis verwaist vorgefunden. Was ich durchlitten habe, während ich nach dir suchte… in der Gewißheit, daß du mich verlassen hast… daß ich dich für immer verloren habe… das hat mich zur Besinnung gebracht. Unsere Ehe… unsere Liebe ist wichtiger als alles andere, das ist mir in diesen schrecklichen Minuten klargeworden. Wir haben viel aufzuarbeiten und dazu ist es nötig, daß wir Praxis und Klinik weit hinter uns lassen.« Jetzt brachte er sogar wieder ein kleines Lächeln zustande. »Auf Sardinien wartet unsere kleine Tochter und dort werden wir zu dem zurückfinden, was wir einmal waren – eine glückliche Familie.«
*
Dr. Daniel hatte an diesem Sonntagmorgen nicht zuviel versprochen. Der plötzliche Urlaub der Daniels kam für viele Menschen in Steinhausen überraschend, trotzdem ließen Robert und Manon sich nicht davon abhalten, am Montag nach Sardinien zu fliegen.
Auf diese Weise entging ihnen die kleine Zeitungsnotiz, die zwei Tage später in der Regenbogenpresse auftauchte:
Erpresserin festgenommen. Rebecca H. verlangte nach einer heißen Liebesnacht von dem Mann, der mit ihr das Bett teilte, eine stattliche Summe. Als Gegenleistung sicherte sie zu, daß seine Ehefrau von diesem Seitensprung nichts erfahren würde. Unglücklicherweise hatte sie sich dafür den falschen Mann ausgesucht. Er war Kriminalkommissar und führte die Festnahme gleich persönlich durch…