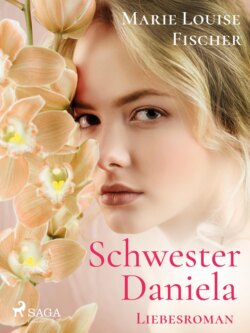Читать книгу Schwester Daniela - Liebesroman - Marie Louise Fischer - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеAls Schwester Daniela am nächsten Morgen nach Hause kam, fühlte sie sich wie gerädert. Sie war froh, als sie sich endlich in den kühlen Laken ihres Bettes ausstrecken dürfte.
Sie hatte das Gefühl, gerade erst eingeschlafen zu sein, als zwei kleine Hände sie beim Arm packten und sie schüttelten. »Mutti! Mutti! Wach doch auf!«
Daniela setzte sich hoch, riß die Augen auf. »Ist was passiert?«
»Onkel Harald ist da.«
Als sie wenige Minuten später in ihrem blauen, seidenen Morgenrock, kleine rote Lederpantoffeln an den Füßen, das kastanienbraune Haar nur flüchtig gekämmt, ins Wohnzimmer trat, erhob sich Harald Spielmann sofort.
Sie reichte ihm nicht die Hand. »Du hättest nicht kommen sollen«, sagte sie.
»Ich weiß. Aber ich konnte nicht anders.«
Ein neuer Ton in seiner Stimme machte sie aufmerksam.
»Eva«, sagte sie, »willst du, bitte, Mutti einen Gefallen tun und für ein paar Minuten in die Küche gehen, ja? Ich glaube, Onkel Harald möchte mir etwas sagen ...«
»Was denn? Ein Geheimnis?«
»Ja.«
»Für meinen Geburtstag?«
»Vielleicht, Liebling. Geh jetzt, bitte, in die Küche, ich rufe dich dann, wenn du wieder hereinkommen kannst, ja?« Sie strich ihrer kleinen Tochter zärtlich durch das lockige, verwuschelte Haar.
»Ich habe mit Professor Kortner gesprochen«, sagte Harald Spielmann, kaum daß Eva die Tür ins Schloß gezogen hatte.
»Ja?«
»Er sagt... ach, Daniela, es ist zu schrecklich!« Er schlug die Hände vors Gesicht, seine breiten Schultern bebten.
Sie fragte nichts, wartete ab, bis er sich wieder einigermaßen beruhigt hatte.
»Ihr ... Bewußtsein ist getrübt«, sagte er endlich.
Daniela zog die Augenbrauen zusammen. »Was soll das heißen?«
»Sie ist wieder zu sich gekommen ...«
»Ja, das weiß ich. Gestern nacht. Ich war dabei.«
»Aber ... sie ist noch nicht ganz da. Sie spricht nichts, und man weiß nicht, ob sie etwas versteht.«
»Deshalb würde ich an deiner Stelle nicht so erschreckt sein, Harald«, sagte Daniela beruhigend. »Du darfst nicht vergessen, daß deine Frau einen gewaltigen Schock bekommen hat. Durch den Unfall... vielleicht sogar schon vorher. Es kann eine Zeit dauern, bis sie den überwunden hat.«
»Ja, aber, ich ... Der Professor sagt, es könnte sich möglicherweise um eine Schädigung des Gehirns handeln. Bitte, Daniela, sag mir ganz ehrlich, was glaubst du?«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich bin keine Ärztin, Harald. Ich kann keine Diagnosen stellen!«
»Aber du hast schon so viele Kranke gepflegt... auch Schwerverletzte nach Unfällen! Du mußt doch ... ein Gefühl für die Sache haben!«
»Weißt du, mit Gefühlen kann man in der Medizin nicht sehr viel anfangen ...«
»Du weichst mir aus!«
»Nein ... warum sollte ich?«
»Niemand kann mir zumuten, daß ich mit einer Irrsinnigen weiter zusammenlebe!«
»Mit einer Kranken, Harald.«
»Es ist also wahr?« Er schrie es fast.
»Bitte, Harald, nicht so laut!« sagte sie nervös. »Denk an das Kind!«
Er trat auf sie zu, packte sie bei den Schultern. »Ich könnte es nicht ertragen, Daniela, glaub mir, ich könnte es nicht!«
Sie sah sein blasses, verzerrtes Gesicht sehr nahe vor sich. »Bitte, laß mich los!«
Er ließ die Hände sinken, starrte dumpf vor sich hin. »Harald«, sagte sie, »warum bist du zu mir gekommen? Was erwartest du von mir? Daß ich dich tröste?«
»Daß du mir hilfst!«
»Ich ... dir? Aber wie könnte ich das?«
»Du weißt es.«
»Ich verstehe dich nicht«, sagte sie hilflos, dann stieg ein furchtbarer Verdacht in ihr auf. »Ich will dich nicht verstehen, bitte, Harald, bitte! Geh jetzt!«
»Daniela«, sagte er direkt, »es liegt in deiner Hand ... unser Glück! Es kann alles noch gut werden, glaub mir!«
»Nein, Harald, nie! Du weißt nicht mehr, was du redest!«
»Doch, Daniela. Doch. Ich weiß es ganz genau. Du mußt es tun, hörst du! Du mußt!«
»Harald!« Sie wich entsetzt einen Schritt vor ihm zurück.
»Wem tust du denn unrecht, wenn du Irene von ihrem Leiden erlöst? Niemandem! Du hilfst ihr ja nur. Glaubst du, daß sie selbst das Leben einer ... einer Blöden führen möchte? Du tust es ja nur für Irene ... und für uns beide. Ich bitte dich, ich flehe dich an!«
»Verlaß sofort dieses Zimmer!«
»Ich soll gehen, ja? Aus deinem Leben verschwinden. Das ist es doch, was du dir wünschst? Aber so einfach geht das nicht, meine Liebe. Hast du vergessen, wie oft du mir geschworen hast, daß du mich liebst? Jetzt auf einmal soll das alles nicht mehr gelten, nur weil ich ein Opfer ... ein kleines Opfer von dir fordere?«
»Was du verlangst, ist... Mord!«
Sein Gesicht verfärbte sich. Sie spürte, daß sie ihn mit diesem Wort getroffen hatte.
Aber schneller, als sie gedacht hatte, faßte er sich wieder. »Nenn es, wie du willst. Es ist die einzig mögliche Lösung.«
Daniela zwang sich zur Ruhe. »Du bist jetzt verstört, Harald. Du bist außer dir, sonst könntest du nicht so reden. Du solltest mich gut genug kennen, um zu wissen, daß ich es nie tun würde! Nie und unter keinen Umständen!«
»Wirklich nicht?« Ein verzweifeltes Lächeln verzerrte seine Züge. »Das wollen wir sehen.« Er wandte sich zur Tür.
Sie wußte, er erwartete jetzt, daß sie ihn zurückrufen würde. Aber seine Drohung schreckte sie nicht.
Sie hatte nur den einen Wunsch, endlich von ihm allein gelassen zu werden.
Aber er ging noch nicht. Zwei Schritte, bevor er die Tür erreicht hätte, drehte er sich um. »Du vergißt, daß du es bist, die an allem schuld ist«, sagte er.
Sie schwieg, sah ihn nur an.
»Wenn du nicht in mein Leben getreten wärst, wenn du es nicht von Anfang an darauf angelegt hättest, mich einzufangen ... all das wäre nie passiert. Ich hätte niemals daran gedacht, Irene zu verlassen. Sie wäre gesund und ich ... ein glücklicher Mensch!«
Als Daniela an diesem Abend das Bruder-Klaus-Krankenhaus betrat, rief der Pförtner hinter ihr her: »Hallo, Schwester ...«
Sie drehte sich um, kam die wenigen Schritte zurück. »Ja?«
»Ich soll Ihnen was ausrichten, Schwester! Vom Herrn Professor. Er bittet Sie, heute nacht Dienst auf seiner Station zu machen ... das Wachzimmer ist nämlich schon leer.«
»Leer?« Daniela erschrak.
»Ja, die Patientin ist jetzt auf Privatstation.«
»Ach so. Vielen Dank, Herr Siegel!« Daniela nickte dem Pförtner zu, dann schritt sie weiter den langen, glänzend gebohnerten Gang entlang, fuhr mit dem Lift nach oben.
Schwester Berta empfing sie im Schwesternzimmer. »Ich habe gerade die Medikamente für die Nacht verteilt«, sagte sie, »es sind noch die alten Fälle, nur eine Niere ist dazugekommen, eine Frau Höger. Sie hat Schmerzen. Wenn es ihr in der Nacht sehr schlecht gehen sollte, können Sie ihr noch einmal Morphium geben. Dann haben wir natürlich den Schädelbruch, aber den kennen Sie ja schon aus dem Wachzimmer!«
»Wie geht es Frau Spielmann?« fragte Daniela.
»Die Oberschenkelfraktur verheilt gut, und überhaupt, das Allgemeinbefinden hat sich sehr gebessert, nur, sprechen tut sie noch immer nicht.«
»Ob sie versteht?«
»Ich weiß nicht. Ich sage immer, wenn erst mal der Schädel kaputt gewesen ist, bleibt immer was übrig.«
Schwester Daniela hatte den Mantel ausgezogen und über einen Bügel gehängt.
»Einer wird sich ja heute freuen, daß Sie wieder da sind«, sagte Schwester Berta augenzwinkernd.
»So?« Daniela steckte eine widerspenstige Locke unter das weiße Häubchen.
»Sie wissen schon, wen ich meine.«
»Ich gebe mir Mühe, mit allen Patienten einen guten Kontakt zu bekommen«, sagte Daniela.
»Gut gesagt.« Berta lachte. »Aber mit manchen geht’s eben doch besser und mit manchen weniger. In Roy Erichson haben Sie jedenfalls einen heißen Verehrer gefunden!«
»Unsinn!« sagte Schwester Daniela schärfer, als sie beabsichtigt hatte, und fügte entschuldigend hinzu: »Sie wissen, ich kann diese Art Witze schlecht vertragen.«
»Es ist gar kein Witz. Mindestens fünfmal hat er mich inzwischen gelöchert, wo Sie stecken und warum Sie nicht wieder auf die Privatstation kommen.«
»Und was haben Sie ihm gesagt?«
»Daß Sie die Weihnachtsfeiertage beurlaubt waren. Wissen Sie, ich hielt es nicht für richtig, ihm die Sache mit der Schädeloperation auf die Nase zu binden. Manche Patienten erschreckt so etwas!«
Während Schwester Berta sich hinsetzte und ihren Bericht zu Ende schrieb, ging Schwester Daniela von Zimmer zu Zimmer, um guten Abend zu sagen.
Als erstes schaute sie zu dem kleinen Mädchen hinein, das zwei Tage vor dem Heiligen Abend am Blinddarm hatte operiert werden müssen. »Guten Abend, Ulli«, sagte sie freundlich. »Gut siehst du aus! Ich könnte mir denken, daß du bald wieder nach Hause darfst.«
»Warum waren Sie gestern nicht da, Schwester? Sie hatten doch versprochen, mir eine schöne Geschichte zu erzählen.«
»Sei mir nicht böse, heute holen wir’s nach, ja? Sobald ich Zeit habe, komme ich zu dir!«
»Au fein! Wissen Sie nämlich, Schwester ... gerade an Weihnachten krank zu sein, das ist gar nicht lustig.«
Schwester Daniela trat ins Nebenzimmer, wo die nierenkranke Patientin lag. »Guten Abend, Frau Höger«, sagte Daniela, »ich bin die Nachtschwester. Wenn Sie einen Wunsch haben ... Sie dürfen jederzeit klingeln.«
»Mir geht es ganz gut«, sagte die Patientin. Ihr Blick war ein wenig verschwommen. Es war noch nicht lange her, seit sie ihre letzte Spritze bekommen hatte.
»Das freut mich. Ich schaue auf alle Fälle nachher noch einmal bei Ihnen herein!«
Mit freundlichem Nicken verließ Daniela das Zimmer. Vor der Tür des Filmschauspielers blieb sie zögernd stehen. Dann ging sie vorbei. Es hatte sie Kraft genug gekostet, für die Sorgen der Kranken aufnahmefähig zu sein, während es ihr so schwer ums Herz war. Den Späßen und den Komplimenten Roy Erichsons fühlte sie sich beim besten Willen nicht gewachsen.
Ganz zuletzt trat sie in das Zimmer Irene Spielmanns. Mit einem Blick stellte sie fest, daß die Schwerkranke sich gut erholt hatte. Ihre Züge wirkten entspannt, fast ein wenig voller, die Farbe war besser geworden. Aber auf ihre deutliche und freundliche Begrüßung erhielt sie keine Antwort.
Schwester Daniela studierte das Krankenblatt, stellte fest, daß Puls, Atmung und Blutdruck sich fast normalisiert hatten. »Es freut mich wirklich, daß es Ihnen soviel besser geht, Frau Spielmann«, sagte sie. »Es ist ja fast ein Wunder, wie schnell Sie sich erholt haben.« Sie ließ während dieser Worte die Kranke keine Sekunde aus den Augen. Frau Spielmann sah sie nur an, ohne irgendeine Reaktion zu zeigen.
»Wenn Sie Schmerzen haben oder irgendeinen Wunsch ...« Daniela trat näher an das Bett, »sehen Sie, hier ist die Klingel. Sie brauchen nur darauf zu drücken, ein paar Sekunden später bin ich bei Ihnen!«
Immer noch sprach Frau Spielmann kein Wort, zuckte mit keiner Wimper. Dennoch hatte Daniela plötzlich das Gefühl, daß sie sehr wohl verstand, was man zu ihr sagte. War es möglich, daß sie nicht reagieren wollte?
»Hat Ihr Mann Sie schon besuchen dürfen?« fragte Daniela.
Ihr schien es, als wenn bei dieser Frage die Pupillen der Patientin zuckten. Aber nur den Bruchteil einer Sekunde dauerte diese Wahrnehmung, dann schloß Frau Spielmann wie ermattet die Augen.
»Er macht sich große Sorgen um Sie«, fuhr Daniela fort, «wie sehr wird er sich freuen, wenn er hört, daß es Ihnen besser geht.«
Die Tür öffnete sich unerwartet, und Schwester Berta steckte ihren Kopf ins Zimmer. »Ah, hier sind Sie! Ich habe schon Roy Erichson verdächtigt, daß er Sie versteckt hätte!«
»Bitte, Berta!«
Berta lachte. »Seien Sie doch nicht so empfindlich, man muß auch Spaß vertragen können.«
Daniela folgte der Kollegin auf den Gang hinaus.
»Schwerer Fall, wie?« fragte Berta mit einer Kopfbewegung zum Krankenzimmer hin.
»Sehr merkwürdig«, sagte Daniela. »Haben Sie nicht manchmal das Gefühl, daß sie ... daß sie doch alles versteht, was man sagt?«
»Könnte ich nicht behaupten. Allerdings ... ich habe gar nicht versucht, mich mit ihr zu unterhalten.«
Berta übergab Daniela den Schlüssel zum Schrank mit den rezeptpflichtigen Medikamenten, dem »Giftschrank«, wie ihn die Schwestern unter sich nannten.
»Die Liste liegt drinnen«, sagte sie. »Ist noch was unklar?«
Daniela schüttelte den Kopf. »Nein, danke, Berta.« Sie hatte das Gefühl, Schwester Berta durch ihre Überempfindlichkeit verletzt zu haben, und fügte versöhnlich hinzu: »Sie werden sich auch freuen, wenn wieder etwas mehr Betrieb auf der Station ist, nicht wahr? Den ganzen Tag allein zu arbeiten, das ist sicher kein Spaß.«
Schwester Berta zuckte die runden Schultern. »Ach, mir macht’s nichts aus. Schließlich ... für lange Zeit ist es sowieso nicht mehr.«
»Nicht?« fragte Daniela erstaunt. »Wollen Sie fort?«
Berta errötete überraschend. »Ich habe nichts gesagt.«
»Doch. Sie haben eine Andeutung gemacht, als ob ...«
»Na und? Haben Sie etwa vor ... ewig als Schwester zu arbeiten?«
Bertas Stimme hatte so gereizt geklungen, daß Daniela rasch einlenkte: »Entschuldigen Sie meine Neugier«, sagte sie, »das ist natürlich einzig und allein Ihre Sache.«
Sie half Schwester Berta in den Mantel, sah nachdenklich hinter ihr her, als sie mit raschen, energischen Schritten den Gang hinunterschritt.
Als Schwester Daniela das Krankenzimmer — Ulli hatte sie ganz unnötigerweise gerufen — verließ, sah sie überrascht zwei Herren in Ärztekitteln auf dem Gang stehen. Sie erkannte Dr. Wörgel und Professor Kortner.
Es war ganz ungewöhnlich, daß Professor Kortner um diese Stunde – es war fast zehn Uhr abends — noch Visite machte. Eisiger Schreck fuhr in Danielas Herz. Ob mit Frau Spielmann etwas geschehen war? Aber das hätte sie doch als erste wissen müssen.
Grüßend ging sie an den beiden Herren vorbei, mußte sich zurückhalten, nichts zu fragen. Dr. Wörgel nickte ihr freundlich zu; beide beachteten sie nicht weiter.
Daniela ließ die Tür des Schwesternzimmers offen und setzte sich an den Schreibtisch. Die Ärzte sprachen gedämpft — nicht ihretwegen, das wußte sie, sondern um die Patienten nicht zu stören. Niemand hätte etwas dabei gefunden, daß sie sich für das sachliche Gespräch interessierte. Dennoch fühlte sie sich wie eine unbefugte Lauscherin.
»Ganz recht, Herr Professor, es wird uns nichts anderes übrigbleiben«, war das erste, was sie verstand; aber sie begriff nicht, auf was Doktor Wörgel damit anspielte.
»Ich kann und kann es mir nicht erklären«, sagte der Professor, »bei der Operation ergab sich doch ein durchaus günstiges Bild. Die Schädeldecke ist gebrochen, ja, aber keineswegs gesplittert, die Dura völlig unverletzt. Mehr Sorgen als die Schädelfraktur hat mir, ehrlich gestanden, die Konstitution der Kranken gemacht. Und nun dies! Ich stehe vor einem Rätsel!«
»Wir sind auf derartige Fälle nicht eingerichtet«, sagte Dr. Wörgel, »nur auf einer Gehirnstation ist eine wirklich genaue Diagnostizierung möglich.«
»Ich weiß. Mit Hilfe von Kontrastdarstellungen käme man natürlich ein gutes Stück weiter. Nur ... ich bin doch schließlich kein Anfänger mehr! Ich muß doch wissen, was ich operiert habe, sonst müßte ich an mir selbst zweifeln!«
»Es gibt immer außerordentliche und ganz und gar ungewöhnliche Fälle, Herr Professor.«
»Wem sagen Sie das?« Professor Kortners Stimme klang ungeduldig. »Schließlich bin ich auch kein Gehirnchirurg im engeren Sinne. Ich hätte nicht einmal diese Operation durchgeführt, wenn mir nicht Eile notwendig erschienen wäre. In jedem Lehrbuch steht, daß man auch bei äußerlich günstig verlaufenen Fällen mit einer Gehirnschädigung rechnen muß. Ich weiß das alles! Aber es leuchtet mir nicht ein! Irgend etwas ist faul an dieser Sache, glauben Sie mir, Kollege. Ich spüre das. Ich rieche es förmlich, und ich habe mich bisher immer noch auf meinen Instinkt verlassen können.«
»Daß ein Schock als solcher so lange andauern könnte, ist schwer denkbar«, sagte Dr. Wörgel. »Sie haben sich doch sicher mit ihrem Mann unterhalten. Was meint denn der?«
Obwohl niemand sie sehen konnte, errötete Schwester Daniela, als die Rede auf Harald Spielmann kam.
»Ein ganz undurchsichtiger Bursche«, sagte der Professor, »spielt den absolut Ahnungslosen und kann sich angeblich nicht vorstellen, was die Frau ausgerechnet am Heiligen Abend zu dieser irrsinnigen Fahrerei veranlaßt haben könnte! Sie hat ja hundert Sachen draufgehabt, wie das polizeiliche Protokoll angibt... hundert Sachen, und das mitten in der Stadt! Aber dieser Herr Spielmann weiß von nichts und kann sich auch beim besten Willen keine Ursache vorstellen.«
»Sie meinen, er hält etwas zurück?«
»Ganz bestimmt. Daran besteht gar kein Zweifel. Die Frage ist nur, ob das, was er uns nicht sagen will, wesentlich für den Fall ist.«
»Wie wär’s, wenn Sie die beiden konfrontierten?«
»Habe ich auch schon dran gedacht, nur ... ich verspreche mir nicht allzuviel davon.«
Was Dr. Wörgel darauf antwortete, konnte Schwester Daniela nicht mehr verstehen, denn die beiden Ärzte entfernten sich durch die Glastür.
Unwillkürlich sprang sie auf, um ihnen nachzulaufen — aber im letzten Moment verließ sie der Mut. Was hätte sie fragen, was sagen sollen?
Unmöglich konnte sie die Wahrheit bekennen.
Ihr Verstand sagte ihr, daß es das beste war, gar nichts zu tun, den Dingen ihren Lauf zu lassen. Sie glaubte nicht daran, daß Irene Spielmann beim Wiedersehen mit ihrem Mann ein Zeichen des Erkennens geben würde.
War es so wirklich nicht das beste? Wenn sie Irene Spielmann nicht mehr sah, vielleicht würde sie sie vergessen können, sie und Harald. Noch war sie jung, und das Leben lag vor ihr mit all seinen Überraschungen und Verheißungen. Ihre Liebe zu Harald war ein Irrtum gewesen. Konnte man diesen Irrtum nicht einfach ausstreichen? Noch während Daniela dies dachte, spürte sie in ihrem Herzen, daß sie nicht dazu fähig war. Sie fühlte sich für die schwerkranke Frau verantwortlich, überzeugt, daß ihre Liebe schuld am Unglück der anderen war.
Aber wenn sie sich irrte? Wenn Irene Spielmann gar nichts von ihrer Existenz ahnte? Wenn ihre Liebe in keinem Zusammenhang mit jenem Unglücksfall stand?
Wie elektrisiert sprang Schwester Daniela auf. Sie mußte es wissen. Sie konnte es erfahren. Jetzt. Sofort.
Sie lief über den Gang in das Zimmer Irene Spielmanns, und erst, als sie die Tür schon geöffnet hatte, kam ihr der Gedanke, daß die Patientin vielleicht schlafen könnte. Aber sie tat es nicht. Irene Spielmann blickte Schwester Daniela aus großen glanzlosen Augen entgegen.
»Oh, ich hoffe, ich habe Sie nicht erschreckt«, sagte Daniela und preßte unwillkürlich die Hand auf das klopfende Herz. »Es ist nur ... ich muß Ihnen etwas sagen, Frau Spielmann!«
Das Gesicht der Patientin blieb völlig gleichgültig. »Ich glaube, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Ich bin Schwester Daniela!« Nach einer kleinen erwartungsvollen Pause fügte sie hinzu: »Daniela Kreuzer!«
Es schien Daniela, als wenn ein flüchtiges Rot die Wangen der Kranken färbte, aber sie konnte es im ungewissen Licht der kleinen Nachttischlampe nicht genau feststellen. »Ich kenne Ihren Mann«, sagte sie, »Harald Spielmann ... nicht wahr, er ist Ihr Mann. Ich habe ihn diesen Sommer kennengelernt. Im August. Aber ich schwöre Ihnen ... ich wußte nicht, daß er verheiratet ist. Ich wußte es nicht!«
Die Patientin öffnete die Lippen. Gespannt starrte Schwester Daniela sie an.
Ein schweres Keuchen entrang sich Irene Spielmanns Brust. Dann stieß sie mit heiserer, fast krächzender Stimme hervor: »Sie lügen!«
Die Anklage traf Daniela wie ein Peitschenhieb.
Die Patientin drückte wild auf die Klingel.
»Gehen Sie! Gehen Sie!« schrie sie. »Hinaus mit Ihnen ... oder ich schreie um Hilfe!«
»Bitte, Frau Spielmann, bitte, glauben Sie mir doch ...«
»Nein! Mir können Sie nichts vormachen! Sie sind schuld. Sie allein! Sie ... Flittchen!«
Ganz überraschend sprang die Kranke mit beiden Beinen aus dem Bett, stürzte, die mageren Hände zu Krallen erhoben, auf Daniela zu.
Die Schwester reagierte blitzschnell. Mit einem Jiu-Jitsu-Griff zwang sie die Kranke zu Boden, unentwegt beruhigend auf sie einsprechend. Aber sie erreichte nichts damit. Zwar war die Rasende in ihrer Gewalt, sie konnte ihr jetzt nicht gefährlich werden, aber sie hörte nicht auf, sich zu wehren, versuchte zu beißen, stieß wild mit den Beinen in die Luft, schrie gellend.
Daniela war verzweifelt vor Entsetzen und Ratlosigkeit. Dann fiel ihr die Spritze ein — die Spritze, die sie schon für Frau Höger mit Morphium aufgezogen und in die Tasche gesteckt hatte.
Nach vielen vergeblichen Versuchen gelang es ihr, die Kranke mit der linken Hand zu bändigen, mit der rechten stieß sie blitzschnell die Spritze in den nackten Oberarm.
Zehn Minuten dauerte es, bis das Morphium zu wirken begann — zehn Minuten, die für Schwester Daniela zu einer Ewigkeit wurden. Die Kranke ließ nicht davon ab, sich gegen sie zu sträuben, stieß wüste Beschimpfungen aus.
Dann allmählich ging es vorbei. Die Stimme der Schwerkranken wurde leiser, immer häufiger fielen ihr die Augen zu, die Befreiungsversuche wurden schwächer. Aber Daniela wagte nicht sie loszulassen, bevor sie ganz eingeschlafen war.
Als sie dann endlich den schlaff gewordenen Körper der Patientin wieder betten konnte, atmete sie auf. Kalter Schweiß stand ihr auf der Stirn. Sie war seelisch und körperlich am Ende ihrer Kräfte.
Es dauerte eine ganze Weile, bis sie die Tragweite des Geschehens begriff. Sie hatte sich nicht geirrt, Irene Spielmann hatte von Haralds Liebe zu ihr erfahren. Deshalb war sie wie eine Wahnsinnige mit dem Auto durch die abendlichen Straßen gebraust. Vielleicht hatte sie sogar bewußt den Tod gesucht. Und sie — Daniela — war schuld.
Ohne ganz zu wissen, was sie tat, verließ Schwester Daniela das Krankenzimmer. Sie bewegte sich auf eine seltsam gleitende, automatische Art wie eine Nachtwandlerin. Im Schwesternzimmer brach sie zusammen.
Kurz vor Mitternacht kam Dr. Wörgel. Er sah blaß und übernächtig aus. »Ich wäre schon eher gekommen«, sagte er fast entschuldigend, »aber es war allerhand los heute nacht!«
»Darf ich Ihnen eine Tasse Kaffee machen?« fragte Daniela.
Er sah sie überrascht an. »Wahrhaftig? Das ist aber mal nett von Ihnen!«
Daniela zögerte einen Augenblick, dann sagte sie: »Ich brauche Ihren Rat, Herr Doktor!«
»Können Sie haben. Um was geht es?«
»Es ist... ziemlich schlimm.« Daniela wußte nicht, wie sie anfangen sollte.
»Hängt es mit Irene Spielmann zusammen?«
»Ja!« sagte Daniela erstaunt. »Woher wissen Sie?«
»Ich habe so meine kleinen Beobachtungen gemacht. Natürlich ist es auch durchaus möglich, daß ich mich getäuscht habe. Sie kennen diese Frau also doch?«
»Nein, Herr Doktor. Ich habe Sie nicht belogen. Ich habe Frau Spielmann das erstemal gesehen, als sie schon im Wachzimmer lag. Aber ... ich kenne ihren Mann.« Sie schwieg.
Dr. Wörgel zündete sich, ohne sie anzusehen, eine Zigarette an. »Reden Sie weiter«, sagte er mit einer Gelassenheit, die erzwungen klang.
»Ich habe nicht gewußt, daß er verheiratet ist«, sagte Daniela. »Sie müssen mir glauben, daß ich es nicht gewußt habe!«
»Was weiter?« fragte er kühl.
»Nun jetzt... begreifen Sie denn nicht, daß ich in einen entsetzlichen Konflikt geraten bin?« sagte sie verzweifelt.
»Wollen Sie sagen, daß Sie sich nicht imstande fühlen, ihre Rivalin zu pflegen?«
»Herr Doktor!« Warmes Rot schoß Schwester Daniela in die Wangen.
»Tut mir leid, wenn ich Sie verletzt habe.«
Schwester Daniela holte tief Luft, zwang sich zur Ruhe. »Schon gut«, sagte sie mit einem gequälten Lächeln, »schweigen wir darüber.«
Sie trat zu dem elektrischen Kocher, nahm den Deckel vom Topf. »Das Wasser kocht gleich, in ein paar Minuten haben Sie Ihren Kaffee!«
»War das alles, was Sie mir sagen wollten?«
Daniela sah ihn mit einem großen Blick ihrer sehr dunkelblauen Augen an. »Nein, ich fürchte, es ist sinnlos!«
»Warum?«
»Sie wissen es. Warum fragen Sie also. Ich ... sehen Sie, Herr Doktor, ich stehe ganz allein auf der Welt. Außer meiner kleinen Tochter habe ich niemanden, und Eva ist jetzt erst fünf Jahre alt. Ich sage Ihnen das, damit Sie mir verzeihen, daß ich Sie mit meinen Sorgen belästigen wollte.«
»Sie glauben, daß ich Sie nicht verstehen kann, nicht wahr? Aber Sie irren sich, Schwester Daniela ... ich kann alles nur zu gut verstehen. Aber ... Sie müssen sich auch in meine Lage versetzen. Ich hätte niemals geglaubt, daß ausgerechnet Sie ...«
»Ich habe Harald Spielmann geliebt«, sagte Schwester Daniela mit fester Stimme.
»Verzeihen Sie!« Dr. Wörgel strich sich nervös mit der Hand über die Stirn. »Ich weiß, ich bin ungerecht... wahrscheinlich kommt es nur daher, daß ich mich erschöpft fühle. Dies scheint mir wirklich keine günstige Stunde für ein ernsthaftes Gespräch zu sein.«
»Aber Sie müssen es wissen!« sagte Daniela mit plötzlichem Entschluß. »Es geht Sie an. Nicht nur als Mensch, sondern als Arzt! Die Patientin hat mich erkannt!«
»Was?«
»Ja. Sie weiß, wer ich bin!«
»Daniela!« Tiefe Enttäuschung klang aus Dr. Wörgels Stimme. »Sie haben doch eben behauptet, Sie hätten gar nicht gewußt...«
»Das stimmt auch. Ich hatte keine Ahnung, daß er verheiratet war. Begreifen Sie doch ...«
»Nein, das kann ich nicht. Was Sie mir da erzählen, klingt absolut konfus und unglaublich! Woher soll die Patientin denn wissen, daß Sie ... nein, Daniela, bei allem Verständnis, das kann ich Ihnen nicht glauben.«
»Ich habe es ihr gesagt!«
Dr. Wörgel sah Schwester Daniela mit einem seltsamen Blick an.
Es schien, als wenn er etwas sagen wollte, dann aber biß er sich nur auf die Lippen.
Sie wandte sich von ihm ab, um ihm Gelegenheit zu geben, mit ihrer Mitteilung fertig zu werden.
Das Wasser kochte, sie spülte die Kanne heiß aus, tat ein paar Löffel Kaffeepulver hinein, schüttete Wasser auf. Sie stellte eine Tasse für Dr. Wörgel und eine für sich selber auf den Schreibtisch, eine Schale Zucker und ein Döschen Kondensmilch dazu.
»Wollen wir uns nicht setzen?« fragte sie und zog sich einen Stuhl heran. »Trinken Sie, bitte, Herr Doktor.«
Er trat näher, blieb aber dann, anstatt sich zu setzen, nahe bei ihr stehen, starrte sie an. Die Hände auf dem Rücken, fragte er: »Warum haben Sie das getan?«
»Weil ich es wissen mußte«, sagte sie. »Ob die Patientin von den Beziehungen ihres Mannes zu mir etwas ahnte ... verstehen Sie denn nicht, daß das ungeheuer wichtig für mich war?«
»Sind Sie sicher, daß sie Sie überhaupt verstanden hat?«
»O ja! Deshalb erzähle ich Ihnen ja alles. Weil ich meine, daß Sie es wissen müßten ... Sie als Arzt. Die Patientin hat mich verstanden, sie hat reagiert.«
»In welcher Form?«
»Sie hat zu mir gesprochen!« Mit einem gequälten Lächeln fügte Daniela hinzu: »Genauer gesagt... geschrien!«
Dr. Wörgel ließ die Kaffeetasse unberührt stehen. Er begann mit heftigen Schritten in dem kleinen Raum auf und ab zu gehen. »Sie wissen hoffentlich, daß Ihr Vorgehen unverantwortlich war!« sagte er scharf. »Als Krankenschwester haben Sie die Pflicht, die Ihnen anvertrauten Patienten zu pflegen, nicht aber ... sie mutwillig aufzuregen! Ich muß jetzt sofort...« Er ging zur Tür.
Schwester Daniela stand auf. »Wohin wollen Sie?«
»Zu der Patientin natürlich!«
»Nicht nötig. Ich habe ihr eine Morphiumspritze gegeben.« Als sie seinen erstaunten, fast kalten Blick sah, fügte sie hinzu: »Ich mußte es tun. Sie ... sie wurde tätlich.«
»Eine feine Geschichte. Das haben Sie wahrhaftig großartig gemacht! Wie, glauben Sie nun, soll es weitergehen?«
»Ich möchte kündigen«, sagte Schwester Daniela mit steifen Lippen.
»Fliehen also! Sich der Verantwortung entziehen? Na, ich kann Sie nur warnen! Das wird ein feines Zeugnis, das Ihnen die Krankenhausleitung dafür geben muß!«
»Ich habe nicht vor, länger als Schwester zu arbeiten.«
»Nun hören Sie mal, finden Sie nicht auch, daß Sie jetzt ein bißchen übertreiben?«
»Nein. Ich weiß genau, was ich tue.«
»Schwester Daniela ... es scheint, Sie haben mich falsch verstanden! Möglicherweise bin ich zu grob mit Ihnen gewesen ... das sollte mir leid tun ...«
»Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Herr Doktor ... eigentlich stand mein Entschluß schon fest, bevor ich mit Ihnen gesprochen habe!«
Sie sah, daß auf der Klingeltafel ein rotes Licht aufleuchtete. »Entschuldigen Sie bitte«, sagte sie rasch, »das ist Frau Höger. Wahrscheinlich hat sie Schmerzen!« Sie schloß den Giftschrank auf, nahm eine Ampulle Morphium heraus, notierte es auf der Liste, schloß den Schrank wieder ab, nahm eine sterilisierte Spritze und verließ das Schwesternzimmer.
Als sie nach knappen zehn Minuten zurückkam, war Dr. Wörgel gegangen.