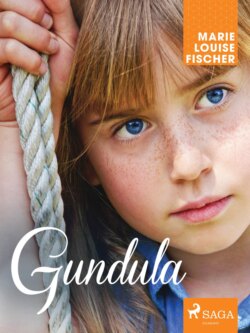Читать книгу Gundula - Marie Louise Fischer - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Auf dem Kriegspfad
ОглавлениеGundula war nicht traurig, als sie allein zurück blieb. Wenigstens blieb ihr jetzt noch Zeit, bis zum Treffen mit Leni etwas sehr Wichtiges zu erledigen. Sie wollte ein Geschenk für ihren kleinen Bruder kaufen.
In einem Eckhaus in der Bahnhofstraße lag das größte Spielzeuggeschäft der Stadt. Gundula hatte schon oft vor den Fensterscheiben gestanden und sich die Nase plattgedrückt. Es gab immer die herrlichsten Dinge zu sehen – Puppenkarussells, elektrische Eisenbahnen, Flugzeuge, Schaukeln, Fahrräder und wunderbar angezogene Puppen mit Klappaugen und lockigem Haar.
Aber heute hatte Gundula es eilig. Sie warf nur im Vorbeigehen einen flüchtigen Blick in die Schaufenster, öffnete dann sofort die Ladentür, die bei ihrem Eintritt sanft klingelte.
Das Geschäft war jetzt, um die Mittagszeit, ziemlich leer. Nur im Hintergrund des Raumes standen zwei Verkäuferinnen in blauen Kitteln und schwätzten miteinander.
„Guten Tag!“ grüßte Gundula laut und vernehmlich.
Dennoch dauerte es noch eine Zeit, bis die Verkäuferinnen sich entschließen konnten, ihr Geplauder zu unterbrechen. Sie trennten sich mit einem vergnügten Gelächter, und die größere, eine dunkelhaarige junge Frau, kam auf Gundula zu. „Na, Kleine, was wünscht du denn?” fragte sie herablassend.
Gundula ärgerte sich. Sie haßte es, wenn man Kleine zu ihr sagte. Schließlich war sie kein Baby mehr.
„Ich möchte ein Geschenk für meinen Bruder kaufen“, erklärte sie hocherhobenen Hauptes, „ein Geburtstagsgeschenk!“
„Ach so“, sagte die Verkäuferin, „wie alt wird denn der Kleine?“
Gundula zog es vor, diese Frage nicht zu beantworten; es schien ihr zu dumm, der Verkäuferin zu erklären, daß der Bruder gerade heute erst auf die Welt gekommen war. „Sieben Mark und fünfundachtzig kann ich ausgeben“, sagte sie statt dessen.
„Na, das ist ja schon ganz schön.“ Die Verkäuferin ging voran zu einem der Tische. „Hat dein Bruder schon eine Anlage für eine elektrische Eisenbahn?“ fragte sie.
Gundula schüttelte den Kopf.
„Wie wär’s dann mit einer Eisenbahn zum Aufziehen? Sehr hübsch, paß mal auf!“
Die Verkäuferin holte einen Karton unter der Theke hervor, packte eine kleine Lokomotive aus, zog sie mit einem Schlüssel auf; sie zeigte Gundula einen kleinen Hebel. „Siehst du, hier kann man sie verstellen … man kann sie immer im Kreis herumlaufen lassen oder auch geradeaus oder in einer großen Kurve, verstehst du?“
Gundula nickte eifrig.
Die Verkäuferin stellte die Lokomotive auf den Boden, surrend setzten sich die Räder in Bewegung. Das kleine Fahrzeug sauste los, prallte auf der gegenüberliegenden Seite gegen einen anderen Verkaufstisch, blieb brummend stehen.
„Gar nicht so einfach“, sagte die Verkäuferin und holte die Lokomotive zurück, „ich glaube, ich habe sie falsch eingestellt … aber dein Bruder wird das sicher schon ’rausbekommen. Jungens verstehen mehr von so etwas.“
Gundula entschloß sich, die Lokomotive zu nehmen.
„Zu Weihnachten oder zum nächsten Geburtstag kannst du deinem Bruder dann noch einen Anhänger dazukaufen“, sagte die Verkäuferin, „das heißt, wenn sie noch heil ist.“
Als Gundula mit dem Paket unter dem Arm das Spielzeuggeschäft verließ, fühlte sie sich sehr stolz und glücklich. Eine Eisenbahn war lange Jahre ihr heißester Wunsch gewesen, aber der Vater hatte immer gesagt: „Das ist kein Spielzeug für Mädchen!“ – und so hatte Gundula verzichten müssen.
Kein Wunder, daß sie die kleine Lokomotive mit dem Hintergedanken gekauft hatte, auch mal selber damit spielen zu können. Aber das wichtigste war doch, daß sie überzeugt war, ihrem Brüderchen damit eine riesengroße Freude zu machen. Ha, der würde staunen! Nicht jeder kleine Junge bekam, kaum daß er auf der Welt war, eine richtige Lokomotive zum Aufziehen geschenkt!
Fröhlich vor sich hinsummend lief Gundula, das Paket immer fest unter dem Arm, durch die Straßen der kleinen Stadt zum Schillerdenkmal, wo sie sich mit ihrer Freundin Leni verabredet hatte. Sie kam fast zwanzig Minuten zu spät. Leni wartete schon. Sie hatte sich die Zeit damit vertrieben, von einem Fuß auf den anderen zu hüpfen.
„Na endlich!“ rief sie und lief der Freundin entgegen. „Ich bin schon halb verrückt vor lauter Warten.“
„Wenns nicht schlimmer wird“, sagte Gundula gelassen, „halb verrückt warst du auch schon vorher.“
Leni sah Gundula mit gerunzelten Augenbrauen an. „Willst du Krach anfangen?“
„Nö …. warum?“
„Dann reiß gefälligst deine Klappe nicht so auf! Sag mal, was schleppst du denn da mit dir herum?“ Sie tippte mit dem Zeigefinger auf das Paket.
„Ich habe ’ne Kleinigkeit eingekauft“, erklärte Gundula selbstzufrieden, „für meinen kleinen Bruder, weißt du!”
„Was denn?“ fragte Leni. „Einen Schnuller? Oder ein Rässelchen?“
„Bei dir piepst’s wohl!“ rief Gundula empört.
„Aber wieso denn? Alle Babys haben Rässelchen, und die meisten …“
„Es interessiert mich nicht, was alle Babys haben!“ erklärte Gundula in ihrem hochmütigsten Ton. „Mein Brüderchen ist nicht wie alle Babys.“
„Woher willst du das denn wissen? Du hast es ja noch nicht einmal gesehen!“
„Weil es mein Brüderchen ist. Siehst du nicht den Unterschied?“
„Überhaupt nicht“, sagte Leni. „Aber jetzt verrat mir endlich mal, was hast du denn eingekauft?“
„Eine Lokomotive zum Aufziehen.“
„Toll!“ Leni war beeindruckt. „Pack doch mal aus“, bat sie, „ich möchte sie mir auch mal ansehen.“
„Etwa hier? Mitten in der Stadt?“
„Warum nicht? Weit und breit ist kein Mensch zu sehen!“
„Kommt nicht in Frage“, erklärte Gundula entschieden. „Du machst sie doch bloß kaputt. Komm jetzt lieber, sonst schaffen wir’s nicht mehr.“
Sie setzten sich in Trab.
Leni mußte sich beeilen, um an Gundulas Seite zu kommen. Bis zum Marienkrankenhaus, wo Frau Berendt und das Brüderchen lagen, waren es zehn Minuten zu Fuß. Unterwegs berieten sie unentwegt mit großer Zungenfertigkeit ihren Schlachtplan. Auf der Brücke blieben sie einen Augenblick stehen, spuckten ins Wasser hinunter und rannten dann weiter.
Das Krankenhaus war ein mächtiger, sehr moderner Bau mit einer großen Empfangshalle, in der es eine Tafel gab, an der man sich über die Lage der einzelnen Abteilungen orientieren konnte.
Gundula und Leni stellten sich, die Hände auf dem Rücken, vor dieser Tafel auf und versuchten, sich zurechtzufinden.
Der Pförtner, ein weißhaariger Mann, der hinter einer Theke von schönem, gemasertem Holz saß, wurde auf sie aufmerksam. „Wo wollt ihr denn hin, Kinder?“ fragte er.
„Zu meinem Onkel!“ sagte Leni sofort.
„Na, und wie heißt dein Onkel?“
„Onkel Paul!“ sagte Leni. „Er liegt auf Zimmer 113 …“
„Na, du weißt aber schon ganz gut Bescheid! Warst du schon mal da?“
„Ja“, sagte Leni, „man muß erst geradeaus gehen und dann links …“
„Richtig. Und dann immer weiter geradeaus, bis es nicht mehr weitergeht, dann rechts abbiegen …“
„Danke“, sagte Leni mit einem kleinen Knicks. „Jetzt erinnere ich mich schon wieder.“ Sie stupste Gundula in die Seite.
Die beiden Mädchen faßten sich bei der Hand und zogen artig, nicht zu schnell und nicht zu langsam, los.
Erst als sie aus der Sichtweite des Pförtners waren, tuschelte Leni der Freundin zu: „Weißt du jetzt, wo es ist?“
Gundula nickte eifrig. „Ja, Wöchnerinnenstation hat mein Vater gesagt. Das ist im dritten Stock ganz rechts!“
„Na, dann los!“
Sie wagten nicht, den Aufzug zu benutzen, rannten lieber die drei Treppen zu Fuß hoch, standen dann ziemlich hilflos in einem langen, gewinkelten Gang mit vielen, vielen Türen. „Was jetzt?“ fragte Leni.
„Immer rechts“, behauptete Gundula. „Nur keine Aufregung, wir finden es schon.“
„Hoffentlich“, sagte Leni sorgenvoll. „Wenn wir bloß jemanden fragen könnten!“
„Untersteh dich!“
Sie gingen weiter und weiter, rechts herum und noch einmal rechts herum – und plötzlich wußten sie nicht, wo sie überhaupt waren.
Sie blieben stehen, sahen sich erschrocken an.
„Was nun?“ fragte Gundula.
„Nichts wie zurück!“ Leni hatte sich schon umgedreht. „Jetzt müssen wir zusehen, wie wir hier wieder herauskommen.“
„Ohne mich.“ Gundula blieb stehen.
„Du willst nicht …?“ fragte Leni.
„Fällt mir gar nicht ein. Ich bin hierhergekommen, um mein Brüderchen zu sehen … und bis ich das nicht geschafft habe, bringen mich keine zehn Pferde hier weg.“
„Gundel, bitte, nimm doch Vernunft an! Wenn du mir wenigstens sagen könntest, in welche Richtung wir weitermüssen!“
„Du kannst ja zurückgehen, wenn du willst!“ Ohne abzuwarten, wie Leni sich entschied, ging Gundula mit großen Schritten weiter geradeaus. Aber innerlich war ihr gar nicht wohl zumute. Sie fühlte sich genauso unsicher wie Leni, aber sie wollte es nicht zugeben.
Leni folgte der Freundin zögernd in einiger Entfernung. Sie hatte große Lust, das ganze Abenteuer aufzugeben, aber sie traute sich allein nicht zurückzugehen; sie wußte ja nicht einmal mehr, wo die Treppe war.
Plötzlich blieb Gundula wie angewurzelt stehen.
„Was ist?“ fragte Leni.
„Ganz still! Horch mal!“ Gundula hob die Hand.
Auch Leni spitzte jetzt ihre Ohren. Wirklich, sie hörte etwas – ein ganz feines Geschrei aus einiger Entfernung.
Gundula strahlte von einem Ohr bis zum anderen. „Das ist es“, sagte sie, „mein Brüderchen. Los … komm! Laufen wir! Jetzt finden wir es bestimmt!“
Sie eilten den Gang entlang und um die Ecke, das Geschrei wurde immer lauter, und endlich stellten sie fest, daß es aus einer breiten Tür mit einem großen Glasfenster kam. Sie hoben sich auf die Zehenspitzen und reckten die Köpfe, um durch das Fenster in das Zimmer hineinsehen zu können, aber das Glas war zu hoch.
„Halt still!“ sagte Gundula entschlossen. „Laß mich auf deine Schultern klettern. Nachher bist du dran!“
Leni machte aus den gefalteten Händen einen Korb für Gundula, die schon ihr Bein hob, um hineinzusteigen – als die beiden Mädchen plötzlich eine Stimme hinter sich hörten.
„Hallo … was habt denn ihr hier zu suchen?“
Sie fuhren herum und sahen erschrocken in das blasse Gesicht einer jungen Krankenschwester.
„Wir … nichts! Nur …“ stotterte Gundula.
Sie tauschte einen raschen Blick mit Leni, dann drehten sich beide auf dem Absatz um und stürmten davon.
Aber die Schwester dachte nicht daran, sie so einfach entwischen zu lassen. Sie hob ihre langen schweren Röcke ein wenig und rannte hinter ihnen her.
Hintereinander sausten Gundula, Leni und die Krankenschwester wie die Wilde Jagd durch die stillen Gänge.
Dann passierte es. Das Linoleum war sehr glatt, und als Gundula gerade wieder um eine Ecke sausen wollte, rutschte sie aus und fiel der Länge nach zu Boden. Leni konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und stolperte über sie.
Die Schwester mußte ihnen wieder auf die Beine helfen. Vorsichtshalber hielt sie die beiden gleich hinten beim Kragen fest, während sie mit ihnen sprach. „Also …, was habt ihr hier zu suchen?“
Gundula war den Tränen nahe. „Ich …“ sagte sie mit kläglicher Stimme, „ich wollte doch nur mein Brüderchen sehen!“
„Ach so!“ Die Schwester blickte streng, aber um ihren Mund spielte ein Lächeln. „Das habe ich mir fast gedacht. Wie heißt denn dein Brüderchen?“
„Michael Sebastian. Darf ich es sehen? Wollen Sie es mir zeigen?“
Die Schwester schüttelte den Kopf. „Nein, das geht nicht …“ sagte sie und fügte dann bedauernd hinzu: „Leider. Es wäre gegen die Vorschriften.“
„Bitte, bitte, liebe Schwester, helfen Sie mir doch! Ich möchte es so gern sehen!“
„Das glaube ich dir schon. Aber ich darf es euch nicht zeigen. Ihr müßt ein bißchen Geduld haben. Ja, ich weiß, es ist vielleicht nicht so einfach … aber man muß viel Geduld im Leben haben. So ist es nun einmal. Wie heißt denn deine Mutter? Soll ich ihr einen Gruß von dir bestellen?“
„Lieber nicht … nein, sie würde sicher schimpfen.“
„Na schön, dann werde ich euch jetzt hinunterbringen. Oh, ich weiß schon, daß ihr auch allein gehen könnt, aber mir ist es doch lieber, ich bringe euch selber nach draußen.“
Die Schwester führte Gundula und Leni zum Aufzug. Überrascht stellten sie fest, daß es gar nicht sehr weit war. Dann fuhren sie alle zusammen nach unten, und die Schwester ließ es sich nicht nehmen, sie bis in die Empfangshalle hinauszubringen.
„Herr Lehmann“, sagte sie zu dem Pförtner, „bitte, schauen Sie sich diese zwei mal sehr gut an! Sie haben versucht, sich einzuschmuggeln … nein, ich mache Ihnen gar keinen Vorwurf, das konnten Sie ja nicht wissen. Aber schauen Sie sie gut an … ein zweites Mal möchte ich sie nicht einfangen müssen.“
Mit gesenkten Köpfen trabten Gundula und Leni davon. Es war ihnen gar nicht wohl zumute.
„Warum hast du nicht wenigstens dein Geschenk abgegeben?“ fragte Leni, als sie schon fast über der Brücke waren. „Die Schwester hätte es doch sicher …“
„Nein“, unterbrach Gundula sie, „mein Geschenk will ich meinem Brüderchen selber geben. Ich muß doch sehen, was es für Augen dazu macht.“
„Bist du noch traurig?“
„Nö“, behauptete Gundula. „Eigentlich … war’s nicht ganz lustig? Jedenfalls hätte ich nie gedacht, daß eine Krankenschwester so rennen könnte.“