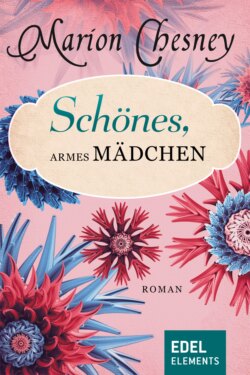Читать книгу Schönes, armes Mädchen - Marion Chesney - Страница 4
2
Оглавление»Ich weiß wirklich nicht, warum du diese Einladung angenommen hast«, sagte Joseph Chalmers ärgerlich zu seinem Freund, dem Marquis von Merechester. »Du magst doch Lady Warburton nicht, und jetzt erklärst du, du wüßtest nicht, ob die Jagd zur Zeit gut ist. Eine von ihren Töchtern muß es dir angetan haben.«
»Vielleicht«, sagte der Marquis beiläufig und steuerte das Gespann mit leichter Hand um eine enge Kurve. »Es ist Zeit, daß ich heirate.«
»Es wird Zeit für dich, mal ordentlich Spaß zu haben«, belehrte ihn Mr. Chalmers, raffte das Bärenfell enger um seine Beine und blickte säuerlich über die herbstlich grauen Felder. »Wie hast du dich abgerackert, um dein Land in guten Zustand zu bringen! Es ist Zeit, daß du dir etwas gönnst.«
»Ich habe mich nicht abgerackert«, erwiderte der Marquis milde. »Die Sache hat mir Freude gemacht. Was stellst du dir unter Spaß vor? Wein oder Gin saufen? Zu Hahnenkämpfen gehen?«
»Wie wär’s mit Theater, mit Bällen und Gesellschaften?«
»Auf dem Land bin ich auf Bällen und Gesellschaften gewesen.«
»Auf dem Land«, echote Mr. Chalmers verächtlich. »Was kann man auf dem Land schon groß tun! Auf rohen Bretterböden zum Klamauk der Dorfmusik tanzen, stundenlang müde Konversation mit Großgrundbesitzern treiben, Bäume und Felder und Vögel anschauen. Aber zurück zum Zweck deines Besuchs«, fuhr er fort. »Der Name Warburton erinnert mich an etwas.«
»Ich war einmal mit Amaryllis Duvane verlobt«, sagte der Marquis sachlich. »Lady Warburton ist ihre Tante.«
»Oh, tut mir leid, mein Lieber. Hatte ich ganz vergessen. Sie verließ dich, nicht wahr?«
»Stimmt.«
»Und was wurde aus ihr? Sir James hinterließ ihr nicht einen Penny.«
»Weiß ich nicht, und ist mir auch völlig egal«, erwiderte der Marquis. »Miss Duvane gab mir zu verstehen, sie wolle sich einen reichen Mann suchen. Und das hat sie wohl auch getan.«
»Du hast dich nicht bei Lady Warburton nach ihr erkundigt?«
»Ich doch nicht. Das ist alles vorbei. Wahrscheinlich hat sie schon einen ganzen Stall voller Kinder.« Sein Ton verriet eine gewisse Bitterkeit.
Mr. Chalmers neigte den Kopf zur Seite. »Offenbar tut es dir immer noch weh. Warum also dieser Besuch?«
»Ich bin käuflich geworden, wenn du so willst«, sagte der Marquis kühl. »Ich möchte heiraten und Söhne haben. Die Töchter der Warburtons sind nicht unangenehm, und jede kriegt eine schöne Mitgift. Ich möchte nicht, daß meine Güter noch einmal in den jammervollen Zustand kommen, in dem sie waren, als ich sie erbte. Meine Pächter sollen nicht mehr fürchten, verhungern zu müssen. Der Weizenpreis ist im Augenblick außergewöhnlich hoch. Wenn der Krieg mit Napoleon vorbei ist, wird er wieder heruntergehen, und wir kriegen schwierige Zeiten. Wenn jemand sich nicht um seine Pächter und sein Land kümmert, ist das eine Schande. Das Leben in London gibt mir nicht viel. Leute, die ihre Güter an Spieltischen verjubeln – so etwas finde ich furchtbar.«
Verstohlen musterte Mr. Chalmers seinen Freund. Ein harter Zug war in das Gesicht des Marquis getreten.
»Ziemlich streng bist du geworden, John, muß ich sagen« , seufzte er. »Es gab eine Zeit, da waren wir beide ganz schön leichtsinnig.«
»Wir waren jung«, entgegnete der Marquis.
Mr. Chalmers verstummte. Da der Marquis seinen Reisewagen selbst steuerte, saßen die beiden auf dem Kutschbock.
Wie der Marquis war auch Mr. Chalmers unverheiratet. In den letzten Jahren hatten sie sich nicht sehr häufig gesehen. Mr. Chalmers hatte mit seinem Regiment in Spanien gekämpft und einen Schuß ins Bein abbekommen. Er hinkte leicht.
Er war ein angenehmer Mann mit unauffälligen Zügen, einer breiten Brust und kräftigen Schultern. Beeinträchtigt wurde seine Erscheinung durch seine spindeldürren Beine, deren er sich ungemein schämte. Unter drei Paar übereinandergezogenen Strümpfen trug er künstliche, aus Holz gefertigte Waden.
In der Gegenwart des Marquis war ihm jetzt nicht sehr wohl. John ist überaus ernst geworden, dachte er. Immer noch zeigt er einen trägen Charme, aber unter diesem dünnen Firnis verbirgt sich eiserne Härte. Mr. Chalmers erinnerte sich noch gut an die Zeit, als der Marquis mit Miss Duvane verlobt war. Als er ihn wegen deren Mitgift aufzog, hatte der Marquis voll Inbrunst erwidert: »Und wenn sie keinen einzigen Penny hätte, ich würde sie dennoch heiraten.« Nun ja, die Zeiten hatten sich geändert. Nichtsdestoweniger war es enttäuschend zu sehen, wie die Warmherzigkeit seines Freundes sich in kalten, berechnenden Zynismus verwandelt hatte.
Graue Wolken zogen über den Himmel. Eigentümlich baumlos war jetzt die Landschaft. Die bebauten Felder waren öden Mooren gewichen, aus denen da und dort runde, schwärzliche Teiche schimmerten. Ein paar Schafe weideten zwischen hohen Grasbüscheln, und ein kalter Wind strich über die düstere Landschaft.
Sie waren an eine Steigung gekommen. Auf dem höchsten Punkt hielt der Marquis das Gespann an und deutete nach links. »Das muß Patterns sein«, sagte er.
In einem kleinen Tal konnten sie zwischen Bäumen hohe Tudor-Kamine ausmachen, aus denen dünner Rauch aufstieg.
»Ah«, sagte Mr. Chalmers, »diese kalte Luft hat mich richtig hungrig gemacht. Ist dir übrigens nie der Gedanke gekommen, daß Miss Duvane unter den Gästen sein könnte?«
»Nein«, antwortete der Marquis. Doch im gleichen Augenblick wußte er, daß er log. Seit er in dem Kaufhaus in London die unscheinbare Begleiterin der Töchter von Lady Warburton gesehen hatte, hatte er von Amaryllis geträumt. Bei Gott! Wie er sie geliebt hatte! Er hatte geglaubt, daß sie seine Gefühle erwidere. Doch wie sie ihn leichthin zurückgewiesen hatte, das würde er nie vergessen. Nun, einen reichen Ehemann hatte sie wahrscheinlich gefunden, und der Marquis hoffte, daß es ihr so jämmerlich ging, wie sie es verdiente.
Als seine Kutsche die Zufahrt zu Patterns hinaufrollte, hatte er sich eingeredet, der einzige Grund seiner Annahme der Einladung sei, daß er eine reiche Mitgift einsacken könne. Der Zynismus des Gedankens gefiel ihm. Frauen waren berechnend, grausam und gnadenlos. Unglücklicherweise konnte man ohne diese Geschöpfe keine Familie gründen. Daraus folgte, daß ein vernünftiger Mann sich bereichern durfte, wenn er sich auf Lebenszeit mit einer von ihnen verband.
Die einzigen Frauen, deren Gesellschaft er mochte, waren die Damen der Halbwelt, die keine Heirat erwarteten und ohne falsches Geziere bereit waren, ihre Gunst um Geld zu verkaufen.
Aus Gedanken wie diesen gewann er gewöhnlich Trost. Doch dieses Mal wollte es nicht gelingen. Die Freundlichkeit des Empfangs durch die Familie Warburton vermochte seine Melancholie nicht zu zerstreuen. Seine gut ausgestatteten Zimmer kamen ihm wie ein Gefängnis vor, und er wünschte sich, irgendwo anders zu sein. Mit den anderen Gästen war er kurz bekanntgemacht worden. Eine Amaryllis Duvane war nicht darunter gewesen, und das war ein Trost, wie er sich sagte.
Da er wußte, daß man auf dem Land manchmal sehr modebewußt war, wies er seinen Diener an, entsprechende Kleidung bereitzulegen. Während er seine Krawatte band und der Diener ihm in das blaue Seidenjackett half, faßte er den Entschluß, seinen Besuch, in dem er jetzt keinen Sinn mehr sah, so bald wie möglich zu beenden.
Mr. Chalmers kam herein und musterte seinen Freund. »Sehr schön, John«, gutachtete er. »Du wirst alle Herzen brechen.«
Im Licht der zwei großen Kerzen auf dem Toilettentisch schimmerte das Haar des Marquis wie mattes Gold. Die Farbe seines Jacketts paßte zum tiefen Blau seiner Augen. Seine Kniehose spannte sich faltenlos über seine muskulösen Schenkel, und seine Zierstrümpfe ließen wohlgeformte Waden erkennen, angesichts derer Mr. Chalmers vor Neid erblaßte.
Der Marquis stöberte in seinem Schmuckkästchen herum, holte eine Diamantnadel heraus und befestigte sie an seiner Krawatte. Er wählte mehrere Ringe, streifte sie über seine langen weißen Finger und steckte dann eine Schnupftabaksdose in die Tasche seines Jacketts.
Die Gesellschaft hatte sich im Salon versammelt. Außer den beiden Schwestern waren keine jungen Damen anwesend. Einige Mitglieder der Aristokratie der Umgebung waren da, daneben eine farblose Frau, die mit ihrer Näharbeit in einer Ecke saß.
Eine arme Verwandte, dachte der Marquis grimmig. Jede gute Familie hatte eine.
Er plauderte gerade mit Sir Gareth Evans, dem Amtsrichter, der sich über Einzelheiten des Jagdrechts verbreitete, als er bei den Schwestern, deren Blicke ständig zwischen ihm und der farblosen Frau in der Ecke hin- und hergingen, eine Art unterdrückter, boshafter Erregung bemerkte.
Dann verkündete der Butler, es sei aufgetragen. Die Damen gingen paarweise in der Reihenfolge ihres Ranges voran. Die Herren folgten, angeführt von Lord Warburton und dem Marquis.
Irgend etwas veranlaßte den Marquis, den Kopf zu wenden, als er im Begriff war, den Salon zu verlassen. Die arme Verwandte sollte offenbar nicht bei Tische dabei sein.
Als hätte sie seinen Blick gespürt, sah sie auf, senkte die Augen aber gleich wieder.
Die Gedanken des Marquis überschlugen sich, als er an der Seite Lord Warburtons aus dem Salon schritt. Einen verrückten Augenblick dachte er, das traurige Geschöpf könne Amaryllis sein. Erinnerungen an sie stiegen in ihm auf. Er glaubte sie vor sich zu sehen wie in jenen glücklichen Tagen, sah den Schimmer ihres kastanienbraunen Haars über dem schönen Gesicht, empfand von neuem ihren Charme und ihre Vitalität. Energisch schüttelte er den Kopf, als wollte er sich damit des plötzlichen Schmerzes entledigen, den dieses Bild ihm verursachte.
Einschließlich des Marquis und Mr. Chalmers’ bestand die Gesellschaft aus einem Dutzend Personen.
Das Speisezimmer war in pastellgrünen Farbtönen gehalten. Porträts der früheren Besitzer blickten von den Wänden herab. Der Marquis fragte sich, ob Warburton sie als seine Vorfahren ausgab.
Er saß rechts von Lady Warburton. Lady Evans war zu seiner Linken plaziert, Cissie und Agatha in der Mitte der Tafel. Was sie sagten, konnte er nicht verstehen, aber er bewunderte ihr Aussehen. Beide trugen prächtige Kleider, die so geschneidert waren, daß sie ihren vollen Busen betonten und die Dicke ihrer Taille kaschierten.
Die Speisen waren aufs phantasievollste dekoriert. Pasteten in Form von Wildvögeln wurden aufgetragen, frischer Kabeljau als Salat und Sellerie in Austerngestalt.
Lady Evans, so war zu hören, stammte aus Boston und war frisch verheiratet. Sir Gareth war ihr dritter Ehemann. Sie sei schockiert, erklärte sie, daß es am Samstagabend so viele Festivitäten gebe. In Neuengland sei das eine geheiligte Zeit, beschied sie den Marquis. Mit einem strengen Blick auf die Pracht seines Seidenjacketts erläuterte sie sodann die Vorzüge demokratischer Kleidung.
In Washington, so berichtete sie dem Marquis, sitze der Präsident des Repräsentantenhauses ohne Robe und Perücke auf seinem Amtsstuhl, und die Würdenträger dieser rasch wachsenden Metropole begnügten sich damit, ein leichtes Baumwolljackett ohne Halstuch und manchmal ohne Weste zu tragen. Dies führe allerdings immer wieder zu Diskussionen, wie sie hinzufügte; manche Ältere beklagten diese Nachlässigkeit.
»Nun«, sagte der Marquis friedfertig, »es ist eben, wie Talleyrand formulierte: ›In Amerika ist noch alles im Fluß, sogar das Klima.‹«
Lady Evans lachte. »Die Mode ist bei uns ein Politikum geworden. Die Barbiere sind alle Anhänger der Föderalisten, weil deren Führer lange, gepuderte Zöpfe tragen. Die Demokraten hingegen haben kurzes Haar oder kleine, nachlässig mit einem Band geflochtene Zöpfe.«
Amüsiert begann der Marquis Lady Evans über Amerika auszufragen. Wenn sie über ihr Heimatland redete, lockerte sich ihre sonst so gestrenge Miene.
Aber bald bemerkte der Marquis, daß Lady Warburton sich um seine Aufmerksamkeit bemühte.
»Meine Töchter haben sich sehr auf Ihr Kommen gefreut, Mylord«, sagte sie.
»Ich fühle mich sehr geschmeichelt«, erwiderte er. Sollte er sich nach Amaryllis erkundigen? Oder war es besser, wenn er nichts wußte?
»Nach dem Dinner haben wir ein Tänzchen geplant. Vielleicht werden Sie uns mit Ihrer Gesellschaft beehren, Mylord«, fuhr Lady Warburton fort. »Natürlich gibt es Tanzkarten.«
»Ich tanze nicht«, sagte der Marquis, plötzlich etwas gereizt. Schalkhaftigkeit stand Lady Warburton weniger gut.
Die Dame des Hauses war sichtlich verstimmt. »Aber wir haben eigens Musiker engagiert«, beklagte sie sich. »Wir haben uns in große Unkosten gestürzt.«
Unbeeindruckt sah der Marquis sie an. Sie errötete ärgerlich. »Nicht daß ich versuchte, Sie zu erpressen…«
»Das hoffe ich aber auch wirklich, Mylady«, entgegnete der Marquis. Erneut wandte er sich Lady Evans zu. »Wie geht es in Washington mit dem Bauen voran?« fragte er. »Soweit man hört, ist die Pennsylvania Avenue das einzige, was einer Straße ähnlich sieht…«
Lady Warburton durchbohrte ihn mit dolchscharfen Blicken. Jeden Penny, den sie ausgab, betrachtete sie als eine Art Investition. Rasch überschlug sie die Kosten der Unterbringung der Gäste, der Kleider der Mädchen – Gott sei Dank war Amaryllis so geschickt mit der Nadel! –, der Bewirtung und des kleinen Orchesters. Aber sie konnte den Marquis schwerlich zwingen, sich ein wenig zu amüsieren.
Die Art, wie Cissie und Agatha ihre blauen Augen zu dem Marquis hinrollten, war einfach zu auffallend; sie mußte mit ihnen darüber reden.
Amaryllis hatte sie kalt beschieden, im Salon zu verweilen, bis die Gäste ihr Dinner beendet hatten. Ein bißchen Fasten tat ihr ganz gut, dachte sie – nicht daß sie, von Speise und Trank über Gebühr beflügelt, den Platz vergaß, der ihr zukam. Sie ahnte nicht, daß sich Amaryllis in diesem Augenblick über eine Auswahl erlesenen. Fleisches hermachte, das ihr mitleidige Bedienstete auf einem silbernen Tablett in den Salon gebracht hatten.
Lady Warburtons Gedanken eilten weiter. Amaryllis war ja eine ausgezeichnete Pianistin und Sängerin und würde wohl irgendwann im Verlauf des Abends gebeten werden, die Gäste zu unterhalten. Aber es war nicht gut, wenn man ihr erlaubte, sich in irgendeiner Weise hervorzutun.
Nach dem Madeira und der Eisbombe erhob sich Lady Warburton, um die Damen in den Salon zu führen. Ein Stirnrunzeln über die Tafel hinweg signalisierte dem Gatten, er solle die Herren keineswegs ermutigen, sich ungebührlich lange bei ihrem Wein aufzuhalten.
Sie hatte sich entschlossen, Amaryllis für den Rest des Abends nach oben zu schicken, aber der Anblick ihrer bescheidenen Haltung und ihrer emsig nähenden Finger stimmte sie um. Amaryllis stellte keine Bedrohung mehr dar. Man brauchte sich nur die strahlende Schönheit von Cissie und Agatha vor Augen zu halten, um in dieser Hinsicht ganz sicher zu sein.
Lady Evans machte Anstalten, zu Amaryllis zu gehen, besann sich aber dann anders. Amaryllis war nicht vorgestellt worden, sie mußte also eine Art Dienstbotin sein.
Cissie und Agatha saßen da und gähnten apathisch. Außer Lady Evans waren noch zwei andere weibliche Gäste anwesend: Mrs. Johnston, eine schottische Dame unbestimmbaren Alters, und Mrs. Giles-Denton, deren Gatte, auch einer der Gäste, Vorstand des Jagdhundvereins war.
Die Herren gesellten sich nach einiger Zeit zu den Damen, und Agathas und Cissies Mienen hellten sich schlagartig auf. Neben dem Marquis, Mr. Chalmers, Mr. Giles-Denton und Sir Gareth Evans war auch der Pfarrer Peter Bascomb mit von der Partie.
Mehr und mehr ärgerte sich der Marquis über Lady Warburtons »Tänzchen«. Die einzigen, die so aussahen, als kämen sie für Tänze mit den Warburton-Töchtern in Frage, waren er selbst und Mr. Chalmers. Ein Versuch der Verkupplung also, wie er im Buche stand.
Fast gegen seinen Willen ging er auf die Stelle zu, wo die geheimnisvolle arme Verwandte über ihre Näharbeit gebeugt saß. Als die Kapelle zu spielen anhob, trat jedoch Lady Warburton zu ihm.
Der Salon öffnete sich am anderen Ende zu einem Saal. Dort hatte man den Teppich aufgerollt und den Fußboden mit Schneiderkreide gleitend gemacht.
»Kann ich Sie nicht überreden, daß Sie sich anders besinnen, Mylord?« fragte Lady Warburton mit einem Lächeln, das alle ihre Zähne entblößte. »Junge Männer sind hier bedauerlich knapp, und Cissie wird ganz unglücklich sein, wenn Sie ihr nicht einen Tanz schenken.«
Der Marquis schaute über Lady Warburtons beturbantes Haupt hinweg und sah mit Entzücken, daß der ältliche Pfarrer Cissie aufs Parkett führte. Sir Gareth und Lady Evans hatten sich zu ihnen gesellt; Mr. Chalmers geleitete Agatha, und Lord Warburton stapfte am Arm von Mrs. Johnston dahin.
»Sieht aus, als würde ich nicht benötigt«, lächelte der Marquis.
Lady Warburton warf dem Pfarrer einen Blick zu, der dem armen Mann eine unmittelbare Gefährdung seiner Existenz androhte.
James, der Diener, wählte genau diesen Augenblick, um mit einem Kuchentablett zu stolpern, und Lady Warburton schritt zu ihm, um ihn gebührend zu tadeln.
Durch sein Monokel beobachtete der Marquis die Tänzer. Cissie warf ihm ein behexendes Lächeln zu und geriet aus dem Rhythmus. Peinlich berührt wandte er sich ab. Sein Blick fiel auf die stille Gestalt in der Ecke. Er ging zu ihr. »Sie haben keine Lust, am Fest teilzunehmen?« fragte er, Amaryllis’ geschäftige Finger beobachtend.
»Nein, Mylord.« Ihre Stimme war kaum ein Flüstern.
»Was für einen Platz nehmen Sie in diesem Haushalt ein?« fragte er und wünschte plötzlich, sie würde aufschauen.
»Ich bin eine Verwandte, Mylord.«
»Lord Merechester!« Lady Warburtons Stimme klang schrill. »Ich hätte gern Ihr Urteil über eine Schnupftabaksdose, die mein Mann neulich gekauft hat.«
Der Marquis wandte den Blick nicht von dem gebeugten Kopf Amaryllis’.
»Sie haben mich dieser Dame nicht vorgestellt, Mylady«, sagte er.
Lady Warburton lachte bellend. »Eine Vorstellung ist da kaum nötig, denke ich.«
Mit geschärften Sinnen sah er die arme Verwandte an. Die hatte zu nähen aufgehört und breitete nervös den Stoff über ihre Knie.
Fast tonlos sagte er: »Das kann doch nicht wahr sein… Amaryllis.«
Sie schaute auf. Er blickte auf das schmale, blasse, bedrückte Gesicht hinunter, starrte in die großen grauen Augen, in denen einst jugendliches Feuer gefunkelt hatte und die nun gewollt ausdruckslos waren.
»Mylord«, sagte Amaryllis, »verzeihen Sie mir, daß ich nicht aufstehe, um Sie zu begrüßen, aber diese Näharbeit hier…«
»Natürlich«, unterbrach er sie rasch. Sich umwendend, gewahrte er, wie Lady Warburton die Szene gespannt verfolgte. »Entschuldigen Sie uns, Mylady«, sagte er mit fester Stimme.
Lady Warburton rauschte davon.
Er holte sich einen Stuhl und setzte sich zu Amaryllis. Die Kapelle spielte flotte Weisen. In früheren Tagen war er manchmal so bei ihr gesessen, hatte ihr schönes Gesicht betrachtet und sich gefreut, weil er glaubte, von ihr geliebt zu werden und der glücklichste aller Männer zu sein. »Wie kommt das?« fragte er. »Sie haben also keinen reichen Mann gefunden?«
»Nein«, erwiderte Amaryllis und senkte den Blick.
»So steht es also jetzt«, stieß er hervor. »Die arme Verwandte! Haben Sie denn keinen Stolz? Hätten Sie keine anderen Möglichkeiten gehabt?«
»Nein, Mylord«, entgegnete Amaryllis scheinbar ruhig. »Ich versuchte eine Stellung zu finden, aber ohne Erfolg. Ich hatte keine andere Wahl.«
»Außer mir«, sagte er bitter. »Und diese traurige Existenz ist Ihnen lieber, als mich zu heiraten? Manchmal quälte ich mich mit dem Gedanken, daß Sie mich wirklich geliebt und nur aus mißverstandenem Stolz fortgeschickt haben. Aber keine Frau, die einen Funken Stolz hat, könnte so ein Leben ertragen. Ich bin froh. Sie verdienen es nicht anders.«
Amaryllis zuckte zusammen.
»Sehen Sie sich nur an! Übermüdet und abgespannt, alt vor der Zeit. Die alte Jungfer, die beim Kamin sitzt. Eine unbezahlte Bedienstete.«
»Hören Sie auf!« Amaryllis standen die Tränen in den Augen.
»Warum sollte ich aufhören? Das ist das letzte Mal, daß ich mit Ihnen rede. Also muß ich jetzt alles, was zu sagen ist, sagen. Ich bin hier, um mich nach einer reichen Partie umzusehen. Eine der Warburton-Schwestern wird es wohl werden – welche, ist mir ziemlich egal.«
»Sie haben sich verändert«, sagte Amaryllis mit leiser Stimme. »So gefallen Sie mir nicht.«
»Meine liebe, arme Verwandte, es steht Ihnen nicht zu, Mißfallen über etwas zu äußern. Ich bin nicht mehr der arme Marquis von Merechester, ich bin sehr, sehr reich…«
»Und sehr, sehr aufgeblasen«, erwiderte Amaryllis erbost. Sie starrte ihn an; vor Zorn war sie rot geworden, und ihre Augen funkelten.
In diesem Augenblick war der Tanz zu Ende, und Agatha und Cissie hüpften herbei. Alles an ihnen hüpfte, von ihrem großen Busen bis zu ihren fettig glänzenden Löckchen.
»Ammy«, rief Cissie, »lauf und hol mir sofort meinen Fächer, du faules Ding! Lieber Lord Merechester, Mama sagt, Sie wollen nicht tanzen. Können wir Sie nicht überreden?«
Der Marquis war aufgestanden, als die Schwestern kamen. Hinter ihm erhob sich Amaryllis eilends und schlich hinaus.
»Nur Schönheiten wie Sie könnten mich herumkriegen«, lachte der Marquis, aber seine Augen lachten nicht mit.
Mit Agatha am einen und Cissie am anderen Arm schlenderte er zum Salon, wo die Kapelle sich anschickte, zum nächsten Tanz aufzuspielen.
Amaryllis ließ den Nähkorb in ihrem Zimmer, schlüpfte in einen warmen Mantel, ging die Treppe wieder hinunter und schlüpfte durch eine Hintertür aus dem Haus. Sie wußte, daß Lady Warburton bei erster Gelegenheit nach ihr sehen würde, doch konnte sie ein Zusammentreffen mit ihr jetzt nicht ertragen. Cissies Fächer zu suchen, daran dachte sie nicht.
Es war ihr, als hätte sie einen Kloß im Hals, und ihr Herz pochte laut. Draußen schimmerte Reif auf dem Gras, und ein kleiner, kalter Mond stand am schwarzen Nachthimmel. Sie setzte sich auf eine marmorne Bank und versuchte, ihre Gedanken zu ordnen.
Wie hatte er sich verändert! Kalt und aufgeblasen war er geworden. Was hätte sie denn anderes tun sollen? Wohin hätte sie gehen sollen? Hätte es irgendeine Möglichkeit gegeben, Amaryllis hätte sie sicher genutzt.
»Wirklich?« meldete sich die Stimme ihres Gewissens.
Ihr erster Versuch, sich Unabhängigkeit zu verschaffen, hatte in einer solchen Katastrophe geendet, daß sie nur zu froh war, wieder zu den Warburtons zurückkehren zu können. Trotzdem, hätte sie es nicht nochmal versuchen müssen?
Damals war sie jung und hübsch gewesen. Jetzt war sie älter, und ihre Schönheit hatte sie eingebüßt. Aber mußte sich nicht irgendeine Familie, irgendeine Anstalt glücklich preisen, sie als Erzieherin engagieren zu können?
Sie stand auf und ging nervös hin und her; der Saum ihres langen Mantels glänzte, wo er über das eisige Gras gestreift war, von Reif.
Lautes Gelächter drang aus dem Haus, und sie merkte, daß sie nahe bei den Fenstern des Tanzsaals war.
Über ausgetretene Stufen stieg sie zu der Terrasse hinauf, die an der Rückfront des Hauses verlief.
In einem der Fenster bemerkte sie einen schmalen Lichtspalt; der schwere Vorhang war nicht ganz geschlossen. Sie ging hin und schaute hinein.
Wie fröhlich alle dort drinnen aussahen!
Der Marquis tanzte mit einer strahlenden, lachenden Cissie im Arm. Sie sagte etwas zu ihm, und er schaute mit seinem trägen Lächeln auf sie herunter.
Amaryllis rang ihre Hände. Wenn sie es auch den Warburtons verübelte, daß sie sie so schäbig behandelten, so hatte sie ihnen gegenüber doch nie Neidgefühle empfunden. Jetzt aber beneidete sie Agatha und Cissie aus tiefstem Herzen. Ach, könnte sie noch einmal hübsche Kleider tragen und lachen und tanzen wie früher!
Der Tanz ging zu Ende. Der Marquis zog Cissies Hand an seine Lippen, und sie lächelte mit Grübchen in den Wangen zu ihm empor.
Nicht einmal geküßt haben wir einander… Amaryllis war verwundert bei diesem Gedanken.
Ihre Zärtlichkeiten hatten sich auf tiefe Blicke und Händchenhalten beschränkt. Obgleich sie die Tatsache, daß er sie wegen ihrer Mitgift heiratete, hingenommen hatte, hatte sie doch gehofft, seine Gefühle für sie würden sich in Liebe verwandeln. Sie erinnerte sich, wie sie bei Bällen zusammengesessen hatten, um sich herum ihre eigene Welt. Jeder Blick war wie ein Kuß gewesen, jede Bemerkung wie ein Liebesbeweis.
Warum war er jetzt so verbittert? Er hatte sie nie geliebt. Hätte er sie geliebt, dann hätte er sie nicht so leicht gehen lassen.
All die Zuneigung, die sie bei ihm vermutet hatte, war nur eine Ausgeburt ihrer Phantasie gewesen. Und ohne ihn war sie besser daran, sagte sie sich zornig. Viel besser. Man brauchte nur zu sehen, wie hart er geworden war. Routiniert flirtete er mit Cissie, aber in seinem Tun lag fast etwas wie Verachtung.
Völlig gleichgültig ist er mir geworden, dachte Amaryllis und wandte sich vom Fenster ab. Sie ging über die Wiese davon, weg von der Musik, weg von Cissies schrillem Gelächter.
Der Schmerz in ihrem Herzen wollte nicht weichen.
Aber vielleicht war ihr Zorn der Grund, warum sie gerader ging als seit Jahren. Mit einer Bewegung voll unbewußter Anmut strich sie sich eine Locke aus dem Gesicht.