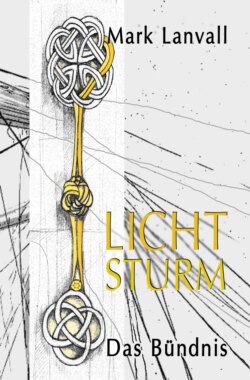Читать книгу Lichtsturm IV - Mark Lanvall - Страница 4
Die Anwärterin
ОглавлениеDer Blick der neuen Anwärterin folgte dem Flug des Graunacken-Bussards. Der kleine Raubvogel trotzte den schweren Regentropfen, die auch auf ihn niederprasselten, seine Flügel schwer machten. Er wirkte unentschlossen. Sicher hatte er den Geruch der Essensreste gewittert, der sich über das Lager ausgebreitet hatte. Und nun, so dachte die Anwärterin, fragte er sich vermutlich, ob er es riskieren konnte, hinabzukommen, um nach einem der Reste zu picken. Sie verstand sein Zögern nur zu gut. Dies war kein guter Ort. Für niemanden. Die alten, zerschlissenen Rundzelte hatten den Namen ‚Unterbringung‘ nicht verdient. Und die Elvan jal’Iniai, die darin wohnten, konnte man schwerlich als Soldaten erkennen. Am ehesten noch die Ausbilder, meist grobschlächtige, uniformierte Gestalten, deren ungehobeltes Auftreten ahnen ließ, warum sie nirgendwo anders eingesetzt waren. Die Übrigen waren meist ärmlich gekleidet, mit zerkratzten, einfachen Schwertern bewaffnet. Oder mit Armbrüsten, die stümperhaft konstruiert waren. Zusammengekauert saßen manche dieser Gestalten auf Steinen, schutzlos dem Regen ausgesetzt, trotzdem womöglich froh, dem stinkenden, engen Leben im Inneren der Zelte entkommen zu sein. Andere übten mit hölzernen Waffen, unter den anklagenden Schreien ihrer Schinder. Oder sie waren - so wie die Anwärterin - in einer Reihe angetreten, um den demütigenden Reden ihres Ausbilders zu lauschen. Der Graunacken-Bussard hatte sicher auch diese Reihe hoffnungsloser Gestalten gesehen und vielleicht daraufhin beschlossen, anderswo nach Nahrung zu suchen. Kluger Vogel, dachte die Anwärterin und senkte ihren Blick.
Rangnuwin, der Ausbilder, war bei ihr angekommen und starrte nun mit vor Zorn verzerrtem Gesicht auf ihre nackten Füße. Sie steckten bis zu den Knöcheln in einer schlammigen Pfütze. Die Anwärterin schaffte es, ein betretenes Gesicht zu machen und dabei sogar ein bisschen zu zittern. Natürlich jagte ihr der Ausbilder in Wahrheit keine Angst ein. Rangnuwin konnte ihr im Umgang mit der Waffe vermutlich nicht annähernd das Wasser reichen. Er sollte allerdings glauben, dass es anders war. Und das tat er.
„Trägst du deine Stiefel nicht, weil du denkst, wir werden heute fröhlich auf einer Wiese zusammensitzen und uns Abenteuergeschichten erzählen? Ist es das, was du glaubst?“
„Nein“, stammelte sie mit schwacher Stimme. „Ich besitze keine Stiefel.“
Es fiel der Anwärterin schwer, in ihrer Rolle zu bleiben. Für den Uniformierten, der wohl noch nicht einmal einen Offiziersrang bekleidete, konnte sie keine Achtung aufbringen. Nicht so sehr wegen seiner mangelnden Erfahrung. Dafür konnte er nichts. Aber Rangnuwin gehörte zu jenen, die es liebten, Macht über andere auszuüben - und sei sie auch noch so erbärmlich gering. Diesem Elvan jal’Iniai lag nichts an der Vervollkommnung von Fähigkeiten. Ihm lag daran, andere zu beherrschen und sie zu demütigen.
„Das heißt ‚Nein, Lehrmeister‘! Glaubst du, ich bin zu deiner Belustigung da?“
„Nein, Lehrmeister.“
Nicht aufschauen, sagte sie sich. Rangnuwin würde merken, wie sehr sie ihn verachtete und wie sehr sie ihm überlegen war.
„So ist es auch besser“, sagte der Ausbilder schroff. Zum Glück ließ er nun von ihr ab und schritt mit übertrieben festen Schritten die Reihe der insgesamt sieben Anwärter ab. Die Arme verschränkte er dabei wie ein Feldherr hinter dem Rücken.
„Denn solange ihr nicht auf Gorgoils oder eine Horde der barbarischen Abtrünnigen trefft, bin ich euer größter Feind. Ich werde euch erniedrigen, schleifen und euch dabei zu Soldaten Lysin’Gwendains formen. Und wenn mein Werk vollendet ist, dann werdet ihr mir dafür dankbar sein. Denn dann und nur dann tut ihr das, wofür ihr hierhergekommen seid, wofür wir Elvan jal’Iniai geschaffen sind: Wir töten, wir unterwerfen, wir herrschen.“
Einer in der Reihe streckte seine Faust zu Himmel und rief mit sich überschlagender Stimme. „Jawohl, Lehrmeister. So wird es sein!“
Ein Narr, dachte die Anwärterin. Der junge Kerl zählte wohl noch keine 50 Jahre. Er hatte ein schmales, wohlgeformtes Gesicht, strahlend große Augen und seidig glänzendes braunes Haar. Seine fein geschnittene Kleidung verriet ihn als Angehöriger der Oberschicht San’tweynas. Die Anwärterin wusste, dass sich in diesen Tagen viele junge Frauen und Männer aus reichen Familien für die Freilegion meldeten. Sie hatten sich vom Machtwahn Sardrowains anstecken lassen, suchten nach Abenteuern fernab des behüteten Elternhauses, in der Hoffnung, als ruhmreiche Krieger zurückzukehren. Wie dumm sie waren, dachte die Anwärterin. Die schlecht ausgebildeten Kämpfer der Freilegion waren die Ersten, die auf dem Schlachtfeld starben. Sie kämpften mit minderwertigen Waffen in vorderster Reihe, um die Stärke des Feindes zu testen, um mit ihrem Tod Zeit für die regulären Truppen zu erkaufen. Daran war nichts Ruhmreiches. Mehr Respekt als vor dem vorlauten Jungen hatte die Anwärterin vor denen, die sich für die Legion verpflichteten, um ihren Stand und ihr Ansehen im Volk zu verbessern. Ehemalige Sklaven etwa oder solche, die die Natur mit Missgestaltungen gestraft hatte. Eine Frau war dabei, deren Kiefer schräg hervorragte, deren Zähne wie umgeknickte Stacheln im Mund standen. Ein anderer hatte eine buckelige Schulter. In San’tweyna wurden solche Elvan jal’Iniai zwar geduldet, aber als zutiefst unvollkommen verachtet. Rangnuwin dagegen schienen sie gleichgültig zu sein. Der vorlaute Junge aber zog seinen Zorn um so heftiger auf sich.
„Ich kann mich nicht erinnern, dir das Wort erteilt zu haben, Bassai“, schrie der Ausbilder. Seine Stimme bebte, die porige Haut seines groben Gesichtes färbte sich rot. „Niemand, und ich wiederhole, niemand sagt hier auch nur eine Silbe, wenn ich es ihm nicht erlaubt habe. Habt ihr das verstanden?“
Bassai. Die Anwärterin hatte das Wort lange nicht mehr gehört. So wurden früher Schüler genannt, die auf dem Weg zur Vollkommenheit scheiterten, die erkennen mussten, dass der Pfad, den sie eingeschlagen hatten, der falsche war. Damals, vor so langer Zeit war das aber keine Schande und das Wort keine Beleidigung gewesen. Viele große Meisterin und Meister hatten sich in Fertigkeiten versucht, denen sie nicht gewachsen waren, bevor sie ihre Bestimmung schließlich fanden. Der Anwärterin war natürlich klar, dass Rangnuwin dagegen den Begriff ‚Bassai‘ verwendete, um den vorlauten Kerl zu treffen und zu verletzten. Womöglich kam er selbst aus einer der unteren Schichten und war von solchen aus der Oberschicht gedemütigt worden. Vielleicht rächte er sich nun dafür an dem noch immer überheblich grinsenden Kerl.
„Ja, Lehrmeister“, riefen die Anwärter im Chor.
Rangnuwin starrte den vorlauten Jungen noch einen Moment hasserfüllt an, dann stieß sein breiter Kopf urplötzlich nach vorne und rammte mit Wucht gegen die Stirn des Anwärters. Ohne einen Laut ging der zu Boden und blieb reglos liegen.
Ein zerstörerischer Stoß, wusste die Anwärterin sofort. Sie hatte das Geräusch erkannt, als die Köpfe aufeinandertrafen. Es war der Laut berstender Knochen. Sie widerstand der Versuchung, Rangnuwin den Hals umzudrehen und dem Jungen zu helfen. Damit würde sie sich verraten. Und das durfte sie nicht. Larinil war nicht hier, um Dummköpfe vor sich selbst zu schützen. Sie war hier, um jemanden zu finden.
Es war dunkel geworden im Lager. Der Regen hatte aufgehört, ebenso wie die tumben Kommandos der Ausbilder. Auch die letzten Anwärter hatten sich nun in die Zelte zurückgezogen - mit Ausnahme derer, die Wache schieben mussten. Manche schliefen, andere unterhielten sich leise im Schein kleiner Lichtkugeln. Der junge Dummkopf lag auf mehreren dicken Kissen, verborgen hinter einem Paravent, der in dieser Umgebung wegen seiner mit allerlei Tieren verzierten Leinwände grotesk wirkte. Er stöhnte, bevor er seine Augen aufschlug. Sofort umspielte wieder dieses überhebliche Lächeln seine Lippen.
„Ein schöneres Erwachen aus einem unschönen Traum hätte ich mir gar nicht vorstellen können“, sagte er und musterte Larinil von oben bis unten. Wie ein Stück Fleisch auf dem Markt. Die Kaijadan-Meisterin bereute einen Augenblick lang, dass sie dem Kerl gerade das Leben gerettet hatte. Sein Stirnknochen war gespalten gewesen. Blut hatte sich bereits im Kopf gestaut. Ohne ihre heilenden Kräfte wäre er in weniger als zwei Tagen zu Staub zerfallen. Larinil erwartete keine Dankbarkeit. Sie wollte Aufsehen vermeiden. Und ein Anwärter, der gleich am ersten Tag von seinem Ausbilder erschlagen wurde, hätte Aufsehen erregt. Außerdem fragte sie sich, ob er ihr vielleicht einmal nützlich werden konnte.
„Ich bin Silior aus dem Hause Wuladin. Und wer seid Ihr, schöne Dame?“
Wieder dieser unverhohlene Blick. Silior gab Larinil eine Vorstellung davon, wie sehr die Umgangsformen in San’tweyna in den letzten Jahrtausenden gelitten haben mussten. Auch sie war in der silbernen Stadt geboren worden und dort aufgewachsen. Damals allerdings waren sich Frauen und Männer noch mit Respekt, Höflichkeit und abwartender Distanz begegnet. Silior dagegen schien zu glauben, dass er sich stets nehmen konnte, was er wollte.
„Ich bin die, die dir soeben dein erbärmliches Leben zurückgeben hat. Was allerdings weniger als eine vergammelte Zerdrak-Frucht wert ist, wenn du Rangnuwin weiter so reizt.“
Silior hustete kurz und winkte dann ab.
„Er ist ein Nichts und wird schon bald herausfinden, was es bedeutet, sich mit dem Haus Wuladin anzulegen. Mein Onkel geht im Hagas’Harwun ein und aus.“
Larinil sah sich um. Diese Unterbringung hatte nicht die geringste Ähnlichkeit mit einem Palast. Sie selbst war zwar noch niemals im Hagas’Harwun, dem Herrschersitz der drei Adro’wiai, gewesen. Allerdings war sie sich sicher, dass dieses nach Moder riechende Rundzelt weit weniger Annehmlichkeiten bot. Beinah 60 Anwärter kauerten oder lagen hier meist auf dem nackten Boden. Nur wenige hatten einfache Liegen, die Decken mancher waren verschlissen. Das Heer San’tweynas verschwendete weder Uniformen noch andere Ausrüstungsgegenstände an die Freilegion. Hatte Silior noch immer nicht begriffen, dass er sich in die tiefsten Niederungen des Daseins hinabbegeben hatte? Dies hier war die Vorkammer des Todes. Und genau dem war dieser Narr gerade um Haaresbreite entronnen.
„Dein Onkel kann dir hier nicht helfen. Du allein bestimmst dein Schicksal in der kurzen Zeit, die dir bis zum Tod in den Tiefen der Na’guas-Wälder noch bleibt. Denn dort werden du und all die anderen bald vergehen. Erschlagen von der stacheligen Keule eines Gorgoils.“
Er lachte kurz auf.
„Ich frage mich, auf wessen Seite Ihr eigentlich steht, meine Dame. Und dennoch. Wie schön Ihr seid, wenn Ihr so finstere Worte sprecht.“
Seine Hand legte sich auf ihre Schulter und glitt langsam hinab in Richtung ihrer Brust.
Larinil schlug ihm mit der Handkante gegen eine Stelle, die einen Fingerbreit vor seinem Ellenbogen lag. Sie fühlte, wie sich der beißende Schmerz von dort aus durch seinen Körper fraß, ihn lähmte. Mit verzerrtem Gesicht sackte Silior in sich zusammen, unfähig, einen Laut hervorzubringen.
„Rangnuwin ist nicht die einzige Bedrohung für dich in diesem Lager, Dummkopf. Die größere von beiden bin ich. Reize ihn und er wird dich quälen. Fasst aber du mich noch ein einziges Mal an, wirst du dir den Tod herbeisehen.“
„Wer bei den Gründern der Welt seid Ihr? Was habt Ihr vor?“, keuchte Silior jetzt. Seine Überheblichkeit war mit einem Male verschwunden. War sie zu weit gegangen? Hatte sie sich nun verraten als eine, die mehr war als eine arme Anwärterin, die Abenteuer und Anerkennung suchte? Aber was hatte sie denn erwartet? Ihr Spiel war durchschaubar und konnte nicht auf Dauer unbemerkt bleiben. Was sie brauchte, waren Elvan jal’Iniai, die in ihrer Schuld standen. Mit Silior wollte sie den Anfang machen. Vielleicht hatte sie aber dessen Dummheit unterschätzt.
„Ich bin auf der Suche“, antwortete Larinil leise. „Nach einem Schwertführer, der Sardrowain einst in die andere Welt begleitet hatte. Es heißt, er sei zurückgekehrt.“
Sie ließ es darauf ankommen. Vielleicht wusste der junge Kerl tatsächlich etwas darüber, was sich in den Kreisen der Adro’wiai abspielte.
„Andrar. Du suchst nach Andrar.“
Larinils Körper spannte sich an. Damit hatte sie nicht gerechnet.
„Du kennst ihn?“
Silior schüttelte den Kopf und rieb dabei seinen Arm.
„Jeder kennt die Geschichte von Andrar, dem Verräter. Timo Hemander, der Vertraute Sardrowains, hat ihn nach Lysin’Gwendain zurückgebracht.“
„Wo ist er jetzt?“, fragte Larinil schroff. Andrar war noch am Leben. Er musste noch am Leben sein.
„Niemand weiß das. Es heißt, er sei niemals in San’tweyna angekommen. Vielleicht haben die Adro’wiai dem Verräter bereits das gegeben, was er verdient: einen langsamen, qualvollen Tod.“
Die Tage verstrichen. Das Leben im Lager der Freilegion war hart und entbehrungsreich. Die Ausbildung war anstrengend, brachte aber bei den Anwärtern keine nennenswerten Erfolge. Kraft hatte stets Vorrang vor Geschicklichkeit, die plumpe Waffe vor der Kunstfertigkeit des Geistes. Die Anwärter mussten lange Strecken durch die östlichen Ebenen laufen, steile Anhänge erklimmen, mal auf Baumstämmen balancieren oder plumpe Kraftübungen durchführen. Die Ausbildung an der Waffe beschränkte sich oft darauf, dass Rangnuwin einen seiner Anwärter im Stockkampf „herausforderte“, um ihn nach Strich und Faden zu verdreschen. Einmal traf es auch Larinil, die den Ausbilder widersterbend gewinnen ließ und sich dabei alle Mühe gab, so unbeholfen wie nur möglich, auszusehen. Meistens allerdings nahm sich Rangnuwin Silior vor und, sobald dieser blutend am Boden lag, einen der anderen. Larinil gelang es oft, nachts mit ihren heilenden Kräften zu helfen. Vorsichtig, damit niemand Verdacht schöpfte. Das hatte zur Folge, dass die Anwärter ihrer Gruppe sie bald vorbehaltlos schätzten, ohne zu viele Fragen zu stellen. Sogar Silior gelang es immer öfter, seine Respektlosigkeit zu unterdrücken. Er hatte wohl inzwischen erkannt, dass ihm seine Herkunft hier tatsächlich nicht weiterhalf. Seine dumme Sicht auf die Dinge hatte er sich allerdings erhalten. Er glaubte tatsächlich, hier im Lager zu einem ruhmreichen Krieger werden zu können.
Larinil dagegen fragte sich, wie es wohl sein würde, den armseligen Kämpfern der Freilegion auf dem Feld gegenüberzustehen. Es wäre ehrlos, sie einfach niederzumachen. Sie überlegte, ob es möglich war, sie für Galandwyn zu gewinnen. Das konnte eigentlich nicht schwer sein, so wie sie hier und wohl auch in San’tweyna behandelt wurden. Aber nein. Das würde sie vermutlich nicht alleine schaffen. Sie bräuchte Verbündete, Gelegenheit, in die Herzen dieser Elvan jal’Iniai vorzudringen. Außerdem war ihr Ziel ein anderes. Jemand anderes.
Larinil wartete. Ihr war nicht klar, worauf genau. Auf etwas, das ihr den Weg zu denen öffnen würde, die ihr mehr sagen konnten als Silior. Auf eine Gelegenheit, die sich ihr schon sehr bald bieten sollte.
„Wir werden Besuch bekommen“, sagte Silior eines Abends. Larinil heilte gerade eine schwere Wunde am Ellenbogen, die sich der junge Kerl beim Sturz von einem Baumstamm zugezogen hatte.
„Offiziere werden kommen, um sich von der Schlagkraft der Freilegion zu überzeugen. Es heißt, sie wollen uns bald in den Westen zur gläsernen Stadt führen.“
Er sah sie prüfend an. Er wollte vermutlich wissen, ob diese Nachricht irgendetwas bei ihr auslöste. Irgendetwas, das seine Neugier befeuerte. Sicherlich gab es längst Gerede über die merkwürdige Heilerin. Darüber, dass sie anders war als die anderen Anwärter.
„Warum sollte mich das interessieren?“, sagte Larinil, zweifelte aber gleichzeitig daran, dass ihr Silior das abkaufte.
„Weil ich nicht glaube, dass Ihr hierhergekommen seid, um mit mir und den zerlumpten Kriegern dieses Zeltes Seite an Seite in den Kampf zu ziehen.“
Larinil fluchte innerlich. Wenn schon Silior sie durchschaut hatte, was dachten dann erst die anderen?
„Ach nein? Und warum, glaubst du, bin ich dann hier? Um auf dich aufzupassen?“
Er lachte.
„Sicherlich nicht. Ich denke, dass Ihr nach Höherem strebt.“
„Ruhm und Ehre. Ein Lob der Adro’wiai. Ist es nicht das, warum auch du hier bist?“
Silior schüttelte den Kopf.
„Ich ganz sicher. Aber nicht Ihr. Glaubt mir, ich kenne Euresgleichen. Es ist die Macht, die Euch lockt und der Reichtum. Ihr seid hier, weil Ihr mit Eurer Schönheit und Eurem Gehabe einen guten Fang machen wollt.“
Larinil zwang sich, nicht laut loszulachen. Das war es also, was er dachte. Dass sie einen hohen Offizier herumkriegen wollte, um in bessere Kreise aufzusteigen. Das passte in Siliors beschränkte Sicht auf die Welt. Motive und Ziele, die sehr viel anders waren als das, konnte er sich offenbar gar nicht vorstellen. Wie armselig! Sie wollte protestieren, ihn beschimpfen, überlegte es sich dann aber anders. Ihr Instinkt sagte ihr, dass es gut war, ihn in dem Glauben zu lassen.
„Und wenn es so wäre?“
Silior grinste triumphierend.
„Dann kann ich Euch helfen. Einer der Offiziere ist mein Vetter. Er bekleidet zwar nur den Rang eines Kohortenkommandanten, aber das wird sich im Laufe dieses Krieges sicherlich schnell ändern. Ich werde ihm schreiben und ihn bitten, Euch nach der Heerschau zu empfangen. Und nach der Hinrichtung Rangnuwins, um die ich ihn ebenfalls gebeten habe.“
Larinil nickte. Vielleicht war das die Gelegenheit, auf die sie gewartet hatte. Ein Kohortenkommandant - auch wenn sie von diesem Rang noch nie gehört hatte - wusste sicher mehr als dieser dumme Junge.
„Und warum tust du das für mich?“, fragte sie so demütig wie möglich.
„Sagen wir, ich will mich erkenntlich zeigen für Eure heilenden Künste. Außerdem ist es hilfreich, wenn mein Vetter in meiner Schuld steht. Ebenso wie Ihr.“
„Wir können es auch lassen und ich erklär es dir einfach nur“, sagte Kristin und sah sie besorgt an. „War vielleicht eine blöde Idee.“
„Quatsch“, antwortete Natalie und rieb sich den Hals. Dieses Druckgefühl wollte einfach nicht verschwinden. Es hatte vor ein paar Tagen angefangen. Eine leichte Erkältung, war ihre erste Vermutung gewesen. Kein Wunder bei den Temperaturen hier in der Festung. Ben war natürlich so lieb, sie mit einem Zauber zu wärmen, wann immer das ging. Allerdings hielt der kaum länger als zwei Stunden an und die Kälte kehrte zurück. Dieses Hin und Her machte ihr zu schaffen. Trotzdem: Handelsübliche Halsschmerzen waren das nicht. Sie würde wohl nicht darum herumkommen, Geysbin zu fragen. Er war ein mindestens so guter Heiler wie Larinil. Was auch immer sie sich da eingefangen hatte, er konnte das kurieren.
Jetzt aber musste sie wohl erst einmal die Zähne zusammenbeißen. „Komm!“, hatte Kristin vor gut einer halben Stunde mit glänzenden Augen gesagt. „Ich zeig es dir.“
Sie war mit ihr gegangen, mitten in der Nacht. Klar, dass es um das Geheimnis der Anderswelt ging. Und klar, dass Natalie sehen wollte, was Kristin entdeckt hatte. Jetzt waren sie im ebenso leeren wie dunklen Mindrai’Coosna und steuerten auf eine der wenigen Fensteröffnungen zu, von denen aus sie auf das gläserne Dach steigen konnten. Nirgendwo sonst hätte man einen besseren Blick auf die Sterne, hatte Kristin gesagt. Geysbin selbst habe es ihr erlaubt.
Kristin öffnete den Riegel und klappte das Fenster nach innen auf. Sofort strömte ihr eisige Luft entgegen. Natalie hatte zwar wieder eine der knallroten Antarktis-Jacken an, die Maus ihr organisiert hatte. Trotzdem fing sie sofort an, zu bibbern.
„Entschuldige!“, murmelte Kristin und legte ihre Hand an Natalies Wange. Eine angenehme Wärme floss in ihren Körper und breitete sich aus. Auch die Schmerzen im Hals ließen augenblicklich etwas nach.
„Viele Zaubereien hab ich noch nicht drauf“, grinste Kristin. „Den Trick hab ich mir aber gleich am Anfang zeigen lassen. Macht Laune, wenn man so verfroren ist, wie ich es als Mensch mal war.“
„Hm“, brummte Natalie dankbar. Und wieder einmal wurde sie darauf gestoßen, dass in der Menschenwelt vielleicht die Spitzohren Außenseiter sein mochten, hier allerdings war sie es. Bis vor Kurzem hatte sie nie wirklich darüber nachgedacht, wie es wäre, wenn auch sie sich verwandelt hätte. Einfacher, lautete die Antwort mittlerweile. Denn Fakt war nun mal: Sie konnte mit den Alben nicht mithalten. Sie konnte mit Ben nicht mithalten. Und sie würde alt werden, während er erst in ein paar Hundert Jahren mit den ersten Falten rechnen musste. Sie liebte Ben mehr als sie jemals jemanden geliebt hatte. Aber sie wusste auch, dass ihre Beziehung nicht für die Ewigkeit gemacht war. Das war nicht möglich. Irgendwann würde Natalie in ihre Welt zurückkehren müssen, weil es zu viel gab, was zwischen ihnen lag. Und dort würde sie alt werden. Alleine.
„Scheint vielleicht doch nicht so gut zu funktionieren, mein Hokuspokus“, sagte Kristin. „Du siehst blass aus. Und du hast etwas Pipi in den Augen. Schmerzen?“
„Alles gut“, log Natalie. „Und jetzt zeig mir schon, was du herausgefunden hast. Ich bin nur ein Mensch und freu mich, wenn ich wenigsten ein paar Stunden Schlaf in der Nacht abbekomme.“
Kristin kletterte aus dem Fenster auf einen schmalen ebenfalls gläsernen Steg, der keinen halben Meter breit war und ohne irgendeine Brüstung oder ein Geländer auskam. Natalie folgte ihr und sofort war ihr schwummrig. Mit ihrer Gesundheit hatte das diesmal allerdings nichts zu tun. Eher damit, dass sich unter ihr gerade das bodenlose Nichts aufgetan hatte. Um dort wirklich irgendetwas zu erkennen, war es zwar zu finster. Aber Natalie wusste, dass sie sehr lange fallen würde, wenn sie jetzt abrutschen würde. Sie klammerte sich mit der einen Hand fest an den Fensterrahmen. Ihr Blick suchte in der endlosen Düsternis nach etwas Vertrautem, nach etwas, das ihr das Gefühl von Sicherheit geben konnte. Da waren die Lichter von drei der anderen Festungen. Bei zwei der Bauwerke erinnerten sie Natalie an eine zusammengeknüllte Weihnachtslichterkette, die man angeknipst und irgendwo im dunklen Garten hatte liegen lassen. Die dritte Festung lag deutlich näher. Natalie erkannte einzelne Fenster und sogar die Umrisse von Alben, die sich in den Räumen bewegten. Mit den Augen einer Verwandelten hätte sie wahrscheinlich sogar die Gesichter erkennen können, vermutete sie.
Ohne Vorwarnung schnürte ihr Kristin das Ende eines Seils um die Hüfte.
„Ja, ich weiß “, sagte die Astrophysikerin. „Das brauchst du natürlich nicht. Du hast mir erzählt, dass du gerne in den Bergen unterwegs bist. Da wird dich das hier wohl nicht wirklich beeindrucken. Das Seil ist nur für mich. Gibt mir einfach ein besseres Gefühl und so.“
Natalie musste lächeln. Dabei hätte sie kein Problem gehabt, zuzugeben, dass sie eine Scheiß-Angst hatte. Dass Kristin ihr aber die Gelegenheit gab, ihr Gesicht zu wahren, war trotzdem ein feiner Zug.
„Danke“, sagte sie leise.
Kristin nickte und drehte sich einer kleinen Leiter mit dünnen Sprossen zu, die an der Außenwand angebracht war und steil etwa zwei Meter weit nach oben führte.
Noch bevor sich Natalie richtig darüber klar werden konnte, wie gefährlich das nun wieder war, hatte Kristin bereits die Hälfte der Leiter geschafft und das Seil spannte sich straff.
„Mist“, stöhnte Natalie und fing nun auch an zu klettern. Vorsichtig erarbeitete sie sich eine Sprosse nach der anderen.
„Alles in Ordnung?“, wollte Kristin wissen.
„Geh bitte weiter!“, antwortete Natalie etwas forscher als geplant. „Lass uns das hinter uns bringen, okay?“
Wieder fluchte sie. Das war wirklich heftig. Ihr Hals pochte schmerzhaft und sie hatte das Gefühl, dass ihr gleich die Luft ausgehen würde. Nach einer gefühlten Ewigkeit spähte sie aber schließlich über die Dachkante. Kristin packte sie vorsichtig und zog sie auf die ebene Fläche.
„Sorry. Der Abstieg ist leichter. Versprochen.“
Natalie atmete tief durch. Mit so viel Aufregung hatte sie nun wirklich nicht gerechnet. Na hoffentlich lohnte sich der Stress, dachte sie und fragte sich einmal mehr, was Kristin die Sterne wohl so Bahnbrechendes erzählt hatten.
„Schau dir den Himmel an, Natalie!“, sagte die Astrophysikerin euphorisch, als sie schließlich etwa die Mitte des Dachs erreicht und sich auf zwei Kissen gesetzt hatten, die dort überraschenderweise bereits positioniert waren. Nichts, aber auch gar nichts störte den Blick ins All. Kein Gebäude, keine Bäume, kein Lichtsmog, keine Wolken. Das Firmament spannte sich wie ein Netz aus Abertausenden Lichtpunkte über sie. So klar und hell war jeder Einzelne, dass es Natalie beinahe unecht vorkam. Sofort verlangsamte sich ihr Puls und sie spürte so etwas wie Geborgenheit. Als würde der Himmel in diesem Moment nur ihr alleine gehören.
„Kennst du dich ein bisschen mit Sternbildern aus?“, fragte Kristin.
„Nicht wirklich“, antwortete Natalie.“ Den großen Wagen kenn ich natürlich. Und Cassiopeia. Dann hört es aber auch schon auf.“
„Kannst du mir sie zeigen?“
Ein kleiner Test also, vermutete Natalie. Das war einfach. Als Kind hatte sie sich die gängigsten Sternbilder von ihrem Vater oft genug zeigen lassen. Wahrscheinlich würde sie sogar auch noch den Löwen und Orion finden.
Sie suchte nach vertrauten Konstellationen. Eine besonders helle und lange Sternschnuppe huschte über den Himmel und lenkte sie für einen Augenblick ab. Sie versuchte, sich zu konzentrieren.
Aber, so sehr sie sich auch bemühte, sie fand die Sternbilder nicht. Den Großen Wagen, den Polarstern. Wenigstens die musste sie doch erkennen. Oder ging das vielleicht deshalb nicht, weil sie auf der Südhalbkugel waren? Dann eben das Kreuz des Südens. In Neuseeland war sie oft mit Ben auf der Wiese vor ihrer Hütte in Squirrels Burrow gelegen und hatten den Sternenhimmel beobachtet. Wenn man wusste, wonach man suchen musste, war das Kreuz des Südens ziemlich leicht zu finden. Aber auch hier: Fehlanzeige.
„Entweder stelle ich mich gerade selten doof an ...“, sagte Natalie und ließ Kristin ihren Satz bereitwillig vollenden.
„... oder es gibt hier keine Sternbilder, die wir kennen.“
Pause. Kristin machte große Augen und lächelte dabei versonnen. Wie eben jemand, der mehr wusste als der andere.
„Erklär’s mir!“, forderte Natalie.
„Die einfachste und naheliegendste Erklärung ist: Wir sind hier nicht auf der Erde.“
Natalie seufzte.
„Natürlich. Du hast recht. Das hier ist die Anderswelt. Wie der Name vermuten lässt, ist hier alles anders. Der Mond sieht anders aus, die Sonne. Warum also nicht auch die Sterne?“
Kristin schüttelte energisch den Kopf.
„Nein, ich glaube, du verstehst mich nicht. Das hier ist nicht die Erde! Wir sind auf einem fremden Planeten.“
Natalie sah ihre neue Freundin an, als hätte sich die gerade eine besonders alberne Pappnase aufgesetzt. Denn das war ja nun wirklich schräg.
„Kein Schattenreich in einer anderen Dimension?“, hakte sie nach.
„Was soll das sein, eine andere Dimension? Es gibt die drei gängigen: vorwärts, rückwärts, nach links und rechts und nach oben und unten. Als vierte Dimension wird gerne die Zeit bezeichnet, bei der wir uns aber nur in eine Richtung bewegen können. Selbst wenn es noch eine fünfte geben sollte, die wir nicht kennen: Sie ist dann kein Ort, sondern eine Bewegungsrichtung.“
„Ein Paralleluniversum?“
„Klar. Eine gewagte Theorie. Der Punkt dabei ist, dass wir - natürlich rein theoretisch - nur die Paralleluniversen erreichen könnten, bei denen die Unterschiede zu unserem Universum minimal sind. Verstehst du?“
„Nein.“
„Naja. Die Theorie geht vereinfacht gesagt davon aus, dass immer dann, wenn sich ein Ereignis in die eine oder andere Richtung entwickeln kann, genau das auch passiert. Die Ereignisstränge trennen sich voneinander. Ein neues Universum entsteht. Beide Universen entwickeln sich in unterschiedliche Richtungen. Bedeutet dann natürlich: Es gibt unendlich viele Universen, so viele, wie es mögliche Entwicklungen gibt. Erwischen wir eines von den Abermillionen Universen, das sich so entwickelt hat, dass Leben auf der Erde völlig unmöglich ist, können wir - nicht mal theoretisch - dorthin, weil wir sofort dort sterben würden. In der Anderswelt aber können wir leben. Sie ähnelt in diesem Punkt unserer Welt sehr. Und trotzdem ist eben auch alles hier anders. Die Kombination ist also: Lebensbedingungen wie auf der Erde, aber sonst komplett verschieden. Die Wahrscheinlichkeit, so ein Paralleluniversum zu finden, ist gleich null. Und damit wären wir wieder bei den Sternen.“
Natalie nickte, obwohl sich ihr Verstand immer noch gegen Kristins Schlüsse wehrte.
„Du hast ja recht: Der Sternenhimmel ist völlig anders als der, den wir kennen. Aber heißt das zwangsläufig, dass wir auf einem fremden Planeten sind?“
Kristin schüttelte den Kopf.
„Er ist zwar einerseits völlig anders. Aber andererseits auch wieder nicht. Wir sind im selben Weltall, vermutlich sogar in derselben Galaxie. Siehst du den Fleck zwischen den drei dicken Sternen? Wenn mich nicht alles täuscht, ist das Andromeda, eine unserer Nachbargalaxien. Sie hat von hier aus in etwa die gleiche Größe, die sie auch von der Erde aus hat. Und dieses helle Band, das sich quer über den Himmel zieht, könnte die Milchstraße sein. Die ist nämlich flach, eine Spiralgalaxie. Steckt man da mittendrin, dann sieht man den Rest der Galaxie genau so, nämlich als milchiges Band.“
„Wow!“ Mehr brachte Natalie nicht heraus. Dass sich der Fantasy-Trip, den sie seit ein paar Jahren erlebte, in einen Science-Fiction verwandeln würde, hatte sie nicht erwartet. Was das bedeutete? Eigentlich erst mal gar nichts. Außer, dass es weitere Rätsel gab. Wie zum Teufel waren sie hierhergekommen? Wie funktionierte das mit den Übergängen? Und wie hatte Geysbin vor Jahrtausenden einen anderen Planeten ausfindig machen und besiedeln können? Das war irre.
„Meinst du, dein Kumpel Maus kann mir ein Teleskop beschaffen? Und ein solarbetriebenes Notebook mit Spezialsoftware? Dann kann ich dir bald genauer sagen, wo wir hier sind.“
Sie atmete einmal tief durch. „Mit Geysbin werden wir aber trotzdem noch mal reden müssen. Ich würde da gerne ein paar offene Fragen mit ihm diskutieren.“
Rangnuwin lebte noch. Womit klar war, dass Silior mit seinem Wunsch nach dem Kopf des Ausbilders vorerst gescheitert war. Larinil hoffte, dass er mit seinem zweiten Wunsch mehr Glück gehabt hatte. Die Offiziere waren im Lager erschienen, eine Einladung von Siliors Vetter, dem Kohortenkommandanten, hatte sie bis dahin allerdings nicht bekommen. Stattdessen musste sie sich nun einem anderen Problem stellen. Rangnuwin hatte ohne Umschweife Larinil als Gegnerin für den nächsten Stockkampf gewählt - diesmal ohne vorher Silior verdroschen zu haben. Das war ebenso ungewöhnlich wie die Tatsache, dass der Ausbilder offensichtlich sehr nervös war. Seine Lider flatterten und er blinzelte weit öfter als sonst. Seine ohnehin schon schmalen Lippen presste er so fest aufeinander, dass sie fast gar nicht mehr zu erkennen waren. Hatte er Angst vor ihr? Natürlich, wenn er von ihren Fähigkeiten als Kaijadan-Meisterin gewusst hätte, dann hätte er Grund dazu gehabt. Aber so konnte es nicht sein, denn dann hätte er sie verraten, aber wohl kaum herausgefordert.
„Gebe dein Bestes, Barfüßige! Biete mir einen guten Kampf! Es soll nicht dein Schaden sein. Ich weiß, dass du zäher und geschickter bist als du tust. Ich sehe das in deinen verschlagenen Augen.“
Larinil war verwirrt. Was bei den Mächten des Lichts war nur in Rangnuwin gefahren?
Ohne ein weiteres Wort attackierte der Ausbilder. Es war ein plumper Schlag auf Kopfhöhe, den sie mühelos parierte. Larinil widerstand dem Zwang, ihrer Abwehr unweigerlich einen todbringenden Stoß folgen zu lassen. Die Kunst des Schwertkampfes, über Jahrhunderte verfeinert, forderte das geradezu von ihr ein. Aber Larinil tat, was sie im Gefecht sonst niemals tun durfte. Sie ließ ihre Gedanken schweifen. Zu Andrar. Dessen viel zu keckes Lächeln, die hellgrünen Augen, die stets neugierig nach ihren Gedanken forschten. Den Kuss seiner vollen Lippen.
Wieder ein Schlag! Larinil wehrte ihn halbherzig ab, ließ zu, dass Rangnuwins Stock mit Wucht den ihren gegen ihre Seite drückte. Sie keuchte vor Schmerz. Wie gerne hätte sie ihrem Zorn freien Lauf gelassen. Wie gerne hätte sie dem ein schnelles Ende bereitet. Dann aber erkannte sie den Grund für Rangnuwins Angst.
„Fahrt fort mit Euren Übungen!“, sagte eine tiefe, befehlsgewohnte Stimme. Sie gehörte einem grauhaarigen Offizier in samtblauer Uniform, der zusammen mit vier anderen, darunter auch einer Frau, zu ihnen getreten war. Die Besucher, dachte Larinil und warf der Gruppe einen flüchtigen Blick zu. War Siliors Vetter unter den Offizieren? Vermutlich. Rangnuwin hatte wohl gewusst, dass die Offiziere zu ihm kommen würden. Und nun wollte er ihnen seine Fähigkeiten als Ausbilder beweisen. Larinil hatte er wohl ausgewählt, in der Hoffnung, sie würde im Kampf eine bessere Figur machen als die anderen Anwärter.
Viel zu langsam, viel zu vorhersehbar konterte sie. Der Stock traf ins Nichts, wurde von Rangnuwin völlig unnötigerweise mit einem zusätzlichen Hieb bedacht.
Der Ausbilder stieß ein triumphierendes „Ha!“ aus, drehte sich einmal um die Achse und schlug - ohne die Kraft, die ihm die Drehung verlieh, auch nur ansatzweise auszunutzen - in Richtung ihres Kopfes. Larinil duckte sich, gerade so weit, dass der Stock knapp ihre Stirn verfehlte. Wohin sollte dieses irrsinnige Gefecht führen? Die Offiziere waren vermutlich nicht so dumm wie Rangnuwin. Würden sie merken, dass Larinil sie täuschte?
Die Kaijadan-Meisterin lief mit gespielter Unbeholfenheit rückwärts, wich weiteren Schlägen und Stößen aus und rempelte schließlich gegen eine Anwärterin, die dem Kampf zugesehen hatte.
„Was ist das für ein Spiel, das Ihr da aufführt, Lehrmeister?“, fragte die befehlsgewohnte Stimme voller Verachtung. „Bringt Ihr Euren Anwärtern bei, ihre Feinde zum Narren zu halten? Dann bin ich sehr neugierig, wie diese Taktik bei Gorgoils wirkt.“
Gelächter unter den Offizieren. In Rangnuwins Gesicht dagegen stand nun nackte Panik.
„Nein, Heerlenker!“, keuchte er. Er war gedemütigt. Und er wusste wohl, dass nur Larinil ihn noch retten konnte - indem sie sich gegen ihn wehrte und dann schließlich von ihm besiegen ließ.
„Und Ihr, Anwärterin!“ Der Grauhaarige sah sie nun direkt an. Als sich ihrer Augen trafen, schwieg er für einen Moment, musterte sie dann mit misstrauischem Blick. Nein, er war nicht dumm. Er hatte gemerkt, dass etwas mit ihr nicht stimmte.
„Ihr zeigt jetzt, was Eurem Können entspricht!“
Der Heerlenker verzog einen Mundwinkel zu einem bösartigen Lächeln.
„Um den Reiz dieses grotesken Schauspiels für Euch zu erhöhen: Bezwingt Ihr diesen unfähigen Ausbilder, dann dürft Ihr heute Abend in meinem Zelt mit uns speisen.“
Er ließ eine kurze Pause, in der Rangnuwin hörbar nach Luft schnappte.
„Schafft ihr das nicht, so verbringt Ihr die kommende Nacht alleine im Wald - mit dem Kopf nach unten in einem Baum hängend.“
Wieder pflichtbewusstes Gelächter unter den Offizieren.
Larinil hatte aber keinen Zweifel daran, dass er ernst meinte, was er das sagte. Andrar hatte ihr davon erzählt, dass die höheren Offiziere in San’tweyna vor Sardrowains Machtergreifung eine schier unantastbare Stellung gehabt hatten. Eine, die ihnen beinahe jede Willkür erlaubt hatte. Die Männer und Frauen in ihren blauen Uniformen wurden ebenso gehasst wie gefürchtet. Larinil hatte nun eine Vorstellung davon, warum. Was sie allerdings nicht wusste, war, wie sie sich nun verhalten sollte. Schlug sie Rangnuwin nieder, verriet sie sich. Die Vorstellung, hilflos an einem Baum zu hängen, gefiel ihr allerdings ebenso wenig. Unschlüssig hielt sie dem Blick des Heerlenkers stand, der sie ebenso interessiert wie belustigt anstarrte. Und dabei bemerkte sie zu spät, dass Rangnuwin den Kampf bereits wieder aufgenommen hatte. Sein Stock traf sie hart an der rechten Schläfe.
Natürlich schwankte die Brücke. Das sollte sie auch, dachte Ben. Es waren bestimmt 700 Meter von der Hauptfestung zur Nachbarburg. Eine Brücke über diese Distanz ist ein kleines Meisterwerk, eines, das halten sollte, wenn der Wind ging. Deshalb musste sie flexibel sein. Eine Hängebrücke eben. Und der Wind ging hier oben eigentlich immer. Das Ding war stabil wie nur irgendetwas, redete er sich ein. Es sei noch niemals etwas passiert, hatte ihm Geysbin versichert, der vor ihm in einem Affenzahn über die Brücke huschte. Die Spalten zwischen den Brettern kamen Ben riesig vor. Natürlich waren sie viel zu schmal, als dass jemand zwischen ihnen ernsthaft durchfallen und in die Tiefe stürzen konnte. Sein Angstgefühl schien das allerdings wenig zu beeindrucken. Ebenso wenig wie der Fakt, dass es dicke Halteseile in Schulterhöhe gab, an denen ein stabiles Netz befestigt war, das bis hinab zu den Brettern reichte. Es konnte also gar nichts passieren. In Geysbins Kopf hatte diese Erkenntnis offenbar eindeutig die Oberhand. Er hielt sich beim Laufen nicht mal fest und sah dabei leichtfüßig aus wie ein junger Hüpfer. Das Einzige, was nervös im Wind zappelte, war sein graues Gewand.
„Laufe ich dir zu schnell, Ben Hartzberg?“, fragte der Großmeister aller Hängebrücken. Dabei zog er belustigt seine buschigen weißen Augenbrauen hoch.
„Ein bisschen“, antwortete Ben und schloss langsam und mit unsicheren Schritten zu Geysbin auf. Es machte keinen Sinn, den Alben anzulügen. Bei ihm funktionierte so etwas nicht. Außerdem war ja auch offensichtlich, dass Ben mit der Brücke haderte. Und mit der schwindelerregenden Höhe.
„Du wirst dich mit der Zeit daran gewöhnen“, sagte Geysbin lächelnd. „Es ist nicht ehrlos, etwas zu fürchten, das man nicht kennt. Bisweilen rettet uns diese Furcht sogar das Leben.“
„Auch wenn es keinen echten Grund dafür gibt?“
„Besonders dann.“
Komisch. Nach diesem kurzen Gespräch lief es auf einmal viel besser. Die Angst war zwar noch da. Ben hatte allerdings das Gefühl, dass sie jetzt nicht mehr sein Feind war. Wie schaffte das der alte Geysbin nur? Magische Kräfte? Vermutlich hatte er bei Ben einfach nur den richtigen Knopf gedrückt.
Erstaunlich schnell jedenfalls lagen die 700 Meter hinter ihnen und sie betraten den festen Boden der anderen Festung.
„Ha fanaimel, Geysbin jukul!“, riefen ein paar Krieger und verbeugten sich tief. Einer legte einen mit Feder bestückten Helm beiseite und kniete sich sogar nieder. Er und die anderen trugen die türkisfarbenen Brustpanzer der Soldaten Galandwyns. Ben wusste, dass sie sich mit diesem antiken Outfit als Nachfahren der Alben zu erkennen gaben, die vor über tausend Jahren zusammen mit Gintwain die weiße Alpenfestung verlassen und mit ihm zurück in die Anderswelt gekommen waren.
„Ischan´nar hewei!“, entgegnete Geysbin sanft. „Hat valin Elvan jal’Iniai.“
Übersetzt hieß das: „Hört auf damit! Ich bin nur ein Kind des Lichts.“ Geysbins vermutlich hundertster Versuch, die demütigen Ehrerbietungen zu beenden, mit denen ihm viele der Alben begegneten. Geysbin galt als Legende, als einziger noch lebender Urvater des albischen Volkes. Und natürlich als Hoffnungsträger im Krieg gegen Sardrowain.
Drei Verwandelte kamen mit schnellen Schritten dazu. Sie trugen zwar weit geschnittene albische Hosen und Hemden - dass die Männer aber einmal Menschen waren, konnte Ben trotzdem schnell erkennen. Sie hatten kurze Haare, einer trug eine Armbanduhr, der andere eine goldene Halskette mit einem Anker daran. Außerdem fiel ihr Gruß weit weniger demütig aus.
„Morgen!“, sagte der kräftigste der drei, der mit der Uhr. Er strich sich über den Stoppelbart am Kinn. Er war so blond wie die Haare des Mannes und nur bei näherem Hinsehen überhaupt von der gebräunten Haut zu unterscheiden. Die anderen beiden nickten.
„Seid gegrüßt“, erwiderte Geysbin freundlich. „Bitte zeigt uns, was geschehen ist.“
Die Verwandelten führten den Großmeister und Ben quer über den Innenhof bis hin zur steinernen Wand des Berges, dann bogen sie links ab in einen breiten Gang, der den Gipfel offenbar umrundete. Ben war auch von dieser Festung beeindruckt. Sie war etwas kleiner als die weiße Hauptfestung, aber auch in ihrem Inneren absolut durchdacht - dabei längst nicht so martialisch, wie er vermutet hatte. Schon bei Betreten war ihm aufgefallen, dass es neben Wehrgängen und vollgestopften Waffenkammern auch geradezu kuschelig anmutende Gebäude und Räume gab. Ben sah darin kunstvoll verzierte Holzmöbel, weich gepolsterte Sessel und teuer aussehende Teppiche. In einem Raum saßen Soldaten und Verwandelte an einem üppig gedeckten Tisch und hatten offenbar eine Menge Spaß. An keiner Stelle hatte Ben den Eindruck, dass es hier nur um Kampf, Drill und Disziplin ging. Das bestätigte ihm wieder einmal, dass die sieben Festungen weit mehr waren als nur bloße Verteidigungsanlagen, eine Zuflucht. Sie waren auch eine Heimat, ein Ort, in dem man leben konnte.
„Hier entlang“, sagte der blonde Verwandelte und führte sie nach einer Weile in ein Gebäude hinein und dort über eine steinerne Treppe hinab in einen geräumigen Gewölbekeller.
Ben schlug sofort der Geruch von frischem Ruß und Asche entgegen. Hier hatte es vor Kurzem gebrannt.
Der Mann zog eine kleine Taschenlampe aus seiner Hosentasche, knipste sie an und leuchte damit auf die völlig verkohlten Überreste von etwa zwanzig Sturmgewehren und ebenso vielen Pistolen. Viel verstand Ben nicht von Waffen. Es war aber offensichtlich, dass von ihnen nur noch die metallenen Teile übrig waren. Der Kunststoff war komplett weggeschmolzen.
„Was ist hier geschehen?“, fragte Geysbin.
Der kräftige Blonde mit der Uhr winkte einem seiner Begleiter zu. Der beförderte eine Patronenhülse zutage und legte sie auf den Boden. Dann nahm er einen verkohlten Gewehrkolben, holte aus und schlug damit dreimal fest auf die Hülse - bis sie aufbrach und das Pulver im Inneren hervortrat.
„Bitte zurückbleiben!“, sagte der Verwandelte und blickte erwartungsvoll auf die zerstörte Hülse.
Nach etwa einer halben Minute begann das Pulver, zu qualmen. Es zischte einmal laut, dann schoss eine blaue Flamme empor, hielt sich einen Moment und ebbte wieder ab.
„Munition ist zwar nicht mein Fachgebiet“, sagte Ben schließlich. „Aber liege ich mit der Vermutung richtig, dass das nicht hätte passieren sollen?“
„Goldrichtig. Das Pulver ist instabil. Entzündet sich selbst. Und das ist, förmlich formuliert, eine ziemliche Scheiße.“
Geysbin strich sich über die von Falten zerfurchte Stirn, sein Blick wanderte noch einmal nachdenklich über den rußschwarzen Fußboden.
„Ist es möglich, dass bei der Fertigung der Hülsen Fehler passiert sind?“, fragte er dann.
Der blonde Verwandelte nickte. „Möglich schon. Es passiert schon mal in schlechten Fabriken, dass das Mischverhältnis nicht passt. Ist nie gut, weil gefährlich. Diese Patronen aber kommen von Top-Herstellern. Von den gleichen, die auch die deutsche Polizei benutzt. Ich weiß das, weil ich bei dem Verein mal mitgespielt habe, als ich noch ein Mensch war. Vorstellbar ist in der Theorie natürlich trotzdem, dass eine ganze Marge Patronen hinüber ist, wenn es ganz dumm läuft.“
„Irgendwas sagt mir, dass wir mit einer Reklamation trotzdem nicht weiterkommen“, sagte Ben.
Der Mann nickte noch einmal.
„Weil das, was wir eben gesehen haben, mit allen Patronen passiert, die wir haben. Egal aus welcher Marge, egal von welchem Hersteller, egal für welche Waffe. Anders gesagt: Ich vermute, dass menschlicher Munition das Klima in der Anderswelt nicht bekommt.“
Ben fiel dazu erst mal gar nichts ein. Sein Verstand musste sortieren, was er da eben gesehen und gehört hatte. War hier tatsächlich etwas in der Luft, das die Patronen reihenweise unbrauchbar machte? Der Verwandelte sah allerdings nicht aus, als würde er blöde Witze machen. Die Sache war für ihn bierernst.
„Eine blöde Frage hätte ich aber schon dazu“, meinte Ben dann. „Wir haben hier in der Anderswelt schon mehrfach Waffen abgefeuert. Warum ist nicht schon früher etwas passiert?“
„Weil die Hülsen normalerweise fest verschlossen sind und das Pulver nicht unmittelbar mit der Luft in Kontakt kommt. Warum es hier in diesem Raum zum Feuerwerk gekommen ist? Ich denke, dass vielleicht eine der Hülsen nicht 100-prozentig dicht gewesen ist. Mit der Zeit drang Anderswelt-Luft in sie ein und ... bumm. Blöd, wenn so etwas in einem geladenen Sturmgewehr passiert.“
„Mist“, fluchte Ben und auch Geysbin atmete tief durch.
„Lysin’Gwendain wählt die Waffen, mit denen wir in diesem Krieg kämpfen müssen. Ein Gesetz, dem sich auch Sardrowain unterwerfen muss“, sagte er.
Ben nickte. Menschliche Waffen konnten sie also vergessen. Das würde vor allem vielen Verwandelten nicht passen, dachte er.
„Und es bedeutet noch etwas anderes“, sagte der Kräftige. „Nämlich, dass wir hier im wahrsten Sinne des Wortes auf einem Pulverfass sitzen. Das ist nicht der einzige Raum, in dem wir kistenweise Munition lagern.“