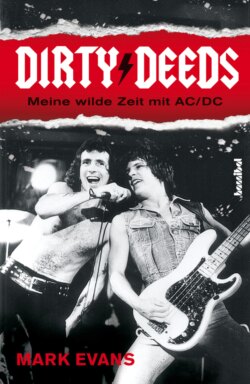Читать книгу Dirty Deeds - Meine wilde Zeit mit AC/DC - Mark Evans - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеMeine Kindheit war geprägt von dem, was man heute wohl eine „Patchwork-Familie“ nennt, wobei mich das damals weder interessierte noch irgendwie beeinträchtigte. Ich war das jüngste von vier Kindern. Meine älteste Schwester Laura und mein Bruder John entstammten der ersten Ehe meines Vaters mit einer wunderschönen Frau namens Susan, die an einer Gehirnblutung gestorben war, als sie noch sehr klein waren. Ich erinnere mich noch sehr lebhaft an ein Porträtfoto von Susan, das in unserem Haus in Murrumbeena, einem Vorort von Melbourne, hing und auf dem sie wie ein Filmstar aussah. Mein Bruder hat dieses Foto noch, und wenn ich es ansehe, dann muss ich sofort wieder an unser altes Haus und die Zeit damals denken. Es ist ein warmes, schönes Gefühl und erinnert mich an eine Zeit, in die ich mich oft zurücksehne.
Meine andere Schwester Judy ist fünf Jahre älter als ich und damit altersmäßig mir am nächsten. Sie stammt aus der ersten Ehe meiner Mutter Norma. Als Jüngster wurde ich sehr verwöhnt, und wahrscheinlich machte ich Judy das Leben zur Hölle, wofür ich mich heute in aller Form entschuldigen möchte. Der erste Mann meiner Mutter, Bud Mintovich, kam in Australien als Sohn einer russisch-jüdischen Familie zur Welt. Als sie heirateten, diente er in der Royal Australian Navy und war, wie auch meine Mutter, erst 19. Sie waren gerade mal zwei Monate verheiratet und meine Mum war mit Judy schwanger, als Bud an Bord der HMAS Bataan Richtung Okinawa ablegte. Die Bataan lag dort im Hafen, als am 25. Juni 1950 der Koreakrieg ausbrach, und das Schiff wurde der amerikanischen Marine überstellt. Bud kam die nächsten 15 Monate nicht nach Hause. In dieser Zeit erlebte er die Landung der UN-Truppen bei Pohang-Dong mit, patrouillierte in der Straße von Korea, war an zahlreichen Blockaden und Feuergefechten beteiligt und kam tagtäglich unter Beschuss.
Als Bud zurückkam, hatte er sich sehr verändert. Der Krieg hatte ihn gezeichnet. Er war angespannt und in sich zurückgezogen, hatte mit knapp 21 schon eine zehn Monate alte Tochter und wohnte bei seinen Schwiegereltern. Als Bud nach Darwin versetzt wurde, weigerte sich mein Großvater, meine Mutter und meine Schwester mit ihm gehen zu lassen, und die Ehe zerbrach. Dass in dieser Zeit trotzdem immer wieder gute Laune im Haus herrschte, war einigen Kindern aus der Parallelstraße zu verdanken; ein neunjähriger Junge und seine 13-jährige Schwester kamen jeden Tag vorbei, um „Mr. und Mrs. Whit“ und das Baby zu besuchen. Dabei hatten die Kinder selbst eine Aufheiterung bitter nötig, denn erst kurz zuvor hatten sie ihre Mutter Susan verloren. Und so wuchsen unsere Familien zusammen. Dass es sich bei meinen Geschwistern genau genommen um Stiefbruder, Stiefschwester und Halbbruder handelt, hat mich nie interessiert, für mich waren sie einfach nur mein Bruder und meine Schwestern. Sie sind meine Familie, ganz einfach.
Man kann wohl mit Fug und Recht behaupten, dass ich nicht gerade in besten Verhältnissen aufwuchs. Während meiner Jugend wohnte meine Familie lange Zeit im Apartment 56 einer Siedlung in South Yarra, dem so genannten Horace Petty Estate. Hinter diesem ziemlich hochtrabenden Namen verbarg sich ein Haufen echter Bruchbuden. Ich selbst nannte unseren Block das Prahran Hilton, und bei meinen Freunden war unsere Wohnung als Club 56 bekannt. Die Siedlung bestand aus drei zwölfstöckigen Hochhäusern und etwa 30 vierstöckigen Wohnblöcken. Es handelte sich um Fertigbauten aus Beton, die man wie Kartenhäuser zusammengekloppt hatte. Im Sommer war es stinkend heiß, und im Winter fühlte man sich wie in einer gigantischen Kühlbox. An einem stickigen Dezembertag hatte man vielleicht Glück, und eine kühle Brise pfiff durch die Ritzen, aber sobald sich die Betonplatten abkühlten, zogen sie sich leicht zusammen und verkanteten sich. Dann gab es stets ein knackendes Geräusch, und gelegentlich traten Risse auf. Es war kein besonders beruhigendes Gefühl, wenn man oberhalb des Erdgeschosses wohnte.
In der Zeitung las ich einmal einen Artikel über die Projekte der Wohnungsbaugesellschaft, die für diese Siedlung verantwortlich war, illustriert mit einer Luftaufnahme des Hilton. Die Schlagzeile lautete: „Horace Petty Estate – ein Beispiel für verfehlte Sozialplanung“. Na großartig!
Für unsere Familie war der Umzug von Murrumbeena nach Prahran trotzdem ein großer Schritt. Das Haus in Murrumbeena war zwar nicht völlig verwahrlost, aber doch ziemlich renovierungsbedürftig, und selbst einfachen Komfort wie warmes Wasser, Teppiche oder eine Toilette im Haus gab es nicht. Allerdings war es billig, das war wohl der einzige Vorteil. John und ich teilten uns einen ausgebauten Wintergarten im ersten Stock, der auf die Murrumbeena Road und zum Bahnhof hinausging. Nachts wurde er von einer riesigen Leuchtreklame von Sennett’s Ice Cream erhellt, die von einem Vordach aus direkt in mein Fenster schien. Sie stellte einen Eisbären dar, und das Summen und Knistern der Neonröhren wiegte mich regelmäßig in den Schlaf.
Im Winter war es ziemlich passend, dass ein Eisbär vor meinem Zimmer lebte, denn dann war es im Haus so kalt wie am Nordpol. Ich lag eingemummelt in einem Schlafanzug, dicken Socken, Fußballhemd und Mütze unter den Decken und zitterte, während draußen der blöde Bär summte. In besonders kalten Nächten wachte ich manchmal auf, weil meine Beine unterhalb der Knie taub waren und meine Hände wie verrückt schmerzten.
Dann geriet meine Familie in Schwierigkeiten. Mein Vater hatte als Verkäufer in einem Möbelgeschäft auf der Chapel Street in Prahran gearbeitet, verlor aber seinen Job, weil er wegen Körperverletzung angezeigt worden war. Ein Polizist beklagte einen gebrochenen Arm, einen gebrochenen Kiefer sowie ein paar üble Bisswunden am Hintern. Zumindest an denen war allerdings nicht mein Dad schuld, sondern unser treuer Familienhund Chris.
Mein Bruder John hatte mit zwei Freunden vor der Milchbar nebenan herumgelungert (die, für die der Eisbär summend Werbung machte), und der Polizist hatte sie aufgefordert, woanders hinzugehen. Ein Wort gab das andere, und schließlich schlug der Bulle Johns Kopf gegen eine Mauer. In diesem Augenblick kam mein Vater mit Chris dazu; eine eher unglückliche Fügung für den übereifrigen Gesetzeshüter. Die Klatschtante der Nachbarschaft bekam das mit und machte später eine Aussage. Dad wurde festgenommen, und die ganze Story prangte schließlich auf der Titelseite der Melbourner Zeitungen. Als Sir Maurice Nathan, der Geschäftsführer des Prahraner Möbelladens, von der Sache Wind bekam, wurde Dad sofort vor die Tür gesetzt, weil er damit „ungeeignet für den täglichen Umgang mit Kunden“ war.
Mein Vater, John und seine beiden Freunde wurden alle wegen Körperverletzung vor Gericht gebracht – Chris, der Hund, kam davon. Auf den Rat eines gut betuchten Freundes hin engagierten wir Sir Frank Galbally, den besten Strafverteidiger der damaligen Zeit. Die vier wurden schuldig gesprochen, bekamen eine happige Geldstrafe aufgebrummt und zwei Jahre auf Bewährung. Die Verteidigung war noch dazu enorm teuer, aber glücklicherweise übernahm besagter Freund, der uns den Anwalt vermittelt hatte, die Kosten und zahlte auch die Strafe.
In dieser Zeit zogen wir um, ein paar Stadtteile weiter in den Norden. Unsere nagelneue Dreizimmerwohnung lag im vierten Stock eines Hauses ohne Fahrstuhl in South Yarra. Es gab aber nun endlich warmes Wasser und eine Heizung, und Dad besorgte Teppiche und neue Möbel, was uns das Gefühl gab, eine Sprosse auf der Gesellschaftsleiter emporgeklettert zu sein. Zum richtigen sozialen Aufstieg fehlte uns nur noch ein Telefon, aber zu einer solchen Anschaffung ließ Dad sich dann doch nicht bewegen. „Wer was von uns will, kann vorbeikommen und klopfen“, pflegte er zu sagen.
Außerdem lautete unsere Adresse nun South Yarra und nicht Prahran, und das war eine ziemlich große Sache. South Yarra war (und ist) eine ziemlich noble Gegend von Melbourne, aber unser neues Zuhause, der Horace Petty Estate, lag in ihrer äußersten und dreckigsten Ecke. Wenn man gefragt wurde, wo man wohnte, und dann South Yarra sagte, dann hielten einen die Leute zunächst mal für einen feinen Pinkel. Wenn sie dann allerdings kapierten, dass man in den Wohnsilos im Süden zu Hause war, wurde man doch schnell wieder als Ghettokind abgestempelt.
Ganz in der Nähe unserer neuen Wohnung lag ein Schwimmbad, das nach dem damaligen australischen Premierminister Harold Holt benannt war – auch eine etwas unglückliche Bezeichnung, wenn man bedenkt, dass Holt 1967 im Meer baden ging und nie wieder an Land kam.
Als wir umzogen, beschloss ich, trotzdem auf meiner alten Schule zu bleiben, der Murrumbeena State School. Meine Eltern ließen mich gewähren; wenn ich bereit sei, jeden Morgen den langen Weg allein zurückzulegen, dann ginge das in Ordnung. Außerdem konnte ich jeden Morgen zusammen mit Dad bis zum Bahnhof gehen, und das war großartig, weil ich ihn für kurze Zeit für mich allein hatte und wir gute Gespräche führten. Leider ging das nicht allzu lange, weil es gesundheitlich mit ihm bergab ging. Er hatte zwar wieder einen Job gefunden, erst in der Nachtschicht beim Autozulieferer Repco, dann in der Möbelabteilung des Kaufhauses Foy in der Innenstadt, aber er musste die Arbeit schließlich aufgeben. Ich nahm morgens den Zug von Hawksburn Station, fuhr sechs Haltestellen weit und lief dann die Hobart Road hinunter zur Schule, die halbe fünfte und die ganze sechste Klasse lang. Die Zugfahrt hatte noch einen entscheidenden Vorteil. Ich freundete mich mit zwei hübschen Mädchen an, die etwas älter als ich waren, in Caulfield zur Schule gingen und auch in Hawksburn einstiegen. Sie bestanden immer darauf, dass ich mich zwischen sie setzte und bis Caulfield mit ihnen kuschelte, und ich leistete keinerlei Widerstand.
An der Murrumbeena State School ging es völlig anders zu als im Horace Petty Estate. Hier wurde nicht geflucht oder gespuckt, und es kam auch niemand auf den Gedanken, einen anderen zu treten oder zu schlagen. Nie wurde jemand aus dem Unterricht geschickt oder musste nachsitzen. Wir hatten sogar ein eigenes Schwimmbecken auf dem Gelände und zwei große Fußballfelder. Ich hätte mir nichts Besseres wünschen können. So führte ich ein Doppelleben: ein geordnetes, diszipliniertes an der Murrumbeena State und ein chaotisches, wildes, darwinistisches im Prahran Hilton, in dem der vierte Stock meine einzige Rückzugsmöglichkeit darstellte.
Ich war ein durchschnittlicher Schüler, der weder durch besonders gute Leistungen auffiel noch besonders viel Ärger hatte. Football war mein großes Hobby, und ich spielte das ganze Jahr. Von der zweiten Klasse an wurden zehn Prozent der Schüler für ihre Leistungen mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet. In der zweiten, dritten und vierten Klasse war ich weit davon entfernt, dazuzugehören, und in der fünften und sechsten Klasse verpasste ich viele Unterrichtstage, weil ich bei der Betreuung meines Vaters half und daher oft zu Hause lernen musste. Tatsächlich verbesserten sich meine Noten dabei aber sogar, und ich bekam auch eine Ehrenurkunde. In der sechsten Klasse war ich sogar der drittbeste.
Rückblickend will ich gar nicht so viel Schlechtes übers Hilton sagen, aber man musste sich schon ein bisschen dran gewöhnen. Ich war zehn, als wir dort einzogen, und wir wohnten noch nicht lange dort, da wurde ich eine Woche lang jeden Abend aufgemischt, wenn ich vom Bahnhof Hawksburn durchs Viertel nach Hause ging. Ich wurde zwar nicht schwer verletzt, aber einige Male musste ich doch ins Alfred Hospital, um meine gebrochene Nase wieder richten oder ein paar Platzwunden nähen zu lassen. Es wurde allmählich zur Gewohnheit, bis mich mein Vater eines Tages zur Seite nahm und sagte: „Wie lange willst du dir das noch bieten lassen?“ Aus Spaß war ich schon ein paar Mal gegen meinen Vater oder meinen Bruder John in den Ring gestiegen; John war ein guter Boxer, der später ins Profilager wechselte und sogar Johnny Famechon, dem Weltmeister im Federgewicht, zehn Runden lang standhielt, um dann nach Punkten zu verlieren. Aber ich war kein Kämpfer.
Bei meinen Angreifern handelte es sich in der Regel um drei Jungen, zwei Brüder und ihren dicken Kumpel. Der war wirklich riesig und noch dazu ein paar Jahre älter, was eine große Rolle spielt, wenn man erst zehn ist und verdammt viel Angst hat. Er war an der Reihe, mir eine Abreibung zu verpassen, als wir uns das nächste Mal begegneten, aber da ich wesentlich kleiner und leichter war als er, konnte ich dem Dicken entwischen. Was für mich super war, für ihn aber nicht: Als ich mich aus dem Staub machte, drehten sich seine beiden sogenannten Freunde zu ihm um und fielen über ihn her. Es war gnadenlos. Komisch, ich konnte damit umgehen, dass ich selbst zusammengeschlagen wurde, aber dass sie ihren eigenen „Freund“ verprügelten, damit hatte ich ein Problem. Ich fuhr herum und brüllte, sie sollten das lassen, und natürlich bekam ich die klassische Antwort: „Kannst ja mal versuchen, uns daran zu hindern!“ Zögernd ging ich auf sie zu und sah, dass der Dicke schon am Boden lag. Er war komplett erledigt. Überall war Blut, er sabberte, und außerdem hatte er sich bepisst. Als ich näher kam, entdeckte ich, dass er sich auch noch in die Hosen geschissen hatte. Da lag er, völlig neben sich, heulte und wälzte sich in seiner eigenen Pisse und Kacke. Nicht gerade ein toller Tag für ihn.
Ich hatte keinen Plan und ehrlich gesagt selbst eine Scheißangst. Aber in mir kochte heiße, reine Wut, vielleicht zum allerersten Mal in meinem ganzen Leben. Ohne nachzudenken ließ ich meine Schultasche fallen und versetzte dem älteren der beiden Brüder einen richtig harten Schlag, den ersten richtig ernst gemeinten, den ich je ausgeteilt hatte. Und auch wenn das aus meinem eigenen Mund vielleicht blöd klingt, es war ein richtig guter Schlag, der ihn genau am Kinn erwischte. Er war vermutlich ebenso verblüfft wie ich, denn er kippte um, als hätte ich ihm einen Kricketschläger übergezogen. Noch heute sehe ich es vor mir, wie der Typ geradewegs nach hinten fiel – ich sah nur noch, wie seine Augen sich verdrehten, dann war er weg. Sein Bruder lief sofort davon und schrie: „Ich hole meinen Vater!“ Ich tat es ihm gleich und rannte die Treppe zu unserer Wohnung empor.
Dad war zu Hause; er war damals oft daheim, obwohl ich nicht genau wusste, weswegen. Mir fiel sein breites Lächeln auf, und ein Lächeln war damals bei ihm eine Seltenheit. Wahrscheinlich wusste er schon, was auf ihn zukam. Jedenfalls strubbelte mir mein Vater durchs Haar und sagte: „Guter Schlag, Kumpel.“ Ich hatte das Richtige getan, meinte er, indem ich mich für jemanden eingesetzt hatte, der in Schwierigkeiten steckte. Dad hatte mir vom Küchenfenster aus zugesehen und sich laut gewünscht, dass ich mich umdrehen und dem Dicken helfen würde. Es ist eine der intensivsten Erinnerungen, die ich an meinen Vater habe.
Heute ist es seltsam, wenn ich in den Spiegel gucke und feststelle, wie ähnlich ich ihm sehe. Es erfüllt mich mit Wärme. Ich weiß, dass ich genauso lächele wie er; meiner Schwester Laura steigen immer noch die Tränen in die Augen, wenn sie sieht, dass sich ein Grinsen über meine Lippen zieht. Ich habe seine leicht olivfarbene Haut geerbt; wir beide bräunen schon nach kurzer Zeit in der Sonne auf genau dieselbe Weise. „Du würdest schon braun werden, wenn du beim Schlafen das Licht anlässt, mein Sohn.“ Das kann ich ihn geradezu sagen hören. Und ich weiß auch heute noch, wie schön es sich anfühlte, wenn er mich in den Arm nahm, und wie toll es war, wenn er mich damit überraschte, dass er sagte: „Komm, lass die Schule heute mal sausen. Wir gehen an den Strand, nur wir beide.“ Als die Krankheit ihn allmählich aufzehrte, merkte ich schließlich, dass seine Umarmungen zwar an Kraft verloren, aber nie an Wärme.
Mein Vater war ein interessanter Typ. Er war ein harter Kerl – früher hatte er selbst geboxt, später trainierte er meinen Bruder. Gleichzeitig war er aber auch sehr sanft. Außerdem hatte er Freunde in den verschiedensten Kreisen, vor allem im Chinesenviertel der Stadt. Ich hatte sogar einen chinesischen Paten. Wenn wir zu den Spielen des FC Carlton gingen, dann kehrten wir auf dem Weg dorthin im ersten Pub zum Mittagessen ein, im nächsten auf ein Bier, und dann in noch einem und noch einem. Mich überraschte, wie freundlich die Leute überall waren, und dass wir offenbar nie irgendwo bezahlen mussten. „Da kommt Pat mit seinen Jungs! Was bekommst du, mein Junge?“ Ich entschied mich immer für rote Limonade und eine kleine Tüte Kartoffelchips.
Meine Mutter erzählte einmal von einer Begebenheit ganz am Anfang ihrer Beziehung, als sie mit meinem Dad unterwegs zu meinem späteren Paten war, der in der Canning Street in Nord-Melbourne lebte. Irgendwann merkte mein Vater, dass ihnen drei Männer folgten. Dad grüßte meinen Paten, der auf seiner Veranda saß, und rief ihm zu: „Wo geht’s denn hier zum Bahnhof, Meister? Wir haben uns verlaufen.“ Er bekam seine Information, umarmte meine Mutter, ließ etwas Schweres in ihre Manteltasche gleiten und verabschiedete sich mit einem kurzen „Bis nachher“, bevor er dann wirklich den Weg zum Bahnhof einschlug.
Dad ging um eine Ecke, und die Männer folgten ihm. Als er schließlich zurückkehrte, hatte er einige Schnitt- und Platzwunden abbekommen, aber er sagte zu meiner Mutter: „Wenn sie die Knarre in die Hände bekommen hätten, wäre das viel schlimmer ausgegangen.“
Offenbar änderte mein Vater sich dann aber grundlegend, nachdem ich auf der Welt war. Meine Mutter bekam einen schweren Nervenzusammenbruch, musste ein halbes Jahr in einer Klinik bleiben und wurde mit Elektroschocks behandelt. In dieser Zeit übernahm es mein Dad, sich um uns vier Kinder zu kümmern. Deswegen wurde er schließlich auch Möbelverkäufer in dem Geschäft in Prahran.
Leider habe ich meinen Vater nie so gut kennen gelernt, wie ich es mir gewünscht hätte, obwohl mich das, was er mir beibrachte, bis heute geprägt hat. Ich wusste, dass er sterben würde, denn vor allem im letzten halben Jahr seines Lebens wurde es unübersehbar, dass wir diesen Kampf nicht gewinnen würden. Von daher war ich so gut auf seinen Tod vorbereitet, wie es eben ging. Ich fand es toll, wenn ich von der Schule nach Hause kam und ins Schlafzimmer meiner Eltern ging: mein Vater war bereits bettlägerig, und die einzige Farbe in seinem Gesicht war der Lippenstift meiner Mutter.
Dad lächelte mich an und sagte: „Deine Mutter konnte es mal wieder nicht lassen, Mark.“
Das bringt mich heute noch zum Lachen, obwohl er damals nicht einmal mehr die Kraft gehabt hätte, sich den Lippenstift wegzuwischen, selbst, wenn er gewollt hätte. Aber das war ganz typisch für meinen Vater. Er hatte ganz offensichtlich starke Schmerzen und versuchte, sich irgendwie mit dem bevorstehenden Tod abzufinden, aber er wollte noch immer einen Spaß mit mir teilen – natürlich auf Kosten meiner Mutter. Er war noch recht jung, ungefähr im selben Alter wie ich heute, und er wusste, dass er sterben würde. Aber er wollte trotzdem seinen Sohn zum Lachen bringen, und das in einer Situation, in der es verdammt wenig zu lachen gab.
Eines Nachmittags Ende März 1968 hatte ich zusammen mit meinem Kumpel Steven Kelly Football gespielt (er ist der Bruder meines Schwagers – gibt es für dieses Verwandtschaftsverhältnis eigentlich eine spezielle Bezeichnung?). Es war spät geworden, und als ich wieder zu unserem Haus zurückging, sah ich, dass mein Bruder mir entgegen kam. Ich wusste sofort: Jetzt ist es soweit. Mein Bruder war schon verheiratet und wohnte nicht mehr zu Hause, wieso sonst also würde er hier sein, noch dazu mit diesem Gesichtsausdruck? Es ging mit Dad zu Ende. Blindlings rannte ich an meinem Bruder vorbei und rein in unser Treppenhaus.
Mit Dad war es schon in den vergangenen vier Wochen abwärts gegangen. Er hatte immer mehr Schmerzmittel genommen und war deshalb oft auch gar nicht mehr ansprechbar, aber wir konnten noch ein bisschen reden, wenn die Wirkung des Morphiums nachließ und der Schmerz noch nicht wieder eingesetzt hatte. Ganz langsam ging er von dieser Welt, das wussten wir alle. Er versuchte sich zusammenzureißen, wenn Besuch kam, aber es war für alle schlimm. Wenn seine Freunde von ihren Gefühlen überwältigt wurden, rastete er aus. „Geh zum Heulen woanders hin – entweder, du erzählst mir was Lustiges, oder du haust ab“, raunzte er, wenn einem alten Freund die Tränen kamen.
Ich saß oft an seinem Bett. Er sah aus wie ein Skelett, über das noch Haut gespannt war, und er schien zu schrumpfen, aber er hatte noch immer sein typisches Lächeln, und manchmal hatten wir doch noch richtige Gespräche. Ich brachte meine ganzen Spielsachen an sein Bett und beschäftigte mich damit, reparierte meine Rennautos, während er eindöste, und wartete darauf, dass er wieder zu Bewusstsein kam. Wenn er sich dann wieder rührte, sagte er oft: „Verdammt noch mal, bist du immer noch hier?“
Der Rest der Familie versuchte mich vor der Krankheit abzuschirmen. Ich war erst zwölf Jahre alt, aber ich wollte unbedingt Zeit mit meinem Vater verbringen, ihm helfen, wenn ich konnte, und wenn auch nur dabei, ihn aufs Klo zu bringen und anschließend sauberzumachen. Als er schließlich nicht mehr laufen konnte und einen Rollstuhl brauchte, wusste ich, dass das Ende kam. In den letzten Wochen konnte ich ihn mit ein wenig Mühe aus dem Stuhl und auf die Toilette heben, und es war ein gutes Gefühl, dass ich zumindest etwas für ihn tun konnte, sein Kissen zurechtrücken oder ihm einen Eiswürfel zum Lutschen in den Mund stecken, Kleinigkeiten, damit er sich ein bisschen besser fühlte. Manchmal denke ich, dass man Kindern zuwenig zutraut, wenn es darum geht, Schicksalsschläge zu ertragen. Aus meiner Erfahrung würde ich sagen, dass sie erstaunlich gut in der Lage sind, mit schwierigen Umständen zurechtzukommen. Und davon mal abgesehen können junge Menschen allein durch ihre Ehrlichkeit ein wenig dringend benötigten frischen Wind in richtig beschissene Situationen bringen.
Als ich an diesem Tag Ende März in Dads Zimmer kam, gab er fürchterliche Laute von sich. Meine Mutter hielt ihn im Arm und wiegte ihn hin und her wie ein krankes Kind. „Geh nicht weg, Pat!“, stieß sie immer wieder hervor. Als sie mich sah, brach sie völlig zusammen, und sie so außer sich zu sehen, war für mich sehr befremdlich. Ich wollte zu ihr gehen, aber sie scheuchte mich weg und bat John stattdessen, mit mir rauszugehen.
John und ich gingen auf den Laubengang vor der Tür hinaus und sahen aufs Basketballfeld hinunter. Schließlich wandte mein Bruder mir den Kopf zu, aber er brachte nichts weiter heraus als „tut mir so leid, Alter“. Eine Weile standen wir nur da. John hatte den Arm um meine Schultern gelegt. „Ich schaue mal nach Dad, du bleibst hier.“ Vom Laubengang aus konnte ich alles hören, was vor sich ging. Die schrecklichen Laute wurden leiser, als Dad allmählich immer mehr das Bewusstsein verlor und wir auf den Krankenwagen warteten. In mir wurde alles taub, es war verwirrend. Ich hörte die Laute, aber meine Gedanken drifteten davon, und ich sah ein paar Freunden zu, die auf dem Basketballfeld im Hof unter uns spielten. Dann holte mich ein Geräusch wieder zurück. Wo blieb nur der Krankenwagen? Wieso brauchten die so lange?
Als der Notarzt schließlich kam, stellte sich heraus, dass der Fahrstuhl zu klein war, um die fahrbare Krankenliege hineinzuschieben. Also schnallte man meinen Dad auf eine Trage, die dann im Lift fast aufrecht gestellt werden musste. Die Fahrt nach unten dauerte nur 20 Sekunden oder so, aber gefühlt war es eine Ewigkeit, und sie hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Dad hing schlaff in den Riemen der Trage und holte keuchend Luft. Der Boden des Fahrstuhls war verdreckt und stank nach Pisse. Dads Füße waren nackt, und der Gedanke, dass sie schmutzig werden könnten, machte mich verrückt, weil ich wusste, wie sehr er das hassen würde. Er ging niemals barfuß irgendwo hin.
Unten wurde er in den Krankenwagen verfrachtet, und Mum und John stiegen mit ein, während ich nur zusah. Er war nun ganz still geworden, und ich war mir sicher, dass er nicht mehr unter uns war. Es war überhaupt ganz, ganz still, abgesehen von dem Klatsch, Klatsch, Klatsch des Basketballs, der auf dem Feld hinter dem Parkplatz immer wieder auftrumpfte. Danach fuhr ich in dem stinkenden Fahrstuhl wieder nach oben und saß dann allein in meinem Zimmer. Dad starb am 22. März 1968.
Ich vermisse meinen Vater heute noch – mit jedem Jahr, das vergeht, sogar mehr. Es gibt so vieles, was ich gern mit ihm geteilt hätte. Dad, John und ich waren begeisterte Fans des Carlton Football Clubs, auch Mighty Blues genannt, und ich erinnere mich noch gut daran, wie ich bei den Spielen der Blues im Princes Park auf Dads Schultern saß, frische Erdnüsse kaute und die Schalen aus seinem vollen, schwarzen, mit Brillantine zurückgekämmtem Haar pulte. Wenn die Blues wieder mal was auf die Mütze bekamen, heulte ich, aber Dad tröstete mich immer, indem er sagte: „Nächste Woche ist das nächste Spiel, Junge.“ Ich versuchte nicht zu weinen, als die Blues ein halbes Jahr nach Dads Tod endlich das Grand Final gewannen. Aber als ich mich zu John umwandte, sah ich, dass der in einem Tränenmeer ertrank. Ich brüllte zum Himmel empor: „Ich hab dir immer gesagt, wir schaffen es!“
Während meiner sechsten Klasse an der Murrumbeena State School war ich an den Freitagen oft zu Hause geblieben, um Zeit mit meinem Vater zu verbringen. Irgendwann, ich glaube, es war kurz vor Weihnachten 1967, hatte ich ihm erklärt, dass ich nicht zu seiner Beerdigung gehen wollte.
„Das ist in Ordnung“, sagte er. „Du musst nicht, wenn du nicht willst.“
Mein Gott – wie muss er sich dabei gefühlt haben? Heute wird mir ganz kalt, wenn ich mir vorstelle, dass eines meiner Kinder so etwas zu mir sagt. Ich ging wirklich nicht zu seiner Beerdigung, und wahrscheinlich ist das der Grund, weshalb mich diese Erinnerungen noch immer so quälen. Ich hatte lange Zeit deswegen Schuldgefühle. Heute noch träume ich manchmal, dass mein Vater plötzlich auftaucht und sagt: „Dich hatte ich hier gar nicht erwartet.“ Aua.
An der Prahran High gab es einen jungen Lehrer, Richard Moran, der zur gleichen Zeit an die Schule gekommen war wie ich. Er war wohl erst Mitte 20, ziemlich gradlinig und anständig, aber kein Typ, der oft lächelte. Er ließ keinen Blödsinn durchgehen und war ziemlich streng, aber bei ihm wusste man, woran man war. Er war es, der mir Bücher nahe brachte, einfach, indem er sie im Unterricht erwähnte. Ich bin mir nicht sicher, ob er das tat, um uns zum Lesen anzuregen, aber bei mir hatte es jedenfalls diese Wirkung. Zu den von ihm genannten Büchern zählten Harper Lees Wer die Nachtigall stört und Hemingways Der alte Mann und das Meer, und beide wurden zu meinen Lieblingsbüchern.
Mr. Moran behielt mich stets im Auge. Ich war Klassensprecher, und wir kamen von Anfang an gut miteinander aus. Eines Morgens im Englischunterricht merkte er, dass ich nicht bei der Sache war, und er wies mich deswegen zurecht. Als ich trotzdem nicht aufpasste, wurde er sauer und ließ mich vortreten.
„So, Evans, kannst du mir bitte kurz wiederholen, was ich der Klasse gerade gesagt habe?“
„Nein“, antwortete ich.
„Was ist denn heute Morgen los mit dir, Evans?“
Er wollte mich richtig anschnauzen, das merkte ich, aber dann ließ er mich ganz unverhofft doch in Ruhe, was eigentlich nicht seine Art war. Ein wenig später kam er zu meinem Platz, während der Rest der Klasse an einer Aufgabe arbeitete, und beugte sich zu mir hinunter.
„Was ist heute mir dir los? Was hast du für ein Problem?“
„Heute wird mein Vater beerdigt“, sagte ich. „Ich wollte nicht hingehen, deswegen bin ich lieber zur Schule gekommen.“
Mr. Morans Gesicht wurde starr. Er sah kurz weg, dann legte er mir die Hand auf die Schulter.
„Davon hat man uns gar nichts erzählt. Es tut mir so leid.“ Sein Gesicht war jetzt weiß wie eine Wand. Dann fragte er etwas ganz Blödes: „Bist du sicher?“
Ich musste gar nichts sagen, er sah mir die Antwort an. Es hatte wirklich niemand an der Schule Bescheid gesagt, dass Dad gestorben war. Meine Mutter hatte es sicher tun wollen, aber irgendwie war das wohl vergessen worden.
Dann fragte Mr. Moran ganz leise, als spräche er mit sich selbst: „Woran ist er denn gestorben?“
„An Krebs“, sagte ich.
„Hier hat niemand gewusst, dass er krank war. Warum hast du nie etwas gesagt, Mark?“
Darauf hatte ich keine Antwort. War es meine Aufgabe, davon zu erzählen? Ich war ganz durcheinander; es war, als stünde ich neben mir und sah dem Geschehen mit Abstand zu. Wie konnte das geschehen? Wieso hatte er nichts gewusst, und wieso hatte Dad sterben müssen?
1971 lag Dads Tod drei Jahre zurück. Ich war 15, als meine Mutter beschloss, ins etwa 40 Kilometer entfernte Seaford zu ihrem neuen Lebenspartner Jock Livingstone zu ziehen, in ein Haus am Strand. Ich konnte verstehen, dass sie mit Jock einen neuen Anfang machen wollte, weit weg vom Hilton und den Erinnerungen an den Verlust von Dad. Ich hatte kein Problem damit, dass sie wegziehen wollte. Im Gegenteil, ich wollte einfach nur, dass sie wieder glücklich wurde.
Allerdings wollte ich deswegen nicht die Schule wechseln, daher blieb ich in unserer Wohnung im Prahran Hilton, und Mum erklärte sich bereit, regelmäßig vorbeizuschauen, um sicherzugehen, dass die Bude noch stand. Mum war vor allem zu Anfang von dieser Vereinbarung wenig begeistert, aber ich war schon immer sehr unabhängig gewesen, und sie hatte mir beigebracht, mich allein zu versorgen, was den Haushalt betraf. Trotzdem brauchte sie eine Weile, um mit dieser Situation zurechtzukommen. Ich hatte natürlich Glück, dass ich mit 15 schon eine eigene Wohnung hatte. Aber in was für einem Umfeld. Das Hilton war damals als Selbstmordadresse berühmt-berüchtigt. Die Leute fuhren mit dem Fahrstuhl bis aufs Dach und sprangen runter.
Einmal stand ich bei meiner Freundin Terri Mannix in der Küche, und während wir uns unterhielten, sah ich etwas am Fenster vorbeirauschen. Dann ertönte ein Geräusch, das ich nur mit dem einer dicken Wassermelone vergleichen kann, die frontal gegen einen Lkw prallt. Zwar hatte ich schon ein schlechtes Gefühl, aber ich ging trotzdem auf den Balkon, um nachzuschauen. Ich wünschte, ich hätte es nicht getan – der Anblick hat sich für immer in mein Unterbewusstsein eingebrannt. Der Selbstmörder da unten auf dem Boden sah aus wie ein Gemälde von Picasso, es war schrecklich. Irgendwie überraschte es mich, dass ein Körper aus so großer Höhe – das Hilton hatte immerhin zwölf Stockwerke – auf den Boden prallen konnte, ohne völlig auseinanderzubrechen. Es war das erste Mal, dass ich einen Toten sah. Er war auf einem Firmenschild gelandet, das ein wenig wie ein Raumschiff aussah. Ich wandte mich zu Terri um und sagte: „Wenigstens hatte er ein Ziel vor Augen.“ Man stumpfte schon ein wenig ab, wenn man im Hilton lebte.
Mein bester Freund, Graham Kennedy, wohnte ebenfalls dort. Er stammte aus Glasgow und hatte, als er zehn Jahre alt war, in den Straßen von Cran Hill mit meinem späteren Bandkollegen Malcolm Young Fußball gespielt. Graham sagte mir, sein Vater Neil hatte schon einmal einen Selbstmörder vom Hilton springen sehen, als er abends von der Arbeit kam. Er beschrieb, wie der Mann kerzengerade, „wie eine verdammte Rakete“, mit an den Körper angelegten Armen und den Füßen voran vom Dach herunterschoss und sich in eines der von der Wohnungsbaugesellschaft frisch angelegten Blumenbeete bohrte. Eine der Klatschbasen aus der Gegend sprach daraufhin von „unserem neuen Gartenzwerg“. Bei einer Party zeigte mir jemand ein Polaroid-Foto von dem Typ und bat mich, es mit meiner Unterschrift sozusagen zu beglaubigen, aber das war dann doch ein bisschen krass, selbst für mich. (Polaroids wurden später noch ein großes Thema auf Tournee, und es hatte schon seine Gründe, dass ein Mitglied der AC/DC-Crew von „Pornoroids“ sprach.)
Ich war 15, als ich mit einigen meiner Kumpels zu einem „Turn“ eingeladen wurde, einer Party, die von ein paar älteren Jungs veranstaltet wurde. Die Bedingung war, dass wir ein paar Dutzend Flaschen Bier Marke Vic Bitter mitbrachten, und außerdem ein paar Mädchen. Aus irgendeinem Grund, der sich mir bis heute nicht erschlossen hat, wurden Mädchen damals „Bürsten“ genannt. Wir gingen gerade den Laubengang im ersten Stock zum „Turn“, als einer der Partygäste durch die Fliegengittertür krachte und von zwei riesigen Typen verdroschen wurde.
Nach einer ziemlich gründlichen Abreibung sagte einer der beiden Angreifer zu seinem Opfer: „Komm schon, Alter, steh auf. Ist doch nichts passiert, hau ab, sieh zu, dass du nach Hause kommst.“ Dann wandte er sich an seinen Kumpel: „Fass mal mit an, ja?“ Und die beiden nahmen ihren Punching-Ball und warfen ihn geradewegs über das Geländer. Als er unten aufschlug, hörte es sich wie eine zerplatzende Wassermelone an. Der eine der beiden Schläger guckte uns an, nahm uns die Flaschen ab und sagte: „Danke, Jungs. Wo sind die Bürsten?“
Glücklicherweise hatten ein paar Büsche und Sträucher den Fall des Prügelknaben gebremst, aber wir dachten damals ernsthaft, dass wir wieder mal eine Leiche im Vorgarten hatten. Die Angreifer gingen wieder in die Wohnung, wir aber nicht; wir fragten uns noch, was wir wegen der neuesten Gartendeko unternehmen sollten. Vielleicht war die Party doch keine so gute Idee.
Dann hörte ich von unten eine Stimme.
„Hey, sind sie wieder reingegangen? Sind sie weg?“
Es war der Typ im Gebüsch. Ich konnte es nicht glauben. Er war am Leben. Wir sagten ihm, die Luft sei rein, und er sprang auf und raste davon wie ein Olympiasprinter, mit richtig großen Sprüngen, und ward nie wieder gesehen. Keine Ahnung, was er eingeworfen hatte – wir hatten damals zwar schon von „Speed“ gehört, wussten aber nicht, was das eigentlich war, wir hielten uns an Alk und sonst nichts – aber ganz sicher hatte der Typ am nächsten Morgen, als er die Wirkung von was auch immer nachließ, nicht den besten Tag.
Trotz all dieser Geschichten habe ich nicht nur schlechte Erinnerungen ans Hilton. Sicher, es gibt jede Menge Gründe, dieses Hochhaus zu hassen, in dem man ständig rumgeschubst, bedroht und zusammengeschlagen wurde. Es war einfach ein übles Loch, in dem jede Menge schräge Typen, Loser und Kaputtniks herumhingen, von den ganz normalen Schlägereien und den damit verbundenen Problemen einmal abgesehen. Die Erinnerung an den Tod meines Vaters war eigentlich noch ein Grund mehr, für diese Höhle keinerlei Sympathien zu hegen. Aber ich habe immer die Ansicht vertreten, dass Erinnerungen selektiv sind, wenn man eine positive Einstellung hat. Es wäre leicht für mich gewesen, mich als Opfer zu betrachten und aufzugeben, oder zu glauben, dass die Welt mir etwas schuldig war, weil ich es in meinen jungen Jahren so schwer gehabt hatte. Aber ich habe für diese Leute nichts übrig, die von Beruf Opfer sind – manche Menschen überstehen unfassbare Tragödien und finden trotzdem Möglichkeiten, weiterzuleben. Vielleicht war es für mein späteres Leben ganz hilfreich, als ich im Hilton oft auf die Probe gestellt wurde und früh lernte, mit beschissenen Situationen umzugehen. Wenn man sieht, wie andere Leute sich ihr Leben versauen, kann man daraus für sich eine Menge lernen, jedenfalls, wenn man einen klaren Kopf behält. Es ist wie eine Art umgekehrter Vorbildfunktion: Ich habe gesehen, wie Leute ihr ganzes Leben weggeworfen haben und mir selbst das Versprechen gegeben, nie so tief zu sinken. Graham und ich wurden endgültig wach, als wir anfingen, ein bisschen Geld zu verdienen, und ich weiß noch, dass er irgendwann sagte: „Wir müssen raus aus diesem Loch. Komm, wir sparen unsere Kohle und gehen irgendwann nach London.“ Das war unser Plan. Und schon allein deswegen, weil wir einen Plan – nein, einen Traum hatten, fühlte ich mich besser. Die Vorstellung, eines Tages irgendwie rauszukommen, war mir sehr wichtig.
Ein anderer guter Freund von mir hieß Steve McGrath. Wir hatten uns beim Football kennen gelernt. Er übernachtete oft am Wochenende bei mir im Hilton, und wir machten das, was alle Jungs im Teenageralter wollen, aber aus Mangel an Gelegenheit nur selten können: Wir luden Mädchen ein, bei uns, ähm, „die Nacht zu verbringen“. Immerhin nannte man meine Wohnung den Club 56, und dort war so ziemlich alles möglich. Steve machte sich allerdings schon bald darum verdient, mich wirklich aus dem Hilton rauszuholen und mir noch dazu eine ganz Welt voller neuer Möglichkeiten zu eröffnen, die den seltsamen Namen AC/DC trug.
Als ich in Glynis Edwards eine feste Freundin fand, war Steve deswegen zunächst ein wenig missmutig, denn das schränkte unsere Wochenend-Vergnügungen natürlich ziemlich ein. Glynis stammte aus Stevenage in England und war, als sie mit ihrem Lächeln in unserer kleinen Szene auftauchte, gerade mal 16. Zuerst blieb sie immer nur übers Wochenende, zog aber später dauerhaft bei mir ein, als sie einen Job in einem Maklerbüro in South Yarra fand. Es klingt ein bisschen arg nach Ghettostory, dass da ein 17-Jähriger und eine 16-Jährige allein in einer Wohnung hausten, aber unsere Mütter waren tatsächlich einverstanden. Und mal davon abgesehen wäre das mit uns ja sowieso weitergegangen, es sei denn, sie hätten Glynis in ein Kloster gesperrt. Wir waren zudem richtig gute Freunde, und das ist ein wiederkehrendes Muster in vielen meiner Beziehungen, auch in den späteren. Ich war immer gern in weiblicher Gesellschaft. Grundsätzlich finde ich Frauen wesentlich interessanter als Männer, und das nicht nur aus körperlichen Gründen – obwohl mir das natürlich auch wichtig ist. Aber ich habe mich in der Gegenwart von Frauen nie unwohl gefühlt. Wahrscheinlich war ich ein bisschen schüchtern, vor allem, als ich noch jünger war, aber das war dann auch schon alles.
Es war nicht schwer, in unserem Viertel an Mädels ranzukommen. In den drei Hochhäusern und den angrenzenden Wohnblöcken wohnten ein paar Tausend Menschen, und die Bevölkerungsgruppe, die mich naturgemäß besonders interessierte – die weibliche eben – machte ebenso naturgemäß einen recht hohen Prozentsatz aus. Ich hatte mich immer schon gern ein bisschen umgesehen, bevor Glynis erschienen war – und, wie ich bei allem Respekt ihr gegenüber zugeben muss, nachher gelegentlich auch.
Allerdings traf ich mich nicht nur mit Mädchen meines Alters. Bevor ich mit Glynis zusammenkam, hatte mir eine verheiratete, junge Mutter aus unserem Haus eine höchst intensive Stunde Sexualkundeunterricht erteilt. Helen (so hieß sie natürlich nicht wirklich) und ich liefen uns gelegentlich über den Weg, wir grüßten uns, ich half ihr gelegentlich manchmal beim Tragen ihrer Einkäufe und gab mir Mühe, einen netten Eindruck zu machen. Sie war allerdings auch jemand, in dessen Gegenwart man einfach immer nett sein wollte, und davon abgesehen ein ziemlich heißer Feger von Ende 20. Bei der Party zu ihrem 30. – sie hatte mich eingeladen – hatte sie ein bisschen zu viel getrunken und ließ es sich deutlich anmerken, dass sie ein Auge auf mich geworfen hatte. Jedenfalls guckten mich einige der anderen Frauen ziemlich komisch an, und ich denke mal, die merkten, dass da was im Busch war. Glücklicherweise war ihr Gatte hackedicht und bekam nicht mit, dass seine Frau mich gern mal rangelassen hätte.
Ich zähle wahrscheinlich zu den wenigen Menschen, die ihre Jungfräulichkeit verloren, als sie eigentlich nur eine neue Lee-Rider-Jeans durchwaschen wollten. Das ist ja das Tolle am Leben – man weiß einfach nicht, was hinter der nächsten Ecke auf einen wartet. In meinem Fall war das Helen.
Auf jedem Stockwerk im Hilton gab es eine Waschküche, in der eine große Industrie-Waschmaschine und ein altmodischer, freistehender Trockner mit Schleuderautomatik stand, der einen höllischen Lärm machte und wie verrückt vibrierte. Ich war kurz zuvor bei Schneider-Boris gewesen, einem alten, jüdischen Schneidermeister, der uns Jungs mit unseren Levis und Lees, Cowboyhemden und ähnlichem versorgte, und der mir immer einen besonders günstigen Preis machte, weil er meine Mutter gut leiden konnte. Und wie wir alle wissen, muss man eine neue Jeans vorm ersten Tragen erst einmal waschen, damit sie nicht so steif ist, dass man rumläuft wie der Blechmann aus Der Zauberer von Oz. Also ab zur Waschküche.
Die Trockenschleuder rotierte vor sich hin und dröhnte dabei in ihrer üblichen Lautstärke, und daher hörte mich Helen nicht, als ich eintrat. Zuerst kapierte ich gar nicht, was sie da trieb, aber dann erkannte ich, dass der Trockner sich nicht nur den Handtüchern widmete, die in ihm rotierten. Ich war völlig hin und weg und stand wie erstarrt da. Gerade wollte ich mich umdrehen und mit Lichtgeschwindigkeit verduften, da bemerkte Helen mich, und ich nehme an, sie war schon viel zu gut dabei, als dass es ihr etwas ausgemacht hätte, dass ich das Ganze mitbekam. Sie griff nach mir, umschlang mich in einer geradezu bärigen Umarmung und zog mich zu Boden. Zu diesem Zeitpunkt machte ich mir bereits fast in die Hose.
Helen zeigte mir natürlich, wo es langging. Ich war 14 und hatte nicht die geringste Ahnung von Sex. Aber so verlor ich meine Unschuld, auf dem kalten, harten Betonboden einer Waschküche. Es war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
Als Kind der späten Sechziger und frühen Siebziger hatte ich zwei weitere große Interessen außer Mädchen: Australian Football und Musik. Ich spielte beim East Hawthorn Football Club auf der Position des Rovers im Mittelfeld und war vorm Tor ein echt gefährlicher kleiner Drecksack. Klar liebte ich es, den Ball rein zu machen. In einer Saison schlug ich einmal Robbie Flower, der später bei den Meisterschaften der einzelnen Bundesstaaten als Kapitän spielte, in einem Torschusswettbewerb. Gerne wäre ich Profi-Footballer geworden, und ich war total verrückt nach meinem eigenen Team, Carlton. Bin ich heute noch. Damals stellte Carlton die ganze Liga auf den Kopf und besiegte in den Schlagerspielen vor allem die Lokalrivalen vom Collingwood FC, dank Spielern wie Alex Jesaulenko, John Nicholls, Sergio Silvagni, Robbie Walls und dem großartigen Ron Barassi, mit dem alles begann.
Es gibt ein Foto von Ron und mir, das noch immer einen Ehrenplatz über meiner Bar einnimmt. Es entstand bei einem „President’s Lunch“ vor einem Spiel der Sydney Swans gegen Melbourne, das 1997 im Sydney Cricket Ground stattfand. Es ist eines der ganz seltenen Fotos, auf dem ich mit Schlips zu sehen bin, denn ohne den fand man keinen Einlass. Ron war einer meiner großen Helden gewesen, seit er 1966 bei Carlton als Captain-Coach unter Vertrag stand. Ich hatte ein paar Mal Gelegenheit, mich mit ihm zu unterhalten, und habe es jedes Mal genossen. Er ist eine überlebensgroße Gestalt im Football, ein eigenwilliger, ganz spezieller Typ und ein richtiger Gentleman. Und ganz sicher hat er das umwerfendste Lächeln im ganzen australischen Sport. Ein paar Jahre später traf ich Ron bei einem Barbecue der Swans erneut und bat ihn, das Foto zu signieren.
Ron betrachtete das Bild, dann guckte er mir ins Gesicht, sah an mir herunter und fragte knochentrocken: „Waren seitdem wohl ein paar harte Jahre, was?“
Als Teenager war ich ein begeisterter Footballspieler. Mit 16 machte ich mein erstes Spiel für meinen neuen Club, St. Kilda City, der Nachwuchsmannschaft des Traditionsclubs und Calton-Konkurrenten St. Kilda, und gleich in der ersten Minute prallte ich mit einem riesengroßen Gegenspieler zusammen, der mich mit einem gut gezielten Stoß seines Ellenbogens ausknockte. Ich fiel um wie ein Stein, und als ich wieder zu mir kam, hörte ich als erstes, wie einer der Trainer sagte: „Eine so schlimm gebrochene Nase habe ich noch nie gesehen.“ Na, herzlichen Dank aber auch. Er wischte mir das Gesicht mit einem nassen Handtuch ab und fügte dann hinzu: „Sollen wir die mal wieder geradebiegen?“
Damit legte er mir seine schmierigen Pfoten auf beide Seiten meiner Nase, und es machte „Knack!“ und „Knirsch!“ Dann stellte er zufrieden fest: „Na also, das sieht man schon gar nicht mehr.“ Inzwischen war ich zwar schon wieder auf den Beinen, stand aber kurz davor, wieder umzukippen. Ich spuckte, schluckte, hustete Blut und sah nur noch schwarz-weiß. Meine Augen schwollen allmählich zu. Aber trotzdem schaffte ich es, bis zum Quartertime Break durchzuhalten, und unser Trainer kam zu mir und gratulierte mir zu meinem Durchhaltevermögen.
„Ich dachte, der hätte dich umgebracht“, sagte er über den frühen Schlag, der mich erwischt hatte. Dann fragte er, ob ich noch ein Quarter schaffen würde. „Das bisschen Schmerz bringt dich schon nicht um.“
Tatsächlich spielte ich weiter bis zur Halbzeitpause, und das noch nicht mal schlecht, aber in der Pause schwollen meine Augen vollständig zu, und damit war Schluss. Einige Tage lang konnte ich nichts sehen. Football war mir unglaublich wichtig, aber mein Selbsterhaltungstrieb und die Tatsache, dass ich – für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich gut genug und groß genug dazu war und tatsächlich überlebte – dazu eingeteilt worden war, bei St. Kilda zu spielen, standen einer Karriere als Profi-Footballer dann doch im Wege.
Und überhaupt wurde die Musik allmählich immer wichtiger. Von frühester Kindheit an war ich von Musik umgeben. Mein Vater war ein großer Fan von Nat King Coles seidiger Stimme. Meine Mutter hörte lieber Frank Sinatra. Aber mit Laura und John fing der Spaß erst richtig an. Bei ihnen liefen ständig Platten von Elvis Presley, Eddie Cochran, Fats Domino, Jerry Lee Lewis, Little Richard und Buddy Holly. Und mitten drin war ich und hopste noch in Windeln zwischen den groovenden Teenagern herum. Schon bald traten dann dank Judy auch die Beatles, die Stones und The Who in mein Leben. Jahre später, als ich mich mit dem Verkauf klassischer E-Gitarren beschäftigte, lernte ich George Harrison persönlich kennen, einen starken Typen und echten Gentleman.
Als ein paar Freunde anfingen, auf Gitarren herumzuschrammeln, war ich sofort mit dabei. Den ersten Bass kaufte ich mir aus dem Grund, aus dem heraus es die meisten Bassisten tun – aus reiner Notwendigkeit, weil niemand anders den Job übernehmen will. Ich sah mich schon bald als den nächsten John Entwhistle, den Killer-Bassmann von The Who. Mit Musikunterricht gab ich mich nicht allzu viel ab, was wahrscheinlich niemanden überraschen wird, der mich einmal hat spielen sehen. Die paar Stunden, die ich tatsächlich hatte, gab mir ein großartiger Gitarrist namens Tony Naylor, der bei Allan’s Music auf der Collins Street in Melbourne unterrichtete. Mein Kumpel Graham Kennedy und ich nahmen jeder vier Stunden, und danach guckten wir selbst, wie es weiterging.
Mit 15 sah ich mein erstes richtig großes Konzert mit Graham in der Festival Hall von Melbourne; die britischen Rocker von Free. Sie traten gemeinsam mit Manfred Mann’s Earth Band und Deep Purple auf, aber Free fegten die anderen geradezu von der Bühne. In diesem Augenblick wusste ich, dass ich in einer Band spielen wollte. Die Typen da oben waren so cool und auch noch sehr jung – Gitarrist Paul Kossoff war nur vier Jahre älter als ich. Plötzlich kam es mir gar nicht mehr so unrealistisch vor, von einem Rock’n’Roll-Leben zu träumen: Wenn diese Jungs es so weit gebracht hatten, warum dann nicht auch ich? Ich hatte schon andere Bands in der Festival Hall gesehen, darunter auch Creedence Clearwater Revival, die absolut phantastisch waren, aber Free waren für mich wirklich das Größte.
Meine Mutter unterstützte mich sehr in meinen musikalischen Ambitionen, auch wenn ich sie einmal schwer enttäuschte: Ich lehnte ihren Vorschlag ab, bei der Caulfield City Pipe Band Dudelsackspielen zu lernen. Keine Ahnung, wieso sie auf diesen Gedanken kam; meine Mutter hatte – und hat – gelegentlich ziemlich exzentrische Einfälle. Man stelle sich nur vor, was die anderen Mieter im Hilton gesagt hätten, wenn sie mich in einem Kilt erwischt hätten! Es ist wiederum eine ironische Wendung des Schicksals, dass mir ein wenig Dudelsack-Erfahrung durchaus gelegen gekommen wäre, als wir später „It’s A Long Way To The Top“ aufnahmen. Aber das konnte ich ja damals nicht wissen.
Aber meine Mutter nahm mir das nicht übel. Wenn sie bei uns im Hilton vorbeiguckte, dann hörte sie Graham und mir bei unseren ersten Versuchen auf sechs Saiten zu, wenn wir die Rolling Stones, The Who und all die anderen verhackstückten. Das war noch während unserer Akustikphase. Als die elektrischen Gitarren, die Verstärker und das Schlagzeug bei uns Einzug hielten, strapazierten wir ihre Geduld ein wenig stärker. Laute Rockbands in der Lernphase sind in einem zwölfstöckigen Hochhaus selten willkommen. Meine Mutter hatte zwar etwas gegen unsere Lautstärke, aber sie stand trotzdem immer hinter uns; die Musik sorgte ihrer Meinung nach dafür, dass wir nicht auf der Straße herumlungerten und uns mit der Polizei anlegten. Und das an sich war schon mal eine gute Sache.
Meinen ersten Bass kaufte ich im Oriental Pearl Loan Office auf der Chapel Street in South Yarra für 22 Dollar. Es war eine Pfandleihe, eine düstere, staubige, muffige Höhle, in der die verschiedensten schrägen Typen herumlungerten und auf eine Wendung des Glücks oder das Geschäft ihres Lebens warteten. Der Laden machte besten Umsatz mit „Gütern aus zweiter Hand“. Der Besitzer, ein kleiner Typ namens Neil, nahm als Bezahlung ohne weiteres den Gutschein der Sozialbehörde an, der eigentlich für meine Schulbücher ausgestellt worden war. Bei dem Bass handelte es sich um einen ziemlich schlechten Fender-Precision-Nachbau, der mich dazu zwang, rechtsseitig Bass-Spielen zu lernen, obwohl ich eigentlich Linkshänder war. Eigentlich hatte ich das Instrument umdrehen und wie Paul McCartney links herum spielen wollen, aber das funktionierte nicht, weil die tiefste Saite dann nicht mehr an den ganz äußersten Wirbel gereicht hätte. Die einzige Lösung wäre ein neuer Satz Saiten gewesen, aber ich hatte leider nur einen Gutschein zum Bezahlen gehabt. Also brachte ich mir bei, rechtsseitig zu spielen.
Als Linkshänder hatte man damals ohnehin jede Menge Schwierigkeiten. In der ersten Klasse hatte ich eine Lehrerin, eine absolut grauenhafte Frau, die Linkshänder nicht ausstehen konnte und alle „betroffenen“ Schüler links an die Doppeltische setzte. Dann ging sie mit gezücktem Lineal durch die Reihen und schlug alle Kinder auf die Knöchel, die sie mit einem Stift in der linken Hand erwischte. Wir Linkshänder wurden also regelrecht zum Rechtsschreiben geprügelt. Wer leicht stotterte, bekam von der blöden Ziege eins mit dem Gürtel übergezogen.
Ich investierte an der Prahran High nicht allzu viel Energie oder Zeit, und den größten Teil meines Wissens habe ich mir irgendwie selbst beigebracht. In den etwas mehr als fünf Jahren, die ich an dieser Schule war, gab es keine Woche, in der ich wirklich an allen Tagen erschien. Ich machte immer mal wieder blau. Und Hausaufgaben machte ich überhaupt nicht – kein einziges Mal. Aber trotzdem lavierte ich mich irgendwie durch und bewarb mich schließlich sogar um ein Stipendium für eine Ausbildung an einem Lehrer-College. Als Lehrer hatte man zehn Wochen Jahresurlaub, und schon allein das hatte seinen Reiz. Seltsamerweise fiel ich während der ganzen Zeit an der Prahran High nur in einem Fach wirklich mit Pauken und Trompeten durch – in Musik.
Schule war für mich eine Art Teilzeitvergnügen. Im Grunde schwänzte ich auch gar nicht, weil meine Mutter darüber Bescheid wusste, dass ich nicht hinging. Es war nicht ihre Art, mich zum Schulbesuch zu zwingen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie mich deswegen zur Rede gestellt hätte. Ich nehme an, wenn meine Zensuren stark in den Keller gegangen wären, hätte es anders ausgesehen.
Es war kein Zufall, dass die Fächer, an denen ich den meisten Spaß hatte, immer von Lehrern unterrichtet wurden, die ich mochte. Englisch war mein Lieblingsfach; so lange ich denken kann, haben mich Wörter und das, was man mit ihnen machen kann, fasziniert. Als ich zur Prahran High School wechselte, las ich bereits sehr viel, auch wenn ich die Bücher, die wir im Unterricht behandelten, meist liegen ließ, zum Beispiel J.D. Salingers Der Fänger im Roggen – ich habe mich immer gefragt, ob solche Bücher wohl extra geschrieben werden, um Schulkinder zur Verzweiflung zu treiben.
Geschichte und Erdkunde fand ich ebenfalls ganz spannend. Dort erfuhr ich etwas über andere Länder, und so etwas fesselte meine Aufmerksamkeit immer, ebenso wie Miss Starr, unsere Geschichtslehrerin. Sie war sehr zierlich und keine klassische Schönheit, aber so gebaut wie keine andere Frau, die ich kannte. Es war, als hätte der liebe Gott ausprobieren wollen, wie er eine Frau bestücken konnte. Mathe war mir ein Buch mit sieben Siegeln, wie eine fremde Sprache, was dieses Fach ja wahrscheinlich auch irgendwie ist. Algebra ist mir heute noch ein Rätsel, obwohl meine jüngste Tochter Virginia sich inzwischen alle Mühe gibt, mir den Stoff der achten Klasse zu verklickern. Die Naturwissenschaften gingen mir auf den Zeiger, und das einzige Thema, das mich einigermaßen ansprach, war Astronomie. Das war wirklich cool.
Football spielte an der Schule auch eine große Rolle, obwohl die Wettkämpfe mit anderen Schulen wie der Richmond oder der Fitzroy High eher unbewaffneten Zweikämpfen glichen. Ich war froh, für die Prahran High aufzulaufen, denn wir hatten ein paar echte Psychopathen im Team. Ein Typ tat das ganze Spiel über so, als sei er ein Cowboy – er klatschte sich beim Laufen auf den Hintern und hoppelte, als säße er auf einem Pferd, während er ein ohrenbetäubendes „Yee-hah!“ ausstieß. Während eines Spiels knockte er einen seiner Gegner mit einem kernigen Klaps richtiggehend aus. Als der Schiedsrichter ihn vom Feld stellte, erklärte er: „Der hat mit dem Mädchen vom Sheriff getanzt!“ Ein anderer aus unserem Team fuhr ein unsichtbares Motorrad. Wir haben nie ein Spiel verloren.