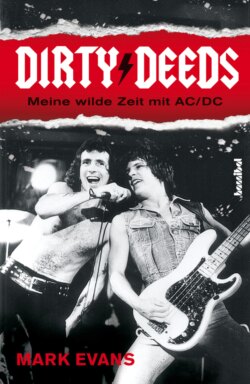Читать книгу Dirty Deeds - Meine wilde Zeit mit AC/DC - Mark Evans - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAuf der Chapel Street, ganz in der Nähe von der Pfandleihe, in der ich meinen ersten Bass gekauft hatte, gab es ein altes, ausgedientes Kino, in dem regelmäßig eine Musikveranstaltung namens „That’s Life“ stattfand. Das Kino, das direkt gegenüber vom Bahnhof Windsor lag, hatte man notdürftig umgebaut und dabei wenig erfolgreich versucht, es wie einen coolen Nachtclub aussehen zu lassen, und der Laden war vor allem berüchtigt für die Schlägereien, die dort zwischen den Sharpies und den Mods stattgefunden hatten. Wie in vielen anderen kleinen Hallen und Theatern traten hier am Freitag- und Samstagabend Bands auf. Da es keine Schanklizenz gab, durfte auch kein Alkohol verkauft werden, und das wiederum führte dazu, dass es beim Einlass keine Altersbeschränkung gab. Natürlich wurden zum Ausgleich schon auf dem Weg zum Konzert große Mengen Bier gekippt. Und es galt als ausgesprochen angesagt, einen Flachmann mit Scotch in der Tasche zu haben, ebenso wie eine Rolle mit Klebefilm umwickelter Zwei-Pence-Stücke, die genau in eine geballte Faust passte und schnell zur Hand war, wenn es nötig wurde. Kurz gesagt, es war ein Ort perfekter abendlicher Unterhaltung, noch dazu von meiner Wohnung im Prahran Hilton bequem zu Fuß zu erreichen.
Wir – meine Bandkollegen Graham, Micky, Norm und ich – gingen oft ins Life, wie der Laden kurz genannt wurde, aber auch ins Garrison an der High Street, in die Ormond Hall, ins Opus in der St. Kilda City Hall oder in den Try Boys Club an der Surrey Road. Dort erlebten wir die besten Lokalbands der damaligen Zeit, die Master’s Apprentices, Billy Thorpe & The Aztecs, Doug Parkinson In Focus, Chain und Carson, bei denen der phantastische Broderick Smith am Mikrofon stand. Später sang er bei meiner absoluten Lieblingsband, den Dingoes.
Im Try Boys wurde es schnell mal ein bisschen brenzlig, weil hier die Surrey Road Gang herrschte. Die Jungs waren nicht zu unterschätzen: Gerüchteweise war ein Mitglied der Bande bei einem Straßenkampf getötet worden, und einige seiner Gefolgsleute hatten sich für eine Verbrennung im eigenen Haus entschieden, um seine Asche später in tiefer Nacht im Prahraner Schwimmbad zu verstreuen. Die Geschichte kursierte einige Jahre, und angesichts des Rufes, den einige der angeblich Beteiligten genossen, zweifelte ich nicht daran, dass sie der Wahrheit entsprach. Ein alter Schulkamerad von mir, Wade Dix, stand dieser Gang recht nahe, ebenso sein Bruder Lee. Ihr Vater war in der Painters And Dockers Union organisiert, der Gewerkschaft der Maler und Hafenarbeiter, die damals die Kais von Melbourne regierte. In den Pubs von Prahran tauchten öfter mal Dinge auf, die irgendwie mal „beim Verladen runtergefallen“ waren, und ich bin mir ziemlich sicher, dass Dix Senior bis zu den blutunterlaufenen Augen in diesen krummen Sachen steckte.
Wade wuchs vor allem meiner Mutter über die Jahre richtig ans Herz; sie hätte ihn bestimmt adoptiert, wenn er zu haben gewesen wäre. Er war ein schmächtiger Junge mit olivfarbener Haut, so wie ich. Und er hatte es nicht leicht, wie sich jederzeit an den vielen blauen Flecken, Schnitten, Beulen und Kratzern ablesen ließ, die seine Haut zierten. Angesichts der Umstände, unter denen er aufwuchs, war es ein Wunder, dass er ein so sonniges Gemüt entwickelte, aber gerade deswegen konnte meine Mutter ihn so gut leiden. In kürzester Zeit stieg sie bei ihm von „Mrs. E.“ zu „Mum“ auf, und das wollte bei Wade eine Menge heißen. Er besorgte sich später ein paar bezahlte freie Wochen auf der Arbeit, indem er einen Finger in eine Metallpresse steckte. Ruckzuck säbelte ihm die schwere Presse ein ordentliches Stück seines Fingers ab, und er konnte die nächsten vier Wochen bei vollem Lohn zu Hause bleiben. Wades Bruder rechnete schnell aus, dass er sich auf diese Weise noch einmal neun freie Monate würde erschleichen können, wenn er sich einen Finger nach dem anderen vornahm.
Silvester 1969 ging ich mit all meinen Freunden ins That’s Life zu einer Nachmittagsshow, die vom Radiosender 3XY gesponsert wurde. 3XY spielte vor allem die Top-40-Songs der damaligen Zeit, also die Beatles, die Stones, die Kinks, die Beach Boys, die Monkees, die Easybeats oder andere Hitgaranten, außerdem die typischen Eintagsfliegen, die anderweitig Berühmt-Berüchtigten und leider auch ziemlich viel Bubblegum Music, wie man die besonders naiven, klebrig-süßen Pop-Hits nannte, die von „Bands“ wie den Archies oder der 1910 Fruitgum Company produziert wurden.
Zu den Bands, die bei dieser Silvester-Show auftraten, zählte unter anderem die Gruppe Compulsion. Ein Maori namens Reno, der schwer auf Jimi Hendrix machte, spielte bei ihnen Gitarre, und ihr Manager war Michael Browning, dem mit dem Sebastians und dem Berties zwei große Rock-Clubs in Melbourne gehörten. Außerdem spielten noch die Valentines aus Perth. Sie hatten damals einen kleinen Hit mit „My Old Man’s A Groovy Old Man“, das aus der Feder von George Young und Harry Vanda stammte. Young und Vanda waren das Songwriter-Team hinter den legendären Easybeats und echter australischer Rock-Adel, auch wenn sie eigentlich aus Schottland beziehungsweise Holland stammten.
Die Valentines waren Teenybopper wie später die Bay City Rollers. Sie trugen eine Uniform aus enganliegenden Schlaghosen, Plateauschuhen und Hippie-Hemden mit durchsichtigen Chiffonärmeln, alles in knalligem Orange. Eigentlich waren sie eine ganz gute Band mit ihren beiden Leadsängern, aber für meinen Geschmack ein wenig zu poppig. (Die Hendrix-Cover von Compulsion waren eher mein Geschmack.) Und es war nicht ganz einfach, sich diese grauenhaften orangefarbenen Outfits wegzudenken. Bei den Mädchen kamen sie allerdings ziemlich gut an, und sie hatten sogar ihren eigenen Fan-Club – lauter junge Frauen, die sich die Lunge aus dem Hals kreischten und Schilder hochhielten, auf denen Sprüche standen wie BE MY VALENTINE IN ’69.
Die Valentines legten als erstes mit ein paar Motown-Songs los und spielten schon mit ordentlich viel Druck, das musste man ihnen lassen. Die meisten Titel sang ein Typ namens Vince Lovegrove, aber der andere Sänger fiel mir weitaus mehr auf. Ganz offensichtlich hatte er schon ein bisschen was getankt, aber noch deutlich Lust auf mehr. Ich saß vor den Lautsprechern am Rand der Bühne und sah ihn öfters während der Soli und nach den Songs nach hinten gehen, um sich eine Flasche Johnnie Walker an den Hals zu setzen. Dann ging er wieder auf die Bühne und brüllte ins Mikrofon. Selbst in dem scheußlichen Orange versprühte er eine gewisse Coolness und Stil. Im Laufe des Konzerts fing er ziemlich an zu schwitzen, und irgendwann sah ich etwas Seltsames unter den Chiffon-Ärmeln. Allmählich zeichneten sich dunkle Tätowierungen ab – er hatte wohl versucht, sie mit Make-up abzudecken, aber durch den Schweiß verlor sich das. Der Typ verwandelte sich vor meinen Augen in Bon Scott.
Es war meine allererste Begegnung mit Bon. Ich fand ihn extrem cool, auch wenn er verglichen mit den anderen in der Band ziemlich klein war. Bon war vielleicht eins fünfundsechzig, aber er hatte etwas unglaublich Mutwilliges, augenzwinkernd Durchtriebenes an sich. Die Tätowierungen und die sich ziemlich schnell leerende Scotch-Flasche waren für einen Jugendlichen wie mich, der noch zur Schule ging, ziemlich beeindruckend.
Für Reno von Compulsion, jener Band, die als Opener für die Valentines spielte, lief es später im Leben übrigens nicht so gut. Er war ein Wahnsinnsgitarrist, der dann aber leider ein bisschen zu viel mit Drogen zu tun bekam und schließlich ein paar Banken überfiel. Erwischt wurde er, als er wieder mal vor einen Schalter trat und seine Knarre zog, aber so zugedröhnt war, dass er nicht merkte, dass es seine Hausbank war. Gehe ins Gefängnis, begib dich direkt dorthin. Gehe nicht über Los, ziehe nicht 4.000 Mark ein. Das war jedenfalls das Ende von Compulsion.
Anschließend verfolgte ich die Karriere von Bon Scott im Musikmagazin Go Set und bekam also mit, dass er von den Valentines zu Fraternity wechselte, einer richtigen Hippie-Band, die auf einem Grundstück bei Aldgate in den Adelaide Hills den Woodstock-Traum lebte. Die Mitglieder betrachteten sich als australische Antwort auf The Band, Bob Dylans legendäre Begleitband, die Ende der Sechziger und Anfang der Siebziger zu den einflussreichsten und angesehensten Gruppen zählte. Bon sagte später über Fraternity: „Wir haben uns zugekifft und hielten uns für die Allergrößten.“ Als ich Bon sechs Jahre später das nächste Mal sah, saßen wir zusammen in meiner Stammkneipe, dem Station Hotel in Prahran.
Gemeinsam mit Graham Kennedy und ein paar Kumpels von der Prahran High School, die einen ähnlichen Musikgeschmack hatten, gründete ich schließlich meine erste Band. Wir probten mit viel Hingabe, und schon bald beherrschten wir eine Reihe von Free-Songs, beispielsweise „All Right Now“, „Ride On A Pony“ oder „Fire And Water“, dazu einige Deep-Purple-Rocker wie „Speed King“ und ein paar Titel von Status Quo. Wie bei allen jungen Bands gab es eine lange und durchaus hitzige Diskussion darüber, welchen Namen die neue Formation bekommen sollte, bevor wir Superstars wurden. Graham, ein großer Micky-Maus-Fan, schlug Steamboat Willie vor, nach dem allerersten Micky-Maus-Cartoon. Wir einigten uns aber schließlich auf Judd, den Nachnamen unseres Drummers Lincoln.
Die Band bestand aus Graham, der Gesang und Gitarre übernahm, Lincoln am Schlagzeug und mir am Bass. Wir alle waren fest entschlossen, die Band richtig voranzubringen – vor allem wollten wir live spielen. Das war unserer Meinung nach das Größte. Unseren ersten Gig gaben wir 1973 bei einer Silvesterparty, die Grahams Schwester Maureen veranstaltete. Zufällig spielten auch AC/DC an diesem Abend zum ersten Mal, gute 800 Kilometer weiter nördlich, im Chequers in Sydney.
Besagter erster Judd-Gig fand bei Maureen zu Hause statt, die damals in Montmorency, einem Vorort von Melbourne, wohnte. Sie und ihr Mann Harold veranstalteten damals wie heute großartige Silvesterpartys. Es war meist eine große Sache, 60 oder 70 Freunde und Verwandte waren eingeladen, und auch von unseren Kumpels waren einige dabei. Ich war ganz schön kribblig, bevor wir anfingen. Erst hielt ich das für Nervosität, aber dann merkte ich, dass es eigentlich reine Vorfreude war, eine Art energiegeladener Anspannung.
Wir bauten unsere Anlage in Maureens ziemlich großem Wohnzimmer auf, organisierten uns ein paar Drinks und legten los. Unsere Lautstärke war vermutlich erst einmal ein Schock für viele Gäste, aber schließlich waren wir eine Rockband und wollten bei unserem allerersten Gig keinerlei Kompromisse eingehen. Und wir hatten kaum den ersten Ton gespielt, als meine ganze Kribbligkeit ruckzuck wie weggeblasen war. Es war ein tolles Gefühl.
Wir gaben ein paar weitere Auftritte und wurden dabei zu einem gut eingespielten Team. Allmählich begannen die Leute uns wahrzunehmen, und wir bekamen das Gefühl, tatsächlich ein wenig voranzukommen. Woraufhin wir zu dem Schluss gelangten, dass wir ein paar eigene Songs ins Programm nehmen sollten, was zu einigen prinzipiell gut gemeinten und ehrgeizigen, aber ziemlich erbärmlichen Kompositionsversuchen führte, die sich ziemlich eng an den Cover-Versionen orientierten, die wir sowieso schon in unserem Set hatten.
Immerhin hatten Judd aber einige Auftritte und spielten noch bei ein paar anderen Partys, und wir konnten auch ein paar Mädchen abschleppen. Graham bekam dann als erster ein richtig gutes Angebot – er stieß zur wohl bekanntesten Band aus Prahran, die von den Madaferri-Brüdern Peter und Mark angeführt wurde, den Fat Bubbles — unglaublicher Name, aber die hießen wirklich so. Mit ihnen spielte er zwei oder drei Gigs die Woche, während ich die Augen offen hielt, ob sich nicht auch für mich eine ähnlich gute Gelegenheit ergeben würde.
Meine Schulzeit fand im sechsten Jahr auf der Prahran High School ein abruptes Ende. Es zeichnete sich ab, dass ich die seltenen Male, die ich im Unterricht auftauchte, sowohl die Zeit meiner Lehrer als auch meine eigene verschwendete. Und so meldete ich mich zwischen zwei Trimestern für die Aufnahmeprüfung zum Öffentlichen Dienst. Meine Schwester hatte einen gut bezahlten Verwaltungsjob in dem Gebäude am östlichen Ende der Spring Street, das von den Einheimischen „das große, grüne Toilettenhaus“ genannt wurde. Im GGT waren zahlreiche Behörden untergebracht, und hier arbeiteten Tausende von Tintenklecksern.
Während ich auf diese Prüfung wartete, bewarb ich mich für drei andere Jobs, wurde zu Bewerbungsgesprächen eingeladen und bekam drei Zusagen. Das mag den Schulabgängern von heute wie reiner Hohn erscheinen, aber das waren eben andere Zeiten. Damals fand man leicht Arbeit, wenn man keine zu großen Ansprüche stellte, und man konnte sich ohne weiteres von der Schule verabschieden, ohne sich allzu große Gedanken über die Zukunft machen zu müssen. Ich jedenfalls dachte überhaupt nicht groß nach, und ich besprach mich auch nicht weiter mit meiner Mutter. Ich glaube, sie war beeindruckt, weil ich so viel Eigeninitiative zeigte und mich selbst zur Aufnahmeprüfung angemeldet hatte. Allerdings wusste sie auch nicht, dass ich an der Prahran High vor dem sicheren Aus stand und mir gar nichts anderes übrig blieb, als mir zügig etwas anderes zu suchen.
Wie man mir sagte, war ich der Jüngste der mehr als 100 Anwärter, die an jenem Tag zur Prüfung antraten. Es dauerte gar nicht lange, vielleicht eine Stunde, aber es war gesteckt voll. Man sagte uns als erstes, dass es sehr viele Fragen gäbe und wir uns beeilen sollten, da viele Prüflinge mit dem Test erfahrungsgemäß gar nicht fertig würden. Also stürzte ich mich gleich hinein. Ich schrieb, bis mein Bleistift qualmte. Es gab Fragen wie „Was bedeutet ICBM?“ (Wir hatten vier Antwortmöglichkeiten zur Auswahl, und nur der Vollständigkeit halber, es ist die internationale Abkürzung für Interkontinentalrakete.) „In welchem Land residiert der Papst?“ Ich glaube, sie zielten vor allem darauf ab, einen nervös zu machen. Ich ackerte mich hindurch, sah mir meine Antworten alle noch einmal an, und dann blickte ich mich um und merkte, dass um mich herum noch alle emsig schrieben. Nach ein paar Minuten kam der ältere Mann, der die Prüfung beaufsichtigte, an meinen Tisch und fragte mich, ob alles in Ordnung sei.
„Ja“, erwiderte ich, „aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die kompletten Prüfungsfragen bekommen habe.“
Der Mann blätterte die Bögen durch. „Doch, das ist alles. Sie haben alles beantwortet, Sie können gehen. Hervorragende Arbeit, junger Mann.“
In diesem Augenblick erfuhr ich, wie blanker Hass aussieht: Er wallte mir von jedem Anwesenden im Prüfungsraum entgegen. Schon allein die Tatsache, dass ich alles beantwortet hatte, war den meisten übel aufgestoßen. Dass ich das noch dazu in nur 20 Minuten geschafft hatte, sorgte beinahe für eine Meuterei.
Während ich auf die Nachricht von der Behörde wartete, nahm ich eine Ausbildungsstelle bei GTE Sylvania als Lagerarbeiter an. Sylvania war ein amerikanischer Leuchtmittelhersteller, der unter anderem den Blitzwürfel für Kameras erfunden hatte. Eine gefühlte Ewigkeit stapelte ich Kisten mit den verdammten Dingern in einem Lagerhaus mit Betonboden, während draußen tiefster Winter herrschte. Es war arschkalt, und es ist ein Wunder, dass ich später noch Kinder zeugen konnte. Wenn man eine Weile in der Halle stand, fühlte man sich wie nach einer Rückenmarknarkose, oder jedenfalls so, wie ich mir das vorstelle.
Die Zeit verging, ohne dass ich etwas von der Aufnahmeprüfung hörte. Bis es eines Abends an meine Tür klopfte. Vor mir stand ein älterer Herr mit einem Stapel Briefe. „Die hier sind wahrscheinlich für Sie – sind Sie Mark W. Evans?“ Die Post war an die Surrey Road 56 gegangen und nicht an die Surrey Road 56/1. Jetzt gab es keine Ausreden mehr – der öffentliche Dienst rief.
Und damit begann ein recht beschauliches Leben. Finanziell ging es mir gut, wobei das damals für mich gar keine so große Rolle spielte, und ich hatte das, was mein Großvater Will als eine „Anstellung fürs Leben“ bezeichnet hätte. Ich kam als Verwaltungsangestellter in die Finanzabteilung der Postbehörde. Mein neuer Kumpel und Mentor war ein gewisser Peter Stevenson. „Stevo“ zeigte mir den ganzen Laden, und er wusste ganz genau, wo in unserem Gebäude in der William Street 172 im Westen der Stadt die Skelette im Schrank versteckt waren. Es war ein Wunder, dass ich dort so lange durchhielt, aber das hatte auch viel mit Stevo zu tun. Er war Mitte 20 und adoptierte mich sozusagen; er war einfach jemand, den man gern in seiner Nähe hatte, ein echter Typ. Zufällig stammte er auch aus Prahran und gehörte zu denen, die schnell gemerkt hatten, dass dieses Ghetto eine Einbahnstraße war und man am besten zusah, dass man dort herauskam.
Mein Anfangsgehalt lag bei 70 Dollar pro Woche, und das war für einen jungen Kerl in meinem Alter eine Menge Kohle. Einen Teil davon gab ich für Klamotten aus, und ich leistete mir auch einen neuen Plattenspieler. Außerdem kaufte ich meiner Mutter eine neue Sitzgarnitur, ließ unsere Wohnung mit Teppichboden auslegen und leistete zum ersten Mal im Leben einen finanziellen Beitrag zu unserem Auskommen.
Die Arbeit war nicht besonders aufregend, aber man konnte in der Mittagspause durchaus ein bisschen Spaß haben. Wir gönnten uns regelmäßig eine kleine Thresenmahlzeit – oder zwei, ich musste für den Football ein wenig an Gewicht zulegen, denn ich spielte immer noch. Jedenfalls gab es im Pub eine ordentliche Portion Kartoffelbrei mit Würstchen, Shepherd’s Pie oder Porterhouse-Steaks, die wir mit ein paar Bieren herunterspülten. Nach der Arbeit verschwanden wir gleich wieder in der nächsten Kneipe, angelockt von der Aussicht auf ein paar weitere eiskalte Biere und eine Runde Pool-Billard. Ich hatte ziemlich schnell kapiert, wie man Pool spielte; die Jungs, die in der Innenstadt nach Dienstschluss in die Pubs gingen, betrachteten mich mit meinen 16 Jahren nicht unbedingt als ernstzunehmenden Gegner, schon gar nicht bei all dem Bier, das im Spiel war, und so konnte ich immer mal wieder ein paar zusätzliche Dollar mitnehmen.
Zu dieser Zeit begann ich allmählich, über eine Karriere als Profimusiker nachzudenken, und der Football trat in den Hintergrund – bei den langen Nächten, dem vielen Alkohol und den Partys mit den Mädels im Club 56 ließ meine Fitness allmählich nach. Es machte einfach zu viel Spaß zu feiern, und die Musik spielte dabei natürlich immer eine Rolle. Ich ging zu kleinen Gigs in Pubs („Willste’n Bier, Alter?“) oder saß mit ein paar Kumpels zusammen, die akustisch spielten („Noch’n Bier vielleicht?“), trat selbst in Clubs oder bei Partys auf („Hol’ mal besser noch’n Bier, nur für den Fall“). Und wenn ich zum Football ging, na ja, da wäre es völlig unaustralisch gewesen, kein Bier zu trinken. Oder mehrere.
Ins Jahr 1975 startete ich mit einer brandneuen Bassverstärkeranlage, einem 300-Watt-Röhrenmonstrum mit zwei Boxen, in denen richtig dicke JBL-Lautsprecher saßen. Das war tatsächlich das Beste, was bei dem ganzen Job im Öffentlichen Dienst herauskam – eine anständige Verstärkeranlage und ein paar gute Freundschaften.
Der Job an sich war nerv- und geisttötend. Nach zwei Jahren war ich offiziell immer noch in der Probezeit. Normalerweise bekam man nach sechs Monaten eine unbefristete Festanstellung, aber in meinem Fall geschah das nicht wegen meiner Fehlzeiten, und weil ich „ein Problem mit Hierarchien“ hatte. Zumindest nannte die entscheidende Dienststelle das so.
Stevo kümmerte sich um mich, zeigte mir, wo’s langging und – das war besonders wichtig – ordnete die entscheidenden Überstunden an. So kam ich an meine Verstärkeranlage, und vor allem auch an die Bars vieler Pubs im Westen der Stadt, ins Golden Age, Great Western oder Mitre Tavern. Es war eine sehr geregelte Welt, verglichen mit der, die sich bald für mich auftun sollte, aber es machte trotzdem Spaß. Mittags konnte man über ein frisch gezapftes Carlton ein paar nette Ladys aus dem Schreibpool und der Personalabteilung kennen lernen. Ich verbrachte einige Samstagnachmittage auf dem Boden des Schreibzimmers mit einer sehr attraktiven, aber auch sehr verheirateten jungen Dame, oder ich spielte Karten mit den Jungs. Der Boden des Schreibzimmers war mir lieber, auch ohne meine gut bestückte Tippsen-Freundin konnte man dort nach dem Mittagessen gut ein Schläfchen halten. Aber diese Kunstfaser-Teppichfliesen sind tödlich für die Knie; bei zu viel Reibung konnte man sich ganz üble Abschürfungen holen.
Mitte Januar 1975 nahm ich vier Wochen Urlaub. Es gab Urlaubsgeld – 500 Dollar, eine Riesensumme für mich. Mit den vielen Scheinen in der Tasche schlug ich mit den Kumpels im Grosvenor Hotel für einen Abschiedsdrink auf. Nach ein paar Bier hielt ich auf den Pooltisch zu, während mir die Textzeile aus Rod Stewarts „Maggie May“ im Kopf herumgeisterte – von wegen „make a living out of playing pool“. Ich konnte einfach nichts verkehrt machen: Jede Kugel, die ich anguckte, ging rein, sehr zum Verdruss einiger älterer Stammgäste, die den „Bubi“ gern um sein Urlaubsgeld erleichtert hätten.
Natürlich legte man es allgemein darauf an, einen Spieler, wenn es gut für ihn lief, möglichst schnell betrunken zu machen, bis er sich auf blöde Wetten einließ und schließlich in die unangenehme Lage geriet, sein eigenes Geld zurückgewinnen zu müssen. Das war auch der Plan für mich und meine 500 Dollar. Wenn jemand an einem Freitagabend mit einem Bündel Scheine in einem Pub in der City aufkreuzte, dann sprach sich das schnell rum. Diese Geier wussten allerdings nicht, dass meine älteren Arbeitskollegen mich mit vielen Ratschlägen gut auf eine solche Situation vorbereitet hatten und dass mein Mentor Stevo vor Ort war, um mich im Auge zu behalten. Es dauerte nicht lange, und die Einsätze wurden immer höher. Wir räumten ziemlich ab, und schnell war abzusehen, dass es eine lange Nacht werden würde – mit dem Vorsprung, den wir hatten, hätten wir uns unmöglich gefahrlos einfach so verabschieden können.
Stevo half mir durch den Abend, indem er die Biere im Auge behielt, die man mir ausgab und die oft verstohlen mit einem Schuss Wodka versetzt wurden. Er gab mir ein paar Pillen und sagte: „Nimm die hier, dann wirst du nicht so schnell besoffen.“ Und er hatte Recht. Die Pillen schienen jeden Schluck Wodka zu neutralisieren, der in meinen Körper gelangte, obwohl ich natürlich drauf war wie die Hölle.
Schließlich organisierte Stevo unseren Rückzug. Er schlug vor, dass ich mit viel Getöse 20 Dollar auf die Bar legte, das reichte 1975 für jede Menge Bier, und eine Lokalrunde ausgab, bevor ich dann laut verkündete: „Ich muss mal pissen!“
Stevo flüsterte mir ins Ohr: „Jetzt gehst du Richtung Klo und dann immer schön weiter geradeaus, durch die andere Bar, raus auf die Little Collins Street, und dann VERPISST du dich im Eiltempo. Ich haue ab, sobald die geblickt haben, dass du weg bist.“
Stevo wartete auf ein Bier, und dann brüllte er zu einem Kumpel hinüber: „Was soll das heißen, er hat sich verpisst? Der Arsch hat mein ganzes Geld!“ Damit stürmte er hinaus auf die Little Collins Street und rannte in die entgegengesetzte Richtung, gefolgt vom halben Pub.
Ich war noch vor Mitternacht wieder zu Hause, immer noch total drauf und völlig unter Strom, und mit mehr als 1000 Dollar in der Tasche. Diese Summe war einfach unvorstellbar, aber noch unvorstellbarer war die Tatsache, dass ich ohne eine Abreibung aus dem Pub rausgekommen war. Keine Ahnung, ob es am Geld oder an den Pillen lag, aber ich fand vor Sonntagabend keinen Schlaf.
Ein paar Tage später traf ich Stevo wieder und erwartete ein paar nette Worte oder sogar ein Dankeschön für den großen Gewinn vom Freitag.
„Ich gebe dir einen freundschaftlichen Rat, Mark“, erklärte er stattdessen. „Geh nie, nie wieder ins Grosvenor Hotel.“
Mein Büro war nur zehn Minuten mit der Straßenbahn von Prahran entfernt, aber nach meinem Urlaub fiel es mir enorm schwer, rechtzeitig zur Arbeit zu erscheinen, wenn ich dort überhaupt aufschlug. Nachdem meine Probezeit zum vierten Mal verlängert worden war – möglicherweise ein Rekord – rief mich ein gewisser Mr. Nicholls in sein Büro. Er war ein Staatsdiener mit 20 Dienstjahren auf dem Buckel, in einer ziemlich hohen Besoldungsgruppe weit oben in der Nahrungskette und ganz offensichtlich jemand, der lebenslänglich in dieser Tretmühle hockte. Ich fand den Typ eigentlich ganz okay, aber er war fürchterlich korrekt und sah immer so aus, als ob er Schuhe trüge, die ihm ein paar Nummern zu klein waren. Wir waren auf völlig verschiedener Wellenlänge. Er gehörte zu denen, die praktisch ihr Leben lang Wasser treten, und diese Vorstellung war für mich die Hölle.
Und so begann Mr. Nicholls unsere kleine Unterhaltung dann auch, indem er endlos davon salbaderte, wie intelligent ich doch offenbar war, und mir sagte, dass ich drauf und dran war, die beste Gelegenheit meines Lebens wegzuwerfen, weil ich mich nicht genug anstrengte.
„Sie wären gut beraten, wenn Sie einmal ernsthaft über Ihre Zukunft im Öffentlichen Dienst nachdenken würden“, erklärte er mir mit völlig ernsthaftem Gesicht. „Und machen Sie mal was mit Ihren Haaren. Mit so einer Frisur wird man Sie ja nie für voll nehmen.“ Ich hatte mich inzwischen für den „Einfach-wachsen-lassen“-Schnitt entschieden, der wahrscheinlich wirklich besser zu einer Rockband passte als in eine Amtsstube.
Nicholls war sicher überzeugt davon, mir einen Gefallen zu tun; er wusste es einfach nicht besser und trug dicke Scheuklappen, was die wahren Möglichkeiten im Leben betraf. Er wollte einfach nur einem „jungen Mann mit rosigen Zukunftsaussichten“ auf den rechten Weg helfen. Dabei war er durchaus höflich und entgegenkommend, und ich bin mir sicher, dass er das Herz am rechten Fleck hatte, aber all das ging ein bisschen an mir vorbei, weil ich während seiner Ansprache schlicht und ergreifend einnickte. Und Chefs mögen es nicht, wenn ihre Angestellten einpennen, während sie gerade dabei sind, Perlen der Weisheit an sie auszuteilen. Dementsprechend rastete er nun richtig aus.
„WIE KÖNNEN SIE ERWARTEN, IN 15 JAHREN DA ZU SITZEN, WO ICH JETZT BIN, WENN SIE SICH NICHT AM RIEMEN REISSEN?“
„Ach du Scheiße“, dachte ich. „In 15 Jahren immer noch hier? Auf seinem Platz?“
Der Vortrag endete, als ich ihm erklärte: „Das können Sie sich alles in den Arsch schieben“, und sein Büro verließ. Das war’s. Später kehrte ich noch einmal zurück, um meinen restlichen Lohn abzuholen, aber wegen meiner ganzen Fehlzeiten waren das nur noch 7,54 Dollar oder so, wenn ich mich recht erinnere. Eine Angestellte aus der Personalabteilung versuchte mich zu überreden, dass ich nicht kündigen, sondern vielmehr eine unbezahlte, einjährige Auszeit nehmen sollte. „Du wirst es dir bestimmt noch überlegen, und dann kommst du wieder“, sagte sie.
Sie war ein bisschen enttäuscht über meinen Abgang, weil wir uns ganz nett angenähert hatten, speziell nach Feierabend auf dem Rücksitz ihres Autos. Meine Kumpels wollten gar nicht glauben, dass ich eine Lady Anfang 30 flachlegte, und löcherten mich ausführlich nach allen Einzelheiten unserer Rücksitzabenteuer. Allerdings war ich diskret und verriet nicht allzu viel. Gerne würde ich heute sagen, dass ich mich damals wie ein Gentleman verhielt, aber tief in mir drin weiß ich, dass ich ein gieriger, geiler, kleiner Drecksack war, nicht mehr und nicht weniger.
Eine der Personalchefinnen hatte einen Narren an mir gefressen (einen rein platonischen, wie ich hier anmerken möchte), und wollte unbedingt verhindern, dass ich meine Berufschancen „wegwarf“. Sie war wirklich eine liebe Seele, und ich fühle mich ein bisschen schäbig, dass ich mich nicht an ihren vollen Namen erinnern kann, aber Margaret, wenn du das hier lesen solltest, dann lass dir sagen, mir ist es gut ergangen, und ich danke dir dafür, dass du dir damals so viel Gedanken gemacht hast. Es war wahnsinnig nett von dir, dich um mich zu sorgen, und ich höre deinen freundlichen Rat noch immer in meinem Kopf, wenn ich an die Jahre vor AC/DC denke.
„Mark“, sagte sie ganz ernsthaft, „Musik bietet keine Berufskarriere wie der Öffentliche Dienst.“
Margaret, du weißt ja gar nicht, wie recht du hattest.
Im März 1975, kurz nach meinem 19. Geburtstag, saß ich mit meinem alten Kumpel Steve McGrath im Station Hotel in Prahran, und – ja, vielleicht gab es da ein Muster – trank ein kühles Bierchen und spielte Pool. Steve hatte viel Zeit bei mir im Hilton verbracht. Seine Familie lebte etwas weiter draußen im Vorort Springvale, und obwohl er nicht darüber sprach, schien es bei ihm zu Hause nicht gerade fröhlich zuzugehen. Ich wusste, dass er ernsthaften Stress mit seinem Vater hatte, der eine Ladenkette für Militärausrüstung besaß und Steve ziemlich unter Druck setzte, den Familienbetrieb zu übernehmen. Daher zog Steve schließlich so gut wie bei mir ein. Wir waren beide noch Teenager, aber wir hatten eine sehr spannende Zeit im Club 56 mit den jungen Damen aus der Gegend. Besonders interessant für uns war das Schwesternwohnheim des Alfred Hospitals in der Commercial Road, direkt neben dem Chevron Hotel. Die Schwesternschülerinnen – oder zumindest einige von ihnen – hatten eine große Schwäche für Steve und mich und waren gern bereit, uns bei praktischer Weiterbildung in bestimmten Bereichen Schützenhilfe zu geben. Dafür werde ich ihnen immer dankbar sein.
Aber zurück zum Station Hotel. Steve und ich saßen also da, tranken unser Bier und redeten ein bisschen.
„Sag mal, was treibst du denn jetzt eigentlich so arbeitsmäßig?“, fragte ich ihn. Es war eine ganz harmlose Frage, aber eine, die mein Leben verändern sollte.
„Ich arbeite für so eine neue Band, AC/DC. Die brauchen übrigens einen Bassisten – was treibst du denn jetzt eigentlich gerade so?“
Was Bands angeht, war es bei mir wieder ziemlich ruhig geworden. Ich spielte mit ein paar älteren Typen und lernte zwar eine Menge von ihnen, wusste aber auch, dass ich das nicht für den Rest meines Lebens machen wollte. Was mich damals rettete, war die Tatsache, dass der Gitarrist meiner damaligen Truppe den irischen Rocker Rory Gallagher verehrte und entsprechend scharf drauf war, echten Hochdruck-Blues zu spielen. Eugene, der Drummer, war auch ziemlich cool, der Keyboarder hingegen ein bisschen eingefahren und konservativ – wenn es nach ihm gegangen wäre, hätten wir ausschließlich Elton-John-Songs gebracht, am liebsten das komplette Album Goodbye Yellow Brick Road. (Keyboarder sind mir sowieso meist irgendwie unheimlich, wenn sie nicht zufällig Fats Domino, Little Richard oder Jerry Lee Lewis heißen.) Komische Sache irgendwie. Ich war immer der jüngste in den Bands, in denen ich spielte.
Kurz gesagt, meine musikalischen Zukunftsaussichten waren ziemlich finster. Meine Monster-Bass-Anlage teilte mit mir (und Glynis) das Schlafzimmer. Wenn ich im Bett lag, waren die silbernen Kuppeln der dicken JBL-K140-Töner in der Mitte auch im Halbdunkel gut auszumachen, und sie schienen mich dauernd anzusehen und spöttisch zu fragen: „Machen wir bald mal irgendwas, oder hocken wir nur hier rum und drehen Däumchen?“ Es war so eine coole Verstärkeranlage, aber ich lag daneben im Bett und dachte immer nur, wenn nicht bald irgendetwas passiert, dann drehe ich komplett durch. Es war schon schlimm genug, dass mein Bassverstärker mit mir sprach.
Dabei wusste ich genau, was ich wollte. Ich wollte Bassist in einer lauten, fiesen Rockband sein, so wie Billy Thorpe & The Aztecs oder die Coloured Balls. Meine Vorbilder waren ZZ Top und Blueser wie Rory Gallagher, Johnny Winter und Freddie King. Außerdem entdeckte ich gerade die Blues-Legenden, von denen die Rolling Stones stark beeinflusst waren – Robert Johnson, Muddy Waters, Buddy Guy, Willie Dixon und Howlin’ Wolf, der in meinen Augen der Größte von allen war.
Was ich in diesen Aufnahmen, von denen einige schon in den Dreißigern entstanden waren, vor allem spürte, war eine gewisse Erdigkeit. Der Sound war karg und akustisch, die Typen schrien und heulten dazu ihre Gefühle heraus, und all der Zorn, die Leidenschaft, die Gefahr schienen geradezu aus den Lautsprechern herauszusickern. Sie waren echt. Sie sangen, spielten und bluteten aus echter Erfahrung.
Tja. Und so stand mein Bassverstärker da in meinem Schlafzimmer und rief meinen Namen. Ich wusste, in was für einer Band ich gern gespielt hätte, und die hatte definitiv nichts mit Elton John am Hut. Es sollte vielmehr laut sein, mit zwei Gitarren wie bei den Stones, fies und dreckig und auf den Blues aufgebaut. Wo konnte ich eine solche Band finden? Und würde die, wenn ich sie fand, einen Bassisten brauchen?
Diese eine Frage, die Steve mir stellte, änderte alles für mich. Ich habe mich oft gefragt, was passiert wäre, wenn ich ihn an jenem Tag nicht gefragt hätte, was er gerade so machte. Vielleicht würde ich dann heute immer noch jeden Freitagabend Pool spielen und mich nach der Arbeit besaufen? Inzwischen würde man mich ins Grosvenor Hotel wohl wieder reinlassen.
Steve interessierte sich zwar nicht besonders für Musik, aber er arbeitete trotzdem gern gelegentlich als Roadie für AC/DC. Von der Band hatte ich schon gehört, und ich wusste, dass ein Typ dabei war, der sich wie ein Schuljunge anzog und sogar mit Ranzen auf dem Rücken auf die Bühne ging.
Steve erzählte mir noch ein bisschen mehr. „Sie spielen Hard Rock“, sagte er. „Eine Menge Stones-Cover, aber sie haben auch ein Album mit eigenen Songs draußen. Müsste eigentlich so richtig was für dich sein.“
Interessant, dachte ich.
Er erwähnte auch, dass es sich bei zweien der Bandmitglieder um die kleinen Brüder von George Young handelte. Und jetzt wurde ich richtig hellhörig. Als Kind hatte ich die Easybeats oft im Fernsehen gesehen, und ich war ein großer Fan der Band. George und sein ehemaliger Easybeats-Partner Harry Vanda hatten kürzlich ein Soloalbum des Easybeats-Sängers Steve Wright produziert – Hard Road, eine richtig großartige Platte, auf der sich unter anderem „Evie: Parts I, II And III“ befand, das sich trotz seiner Länge von über sieben Minuten zu einem echten Monster-Hit entwickelte. Das war schon etwas Besonderes, denn Singles waren damals selten länger als drei Minuten. George und Harry hatten einen echten Lauf. Sonst kannte ich AC/DC hauptsächlich von den Postern im Hard Rock Café, die in großen Buchstaben proklamierten: AC/DC ARE CUM’N – AC/DC KOMMEN.
Steve sagte mir, das Hauptquartier der Band sei momentan in der Landsdowne Road in East St. Kilda, dem benachbarten Vorort, gar nicht weit von der Dandenong Road, wo meine Schwester Judy wohnte. Eines Tages im März 1975, spät an einem Samstagnachmittag, schaute ich dort vorbei. Eine sehr attraktive junge Frau öffnete mir die Tür; sie bat mich herein und sagte, sie sei Angus Youngs Freundin. Ich war verdammt beeindruckt, denn sie war wirklich ziemlich süß und von einem ganz anderen Kaliber als die üblichen Mädels. Die Jungs, erklärte sie, seien im Matthew Flinders Hotel im nahegelegenen Chadstone und spielten einen Nachmittags-Gig. „Die kommen aber bald wieder. Willst du warten?“ Das war ein Angebot, das ich nicht ablehnen konnte.
Die damalige AC/DC-Residenz war ein großes, chaotisches, einstöckiges Haus, das heute sicherlich ein hübsches Sümmchen wert ist. Damals allerdings war St. Kilda mehr als ein bisschen anrüchig; es gab jede Menge Massagesalons und eine vagabundierende Junkie-Population. Die gesamte Band und ihre Crew wohnten in diesem Haus. Tana, ihre Bühnentechnikerin, war vermutlich der erste weibliche Roadie in ganz Australien, und sie machte einen verdammt guten Job.
Ich sah mich ein wenig um. Nach vorne raus gab es einen Wintergarten, und dahinter lag ein großer Flur, an den mehrere Zimmer grenzten, darunter ein großes Wohnzimmer im hinteren Bereich des Hauses. Damals wusste ich noch nicht, dass Bon Scott in der Band war, aber ich fand schnell heraus, dass er dieses Wohnzimmer als seinen ganz privaten Bereich beanspruchte.
Wenig später trudelte ein Großteil der Band ein – und schon als ich sie sah, wusste ich, dass ich bei ihnen mitmachen wollte. Der Grund dafür war schlicht und ergreifend Phil Rudd. Phil wurde unter den Konzertgängern und Möchtegernmusikern, mit denen ich immer herumhing, sehr verehrt. Er spielte Schlagzeug bei einer Band namens Buster Brown, die in den Pubs in der Gegend Stammgast war. Dass er hier auftauchte, wunderte mich – ich wusste nicht, ob er bei Buster Brown ausgestiegen war, oder ob die Band insgesamt die Hufe hochgerissen hatte. War mir auch egal, ich wollte schlicht dabei sein.
Gleich zu Anfang fielen mir einige Dinge bei AC/DC auf. Zum einen war das die Körpergröße der Mitglieder, oder vielmehr, ein Mangel an derselben. Ich bin nun auch nicht unbedingt der Größte, vielleicht eins siebzig, wenn’s hoch kommt, aber neben diesen Jungs kam ich mir groß vor, vor allem neben Malcolm und Angus. Ich konnte mich nicht erinnern, schon mal jemanden gesehen zu haben, der kleiner war als Angus, und so machte natürlich auch die ganze Nummer mit der Schuluniform Sinn. Es war perfekt. Die zweite Sache, die mir auffiel, war ihre Einstellung. Sie kannten mich natürlich nicht, ich war ihnen so fremd wie ein Stück Seife, jedenfalls nach ihrer etwas abgerissenen Erscheinung zu schließen, und von daher hatte ich natürlich nicht erwartet, dass sie mich sofort in die Arme schließen würden. Aber sie umgab so eine Kälte, wie ich sie vorher noch nie erlebt hatte. Das irritierte mich damals sehr. Heute übrigens auch noch.
Wir unterhielten uns erst einmal ein wenig über das Nachmittagskonzert, das gerade hinter ihnen lag. Während ihres Aufenthalts in Melbourne hatte George, Malcolms und Angus’ großer Bruder, als Bassist ausgeholfen, aber George war inzwischen wieder zu seiner Familie nach Sydney zurückgekehrt und widmete sich vor allem Albert Productions, der Plattenfirma von AC/DC, wo er als Hausproduzent tätig war. Von daher war die Band einstweilen als Quartett unterwegs, und Malcolm übernahm den Bass. Dann sprachen wir ausführlich über AC/DC, und ich erzählte, welche Musik mir gefiel. Dabei blieb bei Malcolm wohl vor allem eins hängen: Als wir über unsere Lieblingsmusiker redeten, nannte ich unter anderem Gerry McAvoy, der bei Rory Gallagher spielte.
„Ich möchte gerne so knackig spielen wie der“, sagte ich zu Malcolm. „Keinen abgedrehten Scheiß, nichts Kompliziertes, einfach nur ganz soliden Rock-Bass.“ Malcolm erwiderte nichts, er merkte sich das nur.
Offenbar lief unser erstes Treffen aber ganz gut, denn ich ging mit einem Exemplar ihres ersten Albums High Voltage wieder nach Hause und bekam mit auf den Weg, die Songs zu lernen und am nächsten Tag für einen „Blow“ – eine Jam-Session – wieder bei ihnen aufzuschlagen. Man sagte mir auch, wenn alles passte, dann würde ich dieselbe Gage bekommen wie die anderen Jungs, 60 Dollar die Woche, also deutlich weniger, als ich im Öffentlichen Dienst verdient hatte, aber ich hätte kostenlos bei ihnen in der Lansdowne Road wohnen können. Glücklicherweise war ich nicht darauf angewiesen, denn dort war es schon ziemlich voll.
Das Geld wurde von den Managern Michael Browning und Bill Joseph ausgezahlt; diese Abmachung war Bestandteil eines kürzlich abgeschlossenen Deals. Wie ich bald erfuhr, war es eine Art letzte Rettung gewesen. Die Band war von ihrem vorherigen Manager in Adelaide im Stich gelassen worden, und Michael und Bill hatten sie daraufhin nach Melbourne verpflanzt und ihnen den Arsch gerettet. Die Jungs nannten Michael stets nur bei seinem Nachnamen und wirkten ihm gegenüber stets ziemlich misstrauisch. Das lag möglicherweise an den schlechten Erfahrungen, die der älteste Young-Bruder zu Easybeats-Zeiten mit Managern gemacht hatte; jedenfalls war in Gesprächen öfters mal von Prozessen in England die Rede.
Ich ging also nach Hause und verbrachte den Rest des Samstags damit, mir die Platte anzuhören und mich auf die erste Probe vorzubereiten. Das Album gefiel mir gut, aber irgendwie konnte ich den Eindruck, den ich von den Jungs und ihrem Musikgeschmack gewonnen hatte, nicht mit Titeln wie „Love Song“ in Einklang bringen. Einerseits waren da diese harten, jungen Typen – Bon hatte ich noch nicht kennen gelernt –, die auf richtig harten Rock standen und ein echtes Rockerleben führten. Und dann war da dieses schmalzige Dingsda namens „Love Song“, das sich von den rockigeren Tracks auf dem Album, auf dem sich auch die großartige Blues-Nummer „Baby Please Don’t Go“ und Chuck Berrys „School Days“ befanden, heftig unterschied. Die anderen, selbst verfassten Songs waren auch eher poppig. Das, was ich von Malcolm, Phil und Angus wusste, passte nicht so recht zu dem, was ich hörte. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass die Jungs, die durch die Bierkeller der Vorstädte zogen, mit „Love Song“ zurechtgekommen wären. Im Gegenteil, so ein Song war in unserem Umfeld vermutlich der beste Weg, so richtig um Schläge zu betteln. Was genau es mit all dem auf sich hatte, sollte ich aber schon bald erfahren.
Wie vereinbart, erschien ich am Sonntag wieder in der Lansdowne Road, dieses Mal mit meiner ganzen Ausrüstung. Die Jungs hatten am Abend vorher offenbar mindestens ein Konzert gegeben und sahen reichlich ausgefranst aus. Vor allem Angus machte den Eindruck, als hätte er etwas Schweres auf den Kopf bekommen, er hing völlig in den Seilen. Deshalb fragte ich ihn natürlich gleich, ob sie in der Nacht zuvor ordentlich einen drauf gemacht hätten. Hatte er einen Kater?
„Ich trinke nie was, Alter“, gab Angus zurück.
Das hielt ich natürlich für einen Witz. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie er sonst in so einen Zustand geraten war, wenn er nichts trank. An diesem Nachmittag bekam ich dann allerdings den Eindruck, dass er nur von Zigaretten und Tee lebte, was vielleicht auch seinen fiesen Mörderhusten erklärte. Angus erinnerte mich irgendwie an einen alten Mann – angesichts der Tatsache, dass er damals gerade erst 19 war, ziemlich alarmierend. Dieser Eindruck verflüchtigte sich natürlich sofort, wenn er zu spielen anfing.
Wir wechselten ein paar Worte, Angus hustete noch reichlich vor sich hin und machte sich noch einen Tee, dann bauten wir unser Equipment im Flur auf und legten los. Ich hatte eine ungefähre Vorstellung davon, was von Phil zu erwarten war, aber auf die Show von Malcolm und Angus war ich überhaupt nicht vorbereitet. Nun konnte ich, was das Rockbusiness anging, auch noch nicht auf eine Riesenerfahrung zurückgreifen, aber trotzdem merkte ich eins: Das hier war etwas Besonderes. Die Gitarren bohrten sich geradezu in dich hinein. Das lag nicht allein an der Lautstärke, obwohl es natürlich schon ganz schön schepperte, wenn man im Flur eines Wohnhauses ein paar 100-Watt-Verstärker, Marke Marshall Super Lead, ordentlich aufdrehte. Es war vielmehr die Intensität und die Angriffslust, die mich beeindruckten. Wir spielten die Songs von der Platte, die aber nun viel aggressiver klangen. Wie ich erfuhr, war Phil nach den Aufnahmen zur Band gestoßen und erst seit ein paar Wochen dabei. Das erklärte zumindest einen Teil der neuen Energie.
Wir spielten die Songs von High Voltage einmal durch, ließen allerdings „Love Song“ aus, was mir aber in der Hitze des Gefechts gar nicht auffiel. Wahrscheinlich war der Titel schon auf der Abschussliste. Es lief alles gut: Mein Eindruck war, dass vor allem Malcolm sehr glücklich darüber war, wieder zu seinem angestammten Instrument zurückkehren zu können. Ich hatte sofort gemerkt, wie gut die Gitarren einander ergänzten, und natürlich war auch die Lautstärke, die sie erzeugten, enorm. Ich war froh, dass ich den Weitblick besessen hatte, mir diesen mächtigen 300-Watt-Bassverstärker zu kaufen, denn den brauchte ich auch, um neben Mal und Angus nicht unterzugehen.
Es war ganz eindeutig Mal, der den Ton angab. Er versah die Melodien mit Tempo und Groove, und wir schlossen uns ihm an. Zwar war es das erste Mal, dass wir zusammen spielten, aber es lief schon ziemlich gut, jedenfalls in musikalischer Hinsicht. Mal gab mir ein paar Anweisungen und bemerkte außerdem: „Der letzte Typ, der bei uns war, hat den Song nicht gepackt, deswegen bist du jetzt hier.“ (Wer dieser „letzte Typ“ gewesen war, erfuhr ich nie.) Das klang nicht besonders beruhigend, aber wie ich bald herausfinden sollte, interessierte es bei AC/DC niemanden, ob man sich in ihrer Gegenwart wohl fühlte oder nicht. Davon abgesehen ging es, wie gesagt, richtig gut ab, alles war schön laut und krachig, und wir grinsten uns zufrieden an. „Das haut hin“, dachte ich. „Ich will diesen Job unbedingt haben. Auf genau diese Band habe ich gewartet.“
Später machten wir eine Tee- und Zigarettenpause und unterhielten uns ein bisschen darüber, was ich sonst so machte, um mir mein Geld zu verdienen. Mir war bereits klar, dass mein Job im Öffentlichen Dienst jetzt überhaupt nicht mehr zur Debatte stand; zwar wurde es nicht ausgesprochen, dass man von mir erwartete, alles andere hinzuschmeißen, aber stillschweigend ging wohl jeder davon aus. Damit bekam ich den ersten Vorgeschmack davon, wie AC/DC funktionierten: Du wurdest nicht gefragt, ob dir etwas passte – man erwartete einfach, dass du tun würdest, was für die Band gerade nötig war. Darüber wurde überhaupt nicht geredet. Wenn du dabei warst, dann war es deine Aufgabe, alles für die Band zu tun. Das verstand sich von selbst und bedurfte keiner Worte.
Bei diesem Vorspieltermin erfuhr ich auch, dass Bon Scott in der Band war, obwohl er sich an diesem Tag nicht blicken ließ. Ich hörte lediglich: „Bon ist nicht da.“ Das war alles. Aber für mich war das ein weiteres großes Plus – Phil Rudd, die Youngs und Bon Scott in einer Band, das war Wahnsinn.
Unser informeller Test schien ganz gut zu laufen. Offenbar waren wir alle auf derselben Wellenlänge, aber es war schon komisch, der Größte in der ganzen Band zu sein. Zwar waren die anderen freundlich-kühl, aber mir fiel die enorme Solidarität unter ihnen auf. Sie waren eine Band, daran bestand kein Zweifel, sie wohnten zusammen, sie arbeiteten hart und präsentierten sich als Einheit. Das war keine Attitüde: Es war echt und ungekünstelt. Und ich wollte ein Teil davon sein, unbedingt. Diese Jungs meinten es ernst. Insgesamt hatten wir vielleicht eine Stunde gespielt und ein bisschen gequatscht, immer wieder unterbrochen von Angus’ bösem Husten, und die Band lud mich schließlich ein, am nächsten Donnerstag zu einem ihrer Konzerte zu kommen. Der Gig fand ausgerechnet im Station Hotel in Prahran statt, meinem Stammlokal. Mal wollte wieder den Bass übernehmen, daher bot ich ihm an, dass er mein Equipment benutzen durfte.
Ralph schlug mir vor, mich mit dem Swivel Hips nach Hause zu fahren, dem Truck der Band, der den Wackelhüften-Namen bekommen hatte, weil er nie in der Spur blieb. Es war nicht weit, nur zehn Minuten zu Fuß, aber Ralph bestand darauf. Auf dem Weg unterhielten wir uns. Er war überzeugt, dass ich den Job in der Tasche hatte, und gab mir einige Verhaltenstipps. Und ein paar von den Sachen, die Ralph mir sagte, gruben sich tief in mein Gedächtnis ein.
Ralph kannte Bon schon seit den Zeiten von Fraternity, für die er in England und in Australien als Busfahrer gearbeitet hatte. Ihm zufolge wurde Bon allgemein „Bonnie Roadtest“ genannt, weil er alles ausprobierte, was sich ihm bot. Für einen jungen Kerl wie mich klang das alles ziemlich aufregend.
„Pass mal auf, ich geb’ dir mal einen freundschaftlichen Rat“, fuhr Ralph fort. „Es ist Malcolms Band, und ich glaube, es wäre eine ziemlich gute Idee, wenn du dir das immer vor Augen hältst.“
„Ist okay, Ralph, vielen Dank“, dachte ich, sprach es aber nicht laut aus.
Ralph setzte mich beim Hilton ab und sagte: „Dann mal viel Glück, Kumpel, ich freu mich drauf, mit dir zu arbeiten. Ach ja, übrigens – nach unserem Plan werden wir in einem Jahr in England spielen.“
Als ich ins Haus ging, dachte ich, so ein Quatsch, diese Band wird doch auf keinen Fall in einem Jahr den Durchbruch in England geschafft haben – und ich sollte recht behalten.
Es dauerte ein Jahr und zehn Tage.
Vom Gefühl her war mein Vorspielen bei den Jungs jedenfalls gut gelaufen, und nach meinem Dafürhalten waren wir auch recht gut miteinander zurecht gekommen, auch wenn sie ein bisschen unterkühlt geblieben waren. Nur spürte ich doch eine gewisse Unruhe. Klar, ich wollte den Job, aber es war doch eine kleine Unsicherheit dabei – ich kannte diese Typen im Grunde überhaupt nicht. Es war riskant, aber auch ziemlich aufregend, und vor allem konnte ich mir nichts vormachen – auf mich wartete auch kein besseres Angebot. Phil erzählte mir später, wie die Band über mich geurteilt hatte, nachdem ich wieder verschwunden war. Wie immer hatte Malcolm das erste und letzte Wort.
„Wenn er so gut spielt, wie er redet, dann ist er dabei.“
Ich war vielleicht nicht besonders redselig gewesen, aber ich glaube, meine Bemerkung über den „soliden Rock-Bass, keinen abgedrehten Scheiß“ hatte bei Malcolm Young einen Nerv getroffen.
Es gab allerdings noch ein kleines Problem. Ausgerechnet an dem Wochenende vor unserer Jam-Session war ich im Station Hotel gewesen, und es hatte sich eine kleine Rangelei an der Bar ergeben, wie das in einem australischen Vorstadt-Pub so üblich war. An dem besagten Samstag war es knackevoll in dem Laden, und von daher ließ es sich nicht vermeiden, dass auch Unbeteiligte wie ich in das Geschehen hineingezogen wurden.
Ein Bierglas kam angeflogen, knallte direkt gegen meine Stirn und knockte mich mit einem Schlag aus. Als ich wieder zu mir kam, lag ich in der Greville Street auf dem Bürgersteig; offensichtlich war ich vor die Tür gesetzt worden, weil man mich für einen der Störenfriede hielt. Ich war noch damit beschäftigt, Blut zu spucken und zu checken, ob noch alle Zähne an Ort und Stelle saßen, als die beiden Besitzer, Albert und Marino, zu mir rauskamen und mir mitteilten, ich hätte ab sofort bei ihnen Hausverbot. „Na klasse“, dachte ich, „erst kriegt man ein Bierglas in die Fresse, und dann fliegt man auch noch raus dafür!“
Allen unter euch, die noch nie ein Bierglas mitten ins Gesicht bekommen haben, muss ich sagen: Es tut beschissen weh, wenn man wieder zu Bewusstsein kommt. Es ist kein scharfer Schmerz, eher so ein dumpfes Pochen, als ob dir aus großer Höhe etwas ziemlich Schweres auf den Kopf gefallen ist. Kann ich überhaupt nicht empfehlen. Es ist wie in diesen Zeichentrickserien, wenn irgend so ein armes Schwein einen Amboss auf die Rübe bekommt. In den Jahren zuvor hatte ich im Station Hotel schon allen möglichen Ärger gehabt, und deswegen dachte ich mir zunächst: „Scheiß drauf, diesen Saftladen braucht eh keiner!“ Ich jedenfalls nicht. Bis zu meinem Vorspielen bei AC/DC.
Trotzdem marschierte ich am 19. März 1975 zum Station Hotel, um mir AC/DC anzusehen. Ich war in bester Laune und freute mich auf ein paar Bier und lauten Rock’n’Roll. Weil ich ja eigentlich Hausverbot bei Albert und Marino hatte, war mir ein bisschen unwohl, aber so etwas kam nun auch nicht gerade selten vor, auch wenn es bei mir persönlich tatsächlich das erste Mal war. Jedenfalls war ich ganz optimistisch, dass sich der Pulverdampf verzogen haben würde oder die beiden Besitzer sowieso herausgefunden hatten, dass ich gar nichts angestellt hatte. Beinahe konnte ich den Heiligenschein fühlen, der über meinem Kopf schwebte. Und wenn es doch Schwierigkeiten geben sollte, dann konnte ich mich sicher herausreden. Keine Frage.
Das erste, was ich drinnen zu Gesicht bekam, war Bon, der seine roten Latzhosen auf der Bar bügelte. Was Klamotten betraf, hatte sich sein Geschmack seit den Zeiten der Valentines offenbar nicht entscheidend verbessert. Aber hey, es war Bon Scott. Bon war schon immer sehr, sehr eigen, was sein Äußeres betraf, seine Kleidung und vor allem seine Haare. Vince Lovegrove, der neben Bon bei den Valentines gesungen hatte, erzählte mir einmal, dass Bon damals unbedingt einen Pony tragen wollte, der völlig glatt auf seiner Stirn anlag. Dafür sorgte er, indem er nach dem Haarewaschen seine Stirnfransen perfekt in Form brachte und in nassem Zustand mit Klebeband an seiner Stirn festpappte, damit sie ganz gerade und ordentlich trockneten. Es war vermutlich das einzig Ordentliche an Bon Scott.
Während ich Bon beim Bügeln zusah, hörte ich eine Stimme. Eine sehr grantige. „Du hast hier Hausverbot, du kleines Arschloch.“ Es war Albert.
„Okay, auf zur zweiten Runde“, dachte ich mir, als mein Hintern wenig später wieder auf den Bürgersteig krachte. Bei der kleinen Rangelei, die anschließend entstand, konnte ich Albert einen hübschen Schwinger versetzen, und er wollte sich gerade ordentlich revanchieren, als Tana Douglas auftauchte. Tana war die Größte von uns allen, und das machte schon mal Eindruck. Sie erklärte dem aufgebrachten Pub-Besitzer, dass ich zur Band gehörte.
„Das da“, erklärte sie und deutete auf meinen Bassverstärker, der schon auf der Bühne lauerte, „ist sein Kram.“
Tana war eine „coole Braut“, wie man in Prahran damals zu sagen pflegte, und deswegen gelang es ihr auch, den zornerfüllten Kneipier zu besänftigen. Ich glaube, in meiner ganzen Zeit als Aktiver habe ich nie einen attraktiveren Roadie gesehen. Damals hatte ich den Eindruck, dass sie ziemlich auf Malcolm stand. Albert erklärte sie jedenfalls, wenn er wollte, dass die Band wie vereinbart spielte, dann sollte er mich lieber nicht vor die Tür setzen.
„Na gut, dann kann er bleiben“, brummte Albert, „aber ich hoffe mal, dass er sich jetzt ein bisschen am Riemen reißt!“
So entstand wahrscheinlich diese Legende, dass ich AC/DC zum ersten Mal im Station Hotel begegnete, als ich Ärger mit den Rausschmeißern hatte und mir Bon Scott und mein Kumpel Steve McGrath zur Seite sprangen. Klar, ein Körnchen Wahrheit ist darin, aber es war nicht die ganze Geschichte.
Nachdem ich mich mit Albert wieder vertragen hatte, ging ich zu Bon, den ich unbedingt hatte kennen lernen wollen. Er guckte mich von oben bis unten an und fragte mich dann: „Kannst du einigermaßen bügeln, Alter?“ Damit wandte er sich an den Barmann und bestellte zwei Bier und zwei Scotch.
„Wie geil ist das denn“, dachte ich, „Bon Scott gibt mir einen aus!“
Bon nahm die Drinks, ging an mir vorbei und setzte sich mit dem hübschesten Mädchen im ganzen Laden an einen Tisch.
Mich begleiteten an diesem Abend meine Kumpels Graham Kennedy und Mickey Smith, die wussten, dass ich bei der Band vorgespielt hatte, und die ich nun als moralische Unterstützung mitgeschleppt hatte. Mich interessierte aber auch, was sie von AC/DC hielten. Heute kann man sich die Band als Quartett, mit Malcolm am Bass, nur schwer vorstellen, aber es funktionierte damals hervorragend. Aber es war auch das erste Mal, dass ich sie live erlebte, und es war ein Ding der Unmöglichkeit, von Bon und Angus nicht beeindruckt zu sein, wenn die beiden voll aufdrehten, schon gar nicht in einem so kleinen Laden wie dem Station Hotel. Damals kam mir gar nicht der Gedanke, aber heute wünschte ich, jemand hätte für mich ein paar Bilder von AC/DC als Viererpack gemacht. Ich weiß noch, dass Mickey mich fragte: „Wieso wollen sie denn an diesem Line-up überhaupt irgendwas ändern?“ Das sah ich genauso. Wir waren alle mordsmäßig beeindruckt von der Band, so wie sie war.
Im Station Hotel kam der Sound direkt von der Bühne, denn die Band hatte nur eine kleine eigene Anlage, keine Monitore und auch keine Beleuchtung, von daher war es eine recht spartanische Angelegenheit. Aber mir reichte es völlig, und nachdem ihr erster Set durch war, brannte ich darauf, zu ihnen auf die Bühne zu kommen, auch wenn es nur 60 Mäuse in der Woche dafür gab. Geld spielte dabei sowieso keine Rolle; nicht einmal der Gedanke daran, den großen Durchbruch zu schaffen, kam mir in den Sinn. Mir ging es nur um eines – mit einer Rockband auf Tournee zu gehen. Nicht mit irgendeiner, sondern mit dieser hier. Diese Jungs hier hatten das gewisse Etwas, das spürte ich. Es waren auch ziemlich viele Mädchen im Publikum, wie meinen Kumpels gleich auffiel. Und ich sah keinen Grund, nicht auch gleich mal meine Chancen auszuloten.
Glynis und ich waren noch immer zusammen, jedenfalls theoretisch. Sie hatte mich kurz zuvor schon einmal erwischt, wie ich, um es mal harmlos auszudrücken, meine Hände in der Zuckerdose einer anderen hatte, und das hatte unsere Beziehung doch ein wenig getrübt. Eine Weile lieferten wir uns einen Wettbewerb im Geschirrzertrümmern, aber letztlich blieben wir gute Freunde und gingen auch immer mal wieder miteinander ins Bett, auch, nachdem wir nicht mehr zusammen wohnten. Glynis hatte begründete Zweifel, mir wieder ihr Vertrauen zu schenken, und angesichts dieser Lage interessierten mich die gut gebauten Ladys im AC/DC-Publikum besonders. Ich fühlte mich, als ob ich vor dem Schaufenster eines Bonbongeschäfts stand und gerade die Tür einladend aufschwang.
Der erste Set war laut und rotzig. Mickey fragte mich, ob Angus „immer so war“.
„Wie meinst du das?“, fragte ich.
„Der steht doch total unter Strom, findest du nicht? Was wirft der denn so ein?“
Ich konnte nur den Kopf schütteln. „Ich habe keine Ahnung.“
Aber Mickey gab keine Ruhe. „Finde das mal raus, ja?“
Diese Frage sollte mir von nun an ziemlich häufig gestellt werden. Die Leute kamen mit Angus’ Energielevel einfach nicht klar. Allerdings muss ich zugeben, dass es mich auch ziemlich verblüffte. Angus drehte einfach völlig durch, sobald er die Bühne betrat – er explodierte geradezu und war dann nicht mehr aufzuhalten. Die Intensität seiner Auftritte habe ich immer bewundert. Sobald die Band loslegte, gab er alles. Und das war an diesem Abend im Station Hotel auch so.
Beim zweiten Set war es dann soweit: Ich hatte meinen ersten Auftritt mit der Band. Nach ein paar Bier und Scotch war ich schon ziemlich in Fahrt. Ich freute mich darauf, mit ihnen zu spielen; die Songs waren nicht übermäßig kompliziert, und ich hatte mir die erste Show ja angesehen, wusste also, was auf mich zukam. Ich betrat die Bühne und wurde ein Teil von AC/DC.
Phil grinste mir breit entgegen. „Stell dich am besten direkt dort hin, Alter“, erklärte er und deutete mit seinen Drumsticks auf eine Stelle neben seinem Hi-Hat.
Als erstes spielten wir „Soul Stripper“, den Titel, den „der letzte Typ“ Mal zufolge nicht gepackt hatte. Über diesen geheimnisvollen Mann erfuhr ich niemals mehr, als dass er „Soul Stripper“ immer wieder versäbelte.
Wenn „Soul Stripper“ saß, dachte ich bei mir, dann habe ich den Job schon so gut wie im Sack, und so war es auch. Von Anfang an lief alles bestens. Mit diesen Jungs Bass zu spielen, das war ein großartiger Kick – wobei man auch sagen muss, wer zu Phil Rudds Schlagzeug und Malcolm Youngs Rhythmusgitarre keine vernünftige Basslinie hinkriegt, sollte sich eh einen anderen Beruf suchen. Wir beschlossen unseren Set mit einem Titel, der während der ganzen Zeit, die ich in der Band war, unser Rausschmeißer bleiben sollte: „Baby Please Don’t Go“.
Wir hatten ganz schön viel Dampf auf dem Kessel, und nun bekam ich Angus’ Nummer als epileptischer Schuljunge zum ersten Mal und aus nächster Nähe mit. Es haute mich um, wie schnell er spielen konnte, wie sauber und präzise, während er sich auf dem Bühnenboden wälzte und drehte. Außerdem stellte ich fest, dass Angus’ aus Milch und Schokoriegeln bestehende Ernährung zusammen mit dem Schweiß und dem Schuljungen-Brummkreisel dazu führte, dass er sich in einen Rotzorkan verwandelte. Alle, die mit ihm auf der Bühne standen, bekamen eine Portion ab, und die ersten Zuschauerreihen waren auch nicht sicher. Er ließ einfach total los, alles, auch den Rotz.
Ich war völlig platt, und meinen Freunden ging es genauso. Nachdem ich wieder von der kleinen, engen Bühne runter war, gesellte ich mich wieder zu Graham und fragte: „Und? Was meinst du?“
„Alter“, sagte Graham langsam, „den Job musst du einfach machen!“
Der Grund dafür, dass AC/DC mich an Bord holten, lag vor allem darin, dass Malcolm sich nie als Bassist betrachtete. Wie wir alle noch erfahren sollten, gibt es nicht allzu viele Gitarristen, die einen Song so formen können wie Malcolm; meiner Meinung nach steht er Keith Richards von den Stones und Billy Gibbons von ZZ Top um nichts nach. Auch wenn es heute seltsam erscheint, damals waren Malcolm und Angus für mich die unbekannten Gesichter, und das ging sicherlich nicht nur mir so. Von George, ihrem großen Bruder, hatte ich natürlich schon gehört, aber von ihnen selbst wusste ich gar nichts, und das war vermutlich bei allen anderen Musik-Fans in Melbourne nicht anders. Allerdings sollte sich das nun bald ändern. 1975 waren AC/DC noch ziemlich unbekannt, aber sie machten live enorm was los, und die Leute bekamen das allmählich mit, wobei „der Kleine“ in der Schuluniform immer noch für irritierte Blicke sorgte.
Wie ich später erfuhr, hatte Michael Browning darauf bestanden, mich an diesem Abend im Pub genau unter die Lupe zu nehmen – und hätte er mich nicht gemocht, dann wäre ich auch nicht eingestiegen, so einfach war das. Michael war vor allem der visuelle Aspekt wichtig: Passte ich zum Image der Band? Wie groß war ich? Oder, aus AC/DC-Sicht formuliert, wie klein? Wie schon gesagt, ich kam mir neben den anderen Jungs in der Band wie ein Riese vor. Das hatten wir mit unseren großen Idolen, den Rolling Stones, gemeinsam – wir waren alle nicht gerade die „Größten“.
Malcolm hatte mich also nicht nur zu dem Gig eingeladen, damit ich die Band mal live erleben und auch mit ihnen jammen konnte, sondern auch, damit Michael mich in Augenschein nahm. Als Mal mich dem Manager schließlich präsentierte, sagte er nur: „Das ist der Typ, von dem ich dir erzählt habe.“ Kein Name, kein Händeschütteln, keine höfliche Vorstellung. Michael guckte an mir rauf und runter, sah dann wieder Mal an und nickte. Das war’s. Ich war dabei. Nun hatte ich nicht gerade einen Tusch erwartet, aber ein Handschlag und ein „Willkommen in der Band“ wäre ja doch schon irgendwie nett gewesen. Trotzdem war es natürlich besser, als Verwaltungsangestellter im Öffentlichen Dienst zu sein. Michael nickte mir zu, und damit war ich nun wirklich dabei. So lief es auch später immer: Entscheidungen wurden grundsätzlich gefällt, ohne dass Phil Rudd oder ich dazu besonders viel zu sagen hatten.
Vor allem in den frühen Tagen war die Band keine demokratisch geführte Truppe. Wie Ralph mich schon gewarnt hatte, bekam ich sofort zu spüren, dass es Malcolms Band war, und dass Entscheidungen gewissermaßen durch Osmose weitergegeben wurden, jedenfalls, soweit es mich betraf.
Aber auch, wenn mein Einstand sich etwas kühl gestaltete, war der Abend für mich eine echte Erleuchtung. Endlich bot sich mir eine Gelegenheit, es im Musikbusiness ein bisschen weiterzubringen als bisher – als Teil einer Band, die musikalisch wirklich gut war und in die ich mit meinem persönlichen Musikgeschmack hervorragend hineinpasste. Die Stones, ZZ Top – ihr Album Tres Hombres zählt immer noch zu meinen Lieblingsplatten –, Chuck Berry, Little Richard waren für die ganze Band feste Größen, und das war bei mir nicht anders.
Das Publikum im Station Hotel war dafür bekannt, ziemlich hart mit den Bands ins Gericht zu gehen, die dort auftraten. Es war eine interessante Mischung aus Hippies, Besoffenen und neugierigen Musik-Fans, die sich an jenem Abend AC/DC ansahen. Wegen der Schuluniform gab es ein paar Kommentare wie „Was soll denn der Scheiß?“, vor allem von den Leuten, die wegen Bon gekommen waren. Von der Kiffer- und Linsensuppenszene rund um Fraternity zu AC/DC war es ja nun doch ein ziemlich großer Schritt. Aber Bon passte wesentlich besser zu einer Truppe, bei der er zu erdigem, ruppigem Blues Rock kreischen und schreien und Chaos verursachen konnte, als zu den Ökos, mit denen er vorher herumgezogen war. Heftig abzurocken musste doch einfach mehr Spaß machen, als in den Adelaide Hills irgendwo auf dem Land zu hocken und in Kaftanen rumzurennen, verdammt noch mal!
Nach meinem ersten Abend mit der Band testete ich gleich meinen neu gewonnenen Kredit bei den Ladys im Station Hotel aus. Wir fuhren alle zusammen in die Lansdowne Road zurück, wo ich mich gern als willige Füllung eines Rock’n’Roll-Sandwichs zur Verfügung stellte. Im Station hatte ich zwei neue Freundinnen kennen gelernt. Sie waren wegen AC/DC gekommen und hatten sofort Gefallen an mir gefunden (na ja, sofort, nachdem klar war, dass ich der Bassist war); von daher hatten sie mich auf einen, zwei, zehn Absacker ins Chateau AC/DC begleitet. Ich besorgte eine Flasche Johnnie Walker und Coke (das Getränk, wohlgemerkt) und machte mich damit bei meinen neuen Kollegen gleich richtig beliebt.
Jennie und Sandy (Namen von der Redaktion geändert), die beiden Brothälften meines nächtlichen Sandwichs, waren der Band schon gut bekannt. Sie gehörten zur typischen Entourage, wie sie aufstrebende Bands wie AC/DC am Leben erhält. Sie waren keine Übelnehmerinnen und stets gern bereit, mit anzufassen (oder angefasst zu werden), wenn ein Bandmitglied Hilfe brauchte, und dementsprechend freuten sich alle, dass sie nach dem Konzert noch mit auf die Ranch kamen. Ich fühlte mich großartig – der Gig war gut gelaufen, und nun hieß man mich auch im Clan willkommen. Bon war allerdings nicht da. Wie es sich später zur Gewohnheit entwickeln sollte, war er schon nach der Show verschwunden, um mit seiner damaligen Freundin Judy King, einer sehr anständigen jungen Frau, zusammen zu sein.
Nach ein paar Drinks war mir angenehm wuschig und warm vom Johnnie Walker und der Aufmerksamkeit, die mir die beiden Mädels schenkten. Allmählich bekam ich einen Eindruck davon, wie super das Leben sein konnte, wenn man in einer Rockband spielte. Dann kam mir der Gedanke, es könnte schlauer sein, sich ein wenig zurückzuziehen, um etwas Privatsphäre zu genießen, also ging ich mit einer meiner neuen Bekanntschaften in Phils Zimmer. Ich kann mich ums Verrecken nicht mehr dran erinnern, wieso ich mich für sie entschied und nicht für ihre Freundin, aber es dauerte nicht lange, da tauchte auch die bei uns auf. „Vielen Dank, dass ihr mich da draußen habt sitzen lassen“, erklärte sie ein wenig beleidigt. „Ich dachte, wir bleiben zusammen.“ So langsam erwärmte ich mich immer mehr für den Lifestyle der Band.
Je später es wurde, desto mehr vertieften wir unsere Freundschaft. Für mich war es der Beginn einer Lernkurve, die ziemlich steil nach oben ging; es ist nämlich nicht so einfach, zwei Frauen auf einmal glücklich zu machen, das kann ich euch sagen. Aber es macht auch verdammt viel Spaß. Glücklicherweise lernte ich außerdem ziemlich schnell. Daher an dieser Stelle mal ein Tipp für den Nachwuchs: Sei am Anfang nicht zu schnell und zu eifrig, sondern lass dir Zeit und denke immer daran, dass du spätestens dann mal kurz durchschnaufen kannst, wenn die beiden Ladys mit sich selbst beschäftigt sind, was eigentlich immer passiert. Ich döste während unserer Nummer sogar einmal kurz ein, während die Mädels ihre Motoren weiterlaufen ließen, und startete später wieder durch. Es ist schon erstaunlich, was man alles leisten kann, wenn man entsprechend motiviert ist.
Allerdings war es auch nicht das erste Mal, dass ich in eine derart glückliche Lage geriet. Zu einer gelungenen ménage à trois gehört viel Ausprobieren, und schon einmal zuvor waren mir zwei willige „Assistentinnen“ begegnet, die bereit gewesen waren, mir bei meinen empirischen Untersuchungen im Hilton zur Hand zu gehen. Das Problem war nur, dass meine Mutter unerwartet hereinschneite, und es ist nichts scheußlicher, als mittendrin von Mutti überrascht zu werden. Nach einer peinlichen Pause blieb mir nichts anderes übrig, als tief durchzuatmen und die Damen miteinander bekannt zu machen.
„Mum“, sagte ich, „darf ich vorstellen, das ist –“ Und in diesem Augenblick tauchte ausgerechnet der Kopf meiner zweiten Begleiterin unter der Decke auf.
Meine liebe Frau Mama schluckte kurz, dann fragte sie: „Mark Whitmore Evans – wie viele hast du noch da drin?“