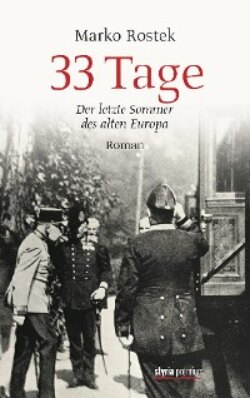Читать книгу 33 Tage - Marko Rostek - Страница 12
SONNTAG, 5. JULI
ОглавлениеDie Nacht im Zug ist ruhig verlaufen, nur einmal hat der Schaffner seinen Schlaf gestört und einen außerplanmäßigen Halt bei Dresden angekündigt. Man müsse bei einem Aggregat der Lokomotive ein Ventil tauschen, was jedoch innerhalb von Minuten erledigt sein würde. Noch schlaftrunken seinen Zeitplan im Kopf durchgehend, hat er sich, mit einem für den Schaffner wohl unverständlichen „Danke für die Information“-Gebrummel wieder umgedreht und ist alsbald durch das charakteristische Tocktock, Tock-tock der Eisenbahn wieder eingeschlafen. Eine halbe Stunde vor Berlin wird er, wie vereinbart, geweckt, kleidet sich an und lässt sich das Frühstück in das Abteil bringen.
Als er schließlich in Berlin aus dem Zug steigt, fühlt er sich bestens vorbereitet und zuversichtlich, die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllen zu können. Vor dem Bahnhof ist er fasziniert von dem Getümmel, dem geschäftigen Treiben in den Straßen, den unglaublich vielen Automobilen und den allerorts erkennbaren Anzeichen einer prosperierenden, modernen europäischen Metropole. Einige Minuten bleibt er so stehen und erliegt ganz der Anziehungskraft des pulsierenden Treibens. „So stelle ich mir die Moderne des 20. Jahrhunderts vor“, denkt er bei sich. Kurz darauf wird er vom Mitarbeiter der österreichischen Botschaft entdeckt, der ihn im Automobil zum Botschaftsgebäude bringt. Nachdem er kurz beim österreichischen Botschafter vorstellig geworden ist, um diesen noch mündlich in die bevorstehenden Gespräche einzuweihen, der durchgeführte schriftliche Telegrammwechsel wird in Zeiten der unausgesetzten Spionagegefahr nur auf die nötigsten Formalismen beschränkt, deckt er sich mit den notwendigen und neuesten Informationen über seine Kontaktpersonen, die er in den nächsten Tagen treffen wird, ein.
Hoyos hat es eilig, denn er wird bereits zum Mittagessen vom deutschen Kaiser erwartet. Der Botschaftsangehörige, der ihn vom Bahnhof abholt, begleitet ihn zum neuen Palais in Berlin und setzt ihn pünktlich vor den Toren des Amtssitzes von Kaiser Wilhelm ab. Während Alexander Hoyos mit großen Augen das imposante Stadtschloss bewundert, erinnert er sich beruhigt daran, dass er seine Unterredungen für den heutigen Tag wieder und wieder im Geiste durchgegangen ist.
Hoyos blickt dem Mitarbeiter der Botschaft nach und wartet, bis dieser einen Parkplatz in unmittelbarer Nähe gefunden hat, dann wendet er sich dem monumentalen Eingangstor des Stadtschlosses zu. Hoch aufragende, beeindruckende Steinsäulen umrahmen ein prächtig glänzendes schwarzes Gittertor, das an seinem oberen Ende mit dem prunkvollen Wappen der Hohenzollern gekrönt wird. Das große Tor, das nur dann geöffnet wird, wenn für Automobile und Lastkraftfahrzeuge die Einfahrt frei gemacht wird, gestattet einen eindrucksvollen Blick auf das Anwesen des deutschen Kaisers. Eine breite und mit strengen, geradlinigen Mustern gepflasterte Straße führt vom Tor geradewegs zum Haupteingang des Schlosses. Links und rechts der Straße sind üppige Blumenrabatten und Beete angelegt, die von kurz geschnittenen Buchsbaumspalieren eingesäumt sind. Im Hintergrund erkennt Alexander Hoyos die ausgedehnten Parkanlagen.
Für jene Gäste, die zu Fuß zum Palast kommen, gibt es an beiden Seiten des großen Tores kleinere Eingangstüren. Zielsicher und ein wenig ehrfurchtsvoll steuert der Österreicher auf den Eingang zu. Nach Aufforderung des Wachhabenden meldet sich Hoyos als Gast des deutschen Kaisers an. Der diensthabende Offizier blättert kritisch in seinen Unterlagen, um dann bei den Einträgen zum heutigen Tag mit den behandschuhten Fingern die Seite entlang nach unten zu fahren. Beim Besuchseintrag für die Mittagsstunde hält sein Finger abrupt an. Der Offizier beugt sich nach vorn um die ausgesprochen klein geschriebenen Buchstaben lesen zu können. „Sektionschef Alexander Hoyos, Wien“, liest der Mann vor. Er richtet sich wieder auf und wirft einen prüfenden Blick auf den Gast: „Ich bitte Sie, mir Ihre Papiere vorzulegen.“ Nachdem sich Hoyos mit seinem Diplomatenpass legitimiert hat, ruft der wachhabende Offizier einen Chargen herein und erteilt den Auftrag, den Gast aus Österreich ins Palais zu Kaiser Wilhelm zu geleiten. Kurz darauf verlassen beide die Torwache durch eine hintere Tür und schreiten dem weiträumigen Vorplatz des Palais entgegen.
Hoyos fällt überall Personal ins Auge, das mit vielerlei Aufgaben beschäftigt ist. Auch Angehörige der Armee in unterschiedlichen Uniformen sind anwesend und wirken allesamt ausgesprochen beschäftigt sowie höchst konzentriert in der Ausführung ihrer Aufgaben. Während die beiden flinken Schrittes auf den imposanten Haupteingang des Schlosses zusteuern, bemerkt der österreichische Delegierte mit Genugtuung, dass man von ihm keine Notiz nimmt. Vorbei an Beeten mit üppigem Blumenschmuck und saftig grünen Rasenanlagen erreichen die beiden den Haupteingang, der ihnen vom zuständigen Personal so zeitgerecht geöffnet wird, dass sie für das Eintreten nicht stehen zu bleiben brauchen. Über eine prachtvolle weiße Marmortreppe geht es in den ersten Stock, dann nach links und einen schier endlosen Gang mit unzähligen Türen an beiden Seiten entlang. Unvermittelt schwenkt der Begleiter alsbald in einen Seitengang und bleibt kurz darauf vor einer eindrucksvollen Eichentür mit schweren Beschlägen stehen. „Bitte warten Sie hier einen Moment, ich werde Sie unverzüglich bei Seiner Majestät anmelden.“ Mit diesen Worten öffnet der Charge die Tür und verschließt diese von der anderen Seite, noch bevor Hoyos einen Blick hineinwerfen kann. Das Geräusch der zugeworfenen Tür hallt den Gang entlang und entschwindet nur langsam Hoyos‘ Ohren.
Kein Mensch ist zu sehen. Hoyos lauscht angestrengt. Von der anderen Seite der Türe sind Schritte zu hören, die langsam näher kommen und sich wieder entfernen. Die kurze Wartezeit nützend, ruft sich Sektionschef Hoyos, während er seine Tasche mit den Unterlagen auf den Boden stellt, nochmals seinen Auftrag in Erinnerung. In den bevorstehenden Zusammentreffen, heute mit dem deutschen Kaiser und morgen mit dem Reichskanzler, gilt es, jene Zusicherungen einzuholen, die nach Ansicht seines Chefs, Minister Berchtold, die Voraussetzung darstellen, um es überhaupt zu einem Vergeltungsschlag gegen Serbien kommen zu lassen. Zu seiner offiziellen Mission gehört auch das Überbringen der Denkschrift und des Memorandums. In Ergänzung dazu soll er in Berlin die Lage der Monarchie am Balkan mündlich ausführlich hervorheben. Im Angesicht der Tragödie von Sarajevo habe er mit größtmöglicher Bestimmtheit die Verpflichtung für Österreich-Ungarn herzuleiten, den von der serbischen Aggression aufgezwungenen Existenzkampf nunmehr sofort aufnehmen zu müssen. Um für dieses Vorhaben Rückendeckung gegenüber den Mächten zu erhalten, habe er weiters das Deutsche Reich um diplomatische Unterstützung vor allem gegenüber Italien und Rumänien, die beide höchstwahrscheinlich Kompensationsforderungen an Österreich stellen werden, zu ersuchen und unbedingt zu erhalten. Es ist natürlich kein Zufall, dass Berchtold gerade ihn für diese Mission ausgewählt hat, denn er ist einer jener engen Berater im Ministerium, die für eine harte und kraftvolle Vorgehensweise gegen Serbien eintreten. Für Hoyos sollte es daher ein Leichtes sein, in den geeigneten Momenten der bevorstehenden Verhandlungen die nötige Selbstsicherheit und die richtigen Argumente für die österreichische Ernsthaftigkeit und Zielstrebigkeit vorzubringen.
Hoyos zupft an seinem Jackett und blickt prüfend an sich herunter. Der Schlips sitzt ordentlich, die Hose ist faltenfrei und sauber, die Schuhe glänzen. Dann zieht er beide Hemdsärmel zurecht, sodass die Manschettenknöpfe deutlich sichtbar unter den Jackettärmeln hervorblinken. Seine Gedanken kreisen noch um etwas anderes, das ihm mitgeteilt worden ist. Neben den Dokumenten und seinen offiziellen Aufträgen hat ihm Berchtold kurz vor der Abreise unter vier Augen noch eine mündliche Instruktion mitgegeben. Er hat genickt, als ihn der Minister einleitend fragte, ob er wisse, was auf dem Spiel stünde. Dann hat Berchtold hinzugefügt: „Das Ergebnis der vorgestrigen Audienz bei Seiner Majestät hat mich genau zwischen die beiden gegensätzlichen Standpunkte für unsere mögliche Reaktion auf das Attentat in Sarajevo gedrückt: Im einen Lager finden wir Conrad, Krobatin, Potiorek, Forgách und andere, die auf die schnelle und militärische Lösung drängen, und auf der anderen Seite steht Graf Tisza, der mit seinem politischen Schwergewicht alleine das Gegenstück darstellt und den Kaiser zurückhält.“ Hoyos erinnert sich, wie Berchtold bei diesen Worten den Blick nach unten richtete und ernüchtert den Kopf schüttelte. Dann hat der Minister den Kopf wieder gehoben und ihm mit ungewohnter Härte in der Stimme zugeraunt: „Wir beide wissen, dass Sie der Gruppe um Conrad zuzuzählen sind, und ich tendiere ebenfalls in diese Richtung. Aber ohne einen Rückhalt aus Berlin können Sie nicht auf mich zählen. Dann wird es keinen Feldzug gegen Serbien geben. Ist das klar, Herr Sektionschef?“ Wieder hat Hoyos genickt. „Wenn Sie mich also auf Ihrer Seite wissen wollen, um beim Kaiser das nötige politische Gewicht gegen Tisza zustande zu bringen, bringen Sie mir eine uneingeschränkte Unterstützungszusage aus Berlin.“
Hoyos ist über diese ungewöhnliche Offenheit und Direktheit des Ministers noch immer erstaunt. Wieder greift er nach seinem Schlips, um diesen ein weiteres Mal zurechtzurücken. In diesem Moment vernimmt Hoyos wieder Schritte. Dieses Mal wird die Tür geöffnet und der Begleiter bittet ihn weiterzukommen. Erneut folgen sie einem Gang, passieren etliche kleinere Zimmer und erreichen endlich den Wartesalon des Kaisers. Gemeinsam mit Mitarbeitern und weiteren Gästen wird Alexander Hoyos in das kaiserliche Speisezimmer geführt und an einen Stuhl am festlich gedeckten Esstisch verwiesen. Bedächtig geht Hoyos auf diesen zu und bleibt dahinter stehen. Sekunden später erscheint Wilhelm II., deutscher Kaiser und König von Preußen, mit energischem Schritt, gefolgt von einer Handvoll Offizieren. Nacheinander begrüßt der Kaiser seine Gäste, blickt jedem dabei fest in die Augen und wechselt einige freundliche Worte. Auch den österreichischen Gast begrüßt er auf diese Weise herzlich, seine behinderte linke Hand stets hinter dem Rücken haltend. Nach einigen allgemeinen Bemerkungen zur Fahrt und dem Befinden bittet der Kaiser zu Tisch und setzt sich. Hoyos und die anderen Gäste nehmen nach den höfischen Regeln erst Platz, nachdem der Kaiser das Zeichen dafür gegeben hat.
Kaum, dass die Plätze eingenommen sind, kommt Wilhelm zur Sache und wendet sich an den Gast aus Wien: „Sie haben Dokumente für mich mitgebracht?“ „Jawohl, Euer Majestät“, entgegnet Hoyos und fährt, nachdem der Kaiser einen fragend Blick des Wieners aufmunternd beantwortet hat, fort: „Es handelt sich hierbei zum einen um ein Memorandum, welches die gegenwärtige politische Lage der Donaumonarchie beschreibt und mit den Erkenntnissen aus den jüngsten schrecklichen Vorfällen in Sarajevo ergänzt wurde, und zum anderen um ein Allerhöchstes Handschreiben Seiner Majestät Kaiser Franz Josephs, welches direkt an Euer Majestät gerichtet ist.“ Hoyos öffnet seine Aktentasche, zieht die beiden Schriftstücke heraus und reicht sie dem ihm nächststehenden Adjutanten. Dieser übernimmt sie mit einem Kopfnicken, geht um den Tisch herum und übergibt sie mit einer tiefen Verbeugung dem Kaiser. Ohne zu zögern öffnet Wilhelm die Umschläge beider Dokumente und beginnt, während die Dienerschaft die Speisen ins Zimmer trägt, diese hastig zu überfliegen. Servierwägen werden gebracht, wobei die darauf befindlichen Speisen durch glänzende Abdeckungen den Blicken der Gäste entzogen sind. Anderes Personal trägt Schalen mit heißem Wasser an die Tische und stellt diese jeweils zwischen zwei der Gäste. Die Vorbereitungen enden damit, dass hinter jedem Gast ein Diener mit einem Tablett wartet. Auf ein Zeichen Wilhelms treten die Diener in vollkommener Bewegungsharmonie an den Tisch und setzen die Speisenteller unmittelbar vor den Gästen ab. Zuletzt wird die Abdeckung auf den Tellern entfernt und der Blick auf die Speisen freigegeben. Sofort steigt der warme Duft der herrlichen Vielfalt den erwartungsvoll am Tisch Sitzenden in die Nasen.
Währenddessen ist Wilhelm aufgestanden und hat seine Gäste ermahnt, sich nicht von den Köstlichkeiten abhalten zu lassen, während er seine Aufmerksamkeit völlig auf die Dokumente zu richten gedenke. Jetzt geht er mit kleinen, vorsichtigen Schritten im Hintergrund des Speisesaals auf und ab und vertieft sich vollständig auf die beiden Schriftstücke, die er kontinuierlich umblätternd mit großem Interesse liest. Ab und an bleibt er stehen, um sich besser auf die Formulierungen konzentrieren zu können. Hoyos, ein wenig orientierungslos ob dieser unorthodoxen Vorgehensweise, blickt Hilfe suchend um sich. Als er sieht, dass der höchstrangige Offizier unter den Anwesenden ihm aufmunternd zunickt, ergreift Hoyos das Besteck und beginnt mit der Mahlzeit. Kaiser Wilhelm verliert er dabei keinen Moment aus den Augen. Wilhelm liest zuerst das Allerhöchste Handschreiben, dann das Memorandum, wie Hoyos bemerkt. Nachdem Wilhelm das Studium der Unterlagen beendet hat, bleibt er stehen, dreht sich zu Hoyos um, der augenblicklich aufspringt, und winkt ihn zu sich. Die Serviette auf den Tisch legend und hektisch den Stuhl nach hinten rückend, eilt Hoyos auf den Monarchen zu. „Ich“, beginnt der Kaiser und dreht sich mit dem Österreicher vom Tisch weg, „bin über die Inhalte der beiden Dokumente nicht überrascht und habe Mir aufgrund des schrecklichen Ereignisses, welches meinen lieb gewonnenen Freund Franz Ferdinand auf so entsetzliche Weise aus dem Leben riss, eine Reaktion auf das Attentat in dieser Art erhofft und erwartet. Richten Sie Seiner Majestät Kaiser Franz Joseph aus, dass Ich die Donaumonarchie unterstützen werde, auch“, Wilhelm hält inne und starrt Hoyos mit leicht zugekniffenen Augen an, „wenn es zu einem Ernstfall kommen sollte. Heute Nachmittag habe Ich eine Unterredung mit Reichskanzler Bethmann Hollweg, dieser wird Ihnen morgen eine definitive Antwort überbringen.“ Hoyos ist überrascht. Auf eine derart klare Aussage hat er nicht zu hoffen gewagt, noch dazu ohne sein gänzliches Dazutun. Nach einem leisen „Jawohl, Euer Majestät“ und einer angedeuteten Verbeugung dreht sich Hoyos um und geht an seinen Platz zurück.
Nach dem Essen erweist Wilhelm II. seinen Gästen noch die Ehre eines gemeinsamen Digestives, bricht dann jedoch alsbald die Konversation mit dem Hinweis ab, dass der Reichskanzler für die angekündigte Unterredung jeden Augenblick eintreffen würde. Alexander Hoyos und die meisten der anderen Gäste werden von einem Hofbediensteten durch die Vorzimmer, Gänge und Treppen wieder zum Tor gebracht. Hoyos ist vom soeben Erlebten zutiefst beeindruckt. Die unkonventionelle Haltung des deutschen Kaisers ihm gegenüber, die unumwunden klare und deutliche Zusicherung, die Donaumonarchie zu unterstützen, sowie die Beiziehung des mächtigen deutschen Reichskanzlers zur Erörterung des österreichischen Anliegens verlangen ihm Respekt vor dem deutschen Führungsstil ab. „Und das alles“, er gerät bei diesen Gedanken ins Schwärmen und kann einen neidvollen Seufzer beim Vergleich mit dem Wiener Krisenmanagement nicht unterdrücken, „innerhalb eines Nachmittages, hier wird nicht lange gefackelt. Es scheint, als würde Wilhelm wissen, was zu tun ist!“
Am großen Tor angekommen, wird er aus dem Neuen Palais entlassen und wieder zurück auf die Straße geführt. Er hört das hinter ihm zufallende Tor und die sich rasch entfernenden Schritte des Wachpersonals. Seine Blicke suchen das Botschaftsautomobil, das er alsbald die Straße hinunter entdeckt. Der Fahrer steht gelassen an das Fahrzeug gelehnt und unterhält sich mit Passanten. Als er vor dem Tor die Straße überqueren will, muss er für einen Moment stehen bleiben, denn eine schwarze Limousine kommt zügig näher. Unmittelbar vor Hoyos reduziert der Fahrer seine Geschwindigkeit und biegt in Richtung Haupttor des Palais ab. Sich erneut dem Tor zuwendend, bemerkt Hoyos, wie zwei Wachebeamte aus dem Haus stürzen und die schweren gusseisernen Flügeltore auseinanderdrehen, um dem Wagen die Durchfahrt zu ermöglichen. Während die Limousine wartet, erkennt der österreichische Sondergesandte den deutschen Kriegsminister Erich Falkenhayn und Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg im Fond des Wagens. Für eine nähere Bestimmung der anderen Personen, deren Silhouetten Hoyos ebenfalls wahrnimmt, reicht die Zeit nicht, denn der Fahrer nimmt sofort wieder Fahrt auf, nachdem die Tore geöffnet sind. Alexander Hoyos beobachtet, wie der Wagen die Auffahrt entlangfährt und, während die Gittertore wieder geschlossen werden, die Männer aussteigen und im Schloss verschwinden.
„Hm, Falkenhayn, Bethmann Hollweg und andere! Unsere Angelegenheit scheint von größter Wichtigkeit für Berlin, denn sonst wäre nicht die Reichsspitze vertreten.“ Hoyos blickt bei dem Gedanken noch einmal links und rechts, um danach schnellen Schrittes die Straße zu überqueren und zum Automobil zurückzueilen.
***
Kaum hat der Wagen vor dem Haupteingang des Palais gehalten, werden die Türen aufgerissen und die Insassen steigen aus. Der deutsche Reichskanzler erhebt sich mühsam und steigt unbeholfen hinter Falkenhayn aus dem Wagen. Kurz stehen bleibend blickt Bethmann Hollweg zurück zur Einfahrt, wo er gerade noch einen Mann erkennen kann, der flinken Schrittes die Fahrbahn überquert und dann seinen Blicken entschwindet. Ihm ist, als hätte er, während das Automobil kurz anhielt, vor dem Tor des Palasts den österreichischen Gesandten gesehen, der für den nächsten Tag bei ihm angekündigt ist. Bethmann Hollweg schiebt den Gedanken beiseite und stellt fest, während er sich langsam die Stufen zum Eingang aufwärtskämpft, dass der Kriegsminister und die anderen Begleiter bereits vorausgeeilt und im Palais verschwunden sind.
Der Reichskanzler fühlt sich müde, ausgezehrt und antriebslos. Der kurzfristige Stimmungsaufschwung, der vorgestern Abend bei ihm durch die kaiserlichen Randnotizen auf Tschirschkys Bericht eingetreten ist, hat nicht lange angehalten. Seine Stimmung hat bald danach wieder umgeschlagen. Durch den Tod seiner über alles geliebten Frau im Mai dieses Jahres hat sich sein bisheriges Leben, sowohl das private als auch das politische, mit einem Schlag relativiert. Schon vor dem tragischen Ereignis hat ihn die lange, schwere Krankheit seiner Frau immens belastet und seine ohnehin ausgesprochen pessimistische Grundhaltung, was die Lage des Deutschen Reiches im Allgemeinen und die Gestaltungsfreiheit seiner Regierungstätigkeit im Besonderen betrifft, zusätzlich verstärkt. Durch den Tod seiner Gattin hat eine Perspektivenlosigkeit und Leere von ihm Besitz ergriffen, mit der er nicht umgehen kann. Schließlich hat er sich vorgenommen, die Sommertage auf seinem Landsitz östlich von Berlin, fernab der politischen Weltbühne, zu verbringen, um seine angeschlagene Verfassung wieder ins Lot zu bringen. Was sein Privatleben anbelangt, so hat er die Hoffnung gehegt, dass sich die vertraute und stimulierende Umgebung auf seinem Gut positiv auswirken würde.
Was sein öffentliches Leben als Kanzler des Deutschen Reiches anbelangt, so hat er mit Erschütterung feststellen müssen, dass sich die innere Leere auch seiner Einstellung zur aktiven Gestaltung der Politik bemächtigt hat. Lustlosigkeit und völliger Verlust von Kompromissbereitschaft haben sich in seine Arbeitsweise eingeschlichen. Während seine außenpolitische Ausrichtung immer danach gestrebt hat, mit England einen friedlichen Konsens zu finden, sieht er jetzt darin keinen Sinn mehr. Die letzten Jahre haben zwar zögerliche Annäherungen mit der Weltmacht gebracht, aber nun tritt die politische und militärische Einkreisung des Deutschen Reiches im klarer vor seine Augen. Für seine Ziele hat er stets Kompromisse gemacht, in Marokko, in Persien, und noch zuletzt ist er dem englischen Sondergesandten Haldane weitestgehend entgegengekommen. Doch jetzt, im Banne der geänderten Wahrnehmung, ist es ihm möglich, sich einzugestehen, dass durch die britisch-russischen Flottenvereinbarungen des vergangenen Jahres seine Politik der Annäherung an England gescheitert ist. Das harte Ringen um die kleinen Schritte hat zu nichts geführt, jetzt ist damit Schluss. Seine persönliche Tragödie hat ihm klargemacht, dass die österreichisch-ungarische Monarchie aus dieser Einkreisungspolitik als letzter und wichtigster Verbündeter hervorgetreten ist. Daher begreift er die Nachricht aus Sarajevo, die ihn auch auf seinem Landsitz erreicht hat, als Chance für Deutschland, aus dieser Umklammerung auszubrechen und Weltmachtpolitik ganz nach der Spielart seines Kaisers zu betreiben.
Was soll ihn jetzt daran hindern? Er, Theobald von Bethmann Hollweg, hat nichts mehr zu verlieren. Er schnauft die letzten Meter ins Sitzungszimmer des Kaisers und stellt fest, dass die übrigen Teilnehmer dieser Unterredung und der Kaiser selbst bereits am Konferenztisch sitzen. Zigarrenrauch treibt ihm entgegen. Durch die geöffneten Fenster dringt kühle Luft ins Zimmer, sodass die Atmosphäre halbwegs erträglich ist. Kaum hat Bethmann Hollweg den Raum betreten und den Kaiser begrüßt, beginnt dieser, sein Gespräch mit dem österreichischen Delegierten Hoyos zusammenzufassen, und liest Auszüge aus den beiden ihm überbrachten Dokumenten vor. Nachdem er mit seiner Schilderung fertig ist, legt Wilhelm die Papiere weg und fährt fort: „Für Österreich und dessen Entschlussfreudigkeit in dieser Sache ist es von enormer Wichtigkeit, dass wir in dieser schweren Stunde hinter ihm stehen. Und für das Deutsche Reich ist es lebenswichtig, dass die Habsburgermonarchie auch weiterhin als vollwertiger Verbündeter im Dreibund verbleibt.“ Wilhelm blickt in die Runde. Niemand sagt ein Wort, doch alle nicken zustimmend. „Ich halte jedoch fest, dass Ich Österreich nicht vorschreiben kann, was es zu tun hat. Trotzdem habe Ich zugesagt, dass sie bei ihren Aktivitäten Unsere volle Unterstützung finden werden.“ „Wenn Österreich nicht länger gewillt ist, diese ewigen Provokationen Serbiens hinzunehmen, wird es wohl militärisch dagegen vorgehen müssen!“ Bethmann Hollwegs Einwurf wird von den Übrigen mit zustimmenden Äußerungen quittiert. Der Reichskanzler fährt fort: „Wir müssen aber in Betracht ziehen, dass Russland diesen Schritt der Österreicher in Serbien nicht tolerieren wird und sich zum Krieg gegen den verhassten Feind entschließen könnte. Österreich würde sich dann einem Zweifrontenkrieg gegenübersehen.“ Bethmann Hollweg klingt besorgt und seine Stimme spiegelt seine müden Augen wider. „Ja, das ist korrekt“, entgegnet Wilhelm. „In diesem Fall tritt Unsere Bündnisverpflichtung in Kraft und Ich habe Österreich jedenfalls Meine Unterstützung auch dafür zugesichert.“
Bethmann Hollweg, Falkenhayn und die anderen sind erstaunt und blicken den Kaiser entgeistert an. Eine überhastete Aktion Wilhelms hatte man schon des Öfteren zu glätten gehabt, aber eine Unterstützungserklärung für einen Kriegsfall gegen Russland, noch dazu in Abwesenheit des Chefs des Generalstabes, wird von allen als ausgesprochen leichtsinnig empfunden. Verlegen wandern Blicke der Männer umher, wer wohl den Mut aufbringen wird, dem Kaiser den Leichtsinn dieser Zusage vor Augen zu führen. General Falkenhayn, der Kriegsminister, fasst sich ein Herz und erkundigt sich ausweichend beim Kaiser, ob gemäß dieser Zusage nicht auch in Deutschland Vorbereitungen für den Kriegsfall zu treffen wären. Wilhelm II. blickt seinen Minister an und schwächt mit einem lächelnden Gesichtsausruck ab: „Nein, das wird nicht nötig sein, denn es wird Meiner Einschätzung nach nicht zum Krieg kommen!“ Der deutsche Kaiser lehnt sich entspannt im Sessel zurück und genießt die verwunderten Gesichter seiner Gesprächspartner. Mit überlegenem Gesichtsausdruck fährt er fort: „Bedenken Sie, dass man, selbst wenn Russland entgegen aller Logik mobilisieren sollte, davon ausgehen kann, dass die österreichische Armee mit den Serben fertig sein wird und sich an die russische Grenze verschiebt, bevor Russland die Mobilmachung abgeschlossen hat. Ich denke also, dass Russland einen Verhandlungsweg einschlagen wird, bevor es sich auf einen Krieg einlässt.“
Nach einem Moment der Zurückhaltung macht wieder allgemeines Kopfnicken die Runde. Man entzündet Zigarren, zieht genüsslich daran und versucht, die Strategie des Kaisers noch einmal nachzuvollziehen. Dieser setzt wohl auf die Tatkraft der Österreicher, die ehestmöglich gegen die Serben zu Felde ziehen und diese vernichtend schlagen müssen. Bevor die Russen dann mit ihrer Mobilmachung, die gewiss 30 Tage dauert, die Österreicher bedrohen, hätten diese einen Stellungswechsel vollzogen und könnten die Russen an der gemeinsamen Grenze erwarten. Die Russen würden daraufhin wieder zurückziehen und die Sache wäre erledigt. Zigarren werden zum Mund geführt und blasser Rauch hebt sich langsam zum Plafond empor.
Nach einer Weile ergreift Erich von Falkenhayn das Wort und bestätigt, sich dabei an die anderen wendend, den Grundgedanken des Kaisers: „Die Einschätzungen Ihrer Majestät zur russischen Mobilmachung werden im Übrigen auch vom Generalstab geteilt. Wir sind überzeugt, dass diese im Moment noch sehr lange dauern würde.“ Niemand antwortet. In typisch militärischer Rhetorik und Gestik verdeutlicht der Kriegsminister den Anwesenden die militärische Lage der beiden großen europäischen Bündnisse und geht dabei insbesondere auf die Lage des Deutschen Reiches ein. Immer wieder auf Bethmann Hollweg blickend, der Falkenhayn in seinen Ausführungen mit zustimmenden Wortmeldungen unterstützt, unterstreicht der Kriegsminister die Warnungen vor einer Übermacht der feindlichen Armeen, die in gemeinsamem Vorgehen einen Vorteil gegenüber der deutschen auf ihrer Seite hätten. Einzig die Schwäche der russischen Mobilmachung halte die Gegner noch davon ab, über Deutschland herzufallen, „aber sie werden laufend besser, denn die französischen Gelder und Militärstrategen zeigen bereits Wirkung. Wir stehen daher auf dem Standpunkt, dass, wenn man losschlägt, um die Einkreisung zu durchbrechen, es jetzt besser ist als später. Ich darf ergänzen, dass auch der österreichische Generalstab, namentlich Conrad von Hötzendorf, diesen Standpunkt vertritt.“ Falkenhayn tritt mit dieser Aussage unter den Besprechungsteilnehmern eine Diskussion los, in der alle für den Kriegsfall ins Auge zu fassenden Maßnahmen und Gegenmaßnahmen detailliert erörtert werden.
Als Einziger beteiligt sich der Reichskanzler nicht an den Wortmeldungen, er stellt aber mit einiger Genugtuung fest, dass die Anwesenden in der aktuellen Lage durchaus die Gelegenheit für eine Loslösung aus der für Deutschland so beängstigenden Umklammerung sehen. Bethmann Hollweg ergreift in einer Gesprächspause das Wort: „Euer Majestät, meine Herren, um diese Diskussion abzukürzen, schließe ich mich der vorhin geäußerten Meinung Eurer Majestät an, dass, im Hinblick auf deren Verhalten in den vergangenen Balkankonflikten der Jahre 1912 und 1913, die Österreicher einen bewaffneten Konflikt wieder scheuen werden und es ohnehin zu keinem Krieg kommen wird.“ „Da könnten Sie recht haben, Exzellenz.“ Aus Wilhelms Tonfall ist resignierende Enttäuschung herauszuhören.
Nach einer Weile des Nachdenkens fährt er fort: „Aus den mir heute zur Kenntnisnahme gebrachten Dokumenten geht überdies hervor, dass sie höchstes Augenmerk darauf legen wollen, dass Bulgarien dem Dreibund beitritt. Bevor es so weit ist, würde man nichts unternehmen wollen. Meine Unterstützungszusagen sind daher nicht wirklich als riskant anzusehen.“ Dem Kaiser wird nach dieser Analyse allgemeine Zustimmung zuteil. „Meine Herren“, Wilhelm steht auf und gibt damit das Ende der Unterredung bekannt, „hiermit sind alle Punkte besprochen und ich überlasse Ihnen ab nun Berlin.“ Mit einem Augenzwinkern verabschiedet er sich von seinen Gästen und verlässt das Konferenzzimmer.
Unmittelbar danach wird der Kaiser abgeholt und im Automobil zum Bahnhof gebracht, wo bereits sein Sonderzug nach Kiel bereitsteht. Wie jedes Jahr steht auch diesen Sommer wieder der alljährliche Kreuzfahrturlaub auf dem Programm. Bethmann Hollweg ist mit dem Ergebnis der Sitzung ausgesprochen zufrieden. Er hat nicht nur im Kriegsminister einen profunden Mitstreiter gefunden, sondern dieser hat ganz in seiner Argumentationslinie bereits seine bevorstehende außenpolitische Ausrichtung vorgegeben: In Wien ist Druck zu machen, damit die Österreicher schnell und kräftig in Serbien Klarheit schaffen, und gegenüber den Mächten ist mit Bestimmtheit der Standpunkt zu vertreten, dass die Angelegenheit nur Österreich-Ungarn und Serbien betreffe. Da mit einer Einmischung von Russland unbedingt zu rechnen sei, wäre es ein Leichtes, das Odium des Verschuldens einer europäischen Auseinandersetzung diesem umzuhängen. Damit wären die Weichen für eine Lösung der Umklammerung gestellt.
Bethmann Hollweg sitzt noch in seinem Stuhl, als die anderen bereits den Raum verlassen haben. Sein Kopf ruht während dieser Gedanken auf seinen Händen, die er beidseitig auf den Armlehnen des riesigen Lehnstuhls abgestützt hat. Langsam greift er nach seinem Glas, trinkt den letzten Schluck und steht auf. Bedeutend leichteren Schrittes geht er zur Tür und folgt den anderen, die sicherlich schon auf ihn warten. Selbst wenn die Österreicher aktiv reagieren sollten – und wann haben sie das schon jemals getan? –, erscheint das Risiko eines großen Krieges nur minimal.