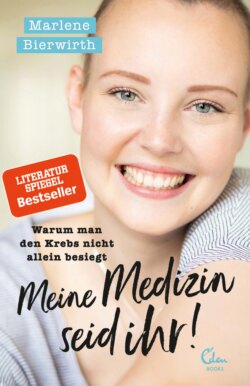Читать книгу Meine Medizin seid ihr - Marlene Bierwirth - Страница 4
Mehr will ich doch gar nicht
Оглавление»Ich will einfach nur mein Abitur machen.«
Das ist das Erste, was ich mich sagen höre. Und auf einmal bin ich ganz weit weg, nicht mehr in diesem Raum mit der typischen Untersuchungsliege. Weit weg von dieser bizarren Situation.
Nie im Leben hätte ich mir vorstellen können, dass mir so etwas passiert. Daran denkt man doch nicht mit 18 Jahren: Und was ist, wenn ich eines Tages …? Na, ich plane mal lieber nicht so weit im Voraus … Und doch scheine ich jetzt mittendrin zu sein. Ich möchte weglaufen, alles hinter mir lassen, so, als hätte es diesen Tag heute nicht gegeben. Ich suche den Resetknopf und lasse den Tag innerlich neu starten. Zu Hause an meinem Schreibtisch: Ich versuche zu lernen, schlage mich mit der Proteinbiosynthese herum und frage mich, ob ich in Bio wohl über die fünf Punkte komme … Typischer Abi-Lernstress eben, so wie für alle anderen aus meinem Jahrgang.
Wieso konnte mein Tag nicht einfach ganz normal weiterlaufen? Wieso höre ich schlecht und wieso sehe ich nicht richtig? Bilde ich mir das alles durch den Lernstress vielleicht doch nur ein?
Tausend Gedanken und Fragen wirbeln in meinem Kopf durcheinander. Unmöglich, mich zu konzentrieren. Mein Magen fährt wie wild Achterbahn. Ich spüre, wie die beiden Männer in ihren weißen Kitteln mich mitleidig anschauen, wie mein Papa mich in den Arm nimmt und mir Sätze wie »Wir stehen das gemeinsam durch« und »Wir sind immer für dich da« ins Ohr flüstert und dabei selbst den Tränen nahe ist. Ich kann nur noch weinen.
Anschließend starre ich wie in Trance ins Nichts und fühle mich auf einmal auf der einen Seite völlig leer und auf der anderen komplett überfordert mit den ganzen Informationen. Aber dennoch weiß ich tief in mir drin eines ganz genau: Ich will das nicht. Ich will kein Mitleid, nicht diese ganze Aufmerksamkeit, ich will meinen Papa diese Worte nicht sagen hören. Ich würde mich am liebsten in Luft auflösen und komme mir plötzlich ganz klein und hilflos vor.
Der Arzt, der neu dazugekommen ist, kommt mir am schlausten vor, er scheint den Überblick über meine Situation zu haben. Er ist Neurochirurg. Er fängt an zu sprechen. Ich kann nicht wirklich folgen, bemühe mich aber auch nicht. Meine Gedanken fliegen mir im Kopf herum und dabei bleiben sie an den Wörtern »Operation« und »Tumor« hängen. Dabei zeigt der Arzt uns auf dem Computerbildschirm die Aufnahmen von dem MRT, das ich eine Stunde zuvor über mich ergehen lassen musste. Ich sehe nichts durch meine tränennassen Augen, bin aber sowieso nicht mehr aufnahmefähig. Mein Papa versucht, dem Arzt zu folgen, doch ich merke, dass auch er mit seinen Gedanken ganz woanders ist.
Der Neurologe, der mich als Erstes untersucht hat, sitzt mittlerweile hinter uns und sagt keinen Ton mehr. Erst denke ich, er hat ein schlechtes Gewissen – aber so fühlt sich wohl Mitleid an. Er hatte sich alle Mühe gegeben, meine Prüfungstermine in der nächsten Woche zu notieren, um mich die Arbeiten vielleicht noch schreiben zu lassen. Doch es war wohl von vornherein klar: Sollte irgendetwas auf den Aufnahmen zu erkennen sein, das da nicht hingehört, würde ich mein Abitur erst einmal vergessen können. Der Zeitpunkt für schlechte Neuigkeiten könnte ungünstiger nicht sein. Oder ist das hier vielleicht eine »Versteckte Kamera«-Situation? Und gleich kommt jemand um die Ecke und sagt mir, dass das alles nur erfunden ist …? Aber leider macht niemand Witze über so ein ernstes Thema. Das weiß ich natürlich selbst.
Nach dem Gespräch steht fest: Marlene bleibt im Krankenhaus. Wie lange und was genau als Nächstes geschieht, erfahren wir noch nicht. Eine Schwester nimmt die Anweisungen der Ärzte, dass ich ein Bett und ein Zimmer bekommen soll, entgegen, und ich verliere gleichzeitig die Kontrolle über mein Leben. Würde es nach mir gehen, würde ich gern erst mal nach Hause fahren, um wenigstens meine Sachen zum Übernachten zu packen. Dafür ist aber keine Zeit, und mich fragt auch gar keiner mehr. Meine Selbstbestimmung ist damit also komplett weg.
Mein Papa und ich sitzen wie bestellt und nicht abgeholt im Wartebereich der Ambulanz herum, bis mein Bett fertig ist. Unsere momentane Situation ist schrecklich und komisch zugleich: Wir sitzen hier mit solchen Nachrichten im Gepäck und können rein gar nichts tun, außer zu warten. Ich klebe an meinem Papa, hänge in seinem Arm, und er versucht mich mit Tränen in den Augen aufzubauen, mir Mut zu machen, aber ich merke, wie fertig ihn diese Situation selbst macht.
»Wir schaffen das!« – Worte, die mich aufbauen sollen, jagen mir einen Schauer über den Rücken. Ich möchte das nicht hören, die Worte sind mir richtig körperlich unangenehm, mir stellen sich die Nackenhaare auf, mir wird ganz kalt, und ich zittere. Von der einen auf die andere Sekunde bin ich zu einem schwerkranken Mädchen geworden, das Unterstützung und Hilfe braucht.
Ich bin 18 Jahre alt, meine Hobbys sind: Reiten, Singen, sogar richtig im Chor, Schauspielern, Fotos machen und mit meinen Freunden ins Kino gehen, ich höre gern Deutsch-Pop und House-Musik und schwärme für Tage ohne Verpflichtungen. Ich bin 18 Jahre alt, das Leben geht los, ich werde erwachsen. Ich bin 18 Jahre alt – und plötzlich bleibt meine Zeit einfach stehen und mit ihr das gerade erst entdeckte starke Gefühl der Eigenständigkeit und die so große Lust darauf.
Um uns herum sind ein paar Plätze besetzt, ich sehe Mädchen in meinem Alter und überlege kurz, wie peinlich es sein könnte, vor ihnen zu weinen. Doch dann entscheide ich für mich: Ich darf weinen. Ich würde am liebsten laut schreien, allen Leuten, die gucken, mitten ins Gesicht, doch ich lasse meinen Gefühlen lieber versteckt im Arm meines Papas freien Lauf. Ein Mädchen direkt neben uns hält mir ein Taschentuch hin, und ich nehme es dankbar an. Ich bin froh, dass sie nichts weiter sagt und nur zaghaft lächelt. Dann lässt mich Papa kurz allein, um Mama anzurufen und ihr die schlechten Nachrichten zu überbringen. Oh, meine arme Mama! Das hier muss das Horrorszenario für jede Mutter sein. Meine Mama hat ihre eigene Mutter an Krebs verloren und darum bei uns, ihren Kindern, immer darauf geachtet, dass wir gesund leben. Und jetzt hat das eigene Kind einen Tumor, um genau zu sein: ein Medulloblastom. Ein bösartiger embryonaler Tumor des Kleinhirns.
Eine Weile später bekomme ich ein Zimmer auf der Neurologiestation. Ich teile es mir mit einer älteren Dame. Ich war noch nie im Krankenhaus und bin deshalb sogar etwas neugierig auf das, was mich erwartet. Auf meinem Zimmer angekommen, schließt mich die Schwester zur Überwachung gleich an einen Monitor an. Über drei selbstklebende Einweg-Elektroden, an denen Kabel stecken, wird die elektrische Aktivität meines Herzens gemessen, auch EKG genannt, und alle 15 Minuten bläst sich die Blutdruckmanschette auf, was alles andere als angenehm ist. Ich bekomme meinen ersten Zugang über den Handrücken gelegt. Au, das tut weh! Jetzt hängen gefühlt tausend Kabel an mir, und mir ist gar nicht gut.
Kurze Zeit nachdem Papa und ich es uns zusammen mit meinem Kabelsalat »bequem« gemacht haben, ich in meinem Bett und er auf einem Stuhl daneben, kommen meine Mama und mein drei Jahre älterer Bruder Pinkus an. Meine jüngere Schwester Ira, sie ist 15 Jahre alt, ist mit meinen Pflegebrüdern Jan, elf Jahre, und Aaron, 18, zu Hause geblieben, denn es ist schon spät, und sie müssen trotz der ganzen Panik ja ins Bett. Meine Eltern sind ausgebildete Pädagogen und nehmen im Rahmen der Jugendhilfe Pflegekinder auf, sie sind eine sogenannte Erziehungsstelle. Das ist genau genommen ihr Job. Er ermöglicht meiner Mama die Arbeit von zu Hause aus und schenkt ihr zusätzliche Zeit mit den Pferden. Mein Papa ist außerdem noch bei einer sozialen Einrichtung angestellt. Als Aaron und ich sieben Jahre alt waren (er ist tatsächlich nur acht Tage jünger als ich), zog er bei uns ein, etwa fünf Jahre später kam dann noch Jan dazu. Aaron und Jan leben bei uns wie Familienmitglieder, sind aber eben nicht adoptiert. Die Jungs sind schon so eine lange Zeit fester Teil unseres Lebens, unsere Brüder eben, dass sie einfach dazugehören. Darum kann ich die oft gestellte Frage: »Fühlst du dich nicht vernachlässigt?«, ganz klar mit Nein beantworten. Klar, sie brauchen mehr Betreuung und Aufmerksamkeit, weil sie es nicht leicht hatten bei ihrem Start ins Leben, aber dadurch lieben meine Eltern mich ja nicht weniger. Jeder hat eben seinen ganz eigenen, individuellen Platz in unserer Familie.
Eigentlich darf man nur bis 18 Uhr Besuch bekommen, und über diese Uhrzeit sind wir schon lange hinaus. Weil es sich um eine Ausnahmesituation handelt. Das sieht das Krankenhauspersonal ein. Ich bin richtig ängstlich vor unserem Aufeinandertreffen. Ich hoffe, sie sind nicht allzu traurig und verzweifelt, denn ich weiß, wenn ich ehrlich bin, nicht, wie ich damit umgehen soll. Als Mama und Pinkus den Raum betreten, spüre ich ihre Unruhe, aber auch irgendwie ihre Erleichterung, mich lächelnd und einigermaßen wohlauf auf meinem Bett sitzen zu sehen. Ich habe mich mittlerweile etwas beruhigt und bin einfach nur noch froh, die beiden zu sehen und ein paar Klamotten zum Umziehen zu bekommen. Mama hat meine Sachen erst mal für ein paar Tage Krankenhaus gepackt. Sie gibt mir zur Begrüßung einen Kuss auf die Wange, und von meinem Bruder bekomme ich eine dicke Umarmung. Ich merke: Sie sind total unsicher. Sie versuchen für mich stark zu sein, sich zusammenzureißen und nicht angespannt und ängstlich rüberzukommen. Ich selbst fühle mich momentan eigentlich ganz gefasst. Ich kann einfach nicht mehr weinen, wobei mir bei ihrem Anblick doch wieder danach zumute ist. Die eigenen Eltern und den eigenen Bruder wegen einem selbst so traurig zu sehen, ist grauenvoll, ich fühle mich absurderweise schuldig. Doch die liebevolle Art und der vorsichtige, zärtliche Umgang von Mama, Papa und Pinkus tun mir gut und geben mir Kraft und das Gefühl, das hier durchhalten zu können. Zumindest erst mal die Nacht zu überstehen.
Als Mama, Papa und Pinkus sich irgendwann losreißen können und müssen, weil uns nun doch eine Schwester daran erinnert, dass Bettruhe ist, weiß ich erst nicht, was ich tun soll. Aber ich bin offenbar so sehr erschöpft von der ganzen Aufregung, dass ich bald einfach einschlafe. Meinen letzten Gedanken nehme ich mit in eine traumlose Nacht:
Wieso passiert mir so etwas?