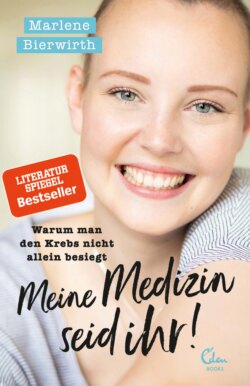Читать книгу Meine Medizin seid ihr - Marlene Bierwirth - Страница 6
Ihre Augen sind in Ordnung
ОглавлениеIch übergebe mich in die Toilette. Mir ist so übel, ich kann nichts mehr essen. Es ist mir peinlich, wieder an den Abendessenstisch zurückzukehren. Bei uns ist das so: Jeden Sonntagabend isst die ganze Familie zusammen, also wir alle sieben. Das ist unser Ritual, und da steht dann auch keiner früher vom Tisch auf, sondern wir beenden die Mahlzeit gemeinsam. Und dabei reden wir gaaanz viel. Das Beisammensitzen und gemeinsame Essen bildet für mich, und ich glaube, auch für die anderen, den guten Abschluss der Woche, ist ihr kleines Highlight, wo wir alle Zeit füreinander finden.
Wenn ich jetzt zurück an den Tisch komme, werden sie sich natürlich fragen, wieso ich so plötzlich und kommentarlos aufgestanden bin. Und ich muss dann erklären, warum, und das möchte ich eigentlich nicht. Ich will nicht so eine sein, die sich vor Aufregung in etwas hineinsteigert und sich deshalb sogar übergeben muss. Das habe ich ja nicht mal als Kind oder Teenie getan. Aber natürlich muss ich wieder zurück in die Küche. Ich setze mich hin und erkläre, dass ich nicht weiter essen kann, dass ich zu aufgeregt bin und gestresst. Wegen morgen. Morgen schreibe ich nämlich meine allererste Abiklausur, und ich bin verdammt nervös. Ist doch auch klar, oder? Aber ich muss etwas essen, mein Körper braucht Kraft, und mein Gehirn braucht Energie.
»Stell dir vor, es ist einfach eine ganz normale, etwas längere Klausur. Du brauchst dich doch jetzt noch nicht verrückt zu machen. Und wenn du wirklich durchfallen solltest, ist das doch auch nicht so schlimm«, versucht mich meine Mama zu beruhigen. Jetzt fängt mein Papa auch noch an, von seinen Abiklausuren zu erzählen und dass er es sich viel schlimmer vorgestellt hatte, als es dann im Endeffekt gewesen ist. Um mir die Angst zu nehmen, das verstehe ich schon. Doch das kommt nicht wirklich bei mir an. Ich nehme ihre Stimmen nur noch wahr, aber höre schon gar nicht mehr zu. Ich mache mir Sorgen über die morgige Prüfung und das Durchhaltevermögen meines Körpers ohne ausreichend Nahrung.
Nach dem Essen sage ich meiner Familie gute Nacht und gehe in mein Zimmer. Ira wünscht mir viel Glück für morgen und verschwindet ebenfalls in ihrem Zimmer, während meine Mama Jan und Aaron ins Bett bringt und mein Papa mit Pinkus zusammen den Tisch abdeckt und die Spülmaschine einräumt. Ich möchte den Abend ganz entspannt ausklingen lassen und noch mal in Ruhe alles für den nächsten Tag durchgehen. Gegen 22 Uhr gehe ich schlafen, ich lege mir ein paar meiner Lernzettel unters Kopfkissen, weil ich auf den Aberglauben hoffen will, dass ich so alles Gelernte über Nacht im Traum verinnerliche.
»Wenn ihr jetzt keine Fragen mehr habt, bitte ich euch, die Vorschläge, die ihr nicht ausgewählt habt, an den Rand eures Tisches zu legen«, leitet unser Lehrer die fünfstündige Klausurenstille ein. Ich schaue noch mal über alle drei Vorschläge und lege dann die zwei nicht ausgewählten Aufgabenbögen weg. Ich hoffe inständig, dass C die richtige Wahl für mich war. Die Aufgaben klingen machbar, und die, die die meisten Punkte bringen, kann ich auf jeden Fall beantworten. Wie ich durch Blicke wahrnehme, scheine ich nicht die Einzige zu sein, die den letzten Bogen gewählt hat. Die Zeit zum Schreiben startet, und ich beginne mit der ersten Aufgabe.
Als ein Drittel der Zeit um ist, habe ich einige der Aufgaben schon gelöst. Darum beschließe ich, eine kleine Pause einzulegen, um etwas zu essen und zu trinken. Ich habe mir extra Rohkost klein geschnitten, damit es mir nicht sofort wieder hochkommt. Außerdem habe ich den leeren Tisch neben mir mit Süßigkeiten, die ich von Lina und Tabea bekommen habe, vollgepackt. Die beiden sind so toll. Was würde ich nur ohne sie machen? Sie haben mir am Wochenende heimlich eine Tüte voll mit Knabbersachen und Süßigkeiten vor die Haustür gestellt und ein Plakat gebastelt, auf dem sie mir viel Glück wünschen. Die beiden sind seit der Oberstufe meine besten Freundinnen, aus gemeinsamen Kursen kennen wir uns aber bereits aus der Mittelstufe. Neben Tabea saß ich im Französischkurs, und Lina habe ich dann über sie kennengelernt. Als in der elften Klasse neue Klassen zusammengesetzt wurden, war klar: Wir wollen zusammen sein! Zum Glück wurde unser Wunsch von der Oberstufenleiterin akzeptiert. Seitdem sind wir unzertrennlich. In der zwölften Klasse aßen wir zum Beispiel jeden Donnerstag in der Mittagspause gemeinsam unseren Döner und quatschten über alles Mögliche. Lina hat dann leider die Schule gewechselt und Tabea ein FSJ angefangen, sie macht ihr Fachabi. Wir drei sind aber natürlich nach wie vor immer füreinander da. Und wenn etwas ist, das wir mal nicht mit unseren Familien oder boyfriends teilen wollen, erzählen wir es aber garantiert einander.
Ich versuche jetzt also, die Prüfung mit Rohkost und Süßem zu überstehen. Ich fange nach ein paar Bissen wieder an zu schreiben, damit ich nicht zu viel Zeit verliere. Nach weiteren 15 Minuten setzt der nervige Schluckauf ein, der mich seit mehreren Wochen um die acht Mal am Tag schikaniert. Ich weiß nicht, woher der kommt, und kann auch leider nichts dagegen tun. Alle Tipps und Tricks, um ihn zu beenden, habe ich bereits versucht und bin kläglich gescheitert: ein Glas Wasser trinken, die Luft für ein paar Sekunden anhalten und schlucken, sobald der Schluckauf kommt, oder mich erschrecken lassen. Sogar einen Handstand habe ich schon probiert. Ich muss einfach abwarten, bis es vorbei ist. So auch jetzt, in dieser äußerst unangenehmen Situation. Einige Mitschüler fangen schon an, mir genervte, andere, mir belustigte Blicke zuzuwerfen, denn bei der aktuellen Stille hört man mein unterdrücktes Hicksen ganz schön laut.
»Es tut mir leid, ich kann leider nichts dagegen machen!«, entschuldige ich mich grinsend. Eigentlich ist es auch ein bisschen lustig, dass ich so oft Schluckauf habe, finde ich. Vielleicht denkt jemand ständig an mich. Daniel? Jemand anderes fällt mir auf Anhieb gar nicht ein. Ich schaue etwas belustigt im Klassenraum umher und stelle mir vor, während ich darauf warte, dass der Schluckauf endlich vorbei ist und ich mich wieder konzentrieren kann, wer der Jungs unsterblich in mich verliebt sein könnte … Fünf Minuten später stehe ich auf und verlasse den Raum, um auf die Toilette zu gehen. Schon das Aufstehen an sich fällt mir schwer, und mir wird schwarz vor Augen. Ich merke, wie mich das stundenlange Konzentrieren auslaugt und wie viel Energie es benötigt, die ich heute nicht bieten kann. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie ich es zur Tür geschafft habe, geschweige denn, bis auf die Mädchentoilette. Ich weiß nur noch, dass ich versucht habe, relativ gerade zu laufen und nicht umzukippen, während ich an unserem Lehrer vorbeiging, der sich meine Uhrzeit aufschrieb. Nach dem Toilettengang taumle ich wieder auf meinen Platz in unserem Prüfungsraum zurück und bearbeite meine Klausuraufgaben weiter.
Eine Stunde später, ich bin fast am Ende der Aufgaben angelangt, setzt der Schluckauf wieder ein. Diesmal wissen alle sofort, dass ich es bin. Viele verkneifen sich ein Grinsen, so wie ich mir selbst auch. Wohl weil wir es bald hinter uns haben und schon eine Art von Gelassenheit über uns alle kommt. Jetzt ziehe ich die letzten zwanzig Minuten noch mal durch – dann bin ich endlich fertig. Ich versuche, so schnell zu schreiben, wie ich kann, um alle meine Gedanken noch auf das Papier zu bekommen. Meine Hand verkrampft langsam schon, aber ich kann einfach keine Pause machen. Es zählt jede Sekunde. Dann endlich ist es vorbei, ich habe Wörter gezählt und gebe meine fertige Klausur meinem Lehrer in die Hand, der am Pult sitzt und auf die letzten Arbeiten wartet. Ich packe mein Zeug zusammen, stopfe alles in meinen Rucksack und gehe in Richtung Ausgang. Dabei merke ich wieder, wie schwach ich bin, ich taumle zur Tür. Draußen wartet zum Glück Lara, eine Freundin, die ich schon seit der Grundschule kenne, auf mich. Sie läuft mit mir in Richtung Toiletten und passt auf, dass ich nicht jeden Moment zusammenklappe.
»Geht’s wieder?«, fragt sie mich, während ich mich am Waschbecken abstütze und in den Spiegel schaue.
»Alles gut, ich bin einfach nur kaputt von der Klausur«, antworte ich, laufe los und übergebe mich fast in eine der Kabinen. Nachdem ich mir etwas kaltes Wasser ins Gesicht geklatscht und Lara hundertmal versichert habe, dass es mir wieder besser geht, gehen wir gemeinsam zum Parkplatz. Lara und ich umarmen uns zum Abschied, und jede steigt in ihr Auto. Ich habe Hunger und merke, wie mein Körper nach Essen verlangt. Aber ich muss noch warten und runterkommen, bevor ich losfahre, damit ich mich richtig konzentrieren kann beim Fahren. Ich spiele also noch etwas mit meinem Handy, schreibe Daniel und schalte mein Gehirn quasi auf Standby. Ich bin froh, nicht mehr denken zu müssen. Nach der Klausur ist mein Kopf Matsch. Nach zwanzig Minuten beschließe ich, nach Hause zu fahren und den Rest des Tages entspannt zu verbringen.
Und täglich grüßt das Murmeltier: Ein neuer Tag, ich verlasse mal wieder das Klassenzimmer, gehe über den Schulhof zum Parkplatz und steige in mein Auto. Es war eben schon wieder so laut im Klassenraum, dass ich nicht mehr wusste, wer spricht und woher welche Stimme kommt. Mein Ohrgeräusch ist mittlerweile so laut und störend geworden, dass ich den Überblick verliere, wenn mehrere Menschen in einem Raum sprechen, und es sehr anstrengend für mich ist, einer Person konzentriert zuzuhören. Die Stimmen dringen für mich immer aus allen Ecken und dröhnen in mein gesundes Ohr.
Ich schnalle mich an und drehe die Zündung herum, mein Auto springt an, und ich verlasse den Schulparkplatz. Während ich fahre, überlege ich, was wohl gleich beim Hals-Nasen-Ohren-Arzt herauskommen wird. Ich hoffe, wir finden eine Lösung für mein schlechtes Gehör. Ich parke vor der Praxis und steige die Treppen in den ersten Stock hinauf. Ich warte an der Anmeldung, bis die rothaarige Frau hinter dem Empfangstresen zu mir hochguckt und mir zunickt. Das ist mein Zeichen:
»Hallo, mein Name ist Bierwirth, ich habe einen Termin«, sage ich.
»Die Versichertenkarte bitte«, antwortet sie und streckt ihre Hand in meine Richtung. Ich reiche ihr die Karte mit diesem schrecklichen Passbild drauf, das auch meinen Perso noch immer verunstaltet. Ich: etwa zwölf Jahre alt, Pferdeschwanz und Pony. Ich sehe aus wie ein Junge. Jeder, der dieses Foto sieht, muss entweder lachen oder glaubt mir nicht, dass ich das bin. Ich habe schon die besten Sprüche dazu gehört. Ein Türsteher wollte mir nicht glauben, dass das wirklich nicht mein Cousin ist, die Polizei am Flughafen machte sich bei der Passkontrolle über mich lustig, und mein Fahrlehrer drohte, meinen Perso zu zerstören, wenn ich durch die Prüfung fallen würde. Zum Glück aber läuft der Perso im April aus. Dann gibt es einen neuen – mit neuem Bild! Endlich werde ich dann einen Perso mit halbwegs schönem und vor allem aktuellem Bild haben.
Die Rothaarige legt meine Krankenkassenkarte vor mich auf den Tresen und winkt mich mit in den Wartebereich. Es ist ein offener Raum, und ich bin die Einzige. Ehe ich mich richtig hinsetzen kann, werde ich schon von einer Arzthelferin aufgerufen. Sie bedeutet mir, ihr zu folgen. Wir betreten einen Raum mit einem Schreibtisch plus Computer und Stühlen davor. Und es steht da noch ein Untersuchungsstuhl.
»Sie können hier warten, der Arzt kommt gleich«, sagt mir die Frau.
Ich setze mich auf einen der Stühle und überlege, was ich dem Arzt gleich erzählen werde. Ich bin gespannt auf seine Antwort. Ich muss bestimmt einen Hörtest machen, ich habe so etwas noch nie gemacht. Ich bin nicht lange allein, dann kommt ein mittelgroßer, freundlich wirkender Mann in den Raum. Er trägt einen weißen Kittel und streckt mir die Hand entgegen. Er stellt sich mir vor und fragt nach meinem Anliegen.
»Ich habe seit etwa einem Monat ein relativ lautes Pochen auf dem rechten Ohr und höre damit auch schlechter als mit dem linken.«
»Okay, dann setzen Sie sich mal bitte dort rüber, ich schaue mir das genauer an«, er deutet auf den Untersuchungsstuhl. Ich stehe auf und setze mich darauf, er sich daneben auf so einen kleinen coolen Drehstuhl, auf dem Ärzte irgendwie immer sitzen. Er nimmt sein Werkzeug in die Hand und schaut tief in mein Ohr. Es kitzelt und ist irgendwie ein komisches Gefühl. Ich warte gespannt auf eine Reaktion von ihm und versuche, ihn zu deuten.
»Es ist alles in Ordnung, ich kann nichts Auffälliges entdecken. Wir sollten aber noch einen Hörtest machen, um sicherzugehen.«
Nach dem Test muss ich dreißig quälende Minuten warten, bis ich wieder ins Arztzimmer gerufen werde.
»Sie haben wohl einen Hörsturz, Frau Bierwirth.« Der Arzt schaut mich mit einem kritischen Blick an.
»Oh«, antworte ich nur erstaunt. Ich weiß nicht wirklich, was ich dazu sagen soll, und kann auch nicht einschätzen, wie schlecht diese Diagnose jetzt für mich ist. Er erklärt mir, dass ein Hörsturz mit 18 Jahren sehr ungewöhnlich sei und ich mich ab jetzt schonen müsse. Er gibt mir ein Rezept für Tabletten mit, die mir außerdem helfen sollen. Ich verlasse die Praxis und laufe zur nächsten Apotheke, die zum Glück nur ein paar Meter entfernt ist. Auf dem Weg dorthin sende ich Daniel eine Sprachnotiz, in der ich ihn über die Diagnose aufkläre.
Zu Hause angekommen, gehe ich erst einmal zu meinen Eltern in die Küche. Sie ist bei uns der Ort, an dem wir abgesprochen unabgesprochen immer dann zusammenkommen, wenn es etwas zu besprechen gibt oder wir uns einfach über unseren Tag austauschen wollen. Unsere Küche mit der aufmunternd knallroten Wand und der motivierend knatternden Kaffeemaschine in der Ecke vor dem Fenster ist sozusagen unser Familientreffpunkt und, ich würde sagen, der von uns allen am meisten genutzte Raum im ganzen Haus.
Ich erzähle meinen Eltern sofort von den Neuigkeiten. Sie sind etwas schockiert über die Tatsache, dass ich in so jungen Jahren einen Hörsturz haben soll, und geben mir besorgt den Auftrag, es in den nächsten Tagen wirklich ruhig angehen zu lassen, auch mal zu Hause zu bleiben.
»Nach morgen und nächster Woche Mittwoch, versprochen!«, antworte ich einigermaßen gut gelaunt, denn ich bin überhaupt froh, dass etwas festgestellt worden ist. Morgen habe ich noch den Termin beim Augenarzt und am Mittwoch die letzte schriftliche Abiprüfung. Ich gehe in die Garderobe im Flur und hänge meine Jacke auf. Dann kehre ich in die Küche zurück. Ich mag die rote Wand, die haben meine Eltern selbst gestrichen. Ich setze mich an den kleinen Tisch, an dem nur drei Personen zum Essen Platz finden. Wenn die ganze Familie sonntags zusammen isst, passen wir natürlich nicht an diesen Tisch, wir essen dann im Wohnzimmer. Dort steht ein großer Tisch, an dem alle, also fünf Kinder und Mama und Papa, sitzen können. Während ich an Essen und den Tisch im Wohnzimmer denke, kommt mir Weihnachten in den Sinn. Der Tisch ist dann immer wunderschön geschmückt, und es gibt ein köstliches Festmahl und, und, und … Ich freue mich jetzt schon wieder auf Weihnachten, obwohl wir doch gerade erst März haben, und die Feiertage quasi just hinter uns liegen.
Meine Mama stellt mir einen Teller Kartoffelauflauf vor die Nase, der Dampf dringt in meine Nase und erinnert mich daran, dass ich noch nicht viel gegessen habe heute. Ich bekomme trotzdem mal wieder nicht viel hinunter, was mich selbst maßlos ärgert. Kann nicht einfach mal wieder alles normal sein? Essen ohne Übelkeit oder Appetitlosigkeit? Ich kann die Blicke meiner Mama förmlich auf mir spüren. Eine Mischung aus Sorge und Strenge in Bezug auf mein Essverhalten. Ich beginne mich selbst unter Druck zu setzen und möchte den Teller wirklich leer essen. Ich bin schon mit der Hälfte der Portion fertig, da spüre ich ein komisches Gefühl in der Magengegend.
»Ich gehe mal eben auf die Toilette«, verabschiede ich mich flugs und verlasse den Raum. Ich schließe die Tür hinter mir ab, setze mich auf den geschlossenen Klodeckel und hoffe, dass das Gefühl gleich von allein wieder verschwindet. Doch es wird nicht besser, letztendlich muss ich mich übergeben. Ich wische mir die Tränen aus dem Gesicht, die mir jedes Mal vor Panik und Ekel hochsteigen. Ich schaue in den Spiegel, richte meine Haare, wasche mir den Mund aus und verlasse so normal wie möglich das Bad. Ich hoffe, davon hat keiner etwas mitbekommen. In der Küche schmeiße ich den Rest des Essens auf meinem Teller weg und erkläre meinen Eltern, dass ich keinen Hunger mehr habe. Ich merke, dass meine Eltern verunsichert sind, ich kann förmlich die Fragezeichen in ihren Augen sehen. Doch sie sagen nichts, und darüber bin ich nur froh. Nach ein paar belanglosen Gesprächen verabschiede ich mich für die Nacht und gehe auf mein Zimmer.
Mein Zimmer ist total cool, es gehört zwar zum Wohnhaus, doch man erreicht es über einen eigenen Zugang. Ich muss also aus dem Haus, in unseren Hof, diesen überqueren und eine kleine, steile Treppe hoch zu meinem Zimmer gehen. Davor ist noch eine süße »Veranda«, wie ich sie nenne, und dann beginnt auch schon mein kleines Reich. Mit Daniel zusammen habe ich vor etwas mehr als einem Jahr die Wände und die Decke neu gestrichen. Anstatt Fasching zu feiern, haben wir die freien Tage damals genutzt, um mein Zimmer ein bisschen schöner, schlichter und erwachsener zu gestalten. Ich mag es jetzt so sehr und fühle mich richtig wohl darin.
Es ist wirklich toll, so zu leben, irgendwie unabhängig und so erwachsen. Nur wenn ich auf die Toilette muss, muss ich leider immer einmal raus und die Treppe runtergehen, denn die befindet sich sozusagen im Raum unter mir. Viele meiner Freunde sagen, das sei der Horror, wenn sie nachts mal auf Toilette müssten, aber ich finde, man gewöhnt sich daran.
Ich ziehe mir eine Jogginghose an, setze mich auf mein Bett und fahre meinen Laptop hoch. Ich öffne die Internetseite unserer Schule und logge mich mit meinen Daten im Schulserver ein. Unsere Schule hat diese Plattform, auf der Schüler und Lehrer miteinander kommunizieren können, ganz praktisch für Arbeitsaufträge und Daten. Dort suche ich meinen Sportlehrer. Ich will ihm eine Nachricht schreiben. Während ich ihm mitteile, dass ich mich aufgrund des Hörsturzes die nächsten zwei Wochen schonen muss, macht sich in mir ein Gefühl von Erleichterung breit. Ich habe mich wegen meiner sportlichen Leistungen im Abi in letzter Zeit sehr unter Druck gesetzt und meinem Sportlehrer vor einer Woche noch mitgeteilt, dass ich mich doch statt in Turnen lieber in Volleyball prüfen lassen wolle. Er war nicht sehr begeistert und hatte mir aufgetragen, in Ruhe meine Entscheidung zu überdenken. Da ich wirklich nicht gut in Volleyball bin, aber relativ gut in Turnen, kann ich die Reaktion meines Lehrers zu hundert Prozent verstehen. Die Beweggründe für den Tausch hatte ich sicherheitshalber für mich behalten. Wahrscheinlich war es mir mal wieder unangenehm, die Wahrheit zu sagen und möglicherweise wegen Übertreibung blöd dazustehen.
»Aber wieso willst du denn nicht mehr turnen?«, war seine Frage. Die Antwort darauf ist wieder schwammig und undeutlich. Ich versuche es mit einem Beispiel: Mit etwa elf Jahren konnte ich problemlos auf einer Metallstange balancieren, ohne runterzufallen. Heute, ein paar Jahre später, soll ich im Sportunterricht beim Turnen auf einem Schwebebalken, der wesentlich breiter als diese Stange von damals ist, balancieren und kann einfach mein Gleichgewicht nicht halten. Ja, das klingt nach einem kleinen Problem, das man mit Übung und ein paar Tipps und Tricks gut lösen kann, doch es hilft einfach alles nichts. Und bevor ich in der praktischen Abiprüfung hundertmal vom Balken falle, lasse ich es lieber gleich sein. Das ist wohl einfach nicht mehr mein Ding, denke ich, und will darum versuchen, meine Note mit Volleyball irgendwie zu retten. Das habe ich meinem Sportlehrer so natürlich nicht gesagt, wie gesagt, ich habe ihm eigentlich überhaupt keinen greifbaren Grund genannt.
Einen Tag später, es ist Freitag, der 24. März 2017, um genau zu sein: Ich setze den Blinker rechts und fahre von der Autobahn ab. Zum Glück kenne ich mich durch meine Zeit in der Fahrschule ein bisschen in der Gegend aus. Ich weiß also ungefähr, wohin ich muss. Ich fahre etwa einen Kilometer auf der Landstraße, dann erreiche ich den Ort. Dort fahre ich auf den nächsten Supermarktparkplatz, stelle mich an die Seite, damit ich niemandem im Weg stehe, und schaue kurz auf Google Maps nach der Praxis. Ich versuche mir den Weg einzuprägen und starte den Motor. Nach etwa fünf Minuten halte ich vor einem weißen neuen Gebäude an der Hauptstraße. Das muss die Augenarztpraxis sein, die mir empfohlen wurde. Ein neben der Eingangstür angebrachtes Schild bestätigt meine Vermutung. Ich klingele, drücke die Tür auf und nehme die wenigen Stufen zum Eingang der Praxis.
Ich hatte meine Klassenkameraden gebeten, mich bei unserem Lehrer zu entschuldigen und zu sagen, dass ich wegen des Arztbesuches später in den Unterricht kommen würde. Und jetzt stehe ich hier, pünktlich um acht Uhr morgens, zu meinem Termin, anstatt im Unterricht zu sitzen. Ich denke darüber nach, wie mein Lehrer wohl reagiert, wenn meine Mitschüler ihm sagen, dass ich mich verspäte und warum. Haben Lehrer Mitleid und machen sich Sorgen um Schüler? Oder sind sie per se genervt, wenn man zu spät kommt?
Ich bin der einzige Mensch in der Praxis. Na, da bin ich wohl ziemlich pünktlich. Mich begrüßt eine nette junge Frau hinter dem Anmeldetresen mit einem Lächeln.
»Ich habe einen Termin um halb neun, mein Name ist Bierwirth.« Ich halte ihr meine Versichertenkarte vor die Nase. Sie scannt sie, gibt sie mir zurück und schickt mich ins Wartezimmer. Dort sitze ich und fühle mich irgendwie sehr erwachsen, ich bin ganz allein hergefahren und bringe diesen Termin jetzt hinter mich. Nach etwa zehn Minuten werde ich aufgerufen und in das Arztzimmer geleitet. Dort begrüßt mich der Arzt, er hat einen Akzent, ich glaube, er ist Grieche. Erinnerungen an den Griechenlandurlaub vor zwei Jahren werden wach. Ich sitze auf dem Untersuchungsstuhl, in dem Raum ist es sehr dunkel, und gegenüber an der Wand sind mehrere Plakate mit Zahlen und Buchstaben darauf angebracht. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder einen Sehtest machen, und dann bekomme ich später das Rezept für die Brillengläser in die Hand gedrückt.
»Was führt Sie zu mir?«, fragt er mich.
»Ich sehe nicht gut und glaube, dass ich eine Brille brauche«, antworte ich recht abgeklärt und emotionslos.
Der Arzt kommt auf seinem Drehhocker (ich finde die Dinger wirklich so cool!) zu mir gerollt, lässt mich durch eine Art Glasscheibe schauen und leuchtet mir in die Augen. Sekunden, die mir wie Stunden vorkommen, vergehen, und die Stille im Raum ist fast schon unerträglich. Was guckt er denn so lange in meine Augen, sollte ich nicht erst mal einen Sehtest machen?
»Sind Sie allein hier?«, fragt er mich und schaut mich mit durchdringendem Blick an. Ich bin ein bisschen verwirrt und antworte: »Ja, ich bin mit dem Auto gekommen.«
Er geht zur Tür und ruft nach der Dame am Empfang. Was hat er denn jetzt vor?
»Sie sind ein Notfall, ich überweise Sie in die Klinik. Ihre Augen sind gut, aber die Nerven dahinter sind angeschwollen. Sie fahren jetzt sofort mit dem Auto nach Hause, und danach lassen Sie sich bitte fahren. Sie bekommen eine Überweisung von mir und fahren direkt in die nächste Augenklinik!«
Jetzt bin ich vollkommen durcheinander und fühle mich schlagartig überfordert von der Situation. Ich muss doch eigentlich in die Schule, mindestens meinem Lehrer Bescheid sagen.
Als ich mit der Überweisung wieder im Auto sitze, greife ich nach meinem Handy und tippe auf den Kontakt meines Papas. Ich erzähle ihm stockend von der Diagnose und dass wir direkt in die nächste Augenklinik fahren müssen. Er versucht mich zu beruhigen und sagt, ich solle erst mal nach Hause kommen. Ich fahre los, und in meinem Kopf spielen sich verschiedene Szenarien ab: Wir fahren in die Klinik, ich mache ein paar Tests, und am Ende brauche ich wirklich einfach nur eine Brille, oder sie finden irgendetwas, das eine Brille nicht einfach beheben kann, und das Ganze wird womöglich eine größere und längere Sache, oder, oder, oder … Der Zeitpunkt hätte auf jeden Fall nicht ungünstiger sein können, denn ich habe keine Zeit. Ich versuche, nicht so viel an die Ungewissheit zu denken, was diese Diagnose für mich bedeutet, und mich ganz auf das Autofahren zu konzentrieren.
»›Notfall‹, steht auf dem Überweisungsschein«, lese ich meinem Papa vor. Wir sind auf dem Weg in die Klinik, und Papa und ich suchen Antworten auf unsere Fragen: warum, weshalb, wieso meine Nerven angeschwollen sind. Wir sind eben noch am Stall vorbeigefahren, um meine Mama auf den neuesten Stand zu bringen. Sie ist aus allen Wolken gefallen. Hoffen wir jetzt einfach mal, dass es nach genauerer Untersuchung Entwarnung geben wird.
In der Klinik angekommen, gehen wir zur Anmeldung, wo mindestens zwanzig Leute warten. Da bekommt man doch sofort gute Laune und freut sich auf die Stunden, die man mit Warten verbringen wird, ohne zu wissen, was mit einem als »Notfall« so los ist. Nach dreißig Minuten bin ich endlich angemeldet und warte, dass mich ein Arzt aufruft.
»Sorry, du musst dich links neben mich setzen, rechts verstehe ich dich nicht so gut«, bitte ich meinen Papa, als er mich fragt, ob ich Hunger habe. Irgendwann werde ich aufgerufen. Wir folgen der Stimme in einen sehr leeren weißen Raum, nur mit einem Gerät auf dem Tisch, das ich so noch nirgendwo gesehen habe. Und zwei Stühlen: einem auf der einen, einem auf der anderen Seite des Ungetüms. Es erinnert mich ein bisschen an einen sehr veralteten Computer der ersten Stunde. Später erfahre ich: Es handelt sich um ein OCT-Gerät, mit dem die Netzhaut der Augen mit Laserstrahlen abgetastet wird. Ich muss mein Kinn auf eine Kunststoffvorrichtung legen, und von der anderen Seite aus schaut mir eine Frau durch eine Art Mikroskop in die Augen:
»Jetzt bitte auf mein rechtes Ohr gucken und nicht mehr bewegen«, lautet ihre Anweisung.
Nachdem sie Fotos von meinen Augen gemacht hat, werde ich weitergeschickt. Es werden noch ein Sehtest und eine Gesichtsfeldkontrolle gemacht. Keiner sagt mir oder meinem Papa irgendetwas Genaues. Mann, Papa tut mir richtig leid! Der wartet eigentlich die ganze Zeit nur und kauft mir was zu essen und zu trinken. Ich versuche, etwas runterzukriegen, schaffe aber nur ein paar Bissen. Mir ist wieder ein bisschen schlecht, das ist wahrscheinlich der ungewissen Situation und der damit verbundenen Nervosität geschuldet.
Mittlerweile ist es schon vier Uhr nachmittags, mein Papa und ich haben schon so viele Stunden mit Warten verbracht, dass ich langsam genervt und ungeduldig werde. Irgendwann kommt eine junge Ärztin, die gebrochen Deutsch spricht, auf uns zu und erklärt uns, dass ich in die Notaufnahme der Uniklinik zu einem Neurologen müsse. Die Gründe stimmen mit denen des Augenarztes überein: Meine Sehnerven sind geschwollen, und das muss sich eben dringend ein Neurologe anschauen.
»Ich habe schon angerufen und Bescheid gesagt, dass Sie kommen«, gibt die Augenärztin uns noch mit auf den Weg. Zum Glück ist die Augenklinik auf demselben Gelände wie das Hauptgebäude der Uniklinik, in dem die Notaufnahme ist, sodass Papa und ich zu Fuß rübergehen können. Im anderen Gebäude angekommen, nehmen wir die Treppe runter zur Notaufnahme, ziehen eine Nummer und warten auf meine Anmeldung. Schon wieder warten. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn man lange auf etwas wartet, weiß man irgendwann nicht mehr, worauf man eigentlich wartet. Ich muss daran denken, wie viel Zeit ich hier heute verliere und dass ich unbedingt noch für meine beiden Prüfungen in der nächsten Woche lernen muss. Dieser Tag läuft nach Strich und Faden anders als geplant. Eigentlich bin ich mit dem Gedanken heute Morgen aufgestanden, nur das Rezept für eine Brille zu besorgen. Und jetzt sitze ich in der Notaufnahme der Uniklinik und warte auf einen Neurologen. Auf der anderen Seite bin ich irgendwie auch froh, dass mein Problem endlich so ernst genommen wird und wir die Lösung jetzt gemeinsam suchen.
»Frau Bierwirth?«, endlich werden wir aufgerufen. Mein Papa und ich folgen dem blonden Arzt, es ist der Neurologe, durch die großen Glastüren, auf denen in Großbuchstaben »Stopp« geschrieben steht. Er führt uns in das erste Zimmer auf der linken Seite. Es ist ein typisches Untersuchungszimmer, eine Liege und ein Schreibtisch mit Computer sind vorhanden. Wir setzen uns auf die Stühle vor dem Schreibtisch, und der Arzt fängt prompt an, mich auszufragen: wie und wann sich das Doppeltsehen bei mir äußern und seit wann ich darunter leiden würde.
»Dann setz dich mal bitte auf die Liege, ich überprüfe deine Reflexe und deine Kraft«, fordert er mich anschließend auf. Ich gehorche, und er beginnt, leicht mit dem Hammer auf mein Knie zu klopfen. Dann werden verschiedene neurologische Tests durchgeführt, wie zum Beispiel, dass ich mir mit dem Zeigefinger auf die Nase tippen oder beschreiben soll, wie mein Gefühl in den Füßen ist. Meine Kraft und mein Gefühl sind in beiden Körperhälften gleich und ganz normal. Nachdem ich auf dem Gang ein paar Meter gelaufen bin, holt der mich untersuchende Arzt einen Kollegen dazu. Der erste Arzt scheint eine zweite Meinung zu brauchen, ich kann mich nicht entscheiden, ob mich das beruhigt oder eher verunsichert. Jedenfalls erzähle ich auch diesem die ganze Geschichte noch mal von vorn: Wann mir zum ersten Mal das schlechte Hören und Sehen aufgefallen ist und wie es sich entwickelt hat. Dann fragt er mich plötzlich: »Ist Ihnen öfter übel, oder erbrechen Sie sich?« Das ist eine Frage, auf die ich nicht wirklich antworten möchte und auf die ich nicht gefasst war: Woher weiß er das? Deshalb spiele ich das Thema etwas herunter:
»Joa, manchmal. Übergeben habe ich mich etwa zwei- bis dreimal in letzter Zeit.« Ich will nicht zugeben, wie es wirklich ist: dass ich fast jeden Morgen mit einem Würgen aufwache und mich schon öfter direkt in meinen Mülleimer oder mein Waschbecken übergeben musste. Meine große Angst ist nämlich, die Diagnose »psychisches Problem« zu erhalten. Der Arzt sagt nichts weiter zu meiner Antwort, es scheint so, als wäre er in Gedanken. Als Nächstes soll ich noch einmal ganz normal den weißen Krankenhausgang entlanglaufen. Das klappt eigentlich wieder ganz gut, sodass ich mit mir zufrieden bin. Dann muss ich auf einer auf dem Boden vorgezeichneten Linie einen Fuß vor den anderen stellen, also balancieren. Ich setze den ersten Schritt auf die Linie, dann den zweiten – danach kann ich mich nicht mehr halten, rudere wild mit den Armen und kippe fast um. Ich kichere verlegen. Wow, so eine einfache Aufgabe schaffe ich nicht? Ich bin selbst verdutzt und probiere es gleich noch einmal. Diesmal bin ich fest entschlossen, es zu schaffen, ich muss mich einfach stärker konzentrieren, klar. Ich fixiere die Linie und laufe beherzt los. Ich schaffe es nicht, einen Fuß vor den anderen zu setzen, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Hinter der Stirn des Arztes rattert es offensichtlich:
»Wir müssen ein MRT machen, um Genaueres zu sagen. Wir fragen an, ob es heute noch gemacht werden kann, nehmen Sie bitte so lange draußen Platz, Sie werden dann aufgerufen. Wenn es heute nicht klappt, dann müssen Sie über Nacht bleiben, und wir machen es morgen. Können Sie das einrichten?«, fragt er mich und blickt mir dabei direkt in die Augen. Ich erzähle ihm von meinen zwei letzten Abiturklausuren und dass ich unbedingt noch lernen müsse. Er schaut nach unten auf seinen Notizblock, nickt und schreibt sich die Daten auf. Dann sollen Papa und ich wieder im Wartebereich Platz nehmen.
»Krass, ich muss ein MRT machen?!«, flüstere ich meinem Papa zu. Ich habe gemischte Gefühle und eine leichte Anspannung in mir. Es scheint ja wohl wirklich etwas Ernstes zu sein. Zumindest werden meine Beschwerden ganz ernst genommen. Aber ich weiß gerade nicht mehr so recht, ob ich das gut oder eher sehr beunruhigend finden soll.
»Wir warten jetzt mal ab, was das MRT sagt, und dann schauen wir weiter.« Papa nimmt meine Hand und drückt sie leicht. Ich habe das Gefühl, dass er auch etwas angespannt ist und mir einfach die Angst nehmen möchte. Aber das muss er gar nicht: Zu viele Gedanken über einen möglichen negativen Ausgang der Untersuchung mache ich mir nicht, das ist einfach viel zu weit weg von mir und völlig unvorstellbar.
Die Notaufnahme kommt mir gerade riesig vor. Dass um sechs Uhr abends so viele Leute hier sind, verwundert mich. Aber was weiß ich schon vom Krankenhausalltag?
Wir entscheiden uns dazu, rauf und raus vor die Klinik zu gehen, um per Anruf die Unwissenden zu Hause aufzuklären. Papa natürlich Mama. Ich weiß gar nicht, wen ich zuerst anrufen soll: Daniel, Lina oder Tabea? Dann schreibe ich erst mal in unsere Beste-Freundinnen-Gruppe und frage, ob wir zu dritt irgendwie telefonieren können. Anschließend rufe ich Daniel an, mit zitternden Händen, plötzlich wird mir kalt. Er ist gerade mit seiner Familie in einem Restaurant. Eigentlich sollte ich auch dabei sein, aber stattdessen sitze ich jetzt hier.
»Ich muss ein MRT machen, und dann können sie mehr sagen«, erkläre ich ihm mit etwas leiserer Stimme als normalerweise. Ich merke, dass sich, während ich es so offen ausspreche und mir der Situation bewusster werde, ein Gefühl von Unruhe und sogar Angst breitmacht. Ich reiße mich zusammen und unterdrücke die Tränen, um keine Panik zu verbreiten. Mein Papa soll davon auch nichts mitbekommen. Noch ist ja gar nichts geklärt. Es ist bestimmt alles gut. Nachdem Daniel mir verspricht, am nächsten Tag sofort zu kommen, sollte ich in der Klinik bleiben müssen, fühle ich mich besser und lege ein bisschen beruhigter auf. Mit Lina und Tabea finde ich gerade leider keine Möglichkeit, gemeinsam zu telefonieren, also entscheide ich, erst die eine anzurufen, dann die andere. Ich tippe auf den Kontakt von Tabea, da sie immer besser erreichbar ist. Es tutet nur zweimal, da hebt sie schon ab. Als sie erfährt, dass ich im Krankenhaus bin, ist sie ganz aufgeregt und voller Adrenalin. Ich erkläre ihr die Situation folgendermaßen:
»Ich muss ein MRT machen, und dann weiß ich, wie es weitergeht. Es kann gut sein, dass ich heute Nacht hierbleiben muss, wenn sie es heute nicht mehr schaffen, damit ich morgen dann gleich dran bin.«
Dann muss ich auch schon auflegen, mein Papa zeigt auf seine Armbanduhr und bedeutet mir, dass wir zurück sollten. Ich schaffe es nicht mehr, auch Lina anzurufen, aber ich weiß zum Glück, dass Tabea sie informieren wird. Es ist mittlerweile schon dunkel geworden, ich habe während der Telefonate die ganze Zeit in die Lichter des Haupteingangs gestarrt. Es ist Ende März und noch ziemlich frisch am Abend. Wir betreten die Eingangshalle und gehen wieder zur Notaufnahme hinunter. Wir setzen uns in den Wartebereich, und das Ausharren geht weiter. So langsam setzt bei mir die Müdigkeit ein, und ich gähne gerade ausgiebig, als der Neurologe vom Anfang in der Tür steht und uns noch mal in sein Untersuchungszimmer bittet.
»Du kannst jetzt noch das MRT machen«, teilt er mir mit. Ich bin froh über diese Entscheidung, denn dann ist das Thema endlich abgeschlossen, und ich muss nicht hier übernachten.
»Sie bekommen jetzt das Kontrastmittel gespritzt«, teilt mir wenig später eine freundliche Arzthelferin mit, während ich halb schlafend in der Röhre liege. Danke an dieser Stelle an meine unnormale Müdigkeit, die mich seit ein paar Monaten begleitet. Vermutlich Abistress.
»Mhm«, antworte ich nur und bin froh, dass ich davon nicht wirklich etwas spüre. Die MRT-Schwester verlässt den Raum und setzt sich auf ihren Platz am Schreibtisch hinter der Glasscheibe. Ich versuche, während der Aufnahmen nicht so viel über das mögliche Ergebnis nachzudenken, wobei das bei der Müdigkeit, die mich überfällt, keine große Herausforderung ist. Ich verschlafe den Rest der Untersuchung und fühle mich geradezu erholt, als ich danach auf meinen Papa zulaufe. Der Arme tut mir so leid, dass er heute den ganzen Tag an diesem unwirtlichen Ort auf mich warten muss, noch dazu sicherlich nicht ganz sorgenfrei. Jetzt heißt es wieder warten.
»Wir brauchen uns ja jetzt noch nicht verrückt zu machen, das wird schon alles gut«, sage diesmal ich aufmunternd zu meinem Papa, der gedankenversunken und sichtlich geschafft neben mir sitzt. Irgendwie denke ich gar nicht daran, dass die Ärzte etwas finden könnten. Warum auch?
Nach einer Stunde Ungewissheit werden wir von dem Neurologen aufgerufen. Wir gehen sehr zügig und konzentriert hinter ihm an mehreren Türen vorbei und wieder in das Arztzimmer. Am Schreibtisch sitzt ein uns unbekannter Arzt. Er ist Neurochirurg, wie wir erfahren. Warum das? Meine Verunsicherung steigt, während wir uns ihm gegenübersetzen.
»Guten Abend, ich werde Ihnen die Bilder erklären, die wir von Ihnen gemacht haben«, richtet der Arzt das Wort an uns. Auf dem Computerbildschirm erkenne ich nur, dass irgendwelche Bilder geöffnet sind. Na, das werden dann wohl meine sein. Ich kann darauf nicht viel erkennen, sie sind schwarz-weiß und erinnern mich an Ultraschallaufnahmen, die mir auch immer völlig schleierhaft sind. Hinter uns sitzt der Neurologe, er ist jetzt ganz still. Ich hatte mich vorhin in seiner Gegenwart irgendwie wohlgefühlt. Der neue Arzt verunsichert mich ein bisschen. Er beginnt zu sprechen. Als er das Wort »Tumor« ausspricht, zerspringt meine kleine, heile Welt …