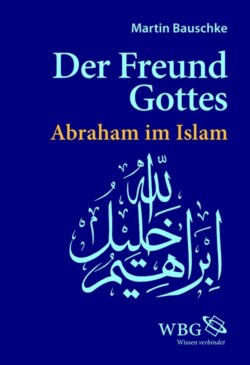Читать книгу Der Freund Gottes - Martin Bauschke - Страница 7
Einleitung
ОглавлениеWer den Koran aufschlägt und einfach zu lesen beginnt, wird schnell bemerken: In der Heiligen Schrift der Muslime gibt es so gut wie keine weit ausgespannten Erzählbögen, in denen die Geschicke großer Gestalten entfaltet werden wie in der Bibel. Vielmehr springt der Koran ständig von einem Thema zum nächsten, von dieser Figur zu jener. Dieser häufige Wechsel macht dem Ungeübten nicht nur eine fortlaufende Lektüre des Korans, sondern auch den gezielten Zugang zu bestimmten Themen und Personen schwer. Dies gilt auch für Abraham. Um sich einen Überblick zu verschaffen, bietet es sich zunächst an, alle Textpassagen über Abraham zu sammeln und sie in der Reihenfolge ihres Vorkommens im Koran zu lesen. Dann stellt man fest: Abraham (arab. Ibrāhīm) kommt in 25 der insgesamt 114 Suren (Kapitel) des Korans in rund 208 Versen vor. Explizit wird sein Name 69 Mal erwähnt. Damit ist Abraham der am zweithäufigsten im Koran genannte Prophet, nur Mose wird noch öfter erwähnt (136 Mal) und kommt in noch mehr Versen (rund 500) vor.1 Hinzu kommen noch etliche verstreute Passagen über Abrahams Neffen Lot (arab. Lūt), auf den ich nur am Rande eingehen werde (Exkurs 2). Denn wie Sara steht auch Lot im Koran ganz im Schatten der überragenden Gestalt Abrahams. Auch wenn man alle Abrahamtexte nacheinander in der Reihenfolge liest, wie sie im Koran begegnen, bleibt das Gesamtbild verwirrend. Es fehlt der rote Faden, die unsichtbare Schnur, anhand derer man die disparaten abrahamischen Motive auffädeln, strukturieren und zu einem kohärenten Ganzen verbinden könnte.
Um eben dies zu erreichen, bietet sich als zweite und aus meiner Sicht beste Möglichkeit an, die Abrahamtexte chronologisch in der Reihenfolge ihrer mutmaßlichen Entstehung bzw. Offenbarung zu ordnen. „Offenbarung“ sage ich deshalb, weil die meisten Muslime selbstverständlich davon überzeugt sind, dass Muhammad sich die Texte des Korans nicht ausgedacht hat, sondern dass sie ihm von Gott – über den Engel Gabriel (arab. Djibrīl) vermittelt – im Laufe seines insgesamt mehr als zwanzigjährigen Wirkens in Mekka (ca. 610–622) und später in Medina (622–632) sukzessive offenbart wurden. Erst bei einer chronologischen Lektüre der Texte fangen diese an zu „sprechen“. Eine Entwicklung, in manchen Fällen eine regelrechte Dramaturgie wird erkennbar. Das verwirrende, sozusagen zweidimensional „flache“ Bild Abrahams erhält Konturen, Tiefe, Transparenz – und zwar nicht nur bezogen auf Abraham selbst, sondern auch im Hinblick auf den Propheten Muhammad. Teilt man nämlich die zeitliche Anordnung der Texte in die vier Hauptphasen der Wirksamkeit Muhammads ein, wie sie sich in der neueren Koranforschung seit Theodor Nöldeke (gest. 1930) etabliert hat, dann wird deutlich: Das Bild, das der Koran von Abraham malt, ist nicht einfach eine Wiederholung oder weitere Variante der zahllosen Erzählungen vom Erzvater aus dem Judentum, sondern zugleich eine Art Selbstporträt Muhammads. Es lässt sich zeigen, dass die Entwicklung und Profilierung der Figur Abrahams in einem direkten Zusammenhang mit den Umständen und Entwicklungen der Wirksamkeit Muhammads stehen. Der Prophet geht beim Patriarchen gleichsam in die Schule. Muhammad findet sich und seine Sendung als arabischer Prophet in zunehmendem Maße in der Ur-Geschichte, dem Ur-Bild und Vor-Bild Abrahams wieder.
Das mag für manche Leser überraschend sein. Man muss ganz offen zugeben: Wer Abraham wirklich war, wissen wir nicht! Seine Existenz ist historisch nicht einmal zu beweisen. Wer Abraham hingegen zu bestimmten Zeiten für bestimmte Gruppen ist, was er ihnen theologisch und auch politisch bedeutet, das lässt sich fassen und beschreiben, so dass sich die grundlegende und nicht nur für Muhammad gültige Einsicht einstellt: Abraham ist seit jeher eine Projektions- und Identifikationsfigur par excellence. In ihm spiegeln und spiegelten sich die unterschiedlichsten religiösen Gruppen und Kreise. Schon in vorislamischer Zeit ist für die Rezeption Abrahams im Judentum kennzeichnend gewesen, dass immer und überall die jeweils aktuellen Anliegen und Herausforderungen, die eigenen Probleme und Interessen in die Zeit Abrahams zurückprojiziert wurden (Exkurs 7). Abraham sollte durch seine Vorbildfunktion Antworten geben und Verhaltensweisen vorleben, die zu den Herausforderungen seiner Erben in späterer Zeit passten. Damit wurde „Vater Abraham“, wie ihn alle drei Religionen titulieren, zugleich zur Legitimationsgestalt, deren Autorität das Anliegen der jeweiligen Gruppe oder des Verfassers sicherstellen sollte. Dasselbe gilt für Muhammad und die islamische Welt. Auch der Prophet aus Mekka hat sich gleichsam „seinen Abraham erschaffen“. Wurde Abraham den Juden zum Ur-Juden, dem ersten Bundespartner Gottes, dem ersten Beschnittenen und Ahnherr eines ganzen Volkes, und dann den Christen zum Ur-Christen, dem ersten Gerechtfertigten aus dem Glauben allein (Paulus), so wird Abraham nun auch den Muslimen zum Ur-Muslim, der den „Islam“ als Gotteshingabe exemplarisch verkörpert. Man kann also nicht nur feststellen, dass wir nicht wissen, ob Abraham überhaupt gelebt hat, sondern auch, dass es den (einen) Abraham nicht gibt! So avanciert der Erzvater zum idealen Spiegel für alle, die sich auf ihn beziehen und berufen. Dieser generell anzutreffende Sachverhalt wird hier am konkreten Beispiel Muhammads aufgezeigt. Auch für ihn war Abraham ein Spiegelbild. Der Erzvater stellt ein hervorragendes Medium und Mittel zur Beantwortung der Frage dar, wie Muhammad sich selbst und seine Sendung verstanden hat.2 Erst von daher kann man behaupten, wie Harry Harun Behr, Professor für Islamische Religionspädagogik, es tut: „Abraham im Koran zu entschlüsseln bedeutet nämlich nichts weniger als den Islam und die Muslime zu verstehen.“3
Im Folgenden gebe ich zunächst einen knappen Überblick über die Abrahamtexte des Korans in der chronologischen Reihenfolge ihrer Entstehung (Tabelle 1 im Anhang). In der Anfangsphase der Wirksamkeit Muhammads in Mekka (ca. 610–615) kommt Abraham nur am Rande vor (11 Verse). Er ist zwar eine allgemein vor allem für seine Gastfreundschaft bekannte Figur, spielt jedoch noch keine eigene Rolle in Muhammads Verkündigung. Das ändert sich in der sog. mittelmekkanischen Phase seiner Wirksamkeit (615–620). Nunmehr erwähnt der Koran viele aus der jüdisch-christlichen Tradition bekannte Gestalten, etwa Adam, Noah, Mose, Maria und Jesus. Auch Abraham spielt jetzt eine immer wichtigere Rolle, was sich schon quantitativ ablesen lässt: Er wird zehnmal so häufig erwähnt (103 Verse) wie in den Anfangsjahren Muhammads. In immer neuen Anläufen wird vor allem von Abrahams Konfrontation mit der Astralreligion seiner Zeitgenossen erzählt. Diese bestand in der Verehrung der Gestirne – besonders von Mond, Venus und Sonne – als Gottheiten, die in Bildern und Statuen dargestellt wurden. In diesen variantenreich erzählten, alten Geschichten spiegeln sich die Konflikte Muhammads mit seinen Gegnern in Mekka wider, die am althergebrachten Kult der vielen Lokalgottheiten, wie sie in der Heiligen Stätte der Ka‘ba (arab. wörtlich: „Würfel“) verehrt werden, festhalten: aus Treue zur Tradition, aus Gründen des Ansehens und um der wirtschaftlichen Vorteile willen, die für die meisten Bewohner Mekkas mit diesem Kult in ihrer Stadt verbunden waren. In der letzten, sog. spätmekkanischen Phase der Wirksamkeit Muhammads (620–622) bleibt Abraham eine wichtige Gestalt in dessen Verkündigung. Die insgesamt 48 Verse schildern, wie sich die Konfrontationen zuspitzen und es schließlich zum Bruch mit dem Vater und zur definitiven Absage Abrahams an das „Heidentum“ seiner Väter kommt. Abraham wandert aus. Sein Vorbild war eine Ermutigung für Muhammad und seine bedrängten Anhänger in Mekka. So kam es im Jahre 622 zur Auswanderung (arab. hidjra) in das 300 Kilometer entfernte Yathrib – dem später sog. Medina (arab. „Stadt“, nämlich des Propheten). Hier, in Medina (622–632), nimmt die Bedeutung Abrahams noch einmal zu. Nun wird er zur zentralen Referenzgestalt für Muhammad. Die 46 Abrahamverse in dieser finalen Phase stehen direkt im Dienst der dramatischen Ereignisse. Wer die dortigen Geschehnisse nicht vor Augen hat, versteht letztlich nicht, wovon in den spätesten Abrahamtexten überhaupt die Rede ist. Nun geht es einerseits um die Konfrontation Muhammads mit den jüdischen Stämmen in Medina, andererseits um den militärischen Konflikt mit den blutsverwandten, aber feindlichen Mekkanern. Der Fluchtpunkt seiner Abrahamrezeption erweist sich als der Fluchtpunkt der Wirksamkeit Muhammads. Denn wie der Erzvater – gemeinsam mit Ismael, seinem bislang im Koran fast bedeutungslosen erstgeborenen Sohn – die Ka‘ba in Mekka gegründet oder renoviert hat, so reinigt Muhammad seinerseits das Heiligtum vom Götzenkult und weiht es von neuem dem einen und einzigen „Gott“ (arab. Allāh). Der Islam als von Muhammad gestiftete Religion ist zwar im Vergleich zum Judentum und Christentum die jüngste Religion. Doch der Koran stellt diese Chronologie auf den Kopf – oder vom Kopf wieder auf die Füße. Der Islam als durch Muhammad wiederhergestellter und nunmehr institutionalisierter Glaube Abrahams ist die älteste, ja sogar die monotheistische Ur-Religion schlechthin.
Zum Abschluss der Einleitung sei ausdrücklich vermerkt: Wie die Neufassung meiner Darstellung des koranischen Jesus hat auch die folgende Beschreibung Abrahams kein primär religionsdialogisches, sondern ein religionshistorisches und religionsvergleichendes Interesse. An erster Stelle steht auch hier die exegetische Auseinandersetzung mit dem Text mit den Mitteln der historisch-kritischen Koranauslegung. Dazu zählen für mich insbesondere die skizzierte chronologische Betrachtungsweise der Entstehung der Suren, die Bezugnahme auf Ereignisse aus dem Leben Muhammads sowie der Hinweis auf die traditionsgeschichtlichen Zusammenhänge, wie sie durch die vergleichenden Querverbindungen zum Judentum erkennbar werden. Denn die Abrahamerzählungen des Korans bilden die spätantike arabische Fortschreibung der antiken jüdischen Abrahamgeschichten. Der neue Schlussteil bezieht sich zwar kurz auf exemplarische Entwicklungen im Trialog, doch wurde im Gegensatz zur Vorgängerausgabe auf eine theologische Diskussion der Bedeutung Abrahams im Verhältnis zwischen Juden, Christen und Muslimen verzichtet. Als Theologe habe ich mich dazu oft genug geäußert, wie ein Blick ins Literaturverzeichnis zeigt. Auch wenn ich nach wie vor davon überzeugt bin, dass die Gestalt Abrahams eine positive Rolle für das Miteinander von Juden, Christen und Muslimen heute spielen kann, ist es mir als Religionswissenschaftler heute wichtiger, stattdessen auf die Ambivalenz des Religiösen am Beispiel Abrahams aufmerksam zu machen. Diese Ambivalenz wird von manchen Trialogakteuren gern übersehen. Bei aller Sympathie für Abraham: Der Erzvater war zu allen Zeiten und ist auch heute noch eine schillernde Figur.
1 Gegen Mehmet Katar, der behauptet (Art. Abraham, islamisch, in: Lexikon des Dialogs. Grundbegriffe aus Christentum und Islam, hg. von R. Heinzmann, Bd. 1, Freiburg 2013, S. 33): „Abraham ist der im Koran am häufigsten erwähnte Prophet.“ Das ist schlicht falsch, wie jede Korankonkordanz zeigt, sowohl hinsichtlich der Häufigkeit der Erwähnung seines Namens als auch hinsichtlich dessen, in wie vielen Koranversen insgesamt Abraham vorkommt, was ja nicht dasselbe ist.
2 Treffend hat der katholische Theologe Karl-Josef Kuschel die koranischen Erzählungen von Abraham als „Spiegelgeschichten“ Muhammads bezeichnet, in: Ders., Streit um Abraham. Was Juden, Christen und Muslime trennt – und was sie eint, München 1994, S. 182.
3 Die Abraham-Konstruktion im Koran, in: Ders./Krochmalnik/Schröder (Hg.), Der andere Abraham. Theologische und didaktische Reflektionen eines Klassikers, Berlin 2011, S. 109–145, Zitat S. 112.